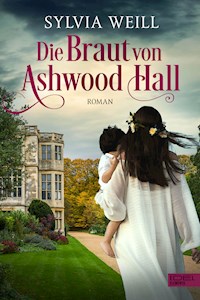Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Im neunzehnten Jahrhundert wächst die Waise Charlotte Parker bei ihren Tanten in England auf. Schon als Kind spielt sie mit Harry, dem Erbe des benachbarten Schlosses. Er wird ihre große Liebe. Doch vorher muß sie in ein Internat in der Schweiz. Während dieser Zeit verschwindet ihre über alles geliebte Schwester unter mysteriösen Umständen. Nach ihrer Rückkehr ist Harry verändert. Während einer Reise nach London wird Charlotte von Harrys Halbbruder Adam betrunken gemacht und ohne ihr Wissen mit ihm verheiratet. Das ändert ihr gesamtes Leben. Sie kämpft gegen diese Eheschließung, doch widerwillig lernt sie ihren Ehemann immer besser kennen. Wird sie sich doch noch in ihn verlieben? Was wird aus ihren Gefühlen für Harry und wird sie jemals ihre Schwester wiedersehen? Erst als sie in einen Hinterhalt gelockt wird, erfährt sie die brutale Wahrheit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 446
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kurzbeschreibung:
Sylvia Weill
Das Haus der sieben Eulen
Roman
Edel Elements
Edel Elements
Ein Verlag der Edel Germany GmbH
© 2018 Edel Germany GmbHNeumühlen 17, 22763 Hamburg
www.edel.com
Copyright © 2018 by Sylvia Weill
Lektorat/Korrektorat: Tatjana Weichel
Covergestaltung: Anke Koopmann, Designomicon, München
Konvertierung: Datagrafix
Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des jeweiligen Rechteinhabers wiedergegeben werden.
ISBN: 978-3-96215-172-0
www.facebook.com/EdelElements/
www.edelelements.de/
Inhalt
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
Epilog
1. Kapitel
Ich kann mich noch sehr gut an meine frühe Kindheit im Haus der sieben Eulen erinnern. Es war für mich das Paradies gewesen, und am liebsten wäre ich immer Kind geblieben, um bis an mein Lebensende mit meinen Tanten und meiner Großmutter dort zu leben.
Das Haus stammte noch aus der elisabethanischen Ära und wurde von jedem Besucher bestaunt, obwohl es nicht sehr groß war. Meine Großmutter hatte den gesamten oberen Bereich bewohnt, meine Tanten Walfriede und Antonia, meine Schwester Edith und ich die beiden Stockwerke darunter. Die wenigen Dienstboten waren in einem Anbau untergebracht.
Ein großer Garten umgab das Haus, in dem Edith und ich, wann immer es vom Wetter her möglich war, gespielt hatten. Wir tauchten in eine kindliche Welt ein, in der es Zwerge, Elfen und Trolle gab, mit denen wir ganz selbstverständlich kommunizierten. Manchmal waren Nachbarskinder zu uns gekommen, die natürlich mit den Naturgeistern auch vertraut gewesen waren. Die Zeit schien stillzustehen, und ich war jedes Mal todtraurig, wenn die Sonne langsam unterging und ich ins Haus gehen musste. Edith hatte damit keine Probleme gehabt.
Wir kletterten auf Bäume und stellten uns vor, in unserem Zauberreich große Abenteuer zu bestehen. Ich war immer die Prinzessin, die in irgendwelche Schwierigkeiten geriet und von Edith oder den Nachbarskindern daraus befreit werden musste.
Damals hatte ich noch kein Gespür für die Zeit und dafür, dass sie so rasch verstreicht, dass wir Menschen gar nicht mithalten können.
Manchmal hatte ich bemerkt, dass Tante Walfriede uns still beobachtete. Sie arbeitete in ihrem Gemüsegarten, den sie inständig liebte, und in dem niemand anderes einen Handschlag tun durfte. Ich glaube, sie sprach auch mit den Seelen ihrer Pflanzen, denn nirgendwo im ganzen Ort gedieh das Gemüse und das Obst so gut wie bei uns. Tante Walfriede erzählte mir immer, dass wenn ein Mensch die Seelen der Pflanzen wirklich liebte, dann erwiderten sie dieses Gefühl und dankten es mit einem prächtigen Wachstum.
Das Einzige, woran Tante Walfriede mich heranließ, waren die Himbeersträucher. Sie wusste, dass ich Himbeeren liebte und nicht genug davon bekommen konnte. Also durfte ich mir so viele pflücken, wie ich wollte. Aber sie hatte darauf bestanden, dass ich mich vorher bei den Pflanzen bedanken musste, dafür, dass ich die Beeren abnahm. Das tat ich auch jedes mal, denn ich war ja mit der Elfe befreundet, die die Himbeeren bewachte.
Weil Edith beim Pflücken der Beeren immer recht ruppig vorging und Zweige abknickte, war es ihr irgendwann nicht mehr erlaubt, sich dort zu bedienen. Aber sie mochte sowieso keine Himbeeren.
Unsere Eltern lebten mit Edith in Indien, weil mein Vater im Dienst der Krone dort beschäftigt war. Doch als meine Mutter mit mir schwanger war, hatten meine Eltern beschlossen, dass sie nach England zurückkehren sollte, um das Kind hier zu bekommen. In Indien gab es einfach wegen der mangelhaften hygienischen Zustände zu viele Gefahren für Mutter und Kind. Bei Edith war alles gutgegangen, dafür dankten sie Gott jeden Sonntag in der Kirche, aber sie wollten das Schicksal lieber nicht noch einmal herausfordern. Also buchte meine Mutter eine Passage nach Plymouth für sich und Edith, die endlich ihre Verwandten in England kennenlernen sollte.
Meine Tanten erzählen noch heute, welchen Aufstand Edith damals gemacht hat, als man sie von ihrer indischen Nanny wegholte, um zum Hafen zu fahren. Sie hatte sie sehr geliebt und konnte den Verlust lange nicht verwinden.
Ich nahm dann wohl schnell den Platz der Nanny in Ediths Herz ein, wie mir die Tanten erzählten. Von Anfang an kümmerte sie sich aufopferungsvoll um mich, obwohl sie selbst noch ein Kind war.
Meine Mutter lebte also im Haus der sieben Eulen, bis ich ein Jahr alt war. Aber die Sehnsucht nach ihrem Mann war so groß, dass sie uns Schwestern dann in der Obhut von ihrer Mutter und ihren Schwestern ließ und nach Indien zurückkehrte. Sie und Vater hatten gemeinsam beschlossen, dass die lange Überfahrt für zwei kleine Kinder wie uns einfach zu viele Gefahren barg.
Zu dieser Zeit hatte unsere geliebte Queen Victoria gerade ihre älteste Tochter, die Prinzessin Royal, mit dem deutschen Kronprinzen Friedrich verheiratet. Das ganze Land beschäftigte sich mit dem Ereignis, und auf dem Kontinent sprach man nur von der „Englischen Heirat“.
Meine Eltern konnten lange nicht von Indien nach Hause kommen, weil mein Vater als Kolonialbeamter einfach zu beschäftigt war. Kurz vor meinem zweiten Geburtstag war es ihnen dann endlich möglich. Dabei glaube ich, dass sie damals längst Indien und all die fremdländischen Gebräuche dort als ihre Heimat angesehen hatten. Meine Großmutter zeigte mir später einmal die Briefe meiner Mutter aus dieser Zeit. Sie klangen nicht wirklich nach Heimweh. Aber sie sehnten sich nach ihren Töchtern, die sie unbedingt wiedersehen wollten. Das Schiff lief dann in einem Sturm auf ein Riff und ging sofort unter.
Es gab keine Überlebenden.
Für meine Großmutter und die Tanten war das damals ein gewaltiger Schock. Aber das Leben ging weiter, und da meine Eltern schon sehr lange nicht mehr bei uns gelebt hatten, verblasste die Erinnerung auch schnell. Ich kann mich an sie überhaupt nicht mehr erinnern.
Edith hingegen hatte schemenhafte Erinnerungen. Sie wurde in Indien geboren und wusste noch, dass sie immer auf dem Schoß unseres Vaters gesessen und den Geruch seines Pfeifentabaks eingeatmet hatte.
Das Haus gehörte meiner Großmutter. Mein Großvater war schon lange tot, bevor Edith und ich geboren wurden. Er hatte ihr das Haus vermacht und sie mit einer stattlichen Pension ausgestattet, von der wir alle gut leben konnten. Es gab also keine Sorgen im Haus der sieben Eulen.
Tante Walfriede hatte wie meine Mutter einen Kolonialbeamten geheiratet. Mit ihm lebte sie lange in Ägypten. Ein Kind wurde geboren, aber kaum dass es das erste Lebensjahr erreichte, starb es an einem Fieber. Darüber ist sie wohl nie ganz hinweggekommen, wie Tante Antonia und meine Großmutter leise flüsterten, wenn sie nicht in der Nähe war.
Den Tod ihres Mannes, auch er starb Jahre später an einem Fieber, das dort grassierte, verkraftete sie besser. Zunächst wollte sie wohl in Ägypten bleiben, aber eines Tages stand sie vor der Tür, und das Haus der sieben Eulen war wieder ihr Zuhause. Auch sie erhielt eine gute Rente aus dem Pensionsfond der Kolonialbehörde, der zu unserem Komfort beitrug. Viel davon gab sie für „ihren“ Garten aus. Sonst hatte sie keine großen Ansprüche.
Ich liebte sie sehr, aber sie kam mir immer etwas sonderlich vor.
Meine Großmutter sagte manchmal lachend: „Eine schrullige englische Lady!“, was sie durchaus liebevoll meinte und von Tante Walfriede sehr wohlwollend aufgenommen wurde.
Tante Antonia war in ihrer Jugend ein wenig rebellisch gewesen. Sie war die Älteste und gewohnt, über ihre Schwestern zu bestimmen. Mit meiner Großmutter schien es damals öfter Streit gegeben zu haben. Sie waren sich wohl zu ähnlich.
Einmal hörte ich ein Gespräch der beiden zufällig mit an. Die beiden unterhielten sich in der Küche beim Tee, ohne zu bemerken, dass ich hereingekommen war.
„Hättest du nur damals auf mich gehört und den Industriellen geheiratet. Was hättest du für ein Leben führen können!“
„Ach Mutter, fang doch nicht schon wieder an. Wann kapierst du endlich, dass ich ihn nicht geliebt habe. Er war nett, und ich war gerne mit ihm zusammen. Mehr nicht.“
„Liebe. Immer die Liebe“, warf meine Großmutter verächtlich ein. „Zu meiner Zeit gab es so was nicht. Da wurde der geheiratet, den die Eltern ausgesucht haben, und man musste eben sehen, wie man zurechtkam. Und meistens ging das ja auch. Bei deinem Vater und mir kam die Liebe eben etwas später, aber dafür haben wir sie wie einen kostbaren Schatz gehütet.“
Tante Antonia machte nur eine wegwerfende Bemerkung. „Pah!“
„Na ja, mit deinem Reverend kam ja dann auch die Liebe, wenn auch nur im Armenhaus.“
„Mutter, warum fängst du immer wieder davon an? Ich bin jetzt fast sechzig, und das ist alles so lange her.“
„Eine Mutter sorgt sich eben. Ich hätte mir für dich ein besseres Leben gewünscht, als immer nur im Pfarrhaus die Betschwestern zu betüddeln. Manchmal denke ich, du hast ihn nur geheiratet, um es mir zu zeigen. Reiner Trotz. Immer musstest du das letzte Wort haben. Und dafür hat dein Vater dich auch noch geliebt. Mein Gott, du warst mit Abstand seine Liebste. Ob Walfriede das weiß?“
„Glaub ich nicht. Aber die wollte doch eh nur immer bei dir auf dem Schoß sitzen.“
Da lachte meine Großmutter. „Ja, das ist wahr. Wenn es nach ihr gegangen wäre, dann hätte ich sie überall hin mitnehmen müssen.“
Jetzt lachten beide, und tranken dazu weiter ihren Tee.
„Und jetzt haben wir es doch so gut hier im Haus der sieben Eulen“, sagte Tante Antonia. „Welch ein Privileg. Das sagt auch der Reverend sehr oft.“
Tante Antonia war sehr rege in der örtlichen Pfarrei. Sie organisierte alle Veranstaltungen, half überall aus und bezahlte heimlich auch so manch kleine Rechnung, wie mir Tante Walfriede manchmal zuflüsterte. „Aber sag ja nichts deiner Großmutter.“
Meine Großmutter hatte eindeutig das meiste Charisma der drei Frauen gehabt, mit denen ich zusammenlebte. Sie war es immer gewohnt gewesen, überall im Mittelpunkt zu stehen. Da sie früher eine außergewöhnliche Schönheit gewesen sein musste, umschwärmten die Männer sie schon deshalb. Aber auch die Frauen suchten ihre Nähe, und so war es etwas abgewandelt auch noch später. Es gab viel Besuch im Haus der sieben Eulen – und fast alle kamen wegen meiner Großmutter. Immer war sie der Mittelpunkt. Alle genossen es und hörten ihr gerne zu, wenn sie von früher erzählte oder Anekdoten aus ihrem Leben zum Besten gab. Sie tat das mit Humor, und manchmal sogar mit einem Hauch Frivolität, den ich als Kind natürlich nicht verstand. Aber ich wusste, wenn Tante Antonia „Mutter, bitte“ sagte und alle lachten, dass meine Großmutter etwas Ungehöriges erzählt hatte.
Sie hatte so viel Strahlendes an sich. Anders kann ich es nicht beschreiben. Wenn sie eine ihrer Dinnerpartys gab und der Mittelpunkt der Tafel war, fühlten alle sich wohl und hingen an ihren Lippen, was sie ganz selbstverständlich genoss.
Natürlich wollte ich als Kind immer genauso werden wie sie. Edith orientierte sich in ihrer pragmatischen Art eher an Tante Walfriede. Aber auch sie liebte meine Großmutter über alles.
Streit gab es im Haus der sieben Eulen so gut wie nie. So lebten hier drei glückliche alte Frauen und zwei glückliche junge Mädchen. Und wenn es nach mir gegangen wäre, dann hätte das nie geendet.
Heute frage ich mich manchmal, warum meine Tanten sich nie wieder gebunden haben. Als sie ins Haus zurückgekehrt waren, waren sie dafür noch nicht zu alt gewesen, und ich erfuhr, dass es durchaus noch Bewerber gegeben hatte. Aber beide hatten dies energisch zurückgewiesen. Vielleicht war ihnen schnell klargeworden, dass sie nirgendwo so glücklich leben konnten wie hier. Aber das verstand ich damals nicht.
Edith und ich lebten zwar bei meinen Tanten, aber die Mahlzeiten nahmen wir mit meiner Großmutter zusammen ein. In der kalten Jahreszeit waren wir dann auch oft oben bei ihr. Ich kann mich noch genau erinnern, wie sie mich nach dem Lunch mit hoch nahm. Dort brannte ein Feuer im Kamin, und sie legte sich auf das Sofa, das davor stand. Ich krabbelte auf einen Ohrensessel und blätterte in einem Heft, malte oder beobachtete meine Großmutter einfach nur verzückt, wie sie schlief. Ich habe sie sehr geliebt.
Edith war mehr mit Tante Walfriede zusammen. Sie brüteten oft über irgendwelchen Gartenproblemen, wann, was und wie angebaut werden musste und wie man es am besten heranzog. Oder sie studierten Kochrezepte, weil beide gerne etwas Neues ausprobierten. Alles Dinge, die mich überhaupt nicht interessierten.
Für den Garten und die Eulen war, seit ich zurückdenken kann, Mr Bossom zuständig, ein in sich gekehrter alter Mann, den schon meine Großmutter vor ewigen Zeiten eingestellt hatte und der zum Haus gehörte wie Tiere selbst.
Eigentlich bekam man von ihm nicht viel mit. Entweder er arbeitete im Garten still vor sich hin oder er hielt sich bei den Eulen unter dem Dach auf. Für Edith und mich gehörte er zu unserem Leben einfach dazu. Manchmal sprach ich ein paar Worte mit ihm oder er brachte mir Himbeeren, aber mehr fand an Kommunikation nicht statt.
Tante Walfriede und er respektierten sich, kamen sich aber gegenseitig nicht ins Gehege. Er mied ihren Gemüsegarten, und sie überließ ihm den Rest des großen Gartens. Ganz selten einmal bat er sie, ihm bei irgendeiner Verrichtung zu helfen. Dann konnte man die beiden in trauter Zweisamkeit arbeiten sehen, ohne dass zwischen ihnen ein Wort fiel. Sie verstanden sich intuitiv, und genauso intuitiv ließen sie sich dann auch wieder in Ruhe.
Nur einmal hat es im gesamten Haus eine Riesenaufregung gegeben. Ich kann mich noch genau daran erinnern.
Es war am frühen Nachmittag. Ich saß im Ohrensessel bei meiner Großmutter, als Jeanette, ihre alte Zofe, plötzlich leise den Raum betrat und meine Großmutter vorsichtig aufweckte. Das war äußerst ungewöhnlich und in meiner Gegenwart noch nie vorgekommen. Ich hielt den Atem an, denn meine Großmutter konnte sehr böse werden, wenn man sie bei ihrem geliebten Mittagsschlaf störte.
Verstört sah sie um sich, noch verschlafen. „Jeanette, wer ist gestorben?“
Diese war instinktiv einen Schritt zurückgetreten. „Madame. Entschuldigen Sie. Mr Bossom wartet draußen und besteht darauf, Sie sofort zu sprechen.“
Verdutzt sah meine Großmutter Jeanette an. „Mr Bossom?“
„Ja, Madame. Er lässt sich einfach nicht abwimmeln und macht es sehr dringend.“
Ich sah von einer zur anderen. Beide schienen schockiert, weil sie aus ihrer Routine herausgerissen worden waren, und das ausgerechnet von Mr Bossom, der nun wirklich der Allerletzte war, von dem sie diesen Fauxpas erwartet hätten.
Meine Großmutter setzte sich auf und streckte sich. „Na, dann lass ihn herein.“
Jeanette wandte sich schon zur Tür.
„Ach, äh, Jeanette. Nimm das Kind mit. Wer weiß, was er hat.“ Auffordernd sah meine Großmutter mich an.
Jetzt war ich ein wenig wütend auf sie. Wie gerne hätte ich gehört, was der alte Bossom von ihr wollte. So etwas hatte es noch nie gegeben, und ich war mitten drin in dem aufziehenden Sturm.
Aber ein weiterer unmissverständlicher Blick von meiner Großmutter genügte, und ich stand widerwillig auf und ging langsam zu Jeanette. Die nahm mich an der Hand, und beide verließen wir das Zimmer.
Draußen stand Mr Bossom so aufgewühlt, wie ich ihn noch nie gesehen hatte. Schnell verschwand er durch die Tür, nachdem ihm Jeanette ihn hereingelassen hatte.
Auch sie wunderte sich wohl sehr, was hier vorgefallen war, und da sie einen Hang zu Klatsch und Tratsch hatte, blieben wir noch einen Moment einfach stehen, ehe wir uns langsam zur Treppe bewegten, um nach unten in die Küche zu gehen.
Da hörte ich meine Großmutter laut rufen: „Was? Sind Sie sicher?“
Jeanette und ich erstarrten. So etwas war noch nie vorgekommen. Großmutter hatte für die Missgeschicke des Personals immer vollstes Verständnis und blieb bei solchen Anlässen die Ruhe in Person, selbst wenn einmal etwas Wertvolles in die Brüche gegangen war. „Wo gehobelt wird, da fallen eben Späne“, pflegte sie dann zu sagen und bemühte sich um Ersatz. Damit war die Sache dann schon erledigt.
Wir hatten noch nicht die Treppe erreicht, da stürmten meine Großmutter und Mr Bossom aus der Tür und rannten zu der kleinen Wendeltreppe, die hinauf unter das Dach führte.
Jeanette und ich sahen uns völlig verdattert an. Was wollten sie denn dort oben? Was war dort geschehen, das meine Großmutter so aus der Fassung brachte?
Unter dem Dach hatten die Eulen ihren Verschlag, in dem sie tagsüber schliefen und den sie nur nachts zur Jagd verließen. Mr Bossom ging lediglich hinauf, um dort sauber zu machen und alles in Schuss zu halten. Ganz selten bin ich auch einmal dort hinauf gegangen, obwohl es mir untersagt war. Aber wahrscheinlich war es das, was mich reizte.
Zu sehen gab es allerdings wenig. Manchmal öffnete eine der Eulen ein Auge und sah mich missbilligend an, weil ich ihre Ruhe störte. Ab und zu knarzte die eine oder andere vor sich hin oder wackelte hin und her. Immer waren es sieben. Das war aber auch schon alles. Ich war meistens schnell gelangweilt und verließ den Dachboden wieder. Edith interessierte sich überhaupt nicht für die Eulen. Ich glaube sogar, dass sie ein wenig Angst vor ihnen hatte.
Jeanette und ich saßen also in der Küche und wussten wohl beide nicht so recht, was wir nun von diesem Auftritt halten sollten.
Lange hatten wir auch keine Gelegenheit, darüber weiter nachzudenken. Denn meine Großmutter und Mr Bossom kamen schnellen Schrittes vom Dachboden herunter.
Da die Küchentür aufstand, konnte ich sehen, wie behände meine alte Großmutter die Treppe hinuntergerannt kam, gefolgt von dem nicht viel jüngeren Mr Bossom.
Aufgeregt rief sie: „Wir müssen etwas unternehmen. Sofort. Irgendwo muss sie sein. Suchen Sie überall, und nehmen Sie alle auf die Suche mit, die sie nur finden können.“
Mr Bossom nickte nur und verschwand so schnell, wie ich es noch nie bei ihm gesehen hatte.
Meine Großmutter kam in die Küche gewankt und ließ sich auf einen Stuhl fallen.
Jeanette und ich konnten sie nur entgeistert ansehen.
„Soll ich Ihnen einen Tee machen, Madame?“
„Was?“ Erst jetzt schien sie uns wahrzunehmen. „Tee? Äh, nein nein. Bring mir einen Sherry.“
Jeanette sprang sofort auf. Irgendetwas sehr Ernstes musste vorgefallen sein, denn sonst trank meine Großmutter niemals am helllichten Tag Alkohol. „Einen doppelten!“, rief sie der völlig verdatterten Jeanette noch hinterher.
In diesem Augenblick erschien Tante Antonia ein wenig atemlos in der Küche. Überrascht sah sie auf meine Großmutter. „Mutter, was ist denn los? Ich habe unten gemerkt, dass etwas nicht stimmt, und Bossom kam die Treppe hinunter, als wäre der Leibhaftige hinter ihm her.“ Damit ließ auch sie sich auf einen der Stühle am Esstisch nieder.
Meine Großmutter stöhnte nur auf. „Ach, es ist etwas Schlimmes geschehen.“
„Was denn?“, fragte Tante Antonia aufgeregt.
Nun erschien auch Tante Walfriede in der Küche. Sie trug ihre schmutzige Gartenschürze, und ihre Hände waren nahezu schwarz. Offenbar hatte sie gerade Unkraut gejätet.
„Was ist denn mit Bossom los? Der rennt da unten herum, als würde die Welt gleich untergehen. Mutter, geht es dir nicht gut?“
Diese winkte nur ab und stöhnte weiter vor sich hin.
„Nun sag doch endlich, was hier los ist“, fauchte Tante Antonia aufgebracht.
„Das konnte ich noch nie an dir leiden, Mutter. Erst veranstaltest du eine Riesenaufregung, und dann kann es dir nicht langsam genug gehen, um zu sagen, was los ist.“ Tante Walfriede sah nur völlig verständnislos von ihrer Schwester zu ihrer Mutter.
In genau diesem Moment kam Jeanette mit dem Sherry zurück und stellte ihn vor meiner Großmutter hin.
Diese nahm ihn und kippte ihn in einem Zug weg. „Bring noch einen.“
Jeanette kippte die Kinnlade nach unten, sie nahm aber das Glas und verschwand wieder. Meine Tanten sahen sich an, als wäre Queen Victoria höchstpersönlich in der Küche aufgetaucht.
„Mein liebes Kind.“ Meine Großmutter sah Tante Antonia kampflustig an. „Es gibt eben viel, was eine Mutter und eine Tochter aneinander nicht leiden können. Da müssen wir wohl durch.“
Und jetzt auch noch ein Streit zwischen meiner Großmutter und ihrer ältesten Tochter? Dies war ein denkwürdiger Tag – und er hatte ja gerade erst so richtig begonnen.
Tante Antonia schien in diesem Augenblick fast zu explodieren. „Und warum bist du eigentlich meine Mutter, kannst du mir das mal sagen?“
Jeanette kam mit dem nächsten Sherry zurück.
Beherzt nahm Großmutter auch diesen, ließ sich jetzt aber Zeit, ihn zu trinken. Dabei schossen ihre Blicke Pfeile in Richtung ihrer Tochter. „Weil dein Vater mich in einem schwachen Augenblick herumgekriegt hat, deshalb.“
Ich wusste gar nicht, wen ich zuerst anschauen sollte. Das hatte es so noch nie gegeben. Natürlich stritten die beiden Frauen ab und zu einmal. Aber so heftig war es doch noch nie gewesen, oder aber ich hatte es einfach nicht mitbekommen, denn sie versuchten immer, Streitereien vor Edith und mir zu vermeiden.
Meine Tante Walfriede schaltete sich nun mit ihrer ruhigen, auf Ausgleich bedachten Art ein. „Nun erzähl uns doch, was passiert ist. Wir müssen es doch auch wissen.“
„Es ist etwas Furchtbares passiert“, flüsterte meine Großmutter.
Alle sahen sie mit offenem Mund an.
Nach einer ganzen Weile setzte sie nach: „Eine Eule fehlt.“
Für einen unendlichen Augenblick hätte man eine Nadel fallen hören können. Dann redeten plötzlich alle durcheinander.
„Nein, das kann nicht sein. Ihr müsst euch irren. Vielleicht kommt sie gleich zurück. Es hat noch nie eine gefehlt.“
Ich verstand überhaupt nichts mehr. Was ich aber kapierte, war, dass die drei Frauen wirklich aufgebracht waren. Das Fehlen der einen Eule schien sie in Angst und Schrecken zu versetzen.
„Was können wir denn nur tun?“, überlegte Tante Walfriede. „Wir müssen alle losgehen und suchen. Vielleicht hat sie sich verletzt und hockt irgendwo hilflos herum.“
„Aber Bossom hat doch schon alle mobilisiert und sucht.“
„Vielleicht hockt sie in irgendeiner Ecke, und ihr habt sie einfach übersehen“, überlegte Tante Antonia. „Ich geh mal rauf.“ Schon war sie weg.
„Bis heute Abend muss sie wieder da sein“, flüsterte meine Großmutter. „Sonst kommt der Fluch über uns. Oh Gott, oh Gott, das hat es in meinem ganzen Leben noch nicht gegeben, und wie lange lebe ich hier schon mit den Eulen.“
Jetzt fiel mir ein, dass meine Großmutter mir einmal, als ich krank im Bett lag, von dem Fluch der Eulen erzählt hatte.
Als das Haus damals gebaut worden war, hatte der Hausherr schon den Verschlag für die Eulen mit eingerichtet. Er liebte die Tiere über alles. Er kaufte ein Paar auf einem Markt in London und setzte sie unter dem Dach ab. Er hoffte, dass sie sich vermehren würden. Er wollte so gerne einen ganzen Schlag voll Eulen haben. Aber es tat sich nichts. Das Weibchen legte keine Eier. Ganz verzweifelt wandte sich unser Vorfahre an die Hexe im Dorf. Die kam und untersuchte die Sache.
„Ich kann dir helfen“, sagte sie. „Aber dann wird ein Fluch über deiner Familie liegen, der sich sofort erfüllt, wenn an einem Abend nicht immer alle sieben Eulen beisammen auf ihrer Stange sitzen.“
„Was wird dann geschehen?“, fragte der Mann.
„Das jüngste Kind wird ins Unglück stürzen, und wenn sie am nächsten Tag bis abends nicht wieder alle beisammen sind, das nächste Kind. Also, willst du meine Hilfe?“
Der Hausherr überlegte eine Weile, aber da seine Kinder schon erwachsen waren und noch keine Enkelkinder im Haus waren, nickte er nach einer Weile.
Also ging die alte Hexe noch einmal hinauf und kam dann kurz darauf zurück. „Morgen wird sie zwei Eier legen. Und vergiss nicht, deinen Nachkommen einzuschärfen, dass jeden Tag jemand die Eulen zählen muss. Hast du das verstanden?“
Er hatte es verstanden, denn es wurde schriftlich fixiert und jedem neuen Hausherrn vorgelegt, auch meinem Großvater, der deshalb Mr Bossom eingestellt hatte.
Plötzlich sahen alle drei Frauen auf mich, als wäre ihnen erst jetzt aufgegangen, dass ja ich das jüngste Kind war, und folglich sich der Fluch zuerst an mir erfüllen würde.
Nach einem Moment stand meine Großmutter auf.
„Ich gehe zum Bürgermeister. Der weiß Bescheid. Er wird sich mit seinen Leuten an der Suche beteiligen. Und du geh zu deinem Reverend. Er soll zusammen mit deinen Betschwestern auch alles absuchen. Oh Gott, oh Gott. Warum strafst du mich noch in diesem Alter mit dem Fluch?“
Dann war ich mit meiner Tante Walfriede allein. „Muss ich jetzt sterben?“, fragte ich sie.
Ungläubig sah sie mich an. „Blödsinn. Wir müssen einfach nur genau überlegen, wo sie sein könnte. Das ist alles. Hysterie hilft da überhaupt nicht.“
Sie stützte ihre Arme auf den Küchentisch und legte ihren Kopf in die Hände.
„Also. Bossom war gestern zuletzt oben, da waren noch alle putzmunter. Da kann also nur heute Nacht irgendwas passiert sein. Eigentlich bewegen sie sich ja nur im Ort. Weit darüber hinaus jagen sie, so viel ich weiß, nie. Das muss also bedeuten, dass sie irgendwo in der Nähe sein muss. Wo könnte sie denn nur sein? Mal überlegen. Am Weiher wahrscheinlich nicht. Da steht das Gestrüpp einfach zu hoch. Beim alten Methew sind die Hunde, das mögen sie auch nicht. Auf der Albert-Farm wurde gerade gepflügt. Na, da gibt es auch nichts zu holen. Also wo?“ Sie versank in brütendes Schweigen.
Plötzlich fuhr sie hoch. „Jetzt fällt mir was ein. Da kann sie sein. Komm, Kind. Zieh deine Schuhe an. Wir gehen los. Schnell.“
So rasch hatte ich noch nie meine Schuhe angezogen. Tante Walfriede nahm mich an der Hand, und wir liefen los, so schnell, wie sie es mit mir im Schlepptau schaffte.
„Wo gehen wir denn hin?“, fragte ich atemlos.
„Wir sind gleich da. Wirst schon sehen.“
Und da standen wir auch schon vor der Eingangspforte zum Friedhof.
„Der Reverend hat gestern die beiden Familiengrüfte geöffnet. Das macht er einmal im Jahr und lässt sie über Nacht auf. Da können natürlich die ganzen Mäuse raus und rein laufen. Das ist doch wie ein gedeckter Esstisch für die Eulen. Aber wo kann sie sein?“
Eine Weile sahen wir an jedem Grabstein nach, konnten aber keine Spur der Eule entdecken.
„Geh du mal da hinten nachsehen. Ich gehe den Weg hier entlang“, sagte meine Tante.
Folgsam tat ich, wie mir geheißen. Ich untersuchte jeden Grabstein, konnte aber nichts finden. Als ich mich schon umdrehen wollte, hörte ich ein ganz leises, fiependes Geräusch, das ich erst gar nicht richtig wahrnahm. Aber dann versuchte ich doch, die Ursache dafür zu finden, wobei ich noch immer nicht an die Eule dachte. Ich vermutete eine Katze, die sich im Dickicht verheddert hatte. Das gab es oft. Man musste sie dann befreien, und alles war wieder gut.
Da sah ich vor der Friedhofsmauer ein Knäuel liegen, von dem das Geräusch kam.
Zunächst starrte ich nur verwundert darauf, ehe ich langsam begriff, dass es die Eule war, nach der mittlerweile wohl das ganze Dorf suchte.
Ich hockte mich davor und berührte sie leicht. Daraufhin gab sie ein klägliches Fiepen von sich.
Das machte mir Angst. Also nahm ich sie so vorsichtig, wie ich es nur vermochte, in beide Hände und stand wieder auf. Sie wog fast nichts, so dass ich sie ganz langsam zu meiner Tante tragen konnte.
Diese kam aufgeregt um eine Ecke gebogen. „Nichts. Absolut nichts. Ich hätte schwören können, dass sie hier irgendwo ist. Ich habe so viele Mäuse umher huschen gesehen.“
Nach einem erstaunten Blick zu mir sagte sie: „Kind, hast du sie gefunden?“
Ganz sachte legte ich das arme Tier in ihre Hände.
„Nein. Dem Himmel sei es getrommelt und gepfiffen, du hast sie gefunden. Wo war sie denn?“
Ich beschrieb ihr, wo ich die Eule gefunden hatte.
„Na, da hat sie im Eifer des Gefechts wohl den Abflugwinkel falsch eingeschätzt und ist gegen die Mauer geknallt. Oh je, hoffentlich kommt sie durch. Komm. Bossom wird sich um sie kümmern.“
Also liefen wir zum Haus zurück. Beide achteten wir darauf, nicht zu stolpern oder die Eule sonst wie zu gefährden. Deshalb dauerte es auch länger als üblich.
Als wir dann endlich zuhause waren, war erst niemand zu sehen, aber dann kam meine Großmutter mit dem Bürgermeister um die Ecke.
„Sie ist einfach nicht auffindbar. So ein Elend. Was sollen wir denn nur tun?“ Da sah sie, dass ihre Tochter etwas ganz vorsichtig in ihren Händen hielt. Sie stieß einen Schrei aus. „Die Eule. Mein Gott, wo habt ihr sie denn gefunden? Lebt sie noch?“
„Auf dem Friedhof. Sie muss gegen die Mauer geflogen sein. Ich glaube schon, dass sie noch lebt. Wo ist denn Bossom? Er muss sich um sie kümmern.“
Der Bürgermeister erfasste die Lage schnell und bot sich an, nach Mr Bossom zu suchen, der ja irgendwo im Ort sein musste.
Inzwischen gingen wir alle ins Haus und setzten uns in die Küche.
Tante Walfriede ließ die arme geschundene Eule in ihrem Schoß liegen und streichelte sie ab und zu vorsichtig mit einem Finger.
Währenddessen kochte Jeanette Tee, um alle Gemüter wieder zu beruhigen.
Mr Bossom ließ nicht lange auf sich warten. Fachmännisch begutachtete er das kranke Tier und murmelte dann irgendwas vor sich hin. Noch vorsichtiger als Tante Walfriede nahm er das kleine Federbündel auf und stieg damit nach oben.
Er würde sie schon durchbringen, da waren wir uns alle sicher. Schließlich kannte sich niemand so gut mit Eulen aus wie er.
Meine Großmutter strich sich ein Strähnen aus dem Gesicht, die sich aus ihrem Haarknoten gelöst hatten.
„Was für eine Aufregung. Das hat es ja lange nicht gegeben. Ich muss jetzt erst einmal nach oben gehen.“ Mit diesen Worten verschwand sie.
Meine beiden Tanten unterhielten sich beim Tee angeregt über den Fluch und hatten mich wohl schon wieder vergessen.
Also lief ich in den Garten. Dort wartete Edith, die dem ganzen Trubel eher passiv gegenüber gestanden und ihn sich von einem Baumast aus mit angesehen hatte.
Emsig kletterte ich auch hoch und setzte mich neben sie.
„Beinahe wärst du jetzt tot“, flüsterte sie. Ich wusste nicht genau, ob das wieder eine ihrer Bosheiten gegen mich sein sollte oder ob sie ehrlich besorgt gewesen war.
„Wär ich nicht“, fauchte ich angriffslustig zurück.
„Wärst du doch“, erwiderte sie ungerührt. „Der Fluch besagt es.“
„Ach, der.“ Hochmütig drehte ich mein Gesicht weg, bekam es aber mit der Angst, weil sie ja recht hatte. Darüber hatte ich bisher in dem ganzen Durcheinander noch gar nicht nachgedacht. ‘Zuerst trifft es das jüngste Kind.’
„Und wenn ich sie nicht gefunden hätte, dann wärst du morgen tot. Am nächsten Tag das nächste Kind“, rezitierte ich.
Entgeistert sah Edith mich an. „Du meine Güte. Du hast recht. Ja, das stimmt. Also haben wir beide in Lebensgefahr geschwebt. Das ist ja spannend. Das muss ich gleich meinen Freundinnen erzählen.“ Und schon kletterte sie herunter und war weg.
Über den Tod hatte ich bisher noch nicht nachgedacht. Niemand sprach darüber, wenn nicht der Reverend in seiner Predigt darauf einging. Aber eigentlich hörten Edith und ich ihm nie zu, weil er so entsetzlich langweiliges Zeug predigte.
Jedenfalls nahm ich mir fest vor, noch nicht so früh zu sterben.
Die Eule überlebte natürlich unter Mr Bossoms kundigen Händen. Er meinte, sie hätte wohl eine Gehirnerschütterung gehabt, nach dem Aufprall auf die Mauer. Manchmal sei sie ein wenig dösig, wie er sich ausdrückte.
Alle waren heilfroh, dass es jetzt wieder sieben Eulen waren, und es kehrte wieder Alltag ein.
2. Kapitel
Als ich acht oder neun Jahre alt war, änderte sich unser Leben in Kent.
Edith und ich bekamen einen neuen Spielkameraden. Eines Tages tauchte er einfach so im Garten auf, wo wir gerade Robin Hood spielten. Wir sahen ihn mit großen Augen an, weil wir ihn nicht kannten. Die anderen Kinder im Dorf waren uns ja alle vertraut und gingen auch bei uns ein und aus.
„Wer bist du?“, fragte ich ihn gleich.
„Ich heiße Harald. Ihr könnt mich aber Harry nennen. Das tun alle.“
Verblüfft sah ich Edith an, dann wieder ihn. Er musste wohl so alt sein wie ich. „Ich bin Charlotte, und das ist meine Schwester Edith.“
Er nickte ihr nur zu und fragte mich dann, ob er mitspielen dürfe.
Bislang hatte Edith Robin Hood gespielt, aber jetzt übernahm das Harry, und dadurch wurde alles noch viel interessanter im Garten.
Er erschien jetzt häufig bei uns, und schon bald konnte ich mir ein Leben ohne ihn gar nicht mehr vorstellen.
Harry war der Sohn des Gutsbesitzers.
Das große Gut grenzte an unser Grundstück, hatte aber einen so großen Park, dass man von unserem Garten aus nichts davon erkennen konnte. Selbst aus den Fenstern bei meiner Großmutter im obersten Stockwerk musste man sich schon sehr anstrengen, um in der Ferne etwas zu erkennen. Dabei war das Gut eigentlich ein kleines Schloss, aber jeder hier nannte es nur das Gut. Es war schon seit vielen Generationen im Besitz der Beringsworths, die im Dorf sehr beliebt waren. Sie beteiligten sich rege am Dorfleben, und auf dem großen Gestüt gab es immer Arbeit für die Menschen. Im Haus waren viele junge Mädchen „in Stellung“, wie meine Großmutter immer sagte.
Einmal hatte sie mich mitgenommen, als Lady Beringsworth sie zum Tee eingeladen hatte, was ab und zu vorkam.
Die beiden Frauen unterhielten sich sehr vertraut über den Basar, der im Pfarrhaus organisiert werden sollte. Sie kannten sich schon ein Leben lang, wie mir meine Großmutter versichert hatte, und sie respektierten sich gegenseitig.
Ich saß bei ihnen und bewunderte die vielen wunderschönen Sachen, die ich zu sehen bekam.
Im Haus der sieben Eulen war es auch sehr liebevoll eingerichtet, und meine Großmutter legte großen Wert darauf, dass alles gemütlich war und sich jeder wohlfühlte. Aber hier herrschte Reichtum, das konnte sogar ich als Kind erkennen. Außerdem wurde das im Dorf herumerzählt. Die Möbel stammten aus den teuersten Londoner Möbelmanufakturen, und an den Wänden hingen sündteure Gobelins. Lord Beringsworth hatte seinen Wohlstand in den Kolonien gemacht, indem er dort regen Handel betrieb. Womit, das wusste niemand so recht, aber es spielte ja auch keine große Rolle. Hauptsache, unsere verehrte Queen hielt große Stücke auf ihn, und das tat sie wohl, wie man hörte.
Harrys Geschwister bekamen wir so gut wie nie zu sehen. Er war ein Nachzügler, sie waren sehr viel älter als er und hatten das Gut längst verlassen.
Unser Leben wurde durch ihn abwechslungsreicher. Wir erlebten in unseren Spielen die allergrößten Abenteuer – und immer wollte Harry mich beschützen.
Das kannte ich bisher nicht, mochte es einerseits, wollte aber auf der anderen Seite auch die strahlende Heldin sein.
„Aber du bist ein Mädchen“, protestierte Harry dann.
„Na und, warum sollen denn Mädchen nicht auch mal Jungen beschützen?“
„So was gibt es nicht. Mädchen beschützen keine Jungen.“
„Und was ist mit deiner großen Schwester?“, warf ich altklug ein.
„Das ist doch was anderes.“
„Ist es nicht. Und was ist mit Queen Victoria? Die beschützt ein ganzes Land. Und in dem gibt es auch Männer.“
„Die ist doch Königin. Die muss das machen.“
„Ach, du bist blöd“, fauchte ich, um die Diskussion damit zu beenden.
Harry nahm mir niemals etwas übel.
Im Winter stöberten wir durch das Gutshaus und das Gestüt oder aber durch das Haus der sieben Eulen. Auch dabei durchlebten wir die größten Abenteuer. Meistens waren wir Prinz und Prinzessin, die in Gefahr waren. Wenn Edith dabei war, musste sie die Mutter spielen. Das tat sie zwar nicht gerne, fügte sich aber meistens widerwillig.
So gingen die Sommer dahin, auf welche die ungeliebten Winter folgten. Auf und ab. Im Haus der sieben Eulen blieb alles gleich. Das war für mich ungeheuer wichtig, denn schon damals hasste ich Aufregungen und unvorhersehbare Wendungen des Schicksals. Wenn es nach mir gegangen wäre, dann hätte dieser Gleichklang der Jahreszeiten immer so bleiben können, auch als wir in die Schule kamen, zuerst Edith, und dann ein paar Jahre später auch ich. Harry wurde mit mir zusammen eingeschult, wobei von vornherein klar war, dass er bald von seinem Vater nach Eton, dem Eliteinternat für die Kinder der Hocharistokratie, geschickt werden würde.
Dann tauchte Meredith auf.
Eines Morgens, vor Beginn des Unterrichts, kam Mrs Grant mit ihr herein.
„Dies ist Meredith Baxter. Sie wird ab heute in diese Klasse gehen.“
Alle starrten sie an. Sie war ein ausnehmend hübsches Mädchen, mit langen dunklen Haaren und einem bronzefarbenen Teint. Ihre Augen schienen fast schwarz zu sein. Es umgab sie diese undefinierbare Aura, die nur sehr schöne Menschen haben und derer sie sich sehr bewusst zu sein schien. Später dann setzte Meredith ihre Ausstrahlung ganz bewusst ein, um zu bekommen, was sie wollte. Als ich sie kennenlernte, war sie jedoch noch unschuldig, aber schon in jener Zeit wusste sie, dass sie meistens bekam, was sie wollte.
„Meredith“, sagte Mrs Grant, „setz dich neben Charlotte dort. Der Platz ist frei geworden.“
Das Mädchen, das bisher neben mir gesessen hatte, war zusammen mit seinen Eltern nach Borneo in die Kolonien übergesiedelt.
Meredith lächelte mich bezaubernd an und setzte sich.
Und damit war Meredith in mein Leben getreten. Hätte ich damals schon gewusst, welche Rolle sie noch für mich spielen sollte, vielleicht hätte ich eins der anderen Mädchen gebeten, sich neben mich zu setzen. Dann wäre diese Freundschaft vielleicht nie zustande gekommen, und vieles wäre mir erspart geblieben.
Meredith war die Tochter eines Generals Ihrer Majestät, der im Krieg auf der Krim gefallen war. Seine Frau hatte sich vor Gram das Leben genommen. Deshalb musste die einzige Tochter, Meredith, jetzt bei einer Tante leben, die bei uns im Ort wohnte. Mrs Baxter war eine von den „Betschwestern“, wie meine Großmutter die Bekannten meiner Tante Antonia aus der Kirchengemeinde verächtlich bezeichnete. Eine große dürre Frau, die immer Grau trug und dazu eine Haube auf ihrem dünnen weißen Haar, natürlich auch in Grau.
Wir Kinder hatten immer ein wenig Angst vor ihr, wenn wir ihr begegneten, sei es im Dorf oder aber in der Kirche, wo sie oft anzutreffen war, weil sie überall aushalf. Ihre Aussprache war abgehackt, und genauso bewegte sie sich auch. Meredith hatte bei ihr bestimmt nichts zu lachen, aber sie beklagte sich nie.
Irgendwie hatte sich sofort eine Freundschaft zwischen uns entwickelt, obwohl ich aus heutiger Sicht gar nicht mehr sagen kann, warum das so schnell gegangen war, denn ich mochte sie ja noch nicht einmal.
Dies hatte jedoch zur Folge, dass sie sehr schnell fast jeden Tag im Haus der sieben Eulen war, später dann auch oft im Gutshaus, wenn wir dort spielten.
Da sie immer sehr brav und wohlerzogen war, mochte sie bald jedermann. Nur meine Großmutter schien einen Vorbehalt gegen sie zu haben, den sie jedoch nie äußerte. Aber da ich sie so liebte, wusste ich immer genau, was sie dachte oder fühlte. Oft genug stand es ihr ins Gesicht geschrieben.
Meredith bemerkte es auch. Es wunderte mich, dass sie trotzdem ausgesucht höflich und zuvorkommend zu meiner Großmutter war. Fast schien es mir, als sei ihre Reserviertheit noch ein Ansporn für Meredith, diese Festung zu erobern.
Später merkte ich, dass Meredith immer von allen Menschen geliebt werden wollte. Ablehnung ertrug sie nicht. Sie musste dann einfach alles tun, bis man sie endlich zumindest mochte.
Bei meiner lebenserfahrenen Großmutter schaffte sie das nie.
Meine beiden Tanten akzeptierten sie als meine Freundin, und da sie fast zur Familie gehörte, behandelten sie sie auch so. Das machte Meredith glücklich.
Über ihre Tante sprach sie so gut wie nie. Diese schien aber immer froh zu sein, wenn sie sich nicht viel um ihre Nichte kümmern musste.
Auch Harry akzeptierte unsere neue Spielkameradin ganz selbstverständlich. Nur Edith blieb eine Spur reserviert, ließ sich aber nichts anmerken. Manchmal dachte ich, dass sie sie jetzt auch mochte, so wie ich, aber dann schnappte ich wieder einmal einen Blick von ihr auf, wenn sie Meredith hinterher sah. Fast schien mir dieser dann verächtlich. Ab und zu fragte ich sie, ob sie Meredith leiden könne. Da wich sie mir aber immer aus. Wahrscheinlich wollte sie als die Ältere nicht Zwietracht in unsere Idylle bringen.
Meredith wurde in unsere Abenteuer in der Fantasiewelt aus Drachen, Feen, bösen Hexen, Königen, Königinnen, Prinzen und Prinzessinnen einbezogen. Sie und ich waren jetzt häufig Schwestern, die in Not gerieten, und Harry musste uns retten und sich dann für eine von uns entscheiden. Meistens wählte er mich zu seiner ewig geliebten Königin, doch manchmal traf seine Wahl auch Meredith.
Das machte mich jedes Mal rasend vor Eifersucht, und er musste sich bittere Vorwürfe anhören. Er war dann immer ganz entgeistert und verstand meine Reaktion nicht.
Meredith sagte dazu nie ein Wort. Sie stand nur neben ihm und hatte ein feines Lächeln im Gesicht. In diesen Momenten hasste ich sie.
Edith spielte oft die böse Hexe oder Stiefmutter. Dabei geschah es häufiger, dass sie Meredith wirklich quälte. Sie schlug sie fest oder fügte ihr sonst ein Leid zu. Wenn diese sich dann beschwerte, tat Edith ganz unschuldig: „Wir spielen doch nur. Jetzt hab dich nicht so. Sonst spiele ich nicht mehr mit euch.“
Dann verstummte Meredith.
Manchmal durfte sie auch bei mir übernachten. Das war wirklich schön. Wir lagen dann abends im Bett, das Gaslicht war schon gelöscht, und erzählten uns alles, was in unseren mädchenhaften Fantasien so vor sich ging. Dabei waren meine Schilderungen meistens sehr viel plastischer als die von Meredith. Sie nahm daran aber regen Anteil und stellte mir viele Fragen. Natürlich beantwortete ich ihr alle so ausführlich wie möglich. Meistens kam dann eine der Tanten, weil sie uns noch flüstern gehört hatte, und befahl uns, endlich zu schlafen.
Irgendwann begann ich dann an solchen Abenden, Meredith davon zu erzählen, dass ich einmal Harry heiraten wolle, wenn ich groß genug wäre.
Dazu sagte sie seltsamerweise nichts. Ich konnte nur ihr feines Lächeln im Dunkeln erahnen, dachte mir aber nichts dabei. Also fuhr ich fort, ihr zu erzählen, wie wir heiraten würden, wo wir leben und wie viele Kinder wir haben würden.
Wenn ich sie dann fragte, wen sie einmal heiraten wolle, wich sie aus: „Och, keine Ahnung. Mal sehen. Ist ja noch so weit hin. Vielleicht Albert oder Matti.“
Das waren ältere Jungen aus unserer Klasse, und beide interessierten Meredith nicht die Bohne. Umgekehrt war es anders. Bald schon war sie der Schwarm aller Jungen im Ort, und ihre Tante bekam es wohl langsam mit der Angst zu tun. Meredith genoss es in vollen Zügen und ermunterte ein ums andere Mal einen der Jungen, sich um sie zu bemühen.
Einmal sollte ich sie zu Hause abholen. Wir wollten dann zusammen in den Konfirmandenunterricht ins Pfarrhaus gehen.
Als ich an dem ärmlichen kleinen Häuschen ankam, stand die Tür ein wenig offen, und ich hörte Stimmen von innen, ärgerliche Stimmen. Ich blieb stehen und lauschte.
„Du niederträchtiges kleines Biest. Das war das Geld für die Milchfrau. Nur du kannst es genommen haben. Wäre ja nicht das erste Mal. Warum straft mein lieber Herrgott mich nur mit dir? Du bist verkommen durch und durch.“
Mehr konnte ich nicht verstehen.
Ich drehte mich um und lief unbemerkt zurück. In meinem Kopf drehte sich alles. Wie konnte ihre Tante nur so mit ihr reden? Das verstand ich nicht. Bisher war ich davon ausgegangen, dass sie sie genauso liebte wie meine Tanten mich. Na ja, fast so. Und jetzt war ich Zeuge geworden, dass sie ihre Nichte augenscheinlich verabscheute. Wie konnte das sein?
Sollte ich mit Edith oder Harry darüber sprechen? Ich verwarf das, aber ab diesem Tag wurde ich Meredith gegenüber vorsichtiger.Denn wenn ihre eigene Tante eine solche Meinung von ihr hatte, konnte mit ihr etwas nicht stimmen. Das kapierte ich selbst als Kind schon.
Später sollte ich noch oft an die Worte ihrer Tante denken.
Als ich meinen dreizehnten Geburtstag gefeiert hatte, veränderte sich die Beziehung zwischen Harry und mir unmerklich, so wie wir beide uns veränderten und langsam aus der unbeschwerten Kinderzeit hinaus in die Welt der Erwachsenen eintraten. Manchmal nahm ich einen Blick von ihm wahr, den ich noch nicht kannte. Ich grübelte dann darüber, warum er mich so ansah und verstand die Gefühle nicht, die das in mir auslöste.
Instinktiv sprach ich nicht mit Meredith darüber, obwohl wir uns sonst alles anvertrauten. Auch sie veränderte sich. War sie vorher schon das schönste Mädchen im Ort gewesen, so entwickelte sie sich nun allmählich zu der schönsten Frau weit und breit. Und sie verstand inzwischen, welche Wirkung sie auf das männliche Geschlecht hatte. Zu meinem allergrößten Erstaunen bemerkte ich ab und zu, wie sie Harry mit genau diesen Blicken bedachte, wenn er nicht darauf achtete und sie sich unbeobachtet fühlte. Deshalb redete ich nicht mit ihr über ihn.
Was ging da nur vor? Ich verstand es nicht. Aber in dieser Zeit verstand ich so gut wie überhaupt nichts. Ich hasste die vielen Veränderungen, die in mir vorgingen, und ich hasste es, dass die Menschen mich plötzlich anders behandelten als die vielen Jahre davor. Wenn es nach mir gegangen wäre, dann wäre ich immer Kind geblieben.
In dieser Zeit der Wirrnisse kam der nächste Schock.
Harry teilte uns traurig mit, dass sein Vater ihn nun endgültig in Eton angemeldet habe und er uns im kommenden Herbst verlassen müsse.
Das machte uns alle sehr traurig, und mich versetzte es in Panik. Mit wem sollten wir denn dann spielen? Wer würde die männliche Hauptrolle in unseren Abenteuern übernehmen? Oder war auch die Zeit für solche Spiele nun vorbei?
Nachts vergoss ich Tränen bei dem Gedanken, dass Harry bald nicht mehr da sein würde. Ich konnte mir ein Leben ohne ihn einfach nicht mehr vorstellen. Sogar Edith schien ein wenig traurig, obwohl sie mit ihm nicht so befreundet war wie Meredith und ich.
Deren Reaktion erstaunte mich.
„Das ist doch schön für Harry. Das ist die beste Schule im ganzen Land. Wenn er fertig ist, stehen ihm alle Türen offen, und er kann heiraten, wen er will.“
Edith und ich sahen sie mit offenen Mündern an.
„Was ist denn in dich gefahren?“, murrte Edith.
Und wie so oft erschien nur Merediths feinsinniges Lächeln auf ihrem schönen Gesicht. Wenn sie das zur Schau trug, dann konnte niemand ihre Gedanken lesen, und es war völlig sinnlos, sie danach zu fragen. In diesen Momenten hasste ich sie. Aber das hielt nie lange, denn wenn Harry in Eton sein würde, dann hatte ich außer Edith ja nur noch sie. Und eigentlich war sie als meine beste Freundin ja immer loyal.
Der Tag, an dem Harry sich verabschieden musste, kam schneller, als ich gedacht hatte.
Schweren Herzens saßen wir im Garten und wussten nicht genau, was wir sagen sollten. Er versprach, uns zu schreiben und zu berichten, wie es dort war. Mir war klar, dass er das höchstens einmal tun würde, und dann würde er uns vergessen haben. Schließlich ging das Leben weiter. Das predigte meine Großmutter immer, und ich hatte damals bereits verstanden, dass darin viel Weisheit lag.
Zum Abschied wollte ich Harry einen kleinen Skarabäus schenken, den mir Tante Antonia mal zum Geburtstag geschenkt hatte. Weiß der Himmel, wo sie ihn herhatte. Er hatte immer am selben Platz in meiner Kommode gelegen, aber ich konnte ihn einfach nicht mehr finden. Zuerst beschuldigte ich Edith, ihn genommen zu haben, aber die wurde über diese Anschuldigung sehr wütend.
„Was soll ich denn damit? Ich habe das komische Ding nie leiden können. Frag doch deine Freundin, die ist doch dauernd bei dir im Zimmer.“
Da fiel mir wieder die Szene ein, die ich vor längerer Zeit belauscht hatte, und ich fragte Meredith nicht danach.
So gab ich Harry eine kleine Haarlocke von mir, die ich mir selbst abgeschnitten und mit einem bunten Haarband zusammengebunden hatte.
Darüber freute er sich sehr und packte sie behutsam in eine Jackentasche.
Wir verabredeten, dass wir uns in seinen ersten Schulferien wiedersehen wollten.
Am nächsten Tag war Harry weg.
Ich werde nie vergessen, wie lange ich an der Leere litt, die sein Weggang hinterlassen hatte. Edith ging es anders. Ich glaube, sie hatte ihn schon vergessen, als er sich von uns verabschiedet hatte. Meredith hingegen war wie eine Sphinx. Es schien, sie wusste etwas, von dem ich keine Ahnung hatte.
Hätte ich damals mitbekommen, was meine beste Freundin hinter meinem Rücken trieb, ich hätte ihr sofort die Freundschaft gekündigt und sie niemals wieder angesehen.
3. Kapitel
Natürlich hörten wir nichts von Harry. Es gab keinen Brief, keine Nachricht, nichts. Und irgendwann hatte ich es akzeptiert und dachte auch nicht mehr daran. Selbst als er zu Besuch bei seinen Eltern war und uns vergessen zu haben schien, war das für mich nur am Rande wichtig.
Manchmal sah ich ihn von Weitem, wenn er an mir vorbeiritt und mich nicht bemerkte. Er war zu einem sehr gutaussehenden jungen Mann herangewachsen. Aber er trug auch ein wenig den Dünkel seiner Herkunft zur Schau. Das musste wohl auch an Eton liegen, denn dort war er schließlich mit den Kindern der Oberschicht zusammen. Dafür hatte ich Verständnis, und in gewisser Weise freute ich mich für ihn.
Ich schwärmte ein wenig für den einen Jungen im Dorf, dann für den anderen, aber es waren nur Schwärmereien, in denen ich mich bei Meredith erging, und während ich ihr davon erzählte, wusste ich ganz genau, dass nichts weiter dahintersteckte.
Meredith und ich hatten uns angewöhnt, zur alten Abtei hinüberzugehen, die an Bretton Hall angrenzte. Das war ein schöner Spaziergang, und dort herrschte immer eine geheimnisvolle Atmosphäre.
Im Mittelalter hatten in dem Kloster Mönche gelebt. Aber sie verließen diesen Ort bereits nach hundert Jahren wieder, da es dort angeblich spukte. Seither verkam das einstmals schöne Gebäude zur Ruine. Aber es standen noch die alten Mauern, und auch ein Turm war noch erhalten.
Irgendwie war es an diesem Ort immer seltsam. Eine unwirkliche Atmosphäre nahm einen sofort gefangen, sobald man dort war. In der Abenddämmerung war das am stärksten.
Meredith und ich glaubten beide an die Existenz von Geistern und hatten schon die Schatten von Mönchen in langen Kutten über das Gelände schweben sehen. Ein andermal hörten wir aus der verfallenen Kapelle undeutlich den Gesang der Mönche. Es war wirklich gespenstig.
Niemand im Dorf ging gerne an diesen Ort, und wenn ich meiner Großmutter oder meinen Tanten gesagt hätte, dass es Meredith und mich dorthin zog, hätten sie es mir kategorisch verboten, und Merediths Tante wohl nicht weniger.
Das machte es natürlich noch spannender für uns.
Also trieben wir uns in diesen milden Herbsttagen oft heimlich dort herum. In der Nähe des früheren Refektoriums gab es eine relativ gut erhaltene Bank, auf die wir uns setzten und unserer Fantasie freien Lauf ließen.
„Was glaubst du, hat sich damals hier abgespielt?“, fragte ich Meredith.
Nachdem diese eine Weile überlegt hatte, antwortete sie leise: „Dramen, viele menschliche Dramen.“
Entgeistert sah ich sie an. „Was meinst du?“
„Na, was denkst du denn? Stell dir mal vor, wenn die Mönche hier ein Leben lang zusammengelebt haben, auf so engem Raum, ohne Kontakt zu Frauen.“
Verdutzt sah ich sie an.
Sie begann zu lachen. „Ach, du bist naiv. Wie immer.“
Erst da verstand ich, worauf sie hinauswollte. Entsetzt schlug ich meine Hand vor den Mund. „Nein!“
„Das waren auch nur Menschen, und man hört da ja so einiges.“
„Wo hört man so einiges?“, wollte ich schnippisch wissen, weil sie schon wieder einmal so tat, als sei sie mir überlegen, obwohl sie ein Jahr jünger war.
„Och, du musst nur den Jungs zuhören, wenn sie meinen, dass sie unter sich sind. Da erfährst du alles, was wir als Mädchen sonst nicht erfahren sollen.“
„Das machst du?“, wollte ich ehrlich interessiert wissen.
Sie lachte ihr silbriges Lachen. „Na, was denkst du denn? Ich heiße ja nicht Charlotte und bin naiv. Ich will alles wissen, alles.“
„Mhm.“ Jetzt begann ich mir die von ihr angedeuteten menschlichen Dramen vorzustellen. Heimliche Liebschaften, Eifersucht, Intrigen. Aber irgendwie behagten mir diese Fantasien nicht.
„Glaubst du, wir haben in der Zeit schon einmal gelebt?“, wollte ich von Meredith wissen.
„Ganz bestimmt.“ Sie schien sich vollkommen sicher zu sein.
Um uns herum begannen ganz sachte die Herbstnebel aufzusteigen, und die Sonne versank langsam am Horizont. Mich fröstelte ein wenig, und ich zog meinen Schal fester um die Schultern.
„Ich war eine Priesterin in Avalon. Das weiß ich genau.“
Zweifelnd sah ich sie an. Jedes Kind in England kannte die Erzählungen. Dann sah ich mich wieder um, sah die sanften Nebel in der Ruine hochsteigen, in die die letzten Sonnenstrahlen schienen und wisperte dann mehr zu mir selbst als zu Meredith: „Vielleicht war ich ja einer der Mönche hier.“ Mich schauderte plötzlich.
Meredith sagte dazu nichts. Sie schien ihren eigenen Gedanken nachzuhängen.
Plötzlich hörte ich ein Geräusch. Ich fuhr hoch, und als ich mich umdrehte, glaubte ich, zwei Mönche auf uns zukommen zu sehen. Gleichzeitig hörte ich den durchdringenden Schrei einer Eule.
Mit Grauen zog ich Meredith hoch: „Komm, wir gehen. Mir wird kalt. Außerdem ist es mir zu unheimlich hier. Wir müssen heim.“
Sie akzeptierte es wortlos. Vielleicht begann sie sich auch in der beginnenden Dunkelheit zu fürchten.
An einem der nächsten Tage entfaltete der Herbst noch einmal seine ganze Pracht. Die Sonne schien warm von einem wolkenlosen blauen Himmel.
Am späten Nachmittag beschloss ich, noch einmal zur alten Abtei zu gehen. Es war mir fast schon unheimlich, wie mich diese alten Gemäuer immer mehr anzogen. Aber der Tag war wie geschaffen dafür.
Als ich dort ankam, flirrte die Luft wie an einem heißen Sommertag. Je näher ich kam, desto mehr nahm ich wahr, dass die Luft für Sekundenbruchteile zu flirren schien. Um mich herum hörte ich Grillen und lautes Vogelgezwitscher, so als wolle die Natur noch einmal alles auffahren, was sie zu bieten hatte.