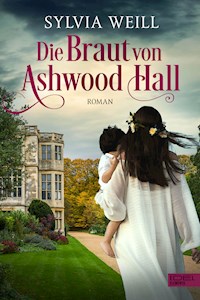5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mathilda wächst in der Regierungszeit von Queen Victoria behütet auf Millhouse Castle in Cornwall auf. Als die Familie Greystone im benachbarten Behringhouse Manor einzieht, findet sie ihre Freundin Tippi. Beide werden unzertrennlich. Als Mathilda später das Schlimmste erleben muss, was einem verliebten Mädchen zustoßen kann, reist sie mit ihrer deutschen Nanny Frieda in deren Heimat, den kleinen Ort Bodenstein am Rande des Schwarzwalds. Dort wird sie sofort von Friedas resoluter Schwester Tana unter deren Fittiche genommen und ersetzt ihr die Mutter. Sie erfährt, dass sie die Enkelin der Gräfin von Burg Rabenstein ist, die über dem Ort liegt. Dort lernt sie auch den Erben Alexander kennen, mit dem sie sich jedoch nicht versteht. Sie bemerkt nicht, dass sich über ihrem Schicksal dunkle Wolken zusammenziehen, bis es zu spät ist. Was wird die von allen ersehnte Nacht unter dem Blutmond Mathilda bringen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 338
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Kurzbeschreibung:
Sylvia Weill
Unter dem Blutmond
Romantic Thriller
Edel Elements
Edel Elements
- ein Verlag der Edel Verlagsgruppe GmbH
© 2022 Edel Verlagsgruppe GmbHNeumühlen 17, 22763 Hamburg
www.edel.com
Copyright © 2022 by Sylvia Weill
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Agentur
Covergestaltung: Designomicon, München.
Konvertierung: Datagrafix
Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des jeweiligen Rechteinhabers wiedergegeben werden.
ISBN: 978-3-96215-436-3
www.instagram.com
www.facebook.com
www.edelelements.de
1. Kapitel
Ich war ein wildes und abenteuerlustiges Kind, sehr zum Missfallen meiner Eltern.
Sie hätten sich ein fügsames kleines Mädchen gewünscht, das die Erwartungen seiner Umwelt penibel erfüllte: brav, sittsam und unauffällig. Aber das war ich nicht. Schon früh in meinem Leben vermochte ich nicht einzusehen, warum mein jüngerer Bruder Tyson alle Rechte in Anspruch nehmen durfte und dafür auch noch Anerkennung erhielt, weil er ein richtiger Junge war. Ich hingegen wurde dafür getadelt, wenn ich mich laut und ungeduldig gebärdete.
Besonders für meine Mutter schien ich eine Enttäuschung gewesen zu sein. Schon seit langer Zeit war sie kränklich, hielt sich oft in ihrem Zimmer auf und nahm dort auch die Mahlzeiten ein. Ich hatte die Angewohnheit, ohne anzuklopfen in ihre Räume zu stürzen, wenn ich sie sehen wollte. Da nahm ich dann auch keine Rücksicht auf knallende Türen, was meine Mutter zusammenzucken ließ.
Meist stürmte ich auf sie zu, krabbelte auf ihren Schoss und begann zu erzählen. Dabei wurde ich immer lauter, je länger ich deklamierte. Für sie muss das jedes Mal eine Tortur gewesen sein, denn sie wurde in dieser Zeit immer geräuschempfindlicher und niemand durfte in ihrer Gegenwart laut reden oder irgendwelchen Lärm machen. Mein Gepolter hielt sie aus, ohne etwas zu sagen. Aber welche Qualen muss sie dabei gelitten haben?
Meistens strich sie mir dann nach einer Weile über die Haare und gab mir einen Kuss auf die Stirn. Das war das Signal zu gehen. Da ich dann aber meistens sowieso mit meinem Redefluss am Ende war, fiel es mir leicht, sie wieder zu verlassen.
Wie ich von den Dienstboten hörte, bekam sie nach meinen Besuchen bei ihr oft schlimme Migräneanfälle und musste dann tagelang im abgedunkelten Schlafzimmer liegen und ich durfte nicht zu ihr. Aber das fand ich dann auch nicht schlimm.
Meine Nanny Frieda versuchte immer wieder, mich zu bändigen. Aber sie war damals schon eine nicht mehr ganz junge Frau und kam bei meinem kindlichen Überschwang schnell an ihre Grenzen. Wenn sie mich zu sehr erziehen wollte, schrie ich einfach ganz laut und hielt den Ton, solange ich konnte. Dann gab sie in der Regel auf. Es muss sich wirklich schaurig angehört haben. Ansonsten liebte ich Frieda innig. Sie war die Mutter für mich, die meine leibliche Mutter nicht sein wollte und nicht konnte.
Frieda stammte aus Deutschland. Nach England kam sie gemeinsam mit meiner Mutter. Eigentlich wollte sie damals nur ein paar Monate in England bleiben, dann aber wurde ein Leben daraus. Und das lag eindeutig an mir. Sie musste Geld verdienen, um sich die Rückfahrt nach Deutschland leisten zu können. Und da ich gerade geboren war und meine Eltern eine Nanny für mich suchten, erfüllte sich das Schicksal und sie blieb bei mir. „Schließlich konnte ich dich hier nicht zurücklassen, Liebchen. Ohne mich wärst du garantiert weggelaufen.”
Damit hatte sie wohl recht. Sie war meine Familie in dem alten Schloss.
Mein Vater beschäftigte sich nur mit mir, wenn er musste. Ansonsten war er auf Tyson fixiert, der sein ganzer Stolz war. Und da der sich zu einem Sohn entwickelte, den jeder Lord in der Upperclass sich nur wünschen konnte, blieb für mich nicht viel.
Aber ich liebte meinen Vater, denn er erfüllte mir fast alle Wünsche, die ich ihm vortrug. Das empörte Frieda oft, da sie ein eher strenges Regiment führte, aber schließlich konnte sie gegen ihren Arbeitgeber nicht aufbegehren. Und das wusste ich schon früh und nutzte es aus, wann immer ich es für richtig hielt. Wie frech war ich oft zu ihr, was ich heute bereue. Aber ich war ein Kind, und Kinder wissen nichts.
Vor meiner Tante Henrietta hatte ich noch am meisten Respekt. Sie war die unverheiratete Schwester meines Vaters und lebte schon seit Jahren auf Millhouse. Sie war eine respekteinflößende Matrone, jedoch sehr eigenbrötlerisch und kauzig. In der Küche behaupteten sie immer, von ihr hätte ich mein aufsässiges Wesen, denn Tante Henrietta tat grundsätzlich auch nur das, was sie für richtig hielt. Mein Vater hatte es wohl ganz schnell aufgegeben, ihr Grenzen zu setzen, denn sie war die Vertraute meiner Mutter und ließ sich von niemandem etwas sagen.
Und da sie mit den Jahren etwas schwerhörig geworden war, sprach sie laut und polternd. Ich fand das großartig, denn so war ich nicht die einzige Person, die man schon von Weitem kommen hörte oder die bei Tisch die Gespräche dominierte.
Frieda hatte Angst vor ihr, worüber ich immer lachen musste. Ich mochte Tante Henrietta, auch wenn sie mit Kindern nicht umgehen konnte. Sie hatte selbst nie welche gehabt und besaß einfach nicht den Draht zu ihnen. Trotzdem kamen wir bestens miteinander aus, indem wir uns in Ruhe ließen. Wenn ihr doch mal der Kragen platzte, dann raunzte sie Frieda an, die daraufhin ängstlich zusammenzuckte.
Tyson liebte ich abgöttisch. Aber hat nicht jedes Mädchen diese Empfindungen für ihren Bruder? Er wusste jedoch nicht viel mit mir anzufangen. Im Kopf hatte er ganz andere Dinge. Vor allem die Jagd, was meinen Vater entzückte, der selbst ein leidenschaftlicher Jäger war.
Ich finde es noch heute furchtbar, Tiere einfach so zu hetzen und sie abzuschlachten.
Bei schlechtem Wetter kam Tyson ab und zu in mein Spielzimmer und setzte sich zu mir, um mitzuspielen. Frieda war darüber immer entzückt und ließ uns dann allein.
Am meisten liebte ich es, wenn Frieda mir Geschichten aus ihrer Heimat, der Grafschaft Bodenstein in Süddeutschland, erzählte. Es gab dort viele gruselige alte Sagen und Legenden, die Frieda mit der Muttermilch eingesogen hatte und von denen ich nicht genug bekommen konnte, so furchteinflößend sie auch teilweise waren. Immer wieder nötigte ich sie, mir eine oder zwei vor dem Schlafengehen zu erzählen. Anfangs hatte sie noch befürchtet, ich könne nicht schlafen, wenn sie die grausamen Geschichten erzählte, aber sie begriff sehr schnell, dass das Gegenteil eintrat. Je mehr sie mir von Trollen, Elfen, Zwergen und Drachen erzählte, desto schneller schlief ich selig ein.
„Du bist schon ein merkwürdiges Kind”, sagte sie dann und küsste mich.
Und jedes Mal, kurz bevor ich einschlief, nötigte ich ihr das Versprechen ab, mit mir nach Bodenstein zu reisen, wenn ich alt genug sein würde.
Dann gab sie mir einen Kuss auf die Stirn und sagte: „Aber ja. Du wirst es lieben.”
Wenn wir allein waren, sprach sie nur Deutsch mit mir. „Schließlich ist unser Prinzgemahl ja ein Deutscher, warum sollst du die Sprache nicht auch lernen? Wer weiß, vielleicht begegnest du ihm einmal und dann könnt ihr euch auf Deutsch unterhalten. Das wäre doch ein Spaß, oder?”
Ich nickte dann heftig, obwohl mir Prinz Albert erst später ein Begriff wurde.
„Und unsere Königin ist schließlich auch deutscher Abstammung. Aber ob sie Deutsch spricht, weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht. Aber Albert bringt es ihr vielleicht bei.”
„So wie du mir.” Dann nickte sie.
Schon früh in meinem Leben streifte ich am liebsten durch die Natur. Millhouse war von einer hohen Mauer umgeben, sodass niemand Angst haben musste, ich würde abhandenkommen. Also ließ mir Frieda meinen Willen.
Es gab in dem großen Park immer Neues zu entdecken, und wenn ich zurückkam, hatte ich Frieda viel zu erzählen, was sie sich geduldig anhörte.
Als ich sechs Jahre alt war, entdeckte ich im hintersten Teil der Mauer einen kleinen Durchgang.
Als ich davorstand, sah ich gleich, dass durch diese Pforte schon sehr lange kein Mensch mehr gegangen war. Die Tür hing schief in den Scharnieren und ließ sich kaum bewegen. Aber so klein wie ich war, passte ich hindurch.
Jetzt stand ich in einem anderen Park, der sehr verwildert wirkte. Das Gras stand hoch und war durchdrungen mit Unkraut, das fast noch höher als das Gras wucherte.
Wo ich mich befand, wusste ich. Nur dort war ich noch nie.
Es war der Park von Behringhouse, dem Herrenhaus, das an Millhouse angrenzte.
Seit vielen Jahren wohnte dort niemand mehr. Die letzten Bewohner von Behringhouse hatten keine Kinder, und als sie kurz hintereinander starben, verwaiste das Anwesen.
Wenn ich etwas darüber aufschnappte, war ich immer ganz aufgeregt. Ein leerstehendes Herrenhaus, das verfiel. Etwas Spannenderes konnte ich mir nicht vorstellen. Und jetzt hatte ich plötzlich die Gelegenheit, dorthin zu gelangen. Es durfte nur niemand merken, sonst konnte ich meine Erkundungsgänge dorthin gleich wieder vergessen.
Ich kämpfte mich langsam durch das Gras und dachte dabei an die Geschichten von Frieda. Ganz ähnliche Dramen spielten sich bestimmt in Behringhouse ab, besonders, da jetzt keine Menschen dort wohnten, welche die Fabelwesen gestört hätten.
Als ich schon fast umkehren wollte, weil es mir zu anstrengend wurde, das hohe Gras niederzutreten, erblickte ich Behringhouse. Ich war fasziniert.
Millhouse war ein typisches elisabethanisches Schloss. Wahrscheinlich hatten es schon die Normannen angelegt, das wusste man nicht mehr so genau. Ich war mir nicht sicher, ob ich es mochte oder nicht. Es war so verwinkelt, dass man sich dort schnell verlief, auch wenn man dort aufgewachsen war. Weite Teile wurden nicht bewohnt. Und es war in den alten Mauern immer kalt. Die Kamine mussten ständig brennen, selbst im Sommer. Und im Dämmerlicht oder der Dunkelheit konnte man sich nur noch ängstigen. Furchteinflößende Schatten huschten über die Wände, und man konnte die Geister flüstern hören. Frieda ängstigte sich in manchen Nächten zu Tode und meinte, das sei wie auf Burg Bodenstein, auf der sie als junges Mädchen in Stellung gewesen war.
Wenn meine Fantasie mit mir durchging, bekam ich es auch mit der Angst zu tun. Meistens aber weidete ich mich an Friedas Ängsten und lachte sie aus.
„Warte es nur ab, kleines Fräulein”, pflegte sie dann zu sagen. „Du wirst dich auch noch zu Tode fürchten”, woraufhin ich mich vor Lachen ausschüttete.
Behringhouse war ganz anders.
Vor mir lag ein mittelgroßer Herrensitz, wohl auch aus der Zeit Elisabeths der Ersten. Es hatte nichts von Millhouse. Großzügig und elegant lag es in dem Park, der vielleicht noch größer war als unserer.
Natürlich war zu erkennen, dass es unbewohnt war. Fensterscheiben waren zerbrochen, und Türen waren aus den Angeln gerissen.
Aber es strahlte immer noch eine gewisse Fröhlichkeit aus, die es in Millhouse nicht gab. Dort wirkte alles düster, besonders die Halle mit ihren Ritterrüstungen.
Ich verliebte mich auf den ersten Blick in Behringhouse und beschloss spontan, dass ich dort einmal leben wollte.
Ich warf noch einen Blick zu den Stallungen, die ebenfalls sehr verlassen wirkten.
Als ich mich schon umwenden wollte, bemerkte ich in einem der oberen Fenster eine leichte Bewegung. Wie angewurzelt blieb ich stehen und starrte hinauf. Nichts war auszumachen. Hatte ich mir das eingebildet, denn Behringhouse war doch unbewohnt? Aber vielleicht hauste dort ein Obdachloser.
Das fand ich sehr verwirrend.
Es fiel mir sehr schwer, Frieda nichts von meinem Ausflug zu erzählen. Aber ich wollte nicht riskieren, dass sie damit zu meinem Vater ging, der die Pforte dann umgehend reparieren und abschließen lassen würde. Niemals durfte das geschehen. Da behielt ich es lieber für mich, wenn mir das auch enorm schwerfiel.
So besuchte ich in diesem Sommer das Anwesen heimlich. Das Grundstück wurde mir immer vertrauter. Auch die Stallungen, die ich durchforstete. Immer wenn ich ein ungewohntes Geräusch hörte, schreckte ich zusammen und dachte an die Fabelwesen aus Bodenstein. In das Gutshaus selbst traute ich mich nicht. Heute bin ich froh, dass ich so viel kindlichen Scharfsinn besaß, um mich fernzuhalten. Was hätte mir dort passieren können, und niemand hätte mich gefunden.
Aber es reichte mir, um das Haus herumstreifen zu können und in die Fenster zu spähen. Alle Möbel waren weg, sodass ich nur leere Räume zu sehen bekam.
Ich war hingerissen und konnte nicht genug bekommen. Wenn mir eine Katze oder eine Ratte über den Weg liefen, hätte ich sie am liebsten gefragt, wer hier gewohnt hatte.
Natürlich blickte ich bei jedem Besuch hinauf zu dem Fenster, hinter dem ich die vermeintliche Bewegung bei meinem ersten Besuch entdeckt hatte, aber es war nie wieder etwas zu sehen. Also vergaß ich es allmählich.
Zu Hause begann ich, Frieda und die Angestellten in der Küche nach Behringhouse zu fragen. Niemand konnte mir viel erzählen, und alle wunderten sich über mein seltsames Interesse an diesem verlassenen Haus.
Nur von Mrs Rott, unserer dicken Köchin, bekam ich eine sonderbare Information.
Sie kochte gerade eine Suppe und stand ein wenig im Dunst an ihrem großen Herd.
„Behringhouse? Du willst etwas darüber wissen?”
Sie rührte in ihrer Suppe und verursachte dadurch noch mehr Dunst.
Ich nickte nur stumm.
„Behringhouse? Und ausgerechnet du musst danach fragen. Na, hätte ich mir ja denken können. Alles, was du nicht sehen sollst, kommt dir vor die Flinte. Lass das bloß nicht deinen Vater hören.”
Dann beugte sie sich etwas über den Suppenkessel, damit ich sie besser verstehen konnte. „Es ist ein verfluchter Ort, jawohl. Ein verfluchter.”
Ich konnte sie nur anstarren. „Warum?”, flüsterte ich verängstigt.
„Dort hat sich einmal jemand umgebracht, und derjenige muss seitdem dort umgehen. Er findet keine Ruhe bei den Toten. Jawohl.”
Ich bemerkte, dass ich leicht zu zittern begonnen hatte vor Grauen, denn als Mrs Rott das sagte, wusste ich im ersten Moment, dass es dieser Untote gewesen sein musste, den ich oben in dem Fenster wahrgenommen hatte.
Abends im Bett fragte ich Frieda: „Glaubst du an Geister?”
Erstaunt hoben sich ihre Brauen. „Wie meinst du das?”
„Geister, die in alten Häusern gefangen sind.”
Ernst sah sie mich an. „Natürlich gibt es die. In Bodenstein haben wir viele davon. Sie gehören zur Familie.”
„Meinst du das ernst?”
“Aber ja. Ich war als junges Mädchen fast einmal mit einem Geist verlobt.”
Dazu nickte sie heftig.
Das konnte ich mir gar nicht vorstellen und wollte sie später wieder zu dieser Aussage befragen. Aber sie behauptete dann immer, ich hätte mich verhört und sie hätte so etwas nie gesagt.
Ich war meine gesamte Kindheit über wie besessen von Behringhouse.
Wenn das Wetter schlecht war und ich nicht nach draußen gehen konnte, war es eines meiner größten Vergnügen, durch das Schloss zu streifen. Es gab dort immer etwas zu entdecken, was ich noch nicht kannte. Und manchmal bekam ich sogar Dinge mit, die nicht für meine Ohren bestimmt waren. Etwa wenn eines der Dienstmädchen sich mit einem der Stallburschen in einer Ecke herumdrückte und seltsame Laute von sich gab. Da ich das aber schon so oft erlebt hatte, interessierte es mich nicht mehr.
Eines Tages regnete es in Strömen und ich war wieder auf Entdeckungstour, als ich in die Nähe der Räume meiner Mutter kam. Aus irgendeinem Grund musste jemand vergessen haben, die Tür zu schließen.
Langsam schlich ich zur Tür. Sie war tatsächlich nur angelehnt.
Ich konnte deutlich die Stimme von Tante Henrietta hören und sehr gedämpft die meiner Mutter. Gespannt spitzte ich meine Ohren. Das würde sicherlich spannend werden. Am Ende erfuhr ich sogar etwas über mich.
„Es geht mir heute nicht gut”, hörte ich meine Mutter.
„Was ist los?”, fragte Tante Henrietta in ganz normalem Ton, was mich erstaunte.
„Eigentlich wird es von Tag zu Tag schlechter.”
„Liebes, sag so etwas nicht.”
Die Antwort meiner Mutter konnte ich nicht verstehen. Dann erwiderte sie: „Er war wieder bei ihr.”
„Ich weiß. Der Dreckskerl gibt sich gar keine große Mühe, es zu vertuschen.”
„Ach, Hetty, lass ihn doch. Ich kann es ihm doch schon lange nicht mehr bieten.”
„In guten wie in schlechten Tagen. Hieß es nicht so vor dem Traualtar?”
„Verurteile ihn nicht, Hetty. Er war mir immer ein guter Ehemann. Das weißt du.”
„Na, ich weiß ja nicht. Jede Nacht hat er dich besucht. Das war ja wohl ein bisschen viel. Wovon hast du denn die Schwäche!”
„Ach, Hetty, manchmal war es sogar schön. Aber meistens wollte ich nur, dass es vorbeigeht.”
„Trotzdem hat er dich krank gemacht. Ich sag es immer wieder, auch wenn du es nicht hören willst.”
„Nein, nein. Nicht er. Mathildas Geburt hat mich zerstört. Wäre ich doch nur gleich gestorben.”
Ich erstarrte zur Salzsäule. Also war es meine Schuld, dass meine Mutter so krank war und immer schwächer wurde.
Lautlos schlich ich weg und streifte ruhelos durch die Gänge. Ich war also so schlecht, dass ich meine Mutter krank gemacht hatte. Dieser Gedanke trieb mich zur Verzweiflung. Als ich ihn nicht mehr aushalten konnte, lief ich zu Frieda, warf mich in ihre Arme und begann zu weinen.
Sie konnte gerade noch alles absetzen, was sie in den Händen gehalten hatte.
Ich schluchzte hemmungslos, und sie ließ mich gewähren. Immer wieder streichelte sie mir besänftigend übers Haar. „Na, na, was ist denn los, mein kleiner Liebling? Sag es der alten Frieda.”
„Ich bin ganz, ganz schlecht.”
„So? Aber warum denn nur?”
„Es ist allein meine Schuld.”
„Was hast du denn getan, Liebes?”
Diese Frage ließ mich noch heftiger schluchzen.
Frieda strich mir nur weiter übers Haar und wartete geduldig auf meine Antwort.
Lange rang ich mit mir, ob ich es ihr offenbaren sollte, aber dann wurde der Schmerz einfach zu groß und ich platzte heraus: „Ich bin schuld, dass es Mama immer schlechter geht.”
Frieda hörte auf, mich zu streicheln, und sah mich mit großen Augen an. „Wie bitte?”
„Ja, ich. Sie hat es eben zu Tante Henrietta gesagt.”
Friedas Augen wurden immer grösser. „Kind, hast du wieder gelauscht?”
„Sie hat gesagt, dass meine Geburt sie krank gemacht hat.”
„Ach so.” Frieda begann wieder, mir übers Haar zu streicheln, und es kamen erneut tiefe Schluchzer aus meiner innersten Seele. Schließlich liebte ich meine Mutter, und den Gedanken, dass ich an ihrem Leid schuld war, konnte ich einfach nicht ertragen.
„Liebling, für viele Frauen ist eine Geburt so heftig, dass sie danach krank sind. Und einige sterben sogar dabei. Das hast du doch auch schon mitbekommen.”
Ich nickte nur in ihrem Schoß.
„Das ist doch aber nicht die Schuld der Kinder, die zur Welt kommen.”
Ich richtete mich ein wenig auf, fuhr mir mit den Händen über die Augen und sah Frieda an. „Wieso?”
„Na, weil die kleinen Würmchen selbst sehen müssen, dass sie am Leben bleiben. Viele sterben bei der Geburt, genau wie die Mütter. So ist nun einmal die Natur. So hat es unser Herrgott in seiner unergründlichen Güte eben eingerichtet. Auch wenn wir es nicht verstehen. Geburten sind für die meisten Frauen ein Risiko. Warum auch immer.” Sie bekreuzigte sich.
„Mein Kind ist auch kurz nach der Geburt gestorben, Gott sei seiner Seele gnädig.” Sie bekreuzigte sich erneut.
„War das deine Schuld?”
„Aber nein. So ist nun einmal die Natur. Ich habe es doch gleich geliebt so wie deine Mutter dich gleich geliebt hat.”
„Meinst du?”
„Aber ja doch. Ich weiß es. Sie war so glücklich, als sie dich geboren hatte. Sie hatte sich doch so sehr ein Kind gewünscht. Na ja, und dann wurde es eben schwierig. Wir können froh sein, dass sie bei deiner Geburt nicht gestorben ist. Nur ist das nicht deine Schuld, meine Kleine.”
Jetzt hörte ich auf zu weinen und klammerte mich nur noch fest an meine geliebte Nanny. Ich wollte sie nie mehr loslassen.
Sie hielt mich ganz fest und wiegte mich hin und her.
„Weißt du was, mein Spätzchen? Wir gehen jetzt runter zu Mrs Rott und bitten sie um einen Keks aus ihrer geheimen Dose. Die magst du doch so. Und heute hast du dir einen verdient.“
Sofort sprang ich auf und hatte all meinen Kummer vergessen.
„Oh ja, einen Keks.”
Ich zerrte an ihrem Arm, damit sie schneller aufstand. Die geheimen Kekse von Mrs Rott waren die größte Köstlichkeit, die ich kannte. Und sie rückte nur ganz selten einmal einen davon heraus. Meistens, wenn ich wieder einmal hingefallen war und mir die Knie aufgeschrammt hatte oder wenn mich Bauchschmerzen quälten. Nach dem Genuss dieser Wunderkekse war immer alles schnell wieder gut.
Als am Abend der Regen gegen die Scheiben peitschte, bat ich Frieda wie so oft nach dem Dinner, mir ein Märchen der Gebrüder Grimm aus ihrer alten Heimat zu erzählen. Zwar ließ sie sich erst immer ein wenig bitten mit der Behauptung, dafür sei ich doch nun viel zu alt, aber da Frieda die Märchen aus Deutschland ebenso liebte wie ich, war sie dann doch schnell dazu bereit. Und Frieda war eine begnadete Märchenerzählerin. Vor allem, wenn sie sie mir auf Deutsch erzählte. Da sie seit meiner Geburt Deutsch mit mir sprach, was meine Eltern ausdrücklich wünschten, konnte ich die Sprache fast so gut wie Englisch.
„Welches willst du denn hören, kleine Maus?”
Das war eine rhetorische Frage, denn ich wollte sowieso immer nur ein ganz bestimmtes Märchen hören.
„Dornröschen.”
„Ach, nicht schon wieder. Warum denn immer nur das? Es gibt so viele schöne andere.”
Ich schüttelte den Kopf. „Nein. Dornröschen. Fang an.”
Wie jedes Mal hockte ich mich neben den Sessel, in dem Frieda saß, und legte meinen Kopf in ihren Schoss.
„In Gottes Namen, also wieder Dornröschen.”
Und sie fing an. „Vor langer Zeit konnte ein Königspaar keine Kinder bekommen. Da sprang eines Tages ein Frosch aus dem Teich und sagte der Königin, dass sie ums Jahr ein Mädchen gebären würde, eine kleine Prinzessin. Die Freude war im ganzen Reich grenzenlos.
Nachdem es zur Welt gekommen war, sollte die Taufe groß gefeiert werden. Alle wurden eingeladen. Zuletzt auch die dreizehn weisen Frauen des Reiches. Da merkte die Königin, dass sie nur noch goldene Teller für zwölf Gäste hatten. Also wurde die dreizehnte weise Frau wieder ausgeladen. Es wurde ein rauschendes Fest, und zum Schluss wurden die Geschenke an die kleine Prinzessin verteilt. Also traten die weisen Frauen eine nach der anderen an die Wiege und schenkten ihr Schönheit, Reichtum, einen guten Ehemann und viele gesunde Kinder. Als die elfte weise Frau fertig war”, Frieda machte eine unheilvolle Pause, sah mit düsterem Blick zu mir herunter und ich klammerte mich vor lauter Angst um ihre Knie.
„Was ist passiert?”, flüsterte ich.
„Du weißt es doch, mein Liebling.”
„Ich will, dass du es erzählst.”
Also holte Frieda tief Luft und rief theatralisch: „Die Tür flog auf, und die dreizehnte weise Frau rauschte zornbebend in den Saal.”
Frieda machte eine Pause, um die Spannung zu erhöhen.
Natürlich wusste ich, wie es weiterging, aber in meiner Fantasie stand ich quasi in dieser Halle und fürchtete mich zu Tode vor der bösen Frau.
„Sie hob ihre Arme und schrie: ‚Weil ich nicht eingeladen wurde, verfluche ich dieses Kind, es soll sich mit fünfzehn Jahren an einer Spindel verletzen und daran sterben.‘ Damit rauschte sie wieder hinaus und schlug die Türen hinter sich zu.”
Wie gelähmt sah ich zu Frieda auf, so als würden wir das gerade selbst erlebt haben.
Frieda sah mich unheilvoll an.
„Da trat die zwölfte weise Frau an die Wiege, die ihren Wunsch für die kleine Prinzessin noch nicht geäußert hatte. ‚Ich kann den Fluch nicht aufheben, aber sie soll mit fünfzehn nicht sterben, sondern in einen hundertjährigen Schlaf fallen. Mehr kann ich leider nicht für sie tun‘.”
Fassungslos sah ich Frieda an. Ich konnte mich gar nicht aus meiner gebannten Fantasie lösen.
„Erzähl weiter.”
„Es kam tatsächlich so. Die Prinzessin verletzte sich mit fünfzehn Jahren an einer Spindel und fiel in einen tiefen Schlaf. Und mit ihr das ganze Schloss. Schnell wucherte eine dichte Hecke darüber, sodass niemand mehr hereinkommen konnte. Nach hundert Jahren kam ein junger Prinz des Weges und hörte von der Geschichte. Vor ihm tat sich die Hecke auf, denn die hundert Jahre waren an diesem Tag vorbei. Er fand Dornröschen und gab ihr einen Kuss. Im selben Moment erwachte sie und mit ihr das ganze Schloss.
Bald wurde Hochzeit gefeiert, und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage.”
Ich seufzte laut in Friedas Schoß, weil ich dieses Märchen einfach zu schön fand. Ob es mir später in meinem Leben einmal ähnlich ergehen würde wie der Prinzessin? Aber ich wollte nicht hundert Jahre schlafen. Was würde mir da alles entgehen!
Ich blieb noch ein wenig in Friedas Schoß liegen und merkte, dass ich sehr müde wurde. Märchen haben noch heute eine entspannende Wirkung auf mich.
Also brachte Frieda mich ins Bett, und ich schlief sofort ein. Dann träumte ich von schönen Prinzen, die arme Prinzessinnen aus den Klauen des Schicksals befreiten. Was für schöne Träume.
In diesem Sommer tauchte Onkel Finnegan wieder einmal in Millhouse auf. Er war der jüngere Bruder meines Vaters und so ganz anders als er. Schon früh in seinem Leben hatte er die See als seine Leidenschaft entdeckt, und so hatte es für ihn nie einen Zweifel gegeben, dass er zur Marine Ihrer Majestät gehen würde.
Er war häufig in den Kolonien stationiert, und dann sahen wir ihn unter Umständen für Jahre nicht. Bis er dann plötzlich vor der Tür stand und für einige Wochen bei uns blieb. Mein Vater schien darüber nicht sonderlich erfreut zu sein, aber worüber war mein Vater schon erfreut? Dass er seinen kleinen Bruder liebte, daran bestand kein Zweifel, er konnte es ihm nur leider nicht zeigen. Ob Onkel Finnegan es wohl trotzdem merkte? Ich litt mit ihm, denn mir konnte mein Vater ja auch nicht zeigen, dass er mich liebte. Wenn er dies denn überhaupt tat, daran hatte ich so meine Zweifel. Seine Liebe zu Tyson konnte jeder sehen und am meisten Tyson selbst. Bei mir und Onkel Finnegan verhielt es sich anders. Vielleicht schweißte uns das so fest zusammen. Wir verstanden uns intuitiv, mussten gar nicht so viel reden. Und ich war sein erklärter Liebling. Deshalb blühte ich jedes Mal auf, wenn er uns besuchte. Er gab mir das uneingeschränkte Gefühl, ein besonderes Kind zu sein, das er innig liebte.
Und es gab noch jemanden, der sich freute, wenn Onkel Finnegan kam: meine Mutter. Kaum traf ihr Schwager bei uns ein, erlebte man eine wundersame Heilung bei meiner sonst so zartbesaiteten, leidenden Mutter. Sie erhob sich von ihrem Krankenlager, zog sich elegante Kleider an, ließ sich die Haare herrichten und schminkte sich dezent. Sie erschien bei den gemeinsamen Mahlzeiten und amüsierte sich königlich über die Witze von Onkel Finnegan, die er eigentlich ständig riss.
Ab und zu gingen die beiden auch im Park spazieren, ganz allein. Sie schienen dann immer in ein Gespräch vertieft und waren nur aufeinander bezogen. Und wenn sie zurückkamen, dann hatten beide leicht gerötete Wangen und glühten von innen heraus. Mir war das ein Rätsel, aber in diesem Alter wusste ich ja bereits, dass Erwachsene höchst seltsame Wesen waren, die ich einfach nicht verstand.
Frieda konnte mir da auch nicht weiterhelfen. Wenn ich sie fragte, warum Onkel Finnegan so vertraut mit meiner Mutter war und warum sie nahezu gesund wurde, wenn er hier war, kniff sie ihre Lippen zusammen und lenkte mich mit irgendwas ab. Wie sollte ich das nur verstehen? Das Leben war mir ein einziges Rätsel.
Auf jeden Fall war in Millhouse immer etwas los, wenn Onkel Finnegan zu Besuch war.
Er nahm mich auf seine Schultern und ritt mit mir durch den Park. Das machte mir so viel Spaß, dass ich dabei laut jauchzte.
Oder wir spielten Verstecken, wobei er mich immer gewinnen ließ, weil er behauptete, ich würde mich in Millhouse besser auskennen als er. Wenn ich ihn daran erinnerte, dass er in Millhouse geboren worden war, lachte er nur: „Ach, das ist schon so lange her, ich habe alles vergessen.”
„Das glaube ich dir nicht, Onkel Finn.” So durfte ich ihn nennen.
Dabei lachte ich, denn ich wusste, was jetzt kommen würde.
„Was, du glaubst deinem alten Onkel nicht, na warte.”
Er stürzte sich auf mich und begann, mich zu kitzeln, bis ich um Gnade bettelte.
Mit ihm durfte ich auch reiten lernen. Er nahm sich dafür viel Zeit und hatte eine unendliche Geduld.
Meinem Onkel habe ich es zu verdanken, dass ich noch heute eine ausgezeichnete Reiterin bin. Meinen Vater kümmerte das nicht.
Manchmal sah ich die beiden abends bei einem Glas Portwein in der Bibliothek sitzen, wenn ich mit Frieda hinunterging, um Gutenacht zu sagen. Dann wirkte mein ansonsten so steifer Vater auch viel weicher und gelöster. Manchmal hörte ich ihn sogar lachen, obwohl mein Vater das sonst nie tat.
Als ich an einem sonnigen Nachmittag mit Onkel Finn durch den Park streifte, fasste ich einen Entschluss.
Ich lenkte unseren Erkundungsgang in Richtung der verbotenen Pforte.
Als wir davorstanden, tat ich überrascht.
Auch mein Onkel wunderte sich: „Ich wusste gar nicht, dass es in der Mauer hier hinten eine Pforte gibt, seltsam.”
Er betrachtete sie sich genau: „Ob die neu ist? Aber das kann ja nicht sein. Das ist merkwürdig.”
Ich nahm seine Hand. „Komm, wir gehen durch.”
Also betraten wir den Park von Behringhouse. Onkel Finn schaute sich sehr erstaunt um. „Hier war ich ja seit ewigen Zeiten nicht mehr. Wie lange hier wohl niemand mehr wohnt? Alles ist wie ausgestorben.”
„Onkel Finn, hast du die Bewohner gekannt?”
„Wen soll ich gekannt haben? Ach so. Ähm, ja. Ich bin mit dem jüngsten Sohn quasi aufgewachsen. Wir waren dick befreundet, bis …”
Er sah zu dem Fenster hoch, in dem ich einmal eine Bewegung wahrzunehmen geglaubt hatte.
Ich zupfte an seiner Hand. „Bis was?”
Er starrte noch immer hoch und schien weit in die Vergangenheit abgetaucht zu sein.
„… bis er sich erhängt hat.”
Im selben Moment registrierte er, wem er das gesagt hatte, und beugte sich beunruhigt zu mir herunter. „Wusstest du davon?”
Zuerst wollte ich lügen und die Altkluge spielen, da mich diese Offenbarung aber so schockiert hatte, war ich dazu nicht in der Lage und schüttelte den Kopf.
„Oh, das wird wohl Ärger geben.” Ratlos fuhr er sich durch sein volles dunkelblondes Haar. „Glaubst du, du kannst darüber schweigen?”
Ich nickte nur eifrig. Für Onkel Finn würde ich alles tun.
„Warum kann ich auch meinen Mund nicht halten? Es ist immer dasselbe. Komm, wir drehen um. Das ist hier alles viel zu düster.”
Als wir wieder im Park von Millhouse waren, fragte ich: „Onkel Finn, warum hat dein Freund das getan?”
„Ach Liebling, das weiß keiner. Und das ist jetzt schon so lange her. Am besten, wir vergessen es einfach.”
Etwas später fragte er mich: „Sag mal, meine Kleine, willst du mich nicht bald einmal auf meinem Schiff besuchen? Vielleicht in ein paar Jahren, wenn du dafür groß genug bist. Du könntest mit in die Kolonien kommen und dir alles ansehen.”
Ich sah ihn mit großen Augen an. „Wirklich?”
„Natürlich. Aber nur, wenn du willst.”
Ich umarmte ihn vor Freude. „Ja, unbedingt. Wann darf ich mitkommen?”
Er beugte sich zu mir hinunter. „Gemach. Jetzt bist du noch zu jung. Aber sobald aus dir eine junge Lady geworden ist, kann das Abenteuer losgehen.”
„Dann werde ich ganz bald eine junge Lady. Vielleicht schon nächstes Jahr.”
Onkel Finn lachte laut. „Wer weiß. Dann mach mal. Die Kolonien warten auf dich.”
„Darf Frieda mitkommen?”
„Selbstverständlich. Sie ist willkommen.”
Jetzt gab es etwas, worauf ich mich freuen konnte. Und tatsächlich wollte ich in den nächsten Jahren nur eines, und das ganz schnell, nämlich eine junge Lady werden, um mit Onkel Finn und Frieda die Meere zu befahren.
Als wir die Halle von Millhouse betraten, liefen wir Tante Henrietta über den Weg.
Onkel Finn ging sofort lachend auf sie zu, packte sie, wirbelte sie durch die Luft und rief: „Hetty, altes Mädchen. Wie geht es dir an diesem schönen Tag?”
Tante Henrietta gluckste vor Vergnügen. Gespielt verärgert schlug sie Onkel Finn auf den Arm. „Finnegan, also wirklich. Kein Respekt vor dem Alter. Aber danke der Nachfrage, mir geht es gut. Muss gleich mal ein wenig in den Park gehen bei diesem schönen Wetter.”
„Oh ja, ich begleite dich, komm.”
Und schon hatte er sie hinter sich her aus dem Haus gezogen.
Wer liebte Onkel Finnegan nicht?
Frieda wartete schon auf mich. „Wo bleibst du denn? Ich muss dich für das Dinner umziehen und deine Haare frisieren.”
Diese Prozedur hasste ich, musste sie aber über mich ergehen lassen.
„Frieda, kannst du ein Geheimnis für dich behalten?”
„Oh, oh. Was hat dieser Tunichtgut dir erzählt?”
„Erst wenn du meine Frage beantwortest.”
„Du weißt doch, dass ich schweigen kann wie ein Grab.”
„Schwöre es.”
Gespielt ernst hob sie einen Finger in die Luft. „Ich schwöre.”
„Er hat sich erhängt”, platzte ich heraus.
Verständnislos sah sie mich an. „Wer hat sich erhängt?”
Ich machte eine Kopfbewegung hinüber zum Behringhouse.
Frieda verstand noch immer nicht.
„Der jüngste Sohn”, flüsterte ich.
Erst nach einer Weile dämmerte es Frieda. „Oh, jetzt weiß ich, was du meinst.” Sie kniff ihre Lippen zusammen, was bei ihr immer ein Zeichen von Verärgerung war. Schweigend kämmte sie mir mein Haar. „Und wer hat dir das erzählt?”
„Onkel Finnegan natürlich”, antwortete ich entrüstet, weil sonnenklar war, von wem ich das hatte. Manchmal kapierte Frieda aber auch gar nichts.
„Dem werde ich was erzählen. Das eignet sich nicht für die Ohren von Kindern.”
„Nein. Nein. Nein.”
„Ach, und warum nicht?”
„Du hast es geschworen.”
„Was habe ich geschworen?”, fragte Frieda ärgerlich.
„Dass du nichts sagen wirst.”
Sie schwieg eine Weile. „Hm, da hast du wohl recht.”
„Also halte dich an deinen Schwur”, murrte ich altklug.
Als sie mich fast fertig frisiert hatte, musste ich doch fragen. „Warum bringt sich ein Mensch um?”
Frieda sah mich groß an. „Du stellst wieder mal Fragen. Ich habe keine Ahnung. Muss wohl sehr verzweifelt gewesen sein, der arme Junge.”
„Hatte er denn keine Nanny?”
„Woher soll ich das denn wissen? Wer weiß, was ihn dazu gebracht hat.”
„Der arme Junge”, echote ich, weil mir nichts Besseres einfiel.
In der Nacht überlegte ich, ob ich eines Tages auch dazu fähig sein würde, mich zu erhängen. Im Moment fand ich mein Leben aber viel zu schön, als dass ich mir so etwas vorstellen konnte. Gerade wegen Onkel Finn, der mein Leben so bereicherte. Also kam ich wieder einmal zu der Erkenntnis, dass Erwachsene eine ganz seltsame Spezies Mensch waren, die ein Kind wie ich einfach nicht begreifen konnte.
Als Onkel Finn schon längst wieder abgereist war, taten sich plötzlich seltsame Dinge in Behringhouse.
Ich hatte wieder einen meiner Streifzüge unternommen, als ich schon von Weitem Stimmen hörte. Also schlich ich mich vorsichtig näher heran, um zu erkunden, was da vor sich ging. Das Gras war ja zum Glück hoch genug gewachsen, um ein kleines Mädchen wie mich zu verschlucken.
Vor der kleinen Treppe zur Eingangshalle standen ein paar Männer und eine Frau.
Sie blickten sich interessiert um, gingen immer wieder ein paar Schritte, sahen am Haus hoch oder musterten den Park.
Wer waren diese Menschen, und was wollten sie hier? Es war das erste Mal, dass ich überhaupt jemanden hier sah. Sie unterhielten sich angeregt und schienen ganz angetan zu sein von dem, was sie sahen. Das konnten doch keine Besucher sein. Behringhouse war schließlich nicht für öffentliche Besichtigungen frei gegeben. Was also hatten sie hier zu suchen?
Was sie sprachen, konnte ich nicht verstehen, denn dafür stand ich zu weit weg.
Die Frau war mir sympathisch. Sie war älter und stand an der Schwelle zur dicken Matrone. Aber wenn sie lachte, schallte das bis zu mir herüber. Und sie lachte oft.
In Millhouse wurde selten gelacht.
Sie verschwanden dann ins Innere, und ich beschloss, lieber wieder zurückzugehen. Schließlich wollte ich hier nicht entdeckt werden.
Ich war ganz unruhig und musste unbedingt wissen, was es für eine Bewandtnis mit meiner Beobachtung hatte. Also wartete ich bis zum Dinner.
Mein Vater hatte wie immer die Times vor sich und war nicht ansprechbar. Also fragte ich Tante Henrietta, die immer gut über alles Bescheid wusste, was um sie herum passierte.
„Was tut sich in Behringhouse, Tante?”
„Häh?”
Also schrie ich noch mal: „Was tut sich in Behringhouse?”
Tante Henrietta sah meinen Vater an. „Also dieses Kind stellt wirklich seltsame Fragen.”
Aber der reagierte wie immer überhaupt nicht auf ihre Bemerkung.
Da platzte Tyson in das Gespräch. „Behringhouse ist verkauft worden, stell dir das nur einmal vor. Ich weiß es vom Vikar.”
Ich ließ meine Gabel fallen. „An wen?”
Jetzt wurde auch mein Vater aufmerksam. „Verkauft, sagst du”, und wandte sich an Tyson.
„Hab‘s vom Vikar.”
„Warum weiß ich denn davon nichts?”
Tyson zuckte nur mit der Schulter.
„Was ist verkauft worden?”, dröhnte Tante Henrietta.
„Behringhouse”, schrien Tyson und ich gleichzeitig.
„Ach so.” Damit setzte sie ihre Mahlzeit fort. „Mrs Rott hat sich wieder einmal selbst übertroffen.”
Das waren seltsame Neuigkeiten. So viele Jahre hatte Behringhouse leer gestanden und plötzlich hatte es einen neuen Besitzer. Was würden das für Menschen sein, die unsere neuen Nachbarn geworden waren? Wann würde ich sie kennenlernen?
Ich konnte es jedenfalls kaum erwarten.
Während der nächsten Streifzüge war alles beim Alten. Niemand war zu sehen, und es schien fast, als hätte ich die Szene mit den Besuchern nur geträumt. Auch Tyson wusste nichts Neues zu berichten. Allerdings interessierte ihn Behringhouse überhaupt nicht. Und selbst Tante Henrietta nahm an meiner Neugier keinen Anteil. Das verwunderte mich, denn ansonsten wollte sie immer alles ganz genau wissen.
Dann jedoch, ich war schon dabei, alles wieder zu vergessen, kam Bewegung in die Angelegenheit.
Als ich wieder einmal durch die eiserne Pforte ging, es hatte tagelang geregnet und es war dadurch zu nass und zu kühl gewesen, um hinüberzugehen, bemerkte ich schon von Weitem Unruhe und auch Lärm. „Jetzt geht es los“, sagte ich vor mich hin.
Und tatsächlich, als ich vorsichtig näher herankam, konnte ich Gerüste erkennen, auf denen Arbeiter standen, die die Fassade neu herrichteten. Aber auch im Inneren musste gearbeitet werden, denn ich hörte einen Höllenlärm, als würden die Wände eingerissen. An einer anderen Stelle war damit begonnen worden, das Dach neu zu decken. Und auch in den Stallungen tat sich was.
Fasziniert lag ich verborgen im hohen Gras und beäugte das Treiben. Also gab es wirklich neue Besitzer, die Behringhouse jetzt renovierten.
Ich wusste nicht genau, ob ich mich darüber freuen sollte, dass nun endlich wieder Leben in das alte Gemäuer einkehrte, oder ob ich traurig darüber sein sollte, dass ich nun meinen Zufluchtsort verloren hatte. Jetzt konnte ich höchstens noch heimlich hierherkommen und musste immer Angst haben, entdeckt zu werden.
Ausgerechnet von meinem Vater erfuhr ich dann während eines Dinners, wer der neue Besitzer war. Mein Vater saß für die Torys im Parlament in London, um den Wahlbezirk hier zu vertreten. Deshalb war er auch häufig nicht zu Hause.
Und Behringhouse war nun ausgerechnet von einem Vertreter der Opposition gekauft worden, was meinem Vater sehr missfiel. „Wie sollen wir denn nachbarschaftlichen Umgang pflegen? Eine sehr unangenehme Situation. Und dabei kenne ich ihn noch gar nicht. Ist mir im Unterhaus nie aufgefallen.“ Aber da mein Vater als Lord im Oberhaus saß, war das auch kein Wunder.
„Ach ja“, wandte er sich an mich, was nun wirklich sehr selten vorkam. „Er hat einen großen Sohn und eine Tochter ungefähr in deinem Alter.“
Ich konnte meinen Vater nur mit großen Augen ansehen.
„Wer ist alt? Ihr meint doch wohl nicht mich?“, brüllte Tante Henrietta.
Mein Vater warf ihr nur einen verächtlichen Blick zu und widmete sich wieder seiner Times. Aber Tyson und ich schauten uns an. Beide hatten wir hier in der Umgebung keine Spielkameraden, was wir uns aber sehr gewünscht hätten.
Also war ich natürlich sehr neugierig auf die Familie, die in Behringhouse einziehen würde. Allerdings musste ich mich noch eine Weile gedulden, denn die Renovierungsarbeiten zogen sich fast bis ins nächste Frühjahr hin. Kein Wunder, denn es waren so viele Jahre vergangen, in denen es langsam verfiel. Da war jetzt viel zu tun. Vater erzählte, dass der neue Besitzer sehr reich sei und es für ihn demnach kein Problem sein konnte, Behringhouse so aufwändig wiederherzurichten.
Natürlich schlich ich immer wieder hinüber und betrachtete mir die Fortschritte.
Das alte Behringhouse, von dem ich so fasziniert war, gab es inzwischen schon nicht mehr. Jetzt sah ich ein stolzes Herrenhaus in all seiner Pracht. Gegen meinen Willen, der an dem alten Haus hing, wurde ich neidisch, denn Millhouse sah bestimmt nicht so aus nach den vielen Hunderten von Jahren, die es schon auf dem Buckel hatte.
Und dann lernte ich Tippi kennen.
Wieder einmal war ich während eines warmen Frühlingstages hinüber gegangen und legte mich in das Gras, das noch immer nicht gestutzt worden war. Zunächst mussten wohl das Haus und die Stallungen instandgesetzt sein, ehe man sich dann dem Park zuwenden würde.
Immer noch kamen große Wagen und brachten Möbel und alles, was man für einen so großen Haushalt brauchte. Es schien kein Ende zu nehmen, Behringhouse einzurichten.