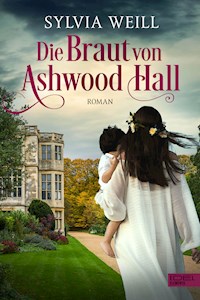Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Margareth Harper will nach dem Tod ihrer Mutter deren Heimat Deutschland kennenlernen, auch weil der Prinzgemahl von Queen Victoria dort herkommt. Also reist sie mit ihrem kranken Vater nach Freiburg im Schwarzwald, um ihre einzige Tante dort zu besuchen. Der Vater stirbt nach einiger Zeit dort. Sie lernt kurz darauf Robert Penderroy kennen, einen jungen Adligen aus England. Aber auch ihr Cousin Friedrich weckt in ihr nicht gekannte Gefühle. Sie nimmt jedoch nach einigem Zögern Roberts Heiratsantrag an und geht mit ihm zurück nach England in das alte Schloss der Familie. Dort ist sie nicht willkommen. Es geschehen seltsame Dinge. Die weiße Frau geht um und erscheint ihr kurz vor der Geburt ihres Kindes. Bald wird ihr klar, daß man ihr im Schloß nach dem Leben trachtet. Welche Rolle spielt ihr Ehemann und kann sie Friedrich vergessen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 384
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kurzbeschreibung:
Sylvia Weill
Das Schloss am Moor
Roman
Edel Elements
Edel ElementsEin Verlag der Edel Germany GmbH
© 2018 Edel Germany GmbHNeumühlen 17, 22763 Hamburg
www.edel.com
Copyright © 2018 by Sylvia Weill
Lektorat: Tatjana Weichel
Covergestaltung: Anke Koopmann, Designomicon, München
Konvertierung: Datagrafix
Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des jeweiligen Rechteinhabers wiedergegeben werden.
ISBN: 978-3-96215-154-6
www.facebook.com/EdelElements/
www.edelelements.de/
Inhalt
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
1. Kapitel
Niemals würde ich vergessen, welche Freude es mir als Kind bereitet hat, wenn meine Mutter mir Märchen aus ihrer deutschen Heimat erzählte. Davon konnte ich nie genug bekommen, und oft bettelte ich darum, dass sie mir ein neues erzählte oder aber mir eins der Märchen noch einmal vorlas, welches ich schon in- und auswendig kannte.
Mutter besaß das seltene Talent, ihre Zuhörer in eine Welt voller Magie und Zauberei zu entführen. Alle Kinder aus der Nachbarschaft hingen an ihren Lippen, wenn sie zuhören durften und Mutter von Schneewittchen und den sieben Zwergen, Hans im Glück oder der Prinzessin auf der Erbse erzählte.
Die meisten Kinder mochten das Märchen von Hänsel und Gretel. Meine Mutter konnte die böse Hexe so gut nachmachen, dass wir dabei alle Angst bekamen. Mir jedoch gefielen die Geschichten, in denen der starke Prinz die schöne Prinzessin aus ihren Schwierigkeiten erlöste und sie für immer glücklich und zufrieden lebten.
Ich war allerdings am liebsten alleine mit meiner Mutter. Meist saß sie dann in ihrem alten Ohrensessel, im Kamin flackerte ein behagliches Feuer, und ich hockte auf ihrem Schoß oder spielte auf dem Boden, wo mir keins von ihren Worten entgehen konnte. Und in diesen Momenten holte sie oft aus ihrer alten Ebenholztruhe ein schon ganz zerfleddertes Märchenbuch hervor und las mir die Geschichten der Gebrüder Grimm auf Deutsch vor.
Wenn wir alleine waren, sprach sie immer in ihrer Muttersprache mit mir. Es war ganz selbstverständlich für mich, ich kannte es nicht anders. Mein Vater war davon zwar nicht begeistert, konnte und wollte es aber auch nicht verhindern. Mit ihm und vor allen anderen Personen in meiner Umgebung sprachen wir natürlich nur englisch. Vater beherrschte Mutters Sprache nicht sehr gut, aber er liebte ihre Heimat ebenso wie sie. Schließlich gab es ein starkes Band zwischen den beiden Ländern.
Unsere junge Königin Victoria entstammte dem Herrscherhaus Hannover, das seit 1714 die englischen Könige stellte, und ihr Prinzgemahl Albert, den sie so abgöttisch zu lieben schien, dem deutschen Adelshaus Sachsen-Coburg und Gotha. Es hieß, sie sprachen deutsch miteinander, wenn sie allein waren. So fühlte ich mich wie viele Engländer mit den Deutschen freundschaftlich verbunden, und wie jedes andere Mädchen in England sehnte ich mich nach einer so glücklichen Ehe mit so vielen Kindern, wie die beiden es Tag für Tag vorführten.
Natürlich wusste auch jeder in England inzwischen, dass unser junges Königspaar das Weihnachtsfest nach deutschem Ritual feierte. Seit ich denken konnte, hatte meine Mutter auch darauf bestanden, das Weihnachtsfest nach dem Brauch ihrer Heimat zu begehen. Dazu gehörte ein Tannenbaum, den sie organisierte und dann liebevoll schmückte. Dabei erzählte sie mir Geschichten von den Weihnachtsfesten ihrer Kindheit in Freiburg im Breisgau, wovon ich ebenso fasziniert war wie von den Märchen.
An Heiligabend gab es Geschenke, und wir sangen deutsche Weihnachtslieder. Mein Vater konnte nur mitsummen, aber das war in Ordnung so und tat der Stimmung keinen Abbruch.
Großen Wert legte meine Mutter jedoch darauf, meinen Vater nicht zu vernachlässigen. Deshalb hing am ersten Feiertag immer ein Strumpf für jeden am Kamin, in dem noch einmal kleine Geschenke steckten. Über den Türen hatte sie Mistelzweige angebracht, aber natürlich gab es zum Essen Gänsebraten wie in Deutschland. Der Nachtisch allerdings musste Plumpudding sein, mit dem sie sich immer große Mühe gab. So konnte mein Vater Weihnachten auch sehr britisch genießen.
Ich glaube, in diesen Momenten der Magie, wenn Mutter von den sieben Zwergen, die in ihrem Wald für Schneewittchen sorgten, erzählte, fühlte sie sich wieder wie zu Hause.
Sie und Vater hatten sich in Mutters Heimatstadt Freiburg kennengelernt, einer kleinen, mittelalterlichen Stadt am Rande des Schwarzwaldes, als Vater eine Bildungsreise durch Deutschland unternommen hatte. Mutter lebte damals zusammen mit ihren Eltern und ihrer Schwester auf einem kleinen Bauernhof, der vor den Toren von Freiburg lag. Am Markttag musste sie immer Eier, Butter und Käse auf den Markt vor dem Münster bringen, um es dort zu verkaufen. Einen Sommer lang blieb er, um ihr dann einen Heiratsantrag zu machen. Im Herbst musste er jedoch zurück nach England, um dort eine Stellung anzutreten. Schweren Herzens war sie ihm nach England gefolgt. Aber da sie ihn so sehr liebte, nahm sie dieses Schicksal auf sich. Nie mehr in ihrem Leben konnte sie nach Deutschland zurückkehren, um ihre Verwandten zu besuchen und heimische Luft zu schnuppern. Ich weiß, dass sie sich sehr nach den Wäldern ihrer Heimat gesehnt hatte.
Schon damals hatte ich mir fest vorgenommen, irgendwann einmal in meinem Leben dorthin zu fahren, um die Stadt zu sehen, in der meine Mutter aufgewachsen war. Sie hatte mir so viel erzählt: von dem berühmten Freiburger Münster und den kleinen Bächen, die durch die mittelalterliche Stadt flossen, den wunderschönen alten Stadttoren und von der verfallenen Burg etwas außerhalb. Zudem musste ja auch immer noch ihre Schwester dort leben.
Mein Vater war es, der mich sehr schonend darauf vorbereitete, dass meine Mutter uns bald verlassen würde. Ich verstand zuerst nicht, was er damit meinte, mit dem Tod hatte ich bisher nicht viel zu tun gehabt. Natürlich hörte man von Todesfällen in der Umgebung oder auch in Vaters Verwandtschaft, aber jetzt war ich zum ersten Mal direkt damit konfrontiert.
Man sagte, es sei die Schwindsucht gewesen. Ich konnte es zunächst gar nicht richtig begreifen, weil sie Zeit ihres Lebens immer gesund und vital gewesen war, doch jetzt verfiel ihr Körper relativ schnell.
Mein Vater und ich waren uns in dieser Zeit eine große Stütze, auch bei der Pflege meiner Mutter. Sie hustete fast ununterbrochen, und immer war ihr Taschentuch voller Blut. Ich sagte ihr ständig, wie sehr ich sie liebte, und sie sagte mir ein ums andere Mal genau dasselbe.
Sie starb, als ich vierzehn Jahre alt war.
Auf ihrem Totenbett musste ich ihr versprechen, ihrer Schwester in Freiburg letzte Grüße von ihr zu überbringen und wie schade sie es gefunden habe, nie nach Deutschland zurückgekehrt zu sein. Tränenreich gab ich ihr mein Versprechen.
Tagelang wusste ich nicht, wie ich weiterleben sollte, so sehr traf mich ihr Tod. Lange bewegte ich mich nur noch wie in Trance durchs Leben. Ich aß und ich schlief, an mehr erinnere ich mich nicht mehr, bis die Zeit dann auch an mir ihre heilsame Linderung vollbrachte und ich langsam wieder unter die Lebenden zurückkehrte.
Mein Vater jedoch brach unter dem Tod seiner Frau wirklich zusammen. Monatelang war er nicht ansprechbar. Abwechselnd kamen seine Verwandten ins Haus, um unseren Alltag aufrechtzuerhalten. Ich war damals selber zu verletzt und auch noch viel zu jung, um alles zu regeln. Immer wieder ertappte ich meinen Vater dabei, wie er mit meiner Mutter sprach, als sei sie noch an seiner Seite. Es war wohl seine Art, Abschied von ihr zu nehmen.
Aber auch dieser Kummer legte sich irgendwann wieder. Vater konnte wieder in seine Kanzlei gehen und schien sich langsam von dem schweren Verlust zu erholen. So wie früher wurde er aber nie wieder. Er hatte meine Mutter vergöttert.
Und auch ich kam schließlich in ein Alter, in dem andere Sachen viel viel wichtiger wurden.
Umso überraschter war ich, als mein Vater mir eines Tages mitteilte, er wolle mit mir nach Deutschland reisen. Entgeistert sah ich ihn an.
Da mein Vater vom Scheitel bis zur Sohle Engländer war, hatte ich nie damit gerechnet, dass er das einmal tun würde. Schließlich war es eine beschwerliche Reise, und nichts war ihm heiliger als sein Komfort.
Ich dachte also immer, ich müsste warten, bis ich selbst verheiratet sein würde und mit meinem Ehemann dorthin fahren könnte.
„Wie meinst du das?“
Seelenruhig sagte er über seine Teetasse hinweg: „Ich will mit dir nach Freiburg fahren, damit du die Heimat und auch die Verwandten deiner Mutter kennenlernst.“
Ich stellte meine Teetasse so heftig ab, dass sie fast zerbrochen wäre. „Ist das dein Ernst?“, brachte ich nur heraus.
„Mein vollster Ernst. Du sollst die Heimat deiner Mutter kennenlernen, ehe du heiratest.“
Ich sah ihn noch einen weiteren Moment lang überrascht an und stieß dann einen lauten Schrei aus, sprang auf, lief um den Tisch herum und drückte ihn ganz fest an mich. „Womit habe ich das denn nur verdient? Niemals hätte ich gedacht, dass du so etwas machen würdest!“
Dabei sah ich ganz genau, dass ihm eine Träne aus dem Auge kullerte.
Er tat es auch für sich. Erst später sollte ich das erkennen.
In der Nacht konnte ich nicht schlafen vor Aufregung. Und erst da fiel mir der Nebensatz meines Vaters auf: ehe du heiratest.
Was hatte er damit gemeint? Wie konnte ich denn in meinem Alter schon ans Heiraten denken? Das würde noch ein paar Jahre dauern, und schließlich gab es absolut niemanden in meiner Umgebung, der dafür infrage gekommen wäre.
Also tat ich es schließlich als nur dahingesagt ab und begann mir den Aufenthalt in Freiburg vorzustellen. Meine Mutter hatte mir so viel von der Stadt an dem Fluss Dreisam und ihrer Umgebung erzählt, dass ich glaubte, mich sofort dort heimisch fühlen zu können. Am meisten interessierte mich die uralte Burg der Zähringer. Irgendwann schlief ich dann schließlich ein und träumte davon, wie ich glücklich durch diese alte Stadt lief.
Natürlich würde ich auch endlich meine Tante und ihren Mann kennenlernen. Viele Verwandte gab es wohl nicht mehr, in den Briefen schrieb meine Tante immer wieder von Todesfällen. Meine Mutter und ihre Schwester hatten sich Zeit ihres Lebens sehr nahegestanden. Leider war das die letzten Jahre nur noch brieflich möglich gewesen, aber das hatte ihrer engen Bindung keinen Abbruch getan, und so wussten sie immer voneinander Bescheid.
Tante Sabinelotte schien es kaum erwarten zu können, das einzige Kind ihrer geliebten Schwester in die Arme zu schließen.
Mit den wenigen Verwandten meines Vaters konnte ich nie warm werden. Er selbst hielt sich auch von ihnen fern und besuchte sie nur, wenn es sein musste. Sie lebten in Wales, waren sehr nationalistisch und konnten meinem Vater nicht verzeihen, dass er eine Ausländerin und keine waschechte Waliserin geheiratet hatte. Und so kam es dann, dass sie von mir, der Tochter dieser Ausländerin, auch nichts wissen wollten. Meinen Vater hatte das anfangs sehr verletzt. Es gab lange Zeit keinen Kontakt zwischen ihnen, bis sie sich dann doch wieder bei ihm meldeten. Von da an besuchte er sie zwar ab und zu, aber ich blieb weiterhin außen vor. Ich hatte das lange nicht verstanden, irgendwann jedoch als gegeben akzeptiert.
Meine Mutter hatte das alles nicht berührt. Sie machte sich darüber keinerlei Gedanken. Es war ihr nicht wichtig gewesen, die Anerkennung der Familie meines Vaters zu bekommen. Im Ort hatte sie ein paar Freundschaften zu Frauen in ihrem Alter geknüpft, und in einem Nachbarort besuchte sie öfter eine Frau, die auch aus Deutschland kam. Mit ihr konnte sie in ihrer Muttersprache über die Ereignisse in Deutschland reden, und von diesen Besuchen kam sie immer bestens gelaunt zurück. Manchmal hatte sie mich mitgenommen. Ich mochte diese Frau auch sehr gerne, aber wenn sie sich dann über den deutschen Kaiser oder politische Vorkommnisse in Deutschland unterhielten, langweilte ich mich. Deshalb ging ich irgendwann nicht mehr mit. Ich glaube, meiner Mutter und ihrer Freundin war das auch recht so.
Auf der Beerdigung musste Tante Rose, wie ich sie nannte, so sehr weinen, dass sie gestützt werden musste. Ich habe sie nie wiedergesehen.
Kurz nach meinem achtzehnten Geburtstag sollte die Reise nach Deutschland losgehen. Es musste so viel geregelt und organisiert werden, dass ich schon gar nicht mehr an eine Abreise glaubte.
Meine wenigen Freundinnen, die mir noch aus der Schule geblieben waren, beneideten mich natürlich glühend. Immer wieder wollten sie alles über die Reise und Freiburg wissen. Ich glaube, sie wären am liebsten alle mitgekommen.
„Wir werden unser Leben lang nicht aus England herauskommen“, sagten sie immer wieder mit dem größten Bedauern.
„Du wirst bestimmt deinen zukünftigen Ehemann dort kennenlernen“, flüsterte Vicky, meine beste Freundin, mir immer wieder zu.
Ich lachte sie dafür allerdings nur aus. An Heirat und Ehe dachte ich damals ganz bestimmt nicht. Ich hatte nur die Reise im Kopf und das, was ich dort wohl erleben würde. Später erst habe ich ab und zu an Vickys Worte gedacht.
Für meinen Vater war die bevorstehende Reise eine willkommene Ablenkung von seinem Kummer. Ich glaube, er hoffte, sich Mutter an ihrem Heimatort wieder näher fühlen zu können, denn er konnte sie einfach nicht vergessen. Zudem hatte er sich in Freiburg sehr wohlgefühlt und auch Tante Sabinelotte in sein Herz geschlossen.
Heute kommt es mir seltsam vor. Meine Freundinnen hatten damals nur ein Thema: wen sie wohl heiraten würden, wie viele Kinder sie haben würden und wo sie leben wollten.
Mir war nichts fremder als das. Zwar hatte mir auch der eine oder andere Junge in unserer Schule gefallen, aber das waren flüchtige Gefühle, die keinerlei Spuren hinterlassen hatten.
Vicky und die anderen Mädchen waren da ganz anders. Jede von ihnen hatte genaue Vorstellungen, wen sie zu ehelichen gedachte, auch wenn der betreffende Junge davon noch gar nichts wusste. Ihr Weg lag klar und eindeutig vor ihnen.
Das war bei mir nicht der Fall. Ich dachte nur an die Reise und dass ich meine Tante endlich kennenlernen würde. Nie habe ich mir auch nur einen Gedanken darum gemacht, was sein würde, wenn wir von dieser Reise wieder zurückkehren würden. Vielleicht hätte ich das tun sollen, denn vielleicht hätte ich diese Reise dann gar nicht angetreten, sondern darauf gewartet, sie mit meinem zukünftigen Ehemann zusammen zu machen.
Später sollte ich ab und zu daran zurückdenken. Hätte es etwas geändert?
2. Kapitel
So war dann irgendwann im Frühling alles geregelt. Mein Vater war in seiner Kanzlei beurlaubt, alle nötigen Papiere waren beisammen und unsere Sachen gepackt. Der Abreisetag rückte endlich näher.
Einen Tag vorher ging ich noch auf den Friedhof, um das Grab meiner Mutter zu besuchen. Das tat ich nicht sehr oft, mein Vater ging viel häufiger hin und hielt Zwiesprache mit ihr, aber ich wollte mich von ihr verabschieden. Als hätte ich gewusst, dass ich sehr lange nicht mehr an ihr Grab kommen könnte.
Ich erzählte ihr, wie sehr ich mich auf Freiburg freute und bat sie um ihren Segen für die Reise.
Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass sie sich freute und mich an mein Versprechen auf dem Totenbett erinnerte, Tante Sabinelotte Grüße von ihr auszurichten.
Ich legte den kleinen Blumenstrauß, den ich für sie gekauft hatte, auf das Grab und murmelte ein paar letzte Worte. Dabei musste ich mir eine Träne aus dem Augenwinkel wischen. Sie war einfach viel zu früh von uns gegangen, und wie gerne hätte ich diese Reise mit ihr und meinem Vater zusammen gemacht.
Die Überfahrt über den Kanal war alles andere als lustig.
Da ich noch nie mit einem Schiff gefahren bin, hatte ich mir das alles ganz romantisch und anheimelnd vorgestellt.
Wir hatten eine sehr einfache Kabine mit zwei Pritschen gebucht, auf denen schmuddelige Decken lagen. Dort verstauten wir unsere Sachen und gingen sofort wieder an Deck, um uns von England gebührend zu verabschieden.
Die Sonne schien, und wir winkten den zurückbleibenden Menschen auf dem Kai zu, die Verwandte oder Freunde zu der Fähre gebracht hatten.
Ich konnte es kaum erwarten, bis das Schiff endlich auslief. Ganz langsam setzte es sich in Bewegung, und immer wieder war die Schiffssirene zu hören.
Ich erschrak, als ich bemerkte, wie leichenblass mein Vater neben mir stand und sich an die Reling krallte. „Vater, was ist denn mit dir?“, fragte ich ihn beunruhigt.
Er lächelte. „Ach, ich glaube, ich bin jetzt schon seekrank. Kümmere dich nicht weiter um mich.“
Ich sah ihn zweifelnd an, aber dann überwog die Neugier, und ich widmete mich wieder der Zeremonie des Auslaufens. Die Fähre war schwerfällig, und es dauerte sehr lange, bis sie endlich auf der glatten See ihre Fahrt aufnehmen konnte.
Neben mir stand ein Mädchen mit ihren Eltern, das wohl ungefähr so alt war wie ich. Sie war auch das erste Mal auf einem Schiff, hatte sie mir erzählt. Abwechselnd wiesen wir uns auf dies und jenes hin, wir waren beide begeistert und bekamen ansonsten nicht mehr viel mit.
Ich lief mit meiner neuen Freundin über das Deck. Während mein Vater sich in einen der bereitstehenden Liegestühle gelegt hatte, um sich zu sonnen, erkundeten wir die Fähre. Als es dunkel wurde, gingen wir unter Deck, um etwas zu essen.
Ich hatte großen Hunger und aß die bescheidene Mahlzeit mit großem Appetit. Mein Vater rührte jedoch nicht viel an. Das war wohl der Seekrankheit geschuldet.
Nach dem Essen gingen wir in unsere Kajüte. Zuerst hatte ich befürchtet, dass ich auf den unbequemen Pritschen nicht würde schlafen können, aber ich schlief sofort ein, kaum dass ich die Decke über mich gezogen hatte.
Nachts wachte ich durch einen ohrenbetäubenden Donner auf. Es klang, als hätte der kurz darauffolgende Blitz direkt in das Schiff eingeschlagen. Ich war zuerst verwirrt, weil ich aus einem tiefen Traum hochgeschreckt war. Erst als ich meinen Vater auf seiner Pritsche sitzen sah, fiel mir wieder ein, wo wir waren.
Das Schiff schaukelte gewaltig, und ich musste mich ein ums andere Mal an der Pritsche festhalten, um nicht herunterzufallen.
Mein armer Vater war ganz grün im Gesicht und sagte immer wieder leise vor sich hin: „Ich hab’s gewusst. Ich hab’s gewusst. Genau wie damals, als ich das erste Mal über diesen verdammten Kanal gefahren bin.“
Mir wurde übel. Ich wollte hoch an die Reling rennen, aber mein Vater hielt mich zurück. „Bleib hier, die lassen niemanden hoch. Zu gefährlich.“
Also musste ich mit dem Eimer vorliebnehmen, der eigentlich als Nachtgeschirr dienen sollte.
Diese Nacht sollte ich so schnell nicht vergessen. Ich dachte, sie nimmt niemals ein Ende, und ich würde mir die Seele aus dem Leib erbrechen.
Mein armer Vater hingegen hielt sich tapfer, aber auch er litt sehr. Erst gegen Morgen ließ das Gewitter nach, und der Seegang wurde ruhiger. Endlich konnten wir einschlafen, auch wenn an ruhigen Schlaf nicht zu denken war.
Diese erste Nacht auf einem Schiff hatte mir die Lust auf Seereisen ein für alle Mal verdorben. Ein romantisches Flair hatte das bestimmt nicht und essen konnte ich auch nicht mehr viel.
Als wir endlich in Bremerhaven ankamen, konnte ich es kaum erwarten, wieder festen Boden unter den Füßen zu haben. Ich verabschiedete mich von meiner neu gewonnenen Freundin, die mit ihrer Familie weiter nach Berlin reiste.
Einen Blick zurück auf die Fähre warf ich nicht mehr. In diesem Moment war ich fest entschlossen, nie wieder ein Schiff zu betreten.
Was mir in Bremerhaven zuerst auffiel, war, dass plötzlich alle deutsch sprachen. Ich hatte zwar Mühe damit, denn das Deutsch, das ich beherrschte, war das aus Freiburg, einem Ort, der viele hundert Meilen weiter südlich lag. Aber ich konnte es doch im Großen und Ganzen verstehen und atmete auf. Endlich war ich im Heimatland meiner Mutter, das dadurch ja auch in gewisser Weise mein Heimatland war.
Ich wusste, dass von nun an ich die Führung übernehmen musste, da mein Vater mit der Sprache auf Kriegsfuß stand. Zwar verstand er wohl das meiste, konnte aber kaum deutsch sprechen.
Ich tat es gerne, gerade weil ich bemerkte, dass er immer noch angeschlagen von der Überfahrt war. Er war schmal im Gesicht und hatte eine ungesunde Hautfarbe. Außerdem sagte er kaum etwas. Mir hingegen war es direkt wieder gut gegangen, kaum dass wir an Land waren.
Wir übernachteten in einer kleinen Pension direkt am Hafen von Bremerhaven, worüber mein Vater sehr erleichtert war. Er fühlte sich wirklich nicht wohl.
Meine Mutter hatte mir viel von den typisch deutschen Lokalen erzählt. Nun saßen wir in so einem, an einfachen Tischen und Stühlen zwischen holzgetäfelten Wänden, und das in einer ziemlichen Lautstärke, denn das Lokal war voll besetzt.
Gegessen wurde deftig. Aber ich hatte so einen Hunger, dass ich eh fast alles gegessen hätte. Die deutsche Küche kannte ich zudem auch. Mutter hatte ab und zu Gerichte aus ihrer Heimat gekocht, wenn sie Lust dazu hatte und die Zutaten bekam. Mir hatte es immer geschmeckt. So ein Riesenunterschied zur englischen Küche machte es für mich nicht.
Ich konnte ja noch nicht wissen, dass die Gastronomie im Süden Deutschlands, unserem Reiseziel, noch typischer war als hier.
Nach einer Nacht, in der ich sehr gut schlief, machten wir uns dann auf den Weg gen Süden. Wir würden mehrere Tage unterwegs sein, vielleicht noch einmal mit einem Schiff auf dem Rhein, aber das wusste ich noch nicht genau.
Es war alles neu, und ich sog es in mich auf wie die Luft zum Atmen. Wo ich konnte, sprach ich mit anderen Reisenden und fragte sie Löcher in den Bauch. Ich wollte alles wissen, aber auch wirklich alles. Die meisten gaben mir bereitwillig Auskunft, waren wahrscheinlich froh für die Abwechslung auf der doch eher eintönigen Reise.
Zum Glück fuhr auch hier schon längere Zeit die Eisenbahn, sonst wären wir wahrscheinlich Wochen unterwegs gewesen. Aber wir mussten oft umsteigen und immer wieder irgendwo übernachten, weil die Anschlüsse so schwierig waren.
Vom Zug aus konnte ich den Rhein sehen, den sagenumwobenen Fluss der Nibelungen. Ich fragte Vater, ob wir den Ort schon passiert hätten, an dem die Nibelungen gewohnt hatten, aber er wusste es nicht. Er wusste nur, dass wir in Mainz, der alten Bischofsstadt, auf ein Schiff umsteigen mussten, und irgendwo in der Nähe lägen Worms und Speyer, wo die Nibelungen herkamen.
In Mainz angekommen, wollte Vater sich ausruhen, ehe es dann weiterging. Ich bummelte also alleine durch die alte Stadt, bewunderte die Fachwerkhäuser und stellte mir vor, dass es in Freiburg auch so aussehen würde. Wovon ich restlos begeistert war, war mein Besuch in dem uralten romanischen Dom. Dort blieb ich lange sitzen, atmete den leichten Geruch nach Weihrauch ein und dachte an meine Mutter.
In der Umgebung der Stadt sah ich auch die ersten Weinberge, die mich jetzt bis Freiburg begleiten würden, das wusste ich. Unser Prinzgemahl Albert hatte die Sitte eingeführt, deutschen Wein zum Essen zu trinken. Da ich mich schon fast als Deutsche fühlte, war ich richtig stolz. Ich hätte gerne die Stadt Coburg gesehen, aus der er kam, aber mein Vater erklärte mir, dass sie sehr weit weg in einer ganz anderen Gegend läge.
Die Schiffspassage auf dem Main dauerte nicht lange. Innerhalb eines Tages waren wir in Frankfurt, und im Gegensatz zu der Passage des stürmischen Kanals merkten wir davon so gut wie nichts. Ich war sogar auf dem Deck eingeschlafen. Es hieß, dass Mainz der Rheinhafen von Frankfurt sei, und man sagte scherzhaft in beiden Städten: Frankfurt und Mainz sind eins. Darüber schmunzelte ich, obwohl ich es nicht ganz verstand. Im Deutschen reimt es sich.
Schon als wir die Stadt langsam ansteuerten, begriff ich, warum es sich um eine der bedeutendsten Städte Deutschlands handelte. Alles sah großzügig, weltoffen und stolz aus.
Wir würden ein paar Tage bleiben. In Frankfurt fand gerade eine Messe statt, und es war geplant, dass Vater sich mit ein paar Bekannten traf, die geschäftlich dort waren.
Am alten Zeughaus stiegen wir aus.
Man hatte für uns in der Nähe des Römers, dem Rathaus der Stadt, ein Zimmer in einem der besseren Hotels vorbestellt, und zu meiner Freude stellte ich fest, dass wir dort mitten in der Stadt wohnten.
Die Betten waren sehr hart, aber vor allen Dingen sauber. Vater legte sich sofort hin und war auch schon im nächsten Moment eingeschlafen, obwohl von draußen das geschäftige Treiben der Stadt zu hören war.
Ich nahm erst einmal ein ausgiebiges Bad, das man mir gerne zubereitete. So schmutzig wie auf dieser Reise hatte ich mich in meinem Leben noch nie gefühlt.
Vater fühlte sich etwas besser, und so gingen wir am Abend hinaus und besuchten ein Lokal, das Zum Steinernen Haus hieß und ganz nah am Römer lag. Es hatte große Butzenscheibenfenster mit bunten Glasmalereien darin.
Hier trafen wir auf zwei von Vaters Geschäftsfreunden, die sich sehr freuten, uns zu sehen. Natürlich sprachen sie gleich englisch miteinander.
Da ich mich am Gespräch nicht beteiligen konnte, blieb mir nur, mich umzusehen und an meinem Apfelwein zu nippen, dem Frankfurter Nationalgetränk. Für ungewohnte Gaumen, wie es der unsrige nun einmal war, schmeckt er zunächst sauer und wenig delikat. Aber nach ein paar Schlucken wurde er richtig gut und entfaltete sein Apfelaroma. In das erste Glas hatte ich mir etwas Wasser geben lassen. Den Rat hatte mir Mutter irgendwann einmal gegeben.
Sie war sehr angetan von der Stadt gewesen und hatte mir auch einiges über ihre Geschichte erzählt, unter anderem, dass hier fast alle Kaiser des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation gekrönt worden waren. Den Krönungsweg wollte ich mir am nächsten Tag unbedingt anschauen. Auch Goethe war hier geboren worden, über dessen Werk wir in England viel gehört hatten und der erst vor ein paar Jahren gestorben war. Er lebte aber schon als junger Mann in Weimar.
Als das Essen kam, staunte ich. Wir hatten alle das Frankfurter Nationalgericht Grüne Soße bestellt. Ich wusste erst nicht, was das war und sah Eier in einer dicken, wirklich intensiv grünen Soße mit Kartoffeln auf meinem Teller. Eier und Soße waren kalt. Man klärte uns auf, dass die Grüne Soße aus sieben Kräutern bestand und tatsächlich kalt serviert wurde. Das Essen schmeckte köstlich, und der Apfelwein passte perfekt dazu. Nach dem zweiten Glas war ich davon allerdings beschwipst, und Vater bestellte nur noch süßen Most für mich.
Manche Gäste hatten Sauerkraut bestellt. Davon hatte Mutter immer geschwärmt, aber in England gab es das leider nicht. Das wollte ich in den nächsten Tagen unbedingt probieren, ebenso wie das Bier, das ich auf manchen Tischen sah, obwohl die meisten hier Krüge mit Apfelwein vor sich stehen hatten.
Die Atmosphäre des Steinernen Hauses nahm mich gefangen. Auch hier waren die Wände holzverkleidet und die Tische, Bänke und Stühle waren aus demselben Holz. Die Menschen waren fröhlich und laut. Manche rauchten Pfeife. Da ich den Geruch mochte, atmete ich immer wieder tief ein. Die Bedienungen hatten Schürzen vorgebunden und trugen eng geschnürte Leibchen. Die meisten hatten die Haare zu Zöpfen gebunden.
Ich konnte mich gar nicht sattsehen.
Abends fiel ich erschöpft, aber glücklich ins Bett und schlief sofort ein.
Nachts wachte ich einmal auf und hörte den tiefen, vollen Stundenschlag der Glocke, die vom Dom her bis zu uns herüberklang. Das fand ich so heimelig, dass ich gleich wieder einschlief.
Am nächsten Tag war Vater verabredet und würde die restlichen Bekannten aus England treffen. Er ließ mich ungern allein und schärfte mir ein, mich nur in der Innenstadt umzusehen und keinesfalls in menschenleeren Straßen oder den Außenbezirken aufzuhalten. Mittags wollten wir uns zu einem Essen wieder im Steinernen Haus treffen.
Ich konnte es kaum erwarten, auf Entdeckungstour zu gehen.
Der Römer, das Frankfurter Rathaus, befand sich in der Nähe und war mein erstes Ziel. Ich bewunderte den mittelalterlichen Platz mit dem alten Brunnen und ging dann die wenigen Schritte des Krönungswegs bis zum Dom, in dem der Erzbischof von Mainz die Kaiser gekrönt hatte. Was musste das für ein Pomp gewesen sein? Ich hätte es gerne miterlebt. Ob meine Mutter auch hier entlanggelaufen war?
Der Dom gefiel mir auch gut, aber den Mainzer Dom fand ich viel imposanter.
Um den Dom herum standen lauter kleine Verkaufsstände. Sie wurden Schirne genannt. Dort schlenderte ich herum und kaufte mir an einem der Stände ein paar bunte Haarbänder.
Plötzlich hatte ich das Gefühl, beobachtet zu werden. Da ich hier niemanden kannte, gab ich erst nichts darauf, doch dann drehte ich mich doch um.
In einiger Entfernung stand ein junger Mann, der mich anstarrte. Als ich mich ihm zuwandte, kramte er sofort in den Auslagen der Schirn, vor der er stand, und begann ein Verkaufsgespräch.
Ich war kurz irritiert, aber dann ging ich zum Steinernen Haus, da es bereits Essenszeit war.
Vater nahm mich kaum wahr, er wirkte etwas nachdenklich und konnte sich auch an dem Gespräch mit seinen Geschäftspartnern gar nicht richtig beteiligen.
Am Nachmittag schlenderte ich durch die Altstadt, spielte mit einem kleinen Kind Ball und setzte mich an einen Brunnen, um auszuruhen.
Kurz glaubte ich, den jungen Mann vom Vormittag an einem Haus stehen zu sehen. Als ich genauer hinsah, bog er jedoch schnell um die Ecke. So konnte ich ihn wieder nicht genau ansehen.
Auch jetzt kümmerte ich mich nicht weiter darum. Also beschloss ich noch, an den Main zu gehen und dort ein wenig zu flanieren. Da die Sonne schien und viele Menschen wohl denselben Gedanken gehabt hatten, bestand für mich keine Gefahr, und ich konnte mich nah am Wasser auf eine Bank setzen und nach Sachsenhausen hinüberblicken, dem allerersten Ortskern von Frankfurt. Da, wo ich jetzt auf der Bank saß, war früher ein ausgedehntes Moor gewesen, das erst mit den Jahren mühevoll trockengelegt werden musste.
Die wenigen Tage in Frankfurt gingen viel zu schnell vorbei. Das fand auch Vater und nahm sich vor, auf der Rückreise hier wieder Station zu machen.
Von dem neuen Hauptbahnhof, der etwas außerhalb der Stadt lag, und mir sehr groß vorkam, fuhren wir dann weiter in Richtung Freiburg. Ich hatte auch langsam genug von fahrenden Zügen, Umsteigen und Nächten in schlechten Pensionen.
Meinem Vater schien es auch so zu gehen, obwohl er sich nicht beklagte. Es kam mir nur so vor, als würde er immer schmaler werden. Ich schrieb es den Reisestrapazen zu und sah ihn unter Tante Sabinelottes fürsorglicher Gastfreundschaft wieder aufblühen.
3. Kapitel
Es dämmerte bereits, als wir aus dem Zug ausstiegen.
Der Bahnhof ähnelte all den anderen, auf denen wir gewartet und umgestiegen waren.
Ich dachte an die Worte meiner Mutter: „Wenn du einmal nach Freiburg kommst, musst du zuallererst einen ganz tiefen Atemzug nehmen. Nirgendwo ist bessere Luft als dort. Die kommt vom Schwarzwald her.“ Und sie hatte recht. Es fiel mir sofort auf, sobald wir das Gepäck auf dem Bahnsteig abgestellt hatten.
Ich atmete ein paar Mal ganz tief ein und aus. So gute Luft hatte ich noch nie gerochen. Samtweich.
Mein Vater sah mich erstaunt an. „Was ist mit dir?“
„Na, die Luft. Merkst du das denn nicht? Mutter hat doch immer davon gesprochen!“
Einen Augenblick zögerte er, dann nahm er auch ein paar tiefe Atemzüge. Er lachte laut los. „Du hast recht.“
Ich war so glücklich. Ich sah ihn das erste Mal auf dieser langen Reise befreit lachen. Jetzt würde alles gut werden, und wir würden einen wundervollen Aufenthalt im Geburtsort meiner Mutter haben.
Wie sehr sollte ich mich täuschen!
An die erste Nacht in Freiburg kann ich mich kaum noch richtig erinnern. Es war eine laue Frühlingsnacht, und Vater bestand darauf, sie in einer Pension am Bahnhof zu verbringen, da er Tante Sabinelotte und ihre Familie so spät nicht mehr stören wollte.
Er hatte ihr geschrieben, dass wir kommen würden, hatte aber den Ankunftstag nicht genau bestimmen können, da er nicht gewusst hatte, wie wir bis Freiburg durchkommen würden. Also wartete an diesem Abend auch niemand auf uns.
Nachdem wir gegessen hatten, gingen wir noch ein wenig spazieren, und ich atmete immer wieder tief ein, worüber Vater schmunzeln musste.
Es war seltsam für mich, so am Rande der Stadt zu laufen, aus der meine Mutter kam und in der auch all unsere Vorfahren gelebt hatten. Ob ich wohl auch eher eine Deutsche als eine Engländerin war?
„Wie ist Tante Sabinelotte?“, fragte ich meinen Vater. „Du kennst sie doch.“
Erstaunt sah er mich an. „Nun, es ist viele Jahre her, dass ich sie kennenlernte. Sie ist die ältere Schwester deiner Mutter und hält die Familie zusammen.“
„Und Onkel Hans?“, fragte ich weiter.
„Margarethe, das hast du mich schon so oft gefragt. Er ist still und zurückhaltend, hat aber das Herz am rechten Fleck und tut alles für seine Familie. Auch deine Mutter kam gut mit ihm zurecht. Sabinelotte und er waren ja schon verheiratet, als ich sie kennenlernte.“
Das konnte mein Unbehagen, welches das ich selbst nicht recht verstand, auch nicht vertreiben. „Also ist Tante Sabinelotte der Mittelpunkt der Familie“, sprach ich aus, was ich dachte.
Meinen Vater schienen meine Fragen zu amüsieren. „Du hast ja Angst vor ihr!“
Zweifelnd fragte ich: „Klingt das so?“ Eigentlich hatte ich noch nie vor jemandem Angst gehabt.
Wieder lachte er los, und nach einem kurzen Moment stimmte ich mit ein. Das war doch wirklich zu komisch. Da liefen wir am Rande der Stadt, für die wir diese lange, anstrengende Reise unternommen hatten, und ich bekam Angst vor dem Zusammentreffen mit dem Menschen, der meiner geliebten Mutter am nächsten gestanden hatte, vielleicht sogar noch vor mir.
Wenn Mutter ihr geschrieben hatte, hatte ich ab und zu ein paar Zeilen hinzugefügt, und nach ihrem Tod schrieb ich ihr weiter, und wir trösteten uns gegenseitig. Tja, und jetzt würde ich sie endlich persönlich kennenlernen, und davor hatte ich regelrecht Angst.
„Deine Tante war damals schon rundlich, hatte lustige Löckchen und immer gerötete Backen. Und wenn sie entrüstet ihre Arme in die Hüften stemmte, dann schleuderten ihre Augen Blitze. Jeder respektierte sie, auch deine Mutter.“
Unsicher musste ich fragen: „Ob sie mich wohl mögen wird?“
„Ach, Maggie“, er unterdrückte wieder ein Lachen, „sie liebt dich doch jetzt schon abgöttisch. Du bist die Tochter ihrer einzigen Schwester. Wahrscheinlich könntest du fast alles tun – sie wird dich immer lieben.“
„Und wenn ich sie vielleicht nicht mag?“, fragte ich ihn ganz verzagt.
Er strich mir mit der Hand über meine Haare, so wie er es immer getan hatte, als ich noch ein Kind gewesen war.
„Sie wird für dich der wichtigste Mensch in deinem Leben werden. Hoffentlich aber erst nach mir!“, setzte er noch lachend hinterher. „Man muss sie einfach lieben.“
„Mochte sie dich?“
Erstaunt sah er mich an. Mit dieser Frage hatte er nicht gerechnet. „Na ja, ich habe ihr ihre geliebte Schwester entführt. Sie waren ja vorher ihr ganzes Leben lang zusammen. Außerdem konnte ich kein Deutsch. Deine Mutter musste immer wieder übersetzen. Da war Sabinelotte, glaube ich, schon skeptisch. Ein Ausländer für ihre kleine Prinzessin. Aber ich habe dann doch noch ihr Wohlwollen gewonnen. Sie spürte wohl die tiefe Liebe zwischen deiner Mutter und mir.“
Er schluckte, als er das sagte, und da wurde mir zum ersten Mal bewusst, wie schwer es für ihn sein musste, an den Ort zurückzukehren, an dem er seine geliebte Frau kennengelernt hatte.
Also hakte ich mich bei ihm unter, gab ihm einen verständnisvollen Kuss auf die Wange und bat ihn, mir noch einmal zu erzählen, wie er meine Mutter kennengelernt hatte. Das tat er, denn an die Geschichte dachte er immer wieder gerne zurück.
Mein Vater war damals während einer sogenannten Bildungsreise in Freiburg gelandet.
An einem wunderschönen Sommertag hatte er vor dem Münster der Stadt das schönste Mädchen entdeckt, das er jemals in seinem Leben gesehen hatte.
„Die ganze Zeit über musste ich sie anstarren, bis sie es bemerkte. Sie stand mit ein paar Freundinnen dort am Brunnen. Sie lachten und scherzten.“
Er hatte hin und her überlegt, was er tun sollte. Denn mein Vater war von Natur aus schüchtern und ging nicht einfach so auf Menschen zu. Außerdem sprach er nur englisch.
Aber als sich das schöne Mädchen langsam in Richtung der verwinkelten Gassen bewegt hatte, in denen er sie niemals wiedergefunden hätte, nahm mein introvertierter Vater all seinen Mut zusammen, lief ihr nach und sprach sie einfach an. Natürlich hatte sie nicht viel von dem verstanden, was er ihr auf Englisch sagte, aber irgendwie war der Funke wohl sofort übergesprungen, und von diesem romantischen Moment an haben sie sich niemals wieder getrennt.
Ihm standen Tränen in den Augen, als er es mir erzählte.
Ich machte mir Vorwürfe, weil ich ihn danach gefragt hatte. Ich hätte wissen müssen, wie sehr ihn die Erinnerung daran erschüttern musste. Die beiden hatten sich so geliebt, wie ich es in meinem Leben noch bei keinem anderen Paar gesehen hatte.
Und jetzt bemerkte ich wieder, wie er sich verändert hatte. Auf der Reise hatte ich es auf die Strapazen geschoben, die ja sogar mir zusetzten. Aber an diesem Abend nahm ich etwas an ihm wahr, das mir ein wenig Angst machte. Ob er krank war?
Aber diesen Gedanken schob ich sofort beiseite. Vater war nie krank gewesen und hatte immer eine beneidenswerte Konstitution gehabt. Es musste einfach die Reise gewesen sein, und er würde sich hier schon wieder erholen.
In dieser ersten Nacht träumte ich von meiner Mutter, die ich weinend auf einem Friedhof an einem offenen Grab sah. Ich wachte ängstlich auf und fragte mich, ob das etwas zu bedeuten hatte. Aber ich beschloss, dass es nur ein Traum war und schlief wieder ein.
Am nächsten Tag war ich sehr aufgeregt. Zum Frühstück konnte ich kaum etwas essen, was unsere Pensionswirtin ein wenig verärgerte. Auch Vater hatte keinen Appetit.
Eine Droschke brachte uns zum Haus meiner Tante. Auf der Fahrt sah ich zwar mehr von der Stadt, aber ich war zu abgelenkt, um es zu registrieren.
Wir hielten vor einem kleinen, strohgedeckten Haus, das ich sofort mochte. Es strahlte etwas Anheimelndes aus und lag nicht weit hinter dem mittelalterlichen Martinstor. Ein großer Garten umgab es, der offensichtlich fleißig genutzt wurde. Überall war Gemüse und Obst angebaut. Viele Bäume spendeten Schatten.
Der Droschkenfahrer fuhr wieder weg, wir waren am Ziel unserer langen Reise angekommen und standen mit unseren Koffern vor dem Haus.
Plötzlich hörte ich eine tiefe Frauenstimme: „Friedrich, wo bleibst du denn?“ Da ging auch schon die Tür auf, und eine beleibte Frau in den besten Jahren stand vor uns und sah uns verdutzt an. Sie trug eine adrette Schürze, und ihre lustigen Locken wippten noch von der Bewegung.
Wir sahen uns an, und sie stemmte ihre Arme in die Hüften, um noch lauter: „Nein, da sind sie ja endlich!“, zu schreien.
Schon kam sie auf mich zu mit einer Behändigkeit, die ich ihr nie zugetraut hätte.
„Margarethe, endlich. Ich dachte schon, ihr kommt überhaupt nicht mehr. Kind, lass dich ansehen. Du bist deiner Mutter ja wie aus dem Gesicht geschnitten.“ Wieder und wieder drückte sie mich an sich, während ein paar Freudentränen über ihre rosigen Wangen liefen.
Dann erst sah sie meinen Vater an und begrüßte ihn ebenfalls auf Deutsch. „Robert, wie schön, dich endlich einmal wiederzusehen. Du hast dich ja kaum verändert.“ Auch er wurde mehrfach gedrückt, was er sich lächelnd gefallen ließ.
„Kannst du denn inzwischen ein bisschen besser Deutsch?“, wollte sie wissen.
Mein Vater schien sie zu verstehen und antwortete: „Ein bisschen“, woraufhin Tante Sabinelotte nur mit dem Arm nach unten schlug und schnaubte. „Das kriegen wir schon hin.“
Ich sah an der Fassade des Hauses empor, an der Wein heraufragte. „Was für ein schönes Haus!“
Tante Sabinelotte war geschmeichelt, das sah ich an der leichten Röte, die ihr Gesicht überflog.
Sie packte mich am Arm: „Also, jetzt gehen wir erst einmal rein, ehe wir hier noch Wurzeln schlagen. Gerechnet habe ich mit euch ja schon lange, aber ausgerechnet heute habe ich nicht an euch gedacht.“
Sie sah sich um und murmelte vor sich hin: „Wo ist denn nur der Bengel? Na, der kann was erleben, wenn ich ihn erwische.“
Am Ende eines kleinen Flurs betraten wir die gemütlichste Küche, in der ich jemals gewesen bin. Der Mittelpunkt war ein großer Ofen mit einem Wassertank.
Tante Sabinelotte drückte mich auf einen Stuhl an dem großen Tisch. Meinen Vater schob sie liebevoll auf den Stuhl an meiner Seite. Sie machte sich daran, Kaffee zu kochen, redete dabei aber ununterbrochen weiter. Immer wieder drehte sie sich zu mir herum, musterte mich und lachte.
Wie Vater es prophezeit hatte, mochte ich die Schwester meiner Mutter auf Anhieb. Sie war eine von den starken Frauen, die im Mittelpunkt einer Familie stehen und deren guter Geist sind. Alles drehte sich um sie, sie werden abgöttisch geliebt und geben allen Halt mit ihrer Kraft. Ich fühlte mich vom ersten Augenblick an von ihr in die Familie aufgenommen.
Als der Kaffee fertig war, setzte sie sich mir gegenüber an den Tisch und stellte mir eine Frage nach der anderen.
Plötzlich fuhr ich zusammen. Ein durchdringendes Flöten in rhythmischen Tönen hatte unser Gespräch unterbrochen. Entgeistert sah ich in die Richtung, aus der es kam – und zum ersten Mal in meinem Leben sah ich eine Schwarzwälder Kuckucksuhr. Der Vogel kam so oft heraus, wie viele Stunden die Uhr schlug. Jedes Mal schrie er.
Erst fing mein Vater an zu lachen und dann auch Tante Sabinelotte.
„Kind, daran wirst du dich gewöhnen müssen. Wir sind hier im Schwarzwald.“
Da kam ein blonder junger Mann herein, vielleicht ein, zwei Jahre jünger als ich, und sah uns entgeistert an.
„Friedrich, endlich sind sie angekommen. Darf ich vorstellen, dein Onkel Robert und deine Cousine Margarethe.“
Jetzt erst bemerkte ich, dass sie meinen Namen von Anfang an deutsch aussprach. Margarethe, nicht Margret. Das fand ich rührend.
Friedrich sah uns noch immer mit offenem Mund an, gab uns dann beiden die Hand und begrüßte uns.
Ich mochte ihn gleich. Er schien zwar ein wenig schüchtern zu sein, aber er wirkte sehr sympathisch. Sicherlich sahen die Mädchen schon hinter ihm her, so hübsch war er.
Er blieb einfach am alten Küchenschrank stehen, während meine Tante mich weiter ausfragte.
„Du meine Güte“, entfuhr es ihr auf einmal. „Was bin ich doch unhöflich! Da rede ich hier wie ein Wasserfall, und ihr habt gerade erst die lange Reise hinter euch. Friedrich, bring sie rüber in die Einliegerwohnung, und denk an das Gepäck. Ich werde mich um das Mittagessen kümmern. Endlich zwei Esser mehr am Tisch.“ Sie stand auf, rückte resolut ihre Schürze zurecht und ging Richtung Speisekammer.
Wir erhoben uns und folgten Friedrich, der nun lachte. „Na, dann kommt mal mit.“
Als wir aus dem Hinterausgang gingen, sah ich gleich, was mit „Einliegerwohnung“ gemeint war. Es handelte sich um einen Anbau am Haus mit kleinen Fenstern, die zum Garten hinausgingen. Auch hier war das Dach strohgedeckt.
„Da hat Großmutter bis zu ihrem Tod im letzten Jahr gewohnt“, erklärte uns Friedrich.
Ich fühlte mich sofort heimisch. Es war nur klein, mit einem größeren und einem kleineren Zimmer sowie einer Küche, die natürlich nichts war im Vergleich zu der großen Wohnküche meiner Tante. Aber für unsere Bedürfnisse war es genau richtig. Das schien auch mein Vater so zu sehen, der mit seinen Koffern gleich in das größere Zimmer lief und dort das Bett ausprobierte.
Friedrich brachte meine Sachen in das kleinere Zimmer, als sei das von vornherein selbstverständlich so.
Vor den beiden Fenstern wuchs der Efeu, und ich sah auf den riesengroßen Garten mit all den vielen Obstbäumen, unter denen Bänke zum Verweilen standen. Hühner scharrten in aller Gemütsruhe im Gras. Hier würde ich mich wohlfühlen, das wusste ich.
„Vater kommt zum Mittagessen. Da könnt ihr ihn dann auch kennenlernen. Wann Luise kommt, weiß ich nicht. Die ist bei Tante Anna. Ich hol euch dann zum Essen wieder ab.“
Vater hatte sich auf das Bett gelegt und lachte mich an. „Na, hattest du sie dir so vorgestellt?“
Einen Moment musste ich nachdenken. „Eigentlich nicht. Sie ist so anders als Mutter. Aber Geschwister sind ja oft sehr unterschiedlich.“
„Da hast du recht. Sie ist nun einmal die Ältere und will alles bestimmen. Das war schon damals so. Deine Mutter hat sie abgöttisch geliebt, und es ist ihr sehr schwergefallen, sie zu verlassen. Da sind viele Tränen geflossen.“
Sein Blick ging in die Vergangenheit, und er schien mich plötzlich vergessen zu haben.
Also besah ich mir die kleine Küche, in der es sogar fließendes Wasser gab. Mit dem alten Küchenherd würde ich schon klarkommen. Was wir so brauchen würden, war vorhanden, und die meiste Zeit über wären wir ja sowieso im Haupthaus. Das würde meine Tante ganz bestimmt nicht anders dulden.
Ich ging hinaus in den Garten. Es war ein wunderschöner Frühlingstag. Die Sonne wärmte schon, und so setzte ich mich auf eine Bank und ließ sie mir ins Gesicht scheinen.
Wie sehr hatte ich mir dieses Zusammentreffen immer gewünscht! Wie oft hatte meine Mutter davon gesprochen! Und jetzt saß ich hier, und alles war schön.
Was würde mir die Zeit hier bringen?
Bei diesem Gedanken lief mir ein leichter Schauder über den Rücken, der mich ein wenig erschreckte und den ich auch nicht verstand.
Heute weiß ich, dass es eine Vorahnung war.
Beim Mittagessen lernte ich Onkel Hans kennen. Er betrieb eine Schmiede in der Stadt, in der er sich meistenteils aufhielt. Aber zum Essen kam er immer nach Hause. Das war ihm wichtig.
Ein großer, breitschultriger Mann sah mich offen lachend an und begrüßte mich: „Entschuldige, Margarethe, ich komme aus der Schmiede und bin nicht ganz sauber. Aber die Hände sind frisch gewaschen, darauf besteht deine Tante!“
Aus den Augenwinkeln sah ich, dass Tante Sabinelotte die Augen verdrehte.
Auch die Begrüßung mit meinem Vater fiel herzlich aus. Offenbar mochten sich die beiden Männer, auch wenn sie sich nicht richtig verständigen konnten. Vater setzte sich gleich neben ihn, so als wäre das schon immer sein Platz am Tisch gewesen.
Ich saß neben meiner Tante, die dann auch wieder den größten Teil des Gesprächs ganz selbstverständlich übernahm.
Immer wieder legte sie mir nach, bis ich vor lauter Lachen nicht mehr weiteressen konnte.