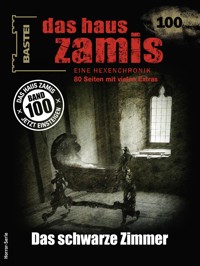
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Das Schmuckstück glühte in der Finsternis. Winzige Flammen tanzten darüber hinweg, verbrannten den Bernstein und erloschen. Eine Explosion ließ den Boden erbeben. Staub rieselte von der Decke. Dann kehrte Ruhe ein. Der deutsche Angriff hatte geendet. Für dieses Mal. Aber der nächste würde kommen, das stand fest.
»Was ist das?«, hauchte Wassili. Den Blick hielt er starr auf das brennende Medaillon gerichtet.
»Das Zeichen, das meine Vorväter so gefürchtet haben. Von dem sie gehofft haben, dass sie es nie empfangen würden.«
»Ich verstehe nicht. Was für ein Zeichen?«
»Das Zeichen, dass das Schwarze Zimmer geöffnet wurde ...«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 162
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhalt
Cover
Was bisher geschah
DER RACHEENGEL
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
mystery-press
Vorschau
Impressum
Coco Zamis ist das jüngste von insgesamt sieben Kindern der Eltern Michael und Thekla Zamis, die in einer Villa im mondänen Wiener Stadtteil Hietzing leben. Schon früh spürt Coco, dass dem Einfluss und der hohen gesellschaftlichen Stellung ihrer Familie ein dunkles Geheimnis zugrundeliegt. Die Zamis sind Teil der Schwarzen Familie, eines Zusammenschlusses von Vampiren, Werwölfen, Ghoulen und anderen unheimlichen Geschöpfen, die zumeist in Tarngestalt unter den Menschen leben. Die grausamen Rituale der Dämonen verabscheuend, versucht Coco den Menschen, die in die Fänge der Schwarzen Familie geraten, zu helfen. Ihr Vater sieht mit Entsetzen, wie sie den Ruf der Zamis-Sippe zu ruinieren droht. So lernt sie während der Ausbildung auf dem Schloss ihres Patenonkels ihre erste große Liebe Rupert Schwinger kennen. Auf einem Sabbat soll Coco zur echten Hexe geweiht werden. Asmodi, das Oberhaupt der Schwarzen Familie der Dämonen, hält um Cocos Hand an, doch sie lehnt ab. Asmodi kocht vor Wut und verwandelt Rupert Schwinger in ein Ungeheuer.
Seitdem lässt das Oberhaupt keine Gelegenheit aus, gegen die Zamis-Sippe zu intrigieren. Michael Zamis sucht indes Verbündete unter den Oppositionsdämonen, die sich Asmodis Sturz auf die Fahnen geschrieben haben. Sein Unternehmen scheitert, und er wird von Asmodi zur Strafe in eine krötenartige Kreatur verwandelt. Während eines Schwarzen Sabbats wird Asmodi von Thekla Zamis vorgeführt. Aus Angst vor seiner Rache flüchten die Zamis vorübergehend aus Wien, kehren schließlich jedoch dorthin zurück. Asmodi erlöst Michael Zamis von seinem Freak-Dasein. Im Gegenzug soll Coco Asmodis missratenen Sohn Dorian Hunter töten. Es gelingt Coco, Dorian zu becircen – doch anstatt den Auftrag sofort auszuführen, verliebt sie sich in ihn. Zur Strafe verwandelt Asmodi Dorian Hunter in einen seelenlosen Zombie, der fortan als Hüter des Hauses in der Villa Zamis sein Dasein fristet.
In Wien übernimmt Coco ein geheimnisvolles Café. Sie beschließt, es als neutralen Ort zu etablieren, in dem Menschen und Dämonen gleichermaßen einkehren. Zugleich stellt Coco fest, dass sie von Dorian Hunter schwanger ist. Bald erhält das Café Zamis Besuch von Osiris' Todesboten. Sie überbringen die Nachricht, dass Coco innerhalb einer Woche sterben wird. Ebenso erhalten ihr Vater Michael und Skarabäus Toth die Drohung. Alle drei bitten Asmodi um Hilfe, müssen dafür jedoch das für sie jeweils Wertvollste als Pfand hinterlegen. So wird Coco ihr ungeborenes Kind entrissen. Mit Hilfe ihres Bruders Volkart gelingt es Coco, die Todesboten zu besiegen. Doch Asmodi gibt das Kind zunächst nicht wieder her. Erst soll Coco noch eine weitere Aufgabe für ihn erledigen. In seinem Auftrag reist sie nach Moskau, zusammen mit dem zwielichtigen Dämon Helmut von Bergen. Coco trifft dort auf Theodotos Wolkow, einen dämonischen Oligarchen, der in Besitz des Schwarzen Zimmers sein soll, und wird von ihm gefangen gesetzt.
DER RACHEENGEL
von Oliver Fröhlich
Leningrad, Oktober 1941
Arkadi Pawlowitsch Bobrow floh vor dem Tod, aber er fürchtete, der Tod würde ihn einholen. Vielleicht nicht heute oder morgen, aber bald. In dem Inferno aus Spreng- oder Brandbomben, Artilleriefeuer und Hunger holte er jeden irgendwann ein.
Er wusste nicht, warum er rannte. Oder wohin. Er gehorchte lediglich einem Reflex, der ihm angesichts der einstürzenden Mauern, brennenden Häuser, aufspritzenden Erdbrocken und allgegenwärtigen Angst- und Todesschreie diktierte, die Beine in die Hand zu nehmen und zu rennen, was das Zeug hielt.
Seine Füße patschten durch den Matsch der aufgerissenen Straßen. Ein ohrenbetäubender Knall erklang links von ihm. Eine Schuttwolke hüllte ihn ein. Steinsplitter trafen sein Gesicht und hinterließen blutige Furchen.
Arkadi hustete, atmete dabei aber nur umso mehr der winzigen Teilchen ein. Seine Augen brannten und tränten. Ein paar Meter schräg vor ihm humpelte eine alte Frau mit einem zerschlissenen Mantel und schmutzigen Kopftuch.
1. Kapitel
Im Arm hielt sie ein kleines Kind, höchstens ein halbes Jahr alt. Es plärrte wie am Spieß, so laut, dass Arkadi es im allgegenwärtigen Chaos hörte.
Die Alte war bestimmt die Babuschka des Kinds. Lebten die Eltern schon nicht mehr? Waren sie den Angriffen der Deutschen zum Opfer gefallen, die seit September die Stadt erschütterten?
»Was macht ihr?«, schrie er über die Detonationen hinweg. »Seht zu, dass ihr in den nächsten Bunker kommt!«
Die Frau hörte ihn nicht. Wie konnte das sein, wo das Weinen des Kindes doch so überdeutlich an seine Ohren drang? Lag es an der Panik der Alten? Oder war sie taub?
»Halt!«, versuchte er es noch einmal. »Ihr rennt in die falsche Richtung!«
Genau wie ich.
Die Erkenntnis traf ihn so unvermittelt, dass er für einen Augenblick ins Stolpern geriet. Natürlich! Seine Flucht war keineswegs ziellos und instinktgesteuert, wie er zunächst geglaubt hatte. Es war ein uraltes Erbe, das ihn in diese Richtung trieb. Vorbei an der brennenden Schule und der Bäckerei, in der täglich die jämmerliche Brotration verteilt wurde. Hin zu seinem Elternhaus und der Truhe mit dem abgegriffenen Schmuckstück.
Arkadi Pawlowitsch Bobrow hatte den Drang nur deshalb nicht erkannt, weil er ihn noch nie gespürt hatte. Genauso wenig wie sein Vater oder Großvater oder dessen Vater vor ihm. Sein Vater hatte ihm nur davon erzählt, dass der Augenblick eines Tages kommen könnte.
Aber warum heute? Wieso ausgerechnet in der schwersten Zeit, die das einstige Sankt Petersburg durchmachte?
Ihm wurde noch etwas anderes klar: Der Tod durfte ihn nicht einholen. Er trug eine schwere Verantwortung, der er gerecht werden musste. Im Andenken an seine Vorväter durfte er nicht versagen, durfte nicht sterben.
Eine weitere Explosion riss ihn aus den Gedanken. Er stellte fest, dass er stehen geblieben war. Mitten auf der Straße. Die Babuschka mit ihrem Enkelkind war verschwunden. Vielleicht in eine Nebengasse abgebogen. Oder sie hatte ein Versteck gefunden.
Wieder ein Knall. Diesmal vor ihm. Er duckte sich weg, doch da explodierte auch hinter ihm etwas.
Die Druckwelle erfasste ihn, riss ihn von den Beinen und schleuderte ihn durch die Luft. Bäuchlings stürzte er in den Matsch. Wasser spritzte auf. Er schmeckte den brackigen Schlamm, der ihm in Mund und Nase drang, spürte das Knirschen der Steinchen zwischen den Zähnen.
Mühsam drehte er sich um – und sah die Leichen der alten Frau und des Kindes. Oder das, was eine Granate von ihnen übrig gelassen hatte.
Zorn kochte in Arkadi hoch. Zorn und Hass auf das verfluchte Nazi-Pack, das nicht einmal vor Säuglingen haltmachte.
Er spürte ein widerliches Ziehen in der linken Schulter. Sein Arm hing herab wie ein Fremdkörper. Dennoch stemmte er sich hoch.
Da sah er in einem Kellerfenster einen schmutzigen alten Mann, der ihm zuwinkte. »Hierher!«
Arkadi zögerte. Noch immer spürte er den Drang, zum Haus seiner Eltern zu laufen und die alte Brosche zu holen, die so wichtig für ihn war, aber die Vernunft diktierte ihm, sich im Keller zu verkriechen. Wenn der Angriff endete und er dann noch lebte, blieb ihm genügend Zeit.
Ein letztes Mal sah er auf die Leichen hinab und torkelte dem Gebäude entgegen, aus dem der Alte winkte. Arkadi kroch halb durch das Fenster, schrie auf, als er sich auf die wahrscheinlich gebrochene Schulter stützte und wegknickte, fühlte, wie er drohte, das Bewusstsein zu verlieren, spürte die Hände des Mannes an den Armen und unter der Achsel. Er wollte ihm noch zurufen, vorsichtig zu sein, da packte der Alte auch schon zu und zog ihn zu sich heran.
Arkadi schrie auf, dann versank er in einem Meer aus Schmerz.
Als er wieder zu sich kam, glaubte er, seine linke Körperhälfte stehe in Flammen. Über ihn beugte sich ein furchiges, eingefallenes Gesicht mit einer Geiernase. »Alles in Ordnung?«
»Geht so«, presste Arkadi hervor. »Wie lange war ich ... war ich ...?«
»Nur ein paar Sekunden. Ich heiße Wassili.«
Eine Granate schlug in der Nähe des Kellers ein, und eine Staubwolke stob durch das Fenster. Instinktiv zog Arkadi den Kopf ein.
»Keine Sorge«, sagte Wassili. »Hier sind wir so sicher, wie man zurzeit nur sein kann. Wenn eine Bombe nicht gerade das Haus trifft, kann uns nichts passieren.«
Der Staub legte sich, und Arkadi spähte aus dem Keller. Dort, wo er vor wenigen Minuten noch hatte hinlaufen wollen, hatte eine Granate einen Krater in die Straße gesprengt. Er wandte sich dem alten Mann zu. »Danke.«
»Wofür?« Wassili zündete eine Laterne an. Der Schein erhellte ein feuchtes Kellerloch, und Arkadi sah an der gegenüberliegenden Wand einen Jungen und ein Mädchen, beide höchstens sechs Jahre alt, die sich umklammerten. Die Tränen zeichneten helle Streifen in die dreckverschmierten Gesichter. In einer Hand hinter dem Rücken des Jungen hielt das Mädchen eine Stoffpuppe, der der Kopf fehlte. Sie saßen auf einer schmalen Holzbank, die in einer Pfütze neben dem Skelett eines Kinderwagens stand. »Dafür, dass ich dich vor dem Tod bewahrt habe und du stattdessen weiter in der Hölle aushalten musst? Wenn unser Peter wüsste, wie die Deutschen die Stadt schänden, der er seinen Namen gegeben hat, würde sein Geist wiederkehren und den Belagerungsring der Nazis sprengen. Das kannst du mir glauben.«
»Peter der Große hat Sankt Petersburg nicht nach sich selbst benannt«, antwortete Arkadi automatisch. »Sondern nach seinem Schutzheiligen, dem Apostel Simon Petrus.«
Wassili musterte ihn. »Ach ja? Woher weißt du das?«
»Von meinem Vater.« Und der weiß es von seinem Vater und der wiederum von seinem. Und der Erste in der Reihe weiß es von Peter selbst, dachte Arkadi, sagte es aber nicht. Das hätte nur weitere Fragen nach sich gezogen.
»Scheint ein schlauer Kopf zu sein, dein Vater.«
»Das war er. Er ist tot.« Er rechnete damit, dass Wassili nun etwas sagen würde wie: »Tut mir leid.« Aber offenbar hatte ihn das Sterben, das überall auf der Welt Einzug gehalten hatte, so sehr abgebrüht, dass er sich eine derartige Floskel ersparte. Arkadi war dankbar dafür.
»Bei einem der Angriffe gefallen?«, fragte Wassili stattdessen.
»Lungenentzündung.« Arkadi lachte auf. Erneut flammte der Schmerz in der Schulter auf. »Da hat er den Großen Krieg überlebt, einen Giftgasangriff überstanden, ist bei einer Explosion mit harmlosen Verletzungen davongekommen, nur um 1920 an etwas zu sterben, das mit dem Krieg nichts zu tun hat. Was für ein Witz.«
»Das ist hart. Du kannst damals noch nicht sehr alt gewesen sein.«
»Zehn Jahre.« Alt genug, ihm auf dem Totenbett das Versprechen zu geben, die Aufgabe der Familie Bobrow weiterzuführen und sie, wenn die Zeit gekommen war, an seine eigenen Kinder weiterzuvererben. Nur dass er keine Kinder hatte. Und so wie es aussah, würde er auch nie welche in die Welt setzen.
Instinktiv fasste er mit der rechten Hand unter Jacke und Hemd zu dem Bernsteinmedaillon, das er um den Hals trug. Ein kleiner, in einen Kreis eingefasster Schlüssel. Das Emblem seiner Familie seit der Zeit Peters des Großen. Neben der Brosche, die im Haus seiner Eltern in einer Truhe lag, das einzige Erbstück, das Pawlow Iwanowitsch Bobrow seinem Sohn vermacht hatte.
Arkadi umschloss das Medaillon mit den Fingern und zog sie sofort wieder zurück. Es war glühend heiß. Das brennende Gefühl in der Schulter stammte nicht von dem Bruch, den er sich bei dem Sturz zugezogen hatte, sondern von dem Schmuckstück.
»O nein!« Deshalb also der plötzliche Drang, nach Hause zurückzukehren und die Brosche zu holen. So schnell es ihm mit einer Hand möglich war, öffnete er die restlichen Knöpfe der Jacke, fetzte das Hemd auf und riss sich die Kette vom Hals. Er spürte einen kurzen Ruck im Nacken, das Einschneiden der Kettenglieder, das der Sinfonie aus Schmerzen in seinem Körper aber kaum neue Töne hinzufügte. Dann schleuderte er das Medaillon in ein dunkles Eck des Kellers.
»Nein, nein, nein«, rief er immer wieder. »Nicht auch das noch.«
Das Schmuckstück glühte in der Finsternis. Winzige Flammen tanzten darüber hinweg, verbrannten den Bernstein und erloschen.
Eine Explosion ließ den Boden erbeben. Staub rieselte von der Decke. Dann kehrte Ruhe ein. Der deutsche Angriff hatte geendet. Für dieses Mal. Aber der nächste würde kommen, das stand fest.
»Was ist das?«, hauchte Wassili. Den Blick hielt er starr auf das brennende Medaillon gerichtet.
»Das Zeichen, das meine Vorväter so gefürchtet haben. Von dem sie gehofft haben, dass sie es nie empfangen würden.«
»Ich verstehe nicht. Was für ein Zeichen?«
»Das Zeichen, dass das Schwarze Zimmer geöffnet wurde.«
2. Kapitel
Wien (Gegenwart), Georg
»Wir werden einen Sabbat ausrichten, der den Sippen von Wien zeigt, dass die Zamis-Familie stark wie eh und je, nein: noch stärker als jemals zuvor ist«, verkündete Michael Zamis. »Selbst den Todesboten ist es nicht gelungen, uns zu vernichten.«
Er warf eine Handvoll Pulver in die Schale auf dem Tisch, und eine Stichflamme zuckte auf. Ein Geruch nach Schwefel durchzog den Raum. Der Duft der Macht. Das Sippenoberhaupt atmete die gelblichen Schwaden ein, stöhnte genüsslich auf und ließ sich in seinen Stuhl zurücksinken.
Ich saß meinem Vater gegenüber und schnüffelte ebenfalls. Sofort spürte ich die belebende Wirkung des Schwarzwurzelrauchs. Trotzdem fühlte ich mich nicht so selbstbewusst wie mein Vater. Oder sollte ich sagen: selbstherrlich? Das Oberhaupt unserer Familie schien die Situation zu überschätzen. Natürlich, er war den Todesboten entkommen, doch der eigentliche Sieger des Spiels hieß eindeutig Asmodi.
Sowohl Skarabäus Toth als auch mein Vater hatten ihre Pfänder zurückerhalten. Der Schiedsrichter der Schwarzen Familie seine Maske als unerbittlicher alter Mann, der Patriarch unserer Sippe seine Ehefrau Thekla. Doch das Pfand meiner Schwester Coco hatte er einbehalten: ihr ungeborenes Kind. Er hatte ihr zwar eine Chance eingeräumt, ihr Balg wiederzubekommen, wie er sich ausgedrückt hatte, doch dafür musste sie ihm ein paar Gefälligkeiten erweisen. Ich war mir nicht sicher, aber ich wurde den Verdacht nicht los, dass es ihm von Anfang an um nichts anderes gegangen war.
Ich sah zu Mutter, die regungslos mit uns am Tisch saß und in die Ferne starrte. Die Hände lagen gefaltet auf der Tischplatte, als – was für ein absurder Gedanke! – würde sie beten. Die Erinnerung an ihre Rückkehr vor einigen Wochen stand plötzlich wieder vor meinen Augen.
Wie Asmodi es angekündigt hat, klingelt es nur Sekunden, nachdem der Herr der Schwarzen Familie unser Haus verlassen hat, an der Tür. Vater und ich öffnen. Vor der Tür steht sie, Thekla Zamis, mit hängenden Schultern, hängenden Armen, gesenktem Kopf und zerzaustem Haar.
»Komm herein«, sagt Vater.
Sie reagiert nicht.
Zuerst glaube ich, sie widersetzt sich ihm, weil er sie Asmodi als Pfand überlassen hat. Doch dann bemerke ich, dass etwas nicht mit ihr stimmt. Ich lege ihr die Hand unter das Kinn und hebe ihren Kopf an.
Ihr Blick ist leer und geht geradewegs durch mich hindurch. Wie bei einer Untoten.
»Mutter?«, frage ich.
Ihre Lippen zittern, als wolle sie etwas sagen, doch wenn sie das wirklich will, gelingt es ihr nicht.
Ich ziehe die Hand weg, und ihr Kopf sinkt herab. Ich frage mich, wie sie es geschafft hat, an der Tür zu klingeln. Vielleicht hat Asmodi es für sie getan, bevor er verschwunden ist.
Vater nimmt sie bei der Hand. Ohne Widerstand folgt sie ihm in die Richtung, in die er sie zieht. »Was ist geschehen?«, fragt er, erhält aber keine Antwort.
Mutter spricht nicht mehr ...
... und hatte es seitdem nicht wieder getan.
Wir wussten nicht, wo sie die Zeit ihrer Pfandschaft verbracht hatte oder was ihr dort widerfahren war. Nach und nach besserte sich ihr Zustand zwar, häufig reagierte sie sogar auf Ansprache, aber ob sie sich jemals vollständig erholte, stand in den Sternen.
»Sollten wir mit einem Sabbat nicht noch warten?«, fragte ich. »Sieh dir Mutter an, sie ...«
»Ach was!«, fuhr Vater mich an. »Sie wird schon wieder. Notfalls braucht sie sich ja nicht sehen zu lassen. Muss ich dich darauf hinweisen, dass ich das Familienoberhaupt bin, Georg? Dass ich es bin, der die Entscheidungen trifft?«
»Nein, natürlich nicht. Aber was ist mit ... ihnen?«
Mit einer Kopfbewegung deutete ich auf den Sessel an der Wand, in dem mein Bruder Volkart saß. Oder besser, der Körper meines Bruders Volkart. Seit einiger Zeit wohnte darin nicht nur seine schwarze Seele, sondern auch die seines Zwillingsbruders Demian. Zuerst hatten wir befürchtet, Demians Rückkehr aus dem Totenreich habe zugleich Volkart aus seinem Leib befördert, aber das hatte sich glücklicherweise als Irrtum erwiesen. Andererseits waren in einem einzigen Körper gefangene Brüder auch nicht gerade das Unanstrengendste, was man sich vorstellen konnte.
»Was soll mit ihnen sein?«, fragte Vater zurück.
Ich zuckte mit den Schultern, beobachtete die einleiblichen Zwillinge und schwieg. Der Anblick sprach für sich selbst.
»Sieh doch, dort ist wieder einer«, flüsterte Demian. Zumindest vermutete ich, dass es Demian war, denn schließlich war er derjenige, der eine reichlich unnütze Fähigkeit aus dem Totenreich mitgebracht hatte.
Volkart/Demian schaute angestrengt zur Tür. Er zog die Brauen zusammen, sodass sie sich über der Nasenwurzel fast berührten.
»Ich sehe nichts«, sagte er.
»Wie kannst du durch die gleichen Augen schauen und doch nichts erkennen?«, fragte er nur einen Moment später. »Da steht er doch. Ist das einer der toten Winkler-Forcas?«
Volkarts Stimme änderte sich zu einem Jammern: »Wo denn? Sag mir, wo du ihn siehst.«
In tieferer Stimmlage: »Dort neben der Tür. Sein Hals ist aufgeschlitzt. Ach je, er blutet den ganzen Teppich voll.«
Instinktiv blickte ich zur Tür, aber wie Volkart entdeckte ich nichts. Weder einen toten Winkler-Forcas noch sonst eine Leiche oder auch nur das Blut auf dem Boden.
»Nein, doch kein Winkler-Forcas«, sagte Demian. »Ich kann ihn nur schlecht verstehen, weil er beim Sprechen so blubbert.«
»Was sagt er denn?«, fragte Volkart aus dem gleichen Mund.
»Ich bin mir nicht sicher. Irgendwas von seiner Frau, dass sie eine ganz Scharfe war, oder so.«
»Warum glaubt er, dass dich das interessiert?«
»Keine Ahnung. Hör nur, er ist ein Mensch, kein Dämon.«
»Ich höre doch nichts!«
»Ja, ja, ich weiß.« Er lachte auf. »Jetzt versteh ich! Nicht seine Frau war scharf, sondern das Messer, mit dem sie ihn umgebracht hat.«
»Eine Frau nach meinem Geschmack. Sie hätte ihm auch noch die Zunge abschneiden sollen, damit er uns in Ruhe lässt. Was will er von uns ... von dir?«
Als Mitglieder der Schwarzen Familie hatten wir schon viel erlebt, aber selbst auf mich wirkte es gespenstisch, wenn Demian und Volkart sich unterhielten.
»Was willst du?«, brüllte einer der beiden plötzlich, vermutlich Demian. Sekunden vergingen, dann kicherte er. »Das kann nicht dein Ernst sein! Du wendest dich an mich, um einen Mord unter Menschen aufzuklären?«
Das Kichern kippte ins Hysterische. Dann wedelte er mit der Hand.
»Lasst mich in Zukunft mit diesem Blödsinn in Ruhe! Eure Geschichten scheren mich ... – Was wollen sie denn, Demian? – Misch dich nicht ein, Bruderherz, wenn ich ein paar Sachen klarstellen muss. Also, wenn euch etwas nicht passt, könnt ihr immer noch spuken oder ... – So lass ich mich von dir nicht behandeln. Das ist auch mein Körper! – Jetzt hab dich nicht so. Wir unterhalten uns später. – Was soll das heißen, hab dich nicht so? Du hast es mir zu verdanken, dass du wieder da bist. Da habe ich wohl ein wenig mehr Respekt ... – Ich habe nicht darum gebeten, mit dir einen Körper zu teilen. – Ich auch nicht. Und es ist mein Körper, den wir uns teilen. Benimm dich nicht, als wäre ich nur Untermieter in einem ... – Du hast leicht reden. Dich nerven auch nicht andauernd irgendwelche Geistwesen aus dem Jenseits, die dir ihr Herz ausschütten. – Dafür nervst du mich, wenn du mit ihnen sprichst. – Und dabei sind die wenigsten Dämonen! Kannst du dir das vorstellen?«
Ich wandte mich ab und sah wieder meinen Vater an. »Willst du sie auch einsperren bei deinem großen Sabbat?«
»Wenn es sein muss.«
»Und Coco ...«





























