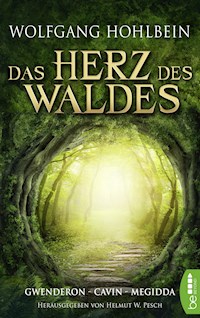
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beBEYOND
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
EIN HEILIGER ORT - EIN FINSTERER HERRSCHER - EINE WELT IM STERBEN:
Eine magische Insel des Friedens in einer Welt der Gewalt - das ist der Schwarzeichenwald. Ein heiliger Ort, der unter dem Schutz von König Oro von Hochwalden steht.
Doch als eines Tages ein Gesandter des machthungrigen Schattenmagiers Lassar am Hofe Oros erscheint, brechen gefährliche Zeiten an: Der finstere Herrscher will das Holz des Schwarzeichenwaldes schlagen, um damit Schiffe zu bauen und die Welt mit Krieg zu überziehen.
König Oro lehnt sein Ansinnen entrüstet ab. Aber Lassar ist niemand, dem man eine Bitte abschlägt. Und so spinnt der dunkle Fürst ein Netz aus Blut und Verrat, das bis tief in das Herz des Waldes reicht.
Können die Helden Hochwaldens die Katastrophe noch abwenden und ihre Heimat, den magischen Schwarzeichenwald, retten?
DAS HERZ DES WALDES: GWENDERON - CAVIN - MEGIDDA: Düstere Schwert und Magie-Fantasy aus der Feder von Wolfgang Hohlbein. Ein Höhepunkt der klassischen deutschen Fantasy, mit einem Vorwort von Helmut W. Pesch.
Digitale Neuausgabe der Trilogie ›Der Waldkönig‹, ›Der Sohn des Waldkönigs‹ und ›Das Erbe des Waldkönigs‹.
eBooks von beBEYOND - fremde Welten und fantastische Reisen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 417
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über dieses Buch
Über den Autor
Titel
Impressum
Vorwort
Der Waldkönig – Band 1: Gwenderon
Der Waldkönig – Band 2: Cavin
Der Waldkönig – Band 3: Megidda
Über dieses Buch
Eine magische Insel des Friedens in einer Welt der Gewalt – das ist der Schwarzeichenwald. Ein heiliger Ort, der unter dem Schutz von König Oro von Hochwalden steht.
Doch als eines Tages ein Gesandter des machthungrigen Schattenmagiers Lassar am Hofe Oros erscheint, brechen gefährliche Zeiten an: Der finstere Herrscher will das Holz des Schwarzeichenwaldes schlagen, um damit Schiffe zu bauen und die Welt mit Krieg zu überziehen.
König Oro lehnt sein Ansinnen entrüstet ab. Aber Lassar ist niemand, dem man eine Bitte abschlägt. Und so spinnt der dunkle Fürst ein Netz aus Blut und Verrat, das bis tief in das Herz des Waldes reicht.
Können die Helden Hochwaldens die Katastrophe noch abwenden und ihre Heimat, den magischen Schwarzeichenwald, retten?
Über den Autor
Wolfgang Hohlbein ist am 15. August 1953 in Weimar geboren und lebt mit seiner Frau Heike und seinen sechs Kindern, umgeben von einer Schar Katzen, Hunde und anderer Haustiere, in der Nähe von Neuss.
Seine Gesamtauflage lag 2006 bereits bei 35 Millionen Exemplaren. Damit ist er einer der erfolgreichsten deutschen Autoren der Gegenwart. Er wurde bislang in 34 Sprachen übersetzt und erhielt zahlreiche Preise und Auszeichnungen.
Wolfgang Hohlbein
DAS HERZDES WALDES
Gwenderon – Cavin – Megidda
beBEYOND
Aktualisierte digitale Neuausgabe der beim Bastei Verlag erschienenen Werke »Der Waldkönig«, »Der Sohn des Waldkönigs« und »Das Erbe des Waldkönigs«
»be« – Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Für die Originalausgaben:
Copyright © 1985 by Bastei Lübbe AG, Köln
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2017 by Bastei Lübbe AG, Köln
Umschlaggestaltung: Thomas Krämer unter Verwendung eines Motives © shutterstock: Elena Schweitzer
eBook-Erstellung: Urban SatzKonzept, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-4646-6
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Vorwort
Fantasy – das war Anfang der Achtzigerjahre für viele noch ein Fremdwort. Science-Fiction dominierte die fantastische Literatur, und die aufkommende Welle von Romanen mit Kriegern und Magiern in fantastischen Welten wurde eher als störend angesehen. ›Richtige‹ SF-Leser fanden so was unseriös. Aber diese Romane und Geschichten waren der Anfang einer Strömung, die im einundzwanzigsten Jahrhundert die gesamte Unterhaltungsliteratur infiltrieren und zu einem ganzen Bündel von Genres werden sollte: Harry Potter, Urban Fantasy, ›Völker-Romane‹ über Elfen, Zwerge und Orks im Sog der Herr-der-Ringe-Verfilmung, Romantasy, Zombie- und Engel-Romane. Selbst die sogenannte Hochliteratur wurde von diesem Virus infiziert, und es schien zeitweise, dass kaum noch eine Art von Romanen von fantastischen Elementen frei bleiben konnte.
Im Jahre 1985, als die ›Waldkönig‹-Trilogie erstmals erschien, sah das alles ganz anders aus. Beim Bastei-Verlag, bei dem neben den dominierenden Romanheften auch die so genannten ›Genre-Taschenbücher‹ wie Western- und Jerry-Cotton-TBs und seit 1971 eben auch Science-Fiction-Romane verlegt wurden, hatte sich neben den SF-Reihen im Laufe der Siebzigerjahre eine bescheidene Reihe von Fantasy-Romanen etabliert, mit einem Titel pro Monat. Hierfür suchte das damalige Team um Verlagsleiter Rolf Schmitz, Chefredakteur Michael Görden und Redakteur Michael Kubiak einen Außenlektor, der diese kleine Reihe betreuen sollte. Also sprach man einen Fantasy-Fan an, der an der Uni Köln arbeitete und gerade auch noch seine Doktorarbeit über dieses Thema geschrieben hatte. Ich überlegte mir das vierzehn Tage lang und fragte dann zurück, ob sie keine Stelle im Verlag für mich hätten. So begann die über dreißig Jahre dauernde Karriere von Helmut W. Pesch bei Bastei-Lübbe – und meine langjährige Freundschaft mit Wolfgang Hohlbein.
Die erste Idee, die es für den jungen Redaktionsassistenten umzusetzen galt, war eine Fantasy-Romanheftreihe mit deutschen Autoren. Dazu muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen. Es hatte vorher schon Versuche gegeben, Fantasy auch im Romanheft zu etablieren. Die erste deutsche Fantasy-Serie nannte sich DRAGON – Söhne von Atlantis (1973–75) und kam aus der Perry-Rhodan-Redaktion des Pabel-Moewig-Verlags. Angestoßen wurde sie von Hubert Straßl alias »Hugh Walker« (Pseudonyme werden im Folgenden immer in Anführungszeichen gesetzt), aber so richtig traute man der Idee nicht, weshalb der Verlag darauf bestand, dem Ganzen einen Vorspann von drei Heften zu geben, die auf dem imaginären Kontinent Atlantis spielten, wie man ihn auch aus der Perry-Rhodan-Serie kannte. Atlantis stellte einst ein interstellares Handelszentrum dar und war Zentrum technischen Wissens von Menschen und Außerirdischen. Die Insel wurde in einem feindlichen Überraschungsangriff um 17.000 v. Chr. zerstört, die Nachkommen der Überlebenden fielen ohne Zugriff auf die technischen Möglichkeiten ihrer Vorväter in die Primitivität zurück. Dragon, der Titelheld, ein Wissenschaftler, überlebte und erwachte nach zweitausend Jahren aus dem Kälteschlaf. Somit wurde die Fantasy in eine klassische SF-Handlung eingebettet; auch der Widersacher Dragons war ein Außerirdischer.
Auch die Autoren rekrutierten sich weitgehend aus der Perry-Rhodan-Serie. Dies war auch meine erste Begegnung mit dem Verlagswesen – als Coverillustrator. DRAGON brachte es auf 55 Heftnummern und wurde dann ziemlich abrupt eingestellt.
Ein schon ernsthafterer Versuch war MYTHOR – Der Sohn des Kometen (1980-85) gleichfalls basierend auf einem Konzept von »Hugh Walker«. Schauplatz ist hier eine eher klassische Fantasy-Welt, bei der die Magie freilich nur eine marginale Rolle spielt und sich auf magische Waffen und Amulette und dergleichen beschränkt. Auch an dieser Serie waren vor allem Perry-Rhodan-Autoren beteiligt, und die Handlung ist eine Folge von Reisen des Helden auf der Suche nach sich selbst und Entdeckungen fremder Länder und Wesen. MYTHOR hatte es zu dem Zeitpunkt, als der Bastei-Verlag sich auf dieses Feld wagte, schon auf weit über hundert Ausgaben gebracht und sollte 192 Heftausgaben erreichen, bevor die Serie ebenfalls mitten im laufenden Zyklus eingestellt wurde. Damals wurden auch Landkarten, wie ich sie für die Heftserie gezeichnet hatte, ein regelmäßiges Beiwerk von Fantasy-Romanen. Die Cover stammten von Nikolai Lutohin, einem Künstler jugoslawischer Herkunft, aber auch ihm fiel es schwer, den richtigen ›Fantasy-Look‹ zu kreieren.
Warum die Cover so wichtig waren? Nun, als FANTASY – Götter, Krieger und Dämonen an den Start ging, war das Ei eher da als die Henne. Der Verlag erhielt nämlich Zugriff auf einen großen Fundus von Bildern der Brüder Hildebrandt, die über eine Agentur angeboten wurden. Diese beiden amerikanischen Maler, Zwillingsbrüder, hatten sich vor allem an der bunten Welt von Walt Disney und Magazin-Illustratoren wie Norman Rockwell und N. C. Wyeth geschult und waren durch drei Tolkien-Kalender (1974-76) für den amerikanischen Tolkien-Verlag Ballantine Books populär geworden. Diese Bilder waren sehr farbenfroh und basierten teilweise auf gestellten Fotografien, was einen gewissen Wachsfigurenkabinett-Effekt erzeugt. Das heißt, sie waren zum einen fast zu realistisch, zum anderen doch irgendwie nicht ganz von dieser Welt. Zu den anderen Themen von Hildebrandt-Kalendern zählten König Artus, die nordische Götterwelt und Drachen – oder zumindest, wie ein amerikanischer Pop-Künstler sich das alles vorstellte. Alles sehr bunt und manches davon hart an der Grenze des Kitsches.
Damit kam von vornherein ein anderer, märchenhafterer Ton in das FANTASY-Projekt. Der erste Roman, Die Macht der Träume von »Andreas Weiler«, der im März 1985 erschien, zeigt ein Mädchen und ein geflügeltes weißes Pferd. So wurde der Untertitel auch ab Nr. 5 in Wunderbare neue Welten geändert, weil der alte ein wenig zu martialisch klang. Es war halt alles ein wenig »learning by doing«; man tastete sich an das Genre heran. Einiges ergab sich auch durch Zufall. So hatte der erste Titelbild-Andruck einen Rahmen mit einer Marmorstruktur. Das erschien dann aber doch als zu unromantisch, und so überlegte man, ihn mit einer Sonderfarbe zu überdrucken. Da Gold bereits durch diverse Liebesroman-Serien überstrapaziert war, entschied man sich für Silber, was zu einem interessanten ›Silbermarmor‹-Effekt führte, mit dem keiner gerechnet hatte. Natürlich haben wir dann später behauptet, es sei alles so geplant gewesen.
Nachdem man das Bildmaterial gesichtet hatte, ergaben sich von selbst mehrere Themenkreise. Es war von vornherein klar, dass es eine Reihe werden sollte, mit Einzelromanen, aber mit Zyklen und Mini-Serien innerhalb der Reihe. Es gab regelrechte Märchenromane, eine Drachen-Serie, Geschichten aus Tausendundeiner Nacht, auch ›Heroic Fantasy‹ mit einem barbarischen Helden und anderes mehr. Ähnlich divers waren die Autoren. »Andreas Weiler« war Übersetzer und SF-Autor, »Erlik von Twerne« Horrorautor und Fantasy-Fan, der immer schon unter diesem Namen Fantasy-Romane hatte schreiben wollen, Alfred Wallon kam aus dem Western, »Earl Warren« vom Krimi her, Dan Kelly schrieb zuvor bei der Serie Schiffsarzt Dr. Hansen mit und verdiente sich sein Geld als Alleinunterhalter auf Kreuzfahrten. Es gab auch totale Seiteneinsteiger wie »Viktor Sobek«, der einen Zyklus über zwei Zauberlehrlinge schrieb und der später als »Frater V.D.« ein Experte für Ritualmagie (und praktizierender Magier) werden sollte. Und da gab es natürlich Wolfgang Hohlbein.
Das heißt, es war natürlich noch nicht der Wolfgang Hohlbein, wie wir ihn heute kennen. Begonnen hatte seine Karriere als »Henry Wolf« mit einem unverlangt eingesandten Romanheft-Manuskript für die Serie Professor Zamorra, das der Redakteur Michael Kubiak entdeckte, in Form brachte und schließlich veröffentlichte. Er hatte danach weiter für Professor Zamorra und diverse Einzelromane für die Heftreihe Gespenster-Krimi geschrieben; diese frühen Romane sind inzwischen unter dem Reihentitel Hohlbein Classics bei Bastei Entertainment als eBooks wieder erhältlich. Darüber hinaus hatte er innerhalb der Gespenster-Krimi-Reihe eine eigene Serienfigur entwickelt, Robert Craven, wobei er Elemente eines übernatürlichen Horrors in der Tradition von H.P. Lovecraft mit einem Romanheft-Format verband.
Dennoch waren die Romane von »Henry Wolf« immens wichtig für die FANTASY-Reihe. Zum einen, weil er der Autor schon einen Namen für ungewöhnliche und für das Romanheft durchaus anspruchsvolle Stoffe hatte und gerade auf dem ersten Höhepunkt seiner Karriere war. Zum anderen, weil es sich dabei um ›richtige‹ Fantasy handelte – High Fantasy, mit Horror-Elementen, aber innerhalb einer erfundenen mittelalterlichen Welt. Eine Fantasy, die sich selbst ernst nahm und nicht als etwas anderes verkleiden musste als das, was sie war. Und die zugleich manche Züge späterer Fantasy-Romane vorwegnahm: eine Mischung aus jugendlichen und erwachsenen Figuren, einen schattenhaften dunklen Herrscher, Zwerge und halbmenschliche Tierwesen und einen Wald mit einem uralten Geheimnis.
Die ›Waldkönig‹-Trilogie zeigt auch schon manche Elemente, die Hohlbeins späteren Stil vorwegnehmen: zum einen die starke Betonung psychologischer Prozesse und der Binnensicht der Charaktere, zum anderen die genauen, aber doch immer irgendwie unpräzisen Beschreibungen, bei denen der Fantasie des Lesers Raum gegeben wird, sich das Schreckliche selbst vorzustellen – was viel effektiver ist, als es einfach nur zu schildern. Letzteres ist ein Charakterzug, der auch die Werke von H.P. Lovecraft kennzeichnet, als die einzige Möglichkeit, das Unaussprechliche in Worte zu fassen.
Also ein bisschen Lovecraft und ein bisschen Tolkien. Tatsächlich zeigte das Titelbild des ersten Bandes, Der Waldkönig, eine Szene mit einem weißen Magier im Wald, der als Lichtgestalt einer Gruppe von drei Helden – einem menschlichen Krieger, einem Zwerg und einem Elben – erscheint. Wenn man dazu noch weiß, dass das Motiv in der Tat aus einem Herr-der-Ringe-Kalender stammte, kann sich jeder, der das Buch gelesen oder den Film gesehen hat, selbst ausmalen, welche Szene ursprünglich gemeint war …
Der Waldkönig als Nr. 3 der FANTASY-Reihe wurde fortgesetzt mit Der Sohn des Waldkönigs als Nr. 7. Der dritte Band ließ auf sich warten; denn gleichzeitig mit dem ›Waldkönig‹ erschien im April 1985 der erste Band von DER HEXER als eigenständige Romanheftserie. Die Leser mussten, da die Reihe vierzehntägig erschien, zweieinhalb Monate warten, ehe die Trilogie mit Das Erbe des Waldkönigs als Nr. 12 ihren Abschluss fand. Immerhin einen Abschluss – was dem Autor in späteren Jahren nicht immer gelingen sollte!
Zum Inhalt möchte ich an dieser Stelle im Einzelnen nichts vorwegnehmen, außer dass am Ende alles zu einer befriedigenden Lösung gelangt, auch wenn man bei der Lektüre zwischenzeitlich kaum noch daran glauben mag.
Der FANTASY-Reihe war langfristig kein Erfolg beschert; sie lief von März 1985 bis April 1986 und wurde dann mit Heft Nr. 28 eingestellt. Tatsächlich stellte sich erst nach der Einstellung heraus – das Reporting kam aufgrund der Auslieferung der Romanhefte in mehreren Phasen immer etwa um drei Monate zeitverzögert –, dass sie mit den letzten Nummern in die Gewinnzone gekommen war; und die absoluten Zahlen waren damals, in den Achtzigerjahren, ohnehin von einer Größenordnung, die man sich später bei Romanheften nur erträumen konnte.
Vielleicht lag es aber auch daran, dass viele der Romane für das Romanheft einfach zu ›literarisch‹ waren. Das soll keine Herabwürdigung der Romanheft-Schreiber im Allgemeinen sein, die ihr erzählerisches Handwerk oft ausgezeichnet beherrschen, was sich auch am nachhaltigen Erfolg zeigt. Aber es ist schon bezeichnend, dass einige der Romane, die in der Reihe erschienen, später im Taschenbuch nachgedruckt wurden. Dies traf auch auf den ›Waldkönig‹ zu, der bei Goldmann in leicht veränderter Form im Taschenbuch erschien und später als Sammelband neu aufgelegt wurde. So wurde aus den Heften ein einziges dickes Buch – zumindest nach damaligen Maßstäben, als Fantasy-Romane generell noch nicht solche Ziegelsteine waren, wie es heute die Regel ist. Auch profitierten viele Autoren selbst von ihrer Beteiligung an der Reihe, wie »Earl Warren«, der danach Jerry Cotton schrieb. »Andreas Weiler«, »Harald Münzer« und »Frank Thys« wurden später unter eigenem Namen als Buchautoren bekannt. Andere, wie der inzwischen verstorbene Rolf Michael alias »Erlik von Twerne« setzten ihre Geschichten im Taschenbuch fort, wiederum andere wie Alfred Wallon im Eigenverlag.
Den kometenhaftesten Aufstieg jedoch hatte Wolfgang Hohlbein. Neben seiner Tätigkeit als Romanheft- und Horror-Autor hatte er mit dem Bestseller Märchenmond (1982), dessen Stoff er zusammen mit seiner Frau Heike entwickelt hatte, bereits den Grundstein zu seiner zweiten schriftstellerischen Karriere als Jugendbuchautor gesetzt. Dieser Erfolg und seine immense Produktivität, verbunden mit seinem erzählerischen Talent, sollten ihn mit weit über vierzig Millionen verkauften Büchern zu einem der erfolgreichsten deutschsprachigen Autoren der Gegenwart machen.
Wir sind trotzdem Freunde geblieben. Es heißt, es gibt keine Freundschaft zwischen Autoren und Lektoren, sondern nur Zweckbündnisse auf Zeit. Aber es gibt immer Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Wenn wir in seinem großen Garten mit dem Koikarpfenteich oder an dem schweren, dunklen Tisch im Wohnzimmer zusammensitzen, haben wir uns immer etwas zu erzählen – und nicht nur von der Vergangenheit. Es gibt immer noch neue Stoffe und neue Ideen. Vieles aber findet sich im Kern schon in der alten ›Waldkönig‹-Trilogie, die zu Wolfgang Hohlbeins bemerkenswertesten frühen Fantasy-Werken zählt.
Trotz allem noch eine inhaltliche Anekdote am Rande: Als der letzte Band erschienen war und wir uns irgendwann am Telefon über möglich weitere Heftromane zu FANTASY unterhielten (zu denen es dann nicht mehr kam), stellten wir zu unserer Überraschung fest, dass in den drei Romanen eine Sache merkwürdig war: Es kommt keine einzige Frau darin vor. Fantasy war damals eben eher was für Männer, um nicht zu sagen: Jungs. Aber es hat Spaß gemacht.
Ich wünsche viel Vergnügen beim Lesen – ganz gleich, ob es nun eine Neu- oder eine Wiederentdeckung ist.
Helmut W. Pesch
Der WaldkönigBand 1: Gwenderon
Der machthungrige Zauberer Lassar will einen ungeheuerlichen Frevel begehen: Er will das Holz des heiligen Schwarzeichenwaldes schlagen, um Kriegsschiffe zu bauen, und stellt König Oro ein Ultimatum.
Prinz Cavin, Oros einziger Sohn, befindet sich gerade auf dem Weg nach Hause und wird dabei von Gwenderon, dem Waffenmeister Hochwaldens, und dem Waldläufer Karelian begleitet.
Gemeinsam kämpfen sie sich durch die bedrohliche Fauna des Schwarzeichenwaldes. Doch die weitaus größere Gefahr geht von Lassar aus …
Eine seltsame Stille hatte sich über dem Schwarzeichenwald ausgebreitet. In den Wipfeln der Bäume rauschte noch immer der Wind, und dann und wann drang sogar noch das leise Plätschern und Murmeln des Wildwasserbaches, den sie vor einer halben Stunde durchschritten hatten, an Gwenderons Ohr. Und trotzdem schien es ihm, als wären sie in einem Kreis von Stille und Schweigen gefangen.
Es waren nur die Geräusche des Waldes zu hören: das Knacken von trockenen Zweigen und Laub unter den Hufen ihrer Pferde, das Rascheln des Windes in den Blättern – sonst nichts. Der Wald atmete weiter, aber seine Bewohner waren verstummt. Kein Vogel schrie. Die Schatten hatten aufgehört, auf weichen Pfoten vor ihnen zu fliehen. Und selbst das Rascheln und Wispern der Insekten, das einzeln nicht wahrzunehmen war, aber trotzdem zu diesem Wald gehörte wie die mannsdicken schwarzen Stämme und der undurchdringliche Baldachin aus Blättern, zu dem sich seine Wipfel verwoben, war verstummt.
Gwenderon schrak aus seinen Überlegungen hoch, als sich das Unterholz neben ihm teilte und Karelian hervortrat. Wie immer war der Fährtenleser so leise, dass Gwenderon seine Schritte selbst jetzt nicht hörte. Der grauhaarige Mann mit dem scharfen Gesicht und den dunklen Augen hatte sein Leben in diesem Wald verbracht. Er war hier geboren und aufgewachsen und im Laufe der Jahre selbst zu einem Teil des Waldes geworden, einem Wesen, das sich so lautlos bewegen konnte wie einer der Schatten, in denen er lebte.
Gwenderon rief sich beinahe schuldbewusst ins Gedächtnis zurück, dass das der Grund war, weshalb Karelian ihn und die Garde begleitete. Sie waren eine mächtige Streitmacht, aber in diesem Teil des Schwarzeichenwaldes herrschten Gesetze, die anders waren als die, nach denen er bisher gelebt hatte. Ein Heer von hundert gepanzerten Lanzenreitern mochte in der grün-braunen Dämmerung des Waldes auf ewig verschwinden, während ein einzelner Mann wie Karelian eine gute Chance hatte, sein Ziel unbehelligt zu erreichen. Sie brauchten ihn, so dringend wie die Lebensmittel in ihren Satteltaschen und das Wasser in ihren Schläuchen.
Trotzdem erschrak er immer wieder, wenn er den grauhaarigen Waldläufer lautlos auftauchen sah.
»Herr?«
Gwenderon brachte sein Pferd mit einem kurzen, harten Ruck am Zügel zum Stehen und sah den Waldläufer fragend an. »Ja?«
Karelian wies mit einer Kopfbewegung in die Richtung zurück, aus der er gekommen war. »Da ist etwas, das ich Euch zeigen muss, Herr«, sagte er. »Ich glaube, es ist wichtig.«
Gwenderon runzelte die Stirn. Für Karelian waren diese beiden Sätze eine ungewöhnlich lange Rede. Der Waldläufer sprach beinahe nie, und wenn er es doch tat, dann beschränkte er sich auf das Nötigste. Seine abgehackte, knappe Art zu sprechen hatte während der ersten Tage Anlass zu zahllosen Witzeleien unter den Männern gegeben. Sein Anliegen musste wirklich wichtig sein.
Einer der Gardisten wandte den Kopf, blickte Gwenderon fragend an und machte Anstalten, sein Pferd ebenfalls zu zügeln, aber Gwenderon gebot ihm mit einer raschen Geste weiterzureiten, schwang sich aus dem Sattel und trat neben den Waldläufer.
Selbst jetzt, nachdem er abgesessen hatte, überragte er Karelian um mehr als Haupteslänge; und das, obwohl er gewiss kein hochgewachsener Mann war.
Karelian drehte sich wortlos um und verschwand im Unterholz. Obwohl er kaum ein hörbares Geräusch verursachte, bewegte er sich so schnell, dass Gwenderon Mühe hatte, ihm überhaupt zu folgen und in der unsicheren Dämmerung nicht den Anschluss zu verlieren.
Der Weg verschwand schon nach wenigen Augenblicken hinter einer undurchdringlichen Mauer aus Grün und Braun in allen nur denkbaren Schattierungen, und einen weiteren Moment später verschluckte der Wald auch die Geräusche der Reiter. Alles, was Gwenderon noch hörte, waren seine eigenen Schritte und das Hämmern seines Herzens.
Er schauderte. Der Schwarzeichenwald war seine Heimat – jedenfalls hatte er ihn dazu gemacht, als er vor nunmehr fast dreißig Jahren in den Dienst König Oros getreten war und ihm Treue geschworen hatte – und trotzdem erfüllte er ihn mit Unbehagen, ja, beinahe mit Furcht.
Sie waren weit von Hochwalden entfernt, sieben Tagesreisen, und die Wälder, durch die sie ritten, hatten nicht mehr viel mit dem Schwarzeichenwald gemein, der sich rings um die gewaltige Burg Oros und seiner Getreuen erhob. Es war ein Dschungel, beinahe undurchdringlich selbst für jene, die ihn so gut kannten wie Karelian. Hätte es die schmalen, wie mit einem gewaltigen Lineal gezogenen Pfade und Wege nicht gegeben, die – wie die Sage behauptete – vom Wald selbst geschaffen worden waren, damit Mensch und Tier ihres Weges gehen konnten, ohne den Bäumen Schaden zuzufügen, hätten selbst siebzig Tagesreisen nicht gereicht, hierherzukommen. Gwenderon hatte von Männern gehört, die verwegen genug gewesen waren, die vorgegebenen Pfade zu verlassen und in den Wald selbst einzudringen, auf der Suche nach Geheimnissen und Gold oder bloß Abenteuern.
Keiner von ihnen war zurückgekommen. Nicht aus diesem Teil des Waldes.
Er verscheuchte den Gedanken. Es waren bloße Gerüchte. Die Menschen pflegten nun einmal die Dinge, die sie nicht verstanden, mit Märchen zu umgeben und sie so noch bedrohlicher zu machen, als sie es ohnehin schon waren. Er sollte nicht auf Gerüchte hören. Er war ein wenig zu alt, um jetzt noch damit zu beginnen.
Der Waldläufer ging langsamer, sobald er sah, dass Gwenderon nicht so rasch vorankam wie er, und als Gwenderon neben ihn trat, rang er sich sogar zu einem kleinen, flüchtigen Lächeln durch, bei dem seine Augen allerdings kalt blieben.
Eigentlich, erinnerte sich Gwenderon, hatte er Karelian nie wirklich lachen sehen.
»Hier«, sagte Karelian. »Seht!«
Gwenderon blickte sich einen Moment verwirrt um, ehe er sah, was Karelian meinte.
Vor ihnen waren Spuren. Es waren zwei Reihen gleichmäßiger, dunkler Abdrücke, die sich tief in den weichen Waldboden eingedrückt hatten. Es musste ein sehr schwerer Körper gewesen sein, der hier entlanggegangen war.
Er sah Karelian stirnrunzelnd an, kniete nieder und fuhr mit den Fingern über die Ränder der Spur. Sie war sehr groß – eine gute Handspanne länger als der Fußabdruck eines normal gewachsenen Mannes – und es war nicht die Spur eines Menschen. Es waren Abdrücke nackter, vierzehiger Füße, an deren vorderem Rand tiefe, wie mit einem Messer ausgestanzte Löcher sichtbar wurden, als hätten sich furchtbare Krallen in den weichen Boden gegraben.
Gwenderon sah mit einem Ruck auf, als er endlich begriff, welches Wesen Spuren wie diese hinterließ.
»Ein Raett?«, sagte er erschrocken. »Hier?«
Karelian nickte. Sein Gesicht blieb ruhig und ausdruckslos wie immer, aber in seiner Stimme vibrierte ein neuer, fast zorniger Unterton, als er antwortete.
»Nicht nur einer«, sagte er. Seine Hand wies nach vorne. Gwenderon folgte der Geste und sah, dass die Spur in einem halb niedergetrampelten Dornenbusch endete. Der Raett war rücksichtslos durch den Wald gebrochen und hatte dabei alles niedergewalzt, was ihm in den Weg geraten war.
Plötzlich verstand er Karelians Zorn. Für ihn musste dieser zertrampelte Busch eine Wunde sein, die dem Wald geschlagen worden war.
»Dort hinten sind mehr Spuren«, fuhr Karelian nach einer Pause fort, die seinen Zorn deutlicher machte als alles, was er hätte sagen können. »Ein Dutzend, vielleicht mehr. Sie folgen uns.«
Gwenderon stand auf und rieb sich die Hände an der Hose, als hätte er sich an der Spur des Raett besudelt. Er zweifelte nicht an der Schlussfolgerung, die Karelian gezogen hatte. Wenn Karelian sagte, sie wurden verfolgt, dann wurden sie verfolgt. »Seit wann?«, fragte er.
Karelian zuckte mit den Achseln. »Die Spur ist keine Stunde alt. Die Ränder sind noch nicht eingesunken, und die Erde ist noch feucht. Aber sie sind schon seit Tagen in unserer Nähe.«
»Seit Tagen?« Gwenderon erschrak. »Warum hast du uns nicht gewarnt?«
Karelian lächelte geringschätzig. »Ich hatte keinen Beweis. Diese Spuren sind die ersten, die ich gefunden habe. Ich hatte sie gespürt. Ich kann ihre Nähe fühlen. Aber Ihr hättet mir nicht geglaubt.«
Es war keine Rechtfertigung, sondern eine Feststellung, und Gwenderon widersprach nicht. »Und … was schließt du daraus?«, fragte er.
Karelian zuckte die Achseln. »Es kann eine wilde Herde sein, die nur zufällig der gleichen Richtung folgt wie wir und hofft, ein paar Abfälle zu finden.«
»Aber das glaubst du nicht wirklich.«
Karelian hielt seinem Blick gelassen stand. »Was ich glaube, spielt keine Rolle«, sagte er. »Es kann harmlos sein – oder auch nicht. Wir müssen Obacht geben.«
Gwenderon nickte. Er hatte keine Angst. Raetts waren gefährlich und unberechenbar, aber er hatte zwei Dutzend der besten Krieger bei sich, und Karelians scharfe Sinne würden sie frühzeitig vor jeder Gefahr warnen. Aber sie waren nicht allein, und er war nicht nur für sein Leben und das seiner Männer verantwortlich.
»Gehen wir zurück«, sagte er. »Die Männer müssen gewarnt werden.« Fast gegen seinen Willen fügte er hinzu: »Glaubst du, dass sie uns angreifen werden?«
»Kaum«, antwortete Karelian nach kurzem Überlegen. »Raetts sind Feiglinge. Und wir sind zwei Dutzend Bewaffnete. Aber wir sollten vorsichtig sein.«
Gwenderon nickte. Karelian sprach längst nicht alles aus, was er dachte. Aber das war auch nicht nötig.
Lautlos wandten sie sich um und gingen nebeneinander zum Weg zurück. Karelian schwieg, und als Gwenderon ihm einen verstohlenen Blick zuwarf, sah er, dass sich auf seinen scharfen Zügen nicht die geringste Regung zeigte. Trotzdem spürte er die Anspannung, die sich hinter der Maske von Ruhe und scheinbarer Entspanntheit des Waldläufers bemächtigt hatte.
Der Tross hatte angehalten, als sie den Weg wieder erreichten, gegen seinen Befehl; Norrot, sein Unterhauptmann und Freund, blickte ihnen mit einer Mischung aus Besorgnis und Neugier entgegen. Seine Hand lag in einer unbewussten Geste auf dem silberbeschlagenen Griff des Schwertes, das er, anders als alle Männer, die Gwenderon kannte, am Sattelgurt und nicht an der Hüfte trug. »Herr?«
Gwenderon schüttelte schnell und fast unmerklich den Kopf, blickte warnend in die Richtung, in der das goldbestickte Wams des Prinzen wie eine bizarre Blume zwischen den silbernen Kettenhemden der Krieger hervorstach, und schwang sich mit einer kraftvollen Bewegung in den Sattel. »Raetts«, flüsterte er, so leise, dass nur Norrot das Wort verstehen konnte.
Der Hauptmann erbleichte, zeigte aber ansonsten keine Regung. Dies war es, was Gwenderon so an ihm schätzte. Nicht einmal seine Haltung versteifte sich. Beinahe gemächlich wendete er sein Pferd, ritt ein Stück voraus und raunte einem der Krieger ein paar Worte zu, schnell und präzise, aber mit unbewegtem Gesicht und in ruhigem, fast beiläufig klingendem Ton.
Der Mann nickte, ritt seinerseits ein Stück voraus und gab Norrots Befehl weiter. Langsam und beinahe schwerfällig, wie ein großes Tier aus Stahl und Fleisch, dessen einzelne Glieder den Befehlen seines Willens nur mit Verspätung gehorchten, setzte sich der Tross in Bewegung.
Aber nicht alle Pferde fielen in den langsamen, kräftesparenden Trab, wie Gwenderon voller Besorgnis feststellte. Der Prinz selbst und drei oder vier seiner höfischen Berater blieben, wo sie waren, und der Ausdruck von Neugier in den hellblauen Augen des Prinzen wandelte sich in Sorge, als Gwenderon näher kam und sein Tier einen Schritt vor ihm zügelte.
»Was ist los, Gwenderon?«, fragte er; eine Spur zu laut und in dem leicht arroganten Tonfall, den er vom ersten Moment an eingeschlagen hatte.
Gwenderon mochte es nicht, wenn jemand so mit ihm sprach. Nicht einmal, wenn es der Sohn seines Königs war; vielleicht ganz besonders dann nicht. Aber dies war nicht der Augenblick, einen Gedanken an Fragen der Höflichkeit und Würde zu verschwenden.
»Nichts, junger Herr«, antwortete er und hoffte, dass der Prinz nicht merkte, dass er log. Er war nie ein guter Schauspieler gewesen. »Karelian hat die Spuren einer Brüllechse entdeckt, das ist alles. Er zeigte sie mir.«
Brüllechsen waren große, plumpe Tiere, massiger als ein Schlachtross und so stark wie zehn Bären, aber sie waren für ihre Feigheit bekannt und griffen nur an, wenn ihnen keine andere Wahl mehr blieb.
Die linke Augenbraue des Prinzen rutschte ein Stück nach oben und verschwand damit fast unter dem Rand des prunkvollen Goldhelms, der seinen Kopf zierte.
»Eine Brüllechse?«, wiederholte er zweifelnd. »Hier? Ich wusste nicht, dass sie in diesem Teil des Waldes vorkommen.«
Die andere, misstrauische Frage, die sich hinter der laut ausgesprochenen verbarg, war nicht zu überhören.
»Niemand weiß viel über diesen Teil der Wälder«, antwortete Gwenderon. »Nicht einmal Karelian.«
Aber der Prinz ließ nicht locker. Sein Misstrauen war geweckt, und wenn Gwenderon ihn auch insgeheim für einen eingebildeten Gecken hielt, der noch viel lernen musste, ehe er zum Mann wurde, so war er doch intelligent und hatte den Spürsinn seines Vaters und den scharfen Verstand seiner Mutter geerbt. »Ihr seht sehr besorgt aus, Gwenderon«, sagte er, »dafür, dass keine Gefahr besteht.«
»Nicht besorgt«, antwortete Gwenderon. »Nur müde, Herr. Es war ein weiter Weg, und ich bin nicht mehr so jung und kräftig wie Ihr.«
Der Prinz blickte ihn an, gleichermaßen geschmeichelt wie verwirrt von seinen Worten. Aber zu Gwenderons Erleichterung drang er nicht weiter in ihn, sondern zwang sein Pferd mit einer unsanften Bewegung herum und ritt zu der bunt betressten Schar seiner Höflinge und Lehrer zurück, die in respektvollem Abstand haltgemacht hatten.
Gwenderon wartete, bis auch der letzte Reiter an ihm vorübergetrabt war, ehe auch er sein Pferd weiterlaufen ließ. Instinktiv blickte er sich um und suchte Karelian, fand ihn aber nicht. Der Waldläufer war so lautlos verschwunden, wie er gekommen war.
Und trotzdem spürte Gwenderon, dass er nicht allein war. Der Busch lag wie eine schwarz-grün-braun gefleckte Mauer zu beiden Seiten des Weges – reglos, still und undurchdringlich. Aber er spürte plötzlich, dass dieser erste Eindruck täuschte. Irgendetwas war da, Augen, die ihn anstarrten, Ohren, die auf jedes seiner Worte lauschten …
Gwenderon versuchte vergeblich, sich einzureden, dass es Karelians Augen und Ohren waren.
*
Obwohl sich an die hundert Menschen auf dem Innenhof der Burg aufhielten, wirkte der gepflasterte Platz leer und auf sonderbare Weise verlassen. Der Wind war kälter geworden, nachdem die Wolken weitergezogen und der Himmel wieder blau geworden war, und in den Ritzen des Kopfsteinpflasters glitzerte Regenwasser. Hier und da hatten sich Pfützen gebildet, die das Licht der tief stehenden Sonne wie achtlos verstreute Spiegelscherben zurückwarfen, und die Schatten wirkten hart, wie mit kräftigen Federstrichen gezogen. Ein Pferd wieherte, und wie zur Antwort erklang der krächzende Schrei eines Vogels hoch in der Luft.
König Oro zog den weißen Mantel, den er sich übergeworfen hatte, als er das Haus verließ, ein wenig enger um die Schultern, hob den Kopf und blinzelte aus zusammengekniffenen Augen zum Himmel. Ein dunkler Punkt zog hoch über der Burg seine Kreise, und als hätte er seinen Blick bemerkt und antwortete darauf, erscholl der krächzende Schrei ein zweites Mal.
Er war nicht abergläubisch. Aber die letzten Tage hatten viel Neues gebracht, und nur wenig davon war erfreulich gewesen. Und das plötzliche Unwetter und die schwarze Krähe hoch oben über der Burg erschienen ihm wie ein böses Omen.
Er fröstelte, aber es war nicht die Kälte, die ihn frieren ließ. Das Unheil lag fast greifbar in der Luft; er spürte es. Irgendetwas hatte sich verändert, seit Resnec vor dem Tor der Burg erschienen war und um Gastfreundschaft und eine Audienz angesucht hatte. Das eine war ihm gewährt worden, weil es der Brauch so vorschrieb, und das andere, weil Resnec ein mächtiger Mann war und sich selbst ein König zweimal überlegte, ihn abzuweisen.
Oros Miene verfinsterte sich, während er vollends aus dem Windschatten des Eingangs trat und mit gemessenen Schritten auf das Tor zuging. Die Fallbrücke war heruntergelassen und das Gatter hochgezogen worden, sodass seine Zinken wie Zähne eines rostigen Eisengebisses aus dem gemauerten Torgewölbe hervorsahen. Die Krieger, die rechts und links des Eingangs Aufstellung genommen hatten, trugen ihre prachtvollsten Uniformen – weiße Waffenröcke und vergoldete Panzer, auf denen Wassertropfen schimmerten, dazu lange, mit bunten Wimpeln versehene Speere, Schild und Schwert. Es war ein Anblick, der mit seiner Pracht das Herz jedes Betrachters hätte erfreuen müssen.
Er tat es nicht; nicht heute. Oro hatte ganz im Gegenteil Mühe, auf seinen Zügen wenigstens einen Anschein von Freundlichkeit oder wenigstens königlicher Würde zu bewahren, als er sich dem Tor und der Hundertschaft Krieger näherte und sein Blick an der dunkel gekleideten Gestalt hängen blieb, die zwischen den Soldaten stand und ihm entgegensah.
Es war etwas an dem Fremden, das die Soldaten schäbig und hilflos erscheinen ließ, nur dadurch, dass er in ihrer Nähe war. Oro hatte während der letzten drei Tage acht- oder neunmal mit ihm gesprochen, und jedes Mal hatte er hinterher das Gefühl gehabt, sich beschmutzt zu haben. Hätte er der Stimme in seinem Inneren gehorcht, dann hätte er Resnec aus der Burg geworfen; eine Minute nachdem er sie betreten hatte.
Oro verscheuchte den Gedanken, straffte die Schultern und ging ein wenig schneller, als er die Kälte deutlicher zu spüren begann. Er war kein junger Mann mehr, und er wollte nicht, dass Resnec sah, wie seine Hände vor Kälte zitterten, und es vielleicht als Schwäche auslegte.
Resnec sah ihm ruhig entgegen. Er war ein großer, dunkelhaariger Mann von schlankem Wuchs und unbestimmbarem Alter. Sein Gesicht wurde von einem dünnen, sorgsam ausrasierten Bart eingefaßt, und seine Hände waren schmal und sehnig; von jener Schlankheit, die große Kraft und ebenso große Behendigkeit verriet. Wäre der stechende Blick seiner Augen und der grausame Zug um seinen Mund nicht gewesen, hätte man ihn durchaus als gut aussehend bezeichnen können. So hatte er etwas von einer Schlange, fand Oro; Manchmal auch einer Ratte. Er war sich bis jetzt nicht darüber klar geworden, welcher Vergleich nun zutreffender war.
Er wünschte sich, Gwenderon wäre da. Der alte Waffenmeister hätte gewusst, wie er mit Resnec umzugehen hatte.
Oro blieb stehen, deutete eine Verbeugung an und wartete, bis Resnec die Geste erwidert hatte und damit der Etikette Genüge getan war.
»Ich sehe, Ihr seid bereit für die Abreise«, sagte er und fügte, mit einer Geste zum Himmel, hinzu: »Es wäre besser, Ihr würdet bis zum nächsten Sonnenaufgang warten. Es wird bald dunkel werden, und der Regen hat die Wege aufgeweicht.«
Es war eine Floskel. Resnec wusste so gut wie er, dass die Worte nicht im Ernst gemeint waren und dass der König in Wirklichkeit genau das Gegenteil hatte sagen wollen. Aber er ließ sich nichts anmerken, sondern schüttelte nur höflich den Kopf und deutete mit einer knappen Handbewegung auf sich und sein Pferd. Er trug die gleiche Kleidung, mit der er gekommen war: dunkle, eng anliegende Hosen aus roh gegerbtem Leder, schwarze Stiefel, einen Waffenrock in der gleichen Farbe und einen schweren, mit Pelz gefütterten Mantel, unter dem der Griff eines wuchtigen Schwertes hervorsah.
»Ich bin gut ausgerüstet, mein König«, sagte er. »Dunkelheit und Regen schrecken mich nicht, und ich habe Eure Gastfreundschaft schon viel zu lange in Anspruch genommen.« Er lächelte: ein rasches, hässliches Verziehen der Lippen, das Oro einen Blick auf ein strahlend weißes Raubtiergebiss gewährte. Dann legte er die Hand auf den Sattelknauf seines Pferdes und wandte sich, in einer genau einstudierten Bewegung, dessen war sich Oro sicher, im letzten Moment noch einmal um.
»Ihr habt Euch Eure Entscheidung nicht noch einmal überlegt, mein König?«, fragte er.
Oro unterdrückte im letzten Moment eine scharfe Entgegnung. Resnec wusste so gut wie er, wie seine Antwort ausfallen musste. »Nein«, sagte er. »Ihr wisst es, Resnec, und Ihr kennt auch die Gründe für meine Ablehnung.«
»Und Ihr die für meinen Wunsch«, entgegnete Resnec. Jede Spur von Freundlichkeit war aus seiner Stimme verschwunden, sie klang jetzt kalt, hart und beinahe drohend.
»Vielleicht überlegt Ihr es Euch doch noch einmal«, fuhr der schwarzhaarige Händler nach einer genau bemessenen Pause fort. »Mein Herr wäre sicher bereit, sein Angebot zu erhöhen, obwohl es schon jetzt mehr als großzügig ist.«
»Das ist es fürwahr«, bestätigte Oro. »Es liegt nicht am Geld, Resnec, richtet das Eurem Herrn aus. Ich weiß die Großzügigkeit seines Angebotes sehr wohl zu schätzen, aber nicht einmal für die zehnfache Summe …«
»Überlegt es Euch gut, mein König«, unterbrach ihn Resnec. Der drohende Klang in seiner Stimme war jetzt nicht mehr zu überhören. »Mein Herr ist mächtig, mit dem Schwert und mit anderen Waffen. Wir brauchen diesen Wald.«
Oro wusste, dass es besser gewesen wäre, jetzt zu schweigen, aber Resnecs Worte ließen eine Welle heißer, unbezwingbarer Wut in ihm aufsteigen. »Um Schiffe daraus zu bauen, ich weiß«, blaffte er. »Kriegsschiffe, die ihr braucht, um andere Länder zu überfallen. Richtet Eurem König aus, dass alle Macht der Welt mich nicht dazu bewegen wird, auch nur einen einzigen Baum meines Reiches zu verkaufen. Nicht zu diesem Zweck!«
Resnec erbleichte. Seine Lippen pressten sich zu einem schmalen, blutleeren Strich zusammen, sodass es aussah wie eine Narbe, die sein Gesicht in zwei ungleiche Hälften teilte. Und als wäre es ein Omen – oder eine genau im richtigen Moment bestellte Geste –, fauchte in diesem Moment ein Windzug durch das offen stehende Tor und bauschte seinen Mantel, sodass er Resnecs schlanke Gestalt umflatterte wie eine Aura der Finsternis. Für die Dauer eines Atemzuges starrte er Oro mit unverhohlener Wut an, dann fuhr er herum, schwang sich in den Sattel und griff nach dem Zügel.
»Ist das Euer letztes Wort?«, fragte er kalt.
Oro nickte. »Mein letztes, Resnec. Wir verkaufen kein Holz, um damit Tod und Gewalt an die Küsten fremder Länder zu tragen.«
Für einen Moment sah es so aus, als wollte Resnec noch etwas darauf erwidern, aber dann beließ er es nur bei einem neuerlichen Verziehen der Lippen, riss mit einem unnötig harten Ruck an den Zügeln seines Pferdes und zwang es, auf der Stelle kehrtzumachen. Das Tier tänzelte nervös und versuchte auszubrechen. Aber Resnec brachte es mit einem zweiten, noch brutaleren Ruck zur Räson.
»Wie Ihr wollt, König Oro«, sagte er wütend. »Aber ich kann Euch nicht garantieren, dass sich mein Herr mit dieser Antwort zufriedengibt.«
»Richtet Lassar meine Worte aus«, antwortete Oro aufgebracht. »Und sollte er Euch nicht glauben, dann sagt ihm, dass er jederzeit selbst auf meiner Burg willkommen ist, um sie aus meinem eigenen Munde zu hören. Und nun geht, solange Euch die Gesetze der Gastfreundschaft noch schützen.«
Resnec starrte ihn einen Moment lang aus brennenden Augen an. Dann, ohne ein weiteres Wort, stieß er seinem Tier die Sporen in die Flanken und preschte los. Der metallische Klang der Hufschläge wurde zu fernem grollendem Donner, als er auf die Zugbrücke hinauspreschte und – ohne sein Tempo auch nur im Mindesten zu mäßigen – den breiten, regendurchweichten Weg zum Waldrand hinunter einschlug.
Oro blickte ihm nach, bis die schwarze Wand der Bäume Pferd und Reiter verschluckt hatte. Aber selbst dann glaubte er noch, seine Nähe zu spüren. Die Luft roch klar und frisch, wie immer nach einem heftigen Regenguss, und trotzdem hatte Oro eine Weile das Gefühl, nicht mehr richtig atmen zu können. Es war, als wäre etwas von der Dunkelheit und Kälte, die den angeblichen Händler wie unsichtbare Schatten begleiteten, in Höhenwald zurückgeblieben.
Vielleicht war es nur die Furcht. Resnecs Worte waren keine leere Drohung gewesen, das wusste er.
»Das war nicht besonders klug«, sagte eine Stimme hinter ihm. Oro runzelte die Stirn, drehte sich um und blickte mit einer Mischung aus Überraschung und Zorn in Faroans Gesicht. Als er aus dem Haus getreten war, war er allein gewesen, und er hatte nicht bemerkt, dass ihm der Magier gefolgt war.
»Wie lange stehst du schon hier und lauschst?«, fragte er zornig, dessen Worte bewusst ignorierend.
»Lange genug«, erwiderte Faroan, der sich auf seinen langen Magierstab mit dem goldenen Knauf stützte. »Je
denfalls lange genug, um deine letzten Worte gehört zu haben. Sie waren nicht sehr klug gewählt. Resnec ist kein Mann, der ein Nein akzeptiert, und du hast ihn obendrein beleidigt. Er wird wiederkommen.«
Oro setzte zu einer scharfen Antwort an, aber dann fiel ihm ein, dass sie nicht allein waren und die Wachen, die rechts und links des Tores standen, jedes Wort hören konnten. Mit einer schroffen Kopfbewegung wies er zum Haus hinüber und ging los. Faroan folgte ihm, zuerst in zwei, drei Schritten Abstand, holte aber rasch auf, als sie außer Hörweite der Wachen waren.
Oro blieb stehen. Vielleicht war es besser, das, was zu bereden war, hier draußen anzusprechen. Trotz des Zornes, der noch immer in ihm brodelte, wusste er im Grunde sehr wohl, dass Faroan recht hatte. Und auch in Höhenwald hatten die Wände Ohren.
»Er wird wiederkommen«, sagte Faroan, übergangslos an das unterbrochene Gespräch anknüpfend. »Und das nächste Mal wird er nicht bitten, sondern fordern.«
»Ich weiß«, antwortete Oro übellaunig. »Und?« Der Zorn auf Resnec, der sich in den letzten Tagen in ihm aufgestaut hatte, drohte sich jetzt auf den Magier zu entladen. Er beherrschte sich nur noch mit Mühe. Seine Hände zitterten jetzt wirklich, aber nicht vor Kälte.
Faroans Stirn umwölkte sich, und auf seinem weißbärtigen Gesicht, dessen jugendlich-glattes Aussehen dem Blick seiner hundert Jahre alten Augen Hohn sprach, erschien ein Ausdruck tiefer Sorge.
»Er wird wiederkommen«, sagte er noch einmal. »Und ich fürchte, er wird uns Ärger machen.«
»Du bist hier, um das zu verhindern«, sagte Oro gereizt. »Wo warst du während der letzten drei Tage? Ich habe dich vermisst, bei meinen …« Er spie das Wort beinahe hervor. »Beratungen mit Resnec.«
Faroan sah ihn einen Moment nachdenklich an, ging aber nicht weiter auf seine Worte ein. Er schien genau zu spüren, was in dem alten König vorging.
»Ich habe geforscht«, sagte er dann. »Ich habe über meinen Büchern gesessen und die Sterne beobachtet, und ich habe das Orakel befragt, Oro. Die Zeichen stehen nicht gut.«
»Papperlapapp«, erwiderte Oro wütend. »Heb dir dein Gewäsch für die Weiber und die Kinder auf, Faroan. Ich …«
»Es ist kein Gewäsch«, unterbrach ihn Faroan ernst, und etwas in der Art, in der er sprach, ließ Oro erschauern. »Ich wollte, es wäre so, aber ich meine es ernst. Die Sterne stehen schlecht, so schlecht wie seit Langem nicht mehr, und ich lese großen Schmerz in den Zeichen.« Er seufzte. »Resnec wird wiederkommen«, sagte er noch einmal. »Man muss kein Sterndeuter oder Magier sein, um das zu wissen. König Lassars Feldzug im Osten ist ins Stocken geraten, seit ihm das Zwergenvolk die Gefolgschaft aufgekündigt hat und er seine Truppen nicht mehr über die Berge versorgen kann. Er braucht eine Flotte, und er braucht Holz, um diese Flotte zu bauen. Und der einzige Wald, der groß genug ist, ihm dieses Holz zu geben, ist der Schwarzeichenwald.«
Oro nickte düster. Faroan offenbarte ihm nichts Neues. Lassar führte seit einem Jahrzehnt Krieg, gegen wechselnde Feinde und mit wechselndem Erfolg, aber bisher waren der Schwarzeichenwald und Hochwalden vor seinem Zugriff sicher gewesen.
»Er wird es nicht wagen, auch nur einen Baum zu fällen«, sagte er. »Der Schwarzeichenwald ist heilig. Seine eigenen Leute würden ihm die Gefolgschaft verweigern, wenn er es täte.«
Seine Worte waren eher Wunsch als Überzeugung, das wussten sie beide. Lassar hatte in den letzten Jahren ein Land nach dem anderen erobert und sein Imperium unaufhaltsam ausgeweitet. Vielleicht war Hochwalden jetzt an der Reihe, von dem Moloch verschlungen zu werden, in den Lassar das ehemals blühende Tiefland verwandelt hatte.
»Er wird es nicht wagen«, sagte er noch einmal, als Faroan nicht antwortete. »Niemand erhebt ungestraft die Hand gegen den Schwarzeichenwald. Die ganze Welt würde aufstehen und ihn zur Rechenschaft ziehen.«
Faroan senkte den Blick, starrte einen Moment wortlos zu Boden und zeichnete mit der Spitze seines Stabes vergängliche Kreise in die Oberfläche einer Pfütze, die sich auf dem Kopfsteinpflaster vor ihm gebildet hatte. »Vielleicht«, murmelte er. Er sah auf, lächelte nervös und unecht und sagte noch einmal: »Vielleicht.«
Aber sie wussten beide, dass es nur ein schwacher Versuch war, sich selbst zu beruhigen.
Oro fror plötzlich stärker, als sie zum Haus zurückgingen.
*
Resnec folgte dem Weg nur so weit, bis er sicher war, dass er von niemandem auf der Burg mehr gesehen werden konnte. Dann zwang er sein Pferd von der schlammigen Straße herunter, preschte eine kurze Böschung hinauf und brach durch dichtes Unterholz, ohne darauf Rücksicht zu nehmen, dass die dornigen Zweige tiefe, blutige Kratzer in die Haut seines Pferdes rissen. Für eine Strecke von vielleicht hundert, hundertfünfzig Schritten bahnte er sich so gewaltsam einen Weg durch das Unterholz, dann erreichte er eine schmale Lichtung, die an zwei Seiten von hohen, rissigen Felsen gesäumt wurde, und hielt an.
Er war allein. Der Wald schwieg, und mit seiner Stille und Kälte kam er ihm für einen Moment vor wie ein großes dunkelgrünes Grab.
Resnec war kein ängstlicher Mensch, aber er wusste, dass das Schweigen nicht allein auf den Regen und den Lärm zurückzuführen war, den er verursacht hatte, wenngleich beide gemeinsam ausgereicht haben mochten, alles Leben in weitem Umkreis zu vertreiben oder wenigstens zum Verstummen zu bringen. Auch die knisternde, unhörbare Spannung, die die Luft vibrieren und die Büsche angstvoll ihre Blätter zusammenziehen ließ, hatte andere Ursachen. Er wusste, was beides zu bedeuten hatte, und gerade dieser Umstand war der Grund für sein Schaudern. Es war keine Angst. Er hatte es unzählige Male erlebt, aber es war ihm niemals gelungen, sich an den Anblick zu gewöhnen oder den Schrecken, den er in ihm auslöste, vollends zu vertreiben.
Vor ihm bewegte sich ein Schatten. Sein Pferd, das mit seinen feinen Instinkten das Fremde, Falsche an diesem Vorgang zehnmal deutlicher spüren mochte als er, fuhr erschrocken zusammen und versuchte rücklings in den Wald zurückzuweichen. Aber Resnec zwang es mit einem harten Ruck, stehen zu bleiben. Mit einer Mischung aus Unbehagen und Neugier sah er den Schatten an.
Wie immer konnte er nicht wirklich erkennen, was geschah. Der Schatten wuchs, wurde zu einem Wirbel aus Dunkelheit und Schwärze und einem namenlosen Unbekannten. Dann teilte sich die Realität, und eine schwarz gekleidete Gestalt trat aus dem Reich der Schatten zurück in die Welt, die sie in ihrem Palast, tausend Meilen und die Dauer eines Atemzuges von hier, verlassen hatte.
Lassar.
Resnec sprang von seinem Pferd und wollte auf die Knie fallen, aber der Schattenkönig hielt ihn mit einer ungeduldigen Bewegung zurück. »Sprich!«
»Ich … habe getan, was Ihr befohlen habt, Herr«, sagte Resnec, ohne die schwarz gewandete Gestalt seines Meisters – oder gar sein Gesicht – anzublicken. »Aber es war, wie ich befürchtet hatte. Er weigert sich.«
»Dieser Narr.« Lassars Stimme war vollkommen kalt, ohne jegliches Gefühl. Resnec war nicht einmal sicher, ob der Herr der Schatten überhaupt in der Lage war, Gefühle zu empfinden. »Dieser starrköpfige, blinde alte Mann. Glaubt er im Ernst, sich meinem Willen widersetzen zu können?«
»Hochwalden ist stark, Herr«, erinnerte Resnec, wobei er sich hütete, auch nur den Anschein eines belehrenden Tones in seiner Stimme hörbar werden zu lassen. »Und er hat Faroan. Ich habe ihn nicht zu Gesicht bekommen, aber ich hörte, dass er ein mächtiger Magier ist.«
»Der mächtigste überhaupt«, sagte Lassar. »Und doch nicht mächtig genug.« Plötzlich lachte er. »So sei es, Resnec. Oro hat es nicht anders gewollt. Du weißt, was du zu tun hast.«
Resnec antwortete nicht sofort, aber Lassar schien auch so zu spüren, was in seinem Statthalter vorging. »Du hast Angst?«
»Das nicht«, sagte Resnec hastig. »Es ist nur …« Er schwieg einen Moment, blickte fahrig hierhin und dorthin – überallhin, nur nicht in das Schattengesicht unter der Kapuze – und verfluchte sich, nicht sofort geantwortet und damit Lassars Misstrauen geschürt zu haben. Jetzt würde er seine Bedenken aussprechen müssen und sich damit vielleicht Lassars Unmut zuziehen.
»König Oro ist ein mächtiger Mann«, begann er vorsichtig. »Sein Reich ist klein, und er hat nur ein paar Hundert Krieger, aber …«
»Aber er hat mächtige Freunde, wolltest du sagen«, fuhr Lassar fort, als Resnec nicht weitersprach. Er lachte leise. »Oh ja, ich weiß, mein Freund. Alle Reiche diesseits der Berge würden wie ein Mann aufstehen und sich gegen uns wenden; oder uns zumindest die Gefolgschaft verweigern – das ist es doch, was du fürchtest, nicht?«
Wieder lachte er, und diesmal war es ein kalter, harter Laut, ein Geräusch, als klirrten Eisstückchen in einem Becher aus Metall, das Resnec erschauern ließ.
»Ich weiß das alles, mein Freund«, fuhr Lassar fort. »Das und ein paar weitere Dinge, die deine Angst noch schüren würden, wenn du sie wüsstest. Der Schwarzeichenwald ist heilig. Noch nie hat es jemand gewagt, die Hand gegen ihn oder seinen Beschützer zu erheben. Täte es einer, würden sich alle Völker und Edlen, vielleicht sogar die Kaste der Magier selbst, gegen ihn wenden. Er würde untergehen, selbst wenn er so mächtig wäre wie ich.« Er schüttelte den Kopf. Resnec spürte die Bewegung, obwohl er ihn noch immer nicht ansah. »Nichts von alledem wird geschehen, Resnec.«
»Aber wie …?«
»Lass das meine Sorge sein«, unterbrach ihn Lassar. »Tu, was ich dir befohlen habe, und überlasse mir den Rest.«
Er sprach nicht weiter, und als es Resnec nach einer Weile wagte, den Blick zu heben, war die Lichtung leer. Lassar war so lautlos gegangen, wie er gekommen war. Die Schatten hatten sich wieder hinter ihm geschlossen. Aber wie immer, wenn Resnec seinem dunklen Herrscher begegnet war, blieb ein unsichtbarer Hauch von Kälte und Dunkelheit zurück, als wäre ein winziger Teil der Welt, in der sich der Herr der Schatten bewegte, zurückgeblieben und löste sich nur zögernd auf; wie Rauch nach einem übel riechenden Feuer.
Ein leises, knackendes Geräusch drang in Resnecs Gedanken und ließ ihn herumfahren. Automatisch zuckte seine Hand zum Schwert. Aber er führte die Bewegung nicht zu Ende.
Das Unterholz rings um die Lichtung teilte sich beinahe lautlos, und eine Anzahl dunkler, allesamt hochgewachsener Gestalten traten hervor. Resnec unterdrückte ein Schaudern.
Lassars Henker näherten sich ihm unterwürfig und blieben in respektvollem Abstand stehen, einen weit auseinandergezogenen Halbkreis großer, zottiger Körper bildend. Er wusste, dass sie ihm gehorchen würden, selbst wenn er sie in den Tod schickte, und trotzdem war alles, was er bei ihrem Anblick empfand, Angst.
*
Der Reiter an der Spitze der kleinen Kolonne zügelte sein Pferd und hob gleichzeitig die Hand. Eine schwerfällige Woge nervöser Bewegung lief durch den Tross, begleitet vom Klirren von Metall und dem Knirschen von Leder, dem unruhigen Schnauben und Stampfen der Tiere und unwilligem Gemurmel, ehe der letzte Reiter zum Stehen gekommen war.
Auch Gwenderon verhielt sein Tier ganz instinktiv für einen Moment, verwirrt durch den plötzlichen Halt. Dann, erfüllt von plötzlich aufflammender Besorgnis, sprengte er los, wobei seine rechte Körperhälfte und die Flanke des Pferdes unsanft durch das Unterholz rechts des schmalen Weges brachen.
Ein Ast traf ihn im Gesicht und riss ihm fast den Helm vom Kopf. Gwenderon schluckte einen Fluch herunter, galoppierte noch schneller – wobei er fast einen der Edelleute aus der Gefolgschaft des Prinzen über den Haufen rannte – und brachte sein Tier erst unmittelbar neben dem Krieger zum Halten.
»Was ist los?«, fragte er unwirsch.
Der Mann deutete stumm nach vorne. Der scharfe Verweis, der Gwenderon zunächst auf der Zunge gelegen hatte, wurde zu einem erschrockenen, nicht mehr ganz unterdrückten Ausruf.
Vor ihnen, nicht mehr als zehn Pferdelängen, erhob sich eine mannshohe, zottige braune Gestalt. Im Halbdunkel des Waldes hätte man sie fast für einen ungewöhnlich breitschultrigen und massigen Menschen halten können. Aber schon ein zweiter Blick zerstörte die Illusion.
Ihr Kopf war zu klein und das Gesicht spitz und wie das einer menschengroßen Maus nach vorne gezogen. Die Augen waren nicht mehr als kleine glühende Knöpfe unter der flachen Stirn und die Ohren wie die einer Katze dreieckig und nach allen Seiten beweglich. Die Hände, die denen von Menschen verblüffend ähnelten, endeten in fürchterlichen hornigen Krallen. Der Körper war mit fingerlangem, dichtem zottigem Fell bedeckt.
»Ein Raett!«, flüsterte er erschrocken.
Der Mann neben ihm nickte, und Gwenderon sah aus den Augenwinkeln, wie sich die Hand des Kriegers dem Schwert in seinem Gürtel näherte.
»Nicht«, flüsterte er. »Er will nicht kämpfen. Wenn sie uns überfallen wollten, hätten sie es geschickter getan.«





























