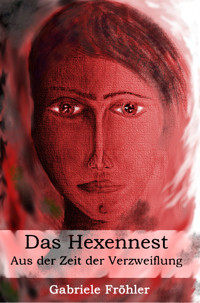
9,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Lemgo in Westfalen im Jahr 1665: Während der Regierungszeit des Bürgermeisters Hermann Grote und mit dessen massiver Unterstützung terrorisiert die letzte, aber blutigste Welle der Hexenverfolgung viele Bürgerinnen und Bürger der Stadt, die bald weit über ihre Grenzen hinaus als „Hexennest“ bekannt wird. Aberglauben, Habsucht, Missgunst und persönliche Abneigungen schüren ein Klima der Angst und des Misstrauens und schließlich die Flammen der Scheiterhaufen. Die Stimmen der Vernunft und des Mitgefühls erheben sich erfolglos gegen die Allianz aus Machtgier und Hass und eine brutale Kettenverfolgung wird in Gang gesetzt. Gesche, die Tochter des Apothekers Jakobus Färber, Elisa, die Zofe der standesbewussten und eitlen Schlossherrin Mathilde sowie deren gemeinsame Freundin Regine, eine angehende Kräuterheilkundige, werden unaufhaltsam in den Strudel der Ereignisse hineingezogen. Im Kampf um ihr persönliches Glück und die Unversehrtheit der Menschen, die sie lieben, geraten die jungen Frauen zunehmend in Gefahr........ Ein lebendiges und detailgetreues Sittengemälde des 17.Jahrhunderts in Westfalen, in dem außer der Hexenverfolgung u.a. die Kräutermedizin, das Scharfrichterwesen, die Lepra, die Küche der Zeit und höfische Feste auf unterhaltsame und spannende Weise thematisiert werden. Die Autorin ist Historikerin mit besonderem Interesse für Regionalgeschichte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Die Stadt - Szene 1
Die Mühle - Szene 2
Das Schloss - Szene 3
Die Stadt - Szene 4
Die Mühle - Szene 5
Das Schloss - Szene 6
Die Mühle - Szene 7
Das Schloss - Szene 8
Die Stadt - Szene 9
Die Mühle - Szene 10
Die Stadt - Szene 11
Riga - Szene 12
Die Stadt - Szene 13
Das Schloss - Szene 14
Die Stadt - Szene 15
Das Schloss - Szene 16
Die Stadt - Szene 17
Die Mühle - Szene 18
Die Stadt - Szene 19
Das Schloss - Szene 20
Die Stadt - Szene 21
Das Schloss - Szene 22
Die Stadt - Szene 23
Das Schloss - Szene 24
Die Stadt - Szene 25
Das Schloss - Szene 26
Die Stadt - Szene 27
Das Schloss - Szene 28
Die Stadt - Szene 29
Das Schloss - Szene 30
Das Leprosorium - Szene 31
Das Schloss - Szene 32
Die Stadt - Szene 33
Das Schloss - Szene 34
Noch zehn Tage - Szene 35
Noch 9 Tage - Szene 36
Noch acht Tage - Szene 37
Noch sieben Tage - Szene 38
Noch sechs Tage - Szene 39
Noch fünf Tage - Szene 40
Noch vier Tage - Szene 41
Noch drei Tage - Szene 42
Noch zwei Tage - Szene 43
Noch ein Tag - Szene 44
Die Stadt - Szene 45
Das Schloss - Szene 46
Impressum
Das Hexennest
Aus der Zeit der Verzweiflung
Vorwort
„Das Hexennest“ ist ein Roman, der von der Hexenverfolgung in Lemgo im 17. Jahrhundert inspiriert worden ist.
Lemgo bekam als einzige lippische Stadt die Blutgerichtsbarkeit vom Landesherrn Simon VI. (1554-1613) verliehen und hatte damit das Recht, bei bestimmten Straftaten über Leben und Tod seiner Bürger zu entscheiden. Lemgo gehörte innerhalb Deutschlands zu den Städten, in denen die Hexenprozesse besonders intensiv geführt wurden.
Alle Figuren sind Produkte der Phantasie der Autorin. Allerdings sind überlieferte biographische Elemente und Charakterzüge des Lemgoer Bürgermeisters Hermann Cothmann (* 1629 in Lemgo † 1683 ebenda) in die Figur des Hermann Grote eingeflossen.
Dessen Mutter, Katharina Goehausen fiel 1654 einem Hexenprozess zum Opfer, ihr Sohn scheute sich aber nicht, später zum Parteigänger ihrer Verfolger zu werden.
Sein Onkel, Hermann Goehausen, lehrte an der Universität zu Rinteln und veröffentlichte 1630 mit dem Buch „Wie man mit Unholden und Zauberischen Personen verfahren soll“ einen Leitfaden, der die harte Einstellung der Rintelner Juristenfakultät zum Ausdruck brachte.
Während Cothmanns Amtszeit 1666 bis 1683 wurden ungefähr 100 der Hexerei verdächtigen Personen hingerichtet. Im ersten Jahr seiner Amtszeit fällte er bereits 37 Todesurteile.
Obwohl ihm von den Gremien und Bürgern der Stadt aufgrund von Korruption und Habgier Widerstand entgegenschlug, blieb seine Macht unangetastet. Rückendeckung gab ihm der lippische Landesherr Simon Heinrich zu Lippe Detmold ( 1646 – 1697 ), der ihn aus Furcht vor Unruhen stützte und ihn außerdem bereits vor seiner Wahl zum Bürgermeister zum gräflichen Landrat ernannt hatte. Simon Heinrich und sein Vater Hermann Adolf zu Lippe Detmold (1616-1666), unter dessen Regentschaft die Mehrzahl der Detmolder Hexenprozesse stattfanden, verschmelzen als Vorbilder in der Figur des Landesherren Adolph Heinrich.
Anna Veltmans, auch bekannt unter dem Namen Witwe Böndel, war eine erfolgreiche Kauffrau. Sie geriet durch mehrfache Anschuldigungen in Hexereiverdacht, konnte aber eine Kaution hinterlegen und wurde freigelassen. Nach dem Tode ihres zweiten Ehemannes wurde sie erneut verdächtigt, angeklagt und gestand unter der Folter. Nach Zahlung der geforderten Summe wurde sie zum Schwert begnadigt und am 23. Dezember 1665 hingerichtet. Ihr Schicksal und die Umstände ihres Todes spiegeln sich in der Figur der Witwe Bender wider.
Das Leben und der Alltag der beschriebenen Personen könnten ansonsten ähnlich wie beschrieben abgelaufen sein. Die Autorin hat ihrer Phantasie lediglich erlaubt, mit den realen Gegebenheiten und Möglichkeiten der damaligen Zeit zu spielen. Diese hat sie in der wissenschaftlichen Literatur und bei diversen Exkursionen recherchiert.
Die Stadt - Szene 1
Seit dem frühen Morgen waren zu Gesches Freude pudrige Flocken vom Himmel gefallen. Auf den Straßen, Gassen und Plätzen wuchs ein Teppich aus Schnee, der die Kinder zu allerlei Spielen aus den Häusern lockte und die vertrauten Geräusche des Marktes dämpfte.
Gesche stand am Fenster ihres Zimmers im ersten Stock der Apotheke und ließ ihre Augen über das geschäftige Treiben wandern. Vor dem Dreißigjährigen Krieg, hatte ihr Jakobus erklärt, wäre die Anzahl der Stände von Krämern, Bauern und Handwerkern sehr viel größer und das Angebot an Waren aus fernen Ländern deutlich umfangreicher gewesen. Das aberwitzige Schlachten hatte Schneisen der Verwüstung durch die Länder geschlagen, viele Straßen unpassierbar und unsicher gemacht.
Beim Gedanken an den Krieg fröstelte Gesche und zog sich das warme Tuch unwillkürlich fester um die schmalen Schultern. Abwechselnd hatten die Schweden und die kaiserlichen Truppen die Stadt und ihre Bewohner heimgesucht. Die Soldaten schlugen ihre Quartiere in deren Häusern auf und bedienten sich freudig an dem, was sie fanden, ohne Rücksicht auf die Bewohner zu nehmen. Man fraß sich satt und soff, was die Schenken und Keller an Bier und Wein hergaben. Auf den Gassen wäre Tag und Nacht ein Juchzen, Singen und Fiedeln gewesen, hatte ihr Vater weiter erzählt. Viele Soldaten hatte der Krieg verroht und sie suchten ihr tägliches Vergnügen darin, die Bürger um des eigenen Vorteils Willen zu drangsalieren. Als Kind hatte er mit ansehen müssen, wie zwei entmenschte Gesellen seinen Nachbarn, den alten Henrich, auf den Boden geworfen, ihm ein Stück Holz zwischen die Zähne gerammt und ihm schließlich mit einem Melkkübel jauchiges Wasser in den Schlund geschüttet hatten, um ihm die Lage von versteckten Gütern zu entreißen. Bereits vollständig ausgeplündert, gab es nichts mehr zu verraten und so flossen Unmengen des stinkenden Nass in den Hals des alten Mannes, bis dessen Kopf blaurot gefärbt zur Seite fiel. Auch die Frauen... An dieser Stelle seines Berichtes hatte sich ihre Mutter Susanne warnend geräuspert und Jakobus war umgehend verstummt, aber indessen war Gesches Neugier erwacht. Ihr Vater hatte sich nicht lange bitten lassen, sondern er fuhr fort, nachdem er seinem Eheweib einen beruhigenden Blick zugesandt hatte.
Vom Rat verlangten die Kommandeure Geld, Brot und Rüstungen und verließen die Stadt an der Spitze ihrer Soldaten erst nach Wochen und Monaten des Plünderns und Brandschatzens.
Neben den regulären Truppen gab es versprengte Söldner, deren Raubzüge die Stadt sich zu erwehren hatte. Die Bürger wurden zum Dienst auf den Mauern verpflichtet und jene, die ihre Pflicht schlecht versahen, bekamen einen scharfen Verweis vom Rat, wenn es einem zuchtlosen Soldatenhaufen gelungen war, sich Einlass in die Stadt zu verschaffen, was unausweichlich zu den gefürchteten Folgen führte. „Nun aber“, Jakobus hatte erleichtert ausgeatmet, „ist der Krieg schon seit Jahren vorbei, wofür ich Gott täglich danke.“
Der melodische Klang der Glocken von Sankt Nicolai läutete das Ende des Marktes ein und riss Gesche aus ihren Gedanken. Die Wolken hatten sich indessen zu Gebirgen getürmt, die bleigrau und gefährlich tief über der Stadt hingen. Ein scharfer Wind trieb die immer dichter fallenden Flocken über den Markt und entlockte den Händlern saftige Flüche, während sie eilig ihre Waren in Kisten und Körben verstauten. Kaum war der letzte Karren vom Platz gerumpelt, erschien wie aus dem Nichts kommend, eine dunkel gekleidete Gestalt, die sich mit weit ausholenden Schritten in Richtung der Apotheke kämpfte.
Gesche kniff die Augen zu schmalen Schlitzen zusammen, um erkennen zu können, wen es in offensichtlich dringenden Angelegenheiten zur Eile trieb. Es war ein Mann, entschied sie, aber keiner, den sie gut kannte wie Dietrich, den alten Freund ihres Vaters oder den dicken Ulrich, der wöchentlich mit hochrotem Kopf und unter viel Schnaufen das Feuerholz lieferte. Sicherlich würde gleich ein energisches Klopfen an der Haustür ertönen, mit dem ein besorgter Ehemann oder Vater Einlass verlangte, wenn die Apotheke bereits geschlossen war, um eine Arznei für die fiebernde Frau oder den zahnenden Säugling zu erbitten. Schon häufig hatte Gesche von ihrem Lieblingsplatz in der breiten Fensternische aus die meist sorgenvollen Gesichter der Hilfesuchenden beobachten können und allein der Gedanke an die Künste ihres Vaters hielt das unweigerlich aufsteigende Mitgefühl in erträglichen Grenzen.
Nach einem prüfenden Blick über den menschenleeren Marktplatz stand der unbekannte Besucher, den schwarzen Hut tief ins Gesicht gedrückt, vor der schweren Holztür mit dem kunstvoll gefertigtem Griff. Ein Schmied aus der Nachbarstadt hatte ihn mit einem verlegenen Grinsen anstelle der fälligen Taler für eine seit langem offene Rechnung angeboten und der Apotheker hatte ohne Umschweife in die dargebotene Hand eingeschlagen.
Gesche hatte den Blick schon vom Fenster abgewandt, als eine unvermutete Bewegung des Mannes, die sie gerade noch aus den Augenwinkeln heraus registrierte, erneut ihre Aufmerksamkeit weckte. Statt, wie von ihr erwartet, weit auszuholen, um die geballte Faust gegen das Eichenholz donnern zu lassen, ging der seltsame Besucher in die Hocke und scharrte den Schnee mit hastigen Bewegungen zur Seite. Gespannt beobachtete das Mädchen, wie er immer noch kniend unter seinen Mantel griff, aus seinem Wams einen Umschlag zog, ihn unter den Türschlitz schob, sich im Drehen erhob und innerhalb eines Lidschlags in dem Vorhang aus tanzenden Flocken verschwand.
Wer war dieser Mensch? Ob wohl sein Kind oder die Frau krank war? Im Winter starben vor allem die Armen, die ihre Stube nicht warm und den Magen nie voll bekamen. Warum hatte er nicht angeklopft? Oder ging es nicht um eine Arznei?
Gedankenverloren starrte Gesche über den Platz und fand erst in die dämmrige Kühle ihres Zimmers zurück, als sie gewahr wurde, dass sie auf dem Ende ihres rechten Zopfes kaute, eine Unsitte aus Kindertagen, die abzulegen sie sich seit Jahren redlich bemühte. Verärgert spuckte sie eine Strähne buchenholzfarbenen Haares zur Seite und beschloss, dem seltsamen Vorgang auf den Grund zu gehen. Anschließend sollte sich in der Küche doch eine Leckerei finden, um den leise knurrenden Magen bis zum Abendessen ruhig zu stellen. Zog nicht gerade der Duft von frisch gekochtem Apfelkompott durch das Haus? Gesche lief das Wasser im Mund zusammen.
Das weiße Quadrat zog ihren Blick magisch an sich, als sie auf dem Weg in die Küche die dämmrige Diele durchquerte. Ohne Umschweife entfaltete sie den Bogen, der an Jakobus adressiert war und schob dabei jeden Gedanken an die unverzügliche Übergabe der Post an Vater oder Mutter zur Seite. Neugier, das wusste sie schon seit langem, war eine Eigenschaft, die das Leben auf vielerlei Weise versüßen konnte.
Gesche sah die Zeichnung eines Haus, das ihr wage bekannt vorkam, neben der eines kegelförmigen Gebildes, das eine deutlich lesbare Aufschrift trug.
BLOCKSBERG entzifferte das Mädchen entgeistert. Zwischen Haus und Berg schwebte ein Besen, auf dem eine ungeschickt gekritzelte Frauenfigur balancierte. Ein beschrifteter Pfeil gab ihr einen Namen: WITWE BENDER .
„Möchte ich hiermit kundtun, dass dies Weib eine Zauberische ist“, klagte die Überschrift des Bildes die Witwe zusätzlich an.
Gesche, die Tochter des Ratsherrn Färber, hatte lesen und schreiben gelernt. Auf den ausdrücklichen Befehl ihres Vaters hin war sie zwei Jahre gemeinsam mit den Brüdern Friedrich und Wilhelm von einem Hauslehrer unterrichtet worden. Nur der Respekt, den Jakobus in der Stadt besaß, hatte das Getuschel allmählich zum Verstummen gebracht. Ein gelehrtes Frauenzimmer war vielen braven Bürgern eine Sünde gegen die Natur der Frau, ein widerwärtiges, aufsässiges Geschöpf, das sich dem Ehegatten überlegen wähnte, den Haushalt und die Kinder nicht versorgen mochte und seine Zeit damit vertat, fromme Traktate und - schlimmer noch - Liebesgedichte lesend auf der faulen Haut zu liegen.
Auch Gesches Mutter hatte mit ihrer Abneigung gegen das Vorhaben nicht hinter dem Berg gehalten.
„Mann, was soll denn daraus Gutes entstehen? Du setzt deiner Tochter nur Flausen in den Kopf. Wozu soll ein Mädchen lesen und schreiben können? Kaufleute, Pfarrer und Advokaten, die müssen es lernen und am besten auch noch das Lateinische und die Mathematik dazu. Aber Gesche ist nun mal ein Mädchen, auch wenn ich es manchmal kaum glauben kann und gehört in die Küche und ans Spinnrad.“
Jakobus Färber hatte sein temperamentvolles Eheweib beruhigt.
„Es wird ihr nicht schaden. Im Gegenteil, sie kann Trost und Ruhe in der Bibel finden und wer weiß, vielleicht findet sie einen Ehemann, dem sie im Kontor zur Hand gehen kann. Und vorlesen wird sie mir, wenn sich im Alter meine Augen trüben.“
„Und wenn sie mir im Haushalt dann nicht mehr zur Hand gehen kann, weil sie Stunde um
Stunde über den Büchern hockt? Glaubst du, es kehrt und putzt sich von allein?“ „Frau!“ Ganz gegen seine Gewohnheiten hatte Jakobus seine Stimme erhoben. „Eine Köchin und zwei Mägde sind dir zu Diensten. Scheuerst du auf Knien die Dielen mit Sand? Schleppst du die Wassereimer ins Haus? Du hast doch täglich Zeit, um mit der Nachbarin zu tratschen. Den Markt besuchst du auch nicht nur, um Milch und Butter einzukaufen. Du schaust doch gerne und ausgiebig, was die Händler so an Tand und Stoffen feil bieten.“
Verlegen hatte Susanne die Augen niedergeschlagen und zur Seite gesehen. Obwohl sie in ihrer langen Ehe mit dem fünfzehn Jahre älteren Jakobus im Grunde ihres Herzens recht zufrieden war, so kamen ihr doch immer wieder Gedanken in den Sinn, die sie vor ihrem Mann verbarg. Nicht wenige davon drehten sich um solch nichtigen Dinge wie ihr Äußeres und welche Sorgen und Freuden es ihr bereitete. Es waren tadelnswerte Gedanken, die sie regelmäßig beichtete und die dafür auferlegte Buße mit Inbrunst auf den Knien rutschend erledigte. Vierzig Jahre war sie alt und schon lange keine junge Frau mehr. Aber nach wie vor liebte sie das Knistern von glänzendem Taft, den beruhigenden Glanz feiner Seide, die aufwendig gefertigten Klöppelspitzen, die schmeichelnden Borten, Bänder, Kragen und Hauben. Noch war ihr Körper fest und geschmeidig und machte sich gut in der neuen Mode, die seit kurzem vom Hof des französischen Ludwigs nach ganz Europa und selbst auf den heimischen Markt geschwappt war. Welche Eleganz lag in den Schnitten und welch verfeinerte Raffinesse in den Details! Nur noch ein Weilchen wollte sie die Blicke der Männer bewundernd auf sich liegen fühlen, bevor das Alter ihr das Gesicht zerfurchte und ihrer Kehle und Brust die Festigkeit nahm. Viele Taler waren bereits aus der Börse ihres Mannes in die von Schneidern, Schustern und Putzmacherinnen geflossen und jeder davon war ihrer Ansicht nach gut angelegt. War sie nicht die Frau eines der angesehensten Bürger der Stadt? Ginge sie im schlichten Leinen, hielte man sie eher für die Magd als für die Gattin des Apothekers und Ratsherren Färber.
Selbstbewusst hatte sie den Kopf gehoben und Jakobus fest in die Augen geschaut.
„Die Bibel lesen? Mein lieber Mann, was in deinen Bücherschränken steht, ist nicht nur gottesfürchtig. Das weiß selbst ich, die keinen Buchstaben entziffern kann. Ich kenne dich. Du hegst mehr als nur ein Quäntchen Ungehorsam gegenüber Gott und der Obrigkeit in deinem Herzen.“
„Und“, hatte ihr Mann sie mit ernster Miene gefragt, „hat es dir oder mir jemals geschadet, dass ich mir meine eigenen Gedanken machen kann und will? Gehe ich nicht zur Kirche wie jeder andere fromme Bürger auch? Und ich sorge gut für die Meinen, oder willst du klagen, dass du Mangel leidest?“
„Jakobus, versteh mich nicht falsch!“, hatte Susanne abgewiegelt. „Du kannst deine Gedanken fest in dir verschließen, so dass kein Sterbenswörtchen zu Ohren der Menschen gelangt, die dir schaden können. Aber Gesche? Ich habe Angst, dass sie in aller Unschuld Gotteslästerliches heraus plappert und dann ins Gerede kommt. Du weißt doch“, hatte sie ihren Mann beschworen, „wie gefährlich so etwas werden kann!“
Insgeheim hatte Jakobus seiner Frau Recht geben müssen. Zwar waren die Feuer der Inquisition erloschen und seit Jahren hatte im Ort kein Scheiterhaufen mehr gelodert, aber konnte man sich je sicher sein, dass ein offenes Wort zu Fremden oder selbst zu Nachbarn gesprochen, nicht böse Folgen nach sich zog? Ein Ketzer war nirgends wohl gelitten und lebte gefährlich. Jakobus hatte ein Weilchen gezögert, bis er seiner Frau geantwortet hatte.
„Die Vorsicht ist eine Tugend, die Angst jedoch eine Plage, die unser Leben nicht regieren soll. Ich werde Gesche erklären, welche Bücher sie im Gespräch mit anderen Menschen außer uns besser nicht erwähnt. Zwei Stunden am Tag soll sie lesen und schreiben lernen. In der restlichen Zeit kann sie ihre häuslichen Pflichten erledigen.“
Seit Jahren studierten die Söhne eine ganze Tagesreise entfernt an der nächstgelegen Universität, während die Tochter der Mutter zur Hand ging, um Kenntnisse zu erwerben, die für eine zukünftige Hausfrau und Mutter unverzichtbar zu sein schienen.
Gesche verabscheute das sich endlos wiederholende Einerlei der Hauswirtschaft und hätte ihr Leben als öde und leer empfunden, wenn da nicht die kostbare Stunde nach dem Abendessen gewesen wäre. Diese Zeit gehörte Vater und Tochter, um die Schriften von Philosophen, Theologen und Medizinern zu diskutieren. Sinnsprüche wurden nicht selten unter Gelächter zitiert und gemeinsam erfreute man sich an den gedrechselten Zeilen der Lyrik. Für Andreas Gryphius, den vor einigen Jahren erst verstorbenen Poeten, konnten sich beide begeistern, auch wenn sie ansonsten beileibe nicht immer der gleichen Meinung waren. Gesche schwärmte besonders für die Schriften Agrippas von Nettelheim, der die Frauen lobte und glaubte, dass sie den Männern geistig ebenbürtig würden, falls man sie nur studieren ließe. Nach einigem Nachdenken hatte Jakobus zu Gesches insgeheimer Freude dem großen Gelehrten Recht gegeben.
Jetzt war es kein Buch, sondern ein einfaches Blatt Papier, dessen unmissverständliche Botschaft die ganze Familie bedrohte, das spürte das Mädchen sofort. Mit einem flauen Gefühl im Magen versenkte Gesche den Brief in ihrer Schürzentasche. Bei passender Gelegenheit würde sie ihn Jakobus übergeben und gemeinsam beraten, was zu tun sei. Ihre Mutter wegen solch einer Schmiererei zu ängstigen, war erst einmal nicht nötig, versuchte sie sich zu beruhigen.
Was wurde hier von ihrem Vater verlangt? Warum richtete sich die infame Denunziation ausgerechnet an einen Mann, der Friedrich von Spee verehrte? Der Jesuitenpater war Autor des 1631 erschienenen Buches CAUTIO CRIMINALIS, in dem er mit scharfsinniger Argumentation und geschickter Rhetorik seine Bedenken gegen die Hexenprozesse vortrug. Neben dessen theoretischen Abhandlungen schätzte Jakobus auch die Kirchenlieder des frommen Mannes, darunter besonders „Zu Bethlehem geboren“, das viel Anklang selbst in der lutheranisch reformierten Kirche von Sankt Nicolai gefunden hatte. Dem frommen Mann hatte sein Eintreten für die der Hexerei Verdächtigen keinen Segen gebracht. Der Orden hatte ihm zwei Jahre nach Erscheinen des Buches seine Position als Moraltheologe in Paderborn entzogen und nach Trier gesandt, wo er unter anderem als Beichtvater in Gefängnissen und Krankenhäusern tätig war und sich 1635 bei der Betreuung und Pflege pestkranker Soldaten infiziert hatte und gestorben war. Ein Anhänger des von Spee konnte niemals ein Parteigänger der Hexenverfolger sein und Jakobus hatte mit seiner Verehrung für diesen integren Mann nicht hinterm Berg gehalten.
„Nein“, dachte Gesche weiter, „das kann nicht, das darf nicht sein. Der Spuk ist doch schon seit Jahren vorbei. Ja, woanders, das hörte man immer wieder, wurden Frauen, bisweilen auch ein paar Männer verbrannt. Aber hier? Und ausgerechnet Jakobus Färber, ein erbitterter Gegner der Hexenverfolgung, sollte die Jagd erneut in Gang setzen? Da gäbe es sicherlich geeignetere Männer als den Apotheker. Vielleicht war die ganze Angelegenheit nur ein übler Scherz.“
„Wo bleibst du? Hast du mein Rufen nicht gehört?“ Susanne streckte ihren vom Herdfeuer krebsrot angelaufenen Kopf durch die Küchentür und sah ihre Tochter auffordernd an. „Dein Vater hat heute Abend eine Sitzung im Rathaus. Deshalb essen wir früher. Sag ihm bitte Bescheid.“
Ein paar Schritte nur und das Mädchen stand vor der schweren Eichentür, die die Apotheke mitsamt Kräuterkammer, Labor und Hinterzimmer vom Rest des dreistöckigen Fachwerkhauses trennte. Übermannshohe Bücherregale, Kupferstiche ferner Städte und eine kostbare Karte, die dem Betrachter die bekannte Welt näher bringen wollte, zierten die Wände.
Jakobus stand an seinem lederbezogenen Schreibpult und beendete gerade in dem Moment, als seine Tochter in der Türöffnung erschien und ihn zu Tisch bat, die Lektüre des Briefes von Julius Wolf, mit dem er regelmäßig korrespondierte.
Lieber Jakobus,
als alter Freund und Studienkollege danke ich für Deinen Ratschlag, mich um die Aufnahme in die „Naturforschende Gesellschaft“ zu bewerben, die sich mittlerweile auch hier in Rostock gegründet hat. Genau wie Du fühle ich mich ich den Wissenschaften seit unseren gemeinsamen Jahren an der hiesigen Universität zutiefst verpflichtet, denn ohne Fortschritt wird die Welt noch tiefer in Unwissenheit versinken, als das bisher schon der Fall ist. Jeder Forscher kämpft auch gegen die Barbarei, jede Entdeckung ist ein Sieg der Vernunft über Dummheit und Aberglauben. Mit besonderer Hoffnung betrachte ich auch die Entwicklung in der Medizin und Pharmazie. Nur hier kann der Kampf gegen die Geißeln der Menschheit, die Franzosenkrankheit und die Pest gewonnen werden. Gegen erstere habe ich gestern aus London eine neuartige Rezeptur erhalten, sie Dir umgehend kopiert und diesem Schreiben beigelegt. Berichte mir, sobald du Erfahrungen damit gesammelt hast. Ich werde ebenso verfahren.
Es grüßt Dich Julius Wolf
Jakobus ließ den Brief sinken und nickte seiner Tochter zu.
***************************
Im Hinterzimmer der Ratsapotheke studierte Jakobus einige Tage später mit zunehmender Begeisterung das Rezept seines Freundes, als ihn die Türglocke aus seiner Versunkenheit riss und ihn nach vorn in die Apotheke rief.
Heinrich Mertens, ein alter Maurermeister, verlangte lauthals ein Mittel gegen seine Magenschmerzen, während er vergeblich gegen das Schwanken seines immer noch kräftigen Körpers ankämpfte.
„Weil wir uns lange kennen“, der Apotheker sah sein Gegenüber bekümmert an, „muss ich dir einfach sagen, dass der Saufteufel schuld an deinen Beschwerden ist. Lass den Branntwein aus dem Körper, dann geht es deinem Bauch wieder besser. Und außerdem“, seine Stimme wurde lauter, „schämst du dich nicht, wegen deiner Trinkerei die Arbeit zu versäumen? Was die Soldaten zerschossen und zerschlagen haben, muss wieder aufgebaut werden. Mach die Augen auf, wenn du zur Ausnahme mal nüchtern bist. Obwohl der Krieg jetzt schon Jahrzehnte vorbei ist, sehe ich immer noch viele Ruinen. Die Bürgerschaft braucht tüchtige Handwerker wie dich, die anpacken, damit es wieder aufwärts geht“
Mertens lachte höhnisch auf. „Auch wenn Tilly oder die Schwedischen schon längst in der Hölle schmoren, so kann ich mein Leben nicht mehr an einen dauerhaften Frieden glauben. Wieder und wieder habe ich Stein auf Stein gesetzt, nachdem die Besetzung der Stadt vorbei war und wieder und wieder kamen die nächsten Truppen, um das gleiche böse Spiel noch mal zu treiben. Jetzt mag ich nicht mehr an den Frieden glauben.“
„Heinrich, der Krieg ist fast zwanzig Jahre vorbei.“
„Und wenn schon“, blieb der alte Mann störrisch, „viele Leute haben ihr Hab und Gut verloren. Die Stadt ist verarmt und die Menschen, ach, die Menschen, die haben sich durch den Krieg verändert. Roh sind sie geworden, sie fluchen gotteslästerlich, krakeleen auf der Straße und die Männer tragen ihre letzten Groschen zu den Dirnen.“
„Ja gut“, gab der Apotheker widerstrebend zu, „es liegt noch vieles im Argen. Aber steht das Korn nicht reif und glänzend auf den Feldern? Vieles ist wieder aufgebaut. Nach und nach wird sich alles aufs Beste richten. Vertraue auf Gott, Heinrich. Und lass dein Herz nicht auf Dauer verbittern. Viel zu lange schon haderst du mit Schrecken, die lange vergangen sind.“
Mertens gab einen resigniert klingenden Laut von sich. „Solche wie du, die immer wieder an das Gute glauben, haben nicht gesehen, was ich sah. Der Krieg brachte das Gemeinste in den Menschen zu Tage. Schreckliche Anblicke haben sich in meinem Kopf festgesetzt.“ Er seufzte tief auf.
„Bitte gib mir jetzt meine Medizin. Schließlich bist du nicht für meine Seele, sondern für meinen Magen zuständig!“
„Nun gut, du weißt, woran du bist mit deiner Trinkerei, die dir den Magen ruiniert. Fürs Erste dürfte das dir helfen.“
Der Apotheker holte eine verstöpselte Phiole aus einer der vielen Schubladen der deckenhohen Schränke. „Hier eine Tinktur aus Wasserminze und Schöllkraut. Das ist im Moment das Beste, was ich dir anbieten kann. Nimm drei Mal täglich fünf Tropfen auf einen Becher Wasser und bring die leere Phiole zurück. Sie ist kostbar. Für die Medizin zahlst du drei Groschen und bekommst zwei zurück, wenn du mir die Phiole bringst.“
Widerwillig suchte der Alte die Münzen aus seiner Börse, als Trommelklang und Fanfarenstöße über den Marktplatz vor der Apotheke schallten
„Mein Gott, da kommt dieses fahrende Pack, diese Schauspieler“, ärgerte sich Heinrich. „Ich geh jetzt los und verrammele Fenster und Türen. Ich weiß genau, wozu diese zerlumpten Gesellen fähig sind.“
Brummelnd verabschiedete er sich von Jakobus, der ihm kopfschüttelnd nachsah. Danach schloss er eilig die Tür hinter sich ab und gesellte sich zu den Menschen, die aus allen Gassen und Winkeln zusammenströmten. Seit Tagen hatte warmes Wetter den Schnee getaut und die ersten Knospen sprießen lassen. Ein verheißungsvoller Geruch nach Frühling lag in der Luft.
Jung und alt, reich und arm gruppierte sich um einen jungen Mann im Kostüm eines Harlekin, der gerade seine Fanfare absetzte. Sein etwa gleichaltriger Begleiter, in bunte Pluderhosen und eine ebensolche Weste gewandet, schlug einen Trommelwirbel.
„Verehrtes Publikum“, der Harlekin hatte eine kräftige und wohlklingende Stimme stellte Jakobus anerkennend fest und spitzte die Ohren. „Heute Abend zeigen wir hier die traurige Geschichte von zwei Liebenden aus dem fernen Italien, erdacht von dem berühmten Meister Shakespeare aus England. Ihr werdet mutige Männer, liebreizende Frauen, den Ausdruck der innigsten Liebe und den des tiefsten Schmerzes sehen. Versäumt nicht die tollkühnen Fechtszenen und die atemberaubenden Kostüme. Heute Abend, wenn die Fanfare ruft, wird unsere Schauspieltruppe eure Herzen verzaubern und euren Geist belehren.“ Mit einer tiefen Verneigung zog er den Hut und verschwand mitsamt seinem Begleiter in der Menge.
Jakobus war entzückt. Nicht allzu oft fand eine Wanderbühne den Weg in den kleinen Ort. An Unterhaltung mangelte es ihm hier oft in der Enge der kleinen Stadt und bisweilen dachte er wehmütig an seine Studienjahre in Rostock zurück. Nein, er wollte nicht ungerecht sein. Die wöchentliche Partie Tarock mit seinem Freund Dietrich würde er nicht missen wollen. Aber für Gesches wissbegierigen Geist, der dem ihrer Brüder mindestens ebenbürtig war, gab es bis auf die Bücher und die abendlichen Unterhaltungen mit ihm kaum Anregungen. Mädchen ihres Alters und Standes hatten meist nichts anderes im Sinn, als so schnell wie möglich eine standesgemäße Partie zu machen und langweilten seine Tochter. Versonnen runzelte Jakobus die Stirn. Vielleicht war es doch ein Fehler gewesen, Gesche in die Welt von Philosophie und Literatur einzuführen. Er schüttelte die trüben Gedanken ab und strebt mit schnellen Schritten zurück ins Haus, wobei er spitzbübisch lächelte. Sicherlich freute sich seine Frau über die unerwartete Gelegenheit, ihren neuesten Sonntagsstaat auszuführen.
Die Mühle - Szene 2
Da kamen sie wieder, die finsteren Gedanken und die Bilder, die so plastisch waren wie die Holzschnitzereien in Sankt Nicolai, die einem gottesfürchtigem Ritter des letzten Jahrhunderts gewidmet waren. Viele Male hatte sie in der Kirche gesessen und die Figuren der Sterbetafel studiert, die Menschen jeden Standes in Freude und Hoffnung, aber auch in Leid und Qual zeigten. Diese Beschäftigung hatte ihr zuverlässig dabei geholfen, die schütteren Gesänge der Gemeinde und im Winter die Kälte auszublenden.
Regine schloss die Augen in dem vergeblichen Versuch, der marternden Erinnerungen Herr zu werden. Ihre Mutter musste in dem Moment, als sie das Klappern der Hufe gehört hatte, gewusst haben, dass es zu spät war, um fliehen zu können. Ganz sicher zu spät für sie, aber vielleicht nicht für ihre Tochter, die das Erstarren der Mutter registriert und ängstlich zu ihr hoch gesehen hatte. „Lauf, so schnell du kannst und versteck dich, bis es dunkel wird.“ Anna hatte Regine einen auffordernden Schubs in Richtung des Waldes, hinter dem der Müller und seine Familie lebten, gegeben und war dann in die entgegengesetzte Richtung geflüchtet. Zwei Reiter waren unter lautem Johlen aus dem dichten Herbstnebel aufgetaucht und unaufhaltsam heran geprescht. Die Jagd auf die Frau und das kleine Mädchen hatte begonnen.
Regine war gelaufen. War über den Acker gerannt, auf dem Mutter und Tochter mühsam Korn für Korn gelesen hatten, war gefallen, hatte sich wieder berappelt. Mit jedem Schritt waren die kleinen Füße in den groben Holzpantinen schwerer geworden und das wütende Schnauben des gehetzten Pferdes war näher und näher gekommen. Der lehmige Boden war nass gewesen und wieder war das Kind gestürzt. Als es zu Tode erschrocken einen Blick nach oben warf, hatte es einen Reiter in der Kleidung der Landsknechte mit dem Bischofskragen aus Kettengeflecht, der Hals und Schultern bedeckte, direkt über sich gesehen.
„Komm her“, der Mann hatte mit einer Furcht erregenden Pistole gewunken und Regines Mund war vor Angst trocken und ihre Hände feucht geworden. „Wir werden gleich ein bisschen Spaß zusammen haben. Bei einer wie dir werde ich mir keine üble Krankheit holen wie bei der letzten Hure.“
Er hatte sich angeschickt, vom Pferd zu steigen, als ein gellender Pfiff ertönte, der den Mann zur Hilfe rief.
Sein schiefes Lächeln hatte bedauernd gewirkt, als er dem Kind einen kalten Blick aus schwarz-braunen Augen zugeworfen hatte, bevor er das Pferd mit einer herrischen Bewegung wendete und zu seinem Spießgesellen aufschloss.
Das Mädchen hatte von Weitem den von vornherein verlorenen Kampf seiner Mutter verfolgt, die wütend und schreiend um sich schlug, bis Regines Verfolger sie erreicht und sich gleichfalls auf Anna geworfen und sie festgehalten hatte. Die Schreie ihrer Mutter erstarben und nur ein verzweifeltes Wimmern und die vor Erregung heiseren Stimmen der Männer waren noch an das Ohr der Tochter gedrungen. Annas erbitterter Widerstand verschaffte dem Mädchen die Zeit, sich in Sicherheit bringen zu können. Regine hatte dennoch endlose Sekunden wie auf dem Acker festgewurzelt gestanden, bis sie schließlich den Blick abgewandt hatte und wie von tausend Furien gehetzt in den Wald geflohen war.
Eine Amsel schlug an und Regine schreckte aus ihren Erinnerungen hoch. Quälend waren sie, diese immer wiederkehrenden, nicht abzuschüttelnden Bilder. Ihre Mutter, die mit Blut und Lehm verschmutzt, erst spät in der Nacht nach Hause fand, ihr verweintes Gesicht zerschlagen. Später zehrte ein Fieber, das sie für Wochen aufs Lager streckte, ihren ohnehin schmächtigen Körper weiter aus. Das nachdrückliche Kopfschütteln der alten Kräuterfrau, als sie Anna mit Bedauern in der Stimme mitteilen musste, dass diese zu spät für den helfenden Trank komme. Der Vater, der kein tröstendes Wort fand und gänzlich verstummte, als der Leib der Mutter sich nach Monaten zu wölben begann. Der Ausdruck von Qual und Scham in den Augen von Anna, der bis zu ihrem Tod nicht mehr weichen sollte.
Die Strahlen der Morgensonne ließ die Lockenpracht des Mädchens rotgolden erglänzen. Regine jedoch hatte keine Augen für die Schönheit des ersten sonnigen Tages nach vielen Wochen Schnee und eisiger Kälte. Weder das baldige Grünen und Blühen des Gartens, noch das Azurblau des Himmels waren ihr einen Gedanken wert oder geeignet, ihren Kummer zu dämpfen. Ein namenloser Zorn regte sich bisweilen in ihr, eine Wut, die sie zu unterdrücken suchte, wenn sie wie jetzt aufflackerte und dem Mädchen Ideen eingab, über die Regine mit keiner Menschenseele zu reden wagte. Je älter sie wurde, umso mehr verstand sie die Warnungen des Vaters und versuchte mit aller Macht, den Fluss ihrer aufrührerischen Gedanken in eine andere Richtung zu lenken, wenn sie fühlte, wie die Empörung sie übermannte. Heute wollte die Anstrengung nicht fruchten.
Der Ärger über sich selbst fuhr ihr in die Arme, die kraftvoll den Besen führten. Mit Schwung kehrte sie den Unrat des Winters vom Hof, die trüben Erinnerungen aber wollten nicht weichen. Regines ausdrucksvolles Gesicht verdüsterte sich beim Gedanken an ihre Mutter und Tränen stiegen ihr in die Augen.
Es hatte damals hier draußen vor den Mauern der Stadt keinen Schutz vor den Söldnern gegeben, die, schon vor Jahren aus Kriegsdiensten entlassen, immer noch marodierend umher gezogen waren und sich nahmen, was sie zu brauchen glaubten. Geld, Schmuck, Kleider wurden geraubt und die Körper der Frauen und Mädchen geschändet. Selbst die Betten wurden aus den Häusern geschleppt und was die entfesselte Soldateska nicht brauchen konnte, schlug sie zum Vergnügen oft noch kurz und klein.
„Nur die da drüben“, dachte Regine wohl zum hundertsten Male und warf einen verbitterten Blick auf das Schloss, „waren verschont geblieben hinter ihren dicken Mauern. Selbstverständlich hatten sie sich auch von den unliebsamen Einquartierungen, die der Rat beschlossen hatte, freigekauft.“ Für vierhundert Taler konnte man ein Haus am Marktplatz erwerben, ein großes mit einer Badestube und vielen Giebeln, die den Leuten zeigten, dass hier ein Herr mit seiner Familie wohnte. Ein Raunen war durch den Landstrich gegangen, als man hinter vorgehaltener Hand von der Summe sprach, hatte ihr Balthasar in einem seltenen Anfall von Redseligkeit erzählt. Noch Jahre später konnte er zudem nicht erklären, warum die von Hohenhausen-Sonnenberg den großen Krieg unbeschädigt überstanden hatten, während selbst der Landesherr bis auf das letzte Pferd ausgeraubt worden war.
Warum plagten und mühten sich die einen vom ersten Hahnenschrei bis spät in die Nacht, fragte sich Regine manchmal, wenn sie ihre verbotenen Gedanken wieder einmal nicht zügeln konnte. Die Mehrheit der Menschen konnte kaum mehr als ein karges Auskommen erwirtschaften, während andere, wie die dicke Mathilde, die Herrin drüben im Schloss, keinen Finger rührte, wenn sie Hunger oder Durst verspürte. Mit einer zierlichen Bewegung ihres rundlichen Armes hob sie ein silbernes Glöckchen oder sie klatschte in die Hände, um die allzeit bereite Dienerschaft springen zu lassen, jeden ihrer unzähligen Wünsche zu erfüllen.
Regine dagegen ahnte seit langem, dass sie vom Leben nicht mehr zu erhoffen hatte als einen guten Ehemann. Ein Mann, der arbeitsam war, nicht trank und die Hand nicht gegen sein Weib erhob, war ein Geschenk des Himmels, wussten die älteren Frauen. Aber Regine hatte keine Lust zu heiraten und einem Mann, wie in der Bibel befohlen und in der Ehe selbstverständlich verlangt wurde, untertan zu sein. Im Gegenteil, sie fürchtete die Männer und die Gefahren und Schmerzen, die sie den Frauen brachten. Das Los ihrer Mutter war nicht das einzige Beispiel. Schlecht erging es auch den Mädchen, die ohne Ehemann in andere Umstände geraten waren und die einzig auf die Kräuter der alten Lineke hoffen konnten, um der Schmach und Schande zu entgehen, die ihnen drohte. Selbst dann, wenn man als ehrbare Ehefrau ein Kind gebar, war das ein gefährliches Ereignis, an dem nicht wenige Frauen zu Grunde gingen. Nein, das Heiraten konnte lange warten, auch wenn der hübsche Caspar, Bäcker seines Zeichens, ihr zu verstehen gegeben hatte, dass sie ihm gut gefalle. Der Vater, dem die verstohlenen Blicke des jungen Mannes nicht entgangen waren, hatte ihr geraten, Caspar nicht vor den Kopf zu stoßen. Als Tochter eines Müllers, das wisse sie von Kindesbeinen an, sei es nicht einfach, eine gute Partie zu machen. Sein Beruf gälte wegen der vielen schwarzen Schafe, die für sich selbst Mehl abzweigten, als anrüchig und unehrlich.
Als Regine ein kleines Mädchen war, war ihr eine Frage, plötzlich und hell wie ein Blitz, durch den Kopf geschossen, deren Beantwortung keinen Aufschub vertragen hatte. Sofort war sie zu ihrem Vater gelaufen und hatte ihn in aller Unschuld gefragt, ob Gott in seiner Gnade und Gerechtigkeit es für wohl befinde, dass die Herrschaften dort drüben im Schloss alle Tage Fleisch auf dem Tisch und Wein im Glas hatten, während ihre Familie sich mit Brei und Suppe sättigen musste. Er hatte sie entsetzt angestarrt und eine Weile geschwiegen, bevor er sie barsch angefahren hatte. „Mädchen, davon verstehst du nichts, hör auf, solch krauses Zeug zu reden, das bringt nur Ärger, der auf mich zurückfällt. Lass dir gesagt sein, dass Gott in seiner Güte alles aufs Beste geordnet hat. Er hat die Menschen auf ihren vorbestimmten Platz gestellt. Die göttliche Ordnung ist ein Segen und nichts, womit man hadern darf, wenn man sich nicht versündigen will.“
Dann hatte er sich mit einem nochmaligen Kopfschütteln umgedreht und seine Arbeit wieder aufgenommen.
Spätesten seit Pastor Hermeling seiner gebannt lauschenden Gemeinde in einer furiosen Sonntagspredigt die im Jenseits zu erwartenden Qualen derjenigen schilderte, die gegen Gottes Gebote verstießen, fürchtete sie diesen Ort der unendlichen Finsternis. Bisweilen träumte sie aber trotzdem davon, wie es wohl wäre, wenn Mathilde an ihrer Stelle schon seit Tagesanbruch in Stall und Garten werken müsste, während sie sich noch einmal in weichen Kissen umdrehen und weiter schlafen dürfte. Unweigerlich spielte bei diesen Gedanken ein feines Lächeln um ihre Lippen.
„Regine! Regine!“ Eine hohe, klagende Kinderstimme schreckte das Mädchen abrupt aus seinen Gedanken. Das Jammern riss nicht ab, sondern steigerte sich zu einem schrillen Wehklagen, das ihr in den Ohren gellte. Regine ließ ihren Besen fallen, raffte die Röcke und lief los, um ihrem Bruder zur Hilfe zu eilen. Vorbei an der Wassermühle, in der ihr Vater schon seit den ersten Morgenstunden seinem Handwerk nachging, vorbei an dem Mühlteich, auf dem eine Entenmutter stolz ihre fünf Jungen ausführte. Ihre Füße in den grob genagelten Stiefeln trommelten über das Holz des kleinen Steges, der den Mühlbach kreuzte. Mit fliegendem Atem erreichte sie den großen Weg, der zum Schloss führte. Vor einigen Jahren hatte ihn Mathilde begradigen und pflastern lassen, weil sie durch den Anblick von Unkraut und Pfützen ihren Sinn für das Schöne beleidigt sah. Jetzt war der Boden so sauber und ordentlich wie der Kirchplatz in der kleinen Stadt unweit des Schlosses, wo die Häuser im Rund das Gotteshaus umstanden, während hier die Bäume rechts und links der Straße in den Himmel ragten.
„Regine! Regine!“ Die Stimme des Bruders führte sie entlang der hohen Sandsteinmauer, die den Schlosspark umgab, bis zu einer kleinen Holzpforte, die sich knarrend öffnete, als das Mädchen sich mit aller Kraft dagegen stemmte. Es war nicht das erste und bestimmt nicht das letzte Mal, dass sie sich auf diese Art Einlass verschaffte. Das Wissen um die Nachgiebigkeit dieser fast vollständig hinter üppig wucherndem Efeu versteckten Tür teilte sie mit Elisa, ihrer Freundin und Vertrauten im Schloss. Jeden Abend um die gleiche Zeit, wenn im Schloss die Speisen aufgetragen wurden, konnte ihre Herrin Elisas Dienste als Zofe für eine Weile entbehren und dann huschte die Freundin hinaus und lief zu Regine, die verlässlich und selbstverständlich an der geheimen Pforte wartete. Elisa war die Tochter der Köchin Maria und arbeitete als Zofe, seit sie gelernt hatte, die Haare einer anderen Frau mit weichen, vorsichtigen Strichen so lange zu bürsten, bis sie glänzten wie das teure Tuch, das ein Händler auf dem letzten Jahrmarkt feil geboten hatte. Die Freundinnen hatten nicht fassen können, wie weich und warm es war und hatten es andächtig wieder und wieder befühlt, bis der Kaufmann, der sich Sogen um die Sauberkeit seiner Ware gemacht hatte, die beiden mit barschen Worten vertrieben hatte. Man stelle sich vor, ein Tuch, das von jenseits des Meeres bis in die kleine Stadt gereist war! Nicht, dass Regine das Meer jemals gesehen hatte, aber die Schiffer, die auf der Weser bis nach Bremen und weiter fuhren, standen nach dem Kirchgang häufig zusammen und beschworen die Erinnerungen an Wellen, die hoch wie Häuser werden konnten, an Wasser, das grau, blau, grün oder sogar gelblich schimmern konnte und weiter reichte, als das Auge zu schauen vermochte. Hinter diesen Wassermassen lagen Länder, zauberhaft und geheimnisvoll, in denen Menschen mit dunkelbrauner, schwarzer oder gelber Haut unter einer tagein, tagaus brennenden Sonne lebten. Dort wurden nicht nur die allerfeinsten Tuche gefertigt, sondern in jenen Gefilden wuchsen auch kostbare Gewürze und die Bohnen des Kakaostrauches, die Mathilde hoch schätzte. Gerade im Winter, wenn es so kalt war, dass ihre Hände und Füße blau vor Kälte wurden, träumte sie von diesen fernen Welten und sehnte sich nach dem Frühling und den ersten wärmenden Strahlen.
„Regine! Regine!“
Gleich rechts neben der Pforte saß Hannes an die Schlossmauer gelehnt, das blasse Gesicht tränenüberströmt, die dunklen Augen, die sich jetzt hoffnungsvoll auf sie richteten, vom Weinen gerötet. Ein Stich ging Regine durchs Herz, wie immer, wenn sie ihren Bruder leiden sah. Seit Anna, ihre Mutter vor elf Jahren bei der Geburt von Hannes im Kindbett gestorben war, hatte sie umgehend Mutterpflichten übernehmen müssen. Der Vater, ein rechtschaffener, wortkarger Mann, ging seinem Tagewerk fleißig, aber mit mürrischer Miene nach. Selten nur richtete er das Wort an seine Tochter und fast nie an Hannes. Regine hatte schon häufig beobachtet, wie der Müller ihren Bruder von oben bis unten gemustert und sich dann mit verschlossenem Gesicht abwandte hatte. Hannes ähnelte weder Anna, die ihre roten Locken unter der Haube offen getragen hatte, noch dem Vater, dessen Haar glatt und von der Farbe des Sommerweizens war. Hannes blickte mit dunkelbraunen Augen unter pechschwarzem Haar in die Welt. Sie zweifelte keinen Moment daran, dass einer der beiden Landsknechte der Vater von Annas zweitem und letztem Kind sein musste. Wie oft hatte sie sich ein liebevolles oder tröstendes Wort des Vaters für ihren Bruder erhofft, auf ein freundliches Nicken, ein Streicheln des kleinen Kopfes gewartet. Balthasar ernährte und kleidete seine Kinder, aber väterliche Zuneigung konnte er Regine nur selten und Hannes gar nicht schenken. Der Tod seiner Frau hatte das Herz des Müllers versteinern lassen.
Ein erneutes Schniefen riss Regine aus ihren Gedanken.
„Hannes, was fehlt dir? Hast du Schmerzen?“
Ihr Bruder rieb sich den rechten Knöchel. „Ich habe versucht, ein Kaninchen zu fangen. Als ich es fast erwischt hatte, bin ich umgeknickt und kann nicht mehr aufstehen. Regine, muss mein Fuß jetzt abgenommen werden?“
Ängstlich tastete er nach ihrer Hand und hielt sie fest. Ein zerlumpter, einbeiniger Bettler, der den Gläubigen bittend die Hand hin streckte, hatte bei dem letzten Kirchgang der Geschwister nicht nur sein Mitleid, sondern auch die kindliche Neugier geweckt.
Ganz entschieden hatte Regine darauf bestanden, dass Beine nicht ganz von selbst abfallen oder etwa von Hexen weggezaubert werden könnten. Der Bettler, hatte sie ihm damals erklärt, sei ein ehemaliger Soldat, dessen im Krieg verletztes Bein zu faulen begonnen hatte und darum amputiert worden sei. Als Hannes dann begreifen wollte, wer Kriege anzettelte und nach den Gründen forschte, hatte sie sich sich - wie so oft - nach ihrer Mutter gesehnt. Regine erinnerte sich gut an die zarte Frau, deren weithin leuchtendes Haar sie geerbt hatte. Anna hatte stets all ihre kindlichen Ängste beschwichtigt und Regine versuchte ihr Möglichstes, ihrem Vorbild nachzueifern, wenn es um Hannes ging.
„Bestimmt nicht.“ Regine löste ihre Hand sanft aus der des Bruders und strich ihm zärtlich über die verschwitzten Haare, bevor sie vorsichtig den rechten Knöchel untersuchte. Sofort fühlte sie eine deutliche Schwellung, doch das Gelenk ließ sich in alle Richtungen bewegen. Leise wimmernd biss sich Hannes auf die Lippen
Erleichtert atmete Regine auf. „Du hast dir sicherlich nur den Knöchel verstaucht. Versuch einmal aufzustehen und dich dann auf meinen Arm zu stützen. Wenn wir zu Hause sind, lauf ich schnell zur Lineke und hol dir ein Mittel.“
Sanft schob sie dem Bruder ihren Arm unter die Achseln und hob den schmalen Körper vorsichtig an. Mit einem Aufschrei stellte sich Hannes auf und lehnte sich keuchend an die Mauer.
Ihr Vater stand schon mit dem gereizten Ausdruck, den Regine kannte und fürchtete, vor der Mühle und hielt Ausschau nach dem Jungen, der ihm täglich in der Mühle zur Hand gehen musste. Mit einem beschwichtigendem Blick schob sie Hannes ins Dunkle des Hauses.
„Er hat nichts angestellt, nur Pech gehabt“, beruhigte sie ihren Vater: „Ich besorge ihm eine Arznei und dann ist er bald wieder auf den Beinen.“
Ohne eine Antwort abzuwarten, drehte sie sich um und lief zu Lineke, der Hebamme und Kräuterfrau, deren Hütte auf einer sonnigen Lichtung des nahe gelegenen Waldes stand. Lineke Klemm besaß die Fähigkeit, den Gebärenden in ihrer schweren Stunde hilfreich beizustehen und kannte die heilenden Pflanzen und Kräuter, aus denen sie Tränke mischte und Salben rührte. Schon oft hatte sie der Familie des Müllers geholfen, nur bei Anna hatte ihre Kunst versagt. „Regine“, noch Jahre später erinnerte sich das Mädchen an den Kummer in Linekes Augen und Stimme, als sie gemeinsam mit dem Vater am Kindbett ihrer Mutter gestanden hatte, die bleich wie ein Laken mühsam nach Luft gerungen hatte. „Ich kann Anna nicht mehr helfen. Der Junge jedoch wird leben und braucht euch.“
Obwohl viele Jahre ins Land gegangen waren, vermisste Regine ihre Mutter schmerzlich. Fröhlich war sie gewesen und hatte gerne gesungen. Selbst wenn sie ihre Tochter einmal tadeln musste, so wie an dem Tag, als Regine in der Messe über die dicke Anneke Berner, gekichert hatte, die schneller gebetet hatte als der Rest der Gemeinde, hatten ihre Augen den liebevollen Blick behalten.
Wie immer brauchten die Augen des Mädchens Zeit, um sich im Halbdunklen des Häuschen zurechtzufinden, in dem die alte Frau lebte. Reichtum hatte sich Lineke mit ihrer Kunst nicht erworben, das stand für Regine seit langem fest. Nur wenige Möbelstücke fanden sich in der kleinen Stube, keines davon mit unnützen Zierrat beladen. Ein Strauß aus Feldblumen und blühenden Gräsern in einer schlichten Vase bildeten den einzigen Schmuck. Kräuter- und Pflanzenbündel hingen unter der Decke und an den Wänden, eine Vielzahl von Gerüchen vereinten sich zu einem schweren, aromatischen Duft, über der Feuerstelle dampfte und brodelte es aus einem schweren Eisentopf.
„Regine“, Lineke legte den hölzernen Rührlöffel beiseite und sah ihre Besucherin freundlich an, „setz dich dorthin.“ Sie deutete auf einen einfachen Holztisch mit drei Stühlen, der unter dem kleinen Fenster aus Pergament stand. „Was führt dich zu mir?“
„Hannes ist gestolpert und hat sich den Knöchel verstaucht. Gebrochen ist er nicht und ich glaube, eine Salbe gegen die Schwellung würde ihm schon helfen. Was meinst du?“ Fragend suchten Regines Augen die der alten Frau. Ihr fiel auf, dass Lineke in die Jahre gekommen war. Tiefe Falten zerfurchten das von der Sonne gegerbte Gesicht, weiße Strähnen durchzogen das ehedem schwarze Haar und ihr Blick wirkt müde. Ihre Stimme jedoch klang energisch wie immer.
„Mädchen, damit hast du sicherlich recht. In Gottes wunderbaren Garten finden sich Kräuter und Pflanzen gegen fast jedes Gebrechen. Beinwell, Arnika und Rainfarn sind wirksame Pflanzen bei Schmerzen, wie sie jetzt Hannes plagen. Du hast Glück. Erst gestern habe ich eine Salbe gekocht, die ihm helfen wird.“ Überraschend flink für ihr Alter durchquerte sie den Raum und öffnete einen großen Schrank, dessen Fächer nahezu überquollen von irdenen Tiegeln und Töpfen, Kannen und Flaschen aus Steinzeug und Glas. Fasziniert bewunderte Regine das Funkeln und Glänzen. Mit sicherem Griff nahm Lineke ein kleines Töpfchen und drückte es ihr in die Hand. „Dreimal täglich reibst du den Knöchel deines Bruders damit ein und zwar so lange, bis nicht der kleinste Rest übrig bleibt.“
Regine nickte gehorsam und sagte der alten Frau den Beutel Mehl zu, den sie für ihre Hilfe erbat.
Sie wandte sich zum Gehen, als Lineke sie zurückhielt.
„Regine“, sie nahm die sehr weißen Hände des Mädchens fest in ihre braunen. „Ich werde nicht jünger, das ist nun mal der Lauf der Welt. Meine Augen brennen am Abend wie Feuer, weil ich häufig blinzeln muss, um die Pflanzen zu erkennen. Es könnte Leben kosten, wenn ich eine heilende mit einer giftigen verwechsele. Zudem sind meine Knochen morsch und schmerzen nicht nur im Winter oder bei Regenwetter, auch wenn ich zur Zeit noch ganz gut auf den Beinen bin. Selbst meine eigenen Tränke geben mir nicht die Jahre zurück. Regine, ich möchte dir einen Handel vorschlagen.“
Fragend sah das Mädchen die alte Frau an, die bekräftigend nickte.
„Du bist jung, hast scharfe Augen und kräftige Beine, die das Ausschreiten gewöhnt sind. Stelle dich in meine Dienste. Es soll dein Schaden nicht sein.“
Obwohl das Ansinnen der alten Frau ihr Mitgefühl, aber auch eine unbestimmte Neugier weckte, schüttelte Regine ablehnend den Kopf. „Vater wird mir nicht erlauben, meine Zeit hier zu verbringen.“
Lineke lachte belustigt auf. „Dein Vater wäre dumm, wenn er ein paar Taler zusätzlich nicht zu schätzen wüsste. Außerdem“, ihr Gesicht wurde ernst, „ist ihm nicht entgangen, dass du dich von den Männern fern hältst. Stellst du dich geschickt an, kannst du meine Nachfolgerin werden. Du wirst dein Auskommen haben und kannst ohne Mann dein Leben fristen.“
Als Regine, der es vor Überraschung die Sprache verschlagen hatte, nicht sofort antwortete, fuhr sie mit einem Unterton in der Stimme fort, der zugleich schmeichelnd und bittend klang. „Ich möchte mein Wissen auch an eine Frau weitergeben, die klug genug ist, damit Gutes zu tun. Und klug bist du, Regine. Du wirst das Wesen der Pflanzen und ihre Geheimnisse erkennen. Du wirst lernen, welches Kraut am Besten als Salbe oder als Trank wirkt, wann es gepflückt und wie es aufbewahrt werden muss. Ich werde dich mit Freude und Sorgfalt in der Kunst der Zubereitung vielerlei Arzneien unterrichten, wenn du mein Angebot annimmst. Überlege dir die Antwort gut, mein Kind. Besprich dich mit deinem Vater und gib mir dann Bescheid.“
In Regines Kopf surrte es wie in einem Bienenstock und mit einem gestammelten Abschiedsgruß verließ sie die alte Frau. Auf dem Heimweg überschlugen sich ihre Gedanken, bis eine plötzliche Eingebung sie zur Ruhe brachte. Zunächst einmal, so beschloss sie, musste sie sich dringend mit Eliza beraten, ob sie ein Angebot annehmen konnte, das ihr sowohl aufregend als auch ein wenig Furcht einflößend erschien.
Das Schloss - Szene 3
Die Sonnenuhr im weitläufigen Park des Schlosses zeigte schon die zehnte Stunde und vorwitzige Strahlen erhellten sanft das hochherrschaftliche Schlafzimmer der Hausherrin.
Mathilde Maria Johanna Freifrau von Hohenhausen-Sonnenberg, von ihrem Gatten, dem Freiherrn Maximilian Friedrich, in zärtlichen Stunden Hildchen genannt, öffnete die veilchenblauen Augen. Zufrieden ließ sie ihren Blick durch den großzügig gestalteten Raum schweifen. Der mit Schnitzereien und fein geschmiedeten Beschlägen verzierte Schrank, der mit Platten aus Marmor geflieste Boden, der goldene Kronleuchter und nicht zuletzt ihr geschnitztes Bett mit dem prächtigen Himmel aus schimmerndem Damast erinnerten sie täglich an den gewonnenen Kampf mit Max. Der alte Knauser hatte sich mit allen Kräften dagegen gesträubt, Geld für den Ausbau des früher zugigen und schmucklosen Baues auszugeben. Sein Starrsinn hatte sie auch deshalb gewurmt, weil jeder von Adel, der auf sich hielt, in den letzten Jahren gewaltige Anstrengungen unternommen hatte, um seinen Besitz bequemer und schöner zu machen. Es war ein regelrechter Wettbewerb um die berühmtesten und besten Baumeister, Steinmetze, Maler und Holzschnitzer ausgebrochen. Besonders begehrt waren die aus Italien stammenden Künstler, welche die sagenumwobene Pracht der dortigen Herrscherdynastien in den kalten Norden mitzubringen versprachen. Nur ihr Geizkragen von Mann hatte darauf gepocht, mit dem Schloss, so wie es war, vollkommen zufrieden zu sein. Während seiner Ausführungen hatte Mathilde ungeduldig zur Decke gesehen, an der sie einen riesigen Stockflecken entdeckt hatte, dessen Existenz ihre Angriffslust zusätzlich gesteigert hatte.
„Du hast keinen Grund, so knauserig zu sein. Wir haben einen eigenen Steinbruch, dessen Erträge weit höher sind als die erkleckliche Summe, die unsere Ernte voraussichtlich einbringt. Die halbe Welt reißt sich um unseren Wesersandstein. Auch die Glashütte wirft jährlich mehr Geld ab. Worauf noch warten? Das Schloss ist zu klein für eine Familie wie unsere, die gesellschaftliche Verpflichtungen hat. Wir müssen schließlich auf unseren guten Namen achten.“
„Unser guter Name!“, hatte Maximilian geknurrt. „Du redest von unserem Namen und meinst in Wirklichkeit damit dein Vergnügen, Bälle, Feste, Jagdgesellschaften, Abendessen und Empfänge.“
„Genau das gehört auch dazu“, hatte Mathilde ihrem Mann geschickt den Wind aus den Segeln genommen, „ebenso wie eine elegante Garderobe und eine nicht zu kleine Dienstbotenschar. Nicht zu vergessen die silbernen Leuchter, die chinesischen Vasen und die Ahnengalerie in Öl.“
„Deine Wünsche sind weiß Gott nicht bescheiden.“
Mathilde hatte ihrem Mann ein strahlendes Lächeln geschenkt.
„Ein bescheidenes Haus zu führen, ist auch nicht das, was mir erstrebenswert erscheint.“
Dann war sie ernst geworden und hatte ihre Hand auf seine gelegt.
„Dabei denke ich natürlich zuerst an die Kinder. Wenn wir sie ihrem Stand gemäß verheiraten wollen, müssen wir ihnen den entsprechenden Rahmen bieten.“
Max hatte ihr abrupt seine Hand entzogen und war aufgestanden, während eine deutlich pochende Ader an seinem massigen Schädel Mathilde gewarnt hatte.
„Ich habe Wichtigeres zu tun, als mich von dir über Angelegenheiten belehren zu lassen, die mich teuer zu stehen kommen.“ Er hatte sich umgedreht und Mathilde, die mit vor Wut zusammen gepressten Lippen seinem breiten Rücken hinterher sah, hatte den mühsam unterdrückten Ärger in seinen stampfenden Schritten gespürt.
Selbstverständlich hatte sie an ihrem Plan festgehalten.
Nachdem Sybilla Luise, Baronin von Freistein sich bei ihrem letzten Besuch spöttisch umgesehen hatte, um dann zu bemerken, dass das neue Haus des Obristenleutnants in der Stadt sehr ansehnlich geworden sei, hatte sie die aufkeimende Wut nur mühsam unter Kontrolle halten können. Auf keinen Fall wollte sie Sybilla Luise die Befriedigung zugestehen, dass ihre impertinente Bemerkung ins Schwarze getroffen hatte. Das Haus eines Emporkömmlings, der als Reiterjunge begonnen hatte, größer und schöner als ihres? Diese Frechheit hatte das hinterlistige Weibsstück so laut von sich gegeben, dass jeder der erlauchten Anwesenden es hatte hören können.
Seit dieser Stunde hatte Mathilde den brennenden Wunsch gehegt, dass ihr Anwesen als Schmuckstück der Architektur und Gartenbaukunst alle Schlösser im Umkreis übertreffen solle. Die Fenster würden vergrößert, die Wände mit hölzernen Friesen und bunten Ölgemälden verziert werden. Gläserne Türen könnten sich zu einem neu angelegten Park öffnen. Fallende Mauern würden kleine Räume in Säle verwandeln, in denen vortrefflich aufgetragen und getanzt werden konnte. Rechts und links erweiterten dann zwei neue Flügel den ursprünglichen Grundriss zu einem hochherrschaftlichen Wohnsitz. Den Gedanken an ihren Geistlichen, der sie immer wieder darauf hinwies, dass die eigentlichen Freuden im Paradiese zu erwarten seien, schob sie beim Pläne schmieden weit von sich. Mathilde wollte schon auf Erden einen Vorgeschmack der himmlischen Freuden kosten, die sich in ihrer Vorstellung zu einem prächtigen Bild üppigen Wohllebens verdichteten.
Genüsslich räkelte sie ihre molligen Glieder beim Gedanken an die Schliche und Ränke, deren es bedurft hatte, bis Maximilian murrend seine Zustimmung zu dem Vorhaben gegeben hatte. Dazu hatten auch heiser geflüsterte Verheißungen für die gemeinsamen Stunden zwischen den Laken ihres Bettes und der Verweis auf drei gesunde Kinder gehört. Der zehnjährige Jakob war ebenso der Stolz und das Glück seines Vater wie der um ein Jahr jüngere Ludwig und Sophie Charlotte, das dreijährige Nesthäkchen, die mit ihren schweren roten Backen wie eine Miniaturausgabe ihres Vaters in Kleidern wirkte. Ausschlaggebend für den Sinneswandel ihres Mannes aber war dessen Einsicht gewesen, dass die Pracht des Gebäudes dem Namen Hohenhausen-Sonnenberg neuen Glanz geben würde. Das Beste an dieser Einsicht, fand Mathilde auch heute noch, war der feste Glauben ihres Gatten, dass sie seinem Gehirn entsprungen sei.
Ihr Lächeln vertiefte sich, als sie an ihren ganz persönlichen Triumph zurück dachte. Jede Familie von Rang und Namen war nach den zweijährigen Bauarbeiten zu der rauschenden Einweihung gebeten worden. Üblicherweise hatten die Herrschaften nicht nur die Dienerschaft im Gefolge, sondern vom Löffel bis zur Bettdecke alles, was es brauchte, die edlen Damen und Herren auf Reisen zu versorgen.
Bei ihr, Mathilde, war das nicht von Nöten, wie die Einladungen vermerkt hatten. Sie hatte ihren Reichtum mit überbordender Freude am Detail inszeniert, wobei ihr der Neid von Sybilla Luise der zuverlässigste Ansporn gewesen war.
Unzählige Kelche aus der eigenen Glashütte hatten neben feinstem Porzellan auf weiß gedeckten Tischen gefunkelt. Scharen von Zofen, Pagen, Köchen, Mägden und Knechten hatten die Gäste von früh morgens bis spät umsorgt. Die beliebtesten Musiker des Landstrichs hatten bei Tisch und zum Tanz aufgespielt.
Spaßmacher, Gaukler und Feuerschlucker hatten die Gesellschaft erst zum Schmunzeln und dann zu vergnügtem Lachen gebracht. Stunden später hatte man sich grölend auf die Schenkel geklopft, als mit fortschreitendem Abend die Scherze immer derber und zotiger geworden waren. Der Wein war in Strömen geflossen, die Gesichter hatten sich gerötet, die Kleidung war gelockert worden und neugierige Hände hatten sich vereinzelt unter Röcke verirrt, die nicht die der Angetrauten gewesen waren.
Der Morgen hatte schon gegraut, als sich die Anwesenden in ihre Räumlichkeiten zurückzogen hatten, um das Fest ganz im Privaten ausklingen zu lassen. Manch einer hatte lauthals auf die Erfüllung der ehelichen Pflichten bestanden, andere waren froh gewesen, schnarchend ihren Rausch ausschlafen zu können. Ja, auch sie, Mathilde, war berauscht gewesen. Regelrecht besoffen hatte sie sich an den bewundernden Ausrufen der Geladenen gelabt, ob an der Pracht der Säle, der Bequemlichkeit der bereitgestellten Quartiere, der Weitläufigkeit des riesigen Parks mit seinen Blumenrabatten und dem Buchsbaum-Labyrinth. Die Üppigkeit und Qualität des Mahles war einhellig gelobt und viele Trinksprüche auf den Herrn und die Dame des Hauses waren ausgebracht worden.
Als der Graf von Eberstein, dem man beste Kontakte zum Landesherrn nachsagte, die hausfraulichen Qualitäten der Schlossherrin gepriesen und augenzwinkernd hinzufügt hatte, dass nur ihre Schönheit diese noch übertreffe, da war Sybilla Luise weiß wie ein frisch gebleichtes Laken geworden und hatte den Blick abwenden müssen, als Mathilde ihr triumphierend zugelächelt hatte.
Noch jetzt, Monate später, freute sich Mathilde über das gelungene Fest, auch wenn Maximilian in dieser Nacht selbst für seine Verhältnisse deutlich über die Stränge geschlagen hatte. Auf dem Weg in ihr Schlafzimmer waren verdächtige Geräusche aus einem Raum unweit der Küche zu hören gewesen. Es war die Stimme ihres Mannes, geil stöhnend und leise drohend und die einer Frau gewesen, deren flehentliches Bitten von unterdrücktem Weinen und Schmerzenslauten begleitet worden war.
Ruckartig hatte Mathilde die Tür geöffnet und den nackten Hintern ihres Gatten über herunter gelassenen Hosen gesehen, der mit ruckartigen, klatschenden Bewegungen ganz offensichtlich das getrieben hatte, was die Geistlichkeit als Pflicht des Mannes zur Erzeugung von Nachkommen pries. Offensichtlich hatte sich eine der jungen Mägde, die weisungsgemäß in der Früh den Kamin anfeuern sollte, nicht rechtzeitig in Sicherheit bringen können. Sie hatte mit hochgeschlagenen Röcken und einem vor Schmerzen verzerrten Gesicht auf einem der Tische gelegen, an denen das Gesinde tagsüber die ihm zustehenden Mahlzeiten aus Brei oder Suppe einnahm. Mathilde hatte gewusst, dass die Furcht des Mädchens weit über den Angst einflößenden Angriff hinaus ging. Schwangere, ledige Frauen wurden von der Kanzel hinunter als Sünderinnen verdammt, die den Einflüsterungen des Bösen nicht hatten widerstehen können und waren als Dienstboten natürlich untragbar.
Sie hatte den Anblick dieser Paarung innerhalb von Sekunden als ihre Chance begriffen. Ohne den Hauch einer Ahnung von der Existenz des großen Machiavelli zu haben, der im fünfzehnten und sechzehnten Jahrhundert im fernen Italien über die Macht und ihren Erhalt philosophiert hatte, folgte sie seinen Überlegungen. Der Fürst, den Machiavelli beschrieb, floh den träge machenden Gewohnheiten und pflegte stattdessen die Fähigkeit, sich der jeweiligen Situation zum Zwecke des Machterhaltes anzupassen. Mathilde hatte nicht geräuschlos die Türe wieder zugezogen, sondern diese von innen mit einem Knall zugeschlagen.
„Du Bock, du alter lüsterner Bock, was unterstehst du dich?“, hatte sie so laut geschrien, dass Maximilian erschrocken sein Tun unterbrochen und seine Hosen hochgezogen hatte, während das Mädchen umgehend vom Tisch gerutscht und wie ein gehetztes Reh aus dem Raum geflohen war.
Maximilian war über den unverhohlenen Zorn seiner Gattin verblüfft gewesen, die ihn mit in die Hüften gestemmten Armen lauthals beschimpft hatte. Warum, zum Teufel, hatte er sie verblüfft gefragt, machte seine Frau solch ein Theater wegen einer Nichtigkeit? Es hatte ihn gejuckt und er hatte sich gekratzt. Was sie das eigentlich anginge, hatte er sich noch erbost über die jähe Störung seines Vergnügens erkundigt.
Mathilde lächelte süffisant bei der Erinnerung an das erstaunte Gesicht ihres Gatten angesichts ihres Wutausbruchs. Selbstverständlich war er es gewohnt, sich die Bauernmädchen zu Willen zu machen, eine Vorliebe, über die man Mathilde schon vor ihrer Hochzeit unterrichtet hatte. Maximilian wusste dagegen, dass seine Gattin eine sorgfältige Erziehung genossen hatte, die sie befähigen sollte, diskret über diese Dinge hinweg zu sehen.
Seit undenklichen Zeiten fühlten die Herren von Stand sich berechtigt, über die Körper der weiblichen Dienstboten und der Töchter der Pächterfamilien zu verfügen. Der Umstand jedoch, dass ihn die eigene Ehefrau in flagranti im eigenen Haus ertappt hatte, hatte jedoch eindeutig auch gegen Maximilians ziemlich selbstherrlichen Moralkodex verstoßen. Nach Schluchzern und Tränen, die Mathilde auf ihr eigenes, inneres Kommando vergießen konnte, hatte ihr Mann später versprochen, dass dergleichen nicht wieder vorkommen werde. Die zähen Verhandlungen, die seinem Schwur gefolgt waren, hatte Mathilde zu ihren Gunsten entschieden und ihrem Zähne knirschendem Mann die Zusage abgerungen, einen Maler einzustellen, der die gesamte Familie porträtieren sollte. Wenn der Künstler, natürlich am liebsten ein Italiener, der bereits in fürstlichen oder besser noch in königlichen Diensten gearbeitet hatte, erst einmal hier im Schloss wäre, würde Maximilian sicherlich einsehen, dass auch etliche Decken der Gemälde bedurften.
Voller Elan schwang sie jetzt die Beine aus dem Bett und zog an einem Strang rechts neben ihrem Bett, ein Griff, der in der Küche eine von vielen Glocken anschlagen ließ .
„Elisa“, Maria ließ das Messer, mit dem sie Möhren für das Mittagessen putzte, sinken und warf ihrer Tochter einen auffordernden Blick zu. „Die Freifrau klingelt nach dir.“
„Ich bin schon unterwegs.“





























