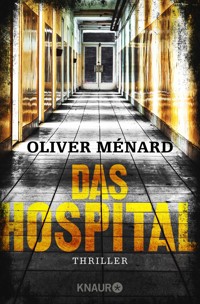
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ein Fall für Christine Lenève
- Sprache: Deutsch
Hochspannung aus Deutschland: Nach Oliver Ménards überragenden Thrillerdebüt "Federspiel", kommt nun "Das Hospital". Als eine Wasserleiche ohne Lippen in der Spree gefunden wird, folgt die Journalistin Christine Lenève der Spur des Mörders. Ihre Recherche führt sie in die Gesellschaft der Superreichen und ihres Handlangers, genannt »der Eismann«. Vor Publikum inszeniert der Unbekannte seine Morde. Nach einer wilden Verfolgungsjagd durch Luxusvillen und ein verfallenes Hospital kommt es zur Konfrontation zwischen Christine und dem Killer. Zwischen den beiden beginnt ein knallhartes Psychospiel - doch der Eismann hat einen Plan ... Oliver Ménard bietet alles, was in einem guten Thriller vorkommen muss - einen fiesen Killer, schockierende Morde, einen überzeugenden Ort des Schreckens und eine toughe junge Heldin. Und das alles in der momentan wohl aufregendsten Hauptstadt Europas: Berlin!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 517
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Oliver Ménard
DAS HOSPITAL
Thriller
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Als eine Wasserleiche ohne Lippen in der Spree gefunden wird, folgt die Journalistin Christine Lenève der Spur des Mörders. Ihre Recherche führt sie in die Gesellschaft der Superreichen und ihres Handlangers, genannt »der Eismann«. Vor Publikum inszeniert der Unbekannte seine Morde. Nach einer wilden Verfolgungsjagd durch Luxusvillen und ein verfallenes Hospital kommt es zur Konfrontation zwischen Christine und dem Killer. Zwischen den beiden beginnt ein knallhartes Psychospiel – doch der Eismann hat einen Plan …
Inhaltsübersicht
Vorbemerkung
Erster Teil. SIEBEN
Weiß. Ihre Haut war [...]
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
Zweiter Teil. EISIGES HERZ
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
Dritter Teil. DAS BLUT DER VÄTER
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
Berlin, 39 Grad, der heißeste Tag des Jahres
Und am Ende …
Die Ereignisse und Charaktere in Das Hospital sind frei erfunden.
Einige Schauplätze des Romans wurden ihren Vorbildern nachempfunden
oder sind im Sinne der Geschichte vom Autor verändert.
Erster Teil
SIEBEN
Weiß. Ihre Haut war schneeweiß, durchschimmernd und ebenmäßig wie Porzellan. Er konnte ihre Adern sehen, feine blaue Linien, die sich durch ihren ganzen Körper zogen, Ströme, durch die einmal das Leben geflossen war.
Ihr schwarzes Haar lag ausgebreitet vor ihm. Die schmalen Schultern, ihre langen Beine – sie war fast vollkommen. Oft hatte er sich gefragt, warum sich die Schönheit nur bestimmte Menschen als Gefäß aussuchte, während all die anderen irgendwann an ihrer Mittelmäßigkeit zerbrachen. Am Ende war die Antwort egal. Auch das Schöne musste sterben.
Ihre bernsteinfarbenen Augen hatten den ursprünglichen Glanz verloren, eine milchige Trübung zog sich über die Pupillen. Die Muskeln in ihrem Körper waren erschlafft. Sie lag auf dem Tisch aus rostfreiem Edelstahl und blickte mit halb geschlossenen Lidern starr gegen die Decke, als wollte sie sich ihrer Müdigkeit hingeben und endlich einschlafen.
Mit den Fingern rieb er über seine Manschettenknöpfe, wie er es immer tat, wenn er sich ein besonderes Bild für immer einprägen wollte. Er zog an den Ärmeln seines Hemdes. Der Stoff klebte an seinen Armen, an seinem Rücken, überall. Die Nacht war unerträglich heiß. Es war der wärmste August seit über zehn Jahren. Berlin kochte.
Er stützte sich auf den Tisch. Das gedämpfte Licht der drei Pendelleuchten über ihm umhüllte den toten Körper wie ein transparentes Tuch. Aber das war nur eine Illusion. Mit dem Zeigefinger strich er über ihren Hals. Immer wieder und ganz sanft.
Das menschliche Herz schlägt in der Minute etwa siebzig bis neunzig Mal. Dann geht es ihm gut. Bei einhundertfünfzig Schlägen beginnt das Herz zu flattern, und bei zweihundertzwanzig Schlägen explodiert es. Er hatte ihren Herzschlag unter seinen Fingern gefühlt. Das sanfte Pochen ihrer Halsschlagader, das erst zu einem Beben, dann zu einem Rasen angeschwollen und genauso schnell wieder erstorben war. Eine Boa constrictor hält ihre Beute so lange umschlungen, bis der letzte Herzschlag verloschen ist und sie nichts mehr spürt. Es war eine angeborene Fähigkeit, ein mitfühlendes Töten, das er bewunderte.
Die Blutergüsse an ihrem Hals glichen rotblauen Schatten mit zwei besonders dunklen, rundlichen Flecken, die vom Abdruck seiner Daumen stammten. Ein sinnloser Tod war schockierend. Er würde sie davor bewahren. Alles war vorbereitet.
Wie still sie vor ihm lag. Vielleicht war sie als Kind ja die Sorte Mädchen gewesen, auf die Eltern stolz sind. Ein wenig aufmüpfig vielleicht, aber auch schön und intelligent. Ihre Klassenkameraden hatten sie insgeheim sicher bewundert. Sie war ein Mensch gewesen, in dessen Nähe sich jeder gerne aufhielt, weil man sich dann selbst wertvoller und wichtiger fühlte. Vielleicht hatte ihre unerträgliche Schönheit auch genervt. Oder ihr übersteigertes Selbstbewusstsein. Oder ihre besserwisserische Art. Vielleicht auch alles von dem. Jedenfalls war sie zu einer hochmütigen Frau herangewachsen. Die drei eingestochenen Tattoos auf ihrem Körper zeugten davon. Sie war überheblich und schön, aber niemand hatte sie auf ihn vorbereitet.
Er beugte sich über ihr Gesicht. Er war alles, was sie in ihren letzten Sekunden gesehen hatte. Er war ein Teil ihres Lebens geworden und hatte sie in den Tod begleitet. Der Gedanke berührte ihn so sehr, dass ihm Tränen in die Augen stiegen. Er legte den Kopf in den Nacken und atmete tief durch. Seinen Gefühlen durfte er sich nicht hingeben. Nicht jetzt. Es blieb ihm nicht viel Zeit.
Die Scheinwerfer eines vorbeifahrenden Autos fielen durch die großen Fenster in den Raum, tasteten die hohen Wände aus Backstein neben ihm ab und glitten über die Stahlträger unter der Decke. So schnell, wie die Lichtstrahlen aufgetaucht waren, verschwanden sie auch wieder. Die Klimaanlage rauschte laut und unregelmäßig, ein ständiges Röcheln und Pfeifen. Seine Lederschuhe knirschten, als er um den Tisch herumging und die Glastür des Kühlschranks öffnete, der neben einem der Fenster stand.
Im Licht der Kühlschrankbeleuchtung stiegen kalte Schwaden auf. Aus dem Tiefkühlfach zog er einen Behälter und brach einen Eiswürfel heraus. Er steckte ihn sich in den Mund und zerknackte ihn mit den Backenzähnen. Der Hemdkragen scheuerte an seinem Hals, schon den ganzen Tag. Er nahm die eine Hälfte des Eiswürfels und rieb ihn über die wunden Stellen. Wasser lief über seinen Nacken. Er mochte das Gefühl der Kälte auf seiner Haut.
Mit einer raschen Bewegung zog er die schweren Vorhänge vor den Fenstern zu. Zweimal drückte er auf einen blau leuchtenden Knopf, der sich in den Fugen des Backsteingemäuers erhob. Sofort warfen die Pendelleuchten unter der Decke ihr Licht um ein Vielfaches verstärkt senkrecht nach unten. Der tote Körper erstrahlte.
Drei Standventilatoren aus Eisen standen um den Edelstahltisch herum. Einer am Kopfende, einer in Höhe der Füße und einer an der Längsseite. Weiße Kabel zogen sich von ihren Sockeln über den Boden. Sie mündeten in einen rechteckigen, blinkenden Schalter.
Er drückte mit der Schuhspitze auf den Lichtpunkt, und ein elektrisches Brummen ertönte. Die dreiflügeligen Rotoren setzten sich in Bewegung, immer schneller und kraftvoller, bis er ihren Drehungen mit den Augen nicht mehr folgen konnte. Der Wind brachte das schwarze Haar der Frau zum Tanzen. Auf und ab. Es gefiel ihm.
Er ging zum Kühlschrank und brach einen weiteren Eiswürfel aus dem Behälter. Er drehte und wendete ihn in seiner Hand. Das half ihm bei der Konzentration. Dann näherte er sich der Frau auf dem Tisch. Der Wind der Ventilatoren zerrte an ihm, brachte den Stoff seines Hemdes zum Flattern, erst schwach, dann immer stärker, je näher er ihr kam.
Ihre wundervollen Lippen waren ihm sofort aufgefallen, als er ihr das erste Mal begegnet war. Ein Laie hätte ihren Mund als voll und symmetrisch beschrieben. Welch eine lachhafte und stümperhafte Einschätzung. Die Feinheiten eines Körpers offenbarten sich nur einem sezierenden Auge. Tatsächlich war ihre Unterlippe ein wenig voller als ihre Oberlippe, nur ein klitzekleiner Unterschied, und doch war die Wirkung gewaltig. Eigenwillig und dominant, fast ein wenig schmollend ließ diese kaum sichtbare Nuance ihr Gesicht wirken. Die Unstimmigkeiten dieses kleinen Details machten ihren Körper in seiner Gesamtheit perfekt. Ihre Lippen waren der entscheidende Schnittpunkt ihrer Erscheinung.
»Ja, die Lippen. Es sind die Lippen. Ich bin mir sicher«, flüsterte er.
Ihr Mund hatte den satten roten Schimmer längst verloren. Aber noch immer wirkten die Lippen leidenschaftlich und verlangend.
Er drehte den tropfenden Eiswürfel zwischen seinen Fingern und beugte sich vor. Vorsichtig rieb er das Eis über ihren Mund und verteilte das geschmolzene Wasser mit dem Zeigefinger. Die Tropfen sammelten sich in den feinen Falten ihrer Lippen.
»Mit einem wie mir hast du nicht gerechnet, oder? Deine Intelligenz und die Erfahrungen deines ganzen Lebens haben nicht ausgereicht, um mir zu entkommen. Würdest du mir nicht recht geben?« Er erwartete keine Antwort, aber er hörte sich gerne reden. Es vertrieb die Stille. »Wir werden jetzt etwas Einzigartiges vollbringen.« Er nickte der Frau auf dem Tisch zu. »Du und ich. Wir beide.« Er gab seiner Stimme einen sachlichen Klang. Was er vorhatte, duldete keinerlei Gefühlsregung. Emotionen würden nur ablenken und alles zerstören.
Die Wände des Backsteingemäuers vibrierten sanft. Ein Zug näherte sich dem Haus. Es war nichts Besonderes. In klaren Nächten saß er oft vor der Tür und wartete auf den galoppierenden Klang der Bahn und auf die kaum spürbaren Schwingungen der Gleisstränge. Das Surren und Pfeifen war nun ganz nahe. Das Signalhorn tutete, einmal lang und einmal kurz. Es war zehn Minuten vor Mitternacht.
Er ging zu dem kleinen Beistelltisch aus Metall, der neben der Eingangstür stand. Es war eine dieser Kommoden in Antikweiß, wie sie in den vierziger Jahren in deutschen Arztpraxen üblich gewesen waren. Auf der Ablage hatten sich schwarzbraune Rostflecken gebildet, die von seinem aufgeschlagenen Lederetui kaum verdeckt wurden. Darauf lag ein Rasiermesser. Er nahm es.
Die Griffschalen aus Grenadillholz lagen in seiner Hand, als wollten sie sich an seine Haut schmiegen. Er hielt die Klinge aus Kohlenstoffstahl prüfend vor seine Augen. Scharf geschliffen. Alles in Ordnung.
Bevor der neue Tag anbrach, wollte er fertig sein.
1
Irgendetwas stimmte nicht an diesem Morgen. Sie konnte es spüren.
Das tiefgrüne Wasser der Spree wurde von den Motoren vorbeifahrender Ausflugsdampfer in starke Wellenbewegungen versetzt. Ein langes schwarzes Stück Holz trieb auf der Oberfläche, umgeben von leeren Getränkedosen und dem Papier einer Chipstüte. Ein paar Touristen liefen in der prallen Sonne über die Uferpromenade und unterhielten sich auf Englisch, Spanisch und Französisch, wobei die Fotoapparate um ihren Hals bei jedem Wort hin- und herschaukelten. Autos fuhren über die Oberbaumbrücke, die im Sonnenlicht tiefgrau und metallisch glänzte. Alles war wie immer an diesem Sonntagmorgen. Und doch war etwas anders.
Julia lehnte sich gegen das Promenadengeländer, spürte den Druck der Streben an ihrer Brust und blickte auf die Wellen. Ihre Stirn war feucht. Mit der Hand fuhr sie sich übers Gesicht und betrachtete die bräunlichen Schlieren aus Schweiß und Make-up an ihren Fingerspitzen. Es war ein heißer August. Gut fürs Geschäft. Eine Bedienung in einem Café, die von sechs Euro die Stunde schwarz auf die Hand in einer Stadt wie Berlin überleben musste, war nun mal auf Trinkgeld angewiesen. Je mehr Touristen, desto besser. So war das eben – ein typisches Studentinnenschicksal.
»Hey, Julia. Nichts zu tun heute?«, rief ein Typ von einem vorbeifahrenden weißen Sportboot zu ihr herüber und winkte ihr zu, während er mit der anderen Hand das Steuerrad weiter nach rechts in Richtung Ufer drehte.
Es war Jo. Eigentlich hieß er Jochen, aber das Kürzel klang natürlich viel hipper, obwohl er schon auf die vierzig zuging und seine beginnende Glatze nur mit einer geschickten Kämmtechnik verbergen konnte. Er hatte einen kleinen Eisladen auf der anderen Seite der Spree und hielt gern bei ihr an.
Julia legte die Arme auf das Geländer. »Mann, du weißt doch, dass die Touri-Horden erst in zwei Stunden kommen, wenn sie ihren Rausch ausgepennt haben.«
Er nickte nur und winkte ihr noch einmal zu. Dann gab er so kräftig Gas, dass der Außenborder aufheulte und der Bug des Bootes fast ausbrach. Der Geruch von Benzin hing in der Luft. Jo verschwand in Richtung Brücke, und sein Boot hinterließ Wellen, die kraftvoll gegen die Mauer des Ufers schwappten. »Angeber«, flüsterte Julia.
Angebunden an einem kleinen Steg vor ihr dümpelte das Ruderboot von Benno. Er war der Koch des Cafés Spreezauber. Eine kleine Flasche Gin und eine durchsichtige Plastiktüte mit ein paar vorgedrehten Joints lagen im Fußraum und schaukelten mit den Bewegungen der Wellen mit. Typisch Benno. Er verbrachte seine langen Mittagspausen gerne allein auf dem Wasser, »weil der Stadtmensch auch mal Freiheit braucht«, wie er immer sagte. Nun wusste sie wenigstens, was er damit meinte. AB UND WEG stand mit roter Farbe auf dem Rumpf des Bootes. Alles klar.
Julia wollte sich gerade umdrehen und in die Küche des Cafés gehen, als ihr das Stück Holz ins Auge fiel, das sie zuvor schon aus einiger Entfernung gesehen hatte. Durch den starken Wellengang war das Brett nun näher gekommen, nur noch knappe zehn Meter war es entfernt. Das Holz wirkte nicht mehr so kantig wie zuvor, eher unförmig und verzogen.
Julia beschirmte ihre Stirn mit den Händen und kniff die Augen zusammen. Von dem dunklen Brett gingen zwei weitere Verstrebungen aus, als würden sie im Wasser ein T bilden, ähnlich einem Querbalken. In der Mitte sah sie einen hellen Punkt, einen runden Fleck, der unter der Wasseroberfläche verzerrt aussah und mal größer, mal kleiner wirkte. Julia erinnerte die Form zuerst an einen löchrigen Fußball, der vollgesogen mit Wasser in der Spree trieb, dann an eine leckgeschlagene Boje. Aber es half nichts. Sie wusste genau, was sie sah.
Es war der Kopf eines Menschen. Kein Zweifel. Vor ihr trieb eine Leiche, die Arme weit vom Körper gestreckt, die Beine unter Wasser.
»Nein. Nein. Oh, nein.« Julia sprach laut und deutlich. Sie konzentrierte sich auf den Klang ihrer Worte, wie sie es immer tat, wenn sie im Hörsaal der Uni vor den anderen Medizinstudenten stand und gegen ihre Aufregung ankämpfte. »Nein, das kann nicht sein.« Sie schüttelte den Kopf und starrte auf die Schuhspitzen ihrer kaputt gelaufenen Sneakers. Hinter ihrer Stirn spürte sie ein intensives Pochen, das sonst nur auftrat, wenn sich ein Tiefdruckgebiet näherte. Sie legte beide Hände an die Schläfen und schloss die Augen.
Der Wind trug das Lachen einer Frau von der anderen Seite der Spree herüber. Hinter sich hörte sie die schweren Schritte eines Joggers. Die Dunstabzugshaube im Café knatterte. Auf der Oberbaumbrücke hupte ein Auto.
Julia umfasste das Geländer vor ihr. Ihr Unterkiefer zitterte, als sie die Augen wieder öffnete. Eine lächerliche Täuschung, eine irre Phantasie – mehr konnte es nicht gewesen sein. Doch das, was sie vor einem Moment für ein Brett gehalten hatte, war nun so nahe, dass sie noch mehr Details erkannte.
Die Leiche im Wasser musste eine Frau sein, sie trug ein kurzes grünes Kleid. Es klebte an ihr wie eine glänzende, metallische Hülle, unter der sich unförmige Fleischmassen gegen den Stoff aufbäumten, als wollten sie ihn zum Platzen bringen. Das Gesicht der Frau war nach unten gewandt. Ihr Hinterkopf ragte ein wenig aus dem Wasser. Keine Haare. Eine Glatze. Der Körper mochte eins siebzig groß sein, vermutlich schlank, doch im Bindegewebe hatte sich Wasser eingelagert.
Julia registrierte alles mit anatomischer Genauigkeit, wie automatisch. Doch das hier war keine Vorlesung im gut klimatisierten Auditorium maximum ihrer Universität. Das hier war die Wirklichkeit an einem heißen Sonntagmorgen.
Ein Achter ruderte über die Spree. Die Männer in ihren engen blauen Shirts bewegten sich synchron wie Maschinen. Von dem Boot gingen kräftige Wellen aus, die die Tote erfassten, sie noch näher zu Julia trieben. Die rechte Hand berührte nun die Ufermauer, tippte mit den Fingern sanft dagegen – wie jemand, der vorsichtig an eine geschlossene Tür klopft und um Einlass bittet.
Julia holte tief Luft. Polizei, ich rufe die Polizei. Jetzt, sofort. Als sie sich umdrehte, stand Benno vor ihr.
»Sag mal, was glotzt du denn da stundenlang aufs Wasser? Wieder Liebesschmerz oder was? Mann, Mann, Mädchen …«
Die Kochmütze hing schief auf seinem Kopf. Er legte die Stirn in Falten; gepaart mit seinen dunklen Augenbrauen verliehen sie seinem Gesicht einen besonders verärgerten Zug. Obwohl es gerade mal zehn Uhr war, hatte seine Schürze schon Fettspritzer an der Brust abbekommen. Er zuckte mit den Schultern. »Also, was ist? Kommst du jetzt? Wir haben zwei Gäste.« Er zeigte auf einen Tisch unter einem Sonnenschirm, an dem zwei Japaner in dunklen Anzügen saßen.
Julia schüttelte den Kopf. »Benno, da schwimmt jemand im Wasser …«
»Na, das ist ja unglaublich bei diesen Temperaturen.«
»Nein. Eine Leiche. Im Ernst. Da …« Julia schlug mit der flachen Hand aufs Geländer. Für einen Moment glaubte sie, dass Benno laut loslachen würde. Doch er blickte sie nur reglos an, als hätte er in ihrem Gesicht eine Veränderung bemerkt. Vielleicht war es ihr Kinn, das noch immer zitterte. Oder ihre Stimme, die auf einmal heiser klang. Benno machte keine Scherze mehr. Er trat ans Geländer und blickte fünf Sekunden lang in die Wellen. Dann drehte er sich um, riss sich die Kochmütze vom Kopf und warf die Schürze auf den Boden. Ein Bein war schon über dem Geländer, als ihn Julia an der Schulter festhielt.
»Was machst du denn da? Was soll das werden?«
Er sah sie über die Schulter an. Seine Lippen waren nur noch schmale Striche. »Na, was meinst du? Willst du die Leiche hier weiter die Spree runtertreiben lassen?« Er deutete mit einer Hand nach rechts auf die Promenade. »Guck nur mal, wie viele Kinder hier unterwegs sind. Das können wir doch nicht machen.«
»Warum rufen wir nicht die Polizei?«
»Das machen wir danach. Ich zieh jetzt erst mal den Körper auf den Steg, und dann legen wir ein Tischtuch drüber. Und fertig.«
Mit einem Satz sprang Benno übers Geländer. Der laienhaft konstruierte Bootssteg mit seinen windschiefen Holzpfählen knirschte unter dem Gewicht des Ein-Meter-neunzig-Mannes. Er wischte sich eine Haarsträhne aus dem Gesicht und griff nach einem Paddel, das im Boot lag. Die Plastiktüte mit den Joints und dem Gin ließ er beiläufig unter dem Sitz verschwinden.
Julia wusste, dass Benno die Kochschule der Bundeswehr absolviert hatte. Die tote Frau im Wasser hatte ihn überrascht, aber nicht entsetzt. Allem Anschein nach war er immer noch mehr Soldat als Koch.
Breitbeinig stand er auf dem Steg, wie eine Lanze hielt er das Holzpaddel in beiden Händen. Den Griff richtete er nach vorne und schwang ihn hin und her, wobei er den Bewegungen der Leiche im Wasser folgte. Die tote Frau war zwei Meter vom Steg entfernt. Benno ging in die Knie und schob den Paddelgriff mit einer schnellen Bewegung in einen der Träger ihres Kleides. Langsam zog er die Leiche heran. Dann ließ er das Paddel fallen, legte sich bäuchlings auf den Steg und zog die Tote an den Achseln aus dem Fluss. Sie rutschte ihm aus den Fingern. Es klatschte, als der Körper wieder ins Wasser fiel. Benno betrachtete seine leeren Hände.
»Mist. Ihre Haut löst sich ab.« Er presste die Lippen aufeinander und packte noch einmal zu. Diesmal formte er beide Hände zu Schaufeln. Zentimeter für Zentimeter hob er die Tote aus dem Wasser. Erst tauchte der Oberkörper auf. Vom Stoff des Kleides perlten Wassertropfen ab, die im Sonnenlicht schillerten und auf den Bootssteg tropften. Es folgten die Beine und die Füße, die sich langsam über die Holzlatten schoben. Die nackten Oberschenkel der Leiche wirkten glasig, die Füße bläulich fahl und aufgedunsen.
Benno nickte Julia zu und zuckte mit den Schultern. »So ein Scheiß. Muss ein Unfall gewesen sein.«
Julia konnte den Blick nicht von der Toten abwenden. Die lachenden Touristen auf den Dampfern. Das Partyvolk mit den klirrenden Bierflaschen auf der Brücke. Und die Leiche, die nun bäuchlings mit angewinkelten Armen ganz still auf dem Bootssteg vor ihr lag. An diesem Sonntagmorgen war alles anders.
An den Zehennägeln der Toten klebten die Reste von grünem Nagellack, brüchig und abgeblättert. Über die Innenseite eines Unterarmes zog sich ein Muster aus blauvioletten Totenflecken. Dazwischen zeichnete sich etwas Graues, Strichartiges ab, das an einen Rahmen erinnerte. Viel zu symmetrisch für Totenflecke. Nun sah Julia auch die hellrote Farbe darüber. Es musste ein Tattoo sein. Der Arm lag so ungünstig, dass sie nur einen Teil erkennen konnte, aber irgendwie erinnerte es sie an etwas.
»Benno, da ist … was auf dem Unterarm.« Sie deutete auf die rechte Körperhälfte der Toten. »Kannst du sie mal umdrehen?«
Benno murmelte etwas Unverständliches.
»Bitte, mach’s doch einfach.« Julias Stimme hatte einen flehenden Klang.
Benno legte die Hände auf die Hüften der Leiche und drehte sie mit einem Ruck um. Ihre aufgeschwemmten Hände klatschten mit einem dumpfen Geräusch auf das Holz. Das Tattoo war nun sichtbar.
Eine rote Sieben, umrahmt von einem grauen Rahmen, klebte wie ein Abziehbild am Unterarm. Benno starrte zuerst auf das Tattoo, dann auf das Gesicht der Toten. Er wich einen Schritt zurück und legte die Hände an die Schläfen, als wollte er verhindern, dass sich dieses Bild in sein Gehirn einprägte. »O Gott, das ist doch … es ist … wie kann sie es sein? Warum ausgerechnet sie?«
Eine Hitzewelle pulsierte durch Julias Kopf, machte ihn blutleer und ließ sie taumeln. Neben ihr klapperte die Kette von einem vorbeifahrenden Rad. Ein Junge warf einen Stein ins Wasser, der mit einem Platschen in den Wellen versank. Sie hielt sich am Geländer fest und flüsterte: »Ja, sie ist es. Sie ist es wirklich. Und es war kein Unfall.«
Die Haut der Toten hing an einigen Stellen schuppig, wie loses Blattwerk von ihrem Gesicht. Ihre Augenlider ruhten verquollen und schwer auf den Pupillen.
Aber dort, wo einst ihre Lippen gewesen waren, klaffte nur noch eine sauber herausgeschnittene Öffnung.
2
Es waren genau dreiundsiebzig Krawatten. Mal länger, mal kürzer gebunden. Sie hingen über den meist rundlich wirkenden Männerbäuchen und huschten an Christine Lenève vorbei wie flatternde Fahnen. Sie hatte die Schlipsträger gezählt, wie sie es immer tat, wenn aus einer dunklen Ecke ihres Gehirns eine Frage auftauchte, die sie sich unbedingt beantworten musste. Die gefühlten dreißig Grad im Flughafen Tegel schienen die Männer in ihren Anzügen voller Beharrlichkeit zu ertragen. Kein Wunder. Es war ein Flug von Frankfurt nach Berlin gewesen, und die Business-Class mit ihren nach scharfem Rasierwasser riechenden Managern erlaubte sich keine Schwäche. Der oberste Knopf blieb zu. Keine Diskussion.
Koffer klapperten über das Rollband, verkanteten sich ineinander, als würden sie sich umarmen. Über Lautsprecher kündigte eine Frau mit fröhlichem Singsang in der Stimme die mehrstündige Verspätung eines Fluges nach Lissabon an. Es roch nach frischer Bodenpolitur, weil eine Putzfrau immer wieder ihren zerschlissenen Wischmopp in einen Plastikeimer tauchte, um eine Ecke des Ankunftsbereiches zu schrubben. Unter den Achseln ihres Arbeitskittels zeigten sich dunkle Schweißflecken.
Vor Christine lag ein kleines Mädchen in einem Blümchenkleid müde auf einem Koffer, sein rechtes Bein zuckte im Halbschlaf. Am liebsten hätte sich Christine dazugelegt, so erschöpft war sie. Aber sie musste wachsam bleiben. Sie wartete auf ihren braunen Lederkoffer mit den messingfarbenen Schnallen, den schon ihr Vater zum Reisen benutzt hatte.
Drei Wochen war sie in Nigeria für eine Fotoreportage unterwegs gewesen. Einundzwanzig Tage zwischen Armut, Korruption und Entführungen. Sie hatte einen ehemaligen Warlord getroffen, war Kindern begegnet, die der Hexerei beschuldigt wurden, und hatte mit Bauern diskutiert, die ihr Land mit Äxten und Macheten verteidigten. Und danach war sie einfach in ein vollklimatisiertes Flugzeug gestiegen, neun Stunden geflogen, umgestiegen und in einer Welt der Maßanzüge und klirrenden Goldkettchen wieder aufgetaucht – eine absurde Welt. Journalistischer Alltag eben.
In einer Schublade ihres Schreibtisches ruhten eingestaubte Urkunden, Journalistenpreise, die sie zwischen klebrigen Bonbons und ausgelaufenen Tintenpatronen achtlos weggesperrt hatte. Für Christine zählte nur die Story. Sie kämpfte um jede Geschichte, verbiss sich in die kleinsten Unstimmigkeiten und gab nicht eher auf, bis alle Antworten sauber sortiert vor ihr lagen – ganz so, als würde sie aus vielen Zutaten ein kompliziertes Gericht kochen. Einer ihrer Chefredakteure hatte sie einmal als unnachgiebige Jägerin bezeichnet, gefährlich und exzellent bis ins letzte Detail. Es war eine Beschreibung, mit der Christine sehr gut leben konnte.
Sie lehnte sich an eine der Säulen. Der unverputzte Beton über ihrem Kopf, der grau gesprenkelte Kunststeinboden und die scharfen Kanten des Gebäudes hatten den Charme einer Lagerhalle. Gerade deshalb liebte sie diesen Flughafen. Seine Kälte und Unnahbarkeit ließ die Ankunftsszenen hinter der Sicherheitsverglasung auf der anderen Seite um so erstaunlicher wirken.
Zwei Seniorinnen mit riesigen Brillen auf der Nase lagen sich in den Armen. Am Ausgang von Gate zwei küsste ein langhaariger Typ seine dunkelhäutige Freundin und blickte ihr dann lange in die Augen. Sie zog ihn an seinen Rastalocken, lachte laut und presste ihren Kopf an seine Brust. Ein Mann in einem unmodischen Karoanzug verbeugte sich vor einer Frau, spitzte die Lippen und hauchte einen Kuss auf die ausgestreckte Hand der sehr blonden Dame. Kitschiger geht’s nicht, dachte Christine, überließ sich aber dennoch dem wohligen Gefühl. So viel Liebe auf einem Platz, das gab es nur auf einem Flughafen.
Viele Jahre lang war Christine durch die Zollkontrolle gegangen, ohne dass auf der anderen Seite jemand auf sie gewartet hatte. Bei ihrem aufreibenden Job hatte sie fast das Leben vergessen. Doch heute war alles anders.
Hinter einer großen Sonnenblume, die für einen Moment hinter dem Fenster der Gepäckausgabe auftauchte, ließ sich ein junger Mann mit lockigem braunen Haar sehen.
Albert. Endlich.
Er richtete die weißen Kordeln seines Kapuzenshirts und kniff die Augen zusammen. Christine wusste genau, wonach er Ausschau hielt.
Sie winkte ihm zu, und in derselben Sekunde lächelte er. Er trat näher ans Glas, legte eine Hand auf die Scheibe und formte mit den Lippen die Worte: Beeil dich.
»Mach ich«, flüsterte Christine zurück.
Seit zehn Monaten waren sie zusammen. Schon zehn Monate oder erst zehn Monate? Sie konnte die Frage nicht beantworten.
Manchmal, wenn sie morgens müde im Bad stand, wunderte sie sich über die fremde Zahnbürste, die auf dem Rand ihres Waschbeckens lag, und dann fiel es ihr wieder ein: Sie war nicht mehr allein. Albert war an ihrer Seite. Ein gutes Gefühl.
Auf dem Rollfeld draußen schwangen Lotsen ihre Signalkellen. Die Sonne brannte durch die Fenster, und Christine spürte, wie eine dünne Schweißperle über ihren Nacken lief und vom Stoff ihrer weißen Bluse aufgesogen wurde. Berlin im Hochsommer. Die Stadt keuchte unter der Hitze.
Zwischen einem silbernen Alukoffer und einem zusammengeklappten Kinderwagen fuhr ihr Lederkoffer auf dem Rollband vorbei. Christine griff zu. Der alte Messinggriff bog sich in der Mitte fast durch, als sie zum Ausgang eilte.
Vor ihr ging ein Mann in einem taubenblauen Anzug, der so laut in sein Handy brüllte, dass es ihr in den Ohren dröhnte. »Ja, genau … die unique selling proposition … ganz genau … und wenn wir das Benchmarking haben, kümmern wir uns um den free cash flow … genau …« Sein lautes Lachen am Ende des Satzes erinnerte an das Wiehern eines sich aufbäumenden Pferdes. Neben dem Durchgang zur Wartehalle stand der Eimer der Putzfrau, darin ihr Wischmopp. Der Mann stieß mit der Schuhspitze dagegen, und sofort kippte der Plastikkübel um, die Stange fiel polternd zu Boden. Trübes Wasser lief über die Kunststeinplatten. Der Mann registrierte es aus den Augenwinkeln und ging weiter. Die grauhaarige Putzfrau, die nur einen Meter danebenstand, ignorierte er völlig. Die Frau senkte den Kopf. Sie hatte die sechzig deutlich überschritten, und sicher war sie Kränkungen durch die Fluggäste gewohnt. Auf die alltäglichen Ungerechtigkeiten war Verlass.
Christine spürte, wie ihr das Blut in den Kopf schoss. Augen zumachen und weitergehen, das wäre das Einfachste, und genau aus diesem Grund tat sie das Gegenteil.
Sie brauchte nur zwei Sekunden. Schwungvoll wie eine Bowlingkugel führte sie den Koffer in ihrer Hand. Sie traf den Mann genau in den Kniebeugen, und fast synchron ließ er sein Handy fallen. Seine linke Hand ruderte durch die Luft, er versuchte, das fallende Gerät zu greifen, vergeblich. Mit ausgestrecktem Fuß wollte er den Aufprall abfangen. Es war eine beschämend billige Sporteinlage. Das Handy prallte von seinem Knöchel ab und blieb vor den Füßen der Putzfrau liegen.
Unerwartet schnell drehte er sich zu Christine um. Auf seiner vor Wut gekräuselten Stirn perlten Schweißtropfen.
»Können Sie nicht aufpassen? Verdammt.« Er zischte die Worte zwischen seinen schmalen Lippen hervor.
»Schon, aber ich bin wohl über die Stange da gestolpert.« Christine deutete auf den Wischmopp am Boden. »Und dann noch diese Hitze, puh …« Sie zuckte mit den Schultern und zog die Augenbrauen hoch. Ihre jahrelang antrainierte Geste für Momente, in denen sie besonders unschuldig wirken wollte.
Voller Empörung stieß der Mann die Luft aus und hob sein Handy auf. Die Szene wirkte, als würde er vor der Putzfrau einen Kniefall machen – wie man es im Mittelalter von einem Knappen erwartet hätte, der seiner Königin huldigt. Dieses Bild gefiel Christine. Bevor sie weiterging, lächelte sie der Putzfrau zu, und die lächelte zurück – eine kurze Sekunde zwischen zwei Fremden, die keine Worte brauchten. Dann senkte die Frau schnell wieder den Blick. Das Lächeln umspielte weiterhin ihre Lippen.
Christine verließ die Gepäckausgabe und ließ sich in Alberts Arme fallen. Er presste sie fest an sich. Der Geruch von Gewürznelken stieg in ihre Nase. Dieses Aftershave benutzte er sonst nur an Feiertagen. Seine Bartstoppeln kratzten über ihre Wange. Sie mochte dieses Gefühl. Es fühlte sich schmerzhaft lebendig an.
Albert klemmte sich die Sonnenblume unter den Arm. »Endlich ist meine Frenchie wieder da. Endlich«, flüsterte er ihr ins Ohr. Er strich mit der Hand über ihr Kinn, dann küsste er sie. Frenchie war ihr Spitzname, den Albert seit ein paar Monaten immer benutzte, wenn er emotional aufgewühlt war.
Der Name war eine Anspielung auf Christines Kindheit in Frankreich und ihr Leben in Cancale. So war es nun mal, wenn man bei seinem Vater in einem Haus am Meer aufgewachsen war. Einem Stadtmenschen wie Albert, der nur ungern in ferne Länder reiste, mochte ihre Vergangenheit außergewöhnlich erscheinen. Doch an ihren Spitznamen hatte sich Christine noch immer nicht gewöhnt. Deswegen weigerte sie sich auch, das Spiel der Verliebten mit einer weiteren abstrusen Namensschöpfung zu bereichern. Albert war Albert, und so sollte es auch bleiben.
Er legte die Sonnenblume auf den Koffer, hielt Christine an den Oberarmen und schob sie ein Stück von sich fort. »Lass mal sehen.« Er musterte sie vom Scheitel bis zur Schuhspitze. »Diesmal keine Kratzer und Schürfwunden im Gesicht? Wird unsere Topjournalistin endlich mal ein bisschen vorsichtiger?«
»Niemals.« Mit gespielter Empörung tippte sie mit dem Finger auf eine wunde Stelle an Alberts Handrücken. »Und was haben wir hier? Hat sich unser Wirtschaftsredakteur in meiner Abwesenheit etwa geprügelt?«
Albert betrachtete seine Hand, als sähe er sie zum ersten Mal. »Na, also … nein, mir ist eine Scheibe Brot im Toaster hängengeblieben, und da habe ich mit einem Messer versucht …« Er ahmte eine stichartige Bewegung nach. »Und dann bin ich abgerutscht. Blöd.«
»Wie aufregend und unglaublich gefährlich.« Christine wollte gerade Albert die Arme um den Hals legen, als der Mann im taubenblauen Anzug an ihnen vorbeilief.
»Nein, genau … wir müssen die human resources komplett austauschen«, rief er in sein Handy. Abrupt blieb er stehen, als er Christine wiedererkannte. Sein Blick war eine Mischung aus Verachtung und einem Schuss Zorn. Ein Blick, wie ihn nur ein Alphatier aus dem oberen Management für den täglichen Gebrauch kultivieren konnte. Vielleicht dachte er darüber nach, Christine mit Worten zu sezieren.
»Miststück«, sagte er gerade so laut, dass sie es hören konnte. Nur ein Wort. Enttäuschend. Dann presste er sein Handy wieder ans Ohr und verschwand zwischen Dutzenden elfenbeinfarbenen Taxis, die vor den Ausgängen des Flughafens auf Fahrgäste warteten.
Albert schüttelte den Kopf. »Hast du mal wieder neue Freundschaften geschlossen?«
»Das war die typische Reaktion eines Mannes angesichts meiner Überlegenheit. Dürfte dir nicht neu sein, oder?« Sie schob die Hände in die Taschen ihrer engen Jeans und lachte. Albert nahm ihren Koffer, packte die Sonnenblume am Stil, und dann gingen sie zwischen den bunten Turbanen einer Reisegruppe aus Bangladesch die Halle hinunter. Auf den digitalen Anzeigetafeln flimmerten die Namen weit entfernter Städte wie Moskau, Miami und Riad in leuchtendem Gelb. Vor den Schaltern der Fluggesellschaften standen lange Schlangen von Menschen, die meisten mit angespannter Miene. An diesem Dienstag waren wohl nur wenige Flüge pünktlich.
»Sag mal …« Albert hob den Koffer so hoch, dass er vor Christines Gesicht hin- und herschaukelte. »Wär es nicht mal Zeit für einen Rollkoffer? Ganz schön schwer, dieses Antikmonstrum.«
»Auf gar keinen Fall. Ich kann Rollen nicht ausstehen. Sie erinnern mich an hölzerne Wackeldackel auf Rädern, die Kinder hinter sich herziehen. Ich finde das stillos.«
»Echt?« Er neigte den Kopf zur Seite.
»Klar.«
Außerdem verabscheute Christine das Geräusch von klappernden Rollen auf Berlins Bürgersteigen. Das Klackklack nervte sie vor allem zur Sommerzeit, wenn die Touristen in die Stadt einfielen. Aber das war nur ein Teil der Wahrheit. Christine liebte den zerschlissenen Koffer ihres Vaters. Oft war Remy Lenève auf der Schwelle ihres Zimmers in Cancale aufgetaucht, wenn er von einer Reise zurückgekehrt war. In diesen Momenten wurde der Raum immer vom warmen, würzigen Duft seiner Sandelholzseife erfüllt. Den Koffer hatte er in der rechten Hand, sein Lieblingscordsakko in der linken gehalten. Beides ließ er fallen, um Christine in seinen Armen aufzufangen und sie durch die Luft zu wirbeln. Es war ein Ritual, das sie beide feierten und den Trennungsschmerz der vergangenen Tage vergessen machte.
Christine war siebzehn gewesen, als ihr Vater starb. Mit der unheimlichen Energie eines Mädchens, das den Tod eines geliebten Menschen nicht akzeptieren will, hielt sie an all den Dingen fest, die sie an ihn erinnerten.
Heute war Christine achtundzwanzig, und geändert hatte sich daran nichts. Niemals würde sie sich vom Koffer ihres Vaters trennen. Aber sie wollte Alberts Wiedersehensfreude nicht trüben, deshalb behielt sie ihre Gedanken für sich.
Vor einem Zeitungskiosk blieb sie stehen. »Ich brauche meine Gauloises, aber ganz schnell.« Mit vier Schritten war sie vor dem kleinen Kiosk. Zeitungen, Kaugummis, Reiseführer, Schlafmasken und Stoffbären türmten sich vor Christine auf.
Hinter dem Tresen stand ein grauhaariger Mann mit Schnauzer und Schiebermütze. Ohne Regung schaute er auf seinen Fernseher, der auf einem wackligen Holzschemel stand. Christine hörte die anfeuernden Männerchöre, die aus dem Lautsprecher drangen. Natürlich, ein Fußballspiel. Sie bat um ihre Zigaretten, und der Mann reichte sie ihr. Dabei wandte er den Blick nicht vom Fernsehschirm ab.
Christine tippte auf die rote Packung vor sich. »Die sind light.« Sie schob die Zigaretten über den Tresen zurück – so vorsichtig, als würde ein giftiger Skorpion vor ihr liegen. »Sehe ich aus wie jemand, der auf Mädchenzigaretten steht?«
Der Mann wandte sich ihr zu und schob seine Mütze ein Stück nach oben. Er verzog den Mund zu einem Grinsen. Im unteren Kiefer fehlte ein Zahn, dafür erinnerte das Funkeln seiner Goldimplantate an eine gut gefüllte Schatzkammer. Mit einer flinken Bewegung zog er die richtigen Zigaretten unter dem Tresen hervor und legte einen Lutscher auf die Packung. »Was zum Naschen, für danach.« Sein Grinsen war noch breiter. Christine legte das Geld auf den Tresen, nahm die Packung und drehte sich um.
Die Sonnenblume lag auf dem Boden, daneben ihr Koffer, und davor stand Albert mit eingefallenen Schultern. Sein Gesicht ähnelte einer steingrauen Maske, als wären all seine Muskeln erstarrt. Nur seine Lippen zitterten. Mit dem rechten Finger zeigte er auf eine Zeitung, die direkt neben Christines Kopf in der Auslage hing. Auf einem grobkörnigen Schwarzweißfoto war die Leiche einer Frau abgebildet. DIE TOTE AUS DER SPREE stand in wuchtigen Buchstaben auf dem Titelblatt.
»Nana …« Der Name klang wie ein heiseres Räuspern aus seinem Mund. »Nana ist tot.«
3
Sie ist erwürgt worden. Aber das war wohl noch nicht genug. Man hat sie verstümmelt und dann einfach wie ein Stück Dreck in die Spree geworfen.« Albert hielt die Zeitung von seinem Körper weg, als sei sie ein glühendes Holzscheit.
Er saß neben Christine auf dem Beifahrersitz des Citroën DS. Sein linkes Knie wippte auf und ab – ein alter Tick, der nur auftrat, wenn er aufgeregt war. Er legte eine Hand auf seinen Oberschenkel und presste ihn gewaltsam nach unten. Dann ließ er die Zeitung sinken und blickte durch die Windschutzscheibe auf den Flughafenparkplatz.
Vor dem abgestellten Wagen lief ein bärtiger Mann mit langem Haar und Rucksack entlang, als sei er gerade eben von einem Berg herabgestiegen. Ein paar Tauben pickten die Reste einer Eiswaffel vor einem Müllcontainer auf. Weiße Schranken hoben und senkten sich in der Nachmittagssonne vor dem Parkplatzgelände. Albert sah alles und nahm trotzdem kaum etwas wahr. Vor ein paar Minuten war er von der Wiedersehensfreude auf Christine erfüllt gewesen, doch nun war ihm, als würde ein dunkler Schatten seine Lungen zusammenpressen.
Er zerknüllte die Zeitung in seinen Händen und warf sie in den Fußraum des Wagens. Die Druckerschwärze des Papiers hatte Schlieren an seinen Fingern hinterlassen. Sein Atem ging viel zu schnell, aber er konnte ihn nicht unter Kontrolle bringen. »Ihre Lippen … Wer immer das war, er hat ihr die Lippen einfach aus dem Gesicht geschnitten.« Er schlug mit der Faust auf das Armaturenbrett des Autos. Die Plastikverkleidung vibrierte. »So ein verdammtes Schwein.« Über den Hass in seiner Stimme war er selbst erstaunt. So ging es wohl auch Christine. Sie deutete ein Kopfschütteln an.
Die ganze Zeit über hatte sie geschwiegen. Sie wollte ihm sicher ein paar Minuten Zeit geben, um den Tod Nanas zu verkraften. Nun wandte sie sich ihm zu. Ihre Hände ruhten auf dem rissigen Lederlenkrad. Sie kniff ihre großen dunklen Augen ein wenig zusammen, so dass ihr ebenmäßiges Gesicht durch die kleine Falte zwischen den Brauen eine seltsame Schwere bekam. Albert kannte diesen Blick. Jetzt wurde es ernst.
»Wenn du wütend bist, dann sag das Alphabet auf. Danach beruhigst du dich wieder.« Sie legte ihm eine Hand auf die Schulter. »Oder denk daran, dass dein Zorn den Mörder freuen würde.«
Das saß. Christine hatte recht. Albert konnte sich selbst nicht leiden, wenn er wütend war. Es passte nicht zu ihm. Er brauchte zwanzig Minuten, um einen Apfel zu essen. Um Kinos machte er grundsätzlich einen Riesenbogen, weil er sich nicht das Tempo vorschreiben lassen wollte, in dem die Bilder an seinen Augen vorbeiflimmerten. Christine lachte ihn dafür regelmäßig aus. Er war ein Mensch, der auf die Replay-Taste drückte, wann immer es ging – ein rationaler Geist, der alles bewusst tat und sich viel Zeit nahm.
Insgeheim liebte er das Vorhersehbare. Spontane Wut stand ihm schlecht. Sie war ihm peinlich. »Tut mir leid. Ich will nur verstehen, wie das passieren konnte. Ich kapier’s einfach nicht.«
Der schwarze Citroën DS hatte dreißig Minuten lang auf dem Parkplatz des Flughafens in der Sonne gebraten. Albert hatte ihn dort abgestellt, wie er es immer tat, wenn er Christines Wagen fahren durfte, um sie am Flughafen abzuholen. Die Hitze im Auto erschien ihm unerträglich. Er kurbelte das Seitenfenster herunter. Nun kam auch noch der Gestank eines vorbeituckernden Daimlers mit Dieselmotor dazu.
Christine wischte sich eine Haarsträhne aus dem Gesicht. Ihr schwarzer Pagenkopf saß wieder perfekt, aber ihre Nase glänzte schweißnass. »War sie eine sehr gute Freundin?«
Albert hätte fast laut gelacht. Er sah Nana vor sich, wie sie ihre Arme in die Hüfte stemmte. »Nein. Eigentlich nicht. Sie war sehr schwierig und oft richtig nervend. Nana war so etwas wie eine Komplizin, bevor es dich gab. Das ist sechs Jahre her. Da war ich gerade frisch in Berlin. Ein Direktimport aus Würzburg, sozusagen.«
Albert entstammte einer konservativen Apothekerfamilie aus Bayern. Sein Vater hieß auch Albert, ebenso sein Großvater, und selbst sechs Generationen zuvor ließ sich dieser Name noch in den auf Pergamentpapier niedergekritzelten Stammbäumen der Familie Heidrich finden. Albert hasste den Klang jeder Silbe. Oft hatte er unter der alten Eiche auf dem Anwesen seiner Eltern gesessen und sein Leben verflucht, das aus Traditionen, Ritualen und überholten Weltvorstellungen bestand. Die Historie seiner Familie klebte wie ein alter Kaugummi an seinem Schuh, bis er ihn mit Gewalt abgekratzt hatte. Er war nach Berlin gegangen. Seine Eltern hatten protestiert. Ihm war es egal gewesen.
»Ich habe Nana an der Uni kennengelernt, beim Informatikstudium. Hat eine ganze Weile gedauert, bis sie sich mit mir angefreundet hat.«
Ihr stolzer, aufrechter Gang war ihm damals sofort aufgefallen. Sie war verschwiegen, abweisend und dabei von einer heimlichen Überlegenheit gegenüber all den anderen Studenten gewesen. Einmal hatte er im Innenhof des Fachbereiches auf einer Wiese gesessen. Nana setzte sich neben ihn, überkreuzte die Beine und stupste ihn mit der Schulter an. »Du kannst doch viel mehr, als du zeigst. Trau dich doch mal.« Sie stand auf und ging. Er blieb noch eine Stunde auf dem Rasen sitzen, strich immer wieder mit der flachen Hand übers Gras und dachte über ihre Worte nach. Bis er zu dem Schluss kam, dass sie recht hatte.
»Nana war eine ganz besondere Frau. Sie hat mit Algorithmen so selbstverständlich jongliert, wie andere Menschen über die Straße gehen.« Albert ahmte mit der linken Hand eine Schließbewegung nach. »Oder eine Haustür öffnen. Darin bestand ihr Talent, verstehst du?«
Christine wischte sich mit dem Handrücken über die verschwitzte Oberlippe und nickte.
»Nana war eine Hackerin, und zwar eine verdammt gute. Die Beste. Und ausgerechnet mich wollte sie für ihre Sache gewinnen, damals. Klar, das hat mir geschmeichelt. Du weißt ja, was dann passiert ist. Plötzlich hockte ich in einer Kreuzberger Kellerwohnung und war damit beschäftigt, großkapitalistische Unternehmen lahmzulegen.« Er schüttelte den Kopf. Wie absurd das heute alles klang. Aber Nana hatte es damals zu einer ganz selbstverständlichen Angelegenheit gemacht.
Sie war eine junge Frau gewesen, die genau wusste, was ihr das Leben schuldete. Er sah sie vor sich: ihr schwarzes Haar, das sie zu einem Zopf geflochten trug, den Laptop auf den angewinkelten Knien und das blaue Licht des Monitors, das von unten in ihr schönes schmales Gesicht strahlte. Sie hatte sich darauf spezialisiert, die Websites von Pharmakonzernen zu hacken, ganze Systeme lahmzulegen und Chaos zu verbreiten. Für sie war die Sache klar: Wer Geld mit den Krankheiten anderer Menschen verdiente, musste bestraft werden.
Sie war charismatisch, skrupellos und von einer Überzeugungskraft, die keinen Widerspruch duldete. Und er, der Sohn eines Apothekers, der zwischen braunen Glasflaschen und Messbechern aufgewachsen war, machte mit. Es war die perfekte Rebellion gegen sein altes Leben. Nana stellte seine Welt auf den Kopf, und auf einmal ergab alles einen Sinn. »Damals habe ich geglaubt, mit Nana an der Seite die Welt verändern zu können. Und ich musste dafür nicht mal umständliche Reisen auf mich nehmen.« Er deutete mit den Handflächen einen etwa dreißig Zentimeter großen Abstand an. »So ein kleiner Computer hat dafür völlig gereicht. Mehr nicht. Eigentlich unglaublich.«
Albert legte eine Hand auf sein linkes Knie, das wieder zu wippen angefangen hatte.
Neben dem Citroën lief eine vollbepackte Familie mit einem Baby vorbei, das mit lautem Gebrüll gegen die Hitze protestierte. Die Mutter schaukelte ihr Kind auf dem Arm hin und her, und das Geschrei ebbte ab.
»Nana war eine brillante Hackerin. Aber irgendwann hat sie die Kontrolle verloren. Es gab nur noch Schwarz und Weiß. Unsere Gruppe wurde immer größer, und sie hat sie regiert wie eine selbstherrliche Königin.«
»Klingt gar nicht so übel.« Christine öffnete die Fahrertür und ließ ein Bein herausbaumeln. »Und dann wurde dir alles zu viel, und du bist mit der kleinen Journalistin gegangen, die einen Hacker für eine Korruptionsgeschichte im EU-Parlament gebraucht hat. Stimmt’s?«
»Exakt. Dann kamst du mit deinen irren Storys.« Albert setzte sich aufrecht hin. Sein Shirt klebte klatschnass an seinem Rücken. Er zog den Stoff von der Haut. Endlich hatte er auch seinen Atem wieder unter Kontrolle. Er holte tief Luft. »Ich habe erst später kapiert, dass ich eine Königin gegen eine andere eingetauscht hatte.« Er nahm Christines Hand. »Du hast mich von der Gruppe befreit. Im Ernst. Wir waren Kriminelle. Das hätte wirklich schiefgehen können. Und womöglich ist genau das jetzt passiert.«
Neben der geöffneten Fahrertür lag eine leere Cola-Dose.
Christine kickte sie mit der Schuhspitze ihres Sneakers weg. Das Blech polterte über den Asphalt und knallte gegen das Kontrollhäuschen des Parkplatzes. Hinter der Scheibe bewegte ein grauhaariger Mann seine Lippen wie ein Pantomime. Er drohte mit dem Zeigefinger, aber Christine zuckte nur mit den Schultern, als hätte sich die Dose eigenständig in Bewegung gesetzt. Ihr Lächeln erinnerte Albert an ein fünfjähriges Kind, das unschuldig, aber doch neugierig seine Umwelt erforscht. Vielleicht liebte er sie ja deswegen so.
Christine stützte das Kinn in die Handfläche und spitzte die Lippen. Sie sah nun wieder ernst aus. »War Nana denn immer noch aktiv als Hackerin? Ich meine, wann hast du sie zuletzt gesehen? Erinnerst du dich noch?«
An dem Tag, als Albert die Gruppe verlassen hatte, verabschiedete ihn Nana mit einem beiläufigen Schulterzucken, als sei er schon weit weg. »Viel Glück, Albert.« Nur drei Worte. Dann hatte sie sich wieder ihrem Laptop zugewandt. Er war die schmalen Stufen hinaufgestiegen, fort von dem muffigen Keller, in dem er zwei Jahre den Sinn seines Lebens gefunden hatte. Nie wieder war er Nana danach begegnet. Er war ihr aus dem Weg gegangen.
»Das muss vier Jahre her sein, seit ich mich verabschiedet habe. Mindestens. Später hat Nana als Dozentin an der Uni gearbeitet. Sie war wohl kurz vor ihrem Doktortitel. Mehr weiß ich nicht.«
In der Seitenablage der Fahrertür stand eine Wasserflasche. Christine nahm einen Schluck und verzog das Gesicht. Das Wasser war zu warm und schmeckte abgestanden. »Und heute bist du Wirtschaftsjournalist bei einem Fernsehsender und sitzt den ganzen Tag auf einem wippenden Designerstuhl. Nicht schlecht.«
Albert atmete schwer aus. »Ja, super.« Er stützte sich auf den Fensterrahmen der Beifahrertür und erschrak über sein Gesicht im Rückspiegel. Die rot geäderten Augen und die tiefen Stirnfalten ließen ihn nicht unbedingt wie einen Mann aussehen, der die dreißig noch nicht erreicht hatte. Er blickte auf die zerknüllte Zeitung zu seinen Füßen und wunderte sich, was eine auf so billigem Papier gedruckte Geschichte in ihm auszulösen vermochte. »Ich habe meine Vergangenheit in der Gruppe nie vergessen. Es ist alles untrennbar miteinander verbunden, bis heute. Das macht mir die Sache mit Nanas Tod so schwer.« Er strich mit der Hand über Christines Nacken, eine ihrer Lieblingsberührungen. »Ich muss wissen, was da passiert ist.«
Christine drehte den Zündschlüssel im Schloss um. Aus der Konsole des über vierzig Jahre alten Autos ragte der Schalthebel wie ein riesiger Füllfederhalter heraus. Sie tippte den Metallstift an, und sofort brummte der Vierzylinder unter der Haube. »Das verstehe ich. Sehr gut sogar.« Sie legte den Schalter um und gab Gas. »Dann lass uns mal sehen, was von deiner Gruppe übrig geblieben ist.«
4
Die Oberbaumbrücke glich einer zugemüllten Partymeile auf Mallorca. Leere Flaschen lagen auf dem Asphalt. Ein leichter Wind trieb bunte Papierfetzen über die Straße, die zerfetzten Reste von weggeworfenen Werbeflyern türkischer Restaurants. Gewaltige Strohhüte schaukelten hin und her. Bierflaschen wurden gegeneinandergestoßen, und dazwischen raschelten die aufgeschlagenen Straßenkarten von hilflosen Touristen. Ein Punk mit Netzshirt beschallte die Brücke. Drug me, drug me, drug me, dröhnten die Stimmen der Dead Kennedys aus seinem alten Kassettenplayer. Auf der anderen Seite der Brücke stand ein Mann mit grauem Haar, das er mit einem Gummi im Nacken zusammengebunden hatte. Er verkaufte biblische Buttons, einen für drei Euro.
Christine fiel der Spruch GOTT HAT TAUSEND AUGEN auf, der fett gedruckt auf einem der Anstecker stand. Hoffentlich hatte Gott auch tausend Hände, um sich die Augen zuzuhalten.
Sie rollte mit dem Citroën ein paar Meter weiter im Nachmittagsstau auf der Oberbaumbrücke. Albert saß neben ihr und biss auf seiner Unterlippe herum. Christine konnte seine Anspannung spüren, als wäre er von einem elektrischen Nebel umgeben, der bei der kleinsten Berührung einen Stromstoß auslösen würde. Er brauchte Zeit. Sie gab sie ihm.
Die U1 ratterte über die Eisenbahnbrücke und überquerte die Spree. Die Brückenbögen mit ihren roten Steinen saugten die Geräusche der Bahn auf und warfen sie um ein Vielfaches verstärkt auf die Menschen darunter zurück.
Christine hasste den Lärm auf der Brücke, der wie eine klebrige Masse in ihren Kopf drang. Es war ein Wirrwarr aus vielen kleinen Geräuschen, die sie einzeln aus dem Soundbrei lösen musste, um sie den Bildern vor ihren Augen zuzuordnen: ein stotternder Auspuff, das Quietschen auf den Gleisen, Trommelklänge, die über die Spree getragen wurden. Sie nahm das Geschehen überdeutlich wahr, all die vielen kleinen Details in ihrer Umgebung, die ihre Sensoren wie feingliedrige Fühler ertasteten und abspeicherten.
Dieses Talent war Christines gefährlichste Waffe in ihrem journalistischen Alltag. Achte auf die versteckten Unstimmigkeiten, die sich in den kleinen Details offenbaren. Immer. Dann wirst du jede verborgene Wahrheit in deiner Umgebung entdecken. Ihr Vater hatte ihr diese Methodik beigebracht, als sie sieben Jahre alt gewesen war, und er hatte recht behalten. Jede ihrer Storys funktionierte so. Ihre Sucht nach der Wahrheit hatte sie zu einer gefährlichen Frau gemacht. Das Chaos auf der Oberbaumbrücke aber strengte sie nur an. Es war Krach, mehr nicht.
Albert schien von alldem nichts wahrzunehmen. Sein Blick war nach unten gerichtet. Er fixierte sein wippendes linkes Knie, als sei es ein Körperteil, das unmöglich zu ihm gehören konnte. Seine Stirn war schweißnass. Er kaute auf den weißen Kordeln seines Kapuzenshirts herum.
»Geht es dir gut, Albert?«
Er riss den Kopf hoch, als sei er aus einem langen Schlaf erwacht. »Ja. Also, ich meine … vielleicht. Wenn ich ehrlich bin … eigentlich nein.«
Drei Antworten auf eine Frage. Es ging ihm nicht gut. Albert war ein feinfühliger Mensch, der sich alles zu Herzen nahm. So war er schon gewesen, als sie noch Partner waren und für ihre Reportagen durch Rumänien, den Sudan oder Russland gereist waren. Christine ging mit analytischer Härte an ihre Storys heran. Sie rechnete immer mit dem Schlimmsten und misstraute jedem Menschen, der ihr begegnete. Grundsätzlich.
Christines Vater war Inspektor bei der französischen Eliteeinheit Brigades de recherche et d’intervention gewesen. Sie war die Tochter eines Inspektors. Auch wenn sie es am liebsten verheimlicht hätte, aber Mörder waren in ihrer Kindheit allgegenwärtig gewesen. Sie hatte viel mehr von der Arbeit ihres Vaters mitbekommen, als sie vor anderen zugab. Sie verstand, wie das Hirn eines Täters funktionierte, wie die Triebe einen Menschen verändern konnten, bis nur noch ein dunkles Etwas übrig blieb. Nanas Mörder machte mit Sicherheit keine Ausnahme von dieser Regel, die Christine ihr Leben lang mit mathematischer Zuverlässigkeit begleitet hatte. Die Verstümmelungen an Nanas Leiche verrieten den Psychopathen.
Krankheiten, dissoziale Persönlichkeitsstörungen und die unbewusste Weitergabe von Traumata – all das konnte Menschen zu sozialen Raubtieren machen. Christine kannte Dutzende Studien, doch sie lachte nur darüber. Natürlich hatte jeder Täter seine eigene Geschichte, schließlich bekam niemand zum achtzehnten Geburtstag die Persönlichkeit eines Mörders geschenkt. Aber psychologische Erklärungsversuche befreiten niemals von einer Schuld. Ein Mörder war ein Mörder. Der Rest war unbedeutend. Christine war die Tochter ihres Vaters.
Albert mit seiner warmherzigen Art war ihr Gegenpol. Insgeheim liebte sie ihn dafür, selbst wenn sie es niemals aussprechen würde. Er erinnerte sie an ihr jüngeres Selbst, wie sie einmal gewesen war, bevor ihr Vater ermordet wurde. Damals, als sich alles änderte.
Sie verdrängte die Gedanken. Nach all den Jahren taten sie noch immer weh. Christine ließ den Arm aus dem Fenster hängen und spreizte die Finger ihrer Hand, um den Fahrtwind zu fühlen. Sie stellte die Lüftung höher. Es knatterte aus dem Gebläse der Armatur. Die Autos vor ihr fuhren wie in Zeitlupe. Das typische Nachmittagstempo auf Berliner Straßen.
Zwanzig Meter weiter schaltete die Ampel an der Kreuzung auf Rot. Stillstand. Ein Mann mit gewaltigem Bierbauch schlängelte sich auf seinem rostigen Fahrrad an den Autos vorbei und blieb vor Christines Citroën stehen. Er hatte von der Sonne knallrote Schultern bekommen. Seine Rückenbehaarung war imposant. Wie nasse Wolle quoll sie unter seinem gerippten Unterhemd hervor. Auf dem Gepäckträger klemmte ein Bierkasten. Zwischen den Flaschen ragten Karotten, Spaghetti, Rettiche und Kartoffeln hervor. Der Mann drehte sich zu Christine um und betrachtete die Motorhaube ihres Wagens. »Schickes Auto haste, Kleene. Hui, hui, hui …« Er nickte, als wollte er sich seine eigene Meinung bestätigen. »Hat Papi dich mal ans Lenkrad gelassen, wa?«
Christine streckte den Kopf aus dem Seitenfenster. »Und du, hat Mutti dich zum Einkaufen geschickt?«
Er hob seinen Daumen und grinste breit.
Christine musste lachen. »Sag mal, wo parke ich denn hier?«
Er zeigte nach links, wo die Bögen der Brücke endeten und sich eine kleine Grünfläche erstreckte.
»Fahr mal dahinten am Ufer lang, da gibt’s noch Parkplätze vor der Bäckerei.« Er blickte auf ihr Berliner Kennzeichen. »Aber nicht den Touris verraten.« Damit warf er ihr eine Kusshand zu und fuhr mit seinem Rad über die rote Ampel. Kreuzberg im Hochsommer. Alles war so wie immer.
Der Mann im Unterhemd hatte nicht gelogen. Ein paar Minuten später stand der Citroën im Schatten der ausladenden Äste einer Eiche. Albert zeigte auf ein grünes Gründerhaus mit Jugendstilornamenten an der Fassade. »Das da ist es.«
Die großen alten Fenster des Hauses schienen gutmütig auf die Passanten herabzublicken. Ein paar Zweige kratzten im ersten Stock am Glas der Scheiben. Eine grauhaarige Frau im Stockwerk darüber lehnte sich aus dem Fenster und beobachtete Christine und Albert. Auf der anderen Seite der Straße machte ein Mann Fotos von der Umgebung. Um seinen Hals baumelten zwei Fotoapparate.
Je näher sie dem herrschaftlichen Altbau kamen, seinen verzierten Balkonen und dem kleinen Türmchen auf dem Dach, desto mehr wunderte sich Christine. »Ein wirklich sehr schönes Haus. Aber warum habt ihr damals die Kellerwohnung gemietet?«
Albert zuckte mit den Schultern. »Kein Geld. Wir waren Studenten.« Ein dünnes Lächeln lag auf seinen Lippen. Er strich sich über seine kurzen Locken. »Und von meinen Eltern hätte ich es nicht genommen. Die dreihundert Euro konnten wir als Gruppe gerade noch aufbringen.« Er blieb vor einer dunkelbraunen Flügeltür stehen, die ins Kellergeschoss des Hauses führte. »Komisch. Warum ist die Tür nach unten nur angelehnt?« Albert stieß sie auf und schlich die bröckligen Treppen hinab. Er zog sofort den Kopf ein. Auf der Hälfte der Treppe ließ er absichtlich eine Stufe aus. Alte Gewohnheit, da war Christine sich sicher. Sie selbst hatte diesen Vorteil nicht. Sie tastete sich mit ausgestreckten Fingern voran. Die Kellertreppe war aus Ziegeln gemauert, die Risse hatten und an den Ecken abgestoßen waren. Ein falscher Schritt, und sie würde stürzen. Der Geruch von Muff und Moder schlug ihr entgegen. Ein fahler gelblicher Lichtschein fiel auf die Stufen. Jemand musste sich in den Kellerräumen aufhalten. Sie hatte das Untergeschoss noch nicht erreicht, als in dem Gemäuer eine fremde Stimme tönte: »Ach, sieh mal an. Unser Apothekersohn schaut mal wieder vorbei.«
Die Stimme war nicht leicht einem Mann oder einer Frau zuzuordnen, es war ein dünnes Organ ohne jede Brustresonanz und Bass, aber dennoch einen Hauch zu tief für eine Frauenstimme. Christine ließ die letzte Stufe hinter sich.
»Und das da ist deine Freundin oder wie? Soll das ein Antrittsbesuch bei deinen alten Kumpels werden?«
Der Mann im Kellerraum hatte hellrote Haare und einen genauso rötlich schimmernden Vollbart, der ihm etwas Wikingerhaftes verlieh und in völligem Gegensatz zu seiner dünnen Stimme stand. Seine Jeans hing ihm wie ein schlaffer Sack in den Kniebeugen. Hellbraune Sommersprossen verteilten sich in seinem Gesicht und über seine Unterarme, als wären die Flecken mit einem Pinsel auf die Haut gesprenkelt worden. Von seinem verwaschenen schwarzen T-Shirt lächelte Christine der gealterte Charles Bukowski an. Durch den Bauchansatz des Rothaarigen wirkte das Gesicht auf dem Stoff seltsam verzogen.
»Wenn du Nana sehen willst … ist ’n bisschen spät dafür, Albert.« Ein Kopfschütteln folgte. »Sogar viel zu spät.« Er nahm eine Tastatur und ließ sie in eine der braunen Pappkisten fallen, die verstreut auf dem Steinboden herumstanden. Neben einem Tisch befand sich ein in Folie eingewickelter Monitor. Daneben lag umgekippt die Plastiktüte eines Supermarktes, in der Bücher gestapelt waren. Alles sah nach Aufbruch aus.
Der Raum wirkte trotz der freigelegten Mauersteine wie eine Hightech-Zentrale. Überall hingen Kabel herum. Die roten und blauen Strippen wanden sich auf dem Boden und an den Wänden und bildeten Muster, die an das irre Kunstwerk eines Happening-Künstlers aus den siebziger Jahren erinnerten.
Christine zählte sieben Schreibtische, meist aus Glas, doch nur zwei Computer standen darauf. Auf dem Tisch direkt neben dem Eingang lagen vier schwarze Notizbücher, ein Lippenstift, ein Buch über Zahlentheorien und zwei verwelkte Rosen. Vielleicht war dies ja Nanas Platz gewesen. Von der Decke strahlten gedimmte Halogenstrahler auf die Schreibtische und tauchten sie in ein gelbliches Licht – ganz so, als wären ihre Besitzer nur für eine kurze Pause nach oben gegangen. An der Wand hing ein Plakat mit einer Weltkugel. DROP DEAD – fall tot um – stand in schrägen, blutroten Buchstaben darunter. Handgemalt. Genau wie die schiefen Zahlen am rechten Rand des Posters: 52.54204724 und 13.40436391.
Die Zahlenreihen sagten Christine nichts. Ein numerischer Brei. Daneben hing ein Foto mit einer geballten Faust, die einen Trommelrevolver hielt. Die Zahlen 0 und 1 waren mit schwarzem Edding auf das Bild gekritzelt worden. Das sollte sicher eine Anspielung auf das binäre Zahlensystem der Programmierer sein.
Weiter rechts hing ein riesiges Wandboard mit privaten Fotos, Skizzen von Schaltplänen und Artikeln über die Pharmaforschung.
»Ich bin wegen Nana hier.« Albert ging einen Schritt auf den Rothaarigen zu. Er klang sehr ernst. »Verstehst du, Guido? Ich will wissen, was passiert ist.«
Sein scharfer Tonfall erstaunte Christine. Offenbar waren Albert und Guido schon früher aneinandergeraten.
»Na so was. Ich glaube nicht, dass Nana heute noch kommt.« Guido ging zu einem Tisch hinüber und riss den Drehstuhl dahinter so gewaltsam hervor, dass er gegen die Wand knallte. Feiner Staub rieselte aus dem Mauerwerk. »Aber du kannst ja gerne hier auf sie warten. Könnte allerdings noch ein Weilchen dauern.« Er lachte laut und hoch. Für Christine klang es nur nach Verzweiflung.
Albert senkte den Kopf. Seine Schultern sackten nach unten. Christine kannte diesen Ausdruck. Er suchte nach der richtigen Antwort. In seinem Innersten mochte er die Zeit verfluchen, die er so gerne angehalten hätte, um die Sätze gegeneinander abzuwägen und ihre Wirkung zu überprüfen, bevor er seinen Mund öffnete. So war Albert eben.
Guido ging einen Schritt auf ihn zu. Nur anderthalb Meter trennten die beiden. »Verdammt, Albert. Mit dir hat es angefangen. Du warst der Erste, der die Gruppe verlassen hat.« Guido knabberte an seinem Daumen. An jeder Fingerspitze klebte ein Pflaster – vielleicht ein Zeichen für Unsicherheit, Ängste oder unterdrückte Aggressionen. Eine Zwangsstörung jedenfalls.
»Hättest du die Gruppe nicht verlassen, wären wir alle noch zusammen. Nach dir sind Christian und Tarek gegangen, dann Birgit und Timon.« Guido kniff die Lippen zusammen. »Und dann war ich mit Nana allein. Nur noch wir beide, weil wir immer noch was bewegen wollten. Kapierst du?«
Albert richtete sich auf. Er drückte den Rücken durch und stemmte die Hände in die Hüften. »Was willst du mir eigentlich sagen? Dass Nana noch leben würde, wenn ich nicht gegangen wäre? Das glaubst du doch nicht wirklich.«
Guido strich über die rötlichen Härchen auf seinem Unterarm und fixierte eine angeschlagene Stelle im Gemäuer. »Nana war genial, aber du hast uns zusammengehalten. Wir waren eine starke Gruppe. Vor uns haben Konzerne gezittert. Niemand hätte was gegen uns ausrichten können.« Er ballte die Faust. »Du warst der Erste, Albert. Du hast dich einfach verpisst. Und wofür? Für irgendeine Journalistin da draußen, die dich nur ausgenutzt hat. Ich habe die Geschichten gehört.«
Christine nahm den Seitenblick aus Alberts Augenwinkeln wahr. Er wollte protestieren und sich auf ihre Seite stellen. So kannte sie ihn. Aber sie brauchte seine Unterstützung nicht. Mehr noch, sie wollte sie nicht. Sie hatte genug von dem gockelhaften Theater im Keller und ging zwei Schritte auf Guido zu. Er war anderthalb Köpfe größer als sie, und doch fuhr er zusammen, als sie seine persönliche Distanzzone von einem Meter durchbrach. Sein Verteidigungsimpuls war aktiviert. Wie automatisch wich er einen Schritt zurück.
»Ich bin Christine Lenève.«
Er musterte sie. Ihr Name schien in seinem Kopf einen Denkprozess auszulösen. Sofort steckte er sich einen Daumen in den Mund und kaute darauf herum. Er wusste, wer sie war. Christine war sich sicher.
»Ja, genau.« Sie legte ein Lächeln auf. »Ich bin die Journalistin, wegen der Albert gegangen ist. Ich bin verantwortlich dafür, dass eure Gruppe auseinandergefallen ist, und bestimmt bin ich auch an Nanas Tod schuld.«
Guidos Augenlider flatterten. Sein rechtes Ohr zuckte. Christine hob die Schultern. »Ja, ganz genau. Von mir aus bin ich an allem schuld. Eine billige Lösung, aber bitte sehr.« Sie drehte die Innenflächen ihrer Hände nach oben. »Es gibt doch nichts Besseres als klare Schuldzuweisungen, nicht wahr?«
»Christine …« Albert verstand offenbar nicht, was sie bewirken wollte. Dabei war es ganz simpel. Sie hob eine Hand, eine deutliche Aufforderung zu schweigen.
Auch Guidos Redefluss war versiegt. Sein Mund stand halb offen. Reglos lag seine Zungenspitze auf den unteren Schneidezähnen. Weiter hinten im Raum brummte ein Lüfter. Vor der Tür der Kellerwohnung gab ein Motorradfahrer im Stand immer wieder Gas. Guido steckte einen weiteren Finger in den Mund und kaute darauf herum. In der Ferne kreischte ein Kind.
»Ist hier Rauchen erlaubt?« Christine zog ihre frische Packung Gauloises aus der Gesäßtasche ihrer Jeans. Guidos Mund war noch immer halb geöffnet. Er nickte viel zu schnell. Sein Körper schüttete Hormone aus. Perfekt. So wollte sie ihn haben. Die Mauer, hinter der er sich verschanzte, war eingerissen.





























