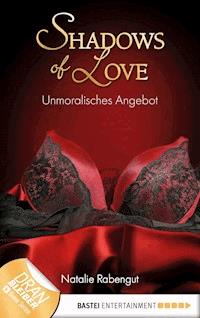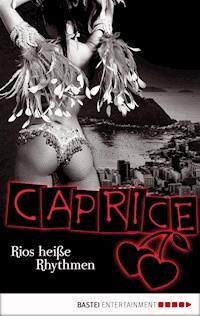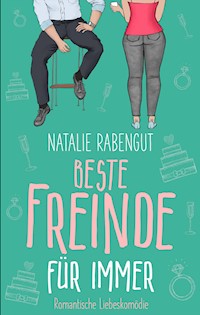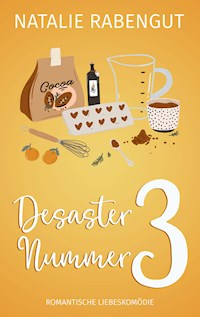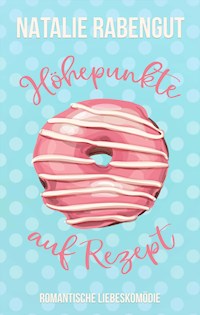Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Black Umbrella Publishing
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Hippert-Schwestern
- Sprache: Deutsch
Ich bin langweilig. Sterbenslangweilig. So langweilig, dass mein Name Langweilig McLangeweile ist. Okay, das ist nicht mein Name. Aber er könnte es sein. Ich muss mich immer an Regeln halten, kann fünf nicht gerade sein lassen und Spaß im Leben habe ich auch nicht. Das wird mir schmerzlich bewusst, als wir mit der ganzen Familie Fotoalben auf der Suche nach einem netten Foto von Oma für ihre Beerdigung durchschauen. Mehr als sechzig Jahre Fotos, nicht ein Lächeln. Nicht ein einziges. Bevor ich so ende, beschließe ich, mein Leben umzukrempeln. Ein Jahr lang werde ich jeden Fehler machen, den man machen kann. Ich werde neue Leute kennenlernen, lockerer werden und mich notfalls auch mal blamieren. Und ich werde etwas Illegales tun. Etwas leicht Illegales. Minimal illegal. Das Problem ist nur, dass jemand wie ich, die nicht einmal nachts an einer verlassenen Straße bei Rot über die Ampel gehen kann, gar nicht weiß, wie so etwas geht. Ein schlechter Einfluss muss her, und zwar schnell! Romantische Liebeskomödie. In sich abgeschlossen. Gefühlvolle Handlung. Ein Schuss Humor. Explizite Szenen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 210
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
DAS JA-JAHR
DIE HIPPERT-SCHWESTERN
BUCH 1
NATALIE RABENGUT
ROMANTISCHE LIEBESKOMÖDIE
Copyright: Natalie Rabengut, 2023, Deutschland.
Korrektorat: http://www.swkorrekturen.eu
Covergestaltung: Natalie Rabengut
ISBN: 978-3-910412-22-4
Alle Rechte vorbehalten. Ein Nachdruck oder eine andere Verwertung ist nachdrücklich nur mit schriftlicher Genehmigung der Autorin gestattet.
Sämtliche Personen in diesem Text sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind zufällig.
www.blackumbrellapublishing.com
INHALT
Das Ja-Jahr
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Nächster Band der Reihe: Die Nein-Nummer
Über Natalie Rabengut
DAS JA-JAHR
Ich bin langweilig. Sterbenslangweilig. So langweilig, dass mein Name Langweilig McLangeweile ist.
Okay, das ist nicht mein Name. Aber er könnte es sein.
Ich muss mich immer an Regeln halten, kann fünf nicht gerade sein lassen und Spaß im Leben habe ich auch nicht. Das wird mir schmerzlich bewusst, als wir mit der ganzen Familie Fotoalben auf der Suche nach einem netten Foto von Oma für ihre Beerdigung durchschauen. Mehr als sechzig Jahre Fotos, nicht ein Lächeln. Nicht ein einziges.
Bevor ich so ende, beschließe ich, mein Leben umzukrempeln. Ein Jahr lang werde ich jeden Fehler machen, den man machen kann. Ich werde neue Leute kennenlernen, lockerer werden und mich notfalls auch mal blamieren.
Und ich werde etwas Illegales tun. Etwas leicht Illegales. Minimal illegal.
Das Problem ist nur, dass jemand wie ich, die nicht einmal nachts an einer verlassenen Straße bei Rot über die Ampel gehen kann, gar nicht weiß, wie so etwas geht.
Ein schlechter Einfluss muss her, und zwar schnell!
Romantische Liebeskomödie. In sich abgeschlossen. Gefühlvolle Handlung. Ein Schuss Humor. Explizite Szenen.
1
MARIE
»Ich habe eins, ich habe eins!« Sarah klang ernsthaft erleichtert und wedelte mit einem der Fotos.
Wir atmeten praktisch kollektiv aus.
»Wirklich?« Mama runzelte die Stirn und schob die Lesebrille auf ihrer Nase nach oben.
Es juckte mir nicht nur in den Fingern, ihr die Brille abzunehmen und sie anständig zu reinigen, nein. Ich wollte Mama am liebsten in den Laden schleifen und sie endlich zu einem Sehtest zwingen. In mir zog sich alles zusammen, sobald ich mitbekam, wie sie und Antje, ihre beste Freundin, untereinander Lesebrillen tauschten, als wären es Blusen. Nie im Leben hatten die beiden die gleiche Sehstärke.
Um nichts zu sagen, biss ich mir auf die Zungenspitze, und um mir nicht doch die Brille zu schnappen, setzte ich mich lieber auf meine Hände. Es war ohnehin aussichtslos, weiter die Fotos durchzusehen. Wir wussten alle, dass wir kein einziges anständiges Foto von Oma hatten.
»Ja.« Sarah nickte, bevor sie die Augen zusammenkniff und sich vorbeugte. »Mist. Es war doch nur eine Fluse.«
»Kein Lächeln?«, fragte Norbert, Antjes Mann, vorsichtig nach.
»Als ob«, brummte mein Vater. »Meine Mutter hat nie gelächelt. Kann sich hier irgendjemand an ein Lächeln erinnern?«
Um den langen Esstisch herum, der, solange ich denken konnte, den gleichen sechs Leuten Platz geboten hatte, wurden die Köpfe geschüttelt. Ich hatte die Jahre 1958 bis 1966 durchgesehen, Papas Geburt und Jugend. Nichts, nicht ein einziges Lächeln. Sarah hatte sich 2007 bis jetzt vorgeknöpft, Mama, Papa, Antje und Norbert alles dazwischen. Hunderte Fotos, von der gesamten Familie zusammengetragen und auf keinem einzigen hatte Sybille Seger auch nur ansatzweise ihre Mundwinkel gehoben.
»Das hier vielleicht, Kurt?« Antje hielt ihm ein Foto hin – die rötliche Sepia-Färbung und die Dauerwellen ließen mich vermuten, dass es aus den Achtzigern stammte.
Papa nahm das Bild entgegen und seufzte. »Ingos Polterabend.«
Mama schob Antjes Lesebrille erneut hoch und brachte mich dazu, nach meiner eigenen Brille zu tasten. Mein Nasenrücken begann immer zu jucken, wenn ich schlecht sitzende Brillen sah.
»Na«, sagte Mama, »als Lächeln geht das aber nicht durch.«
Sarah stützte ihr Gesicht in die Hände und atmete so laut aus, dass es eher wie ein feuchtes Furzen klang, weil sie ihre Wangen viel zu fest zusammenpresste. »Warum versuchen wir überhaupt, die Realität zu beschönigen? Ich meine, wir haben fast siebzig Jahre Fotos durchgesehen und nichts gefunden, weil Oma halt nie gelächelt hat. Entweder wir müssen ein halbwegs annehmbares Foto nachbearbeiten, oder wir arrangieren uns damit, dass Oma dauerhaft angepisst geguckt hat.«
»Sarah«, ermahnte ich meine ältere Schwester. »Man soll nicht schlecht über Tote sprechen.«
Mein Vater lachte auf. »Du meine Güte, Marie, nimm doch nicht immer alles so ernst. Sarah spricht nicht schlecht über meine Mutter – es ist die Wahrheit. Sybille Karlotta Seger hatte Zeit ihres Lebens einen Stock im Arsch und war nie glücklich. Ich frage mich schon seit meiner Kindheit, wie Papa es mit ihr ausgehalten hat.«
Prompt verstummten wir alle und hingen den Erinnerungen an Opa nach. Er war bereits vor mehr als zehn Jahren gestorben und wir vermissten ihn und seine gute Laune schmerzlich. Er war das absolute Gegenteil von Oma gewesen. Papa sagte die Wahrheit, wir hatten uns immer alle gefragt, was die beiden jemals aneinander gefunden hatten.
Opa war stets zu Scherzen aufgelegt gewesen, hatte selten die Ruhe verloren und nichts hatte ihn so glücklich gemacht wie ein frischer, klarer Schnaps.
Oma hatte nie auch nur einen einzigen Tropfen Alkohol angerührt, ihre Mundwinkel waren mit jedem Lebensjahr mehr der Erdanziehungskraft erlegen, und bis heute wusste ich nicht, was sie eigentlich gemocht hatte. Selbst Kuchen hatte sie immer gegessen, als wäre es die reinste Zumutung.
Ich war die Letzte, die dachte, dass man Alkohol und Drogen brauchte, um eine gute Zeit zu haben, aber selbst ich hatte mich mehr als einmal bei dem Gedanken ertappt, dass ein Sekt so dann und wann Oma wahrscheinlich nicht geschadet hätte. Vor allem wenn ich bedachte, dass sie jeden Abend vor dem Schlafengehen ihre Füße mit Klosterfrau Melissengeist eingerieben hatte. Ob das auf Dauer, so sechzig Jahre lang, wirklich gut war?
»Sollen wir es einfach noch ein bisschen versuchen?«, schlug Antje tapfer vor und nahm den nächsten Bilderstapel in die Hand.
Mama nickte langsam. »Ist wahrscheinlich besser. Ich bin kein Fan von dem hier und irgendeins wollen wir ja aufstellen, richtig?«
»Richtig.« Sarah beugte sich zur Seite und kramte offensichtlich in ihrer Bilderkiste. Sie hatte mehrere Papierumschläge in der Hand, als sie sich wieder aufrichtete und mich anschaute. »Du solltest dir das übrigens zu Herzen nehmen, Lieblingsschwester.«
Ich sparte mir den Hinweis, dass sie keine weitere Schwester hatte, wodurch die Vorsilbe irgendwie überflüssig wurde, aber dann würde Papa mich wieder eine Klugscheißerin nennen und die Diskussion hatten wir inzwischen nun wirklich oft genug geführt.
»Was genau sollte ich mir zu Herzen nehmen?« Ich runzelte die Stirn, weil plötzlich alle ganz furchtbar mit ihren Fotostapeln beschäftigt waren und krampfhaft Blickkontakt mit mir vermieden.
»Äh … nichts, nichts. Das war nur so dahergesagt«, versuchte Sarah abzuwiegeln.
»Einfach so dahergesagt? Bist du dir sicher?«
Meine ältere Schwester seufzte. »Hör zu, du bist zwar nicht wie Oma, aber …«
»Viel fehlt nicht«, ergänzte mein Vater.
»Wie bitte?« Ich sah zwischen den beiden hin und her.
»Sie meinen es nicht so, Liebling.« Meine Mutter tätschelte aufmunternd meinen Rücken. »Es ist nur … ähm …«
Sarah hob ihr Handy vom Tisch und hielt es mir unter die Nase. »Weihnachten – guck auf deinen Gesichtsausdruck. Silvester. Antjes Geburtstag. Grillen im Sommer. Beim Erdbeerpflücken. Dein Geburtstag.«
Ich blinzelte langsam. »Ich bin halt nicht vorteilhaft getroffen.«
Um ehrlich zu sein, fühlte ich mich ein klein wenig in die Ecke getrieben. Statt mich weiter zu rechtfertigen, nahm ich meine Brille ab und begann, sie zu putzen. Das machte ich immer, wenn ich gestresst war, weshalb ich aufgehört hatte, mit meiner Familie zu pokern. Es machte einfach keinen Spaß, wenn sie alle sofort die Einsätze erhöhten, sobald ich meine Brille bloß berührte.
»So kann man es auch nennen.« Sarah schnaubte. »Abgesehen davon, dass es beinahe unmöglich ist, dich überhaupt mit aufs Bild zu bekommen, es sei denn, wir drohen dir Gewalt an, habe ich schon Bilder von Geiseln in Gefangenschaft gesehen, die mehr gelächelt haben als du.«
»Sarah! Darüber macht man keine Witze!«, sagte ich empört und sah mich nach Unterstützung um.
Norbert trank eilig einen Schluck Bier, mein Vater musste dringend seine Socken hochziehen, Antje und meine Mutter fanden die Fotos interessanter.
»Das stimmt gar nicht.« Ich verschränkte die Arme.
Sarah hob das Handy und machte ein Foto von mir. »Ach nein? Hier. Der exakt selbe Gesichtsausdruck.«
Sie zeigte mir das soeben geschossene Foto, und ich konnte wirklich nicht leugnen, dass ein Funken Wahrheit in ihren Worten lag. Mein jetziges Schmollen war nicht von dem Gesichtsausdruck zu unterscheiden, den ich auf dem Bild von meinem Geburtstag aufgelegt hatte. Wir saßen alle auf der sonnigen Terrasse, ich hatte einen riesigen Kuchen vor mir stehen, den angeblich Antje gebacken hatte, aber ich wusste schon seit Jahren, dass es Norbert war, der heimlich diese spektakulären Tortendekorationen kreierte.
Nicht, dass man meiner Miene angesehen hätte, dass ich sie spektakulär fand. Ich wirkte … als wäre ich überall lieber als dort.
Da saß ich zwischen Geschenken, Torte und den Menschen, die ich liebte, doch nichts davon war meinem Gesicht anzusehen.
Ich verspürte ein beklommenes Gefühl in der Magengegend und beugte mich über den Karton 1958-1966 und holte einen der Stapel raus, die ich bereits durchgeschaut hatte.
Da war es. November 1963, Sybilles Geburtstag, stand da in Opas ruppiger Handschrift auf der Rückseite.
Das Blut rauschte in meinen Ohren, während ich das Foto anstarrte. Oma saß am Tisch hinter ihrer Torte, viel jünger, aber genauso verdrossen guckend, wie ich sie kennengelernt hatte.
Da ich ziemlich nach Papa kam, war auch eine gewisse Ähnlichkeit zu Oma durchaus zu erkennen. Trotz der beinahe sechzig Jahre, die zwischen den beiden Fotos der Geburtstagspartys lagen, waren die Gemeinsamkeiten der vermeintlich angepissten Frauen frappierend.
»Ich sag es ja immer wieder.« Antje zuckte mit den Achseln. »So viele Frauen wollen nicht auf Fotos sein, zu dick, zu alt, nicht geschminkt, Haare nicht gemacht – und nachher sitzt die Familie da und hat keine Erinnerungen zum Angucken.«
Ein schwerer Stein schien in meinem Magen zu liegen. Ich bekam kaum mit, was Mama antwortete, denn der Stein wurde immer schwerer und kälter.
Ich legte die Hand auf meinen Bauch. War ich wie Oma?
Oma hatte sich offenbar nicht gern fotografieren lassen – ich ließ mich nicht gern fotografieren.
Sie hatte Opa immer angemeckert – wirklich glücklich war ich in meiner Beziehung mit Elias auch nicht.
Oma hatte an der VHS Handarbeiten unterrichtet und es gehasst – ich mochte meinen Job zwar, aber da war dieser eine Kollege, der mich absolut in den Wahnsinn trieb, doch ich sagte nichts.
Stattdessen war ich lieber die ganze Zeit unzufrieden und beklagte mich bei meinen Kolleginnen über ihn – so wie Oma sich bei uns beklagt hatte.
Grundgütiger. Ich war Oma. Also ich war nicht meine eigene Oma, aber ich war wie sie.
Das Blut rauschte lauter in meinen Ohren, und irgendwie fiel es mir von Sekunde zu Sekunde schwerer, richtig Luft zu holen. Meine Brust fühlte sich eng an. Sehr, sehr eng.
Punkte flirrten vor meinen Augen, und ich fragte mich, ob die anderen wohl auch so schlecht Luft bekamen. Ob wir mal lüften mussten?
Völlig verzerrt hörte ich die Stimme meiner Mutter, die wie durch Watte an mein Ohr drang.
»Alles ist gut, Marie, alles ist gut«, sagte sie und rieb mit festem Druck über meinen Arm.
Ich sog gierig Luft ein, doch es schien immer noch zu wenig zu sein.
»Alles ist gut.« Antje strich über mein Haar.
Ich rückte meine Brille zurecht. Moment mal. Warum lag ich denn auf dem Rücken und schaute in fünf besorgte Gesichter?
»Da ist sie ja wieder«, sagte mein Vater und berührte mein Knie. »Geht’s, Marie?«
»Was … was … was?« Ich brachte den Satz gar nicht ins Ziel. Stattdessen bemerkte ich, dass mein Rücken verdächtig nass geschwitzt war.
»Du hattest eine Panikattacke.« Sarah half mir, mich aufzusetzen, und drückte mir ein Glas in die Hand. »Hier, trink einen Schluck.«
Obwohl ich meine Familie nun seit neunundzwanzig Jahren kannte, ging ich in meiner Naivität davon aus, dass sie mir in einer solchen Situation Wasser geben würden. Fehlanzeige.
Es war Weißwein, womit ich natürlich nicht rechnete und mich prompt verschluckte. Das Glas leerte ich danach trotzdem.
»Möchtest du darüber reden, Schatz?« Mama rieb immer noch über meinen Oberarm und alle sahen mich interessiert an. Reden war ein ganz großes Thema bei uns und vermutlich der Hauptgrund, dass ich mich innerlich zusammenkrümmte, sobald mir jemand exakt diese Frage stellte.
Ich räusperte mich. »Ich … ähm … ich glaube, ich sollte versuchen, mehr auf Fotos zu lächeln.«
Antje nickte verständnisvoll. »Das ist eine sehr gute Idee.«
Auch Norbert versuchte sich an einem verständnisvollen Lächeln, doch es wirkte ein wenig gruselig, weil er eher der ruhige, rationale Typ war und nicht so sonnig-fröhlich wie Antje.
»Mehr lächeln«, presste er hervor und schaffte es, die simplen Worte ein bisschen wie eine Drohung klingen zu lassen.
»Danke, es geht schon wieder.« Ich reichte Sarah das Glas an.
In weniger als fünf Sekunden gab sie es mir zurück – bis zum Rand mit Weißwein gefüllt. Eigentlich wollte ich nichts mehr trinken, aber der Boden bebte sowieso schon unter mir, was für einen Unterschied machte es also?
Ich leerte das Glas in einem Zug, ignorierte Papas stolzen Blick dabei. Ich leckte mir über die Unterlippe und seufzte. »Wahrscheinlich sollte ich ein bisschen mein Leben … ich weiß auch nicht … umkrempeln?«
»Noch eine sehr gute Idee.« Mama hörte gar nicht mehr auf, meinen Arm zu reiben, während sie mich über den Rand von Antjes Lesebrille anschaute. »Wir sind für dich da. Wenn du unsere Hilfe brauchst, musst du nur fragen.«
»Genau.« Norbert nickte noch eifriger, offensichtlich sehr überfordert mit meinem irgendwie emotionalen Ausbruch, denn das war eigentlich nicht meine Art.
Sarah war für alles Dramatische, Theatralische und sämtliche Übertreibungen zuständig.
Ich war … die Spießerin. Die Langweilerin, die Klugscheißerin und in dieser Runde hier definitiv das schwarze Schaf.
Ein neues Weinglas tauchte vor meiner Nase auf und ich griff dankbar danach. Ich trank nicht zu viel, dachte ich mir, ich versuchte gerade bloß aktiv, eben nicht wie Oma zu sein.
Genau. Genau, das war es.
Das und keineswegs die Angst, wie meine Oma zu enden. Nein, nein. Alles war in Ordnung.
Wie oft musste ich mir das wohl selbst sagen, bis ich es auch glaubte?
2
MARIE
Ich schaltete das Licht in den Schaufenstern an und wischte dann über den Verkaufstresen und die Kasse. Als ich einen Schritt zurücktrat, war ich mit meiner Arbeit zufrieden.
Harald kam aus unserem Lagerraum/Büro/Kassenzimmer und hob die Hand. »Tschö mit Ö«, sagte er und ging geradewegs auf den Ausgang zu.
»Oh, bist du schon fertig mit der Neuware? Ich dachte, du würdest heute zuschließen. Harald? Harald?«
Die Tür fiel hinter ihm ins Schloss, und mit einem Seufzen nahm ich meine Brille ab, nur um sie gleich darauf mit meinem neuesten Putztuch viel zu hektisch zu polieren. Jedes Mal, wenn ich mit Harald für die Spätschicht eingeteilt war, folgte das gleiche Trauerspiel.
Ich wollte auch gar nicht nach hinten gehen, weil ich mir sicher war, dass er die letzte Dreiviertelstunde, die er im Büro verbracht hatte, keineswegs die Neuwaren ausgepackt, gescannt und für den Verkauf vorbereitet hatte. Nein, er hatte sicher wieder mit seinem Handy gespielt und mir die Arbeit liegen lassen, während ich brav und ordentlich meine Aufgaben erledigt hatte.
Es war nichts Neues und ändern konnte ich es auch nicht. Harald wusste, dass er ein Arschloch war, alle meine Kolleginnen wussten es und mein Boss Robin wusste es erst recht. Harald kümmerte sich nicht um die Hierarchien. Er trampelte auf uns allen herum.
Obwohl ich eine klare Vorstellung von dem hatte, was mich erwartete, schwappte trotzdem neue Wut in mir hoch, als ich die Tür zum Büro öffnete. Die sieben Schütten standen unverändert und noch verplombt im Raum, er hatte sie nicht einmal anstandshalber von dem Rollbrett gehoben.
In mir regte sich Trotz, und ich spielte mit dem Gedanken, die Schütten schlicht stehen zu lassen. Robin hatte Harald klipp und klar gesagt, dass er für die Neuware verantwortlich war. Allerdings hatte Robin morgen frei und Jana war für die Frühschicht eingeteilt. Ihr konnte ich das nicht antun. Sie war sowieso schon immer gestresst, wenn sie den Laden öffnen musste, und wenn dann noch die sieben Schütten hier standen …
Ich hätte heulen können, weil alles an mir hängen blieb. Harald war nicht der Einzige, der heute Abend Pläne hatte. Es war so ungerecht. Regelrecht zum Schreien.
»Und wessen Schuld ist das?«, fragte die Stimme in meinem Hinterkopf.
Na, es war ganz sicher nicht meine. Wenn jemand Schuld hatte, dann der Meister der schlechten Wortspiele. Tschö mit ö. Ciao for now. Auf Wieder-tschüss. Aus die Maus. Bis Baldrian. Bis denn, Sven. Mach’s gut, Knut. Mach’s gut – ich mach’s besser. Schönes Knochenende. Sayonara carbonara. Tschau bella frikadella.
Und einer meiner absoluten Favoriten: Bis später, Attentäter.
Die Stimme in meinem Hinterkopf räusperte sich. Mehrfach. Und sehr laut.
Ich beschloss, dass ich für so etwas gerade keine Zeit hatte. Ich musste Schütten ausräumen und Neuware wegsortieren.
Wie sollte ich da noch darüber nachdenken, dass ich mir eigentlich fest vorgenommen hatte, Harald endlich die Meinung zu sagen?
Und überhaupt hatte ich mir doch vorgenommen, mein Leben zu ändern. Aber … so von heute auf morgen, das war ja auch nichts.
»Wie lang ist Omas Beerdigung noch gleich her? Ach ja, drei Monate«, ließ mich die Stimme wissen. Ich hätte mir am liebsten die Ohren zugehalten, doch das wäre nutzlos gewesen, denn die Stimme kam eindeutig aus meinem Kopf.
Ich hatte mir fest vorgenommen, ein paar Dinge in meinem Leben zu ändern, aber es war eben … so viel zu tun.
Ich zog mir den Rollhocker ran, setzte mich darauf und drehte mich um, bis ich den großen Wandkalender sehen konnte. Mein Urlaub, meine freien Wochenenden, alles war hier eingetragen. Leider auch mein Geburtstag, mit pinkfarbenem Textmarker hervorgehoben. Wir alle hatten unsere eigenen Farben. Harald war blau, Robin grün, Barbara gelb, Jana orange und ich hatte eben pink.
Mir blieben noch etwas über sechs Monate, bis ich dreißig wurde. War das nicht ein einschneidendes Erlebnis? Einschneidend genug, um ein paar Veränderungen zu rechtfertigen?
Je länger ich den Kalender ansah, desto unwohler fühlte ich mich. Ich sollte meinen Geburtstag nicht so emotional aufladen. Es war doch alles gut, so wie es war.
Ich drehte mich auf dem Rollhocker um und sah die Schütten mit der Neuware. Okay. Vielleicht war nicht unbedingt alles gut, aber der Großteil meines Lebens war … in Ordnung. Und »in Ordnung« war gut genug. So.
Was sprach denn auch gegen Mittelmäßigkeit? Ich mochte es ruhig, sicher und berechenbar. Mir war es ja schon zu aufregend, wenn Sarah kochte und mir vorher nicht sagte, was es gab. Ich war eben kein abenteuerlicher Typ. Oder experimentierfreudig. Oder mutig.
Mein Handy piepte, und weil außer mir ohnehin niemand mehr im Laden war, holte ich es aus dem Spind.
Elias ließ mich wissen, dass er im Stau stand und dass ich ihm sein Abendessen gern warm halten konnte.
Ich runzelte die Stirn, denn er hatte doch gesagt, dass ich heute zu ihm kommen sollte. Weil ich verwirrt war, schrieb ich ihm auch genau das zurück.
»Ich weiß«, antwortete er. »Aber ich dachte, du machst vielleicht Spaghetti Bolognese für mich.«
Ich war drauf und dran, ihm zurückzuschreiben, dass er mal schön für sich selbst kochen konnte. So schwer war es nun auch nicht, ein bisschen Hack anzubraten und Nudeln in kochendes Wasser zu geben. Manchmal fühlte ich mich wirklich wie eine unbezahlte Haushälterin.
Die Stimme in meinem Hinterkopf wurde langsam sehr aufdringlich und räusperte sich schon wieder.
Ich öffnete die Kamera an meinem Handy und wechselte zur Frontansicht. Prompt verstärkte sich das ungute Gefühl, denn meine Mundwinkel wirkten recht … unmotiviert.
Obwohl es mir zutiefst widerstrebte, glitt mein Daumen zum Auslöser und ich machte ein Foto von mir. Mein Herz klopfte schneller. Ich hatte so viele Bilder von Oma für die Beerdigung durchgeschaut und ahnte, wie meine Zukunft aussah, sollte ich nicht bald etwas ändern.
Ich war nicht einmal dreißig und fühlte mich, als wäre ich bereits am Ende meines Lebens angekommen. Ich steckte in einer riesigen Sackgasse fest.
Eine ganze Weile starrte ich mein eigenes Foto an, ehe ich zum Kalender sah. Sechs Monate. An meinem Geburtstag würde ich ein weiteres Selfie machen und nachmessen, ob meine Mundwinkel höher saßen oder nicht. Bis dahin musste ich ein paar Sachen verändern. Ich konnte nicht dreißig werden, aber schon unzufrieden sein, als wäre ich über achtzig und von zwei kaputten Hüften geplagt.
Ich ließ Elias wissen, dass ich frühestens in einer Stunde bei ihm sein würde, und öffnete die erste Schütte.
Sonnenbrillen. Das war easy.
Ich bewegte die Maus, klickte die Inventarliste an und hielt inne. Eine Liste. Das war eine exzellente Idee. Ich sollte mir eine Liste mit den Dingen machen, die ich ändern wollte.
Oh, und eine Liste, auf der ich festhielt, wann Harald seinen Aufgaben nicht nachkam. Ein Protokoll. In ein paar Wochen würde ich das Robin vorlegen, damit er endlich ein ernstes Wort mit Harald redete. Wobei unser Boss eigentlich ständig mit Harald redete, weil er nie seinen Job machte.
Ich öffnete ein neues Dokument auf dem Computer und betitelte es mit »Haralds Mängelliste«, bevor ich es umbenannte in »Das große Protokoll der Inkompetenz«. Ja, das war gut.
Ich trug das heutige Datum und die Uhrzeit ein, was Harald versäumt hatte, und machte mich an die Arbeit.
Eigentlich war es nicht einmal eine große Sache, die Neuware zu sortieren. Ich brauchte bloß vierzig Minuten, bevor ich den Müll der Umverpackungen entsorgte und in meiner Liste festhielt, wie viel Zeit es mich gekostet hatte, Haralds Job an seiner Stelle zu erledigen.
Meine private Liste würde ich lieber zu Hause schreiben, ehe ich sie noch versehentlich an die Firmenleitung mailte, wie es Robin mal mit der Einladung zu seiner Karaoke-Party passiert war.
Ich schaltete überall das Licht aus, vergewisserte mich, dass es in den Schaufenstern an war, schloss den Laden ab und deponierte den Schlüssel in der Box, ehe ich den Code änderte. Auf dem Weg zum Parkplatz schrieb ich Jana eine Nachricht mit dem neuen Code und ließ sie wissen, dass ich abgeschlossen hatte. Dann konnte sie heute Nacht wenigstens ruhig schlafen, weil sie kein von Harald verursachtes Chaos zu befürchten hatte.
»Ich würde ja sagen, dass ich überrascht bin, aber ich bin es nicht. Du bist ein Schatz! Tausend Dank! Die nächste Eiswaffel geht auf mich«, antwortete sie und prompt fühlte ich mich bezüglich meiner unerwünschten Überstunden etwas besser. Es war nett, anderen das Leben leichter machen zu können.
Allerdings hätte ich mich noch mehr gefreut, wenn mein eigenes Leben auch leichter gewesen wäre. Als ich bei Elias ankam, war sein reservierter Parkplatz leer, er war also bisher nicht zu Hause.
Insgesamt musste ich drei Runden um den Block drehen – die reinste Freude bei den unzähligen Einbahnstraßen –, bis ich sah, wie ein Kombi ausparkte. Ich hechtete in die frei gewordene Lücke, nur um festzustellen, dass ich kaum weiter von Elias’ Wohnung entfernt hätte parken können.
Ich kramte seinen Schlüssel aus meiner Tasche, schloss die Tür auf und schaltete das Licht an. Sofort stieg mir der muffige Geruch in die Nase. Ich folgte ihm in die Küche und fand den Übeltäter im Mülleimer. Ein riesiger Ball … Schimmel. Vielleicht eine überdimensionierte Orange?
Ich riss das Fenster auf, holte den Sack aus dem Mülleimer und brachte ihn in den Hof, wo ich ihn zu allem Überfluss in die vollen Tonnen quetschen musste. Die Müllabfuhr war hier extrem pingelig, und wenn der Deckel der Tonne auch nur einen halben Millimeter offen stand, wurde sie nicht geleert. Das Thema war seit Jahren ein Evergreen in der Lokalpresse.
Als ich wieder in Elias’ Wohnung war, wusch ich mir die Hände und sehnte mich dabei eher nach einer Dusche mit Desinfektionsmittel. Der muffige Geruch hing ziemlich penetrant in der Luft. Das musste ihm doch aufgefallen sein.
Ich war das letzte Mal am Sonntag hier gewesen – reichten vier Tage, um einen ausgewachsenen Schimmelball zu züchten? Ich erschauerte.
Gut, nächster Punkt auf der Tagesordnung: Spaghetti Bolognese.
Ich holte einen Topf und eine Pfanne raus, öffnete den Kühlschrank und suchte nach dem Hackfleisch. Zweimal schaute ich alle Fächer durch. Nichts.
Gut, vielleicht war es eingefroren und im Gefrierschrank. Auch hier durchsuchte ich sämtliche Schubladen mehrfach. Kein Hack.
Ich hatte bereits einen Verdacht, wollte aber nicht vorschnell urteilen. Ich war es ihm zumindest schuldig, in die Schränke zu schauen.
Zwar fand ich eine Packung Spätzle, doch sonst keinerlei Nudeln, schon gar keine Spaghetti. Er hatte nicht einmal Tomatenmark im Haus.
Elias war nicht nur davon ausgegangen, dass ich Spaghetti Bolognese für ihn kochte, offenbar hätte ich auch noch auf telepathischem Wege herausfinden müssen, dass er keine Zutaten hier hatte – womit das Einkaufen ebenfalls mir zugefallen wäre.
Meine Frustration kannte keine Grenzen, und dass mein Magen knurrte, half auch nicht unbedingt.
Ich hörte Elias’ Schlüssel im Schloss und rührte mich nicht von der Stelle, bis er in die Küche kam. »Hi«, sagte ich. »Wie geht es dir?«
»Gut.« Er schnüffelte in die Luft. »Keine Bolognese, Schatz?«