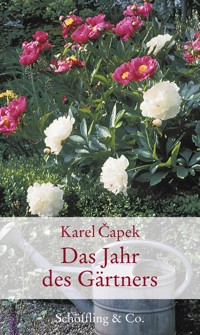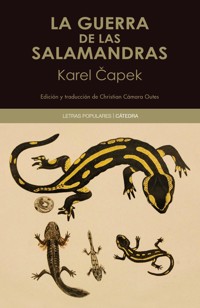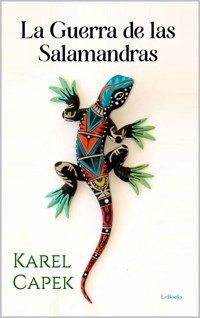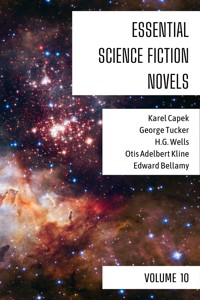Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Der begeisterte Gärtner Capek war als einer der ersten Science-fiction-Autoren bekannt. Mit Humor und Ironie führt er seine Leser durchs Gartenjahr. Mit Phantasie und Liebe zum Gärtnern geht der Autor Monat für Monat durchs Gartenjahr, wagt manchen Seitenblick auf Nebenthemen und macht dabei Lust aufs Gärtnern.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 130
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Wie man Gärten anlegt
Wie der Gärtner entsteht
Der Gärtner im Januar
Samen
De Gärtner im Februar
Von der Gärtnerkunst
Der Gärtner im März
Knospen
Der Gärtner im April
Feiertag
Der Gärtner im Mai
Gesegneter Regen
Der Gärtner im Juni
Von den Gemüsezüchtern
Der Gärtner im Juli
Ein Kapitel Botanik
Der Gärtner im August
Von den Kakteenzüchtern
Der Gärtner im September
Der Boden
Der Gärtner im Oktober
Von den Schönheiten des Herbstes
Der Gärtner im November
Die Vorbereitung
Der Gärtner im Dezember
Vom Leben des Gärtners
Wie man Gärten anlegt
Gärten kann man auf verschiedene Art anlegen; die beste ist die, einen Gärtner zu nehmen. Der Gärtner pflanzt dann verschiedene Stöcke, Reiser und Besen an, von denen er behauptet, dass es Ahorne, Weißdorne, Flieder, Hochstämme, Halbstämme und andere Natursorten seien; dann wühlt er in der Erde herum, kehrt das Unterste zum Obersten, drückt alles wieder glatt, macht aus Schlacke Wege, steckt hier und dort irgendein verwelktes Laub in die Erde, von dem er erklärt, es seien Perennen, sät den Samen für den künftigen Rasen aus, den er englisches Raygras und Straußgras, Fuchsschwanz, Kammgras, Riedgras nennt, und geht dann weg, den Garten braun und kahl wie am ersten Tage der Erschaffung der Welt zurücklassend; nur legt er euch ans Herz, all die Gartenerde täglich sorgsam zu begießen und, bis das Gras zu wachsen anfängt, Sand für die Wege anfahren zu lassen. Nun gut.
Man würde denken, das Begießen eines Gartens sei eine sehr einfache Sache, gar wenn man einen Schlauch dazu benutzt. Es zeigt sich jedoch bald, dass der Schlauch ein ungewöhnlich hinterlistiges und gefährliches Geschöpf ist, solang er nicht gezähmt wurde. Er krümmt sich, schnellt hoch, macht eine große Wasserlache unter sich und taucht mit Wonne in den Schlamm unter, den er sich auf diese Weise schuf; sodann stürzt er auf den Menschen los, der begießen will, und ringelt sich um dessen Beine. Man muss auf ihn treten, da aber leistet er Widerstand und windet sich einem um Hüften und Hals; während der Angefallene mit ihm wie mit einer Riesen-schlange kämpft, richtet das Ungetüm sein Messingmaul nach oben und speit einen mächtigen Wasserstrahl in die Fenster auf die frisch aufgehängten Vorhänge. Es bleibt nichts andres übrig, als ihn energisch beim Kopf zu packen und so weit als möglich zu strecken; die Bestie wütet vor Schmerz und beginnt Wasser zu spritzen, freilich nicht aus dem Maul, sondern aus dem Hydranten oder irgendwo aus der Mitte des Körpers. Beim ersten Mal sind drei Leute nötig, die sie einigermaßen bändigen; alle verlassen dann den Kampfplatz, bis über die Ohren mit Erde beschmiert und ausgiebig mit Wasser bespritzt. Was den Garten anbelangt, verwandelt er sich stellenweise in eine schmierige Pfütze, während er an andern Stellen vor Trockenheit Risse bekommt.
Tut man das täglich, beginnt in vierzehn Tagen Unkraut statt Gras zu wachsen. Es ist ein Naturgeheimnis, warum sich aus dem besten Rasensamen das üppigste und stachligste Unkraut entwickelt; vielleicht sollte man Unkrautsamen aussäen, um einen schönen Rasen zu bekommen. Nach drei Wochen ist der Rasen dicht mit Disteln und anderem kriechenden oder ellentief in der Erde verwurzelten Unkraut bewachsen; versucht man es aus der Erde zu ziehen, reißt es gleich oberhalb der Wurzel ab oder nimmt einen ganzen Erdklumpen mit. Es ist schon so: je größer das Luder, desto besser gedeiht es.
Inzwischen verändert sich durch eine geheimnisvolle Umwandlung der Materie die Schlacke der Wege in die klebrigste und schlüpfrigste Tonerde, die man sich nur vorstellen kann.
Nichtsdestoweniger muss man das Unkraut aus dem Rasen entfernen; man jätet und jätet, und hinter jedem Schritt verwandelt sich der künftige Rasen in kahle, braune Erde, wie sie am ersten Tag der Erschaffung der Welt ausgesehen haben mag. Nur an zwei oder drei Stellen bemerkt man einen grünlichen Schimmer, wie ein hingehauchter, schütterer Flaum; da gibt es keinen Zweifel mehr, das ist Gras. Man geht auf den Fußspitzen umher und jagt die Spatzen fort; doch während man auf den Boden starrt, kommen, noch ehe man sich besinnt, auf den Stachelbeer- und Johannisbeersträuchern die ersten Blättchen heraus. Immer kommt einem der Frühling zuvor.
Das Verhältnis zu den Dingen hat sich geändert. Regnet es, sagt man, es regne auf den Garten; scheint die Sonne, scheint sie nicht bloß so, sondern scheint auf den Garten; ist es Nacht, stellt man mit Befriedigung fest, dass sich der Garten ausruhe. Eines Tages wird man die Augen öffnen, und der Garten wird grün sein, das hohe Gras im Tau erglänzen, pralle, bräunliche Knospen werden aus dem Dickicht der Rosenkronen hervorgucken, und die alternden Bäume werden breitästig und dunkel, mit schweren Kronen und voll verwesendem Duft feuchten Schatten spenden. Nichts wird mehr an den zarten, kahlen und braunen Garten jener Tage erinnern, an den spärlichen Flaum des ersten Grases, an das armselige Aufbrechen der ersten Knospen, an all die erdige, arme und rührende Schönheit des Gartens, der angelegt wurde.
Nun gut, jetzt aber heißt es begießen, jäten und die Steine aus der Erde klauben.
Wie der Gärtner entsteht
Allem Anscheine zuwider wird der Gärtner weder aus einem Samen, noch einem Triebe, noch einem Knollen oder Ableger geboren, sondern entsteht durch die Erfahrung, durch die Umgebung und die Naturbedingungen. Solange ich klein war, hatte ich ein feindseliges, ja schadenfrohes Verhältnis zu Vaters Garten, weil mir verboten war, auf den Beeten herumzutreten und unreifes Obst zu pflücken. Ähnlich war es auch dem Adam im Paradiesgarten verboten gewesen, auf den Beeten herumzutreten und Obst vom Baum der Erkenntnis zu pflücken, weil es noch nicht reif war; nur dass Adam, so wie wir Kinder, doch das unreife Obst pflückte und deshalb aus dem Paradies hinausgejagt wurde. Von dieser Zeit an ist und bleibt das Obst am Baume der Erkenntnis unreif.
Solange sich ein Mensch in der Blüte seiner Jugend befindet, glaubt er, eine Blüte sei das, was man im Knopfloch trägt oder einem Mädchen schenkt; er hat nicht das richtige Verständnis dafür, dass eine Blüte etwas ist, was überwintert, was man umgräbt und düngt, umsetzt und für Stecklinge verwendet, beschneidet, anbindet und von Unkraut, Fruchtlagern, trockenen Blättern, Blattläusen und Meltau befreit. Statt die Beete umzugraben, läuft er den Mädchen nach, befriedigt seinen Ehrgeiz, genießt die Früchte des Lebens, die er nicht selbst aufgezogen hat, und verhält sich überhaupt im ganzen destruktiv. Es ist eine gewisse Reife, ich möchte sagen, ein gewisses väterliches Alter vonnöten, um Amateurgärtner werden zu können. Überdies muss man einen eigenen Garten haben. Gewöhnlich lässt man ihn von einem Berufsgärtner anlegen und denkt, dass man nach getaner Arbeit in den Garten gehen und sich über die Blumen freuen und dem Zwitschern der Vögel lauschen werde. Eines Tages setzt man selbst mit eigener Hand eine Blume ein; ich tat das mit der Hauswurz. Dabei dringt durch einen Riss in der Haut oder sonst irgendwie etwas Erde in den Körper und verursacht eine Vergiftung oder Entzündung. Kurzum, der Mensch bekommt das Gartenfieber.
Ein andermal entsteht ein Gärtner durch Ansteckung seitens der Nachbarn; er sieht vielleicht, wie beim Nachbar die Pechnelke blüht, und denkt sich: verdammt, warum könnte sie nicht auch bei mir blühen? Das wäre noch schöner, wenn ich das nicht besser träfe! Von da an verfällt der Gärtner immer tiefer und tiefer der neu erwachten Leidenschaft, die durch weitere Erfolge genährt und durch weitere Misserfolge aufgepeitscht wird; der Sammlertrieb bricht bei ihm durch, der ihn anspornt, alles nach dem ABC großzuziehen, von der Achillea bis zur Zinnia; später entwickelt sich in ihm der Eifer für Spezialitäten, der aus dem bis dahin zurechnungsfähigen Menschen einen Rosenliebhaber, Georginenliebhaber oder eine andere Art überspannten Monomanen werden lässt. Andere wieder verfallen einer künstlerischen Leidenschaft, bauen, ändern und setzen ständig ihren Garten um, stellen Farben zusammen und gruppieren die Blumenstöcke; gehetzt durch die sogenannte schöpferische Unzufriedenheit, wechseln sie aus, wo etwas steht und wächst. Es soll sich nur ja niemand einbilden, echte Gärtnerei sei eine bukolische und beschauliche Tätigkeit. Eine unstillbare Leidenschaft ist sie, wie alles, was ein gründlicher Mensch anfängt.
Jetzt will ich noch verraten, woran man einen wirklichen Gärtner erkennt. »Sie müssen mich besuchen«, sagt er, »ich muss Ihnen meinen Garten zeigen.« Kommt man also hin, um ihm Freude zu machen, so findet man sein Hinterteil irgendwo zwischen den Perennen emporragen. »Ich komme gleich«, sagt er über die Schulter hinweg, »ich setze nur das hier um.« »Lassen Sie sich nicht stören«, erwidert man ihm freundlich. Nach einiger Zeit ist das Zeug wahrscheinlich schon umgesetzt; kurzum, er erhebt sich, macht einem die Hand schmutzig und sagt, vor Gastfreundschaft strahlend: »Also kommen Sie, schauen Sie sich ihn an; es ist zwar nur ein kleiner Garten, aber – einen Augenblick«, sagt er und bückt sich zu einem Beet nieder, um einige Gräser auszujäten. »Also kommen Sie. Ich zeige Ihnen eine Dianthus Musalae, da werden Sie Augen machen. Herrgott, hier habe ich vergessen aufzulockern«, sagt er und beginnt in der Erde herum-zustochern. Nach einer Viertelstunde richtet er sich wieder auf und meint: »Richtig, ich wollte Ihnen ja die Glocken-blume, Campanula Wilsonae zeigen. Das ist die schönste Glockenblume, die – warten Sie, ich muss den Rittersporn da anbinden.« Sobald er ihn angebunden hat, erinnert er sich: »Ach ja, Sie wollten den Reiherschnabel sehen. Einen Augenblick«, brummt er, »ich will nur diese Aster hier um-setzen; sie hat zu wenig Platz.« Worauf man auf den Fußspitzen davonschleicht und das Hinterteil des Gärtners zwischen den Perennen emporragen lässt.
Und sobald er einem wieder begegnet, sagt er: »Sie müssen mich besuchen kommen; bei mir blüht eine Rose, so etwas haben Sie noch nicht gesehen. Also Sie kommen? Aber bestimmt.«
Nun gut: besuchen wir ihn, um zu sehen, wie das Jahr vergeht.
Der Gärtner im Januar
»Nicht einmal der Januar bedeutet für den Gärtner eine Zeit der Untätigkeit«, sagen die Handbücher für Gärtner. Gewiss nicht, denn im Januar pflegt der Gärtner hauptsächlich: das Wetter. Mit dem Wetter ist es eine eigene Sache; es ist niemals in Ordnung. Entweder schießt es über die eine oder die andere Seite hinaus. Die Temperatur stimmt nie mit der hundertjährigen Norm überein; entweder sind 5 Grad unter oder 5 Grad über ihr. Niederschläge aber fallen entweder zehn Millimeter unter oder zwanzig Millimeter über dem Normalen. Ist es nicht zu trocken, so ist es sicherlich zu feucht.
Wenn schon die Leute, die es sonst gar nichts angeht, Grund genug haben, über das Wetter zu klagen, wie erst der Gärtner! Schneit es zu wenig, so brummt er mit Recht, dass es durchaus nicht genüge; schneit es zu viel, äußert er ernste Befürchtungen, dass seine Nadelbäume und Rosensträucher brechen werden. Schneit es überhaupt nicht, jammert er über die verheerenden Kahlfröste; tritt Tauwetter ein, verflucht er die verrückten Winde, von denen es begleitet ist und die die schändliche Gewohnheit haben, Reisig und andere Frostdeckung im Garten herumzuwirbeln, oder, zum Donnerwetter, gar ein Bäumchen zu brechen. Wagt im Januar die Sonne zu scheinen, fasst sich der Gärtner an den Kopf; die Sträucher könnten vorzeitig Saft treiben. Regnet es, fürchtet er für seine Alpenblumen; ist es trocken, denkt er mit Schmerzen an seine Rhododendren und Andromeden. Und doch wäre es gar nicht so schwer, seinen Wünschen entgegenzukommen: er würde sich begnügen, wenn vom ersten bis letzten Januar 0,9 Grad unter Null wären, hundertsiebenundzwanzig Millimeter Schnee (leichter und womöglich frischer Schnee), meist bewölkt, keine oder nur mäßige Westwinde. Dann wäre alles in Ordnung. Aber das ist es eben: um uns Gärtner kümmert sich niemand, niemand fragt uns, wie es sein sollte. Deshalb sieht die Welt auch so aus.
Am ärgsten ist dem Gärtner zumute, wenn die Kahlfröste einsetzen. Da erstarrt die Erde und trocknet bis auf die Knochen aus, Tag um Tag, Nacht um Nacht, immer tiefer; der Gärtner denkt an die Wurzeln, die in der toten und steinharten Erde einfrieren, an die Zweige, die der trockene und eisige Wind bis zum Mark durchdringt, an die frierenden Knospen, in welche die Pflanze im Herbst ihre Siebensachen gepackt hat. Wenn ich wüsste, dass es hilft, zöge ich meiner Stechpalme den eigenen Rock an, und dem Wacholderstrauch meine eigene Hose; für dich, pontische Azalee, ziehe ich mein Hemd aus, dich, Granatrispe, decke ich mit dem Hute zu, und für dich, Mädchenauge, bleiben nur noch meine Fußsocken übrig: nimm sie zum Dank.
Es gibt verschiedene Finten, wie man dem Wetter beikommen und seine Veränderung herbeiführen kann. Wenn ich mich zum Beispiel entschließe, die wärmsten Kleider, die ich habe, anzuziehen, wird es regelmäßig wärmer. Tauwetter tritt gleichfalls ein, wenn sich ein paar Freunde verabreden, ins Gebirge Schifahren zu gehen, auch wenn jemand einen Artikel für die Zeitung schreibt, in dem er die herrschenden Fröste schildert, die gesunden, frischen Wangen, das Leben und Treiben auf den Eislaufplätzen und andere ähnliche Erscheinungen, setzt gerade in dem Augenblick Tauwetter ein, wo der Artikel gedruckt wird. Die Leute lesen ihn dann, während es draußen bereits wieder lauwarm regnet und das Thermometer 8 Grad über Null zeigt; kein Wunder, wenn dann die Leute sagen, in den Zeitungen wären lauter Lügen und Schwindel – lassen Sie uns mit der Zeitung in Ruhe. Andererseits haben Verwünschungen, Jammern, Fluchen, »Brrr«-Sagen und andere Beschwörungsformeln keinen Einfluss auf das Wetter.
Was die Vegetation im Januar betrifft, sind die sogenannten Blumen am Fensterglase die bekanntesten. Damit sie aufblühen, muss die Zimmerluft wenigstens etwas ausgeatmeten Wasserdampf enthalten. Ist die Luft vollkommen trocken, kann man nicht einmal die armseligste Nadel an die Fenster zaubern, geschweige denn Blüten. Dann muss auch das Fenster irgendwo schlecht schließen; in der Richtung, in der es durchs Fenster bläst, wachsen die Eisblumen. Deshalb gedeihen sie auch eher bei armen Leuten als bei reichen, weil bei den Reichen die Fenster besser schließen.
Botanisch zeichnen sich die Eisblumen dadurch aus, dass sie eigentlich keine Blumen sind, sondern Blätter. Sie ähneln den Endivien-, Petersilie- und Sellerieblättern; auch verschiedenen Distelarten aus der Familie der Cynarocephalae, Carduaceae, Dipsaceae, Acanthaceae, Umbelliferae und anderen; man kann sie mit folgenden Arten vergleichen: Stechkraut oder Bergdistel, Sonnendistel, Kratzdistel, Brachdistel, Donnerdistel, Kugeldistel, Karddistel, Weberdistel, Distelsafran, Bärenklaue und noch mit einigen anderen distelartigen, fiederschnittig, gezähnt, gespalten, geschweift, geschnitten oder schrotsägeförmig beblätterten Pflanzen; manchmal ähneln sie den Farnkräutern oder Palmblättern, ein andermal wieder den Wacholdernadeln. Blüten haben sie jedoch keine.
Also »nicht einmal der Januar bedeutet für den Gärtner eine Zeit der Untätigkeit«, wie die Handbücher für Gärtner – sicher nur zum Trost – behaupten. Vor allem könne man angeblich den Boden bearbeiten, weil er sich durch die Kälte bröckle. Da stürzt denn der Gärtner gleich zu Neujahr in den Gatten hinaus, um den Boden zu bearbeiten. Er macht sich mit dem Spaten ans Werk; nach einiger Anstrengung gelingt es ihm, den Spaten an dem steinharten Boden zu zerbrechen. Nun versucht er es mit der Hacke; hat er Ausdauer, bricht er ihren Stiel entzwei. Da greift er nach der Doppelkrampe, mit der es ihm wenigstens gelingt, eine Tulpenzwiebel zu zerhacken, die er im Herbst eingesetzt hat. Als einziges Mittel bleibt: die Erde mit Stemmeisen und Hammer zu bearbeiten. Freilich ist das ein sehr langwieriges Verfahren, das einen bald verdrießt. Vielleicht ließe sich der Boden mit Dynamit auflockern, das aber der Gärtner für gewöhnlich nicht besitzt. Gut, dann überlassen wir den Boden eben dem Tauwetter.
Und siehe, das Tauwetter ist plötzlich da; wieder stürzt der Gärtner in den Garten hinaus, um den Boden zu bearbeiten. Nach einer Weile trägt er die Erde, soweit sie an der Oberfläche aufgetaut ist, an seinen Stiefeln nach Hause; nichtsdestoweniger macht er ein glückstrahlendes Gesicht