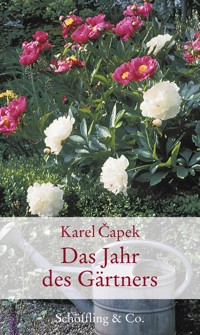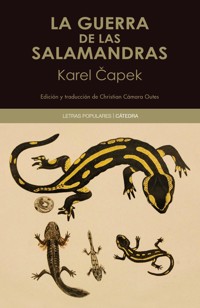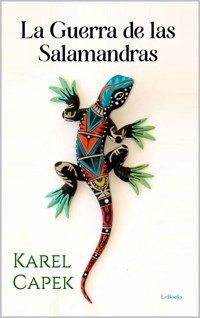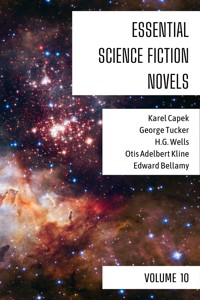Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Elsinor Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Zufällig entdeckt Kapitän J. van Toch vor einer indonesischen Insel eine Kolonie lebender Fossilien – zutrauliche Riesenmolche, groß wie Kinder. Die überraschend klugen Tiere erlernen die Perlenfischerei und lassen sich für einen Tauschhandel gewinnen. Aber dabei bleibt es nicht: Internationale Unternehmen erkennen die Tauglichkeit der Molche als Arbeitskräfte; die Tiere, in Massen gezüchtet, werden zur Handelsware. Doch die Amphibien werden sich ihrer Lage bewusst und setzen sich zur Wehr. Mensch oder Molch – wer wird diesen Konflikt gewinnen ?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 385
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Karel Čapek
Der Krieg mit den Molchen
Aus dem Tschechischen von Eliška Glaserová
Mit einem Nachwort von Marko Martin
Elsinor
Inhalt
Erstes Buch Andrias Scheuchzeri
1 Das absonderliche Wesen des Kapitäns van Toch
2 Herr Golombek und Herr Valenta
3 G. H. Bondy und sein Landsmann
4 Kapitän van Tochs Handelsunternehmung
5 Kapitän J. van Toch und seine dressierten Eidechsen
6 Die Jacht in der Lagune
7 Fortsetzung der Jacht in der Lagune
8 Andrias Scheuchzeri
9 Andrew Scheuchzer
10 Kirchweih in Nové Strašecí
11 Über Menschenechsen
12 Das Salamandersyndikat
Zweites Buch Stufe um Stufe zur Zivilisation
1 Herr Povondra liest Zeitungen
2 Stufe um Stufe zur Zivilisation
3 Herr Povondra liest wieder einmal Zeitung
Drittes Buch Der Krieg mit den Molchen
1 Das Massaker auf den Kokosinseln
2 Der Zusammenstoß in der Normandie
3 Der Zwischenfall im Ärmelkanal
4 Der Nordmolch
5 Wolf Meynert schreibt sein Werk
6 X warnt
7 Das Erdbeben von Louisiana
8 Der Chief Salamander stellt Bedingungen
9 Die Konferenz von Vaduz
10 Herr Povondra nimmt alles auf sich
11 Der Autor spricht mit sich selbst
Anmerkungen
Salamander sind auch keine besseren Menschen
Erstes Buch Andrias Scheuchzeri
1 Das absonderliche Wesen des Kapitäns van Toch
Wer die Insel Tana Masa auf der Landkarte suchte, fände sie genau am Äquator, ein wenig westlich von Sumatra; fragt man aber Kapitän J. van Toch an Bord der Kandong Bandoeng, was es mit dieser Tana Masa, wo er soeben vor Anker ging, auf sich hat, wird er zunächst mächtig schimpfen und dann sagen, dies sei das dreckigste Loch auf den ganzen Sundainseln, noch viel gottverlassener als Tana Bala, aber zumindest ein ebenso verdammter Fleck Erde wie Pini oder Banjak; der einzige Mensch, der dort lebe – die lausigen Bataks natürlich nicht mitgerechnet –, sei ein betrunkener Agent, eine Kreuzung zwischen Kubu und Portugiesen und ein noch größerer Gauner, Heide und Schweinehund als ein ganzer Kubu und ein ganzer Weißer zusammengenommen; und wenn es etwas Verdammtes auf der Welt gäbe, dann sei es das verdammte Leben auf dieser verdammten Tana Masa, Herr. Worauf man ihn offenbar fragen würde, warum er denn hier seinen verdammten Anker geworfen habe, als wollte er verdammte drei Tage lang dableiben. Und er würde zornig fauchen und etwas in dem Sinne brummen, daß die Kandong Bandoeng bloß wegen der verdammten Kopra oder des Palmöls bestimmt nicht hierhergekommen wäre, das versteht sich von selbst, und übrigens geht Sie das nichts an, Herr, kümmern Sie sich freundlichst um Ihre eigenen Angelegenheiten. Und er würde so ausgiebig und weitschweifig fluchen und schimpfen, wie es sich für einen älteren, aber für sein Alter noch rüstigen Kapitän geziemt.
Wenn man aber, statt vorwitzige Fragen zu stellen, es lieber Kapitän van Toch überließe, nach Herzenslust für sich zu brummen und zu fluchen, würde man vielleicht mehr erfahren. Sieht man es ihm denn nicht an, daß er seinem Herzen Luft machen muß? Laßt ihn nur, seine Erbitterung wird schon von selbst ein Ventil finden. «Also bitte, Herr», bricht es aus ihm hervor, «diese verdammten Kerls da oben in Amsterdam besinnen sich auf einmal, Perlen sollen es sein, Mensch, schauen Sie sich nach Perlen um. Die Leute sind jetzt ganz verrückt auf Perlen, sagen sie, und überhaupt.» Hier spuckt der Kapitän erbittert aus. «Versteht sich, Pinkepinke in Perlen anlegen! Das kommt davon, daß ihr alle fortwährend Krieg führen wollt, oder was weiß ich. Angst ums Geld, darum dreht sich’s. Und das nennt man dann Krise, Herr.» Kapitän J. van Toch zögert einen Augenblick, ob er sich in ein Gespräch über volkswirtschaftliche Fragen einlassen soll; heutzutage spricht man ja über nichts anderes. Nur ist man in dieser Hitze vor Tana Masa zu träge; Kapitän van Toch macht nur eine Handbewegung und brummt:
«Leicht gesagt, Perlen, Herr, auf Ceylon ist schon alles auf zehn Jahre ausgepowert, auf Formosa ist das Perlenfischen verboten. – Na, dann sehen Sie eben zu, Kapitän van Toch, kriegt man gesagt, daß Sie neue Fundstätten entdecken. Fahren Sie doch mal zu diesen verdammten Inseln, vielleicht finden Sie da ganze Muschelbänke …» Der Kapitän trompetet verächtlich in sein himmelblaues Taschentuch. «Diese Landratten in Europa stellen sich vor, daß man hier noch was finden kann, wovon niemand weiß! Donnerwetter noch mal, sind das Hornochsen! Ein Wunder, daß sie nicht von mir verlangen, ich soll den Bataks in die Nasenlöcher gucken, ob sie nicht Perlen ausschneuzen. Neue Fundstätten! In Padang ist ein neues Bordell, das ja, aber neue Fundstätten? Herr, ich kenn die ganzen Inseln hier wie meine Hosentasche … von Ceylon bis zu dem verdammten Clipperton Island und noch weiter … Wenn sich jemand einbildet, hier findet sich noch was, woran sich verdienen läßt, dann glückliche Reise, Herr! Dreißig Jahre fahre ich diese Route, und jetzt wollen die Trottel, daß ich hier etwas entdecke!» Kapitän van Toch erstickte fast an dieser beleidigenden Zumutung. «Sollen sie doch irgendein Greenhorn herschicken, der wird ihnen was entdecken, daß sie die Augen nur so aufreißen; aber so etwas von jemandem verlangen, der sich hier auskennt wie Kapitän van Toch … Na, sagen Sie selbst, Herr! In Europa, ja, da ließe sich noch allerhand entdecken, aber hier … Hierher kommen die Leute doch nur, um herauszuschnüffeln, ob es was zu fressen gibt, und nicht einmal zu fressen: zu kaufen und zu verkaufen, Herr. Wenn in den ganzen verdammten Tropen noch was wäre, was eine Dubbeltje wert ist, gleich stehen drei Agenten dabei und winken mit ihren verrotzten Schnupftüchern den Schiffen von sieben Staaten, damit sie dort anlegen. So ist das, mein Herr. Ich kenn mich hier besser aus als das Kolonialamt Ihrer Majestät der Königin, mit Verlaub.» Kapitän van Toch überwindet nur mit Mühe seinen gerechten Zorn, was ihm erst nach längerem Poltern gelingt. «Sehen Sie die beiden elenden Faulenzer dort? Das sind Perlenfischer aus Ceylon, Gott steh mir bei, Singhalesen, wie sie der Herrgott erschaffen hat; aber warum er sie erschaffen hat, weiß ich wirklich nicht. Das führ ich jetzt mit mir herum, Herr, und wo ich irgendein Stückchen Küste finde, an dem nicht Agency oder Bat’a oder Zollamt geschrieben steht, lasse ich das ins Wasser hinunter, um Perlmuscheln zu suchen. Der kleinere Gauner taucht bis achtzig Meter tief; drüben auf den Prince Islands hat er aus einer Tiefe von neunzig Metern die Kurbel von einem kinematographischen Apparat herausgefischt, Herr, aber Perlen, wo denken Sie hin! Nicht die Spur! Ein elendes Gesindel, diese Singhalesen. Also sehen Sie, solch eine verdammte Arbeit hab ich, tun, als ob ich Palmöl kaufen wollte, und dabei neue Perlenfundstätten suchen. Am Ende werden sie noch von mir verlangen, daß ich einen jungfräulichen Kontinent entdecke! Ist das eine Arbeit für einen rechtschaffenen Handelsmarinekapitän, Herr? J. van Toch ist doch kein verfluchter Abenteurer, Herr. Nein, mein Herr.» Und so weiter. Das Meer ist groß, und der Ozean der Zeit hat keine Grenzen; du spuckst ins Meer, Mensch, und es schwillt nicht an, du haderst mit deinem Schicksal und änderst es nicht; und so sind wir nach vielen Vorbereitungen und Umständen endlich so weit, daß der Kapitän des holländischen Dampfers Kandong Bandoeng, J. van Toch, unter Seufzen und Fluchen in das Boot hinabklettert, um beim Kampong auf Tana Masa auszusteigen und mit der betrunkenen Kreuzung zwischen Kubu und Portugiesen über geschäftliche Angelegenheiten zu verhandeln.
«Sorry, Captain», sagte schließlich die Kreuzung zwischen Kubu und Portugiesen, «aber hier auf Tana Masa wachsen keine Muscheln. Die dreckigen Bataks», sagte er mit maßlosem Ekel, «fressen sogar Medusen, sie sind mehr im Wasser als auf dem Land, die Frauen stinken nach Fisch, das können Sie sich überhaupt nicht vorstellen – was hab ich sagen wollen? Aha, Sie haben nach Weibern gefragt.»
«Und gibt es nicht irgendein Stückchen Küste», fragte der Kapitän, «wo diese Bataks nicht ins Wasser gehen?»
Die Kreuzung zwischen Kubu und Portugiesen schüttelte den Kopf. «Nein, Herr. Höchstens Devil Bay, aber das ist nichts für Sie.»
«Warum nicht?»
«Weil … dort niemand hindarf. Soll ich Ihnen einschenken, Kapitän?»
«Thanks. Sind Haifische dort?»
«Haifische und überhaupt», murmelte der Mischling. «Ein schlechter Platz, Herr. Die Bataks würden es nicht gern sehen, wenn sich dort jemand zu schaffen machte.»
«Warum?»
«… Es sind Teufel dort, Herr. Seeteufel.»
«Was ist ein Seeteufel? Ein Fisch?»
«Nein, kein Fisch», erwiderte der Mischling ausweichend. «Eben ein Teufel, Herr. Ein Seeteufel. Die Bataks nennen ihn Tappa. Tappa. Sie sollen dort eine ganze Stadt haben, die Teufel. Darf ich einschenken?»
«Und wie sieht so was aus … so ein Seeteufel?»
Die Kreuzung zwischen Kubu und Portugiesen zuckte die Achseln. «Wie ein Teufel, Herr. Ich hab einmal einen gesehen … das heißt, nur den Kopf. Ich kam im Boot von Cape Haarlem … und auf einmal steckt er vor mir den Schädel aus dem Wasser.»
«Na und? Wie sieht er aus?»
«Also einen Schädel hat er … wie ein Batak, Herr, aber ganz kahl.»
«War es nicht wirklich ein Batak?»
«Nein, Herr. An der Stelle geht doch kein Batak ins Wasser. Und dann … es hat mir mit den untren Augenlidern zugezwinkert, Herr.» Der Mischling schüttelte sich vor Grauen. «Mit den untren Lidern, sie gehen über das ganze Auge. Das ist der Tappa.»
Kapitän J. van Toch drehte das Glas mit dem Palmwein in seinen dicken Fingern. «Und waren Sie nicht vielleicht betrunken? Besoffen waren Sie nicht?»
«Aber natürlich, Herr. Sonst wär ich doch dort nicht vorbeigerudert. Die Bataks sehen es nicht gern, wenn man den … Teufeln in die Quere kommt.»
Kapitän van Toch schüttelte den Kopf. «Mensch, Teufel gibt’s keine. Und wenn, dann müßten sie wie Europäer aussehen. Es war vielleicht bloß ein Fisch oder so was.»
«Ein Fisch», stotterte die Kreuzung zwischen Kubu und Portugiesen, «ein Fisch hat keine Hände, Herr. Ich bin kein Batak, Herr, ich bin in Badjoeng in die Schule gegangen … vielleicht kann ich sogar noch die Zehn Gebote und andere wissenschaftlich bewiesene Lehren; ein gebildeter Mensch erkennt doch, was ein Teufel und was ein Tier ist. Fragen Sie nur die Bataks, Herr.»
«Das ist bloß Aberglaube, das haben Sie von den Schwarzen», erklärte der Kapitän mit dem jovialen Übergewicht des gebildeten Mannes. «Wissenschaftlich ist es Unsinn. Ein Teufel kann doch nicht im Wasser leben. Was soll er dort? Du darfst nichts auf das Geschwätz von Eingeborenen geben, mein Junge. Jemand hat der Bucht den Namen Teufelsbai gegeben, und seitdem fürchten sich die Bataks davor. So ist das», sprach der Kapitän und schlug mit seiner dicken Hand auf den Tisch. «Nichts ist dort, Junge, das ist doch wissenschaftlich einwandfrei klar.»
«Ja, Herr», stimmte die Kreuzung bei, die in Badjoeng zur Schule gegangen war. «Aber kein vernünftiger Mensch hat in der Devil Bay etwas zu suchen.»
Kapitän van Toch wurde rot. «Was?» schrie er. «Du dreckiger Kubu, du glaubst wohl, ich werde mich vor deinen Teufeln fürchten? Das wollen wir doch einmal sehen», sagte er und erhob sich in der ganzen mächtigen Fülle seiner rechtschaffenen zweihundert Pfund. «Ich werde mit dir hier nicht meine Zeit vertrödeln, ich habe business zu tun. Aber eins merk dir: In den holländischen Kolonien gibt es keine Teufel; wenn es welche gibt, dann in den französischen. Dort könnten schon welche sein. Und jetzt ruf mir mal den Vorsteher von diesem verdammten Kampong.»
Der besagte Würdenträger mußte nicht lange gesucht werden; er hockte neben dem Laden des Mischlings und kaute Zuckerrohr. Es war ein nackter älterer Herr, aber weit magerer, als Gemeindevorsteher in Europa zu sein pflegen. Hinter ihm hockte, unter Einhaltung der gebührenden Distanz, das gesamte Dorf mit Frauen und Kindern, augenscheinlich in Erwartung, gefilmt zu werden.
«Also, hör mal, Junge», sprach ihn Kapitän van Toch auf Malaiisch an (er hätte ebensogut Holländisch oder Englisch sprechen können, denn der ehrwürdige alte Batak konnte kein Wort Malaiisch, und die Kreuzung zwischen Kubu und Portugiesen mußte die ganze Rede des Kapitäns ins Batakische verdolmetschen; aber aus irgendwelchen Gründen hielt der Kapitän Malaiisch für geeigneter. «Also hör mal, Junge, ich würde ein paar große, starke, mutige Burschen zum Fischen brauchen. Zum Fischen, verstehst du?»
Der Mischling übersetzte, und der Vorsteher nickte, ja, er habe verstanden, worauf er sich an das übrige Auditorium wandte und eine Rede hielt, die sichtlich von Erfolg begleitet war.
«Der Häuptling sagt», dolmetschte der Mischling, «daß das ganze Dorf mit dem Tuan Kapitän fischen geht, wohin der Tuan will.»
«Na, siehst du. Sag ihnen also, wir gehen in die Devil Bay, Muscheln fischen.»
Es folgte ein viertelstündiges aufgeregtes Hin und Her, an dem sich das ganze Dorf beteiligte, besonders die alten Frauen. Endlich wandte sich der Mischling dem Kapitän zu. «Sie sagen, Herr, in die Devil Bay kann man nicht.»
Der Kapitän lief rot an. «Und warum nicht?»
Der Mischling zuckte die Achseln. «Weil Tappa-Tappa dort sind. Teufel, Herr.»
Der Kapitän begann violett anzulaufen. «Dann sag ihnen, wenn sie nicht gehen … schlag ich ihnen alle Zähne aus … reiß ich ihnen die Ohren ab … häng ich sie auf … und verbrenn ihren lausigen Kampong, verstanden?»
Der Mischling übersetzte redlich, worauf wieder eine längere, lebhafte Beratung folgte. Endlich wandte sich der Mischling dem Kapitän zu. «Sie sagen, Herr, sie werden sich in Padang bei der Polizei beschweren, daß ihnen der Tuan gedroht hätte. Dafür, sagen sie, gibt es Paragraphen. Der Häuptling sagt, er läßt das nicht auf sich beruhen.»
Kapitän van Toch lief blau an. «Dann sag ihm», brüllte er, «daß er …», und er sprach ohne Atempause gute elf Minuten lang.
Der Mischling übersetzte, soweit sein Wortschatz reichte, und nach einer neuerlichen, zwar langen, aber sachlichen Beratung der Bataks verdolmetschte er dem Kapitän: «Sie sagen, Herr, sie wären also bereit, von einer gerichtlichen Verfolgung abzusehen, wenn der Tuan Kapitän der hiesigen Behörde eine Strafe zahlt. Sie verlangen», er zögerte, «zweihundert Rupien, aber das ist etwas viel, Herr. Bieten Sie ihnen fünf an.»
Die Farbe Kapitän van Tochs begann sich in braunrote Flecken aufzulösen. Zuerst bot er die Ausrottung aller Bataks auf der ganzen Welt an, dann ging er auf dreihundert Fußtritte herunter, und schließlich wollte er sich damit begnügen, den Häuptling für das Kolonialmuseum in Amsterdam ausstopfen zu lassen. Die Bataks dagegen gingen von zweihundert Rupien auf eine eiserne Pumpe mit Radantrieb zurück, und schließlich bestanden sie auf einem Benzinfeuerzeug. («Geben Sie es ihnen, Herr», redete ihm die Mischung zwischen Kubu und Portugiesen zu, «ich habe drei Feuerzeuge auf Lager, aber ohne Docht.»)
So wurde der Friede auf Tana Masa wiederhergestellt, aber Kapitän J. van Toch wußte, daß nun das Prestige der weißen Rasse auf dem Spiel stand.
Am Nachmittag stieß von dem holländischen Schiff Kandong Bandoeng ein Boot ab, in welchem insbesondere anwesend waren: Kapitän J. van Toch, der Schwede Jensen, der Isländer Gudmundson, der Finne Gillemainen und die beiden singhalesischen Perlenfischer. Das Boot fuhr geradewegs zur Devil Bay.
Um drei Uhr, als die Ebbe ihren Tiefstand erreicht hatte, stand der Kapitän am Ufer, das Boot kreuzte etwa hundert Meter vor der Küste, um nach Haifischen Ausschau zu halten, und die Singhalesen warteten, das Messer in der Hand, auf das Zeichen, ins Wasser zu springen.
«So, jetzt du», befahl der Kapitän dem größeren der beiden nackten Männer. Der Singhalese sprang ins Wasser, watete einige Schritt und versank in der Tiefe. Der Kapitän schaute auf die Uhr.
Nach vier Minuten zwanzig Sekunden tauchte etwa sechzig Meter links ein brauner Kopf auf; in seltsamer, verzweifelter und doch paralysierter Hast klomm der Singhalese an den Felsblöcken empor, in der einen Hand das Messer zum Abschneiden der Muscheln, in der andern eine Perlmuschel.
Der Kapitän runzelte die Stirn. «Na, was ist denn?» sagte er scharf.
Immer wieder glitt der Singhalese ab, von einem Felsblock zum andern, sein Atem ging laut und stoßweise vor Grauen.
«Was ist geschehen?» fragte der Kapitän.
«Sahib, Sahib», stöhnte der Singhalese und sank keuchend aufs Ufer. «Sahib …, Sahib …»
«Haifische?»
«Dschinns», stöhnte der Singhalese auf. «Teufel, Herr. Tausende, Tausende Teufel.» Er bohrte die Fäuste in die Augen. «Lauter Teufel, Herr!»
«Zeig mal die Muschel her», befahl der Kapitän und öffnete sie mit dem Messer. Eine kleine, reine Perle lag darin.
«Mehr hast du nicht gefunden?»
Der Singhalese zog drei weitere Muscheln aus dem Beutel, der ihm am Hals hing. «Muscheln sind da, Herr, aber die Teufel bewachen sie … Sie haben mir zugeschaut, als ich sie abschnitt …» Sein buschiges Haar sträubte sich vor Entsetzen. «Sahib, hier nicht!»
Der Kapitän öffnete die Muscheln; zwei waren leer, die dritte enthielt eine erbsengroße Perle, rund wie ein Quecksilbertropfen. Kapitän van Toch blickte abwechselnd auf die Perle und den auf der Erde zusammengesunkenen Singhalesen. «Du», sagte er zögernd, «möchtest du nicht noch einmal hinunter?»
Der Singhalese schüttelte wortlos den Kopf.
Kapitän J. van Toch hatte schon einen starken Fluch auf der Zunge; zu seiner eigenen Überraschung jedoch hörte er sich leise, fast sanft sprechen: «Hab doch keine Angst, Junge. Wie sehen sie denn aus … deine Teufel?»
«Wie kleine Kinder», hauchte der Singhalese. «Sie haben einen Schwanz, Herr, und so groß sind sie», er zeigte etwa einen Meter zwanzig vom Boden. «Sie standen um mich herum und guckten zu, was ich mache … rundherum standen sie …» Der Singhalese schlotterte. «Sahib, Sahib, hier nicht!» Kapitän van Toch überlegte. «Hör mal, und zwinkern sie nicht vielleicht mit dem untren Augenlid?»
«Ich weiß nicht, Herr», antwortete der Singhalese heiser.
«Es sind, es sind … zehntausend!»
Der Kapitän sah sich nach dem anderen Singhalesen um; der stand etwa hundertfünfzig Meter entfernt und wartete gleichgültig, die Hände auf den Schultern gekreuzt. Nun ja, wohin soll ein nackter Mensch auch mit seinen Händen? Er kann sie nur auf die Schultern legen. Der Kapitän gab ihm schweigend das Zeichen, und der kleine Singhalese sprang ins Wasser. Nach drei Minuten fünfzig Sekunden tauchte er wieder auf und klomm an den Felsblöcken empor, aber seine Hände glitten immer wieder ab.
«Na, komm doch schon», schrie der Kapitän, aber dann sah er aufmerksamer hin, und schon sprang er über die Felsblöcke zu den verzweifelt tappenden Händen. Es ist schier unglaublich, wie solch ein unförmiger Körper springen kann. Im letzten Augenblick packte er den Singhalesen an einer Hand und zog ihn schnaufend aus dem Wasser. Dann legte er ihn auf einen Felsblock und wischte sich den Schweiß ab. Der Singhalese lag vollkommen reglos; das eine Schienbein war bis auf den Knochen abgeschürft, offenbar durch einen Stein, aber sonst war er heil. Der Kapitän hob sein Augenlid, man sah nur das Weiße der starren Augen. Er hatte weder Muscheln noch Messer.
Das Boot mit der Besatzung steuerte näher zum Ufer.
«Herr», rief der Schwede Jensen, «Haifische! Tauchen Sie weiter?»
«Nein», sagte der Kapitän. «Kommen Sie die zwei da abholen.»
«Schauen Sie, Herr», machte Jensen aufmerksam, als das Boot zum Schiff zurückruderte, «wie seicht es hier auf einmal ist. Und das zieht sich von hier geradeaus bis zum Ufer», zeigte er, indem er das Ruder ins Wasser stieß. «Als ob unter Wasser ein Damm wäre.»
Erst auf dem Schiff kam der kleine Singhalese zu sich. Er saß, die Knie unter das Kinn gezogen, und zitterte am ganzen Körper. Der Kapitän schickte die Leute fort und setzte sich mit weit gespreizten Beinen nieder.
«Also heraus mit der Sprache», sagte er. «Was hast du gesehen?»
«Dschinns, Sahib», flüsterte der kleine Singhalese; jetzt begannen auch seine Augenlider zu zittern, und seinen ganzen Körper überlief eine Gänsehaut.
Kapitän van Toch räusperte sich. «Und … wie sehen sie aus?»
«Wie … wie …» In den Augen des Singhalesen erschien wieder ein weißer Streifen. Kapitän van Toch schlug ihm unvermutet mit Handfläche und -rücken gewandt auf beide Wangen, um ihn wieder zu sich zu bringen.
«Thanks, Sahib», hauchte der kleine Singhalese, seine Pupillen schwammen ins Weiße zurück.
«Wieder gut?»
«Ja, Sahib.»
«Waren Muscheln dort?»
«Ja, Sahib.»
Kapitän J. van Toch fuhr in seinem Kreuzverhör mit nicht wenig Geduld und Gründlichkeit fort. Ja, Teufel seien dort. Wieviel? Tausende und Tausende. Sie sind ungefähr so groß wie ein zehnjähriges Kind, Herr, und beinahe schwarz. Sie schwimmen im Wasser, aber auf dem Grund gehen sie auf zwei Beinen, Sahib, wie Sie oder ich, nur wiegen sie dabei den Körper, hin und her, immer hin und her … Ja, Herr, sie haben auch Hände, wie Menschen. Nein, Krallen haben sie nicht, es sind eher Kinderhände. Nein, Sahib, sie haben keine Hörner und auch keine Schuppen. Ja, einen Schwanz haben sie, so eine Art Fischschwanz, aber ohne Schwanzflosse. Und einen großen Kopf, rund, wie die Bataks. Nein, gesagt haben sie nichts, Herr, nur so etwas wie geschnalzt. Als der Singhalese in einer Tiefe von ungefähr sechzehn Metern Muscheln abschnitt, spürte er auf einmal etwas am Rücken, als ob ihn kleine, kalte Finger berührten. Er drehte sich um, und da waren Hunderte und Hunderte rings um ihn. Hunderte und Hunderte, Herr, schwimmend und auf Steinen stehend, und alle schauten zu, was der Singhalese dort machte. Da ließ er Messer und Muscheln los und trachtete nur, möglichst schnell wieder an die Oberfläche zu kommen. Dabei war er an einige Teufel gestoßen, die über ihm schwammen, und was dann geschah, das wisse er nicht mehr, Herr.
Kapitän J. van Toch sah den zitternden kleinen Taucher nachdenklich an. Der Bursche wird nie wieder etwas taugen, sagte er sich, von Padang schicke ich ihn heim nach Ceylon. Brummend und schnaufend ging er in seine Kabine. Dort schüttete er aus einem Papiersäckchen zwei Perlen auf den Tisch. Die eine war klein wie ein Sandkorn, die andere erbsengroß, silbrig glänzend, mit einem Hauch von Rosa. Der Kapitän des holländischen Schiffes schnaubte und holte seinen irischen Whisky aus dem Schrank.
Gegen sechs Uhr ließ er sich wieder im Boot zum Kampong fahren und ging direkt zu der Kreuzung zwischen Kubu und Portugiesen. «Toddy», sagte er, und das war das einzige Wort, das er sprach. Er saß auf der Wellblechveranda, hielt ein dickwandiges Glas in den dicken Fingern und trank und spuckte und glotzte aus buschigen Brauen die gelben, mageren Hühner an, die auf dem schmutzigen, festgestampften Hof irgend etwas unter den Palmen aufpickten. Der Mischling hütete sich zu sprechen, er schenkte nur ein. Allmählich bekam der Kapitän blutunterlaufene Augen, und seine Finger bewegten sich nur noch sehr schwerfällig. Es war beinahe Dämmerung, als er aufstand und die Hosen zurechtschob.
«Gehen Sie schon schlafen, Kapitän?» fragte die Kreuzung zwischen Teufel und Satan höflich.
Der Kapitän stieß einen Finger in die Luft. «Das möcht ich mir doch mal anschauen», sagte er, «daß es auf der Welt Teufel geben soll, die ich noch nicht kenne. Du, wo ist hier dieser verdammte Südwesten?»
«Dort», zeigte der Mischling. «Wohin gehen Sie, Herr?»
«In die Hölle», grunzte Kapitän J. van Toch. «Devil Bay ansehen.»
An diesem Abend begann das absonderliche Wesen Kapitän J. van Tochs. In den Kampong kam er erst mit der Morgendämmerung zurück. Er sprach kein Wort und ließ sich zum Schiff fahren, wo er sich bis zum Abend in seine Kabine einschloß. Das fiel vorläufig noch niemandem auf, denn die Kandong Bandoeng hatte eine Menge von dem Segen der Insel Tana Masa zu verladen (Kopra, Pfeffer, Kampfer, Guttapercha, Palmöl, Tabak und Arbeitskräfte). Als er jedoch am Abend die Meldung empfing, die gesamte Ware sei verladen, schnaubte er nur und sagte: «Das Boot. Zum Kampong.» Und wieder kehrte er erst mit der Morgendämmerung zurück. Der Schwede Jensen, der ihm an Bord half, fragte eigentlich nur aus Höflichkeit: «Also heute geht es weiter, Kapitän?» Der Kapitän drehte sich um, als hätte er ihn in den Hintern gestochen. «Was geht dich das an?» fertigte er ihn ab. «Kümmre dich um deine eigenen verdammten Angelegenheiten!» Den ganzen Tag lag die Kandong Bandoeng, einen Knoten von der Küste Tana Masas entfernt, untätig vor Anker. Am Abend trudelte der dicke Kapitän aus seiner Kabine und befahl: «Das Boot. Zum Kampong.» Der kleine Grieche Zapatis blickte ihm mit einem blinden und einem schielenden Auge nach. «Jungs», krähte er, «entweder hat unser Alter drüben ein Frauenzimmer oder er ist rein verrückt geworden.» Der Schwede Jensen runzelte die Stirn. «Was geht dich das an?» fertigte er Zapatis ab. «Kümmre dich um deine eigenen verdammten Angelegenheiten!» Dann nahm er zusammen mit dem Isländer Gudmundson einen kleinen Kahn, und sie ruderten in der Richtung Devil Bay davon. Sie verbargen sich mit ihrem Kahn hinter Felsblöcken und warteten. In der Bucht ging der Kapitän auf und ab, er schien jemanden zu erwarten. Von Zeit zu Zeit blieb er stehen und rief etwas wie «ts, ts, ts». – «Schau mal», sagte Gudmundson und wies auf das Meer, das nun strahlend rot und golden im Sonnenuntergang lag. Jensen zählte zwei, drei, vier, sechs sichelscharfe Flossen, die zur Devil Bay zogen. «Herrgott», brummte Jensen, «Haifische gibt’s hier!» Ab und zu tauchte eine der Sicheln unter, über dem Wasser schlug der Schwanz, unter dem Wasser gab es einen heftigen Wirbel. Dann sprang der Kapitän J. van Toch am Ufer wütend herum, fluchte, was das Zeug hielt, und drohte den Haifischen mit der Faust. Danach kam die kurze tropische Abenddämmerung, und der Mond stieg über der Insel auf; Jensen ergriff das Ruder und lenkte den Kahn näher zum Ufer, bis auf einen Furlong. Der Kapitän saß nun auf einem Felsblock und machte «ts, ts, ts». Etwas bewegte sich rings um ihn, aber was, konnte man nicht recht erkennen. Sieht wie Seehunde aus, dachte Jensen, aber Seehunde kriechen anders. Das da tauchte aus dem Wasser zwischen den Felsblöcken auf, tappelte am Ufer herum und wiegte den Körper wie Pinguine. Jensen ruderte leise und hielt einen halben Furlong vom Kapitän entfernt. Ja, der Kapitän sagte etwas, aber der Teufel soll verstehen, was; wahrscheinlich war es Malaiisch oder Tamulisch. Jetzt streckte er die Arme aus, als ob er den Seehunden etwas zuwürfe. (Aber es sind ja gar keine Seehunde, sagte sich Jensen hartnäckig.) Und dazu quasselte er Chinesisch oder Malaiisch. In diesem Augenblick entglitt Jensen das erhobene Ruder und klatschte auf das Wasser. Der Kapitän hob den Kopf, stand auf und ging ungefähr dreißig Schritte zum Wasser; plötzlich begann es zu blitzen und zu krachen; der Kapitän schoß mit seinem Browning in Richtung des Bootes. Beinahe gleichzeitig rauschte, wirbelte, klatschte es in der Bucht, als sprängen tausend Seehunde ins Wasser; aber da legten sich Jensen und Gudmundson schon in die Riemen und jagten ihr Boot um die nächste Ecke, daß es nur so pfiff. Als sie auf das Schiff zurückkamen, sagten sie nichts. Diese Nordländer können schweigen! Gegen Morgen kehrte auch der Kapitän zurück, finster und wutschnaubend, aber er sprach kein Wort. Nur als ihm Jensen an Bord half, begegneten sich zwei Paare blauer Augen in einem kühlen, forschenden Blick.
«Jensen», sagte der Kapitän.
«Ja, Herr.»
«Heute fahren wir.»
«Ja, Herr.»
«In Surabaja bekommen Sie Ihr Buch.»
«Ja, Herr.»
Das war alles. An jenem Tage fuhr die Kandong Bandoeng nach Padang. Von Padang sandte Kapitän J. van Toch seiner Firma nach Amsterdam ein Päckchen, das er auf zwölfhundert Pfund Sterling versicherte. Zugleich das telegrafische Gesuch um ein Jahr Urlaub. Dringende gesundheitliche Gründe und so weiter. Dann streifte er in Padang herum, bis er den Mann fand, den er suchte. Es war ein Wilder aus Borneo, ein Dajak, den von Zeit zu Zeit englische Reisende als Haifischjäger mieteten, des Schauspiels halber; denn der Dajak arbeitete noch in der alten Weise, nur mit einem langen Messer bewaffnet. Sicher war er ein Menschenfresser, aber er hatte seine feste Taxe: fünf Pfund für den Haifisch außer der Verpflegung. Übrigens bot er einen furchteinflößenden Anblick, seine beiden Arme, die Brust und die Oberschenkel waren von der Haut der Haifische abgeschürft, in Nase und Ohren trug er Haifischzähne als Schmuck. Er wurde allgemein Shark genannt.
Mit diesem Dajak übersiedelte Kapitän J. van Toch auf die Insel Tana Masa.
2 Herr Golombek und Herr Valenta
Es war ein heißer Redaktionssommer, in dem sich nichts, aber auch rein gar nichts ereignet, in dem keine Politik gemacht wird, in dem es nicht einmal eine europäische Situation gibt. Und doch erwarten auch in dieser Zeit die Zeitungsleser, die in einer Agonie von Langeweile an den Ufern der Gewässer oder im spärlichen Schatten der Bäume liegen, von Hitze, Natur, ländlicher Ruhe und überhaupt dem gesunden und einfachen Urlauberleben demoralisiert, täglich neu enttäuscht, wenigstens in der Zeitung etwas Neues, Erfrischendes zu finden, etwa einen Mord oder einen Krieg oder ein Erdbeben, kurz etwas; und wenn sie es nicht finden, werfen sie die Zeitung hin und erklären empört, daß in dieser Zeitung nichts, aber auch rein gar nichts steht und daß es überhaupt nicht die Mühe lohnt, sie zu lesen, und daß sie sie nicht mehr abonnieren werden.
Inzwischen sitzen in den Redaktionen einsam und verlassen fünf bis sechs Leute, denn die übrigen Kollegen sind auch auf Urlaub, und auch sie werfen empört die Zeitung hin und beschweren sich, daß jetzt in der Zeitung nichts, aber auch rein gar nichts steht. Und aus der Setzerei kommt der Herr Metteur und sagt vorwurfsvoll: «Meine Herren, meine Herren, wir haben für morgen noch keinen Leitartikel.»
«Na, dann geben Sie, sagen wir … den Artikel … über die wirtschaftliche Lage in Bulgarien hinein», meint einer der verlassenen Herren.
Der Herr Metteur seufzt tief auf: «Und wer soll so etwas lesen, Herr Redakteur? Schon wieder wird im ganzen Blatt nichts zu lesen sein.»
Die sechs verlassenen Herren heben die Augen zur Decke, als ob man dort etwas Lesbares entdecken könnte.
«Ja, wenn irgend etwas los wäre», meint der eine unsicher.
«Oder … wenn man … irgendeine … interessante Reportage hätte», wirft der andere hin.
«Worüber?»
«Das weiß ich nicht.»
«Oder man könnte … sich ein neues Vitamin ausdenken», brummt ein dritter.
«Jetzt im Sommer?» entgegnet der vierte. «Mensch, Vitamine, das ist zu gebildet, das paßt eher für den Herbst …»
«Himmel, ist das eine Hitze», gähnt der fünfte. «Es müßte etwas aus dem Polargebiet sein.»
«Aber was?»
«Ach, so etwas wie dieser Eskimo-Welzl. Erfrorene Finger, ewiges Eis und solches Zeugs.»
«Leicht gesagt», meint der sechste. «Aber woher nehmen?» In der Redaktion verbreitete sich hoffnungslose Stille.
«Ich war Sonntag in Jevíčko …», ließ sich endlich zögernd der Herr Metteur vernehmen.
«Na, und?»
«Dort, erzählt man, ist irgendein Kapitän Vantoch auf Urlaub. Er soll in Jevíčko geboren sein.»
«Was für ein Vantoch?»
«So ein dicker. Er soll Kapitän eines Schiffes sein. Man sagt, er hat dort irgendwo Perlen gefischt.»
Herr Golombek sah Herrn Valenta an.
«Und wo hat er sie gefischt?»
«Auf Sumatra … und Celebes … überhaupt irgendwo dort unten. Dreißig Jahre soll er schon da unten leben.»
«Mensch, das ist eine Idee», sagte Herr Valenta. «Das könnte eine prima Reportage geben. Golombek, fahren wir?»
«Na, wir können’s ja versuchen», meinte Herr Golombek und glitt von dem Tisch, auf dem er gesessen hatte.
«Der Herr dort ist es», sagte der Wirt in Jevíčko.
An einem Tisch im Garten saß dick und behäbig mit gespreizten Beinen ein Herr mit einer weißen Mütze, trank Bier und kritzelte versonnen mit seinem dicken Zeigefinger auf dem Tisch herum. Die beiden Herren traten näher.
«Redakteur Valenta.»
«Redakteur Golombek.»
Der dicke Herr hob die Augen. «What? Was?»
«Ich bin Redakteur Valenta.»
«Und ich Redakteur Golombek.»
Der dicke Herr erhob sich würdevoll. «Captain van Toch. Very glad. Setzt euch, Jungs.»
Die beiden Herren setzten sich bereitwillig und legten die Schreibblocks vor sich auf den Tisch.
«Was wollt ihr zu trinken, Jungs?»
«Himbeerwasser», sagte Herr Valenta.
«Himbeerwasser?» wiederholte der Kapitän ungläubig.
«Warum? Herr Wirt, bringen Sie Bier. – Also was wollt ihr eigentlich?» fragte er und stützte die Ellbogen auf den Tisch.
«Ist es wahr, Herr Vantoch, daß Sie hier geboren sind?»
«Yes. Bin hier geboren.»
«Und wie sind Sie eigentlich aufs Meer gekommen?»
«Tjaa, via Hamburg.»
«Wie lange sind Sie schon Kapitän?»
«Zwanzig Jahre, Junge. Hier hab ich die Papiere», sagte er mit Nachdruck und schlug an seine Brusttasche. «Ich kann sie euch zeigen.»
Herr Golombek hatte die größte Lust, sich einmal die Papiere eines Kapitäns anzusehen, unterdrückte sie jedoch.
«In diesen zwanzig Jahren haben Sie sicher ein schönes Stück Welt gesehen, Herr Kapitän, nicht wahr?»
«Yes. ’n schönes Stück. Tjaa!»
«Was denn?»
«Java, Borneo, The Philippines. Fidji Islands. Salomon Islands, Carolines, Samoa. Damned Clipperton Islands. A lot of damned islands, Jungs. Warum?»
«Nur so. Weil es interessant ist. Wir möchten gern mehr von Ihnen hören, wissen Sie?»
«Yes. Also nur so, hm?» Der Kapitän heftete seine hellblauen Augen auf die beiden. «Also Sie sind von der P’lis, was die Polizei ist, wie?»
«Nein, Herr Kapitän. Wir sind von der Zeitung.»
«Ach so, von der Zeitung, reporters, wie? Also schreiben Sie: Captain J. van Toch, Kapitän des Schiffes Kandong Bandoeng.»
«Wie?»
«Kandong Bandoeng, Hafen Surabaja. Zweck der Reise: vacances – wie sagt man das?»
«Urlaub.»
«Yes. Donnerwetter noch mal, Urlaub. Also dann geben Sie’s eben in diese Zeitung, wo drinsteht, wer angekommen ist. Und jetzt steckt die notes in die Tasche, Jungs. Your health.»
«Herr Vantoch, wir sind zu Ihnen gekommen, damit Sie uns etwas aus Ihrem Leben erzählen.»
«Warum?»
«Wir wollen das in die Zeitung geben. Die Leute interessieren sich sehr dafür, von fernen Inseln zu lesen, und was ein Landsmann von ihnen, ein Tscheche aus Jevíčko, dort alles gesehen und erlebt hat.»
Der Kapitän nickte. «Das ist wahr. Junge, ich bin der einzige Captain aus ganz Jevíčko. Tjaa, stimmt schon. Angeblich soll ja noch ein Kapitän von hier sein, von … von … den Riesenschaukeln, aber ich glaube», fügte er vertraulich hinzu, «der ist gar kein richtiger Captain. Das wird nämlich nach der Tonnage gemessen, weißt du?»
«Und was für eine Tonnage hatte Ihr Schiff?»
«Zwölftausend Tonnen, junger Mann.»
«Da waren Sie ein großer Kapitän, nicht wahr?»
«Ja, sehr groß», sagte der Kapitän würdevoll. «Jungs, habt ihr Geld?»
Die beiden Herren sahen einander etwas unsicher an. «Ja, aber nur wenig. Brauchen Sie welches, Kapitän?»
«Yes. Ich könnt schon welches gebrauchen.»
«Also schauen Sie! Wenn Sie uns recht viel erzählen, schreiben wir es in die Zeitung, und Sie bekommen Geld dafür.»
«Wieviel?»
«Na, kann sein … so um tausend herum», sagte Herr Golombek großzügig.
«Pounds Sterling?»
«Nein, Kronen.»
Kapitän van Toch schüttelte den Kopf. «Also dann nicht. Die hab ich selber, junger Mann.» Er fischte aus seiner Hosentasche ein dickes Bündel Banknoten. «See?» Dann stützte er die Ellbogen auf den Tisch und neigte sich zu den beiden Herren vor. «Hört mal, ich hätte für euch a big business. Wie sagt man das?»
«Ein großes Geschäft.»
«Yes. Ein großes Geschäft. Aber da müßten Sie mir fünfzehn … halt, wart mal, fünfzehn, sechzehn millions Kronen geben. Na?»
Die beiden Herren sahen einander wieder unsicher an. Redakteure haben ihre Erfahrungen mit den sonderbarsten Sorten von Narren, Schwindlern und Erfindern.
«Halt», sagte der Kapitän. «Ich kann euch etwas zeigen.» Er fischte mit seinen dicken Fingern in der Westentasche herum, zog etwas heraus und legte es auf den Tisch. Es waren fünf rosig angehauchte, kirschkerngroße Perlen. «Versteht ihr was von Perlen?»
«Was kann so etwas kosten?» hauchte Herr Valenta.
«Well, lots of money. Junge. Aber die da hab ich nur … als Probe mitgebracht, als Muster. Also macht ihr mit?» fragte er und reichte ihnen über den Tisch seine breite Hand.
Herr Golombek seufzte. «Herr Vantoch, so viel Geld …»
«Halt», unterbrach ihn der Kapitän. «Ich weiß, du kennst mich nicht; aber frag in Surabaja, in Batavia, in Padang oder wo du willst nach Captain van Toch … Geh nur hin und frag, und jeder wird dir sagen, yes, Captain van Toch, he is as good as his word.»
«Herr Vantoch, wir glauben Ihnen», protestierte Herr Golombek. «Aber …»
«Halt», befahl der Kapitän. «Ich weiß, du willst dein gutes Geld nicht so ohne weiters hineinstecken; brav, mein Junge. Aber du legst es in einem Schiff an, see? Du kaufst das Schiff, du bist selbst der ship-owner, und mitfahren kannst du auch; ja, kannst du, damit du siehst, wie ich für dein Geld damit wirtschafte. Aber das Geld, das wir dabei machen, wird fifty-fifty geteilt. Das ist doch ein ehrliches business, oder nicht?»
«Aber Herr Vantoch», brachte schließlich Herr Golombek etwas bedrückt hervor, «so viel Geld haben wir ja gar nicht!»
«Tjaa, das ist etwas anderes», sagte der Kapitän. «Sorry. Na, dann weiß ich aber wirklich nicht, warum ihr eigentlich zu mir gekommen seid.»
«Damit Sie uns etwas erzählen, Kapitän. Sie müssen doch so allerlei Erfahrungen gemacht haben …»
«Hab ich, hab ich, Junge. Verdammt viel Erfahrungen hab ich gemacht.»
«Haben Sie einmal einen Schiffbruch erlebt?»
«What? Meinen Sie ship-wrecking? Na also, das denn doch nicht. Was denkst du dir eigentlich? Wenn du mir ein gutes Schiff gibst, dann kann ihm nichts passieren. Kannst ja in Amsterdam nach meinen references fragen. Geh nur hin und frag.»
«Und die Eingeborenen? Haben Sie die Eingeborenen kennengelernt?»
Kapitän van Toch schüttelte den Kopf. «Nichts für gebildete Leute. Das kann ich euch nicht erzählen.»
«Dann erzählen Sie uns doch etwas anderes.»
«Tjaa, erzählen», brummte der Kapitän argwöhnisch.
«Und ihr verkauft es dann irgendeiner Company, und die schickt ihre eigenen Schiffe. Ich sag dir, my lad, die Menschen sind große Gauner. Und die größten Gauner sind die bankers in Colombo.»
«Waren Sie oft in Colombo?»
«Ja, oft. Und in Bangkok auch, und in Manila. – Jungs», sprach er plötzlich, «ich wüßte von einem Schiff. ’n feines Schiff, und für das Geld billig. Es liegt in Rotterdam. Kommt es euch doch mal ansehen. Rotterdam ist gleich da drüben.» Er wies mit dem Daumen über die Schulter.
«Schiffe werden jetzt spottbillig verkauft, Jungs. Als altes Eisen! Es ist nur sechs Jahre alt und mit Dieselmotor. Wollt ihr’s euch nicht ansehen?»
«Wir können nicht, Herr Vantoch.»
«Seid ihr aber komische Leute», seufzte der Kapitän und schneuzte sich schallend in sein himmelblaues Taschentuch.
«Und wißt ihr nicht hier vielleicht jemand, der so ’n Schiff kaufen möchte?»
«Hier in Jevíčko?»
«Tjaa, oder irgendwo hier im Dreh. Ich möchte nämlich das große Geschäft jemandem hier zuschanzen, in my country.»
«Das ist wirklich schön von Ihnen, Kapitän …»
«Tjaa, die andern da drüben sind mordsmäßige Gauner. Und sie haben kein Geld. Ihr von den newspapers müßt doch die großen Leute hier kennen, so ’ne bankers und ship-owners, wie nennt man das nur schnell? Reeder, nicht wahr?»
«Ja, Reeder. Aber wir kennen keine, Herr Vantoch.»
«Schade», der Kapitän wurde ganz traurig.
Herrn Golombek fiel plötzlich etwas ein. «Kennen Sie nicht vielleicht Herrn Bondy?»
«Bondy? Bondy?» überlegte Kapitän van Toch. «Wart mal, den Namen müßt ich irgendwie kennen. Bondy. Tjaa, in London gibt es eine Bond Street, dort leben sehr reiche Leute. Hat er nicht ein Geschäft in der Bond Street, euer Herr Bondy?»
«Nein, er lebt in Prag, aber geboren ist er, glaube ich, hier in Jevíčko.»
«Teufel noch mal», rief der Kapitän erfreut, «du hast ganz recht, Junge. Der hatte am Marktplatz einen Schnittwarenladen. Ja, Bondy – wie hieß er nur? Max. Max Bondy. Also er hat jetzt ein Geschäft in Prag?»
«Nein, das war wohl sein Vater. Dieser Bondy heißt G. H. Präsident G. H. Bondy, Kapitän.»
«G. H.?» Der Kapitän schüttelte den Kopf. «G. H. war hier keiner. Höchstens, daß es der Gustel Bondy wär – aber der war kein Präsident. War so ein sommersprossiges Jüngelchen. Der kann’s also nicht gut sein.»
«Er wird es schon sein, Herr Vantoch. Sie haben ihn doch jahrelang nicht gesehen.»
«Tjaa, da hast du recht. Wie die Zeit vergeht», pflichtete der Kapitän bei. «Vierzig Jahre, Junge. Kann schon sein, daß der Gustel jetzt groß ist. Und was ist er?»
«Er ist Präsident des Verwaltungsrates der MEAS, wissen Sie, das ist die große Fabrik für Kessel und solche Sachen, und auch Präsident von ungefähr zwanzig anderen Aktiengesellschaften und Kartellen. Ein sehr großer Herr, Herr Vantoch. Man nennt ihn allgemein einen Kapitän unserer Industrie.»
«Kapitän?» wunderte sich Captain van Toch. «Da bin ich also doch nicht der einzige Kapitän aus Jevíčko! Teufel, Teufel, also ist der Gustel auch Captain. Da möcht ich aber sehr gern mit ihm zusammenkommen. Und hat er Geld?»
«Du lieber Himmel! Geld wie Heu, Herr Vantoch. Der hat gut und gern seine paar hundert Millionen. Der reichste Mann im Land.»
Kapitän van Toch wurde tiefernst. «Und auch Captain. Da dank ich dir, Junge. Werd also mal zu ihm hinsegeln, zu diesem Bondy. Tjaa, Gustel Bondy, I know. So ’n kleines Kerlchen. Und jetzt ist er Captain G. H.Bondy. Ja, ja, wie die Zeit vergeht», seufzte er melancholisch.
«Herr Kapitän, wir müssen gehen, damit uns der Abendzug nicht davonfährt …»
«Na, da begleit ich euch natürlich zum Hafen», sprach der Kapitän und begann den Anker zu lichten. «Hat mich sehr gefreut, daß Sie gekommen sind, meine Herren. Ich kenne einen Redakteur in Surabaja, ein braver Mensch, ja, a good friend of mine. Schrecklicher Säufer, Jungs. Wenn ihr wollt, kann ich euch eine Stellung bei der Zeitung in Surabaja verschaffen. Nein? Na, wie ihr wollt.»
Und als der Zug sich in Bewegung setzte, winkte Kapitän van Toch langsam und feierlich mit seinem riesigen blauen Taschentuch. Dabei fiel ihm eine große, unregelmäßige Perle in den Sand. Eine Perle, die nie wieder gefunden wurde.
3 G. H. Bondy und sein Landsmann
Je größer der Herr, desto weniger steht bekanntlich auf dem Schild an seiner Tür. Beim alten Herrn Max Bondy in Jevíčko zum Beispiel mußte noch über dem Laden, zu beiden Seiten der Tür und sogar auf den Schaufenstern in großen Buchstaben gemalt stehen, dies sei das Geschäft Max Bondys, Schnittwaren aller Art, Brautausstattungen, Webwaren, Handtücher, Geschirrtücher, Tischtücher und Bettüberzüge, Kattun und Gradel, I a Tuch, Seide, Vorhänge, Lambrequins, Posamenterie und sämtliches Schneiderzubehör. Gegründet 1885. – Sein Sohn, G. H. Bondy, der Industriekapitän, Präsident der Aktiengesellschaft MEAS, Kommerzienrat, Börsenrat, Vizepräsident des Industriellenverbandes, Consuláto de la República Ecuador, Mitglied zahlreicher Verwaltungsräte usw. usw., hat an seinem Haus nur eine kleine schwarze Glastafel mit der Aufschrift in Goldbuchstaben:
Nichts weiter. Nur Bondy. Mögen andere an ihr Tor schreiben Julius Bondy, Vertreter der Firma General Motors, oder MUDr. Ervín Bondy oder S. Bondy & Co.; aber es gibt nur einen einzigen Bondy, der einfach Bondy ist ohne nähere Einzelheiten. (Ich glaube, der Papst hat an seinem Tor auch nichts als Pius stehen, ohne Titel und ohne Zahl. Und Gott hat überhaupt keine Tafel, weder im Himmel noch auf Erden. Du mußt von selbst erkennen, Mensch, daß ER da wohnt. Aber das gehört eigentlich nicht hierher und sei nur nebenbei bemerkt.)
Vor dieser Glastafel blieb eines Tages ein Herr in einer weißen Matrosenmütze stehen und wischte sich mit einem blauen Taschentuch die mächtige Fleischmasse seines Nackens. Verdammt vornehmes Haus, dachte er sich, und zog etwas unsicher an dem Messingknopf der Glocke.
In der Tür erschien der Portier Povondra, maß den dicken Herrn mit den Augen von den Schuhen bis zu den goldenen Tressen der Mütze und sagte reserviert: «Bitte?»
«Sag mal, Junge», rief der Herr mit fröhlich schallender Stimme, «wohnt hier ein Herr Bondy?»
«Sie wünschen?» fragte Herr Povondra eisig.
«Sagen Sie ihm, Captain J. van Toch aus Surabaja möcht mit ihm sprechen. Tjaa», erinnerte er sich, «da ist meine Karte.» Und er überreichte Herrn Povondra eine Visitenkarte mit geprägtem Anker und dem Namen in Druckschrift:
Herr Povondra senkte den Kopf und zögerte. Soll ich ihm sagen, Herr Bondy ist nicht zu Hause? Oder: Bedaure, aber Herr Bondy hat gerade eine wichtige Konferenz? Es gibt Besuche, die man melden muß, und andere, die ein rechtschaffener Portier selbst erledigt. Herr Povondra fühlte ein peinliches Versagen seines Instinkts, nach dem er sich in solchen Fällen zu richten pflegte; dieser dicke Herr paßte in keine der gewohnten Kategorien unangemeldeter Besuche; er schien weder ein Handelsvertreter noch Funktionär eines Wohltätigkeitsvereins zu sein. Unterdessen schnaufte Kapitän van Toch und wischte sich mit dem Taschentuch die Glatze. Dazu zwinkerte er so arglos mit seinen blaßblauen Augen – Herr Povondra entschloß sich plötzlich, die ganze Verantwortung auf sich zu nehmen. «Bitte, treten Sie ein», sagte er, «ich werde Sie Herrn Kommerzienrat melden.»
Captain J. van Toch wischte sich mit seinem blauen Taschentuch die Stirn und sah sich in der Eingangshalle um. Donnerwetter, ist der Gustel eingerichtet! Das ist ja wie der saloon auf einem der ships, die von Rotterdam nach Batavia fahren. Eine Stange Geld muß das gekostet haben. Und so ein kleines, sommersprossiges Jüngelchen war er, wunderte sich der Kapitän.
Inzwischen betrachtete G. H. Bondy in seinem Arbeitszimmer versonnen die Visitenkarte des Kapitäns. «Was will er?» fragte er argwöhnisch.
«Ich weiß nicht, Herr Kommerzienrat», murmelte Herr Povondra ehrerbietig.
Herr Bondy hält noch immer die Visitenkarte in der Hand. Geprägter Schiffsanker. Captain J. van Toch, Surabaja – wo liegt eigentlich dieses Surabaja? Irgendwo auf Java? Ein Hauch der Ferne berührte Herrn Bondy. Kandong Bandoeng. Das klingt wie ein Gongschlag. Surabaja. Und gerade heute ist solch eine tropische Hitze. Surabaja.
«Ich lasse bitten», befiehlt Herr Bondy.
In der Tür steht ein Koloß von einem Mann mit Kapitänsmütze und salutiert. G. H. Bondy geht ihm entgegen.
«Very glad to meet you, Captain. Please come in.»
«Nazdar, nazdárek, ’n Tag, Herr Bondy», ruft der Kapitän erfreut.
«Sie sind Tscheche?» fragt Herr Bondy verwundert.
«Yes, Tscheche. Aber wir kennen uns doch, Herr Bondy. Von Jevíčko her. Kaufmann Vantoch, do you remember?»
«Richtig, richtig», freut sich G. H. Bondy etwas zu laut, er verspürt eine leichte Enttäuschung. (Also ist er gar kein Holländer!) «Kaufmann Vantoch, am Marktplatz, nicht wahr? Sie haben sich gar nicht verändert, Herr Vantoch. Immer noch der alte. Was macht das Geschäft?»
«Thanks», sagte der Kapitän höflich. «Mein Vater ist schon lange gegangen, wie sagt man –»
«Gestorben? Aber, aber! Ganz richtig, Sie müssen der Sohn sein …» Herrn Bondys Augen beleben sich in plötzlicher Erinnerung. «Menschenskind, sind Sie nicht der Vantoch, der sich in Jevíčko immer mit mir gebalgt hat, als wir noch Jungs waren?»
«Yes, das werd ich schon sein, Herr Bondy», nickte der Kapitän ernst. «Deshalb mußt ich ja von zu Hause fort, nach Moravská Ostrava.»
«Wir haben uns tüchtig gebalgt. Aber Sie waren der Stärkere», erkannte Herr Bondy sportlich an.
«Yes, stimmt. Sie waren halt so ein schwacher Knirps, Herr Bondy. Ich hab Ihnen gehörig den Hintern verhauen, ganz gehörig.»
«Das haben Sie, alles was recht ist», schwelgte G. H. Bondy bewegt in Jugenderinnerungen. «Aber setzen Sie sich doch, alter Freund! Nett von Ihnen, daß Sie an mich gedacht haben! Wo kommen Sie denn plötzlich her?»
Kapitän van Toch ließ sich würdevoll in einem Ledersessel nieder und legte die Mütze auf den Fußboden. «Ich nehme hier meine Ferien, Herr Bondy. So ist das, tjaa. That’s so.»
«Wissen Sie noch», versenkte sich Herr Bondy in Erinnerungen, «wie Sie mir immer nachgerufen haben: ‹Stinkerter Jud› …?»
«Yes», sprach der Kapitän und schneuzte sich laut und gerührt in sein blaues Taschentuch. «Oh, yes. Das waren schöne Zeiten, Junge. Aber was nützt das alles, die Zeit vergeht. Jetzt sind wir beide alte Leute und beide Captains.»