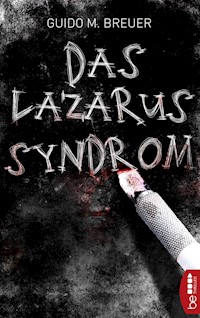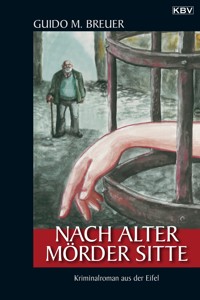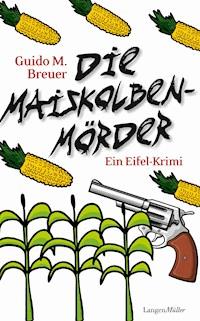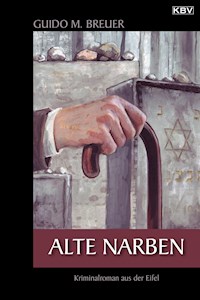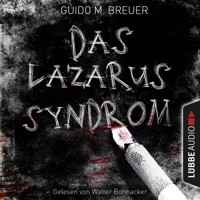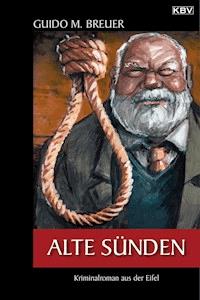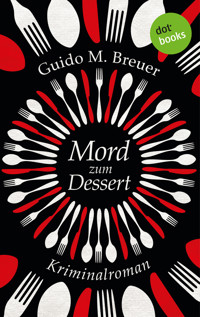6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Guido M. Breuer Publishing
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Sie entwickeln außergewöhnliche Fähigkeiten. Sie könnten zu Superhelden werden oder zu Marionetten einer Macht, die sie nicht verstehen. Kriminalkommissarin Bilke Sand jagt einen Serienmörder, der sich dem Zugriff der Polizei auf unerklärliche Weise zu entziehen vermag. Und Bilke teilt mehr mit ihm als ihr lieb ist. Neurobiologin Ana Maria Ojeda baut eine Art von Verbindung zu dem Delfin Bella 3A auf, die jedes erklärbare Maß übersteigt. Schauspielstudent Benjamin Shanks entdeckt eine übermenschliche Fähigkeit an sich, deren Erkundung sein Leben in eine Katastrophe verwandelt. Die Elitesoldatin Judith Weizman entwickelt während eines Einsatzes ungeahnte Kräfte, die sie an allem, woran sie glaubt, zweifeln lassen. Die Physikerin Yetunde Kourouma erforscht einen Ort, an dem die Naturgesetze außer Kraft gesetzt scheinen. Sie alle suchen Antworten, aber sie kennen die richtige Frage noch nicht: Wer oder was ist das Kollektiv?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 431
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Rheinkilometer 636, Deutschland 50° 36' 10.829" N / 7° 12' 41.627" O
Es war so still, dass Bilke Sand das Blut in ihren Ohren rauschen hören konnte. Oder war es vielleicht doch das kaum wahrnehmbare Fließen des Wassers? Nur wenige Zentimeter vor ihr zog ein Tausendfüßler seine Bahn. Die wellenförmigen Bewegungen der vielen kleinen Beinchen machten ein Geräusch, das sich unmerklich mit dem allgegenwärtigen Atem der Welt vermischte und darin aufging. Ein langes Wolkenband quälte sich über den Nachthimmel und gab Stück für Stück den Vollmond frei. Es wirkte beinahe so, als würde jemand mit unsichtbarer Hand einen Vorhang öffnen. Der Strom floss ölig und schwarz dahin. Bilke spähte angestrengt, suchte die Fenster des am Ufer stehenden Hauses nach Bewegungen ab. Nichts zu sehen. An der gegenüberliegenden Rheinseite stachen hin und wieder die Lichtfinger fahrender Autos durch die Dunkelheit, so weit entfernt, dass das Motorengeräusch kaum vom Krabbeln des Tausendfüßlers zu unterscheiden war. Das Tier war mittlerweile irgendwo im Gras verschwunden. Dann – endlich – doch etwas.
Eine heisere Frauenstimme, die fast schrill die Nacht durchschnitt. Es folgte das dröhnende Lachen einer tiefen Männerstimme, störend und nervig.
»Verdammt, was ist das?« zischte Bilke tonlos. »Wir haben doch den Abschnitt abgeriegelt!«
»Beruhige dich, Bilke«, flüsterte der neben ihr liegende Mann, ohne das Nachtsichtgerät abzusetzen. »Was ist los mit dir? Das sind zwei Kollegen des Sondereinsatzkommandos. Du hast das selbst vorgeschlagen, damit der Nomade keinen Verdacht schöpft.«
Bilke Sand biss sich auf die Unterlippe und schüttelte den Kopf. Natürlich. Dreißig Stunden ohne Schlaf in rastloser Jagd nach diesem Schwein hatte sie zwar in diese aussichtsreiche Zugriffssituation, aber dafür auch an den Rand der Erschöpfung gebracht. Sie schloss für einen Moment die brennenden Augen. Natürlich wusste sie, dass es geplant war, das Haus zu stürmen, exakt zwei Minuten nachdem das angebliche Paar vorübergegangen sein würde. Wie hatte sie das vergessen können?
Kriminalhauptkommissar Sebastian Kirsch unterbrach nun doch kurz die Beobachtung und sah sie an. Bilke konnte trotz der Dunkelheit in seinem Gesicht lesen. Da war keine Spur von Ärger eines Vorgesetzen über ihre Fehlleistung. Nur echte Besorgnis. Sie spürte eine kleine Insel der Wärme in der Nacht.
»Alles in Ordnung mit dir?«
»Ja, alles klar«, antwortete Bilke fast unhörbar leise. Nach zwei heftigen Herzschlägen fügte sie noch ein »Danke« hinzu. Vor dem alleinstehenden Haus am Rheinufer taten die beiden Kollegen so, als seien sie etwas aufgekratzt und albern.
Sie passierten den Hauseingang, machten nicht den Fehler, dann zu verstummen, sondern redeten weiter belangloses Zeug, während sie sich langsam vom Haus entfernten. Eine Fledermaus schwirrte über die Köpfe der beiden hinweg. Bilke vernahm leise, aber deutlich die in hoher Frequenz und schneller Folge ausgestoßenen Orientierungsrufe des Tiers.
Es war auf der Jagd nach Insekten, die von den Menschen angezogen wurden. Das angebliche Pärchen ließ ein lautes Lachen hören, dann rief die Kollegin wie übermütig aus:
»Du bist mir vielleicht einer!«
Das war das verabredete Codewort für den Countdown.
»Also gut«, flüsterte Sebastian und startete den Timer seiner Armbanduhr. Bilke rückte noch einmal ihr Headset zurecht und aktivierte ihr Mikrofon für den Einsatzkanal, für den bis zu diesem Zeitpunkt Funkstille vereinbart worden war – so lange alles nach Plan lief.
»Zeit läuft. Einhundertzwanzig bis Zugriff.«
Sie lauschte den knappen Meldungen, die allesamt Bereitschaft signalisierten. Die Scharfschützen in Beobachtungsposition, das Team, das sich für das Eindringen in Fenster und Hauseingang bereithielt, ebenso das Rheinstreifenboot der Wasserschutzpolizei und der Hubschrauber, der weit entfernt darauf wartete, sich nähern zu können, sobald der Sturm auf das Haus begonnen haben würde.
Jetzt stand der Vollmond völlig frei am Himmel und tauchte alles in ein unwirklich helles Licht. Leise fluchend regelte Sebastian die Empfindlichkeit seines Nachtsichtgerätes. Bilke presste nochmals mit aller Kraft die Lider herunter, um das Augenbrennen und das Gefühl der Müdigkeit in den Griff zu bekommen.
Ihre Muskulatur spannte sich bis zur Schmerzgrenze an. Ein Teil von ihr wünschte sich, zu denjenigen zu gehören, die sich jetzt langsam und lautlos dem Ziel näherten, um an vorderster Front so schnell als möglich in Aktion treten zu können. Wenn sie sich aber in diese Kollegen hineinversetzte, packte eine eiskalte Hand in ihren Magen, und sie war dankbar, erst mit der zweiten Welle in das Haus einzudringen, in dem sie dieses Monster wusste. Den Mann, dem sie seit über einem Jahr auf der Spur war, den man in der Mordkommission den Nomaden nannte, und der mehr Leichen hinterlassen hatte als jemals ein Mörder zuvor in ihrer Laufbahn. Sie konnte seine Präsenz spüren, so intensiv, dass sie fürchtete, er könnte sie ebenfalls wahrnehmen. Noch ein Grund, warum es gut war, hinter den erfahrenen Spezialisten des SEK zu bleiben. Die Nachtluft roch nach – nach irgend etwas, was sie nicht identifizieren konnte. Vielleicht war es das Flusswasser, vielleicht auch ihr eigener Schweiß, aber sie hätte schwören können, den Geruch von Blut in der Nase zu haben.
»Dreißig bis Zugriff«, hörte sie die Teamleaderin an der Hauswand flüstern, die jetzt das Kommando hatte. Noch einmal kontrollierte Bilke die Fenster, ob dort jemand herausschauen würde. Keine Bewegung. Die dunklen Gestalten schoben sich lautlos voran, jede Deckung ausnutzend. Bezogen Stellung an der Eingangstür. An den Fenstern. »Zehn.«
Bilkes rechte Hand tastete nach der Pistole. Die Walther PPQ war da, wo sie sein sollte. Natürlich, dessen war sie sich ohnehin bewusst, aber der kontrollierende Griff gab ihr einen Anflug von zusätzlicher Sicherheit.
»Drei – zwei – eins – Zugriff!«
Das Bersten der Fensterscheiben zerschnitt die Nacht, nur einen Sekundenbruchteil später flammten Scheinwerfer vom Wasser her auf. »Los!«, schrie Bilke völlig unnötig und sprang auf. Sebastian kam ebenfalls hoch und berührte sie flüchtig am Arm, bevor sie beide losrannten. Sie war schnell, ließ Sebastian hinter sich, hörte Schreie im Haus, Kommandos, aber keine Schüsse. Bilke spurtete über die Straße, dorthin, wo die Türe aufgebrochen worden war. Ein Kollege hatte dort mit dem Gewehr im Anschlag Position bezogen. Der Eingang war gesichert. Als Bilke in den Flur eingedrungen war, stoppte sie, um sich zu orientieren. Obwohl ihre Nerven aufs Äußerste gespannt waren und sie versuchte, jedes Detail der Wohnung in sich aufzunehmen, vernahm sie aus der Ferne das Blubbern des Helikopters, das merklich anschwoll. Durch ein flussseitiges Fenster drang das grelle Licht der Scheinwerfer, mit denen man vom Boot aus das Haus beleuchtete. Einen Moment war Bilke geblendet. Erschrocken erhob sie eine Hand vors Gesicht und richtete ihren Blick zu Boden.
»Küche gesichert«, hörte sie einen Ruf von links. »Bad gesichert!« kam die zweite Meldung. Eine Frau kam ihr entgegen, sie erkannte die Einsatzleiterin des SEK. »Wohnzimmer gesichert! Erdgeschoss klar. Wir gehen hoch!«
Bilke sah eine Treppe, die ins Obergeschoss führte. Sie erschrak nochmals. Irgendwie hatte sie gedacht, das dort schon längst jemand unterwegs wäre. Jetzt realisierte sie erst, dass sie viel früher losgerannt war, als Sebastian das vorher empfohlen hatte. Jetzt stand er neben ihr und legte eine Hand auf ihre Schulter. Das bedeutete wohl, dass sie warten sollte. Doch sie agierte so schnell, wie der Gedanke in ihr aufblitzte: Wer geht runter? Wo ist die Kellertreppe? Sie rannte nach links, fand sich schon nach wenigen Schritten in der Küche wieder. Hier ging es nicht weiter, mehr war da nicht. Von der anderen Seite hörte sie die Einsatzleiterin rufen:
»Hier gibt es keine Treppe nach unten! Keller negativ!« Sie wollte zurückrennen, stieß mit Sebastian zusammen, der ihr gefolgt war.
»Es gibt einen Keller, es gibt bestimmt einen Keller«, keuchte sie hektisch.
»Bilke.« Sebastians Stimme war so ruhig, wie es in diesem Moment nur möglich war. »Wir sind direkt am Rheinufer. Die Häuser hier haben oft keinen Keller.«
»Quatsch!«, schrie Bilke beinahe panisch. Sie konnte den Raum unter ihr körperlich spüren. Einen Raum, in dem es nach Flusswasser roch, nach Moder und – nach etwas anderem. Da war diese Präsenz, sie sprang Bilke an wie ein Raubtier. Eine eiskalte Hand schien sie zu würgen. Sie schüttelte die Beklemmung ab und sah sich gehetzt um. Nebenan brachen die Scheinwerfer des Polizeibootes durchs Fenster. Die Küche hatte kein Fenster in Richtung des Flusses. Warum nicht? Von oben hörte sie die Meldung: »Obergeschoss gesichert!«
Ihr Blick folgte dem Verlauf der Wand. Hinter der Küchentür weitete sich das Wohnzimmer zum Fluss hin. Warum war die Küche in dieser Richtung verkürzt? Sie starrte die Wand an, hinter der sich etwas zu bewegen schien. Bilke konnte es weder hören noch sehen, aber da war etwas zu spüren – so deutlich, als würde es sie durch eine Scheibe angrinsen. Ohne nachzudenken, riss sie die Waffe hoch und schoss. Dreimal drückte sie ab, sie fühlte irgendwie, wie die Projektile durch die Wand drangen, sich dabei leicht verformten und dahinter in etwas Weiches, Warmes schlugen. Sie wurde immer noch nicht von bewusstem Nachdenken geleitet, als sie gegen das vermeintliche Mauerwerk sprang, das sich als dünne Abtrennung entpuppte, und sah einen Schatten, der sich sehr schnell eine steile Treppe hinunter bewegte.
Sie jagte diesem Etwas noch zwei weitere Schüsse aus ihrer Walther PPQ hinterher und stolperte dann vorwärts. Im Schein des Mündungsfeuers hatte sie die Konturen der Treppenstufen erahnt. In der Hast verfehlte sie einen Tritt und kam zu Fall. Die Treppe war glücklicherweise sehr kurz, Bilke schlug gegen ein Hindernis und wurde so gestoppt, bevor sie im Sturz richtig Fahrt aufnehmen konnte.
»Hier unten, Küche!« hörte sie Sebastians kräftige Stimme wie durch einen dichten Nebel, dann stand er auch schon neben ihr und leuchtete mit einer Taschenlampe gegen die metallbeschlagene Holztür. Dahinter war ein Geräusch zu hören, der Nomade musste da sein. Bilke raffte sich auf, packte den Griff der Tür und zog daran, nachdem sie sich vergewissert hatte, dass Sebastian seine Waffe im Anschlag hatte. Die Tür war verriegelt. Der Griff hatte sich nass angefühlt. Sie betrachtete ihre Hand und sah das Blut, das im Schein des bläulichen LED-Strahlers eine unwirkliche Farbe annahm. Es war nicht ihres.
»Wir müssen hier unten eine Tür aufbrechen!«, brüllte Sebastian. Bilke drückte sich zur Seite, als die Männer mit dem Gerät, das sie schon für den Hauseingang benutzt hatten, herunter kamen. In Sekunden war die alte Tür zerstört. Die Waffen, die in den winzigen Kellerraum gerichtet waren, fanden kein Ziel. Bilke trat nach den Kollegen ein und betätigte den Lichtschalter. Auf dem Boden lag ein Bündel blutiger Kleidung, ein Wasserhahn war aufgedreht, das Rinnsal floss über den Zementboden und verschwand in einem handtellergroßen vergitterten Abfluss. Zum Rhein hin gab es keinen Ausgang, lediglich ein Fenster, nicht größer als ein Bogen Briefpapier. Bilke betrachtete das Glas, das bestimmt seit Jahren nicht geputzt worden und fast undurchsichtig war. Es gab keinen Hebel, keinen Mechanismus, mit dem man dieses Fenster hätte öffnen können.
»Was zum Teufel ...«, stieß Sebastian hervor.
Bilke sah aus dem Fenster. Schemenhaft war das Boot zu erkennen. »Sand an Skipper!« rief Bilke in ihr Mikro. »Seht ihr draußen was?«
»Negativ«, kam prompt die Antwort.
Bilke sah sich um. Die blutige Kleidung auf dem Boden, direkt neben dem Abfluss, das Wasser wusch einen Teil des Blutes aus dem Stoff und trug es mit sich fort. Sie sah drei Projektile auf dem Boden liegen. Sie wusste, diese würden sich bei der späteren Untersuchung als Geschosse aus ihrer Dienstwaffe erweisen. Bilke hörte das Trommeln der Rotoren des Hubschraubers, der jetzt direkt über dem Haus stand. Sie versuchte, sich auf das laufende Wasser zu konzentrieren, irgend etwas war damit, es zog sie magisch an, nahm sie in Gedanken mit sich fort, sie sah vor ihrem geistigen Auge ein Rohr, ließ sich mit dem blutigen Wasser darin weitertragen, bis es sich mit dem Wasser des Flusses vermischte.
»Das Wasser fließt direkt in den Rhein«, murmelte sie.
»Was meinst du?« fragte Sebastian und bedeutete den anderen, still zu sein. Er kannte seine Partnerin und wusste, dass sie eine Spur hatte. »Wo führt dich das hin?«
»Wo führt mich das hin?« wiederholte Bilke wie abwesend, als spreche sie nicht zu den anderen, sondern nur mit sich selbst. »Wo führt mich das hin? Wo führt ihn das hin?« Dann schrie sie: »Er ist im Wasser! Er taucht weg, schaut ins Wasser!«
Draußen wurde es hektisch, Sebastian sprach über Funk mit dem Boot. Bilke war wie betäubt und bekam kaum etwas mit. Ein Druck lastete auf ihren Schläfen, Übelkeit stieg in ihr hoch. Wie in einem Albtraum bekam sie mit, dass Helikopter und Boot mit Scheinwerfern und Infrarotsucher arbeiteten, dann sprangen Taucher ins Wasser.
Die Männer des SEK rannten nach oben, den knappen Anweisungen ihrer Teamleiterin folgend, die an Ort und Stelle blieb und versuchte, den Überblick zu behalten. Sebastian zog Bilke hinterher. Als sie am Rheinufer angekommen waren, lag ein nackter Mann auf dem Kiesboden. Auf ihm knieten mehrere Polizisten. Als Bilke sich der Gruppe näherte, hob der Mann den Kopf und sah sie an. Er bleckte die Zähne und gab ein Geräusch von sich wie ein Tier, in dessen Fleisch sich gerade die eisernen Zähne einer Falle geschlagen hatten.
Der Blick, der sich in Bilkes Hirn bohrte, verwirrte sie. Es lag keinerlei Angst darin, vielmehr etwas wild Triumphierendes. Ihre Knie gaben nach, der Druck auf ihre Schläfen wurde übermächtig. Sie spürte nicht mehr, wie Sebastian sie auffing und sicher in seinen Armen hielt.
Charlotte Street, London 51° 31' 8.108" N / 0° 8' 9.733" W
»Hey, Ben, träumst du?«
Benjamin sah die anderen am Tisch der Reihe nach an. Wer von ihnen hatte ihn angesprochen? Sally, die empathische junge Frau mit dem Wuschelkopf, oder Ailing, die zierliche Kommilitonin aus Hongkong, die nach zwei Jahren Aufenthalt in London ein besseres Englisch sprach als er selbst, der hier aufgewachsen war? Mark und Tom, die beiden anderen Jungs, die mit ihnen im Café saßen, konnten es nicht gewesen sein. Die Stimme hatte weiblich geklungen.
»Ist ja auch egal.«
Als Sally ihn mit großen Augen ansah, wurde ihm klar, dass er das laut gesagt hatte. Benjamin lächelte zaghaft. Er erinnerte sich wieder, worüber sie eben noch gesprochen hatten.
»Ich meine, es ist mir egal, wem Professor Brody die Hauptrolle gibt. In jeder Rolle kann man zeigen, was man gelernt hat.«
»Da hat er Recht, unser Schöner«, meinte Mark, der beim Reden ständig selbstverliebt mit seinen langen blonden Locken spielte. »Aber das sagt sich dennoch leichter, wenn man selber die Hauptrolle bekommt.«
Benjamin zuckte kurz mit den Schultern, halb als Entschuldigung, halb als Geste des Desinteresses.
Heute war so ein Tag, an dem er es beinahe bereute, sich ein Jahr lang die Beine ausgerissen zu haben, um an der Schauspielschule angenommen zu werden. Nein, er musste fair bleiben, trotz der Leere und der Zweifel, die ihn immer wieder packten. London war eine faszinierende Metropole, und das Studium war genau das, was er machen wollte. Es war nur an solchen Tagen wie diesem, wenn er schon beim Aufstehen merkte, dass er niemanden sehen oder gar sprechen wollte, keinen Menschen und besonders nicht die anderen Schauspieler, die immer um ihn herum waren, die ihn nervten mit ihren ständigen Beobachtungen des so oder so Seins. Nicht, dass er die Beobachtungen und das Sichhineinversetzen und das Nachahmen nicht mögen würde – es schien ihm nur manchmal so zu sein, dass er allein es war, dem das zustand. Die anderen sollten einfach ihr Leben leben, und er, Benjamin Shanks, war derjenige, der beobachtete, lernte, nachahmte und interpretierte.
»Ach komm, lass Ben in Ruhe«, meinte Sally, und es schien ihm angemessen, etwas Dankbarkeit darzustellen. Also stellte er sich vor, der Kommilitonin von Herzen dankbar zu sein, und es sich nicht anmerken zu lassen, was jedoch misslingen sollte, wenn er sie mit der Andeutung eines Lächelns ansah. Es funktionierte. Sie lächelte zurück und nippte an ihrem Tee. Sollte sie ruhig glauben, ihm etwas Gutes getan zu haben. Eigentlich fühlte es sich sogar so an, als sei ihr dies an ihm gelungen. Warum sich diesem Gefühl, echt oder gespielt oder beides, nicht einfach hingeben?
Vielleicht war dies der Schlüssel zum ganz normalen Leben? Ein Leben ohne Anfälle von Depressionen und Zweifeln?
»Wollen wir ein Spielchen machen?«, fragte Tom, dem immer schnell langweilig wurde, wenn man zusammensaß, ohne irgend etwas zu »machen«.
Benjamin befürchtete, die anderen würden wieder dieses »Ich stell mir vor ich wäre diese Person« spielen wollen. Deshalb schlug er schnell vor: »Lasst uns das Wonderboys-Ding versuchen!«
Ailing winkte ab. »Ach nein, dieses Geschichtenausdenken ist doch was für Autoren. Lasst uns richtig spielen. Ich bin dieser alte Mann da!«
Sie wies auf einen Passanten, der langsam, mit unsicherem Gang, die Charlotte Street hinab schlurfte. Benjamin verdrehte die Augen, aber nur innerlich, denn er wollte Ailing nicht beleidigen. Er mochte dieses Spiel nicht, für das sich die anderen seit Wochen begeisterten. Nein, nicht mögen traf es nicht richtig. Es verursachte ihm Unbehagen, noch mehr – er hatte sogar Angst davor, ohne den Grund dafür zu kennen.
Ailing stand auf. Sie wartete noch ein wenig, bis der alte Mann ein paar Meter an dem Café vorbei war und ihnen den Rücken zukehrte. Dann ging sie einige Schritte über den Bürgersteig und drehte sich um. Sie zeigte den anderen ein Gesicht, dass sie offenbar für müde und alt hielt. Sie zog sich in sich hinein, versuchte ihre jugendliche Gestalt trocken und verbraucht wirken zu lassen, und kam stockend auf die Gruppe der am Tisch sitzenden Studenten zu.
Sie machte es gar nicht schlecht, fand Benjamin. Ihr glattes schwarzes Haar, das ihm immer dicht und glänzend erschienen war, wirkte bei ihrer Vorstellung fast dünn, strohig und schütter, er glaubte ihre Kopfhaut durchschimmern zu sehen, was ihm sonst noch nie aufgefallen war.
»Entschuldigen Sie bitte«, murmelte Ailing mit leiser, müder Stimme, fast als führe sie ein Selbstgespräch. »Entschuldigen Sie, haben Sie meinen Hund gesehen? So einen kleinen.« Mit den Händen deutete sie die Körpermaße des imaginären Haustiers an. Tom spielte mit und antwortete:
»Nein Sir, hier laufen keine Hunde frei herum. Zu viele Chinesen, wenn Sie verstehen.«
Ailing war auf den dummen Witz nicht gefasst und prustete los.
»Du blöder Rassist!«, lachte sie. »Wir essen nicht alle Hunde auf, die wir finden, weißt du?«
»War aber im Ansatz nicht schlecht. Jetzt Ben.«
Benjamin winkte ab. »Bitte, ich mag nicht.«
Sally legte ihm eine Hand auf den Unterarm. »Warum nicht? Du bist gut darin, und beim letzten Mal habe ich schon geglaubt, du würdest bei dieser Übung einen echten Durchbruch erleben.«
Das ist es ja, was ich fürchte.
Laut sagte er: »Okay. Aber keine blöden Sprüche wie eben.«
»Versprochen«, antwortete Tom und zwinkerte.
Benjamin erhob sich und ging ein paar Schritte weg von den anderen. Zwei Tische weiter saß ein Paar mit einem Jungen, der ihm eben schon aufgefallen war.
Er war vielleicht neun oder zehn Jahre alt, konnte nicht eine Minute an seinem Eis sitzen bleiben und rannte ständig herum, irgendein dummes Zeug laut vor sich hin brabbelnd. Ein nervtötendes Kind. Jetzt kam der Junge wieder um den Tisch gelaufen und stand breitbeinig vor ihm, als wolle er sich mit ihm duellieren. Benjamin atmete tief und ruhig, er sah dem Kind direkt in die Augen. Nicht lächelnd, auch nicht mit stechendem Blick wie als wenn er ärgerlich wäre, sondern ganz neutral und gelassen. Der Junge schien etwas sagen zu wollen, dann zuckte er kurz, als wolle er sich abwenden und zu seinen Eltern laufen, doch dann erwiderte er Benjamins Blick und blieb bewegungslos stehen.
Benjamin spürte die erwartungsvollen Blicke der Freunde, doch dann konzentrierte er sich ganz auf das Kind. Er versenkte sich in die wasserhellen, leicht geröteten Augen, beobachtete die Pupillen, die leicht hin und her zuckten, als wollten sie woanders hin schauen und könnten doch nicht. Benjamin folgte gedanklich dem Glaskörper eines Auges über den Sehnerv bis zum Gehirn, dort, wo vielleicht auch dieser Rotzbengel so etwas wie ein Bewusstsein aufbewahrte. Ohne darüber nachzudenken, hob Benjamin eine Hand und legte sie dem Jungen auf die Schulter. Es prickelte in den Fingerspitzen, dann wurde alles taub, als fasse er Trockeneis an.
Diese Taubheit breitete sich wie eine Welle über die Hand, den Arm, den ganzen Körper aus. Es wurde ihm schwarz vor Augen, doch nur für einen winzigen Moment. Dann wurde alles wieder klar.
Er wankte etwas, fühlte sich unsicher auf seinen Beinen, sah an sich herab auf seine Füße. Diese steckten in bunten Sneakers, dazu weiße Socken und spindeldürre, nackte Beine. Er sah wieder hoch. Vor ihm, zwei Köpfe größer oder mehr, stand ein junger Mann.
Er kannte ihn, es war Benjamin Shanks, Schauspielstudent an der renommierten Royal Academy of Dramatic Art. Er selbst also, oder, wie er verwundert feststellte, sein geistlos und leer wirkender Körper. Er ging um ihn herum, betrachtete ihn von der Seite, dann von hinten, und wunderte sich nicht, als er dann zu wanken begann und zusammenbrach. Er hörte Sally und Ailing wie aus einem Mund plötzlich schreien, alle vier Freunde sprangen vom Tisch auf und liefen zu ihm, oder zu seinem Körper, hin. Tom drehte ihn um. Die Augen und der Mund waren geöffnet, er atmete offensichtlich, wenn auch flach und kraftlos, reagierte aber nicht auf die anderen. Benjamin trat näher und fasste Sally, die sich hingekniet hatte, am Arm.Sie drehte sich um, sah ihn überrascht an und stand auf. Sie war plötzlich größer als er, seine Nase war auf der Höhe ihrer Brüste. Das entlockte ihm ein Grinsen.
»Was willst du?«, fragte sie ihn.
»Sally, du musst keine Angst um mich haben. Es ist alles okay.«
»Was meint der Nervzwerg?«, fragte Mark und erhob sich ebenfalls.
»Ich bin‘s, Benjamin«, sagte er mit einer hohen, kindlichen Fistelstimme. »Ein Tipp: Vergiss Method Acting.«
Er hätte lachen mögen, gleichzeitig aber zog sich sein Herz zusammen, als packe eine eiskalte Hand danach. Faszination und Furcht, Neugier und Entsetzen, er wusste nicht was stärker war. Er spürte, wie sein Puls sich beschleunigte und Schweißperlen an Nase und Haaransatz hervortraten. Es reichte, es war genug, sein eigener Körper schien unendlich weit weg, wurde vielleicht schon kalt, wer konnte das wissen? Er musste zurück. Benjamin kniete nieder und berührte den jungen Mann, der er selbst war, an der Hand. Bitte, dachte er, ich will zurück, nimm mich wieder an, ich nehme dich wieder an, verdammt was auch immer, ich bin du und jetzt nehme ich mir wieder, was sowieso mir gehört!
Nichts geschah. Das war vielleicht der falsche Weg. Er packte seine Hand fester und versuchte sich zu beruhigen. Benjamin sah in seine eigenen Augen, die blöde und geistlos glotzten, vertiefte sich darin, atmete ruhiger und ruhiger, bis ihm die Sinne schwanden. Ein greller Blitz zuckte durch die Dunkelheit, dann sah er das verstörte Gesicht dieses Knaben über sich, der plötzlich gleichzeitig zu schreien und zu weinen begann. Er sah, wie der Junge zu seinen Eltern rannte, die sich bereits besorgt erhoben hatten.
»Benjamin?« Mark sah ihn unsicher an. »Ja, da bin ich wieder«, antwortete er und hielt Mark die Hand entgegen, damit er ihm aufhalf.
Tatsächlich brauchte er Hilfe, seine Knie zitterten heftig. Doch schnell kehrte die Sicherheit zurück, und so, wie er seinen eigenen Körper wieder fühlte, ließ auch die Panik nach, die eben kurz aufgeflackert war.
»Hey Sally«, sagte er grinsend, als er aufgestanden war und sich den Straßenstaub aus der Hose klopfte. »Wenn man so klein ist, dass deine Möpse gerade auf Augenhöhe sind, sehen sie echt gigantisch aus.«
»Du Blödmann«, entgegnete Sally kopfschüttelnd. »Du hast uns Angst gemacht. Was sollte das? Ist das dein Neffe, oder hast du ihm was gegeben für die Show?«
»Ich soll verwandt sein mit diesem Knaben? Niemals!«, lachte Benjamin und ging zu seinem Platz zurück. Die anderen folgend ihm zögerlich. Ailing meinte: »So macht das Spiel keinen Spaß.«
Er setzte sich hin und trank einen Schluck, versuchte sich zu entspannen. Nein, dachte er. Das war kein Spiel, und Spaß sollte es auch nicht machen. Es war viel mehr als das. Aber was genau – das musste er unbedingt herausfinden. Die Menschen um ihn herum, die Kommilitoninnen, die Fremden, das Gewusel der Großstadt, all dies verschwand aus seiner Wahrnehmung. Er hatte die Türe zu etwas aufgestoßen, was da draußen nicht zu finden war und wohin ihn niemand führen konnte.
Da war nur er selbst und eine Welt in ihm, die neu und beängstigend erschien und doch ein Teil von ihm war. Und dort war er völlig allein.
Syrisches Grenzgebiet, Wadi ar Raqqad 32° 45' 36.187" N / 35° 46' 19.463" O
Kaltes Licht, beinahe so konzentriert wie Laserstrahlen, bohrte sich durch die Dunkelheit, ließ die giftigen Nebelschwaden in unwirklichen Farben aufleuchten. Hier und da ein Schatten. Die Feinde benutzten Kampfanzüge, die sie vor den genetisch programmierten Kampfstoffen schützen sollten. Eine Art Exoskelett, das die weichen Körper nicht nur abschirmte, sondern auch stärker machte. Technische Ortung fast unmöglich, Feuer auf Sichtkontakt. Judith musste genau zielen, wenn sie eines dieser Wesen erwischen wollte. Kaum hatte sie einen Umriss des Feindes in der Zieloptik erfasst, war er auch schon wieder im Nebel abgetaucht. Das Visier ihres Kampfanzuges behinderte sie zusätzlich. Der Anzug war schwer, hermetisch abgeschlossen, ursprünglich für den Aufenthalt im Vakuum des Weltraums entwickelt. Flüssigkeit, Temperatur, Nahrung, alles das war innerhalb dieses Anzuges in autarken Regelkreisläufen organisiert. Sie würde in der vergifteten Atmosphäre dieses trostlosen Schlachtfeldes ohne diesen Schutz kaum eine Sekunde überlebt haben. Ihre gesamte Wahrnehmung, ihre Biodaten, ihre Bewegungen, Munitionsverbrauch und die äußere Sensorik des Kampfanzuges wurden an die fliegende Einsatzzentrale übermittelt, die weit entfernt war.
Diese taktische Telemetrie war die einzige Verbindung zu ihrer Spezies. Das vorherrschende Gefühl während dieses mörderischen Einsatzes war nicht die Angst vor Verletzung oder Tod. Es war die Einsamkeit. Der Feind kannte hier jede Mulde, jede noch so kleine Deckung, hatte das Kampfgebiet jahrelang studiert und infiltriert. Sie fühlte sich fremd hier, obwohl es doch ihre Heimat war, ihr Land, in dem sie geboren wurde, für das sie kämpfte, liebte, litt, hasste, tötete.
Die Nacht in der Wüste war kalt. Ihr Anzug war im unteren Bereich der Reserve. Der Einsatz dauerte bereits viel länger als geplant. Wenn die Bedingungen nicht bald besser wurden, würde sie die Waffenenergie zugunsten der Lebenserhaltung drosseln müssen. »Mission Control«, stieß sie heiser hervor. Dann räusperte sie sich, weil sie vielleicht gar nicht verstanden wurde und begann nochmals. »Mission Control, hier Leutnant Weizman. Wie lange noch bis Sonnenaufgang?«
Sie hätte diese Information auch aus ihrem eigenen Computer abrufen können, doch sie wollte einen Kontakt. Es knackte im Helmfunk, dann Rauschen, dazwischen abgehackte Worte. Der Feind störte den komplex verschlüsselten Funkverkehr. Ihre eigenen Biodaten waren der Code zur Entschlüsselung der Übermittlung.
»Mission Control an Weizman – acht Minuten bis Sonnenaufgang. Ihre Energiewerte sind kritisch. Externe Zufuhr erforderlich in vier Minuten.«
Judith spürte, wie die Angst von ihrem Kopf über die Kehle bis zum Herzen sickerte und sie lähmte. Das durfte sie nicht zulassen. Der erste klare Gedanke, den sie nach den Informationen von Mission Control fassen konnte, war seltsam.
Das Licht, das jetzt in diesem Moment die Sonne verließ, würde das erste sein, dass sie am Horizont erblicken könnte. Rund acht Lichtminuten war dieser Planet von seinem Stern entfernt. Der zweite Gedanke: Externe Energiezufuhr. Sie brauchte dringend einen Ersatzakku für den Kampfanzug. Langsam und vorsichtig löste sie sich aus der Deckung. Die bohrenden Lichtfinger waren nicht in ihrer Nähe, sie bewegte sich in völliger Dunkelheit. Jetzt musste sie über einen kleinen Hügelkamm hinweg. Das war ein gefährlicher Moment, in dem sie ein gutes Ziel abgab. Sie presste sich an den Boden und schob sich vorwärts. Jetzt musste sie möglichst flach unten bleiben, gleichzeitig aber auch schnell sein. Judith erreichte den höchsten Punkt und beeilte sich, abwärts zu rutschen. Etwas hatte sich dort bewegt.
Während sie hinabglitt, zielte sie mit der Mündung ihres Schnellfeuergewehres in die Mulde. Kein Feind zu sehen. Dort unten lag etwas. Jemand. Sie war heran. Ein toter Soldat. Ein Kamerad. Der Helm zerstört, das Gesicht komplett weggeschossen. Frisches, flüssiges Blut überall. Frontaler Treffer ins Visier. Er hatte es wohl gar nicht mehr richtig gemerkt. Judith zwang sich, ihren Blick von dem Toten abzuwenden. Sie drehte die Leiche um und suchte den oberen Rücken ab, dort, wo der Anzug seine Ports haben musste.
Sie entfernte die Schutzverschalung und betrachtete den Akku. Gelbes Licht, das bedeutete Energie für Stunden. Schnell entriegelte sie den Verschluss, zog den Akku heraus. Ihren eigenen Versorgungsport konnte sie per Sprachbefehl öffnen und den leeren Akku auswerfen. Aber den anderen einstecken musste sie manuell. Sie legte die Waffe ab und verrenkte sich, um das kleine Kästchen mit ihrem Anzug zu verbinden. Es klickte, dann meldete der Computer Verbindung und Energiestatus. Judith atmete auf.
Fast zu spät sah sie die Bewegung, doch sie war gut trainiert und verfügte über sehr schnelle Reflexe. Bevor sie überhaupt zu denken begann, hatte sie nach dem Gewehr gegriffen und eine Lasersalve abgefeuert. Die Gestalt vor ihr brach zusammen. Sie hatte das Ding voll erwischt und ein großes Loch in die Körpermitte gebrannt. Es musste wohl kurz zuvor ihren Kameraden getötet haben. Bewegte es sich noch? Sie hielt den Kopf im Zentrum der Zieloptik ihrer Waffe und näherte sich. Noch nie hatte sie den Feind so nahe gesehen. Neugier trieb sie an. Mit einer Hand zielte sie weiter auf die am Boden liegende Gestalt, mit der anderen zerrte sie an dem Helm des Exoskeletts herum, um dem Feind ins Gesicht sehen zu können. Erstaunlich schnell fand sie einen Verschluss. Es zischte, Atmosphäre entwich, dann klappte das Visier auf. Wie ein tiefer Stich ins Herz fühlte es sich an, als sie es erkannte.
Was hat sie erwartet? Ein Monster, hässlich wie ein Untier aus den schlimmsten Horrorfilmen? Weit davon entfernt. Homo Sapiens. Es war ein Mensch. Blut lief aus Mund und Nase.
Ihr Treffer hatte wohl seine Lungen zerfetzt. Er lebte noch, versuchte zu atmen, doch das konnte er nicht mehr. Seine Augen waren weit aufgerissen, es zuckte in diesem vom nahen Tod gezeichneten Gesicht. Dann lag er still. Und jetzt plötzlich, warum auch immer sie es erst in diesem Moment erkannte – dieser Mensch war es, der hier zuhause war. Sie war der außerirdische Kämpfer, der Besatzer, der in dieser gottverdammten Wüste tötete, Ansprüche geltend machte. Aber ganz so einfach war es nicht.
»Nein, es ist auch meine Heimat!«, schrie sie dem Toten ins Gesicht.
Judith schreckte vom Klang der eigenen Stimme auf. Ihr Herz raste. Es dauerte zwei keuchende hektische Atemzüge, bis sie bemerkte, dass sie aus einem Albtraum erwacht war. Was für eine irrsinnige Geschichte. So real hatte es sich angefühlt, und so verrückt kam es ihr jetzt, da sie wach war, vor. Ein Blick auf die Armbanduhr, die eigentlich ein taktischer Kleincomputer war, zeigte ihr, dass sie keine zehn Minuten geschlafen hatte. Es hatte sich viel länger angefühlt. Nach dem Gefecht und dem anschließenden langen, anstrengenden Marsch mussten sie noch das Camp errichten und sichern, dann eine Kleinigkeit essen und die Lage besprechen.
So war sie todmüde gewesen, als sie sich endlich hingelegt hatte, und war sofort eingeschlafen, trotz ihrer Aufgewühltheit. Der Albtraum war die logische Konsequenz. Judith setzte sich auf. Der Himmel über dem Golan war sternenklar.
Weit im Westen, unerreichbar für sie, der See Genezareth. Ihr Lager – irgendwo zwischen Alpha- und Bravo-Line der vereinten Nationen, Niemandsland zwischen Israel, Jordanien, Syrien. Jeder, auf den sie treffen konnten, war ein potentieller Feind. Die Mission war geheim, illegal für alle Welt außer für sie. IS, Hisbollah, Kassam-Brigaden der Hamas, versprengte Drusenmilizen mit unklarer Ausrichtung, hier wohnhafte Zivilisten, die wie heimatlos verloren wirkten. Judith zog sich das verschwitzte Hemd über den Kopf und suchte sich ein frisches aus dem Rucksack. Sie wartete noch ein wenig, bis sie es anzog, ließ die kühle Nachtluft die Hitze des mörderischen Traums vertreiben. Jetzt erst spürte sie, dass sie beobachtet wurde. Hauptmann Itzhak Rebić nickte ihr zu.
»Judith, alles klar bei dir?«
Sie erwiderte seine Geste. »Hatte einen miesen Traum. Aber es geht schon wieder. Danke.«
Der Kommandeur des Stoßtrupps rückte etwas näher an sie heran.
»Es war ein verdammt harter Tag. Du bist gut ausgebildet, hast alles, was man für ein solches Kommando braucht. Aber es ist für niemanden einfach, zum ersten Mal einen Menschen zu töten.«
»Ich dachte es wäre einfach, wenn es ein gerechter Kampf ist.«
»Jetzt weißt du es besser.«
»Ja, jetzt weiß ich es besser.«
Es war nicht genau das, was sie empfand. Aber es erschien ihr das zu sein, was der Hauptmann hören wollte. Und gelogen war es sicherlich auch nicht.
Da war nur dieser Gedanke – nein, es war mehr ein Gefühl – dass etwas nicht stimmte.
Natürlich belastete es sie, dass sie an diesem Tag zum erstes Mal jemanden aus nächster Nähe erschossen und die blutige Leiche anschließend durchsucht hatte. Doch das fühlte sich dennoch richtiger an als der Job am Grenzzaun in Gaza, wo ihre Kameraden aus sicheren Stellungen heraus auf palästinensische Demonstranten schießen mussten. Hier waren es Kassam-Kämpfer gewesen, topmodern bewaffnet und militärisch ausgebildet, mit dem unbedingten Willen, sie und alle anderen Juden umzubringen. Die Milizen operierten hier genauso geheim wie die israelischen Spezialkräfte, aber Judith trug ihre Uniform im Bewusstsein, auf der Seite eines Rechtsstaates zu stehen, der seine Bürger schützte. Sie war mit sechs weiteren Kameraden in die Wüste gegangen, um Terroristen zu bekämpfen. Das war der Auftrag, und es war richtig. Aber es fühlte sich nicht so an.
»Du bist sehr gläubig, nicht wahr?«, unterbrach Itzhak ihre Gedanken.
Sie nickte wortlos.
»Dann mag es dir helfen zu beten. Das habe ich bei meinen Leuten schon oft beobachtet. Mir selbst hilft es nicht. Dir vielleicht schon.«
Wieder nickte Judith stumm. Und sie wünschte, der erfahrende Kommandeur hätte Recht. Ihre Feinde waren fest davon überzeugt, dass Allah an ihrer Seite in den Kampf zog und seine schützende Hand über ihre Seelen hielt. Sie selbst war ganz und gar nicht sicher, ob der Unaussprechliche dasselbe für sie tat.
Grassy Key, Florida 24° 46' 2.932" N / 80° 56' 50.132" O
Der Beifall, den sie nach ihren Schlussworten wie immer bei der Verabschiedung der Gäste geernet hatte, war abgeebbt. Die Besucher hatten sich verlaufen, manche flanierten noch weiter über das Gelände der Forschungsstation, andere waren bereits auf dem Weg zur nächsten Sehenswürdigkeit. Davon gab es auf den Keys mehr als genug. Das Dolphin Research Center gehörte aber sicher dazu. Ana Maria Ojeda mochte die Führungen. Die meisten Forscherinnen bekamen Kopfschmerzen allein bei dem Gedanken, Touristen auf verständliche, also oberflächliche Art zu unterhalten. Für Ana war es jedoch eine schöne Gelegenheit, ihre Begeisterung für die Delfine an andere Menschen weiterzugeben. Die Leute kamen freiwillig, hatten also echtes Interesse. Und wenn sie gingen, hatte Ana Maria aus diesem Interesse eine Liebe zu diesen wundervollen Geschöpfen entstehen lassen. Zumindest an einem guten Tag. Und dieser war definitiv einer von den besseren. Die Tiere hatten ihren Spaß gehabt, hatten sich kommunikativ und gut gelaunt gezeigt. Keine andressierten Kunststücke wie in den Unterhaltungsparks, sondern echte Kontakte auf freiwilliger Basis. Besonders Bella hatte sich in Hochform gezeigt. Die hochintelligente Delfindame zeigte sich manchmal gar nicht, an manchen Tagen jedoch schien sie Ana Marias Part bei dem Edutainment regelrecht übernehmen zu wollen.
Am liebsten hätte Ana Maria das für den nächsten Tag geplante Experiment mit Bella 3A vorgezogen. Doch es war noch vieles vorzubereiten. Der Stress für das sensible Tier musste minimiert und die Ergebnisse maximiert werden.
Sie ging in die Halle, deren Meerwasserbecken mit Messtechnik angefüllt war. Routiniert ging sie die Sonaranlage, den Ultraschall und den Magnetresonanztomografen durch, eine teure Spezialanfertigung, die das technologische Herzstück ihrer Forschung war. Ihr Kollege Dave war dort bereits mit der Kalibrierung der Sensorik und der Computer beschäftigt. Er sah auf, als Ana Maria zu ihm trat.
»Hi Ana. Gute Laune?«
»Aber ja. Warum auch nicht? Es ist ein schöner Tag, es ist nicht schwül, der Himmel ist wolkenlos und das Wasser klar. Warum sollte ich keine gute Laune haben?«
Daves Miene war definitiv finsterer als der Himmel über den Keys.
»Du hast doch die Email aus Miami gelesen?«
Natürlich hatte sie. Ihre Fakultät hatte ihr mitgeteilt, dass die Erforschung des Bio-Sonars an Delfinen mit dem aktuellen Projekt ausgereizt sei und weitere Mittel nicht bereitgestellt werden könnten. Man solle sich um eine private Drittmittelfinanzierung kümmern oder eine andere Richtung einschlagen.
»Ja, habe ich. Der Dekan hat sogar Vorschläge gemacht, was wir anderes erforschen könnten. Ist er nicht nett zu uns?«
»Höre ich da eine gewisse Ironie heraus?«
»Kannst du gerne annehmen. Aber es ist in Wahrheit wirklich traurig. Ich habe es einfach nicht geschafft zu erklären, dass es mir gar nicht primär um die Funktionsweise des Bio-Sonars geht, sondern um die Evolution der Biotechnologie als Ganzes. Diese ganze teure Einrichtung hier brauchen wir eigentlich gar nicht. Die habe ich nur beantragt, weil wir sonst gar keine Förderung erhalten hätten. Wir betrachten uns als die Krone der Schöpfung, weil wir Sonargeräte und viele andere außerkörperliche Werkzeuge entwickelt haben. Delfine haben dafür ein Organ entwickelt, mit den Vorteilen intuitiver Bedienung, direkter zerebraler Schnittstelle und optimaler Anpassung an die Lebensbedürfnisse. Diese organische Art der technischen Evolution hat ein viel größeres Potential als die, welche wir Primaten vorangetrieben haben. Stell dir nur mal eine Spezies vor, die unser technologisches Wissen organisch umsetzen könnte. Welche unendliche Überlegenheit in diesem Konzept angelegt wäre, vielleicht in Delfinen sogar angelegt ist! Und denken wir mal an die vielen Spezies, die über Magnetfeld-Rezeption verfügen. Man könnte fast meinen, wir Menschen sind die einzigen, die das nicht drauf haben.«
»Ist ja gut, Ana. Mir musst du den Vortrag nicht halten. Ich kenne deine Theorie, und ich finde sie brillant, das weißt du. Und ich glaube auch nicht, dass sich ansonsten niemand dafür interessiert.«
Dave richtete sich jetzt ganz auf, um aus der Höhe von beinahe zwei Metern auf die einsneunundfünfzig kleine Ana Maria herabzulächeln. Dave war ein Meeresbiologe, wie man ihn sich vorstellte. Strähniges Haar umrahmte das sonnengebräunte Gesicht, in dem ein blonder Bart wucherte, seine breite Brust hätte jedem Rettungsschwimmer alle Ehre gemacht. Ana Maria wirkte dagegen zierlich und klein, allerdings wusste Dave, dass sie es im Schwimmen und Tauchen jederzeit mit ihm aufnehmen konnte. Vielleicht war er etwas schneller, immerhin war er sechsundzwanzig Jahre alt, und Ana achtundfünfzig. Sie war Professorin und seine Vorgesetzte, was dem Naturburschen jedoch überhaupt nichts ausmachte. Er war immer sehr nett und freundlich zu ihr, auf eine solche Art, dass Ana Maria vermutete, dass er sich trotz des Altersunterschiedes in sie verliebt hatte, ohne sich zu trauen, ihr dies zu gestehen. Vielleicht war Dave aber auch so schlau einzusehen, dass er im Wettbewerb um die Gunst der Kollegin keine Chance gegen die Delfine hatte. Als hätte er ihre Gedanken erraten, sah er Bella 3A zu, wie sie vom Außenbecken zu ihnen wechselte, zwinkerte dann Ana Maria zu und meinte: »Ich lasse euch beide dann mal allein. Morgen oder spätestens übermorgen soll es stürmisch werden. Ich werde zur Marina gehen und mein Boot gut festmachen. Soll ich deins auch mal checken?«
»Danke Dave, das mache ich später selbst noch. Wir sehen uns!«
»Okay.«
Ana Maria sah dem langen Kerl belustigt hinterher, bis er die Halle verlassen hatte, dann wandte sie sich Bella zu, die sie vom Beckenrand aus neugierig ansah.
»Meinst du? Er ist eifersüchtig? Kann doch nicht sein, oder?«
Bella schien ihren Gesichtsausdruck nur minimal zu verändern, machte dabei aber ein Geräusch, von dem Ana Maria wusste, dass die Delfindame gerade herzlich lachte. Die Wissenschaftlerin nahm sich vor, als nächstes Projekt vielleicht den Humor der Tiere als wesentliches Kennzeichen fortgeschrittener Intelligenz systematisch zu untersuchen. Vielleicht gab es dafür mehr Forschungsgelder.
»Was hat er eigentlich damit gemeint? Er glaubt nicht, dass sich niemand für meine Forschung interessiert?«
Vielleicht weiß er etwas.
Der Gedanke kam ihr so plötzlich und erschien ihr so fremd, als wäre es nicht ihrer gewesen. Wenn man ihre Theorie nun weiter denken und Anknüpfungspunkte in vorhandenen Technologien suchen würde? KI, Bionik, Implantate, in vitro erzeugte Organe mit Modifikationen? Militärische Nutzungen? Hatte Dave Kontakte in diese Richtung? Wusste er um konkrete Interessenten? Bella schlug mit der Schnauze aufs Wasser, dass es laut klatschte.
»Ist ja gut«, meinte Ana Maria. »Ich sollte mich an die Fakten halten und nicht herumspinnen. Und wir haben viel zu tun, nicht wahr?«
Der Delfin sah sie skeptisch an.
Die Arbeit hier wird bald ein Ende finden.
Ana Maria setzte sich auf den Beckenrand und ließ die Unterschenkel ins Wasser baumeln. Gedankenverloren streichelte sie Bellas Kopf. Warum dachte sie jetzt an ein rasches Ende ihrer aktuellen Forschung? So war der Brief des Dekans nun bestimmt auch wieder nicht zu interpretieren. Oder doch? Was würde sie denn dann machen?
Die täglichen Touristenführungen waren zwar eine nette Abwechslung, aber sie war Wissenschaftlerin. Und wenn sie den Arbeitsplatz wechseln müsste – was würde dann mit Bella 3A und den anderen Tieren geschehen?
Das hier wird enden – aber nur, damit etwas viel Größeres seinen Anfang nehmen kann.
Ana Maria schüttelte den Kopf. Sie hatte sich schon als kleines Mädchen stundenlang mit sich selbst unterhalten können und manchmal darüber gerätselt, wer da zu ihr sprach. Aber natürlich war sie das immer selbst. Wer denn sonst? Wenn sie nun jedoch Bella 3A ansah, war sie sich dessen nicht mehr so sicher. Was sollte denn da Wichtigeres auf sie zukommen als das, was sie gerade tat?
»Bella, bist du das? Hast du das gesagt?«
Der Delfin lachte wieder, und Ana Maria stimmte in das Lachen ein. Manchmal war sie halt immer noch das kleine Mädchen, dem in ihren Selbstgesprächen die Fantasie durchging.
Froh sein ist gut. Die Stimme in ihrem Innern beruhigte sie.
Halte dich bereit. Und hab keine Angst.
Köln, Deutschland 50° 56' 15.202" N / 6° 59' 41.755" O
Bilke erwachte mit dem dämmerigen Gefühl, sich an einem schwülen Sommertag einem viel zu langen Mittagsschlaf hingegeben zu haben. Der dösige Nebel in ihrem Kopf verschwand auch nicht mit dem Zähneputzen oder der kalten Dusche, zu der sie sich zwang. Nicht einmal der starke Kaffee vermochte etwas zu verbessern. Mit dem letzten Schluck nahm sie ihre morgendliche Dosis Lithium ein. Nun erst gestattete sie sich die konkrete Erinnerung an die vergangene Nacht. Es erschien ihr wie ein Wunder, dass sie ihn wirklich gefasst hatten. Nachdem ein Notarzt sie untersucht und nichts als Erschöpfung hatte feststellen können, hatte sie alles gefuttert, was sie in die Finger bekommen konnte. Dann hatte Sebastian sie nach Hause gefahren. Er war dann gleich weiter zur ersten Vernehmung, die bestimmt die ganze Nacht angedauert hatte und vielleicht immer noch im Gange war. Bilke sah auf die Uhr. Gleich zwölf. Es war Zeit, ins Präsidium zu fahren. Mit dem Rad dauerte die Fahrt, wenn sie richtig in die Pedale trat, kaum eine Viertelstunde. Angeschwitzt erreichte sie ihr Büro, wo sie Sebastian alleine beim nachdenklichen Kauen eines Schokoladenriegels antraf.
»Hi Freckle«, sagte er und stand auf. Sein Lächeln war zu freundschaftlich, um sich über den Spitznamen zu ärgern, den er ihr gegeben hatte und den auch nur er benutzte.
Niemand sonst hätte es gewagt, ihre Sommersprossen, die ihr Gesicht, aber auch Hals und Brust, Schultern und Oberarme fast vollständig bedeckten, auch nur zu erwähnen.
»Wie geht es dir? Du hättest heute ruhig zuhause bleiben können.«
Bilke beschloss, nur auf Sebastians Frage einzugehen.
»Immer noch müde, aber so langsam komme ich in die Gänge. Hast du noch so einen?« Sie wies auf den Riegel, der ihr süß genug erschien, um ihren Appetit nach Hochkalorischem zu befriedigen. Wie hatte sie nur das Frühstück vergessen können?
Sebastian griff in die Schublade und gab ihr den Snack, nicht ohne die Verpackung für sie aufzureißen und den Riegel ein Stück herauszuschieben.
»Danke«, sagte sie, bereits kauend. »Hat er was gesagt?«
Sebastian schüttelte den Kopf. »Nichts.«
»Überhaupt gar nichts?«
Es dauerte etwas, bis die Antwort kam. »Ich meine, er hat nichts zur Sache ausgesagt. Aber er wollte dich sprechen.«
»Echt jetzt?«
»Er fragte nach der Frau, die auf ihn geschossen hat. Ich sagte ihm, er hätte heute keinen Wunsch frei.«
»Ich will mit ihm reden.«
»Langsam, Bilke« wiegelte Sebastian ab. »Natürlich wirst du mit ihm reden, aber das hat noch Zeit. Lass ihn etwas auf kleiner Flamme garen.«
»Wenn du meinst.«
Bilke gab sonst nicht so schnell nach. Aber der erfahrene Hauptkommissar hatte vermutlich recht, und auch wenn sie das niemals zugegeben hätte, war es eine Tatsache, dass sie für ein Gespräch mit dem Serienmörder mehr Kraft benötigte, als sie momentan besaß. Und Sebastian wusste das.
»Wo hab ich ihn denn erwischt? Er schien nicht schwer verletzt.«
»Das ist eine der vielen Fragen, die sich heute Nacht ergeben haben«, antwortete Sebastian und sah sie skeptisch an.
»Wir haben alle Projektile sichergestellt, und auch jede Menge Blutspuren im Keller. Es ist sicher, das du ihn mindestens einmal getroffen hast. Eigentlich.«
»Wieso eigentlich?«
»Er weist keinerlei Verletzungen auf. Gesund und munter, die Haut hat kein Loch und keinen Riss, wie neugeboren.«
»Wie ist das möglich? War das Blut frisch?«
»Kein Zweifel. Es sieht so aus, als hätte er in den paar Sekunden, die er dir voraus war, nicht nur den Kellerraum erreicht und die Tür vor dir abgeschlossen, sondern unterwegs auch noch eine vorbereitete Blutkonserve auf dem Boden und der Tür verteilt, eine deiner Kugeln aus der Wand geklaubt, etwas von seinem Blut darauf gegeben und das Projektil wieder in die Wand zurückgesteckt.«
»Haha.«
»Genau. Ist total unmöglich. Aber wenn das nicht so oder ähnlich abgelaufen ist, müsste er eine Schussverletzung aufweisen. Aber die hat er nun mal nicht, und unsere Ärzte haben ihn mehr als gründlich untersucht.«
»Das ist verrückt.«
Sebastian nickte. »Aber wir untersuchen die Spuren noch exakter. Das Labor sagte, es könnte theoretisch immer noch sein, dass es sich doch nicht um sein Blut handelt. Das endgültige Ergebnis haben wir noch im Laufe des Tages. Aber es kommt noch besser: Die beiden Taucher, die ihn aus dem Rhein gefischt haben, berichten beide übereinstimmend, dass sie ihn schon fest gepackt hatten, dann schien er plötzlich verschwunden, um dann einige Meter stromabwärts wieder aufzutauchen. Dann erst konnten sie ihn ans Ufer zerren.«
»Es war dunkel und hektisch, großartig dass sie ihn überhaupt haben fassen können.« Bilke argumentierte gegen ihre eigene Überzeugung und versuchte so, die aufkeimende Angst in den Griff zu bekommen.
»Das würde ich nur zu gerne auch genau so sehen«, meinte Sebastian. »Aber wir haben die Wärmebildkamera des Helikopters. Darauf waren während des Zugriffs drei Personen im kühlen Wasser deutlich nah beieinander zu erkennen. Dann verschwand ein Körper vom Bildschirm, um wenig später in einigem Abstand von den beiden anderen wieder aufzutauchen.«
Bilke spürte, wie sich ein Kloß in ihrem Hals bildete. Sie wollte etwas sagen, aber es schien, als sei ihr das unmöglich.
»Ich weiß«, sagte Sebastian leise und legte einen Arm um ihre Schulter. Er spürte ihr Zittern. Leise flüsterte er Bilke zu:
»Ich wünsche mir genauso sehr wie du, dass diese seltsamen Dinge, die damals geschehen sind, nur ein blöder Zufall und das Zusammentreffen von Faktoren waren, die wir nur nicht erklären konnten. Aber sieh es mal positiv: wir wissen nun zumindest genau, dass du nicht verrückt bist.«
Bilke biss die Zähne zusammen und versuchte sich zu beherrschen, aber sie konnte nicht verhindern, dass ihr eine Träne aus dem Auge quoll und langsam die Wange hinabrollte. Schnell wischte sie mit dem Handrücken darüber. Gleichzeitig zog sie die Nase hoch. Sie wusste, dass sie damit wegen der verdammten Sommersprossen wie eine Rotzgöre wirkte, aber bei Sebastian war das egal. Fast. Jedenfalls nicht so unerträglich wie bei irgend einem anderen Kollegen.
»Verrückt ist das Stichwort«, sagte sie dann. »Ich habe diesen Termin beim Psychologen, du weißt schon.«
Natürlich wusste Sebastian von dem Termin, immerhin war er Bilke nicht nur freundschaftlich verbunden, sondern auch ihr Vorgesetzter und hatte dieses Pflichtgespräch seit dem seltsamen Vorfall damals anordnen müssen.
Bilke hatte es immer wieder hinausgeschoben, aber heute musste sie den Termin endlich wahrnehmen. Es war ja nicht zu ahnen, dass es nun unmittelbar nach der Festnahme ebenjenes Täters war, der sie seinerzeit aus der Bahn geworfen hatte.
»Ach so«, sagte Sebastian, als Bilke sich schon erhoben und aus seinem sanften Griff gewunden hatte. »Deinen Bericht machen wir heute Nachmittag zusammen, ja? Das war übrigens eine klasse Leistung letzte Nacht. Niemand hat diese tapezierte Tür zum Kellerabgang in der Küche gesehen. Nicht bei diesen miserablen Lichtverhältnissen und der hektischen Situation. Die Jungs vom SEK und auch die Einsatzleiterin schämen sich ein bisschen, richten aber Respekt und Glückwünsche aus.«
»Danke«, murmelte Bilke tonlos und schaute Sebastian dabei gar nicht an. Wie sollte sie ihm jetzt, bei all diesen offenen Fragen, zusätzlich erklären, dass sie die Tür gar nicht bemerkt hatte?
Dass sie den Mann irgendwie durch die Wand gesehen oder vielmehr gespürt hatte? Er hätte ihr daraufhin vermutlich erklären wollen, dass sie eine gut geschulte, erfahrene und mit exzellenten Instinkten ausgestattete Polizistin war, die unbewusste Sinneseindrücke intuitiv richtig ausgewertet und entsprechend schnell und folgerichtig gehandelt hatte. Aber sie wusste, so war es nicht gewesen. Oder doch? Konnte sie sich ihrer Wahrnehmung überhaupt sicher sein bei diesem enormen Stress? Sie hatte etwas bemerkt und auf einen hochgefährlichen Täter bei akuter Fluchtgefahr das Feuer eröffnet.
So würde sie es später zu Protokoll geben. Wenn sie clever war. Bilke winkte Sebastian noch kurz zu und wandte sich zur Tür. Dann hielt sie inne, wies auf das letzte Stück angeschmolzener Schokolade, das sie immer noch in der Hand hielt, und fragte:
»Hast du noch so einen?«
Sebastian öffnete lächelnd die Schublade und gab ihr die Packung mit, in der noch mehrere Riegel enthalten waren. Bilke nahm sie dankbar an und machte sich auf den Weg.
Das Büro des Polizeipsychologen war im oberen Geschoss. Sie nahm wie immer das Treppenhaus und aß auf dem Weg noch einen Riegel. Ihr Hunger verlangte eigentlich nach einer wesentlich massiveren Mahlzeit, aber dazu war jetzt nicht die Gelegenheit. Wieder bereute Bilke, zu dem ersten Kaffee zuhause nichts gegessen zu haben.
Bevor sie anklopfte, hielt sie inne und sah erst auf das Namensschild am Eingang, dann auf die Uhr. Sie war zwei Minuten zu spät. Kein Problem. Und überhaupt – Menschen, die in nicht kritischen Situationen überpünktlich erschienen, waren Bilke suspekt.
Dann prüfte sie, ob sie Schokolade an den Fingern hatte. An ihrem Zeigefinger wurde Bilke fündig. Sie lutschte ihn sorgfältig ab und rieb ihn an der Jeans trocken. Dann atmete sie noch einmal tief durch und trat ein. Als sie die Tür schon halb geöffnet hatte, holte sie noch schnell das Anklopfen nach.
»Frau Sand. Kommen Sie herein – na ja, Sie sind ja schon drin«, sagte der Mann, der hinter dem Schreibtisch saß, mit einem breiten Grinsen. Er stand auf, offenbar um seinen Tisch zu verlassen und Bilke zu begrüßen, doch sie war schnell herangetreten und streckte im ihre Hand entgegen, die er ergriff und energisch schüttelte.
»Guten Tag, Herr Jacobs.«
»Frau Sand, wie schön dass Sie hier sind, bitte setzen Sie sich doch.«
Bilke sah sich um. »Keine Couch?
Der Psychologe lachte laut auf, als wäre das ein Witz, den er noch nie gehört hatte. Er ließ sich selbst wieder nieder, nachdem sie Platz genommen hatte.
»Nein, ein ganz normaler Stuhl. Dürfte sich nicht von der Ausstattung in Ihrem Büro unterscheiden, oder?«
Bilke fragte sich, ob er damit andeuten wollte, dass sie Gemeinsamkeiten hatten oder gar so etwas wie Kollegen waren, um damit eine kooperative Gesprächsatmosphäre zu schaffen.
»Nee, kommt mir ziemlich bekannt vor«, sagte sie.
Dr. Jacobs blieb bei seinem freundlichen Gesicht. »Sagen Sie mal, ich habe Sie heute beim besten Willen nicht erwartet.«
»Wieso? Weil ich schon drei mal verschoben habe?«
»Aber nein. Heute hätten Sie den allerbesten Grund für eine neuerliche Terminverschiebung gehabt. Die Festnahme und die turbulenten Umstände haben hier ziemlich die Runde gemacht. Sie müssen jetzt alles andere im Kopf haben als unser Gespräch.« »Stimmt irgendwie.« Bilke merkte, dass er begann, sie für sich einzunehmen. Schien gar kein so übler Kerl zu sein. Oder ein guter Schauspieler. Vielleicht auch beides.
»Ehrlich gesagt, ich bin ziemlich müde.«
»Aber sicherlich doch auch froh und stolz, oder? Ich muss Ihnen zu Ihrem Erfolg gratulieren.«
»Danke.«
»Sie scheinen sich nicht wirklich zu freuen. So ein Erfolg nach den Anstrengungen einer monatelangen Hochdruckermittlung, das muss doch gut tun.«
»Schon. Vielleicht kommt das noch, wenn ich ein- oder zwei Nächte normal durchgeschlafen habe.«
»Verstehe. Und warum sind Sie jetzt hier?«
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: