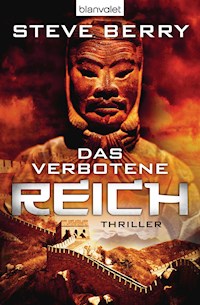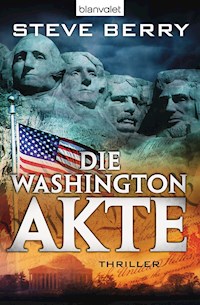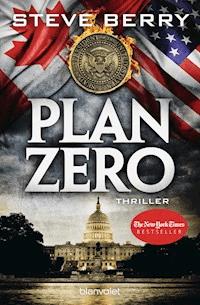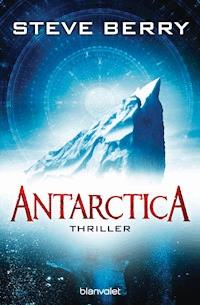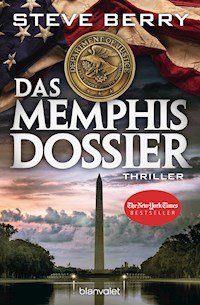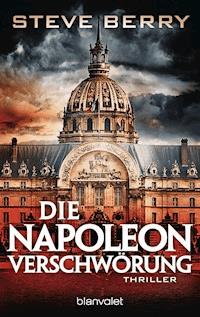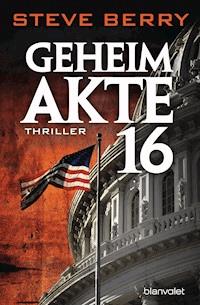9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Cotton Malone
- Sprache: Deutsch
Das größte Geheimnis der britischen Krone wird Europa ins Chaos stürzen ...
Cotton Malone will mit seinem Sohn Gary in den Urlaub, als er in letzter Minute einen Auftrag erhält: Er soll den Teenager Ian, der zuvor versucht hatte, ohne Papiere in die USA einzureisen, der Polizei übergeben. Doch statt der vereinbarten Übergabe wird Malone niedergeschlagen und Gary von Unbekannten entführt, Ian kann in letzter Sekunde flüchten. Die Entführer scheinen hinter einem Dokument her zu sein, das nur Ian beschaffen kann und in dem das bestgehütete Geheimnis der englischen Monarchie enthüllt wird. Ein Geheimnis, das eine große Gefahr für den Frieden in Europa bedeutet …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 599
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Buch
Der fünfzehnjährige Ian, der sich in London als Taschendieb über Wasser hält, kommt durch Zufall in den Besitz von Unterlagen, die ein wohlgehütetes und brisantes Geheimnis des britischen Königshauses enthüllen. Als er sich plötzlich mit kaltblütigen Verfolgern konfrontiert sieht, die hinter den geheimen Dokumenten her sind und ihm nach dem Leben trachten, flüchtet er. Cotton Malone erhält unterdessen den Auftrag, den Jugendlichen zurück nach England zu bringen. Doch die Übergabe geht schief, und Malones Sohn Gary wird von Unbekannten entführt. Was zunächst wie ein einfacher Auftrag erschien, entwickelt sich bald zu einer Hetzjagd, denn auchCIAund der britische Geheimdienst sind hinter Cotton Malone und Ian her. Und Malone erkennt bald: Sie beide sind Mitwisser eines Geheimnisses, das genug Sprengkraft besitzt, um Großbritannien ins Chaos zu stürzen.
Autor
Steve Berry war viele Jahre als erfolgreicher Anwalt tätig, bevor er seine Leidenschaft für das Schreiben entdeckte. Mit jedem seiner hochspannenden Thriller stürmt er in denUSAdie Spitzenplätze der Bestsellerlisten und begeistert Leser in über 50 Ländern. Steve Berry lebt mit seiner Frau in St. Augustine, Florida.
Ebenfalls von Steve Berry lieferbar:
Antarctica (37335), Der Korse (37676), Das verbotene Reich (37864), Die Washington-Akte (38077), Die Kolumbus-Verschwörung (38279)
STEVE BERRY
DAS
KÖNIGS
KOMPLOTT
Thriller
Aus dem Amerikanischen
von Barbara Ostrop
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen. Die Originalausgabe erschien 2013 unter dem Titel
»The King’s Deception« bei Ballantine Books, New York.
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet
und www.twitter.com/BlanvaletVerlag.
1. Auflage
Deutsche Erstveröffentlichung Juli 2015 bei Blanvalet,
einem Unternehmen der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München..
Copyright © der Originalausgabe 2013 by Steve Berry
Published by arrangement with Magellan Billet Inc.
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische
Agentur Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen.
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2015 by Blanvalet Verlag,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH, München.
Umschlaggestaltung: Johannes Frick
Umschlagmotiv: Shutterstock
BS · Herstellung: sam
Redaktion: Werner Bauer
Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach
ISBN: 978-3-641-15775-3V002
www.blanvalet.de
Für Jessica Johns und Esther Garver
»Ich sage euch, mein Thron war der Thron von Königen.
Ich lasse nicht zu, dass ein Schurke mir nachfolgt,
und wer sollte mir nachfolgen, wenn nicht ein König?«
– Elisabeth I.
Prolog
Whitehall Palace
28. Januar 1547
Katherine Parr erkannte, dass das Ende nahe war. Es würden nur noch wenige Tage verbleiben, vielleicht sogar nur noch ein paar Stunden. Sie hatte die letzte halbe Stunde schweigend dabeigestanden und zugeschaut, wie die Ärzte ihre Untersuchung beendeten. Nun würden sie gleich ihr Urteil sprechen.
»Sire«, sagte einer von ihnen, »alle menschliche Hilfe ist nun vergebens. Es ist die Zeit gekommen, Euer Leben zu überdenken und Gottes Gnade durch Jesus zu suchen.«
Sie beobachtete, wie Heinrich VIII. über diesen Ratschlag nachdachte. Der König hatte bäuchlings im Bett gelegen und laute Schmerzensschreie ausgestoßen. Nun verstummte er, hob den Kopf und fasste den Überbringer der Nachricht ins Auge. »Welcher Richter hat dich geschickt, mir dieses Urteil zu verkünden?«
»Wir sind Eure Ärzte. Gegen dieses Urteil gibt es keine Berufung.«
»Verschwindet«, schrie Heinrich. »Alle miteinander.«
Auch todkrank war der König noch immer der Herrscher. Die Ärzte eilten rasch aus der Schlafkammer hinaus, gefolgt von den erschreckten Höflingen.
Auch Katherine wandte sich zum Gehen.
»Gute Königin, ich bitte Euch, bleibt«, sagte Heinrich.
Sie nickte.
Sie waren allein.
Er schien sich aufzuraffen.
»Wenn ein Mensch sich den Bauch mit Wildbret und Schweinebraten, mit Rindfleisch und Kalbspasteten vollschlägt und all dies mit Fluten von Bier und Wein hinunterspült, die niemals eine Nippflut sind.« Heinrich stockte. »Dann wird er in einer schwarzen Stunde Unkraut statt Weizen ernten. Sein dicker Wanst wird ihn nicht glücklicher machen. So, meine Königin, steht es mit mir.«
Ihr Mann sagte die Wahrheit. Eine selbstgewählte Krankheit hatte ihn verzehrt, eine Krankheit, an der er von innen heraus verfault war und die sein Lebensfeuer erstickt hatte. Er war so prall und rund, dass er kurz vor dem Platzen zu stehen schien; er konnte sich keinerlei Bewegung mehr verschaffen und war so träge wie ein Berg von Talg. Dieser Mann, der in seiner Jugend äußerst gut ausgesehen hatte, der Burggräben überspringen konnte und der bester Bogenschütze Englands gewesen war, der bei Turnieren geglänzt, Armeen geführt und Päpste besiegt hatte – jetzt könnte er noch nicht einmal mehr ein Fürstenkind umschubsen oder auch nur ohne Mühe die Hand heben. Er war ein dicker Kloß geworden, seine Augen lagen zwischen Fettwülsten und sein schwabbeliges Gesicht hatte ein Doppelkinn. Er sah aus wie ein Schwein.
Abstoßend hässlich.
»Sire, Ihr sprecht grundlos schlecht von Euch«, erwiderte sie. »Ihr seid mein Lehnsherr, dem ich und ganz England Gefolgschaft schulden.«
»Aber nur, solange ich noch atme.«
»Was Ihr ja weiter tut.«
Sie kannte ihren Platz. Wenn der eine Partner alle Macht besaß und der andere keine, war es ein gefährliches Vergnügen, einen Ehestreit anzuzetteln. Doch auch wenn sie schwach war, so war sie doch nicht ohne Waffen. Treue, Freundlichkeit, Schlagfertigkeit, beständige Sorge für ihn und eine hervorragende Auffassungsgabe – damit ließ sich arbeiten.
»Ein Mann kann seinen eigenen Samen tausendmal säen«, sagte sie. »Wenn er sich vor der Pest hütet und auch sonst gut und gesund lebt, mag er am Ende noch stark wie eine Eiche dastehen und wie ein Hirsch springen, der über sein Rudel herrscht. Das seid Ihr, mein König.«
Er öffnete die fette Hand, und sie legte ihre hinein. Seine Haut war kalt und klamm, und sie fragte sich, ob der Tod ihn schon in den Fängen hielt. Er war sechsundfünfzig Jahre alt und herrschte seit beinahe achtunddreißig Jahren. Er hatte sechsmal geheiratet und fünf von ihm anerkannte Kinder gezeugt. Er hatte die Welt herausgefordert, der katholischen Kirche getrotzt und seine eigene Konfession gegründet. Sie war die dritte Frau namens Katherine, die er geheiratet hatte, und sie würde wohl Gott sei Dank auch die letzte bleiben.
Das schenkte ihrem Herzen Hoffnung.
Mit diesem Tyrannen verheiratet zu sein war kein Vergnügen gewesen, aber sie hatte ihre Pflicht getan. Sie hatte nicht seine Frau werden und lieber seine Geliebte sein wollen, denn seinen Ehefrauen war es schlecht ergangen. Nein, werte Dame, hatte er geantwortet, ich möchte Euch in der bedeutenderen Rolle sehen. Sie hatte bei diesem Angebot bewusst keine Begeisterung gezeigt und auf seine königlichen Gesten verhalten reagiert, da ihr bewusst war, dass Heinrich mit zunehmendem Alter immer schneller Köpfe hatte rollen lassen. Vorsicht war nach ihrem Dafürhalten der einzige Weg zu einem langen Leben. Und so hatte sie, da ihr keine andere Wahl blieb, Heinrich VIII. Tudor in einer großen Zeremonie vor den Augen der Welt geheiratet.
Nun näherten sich vier Jahre ehelicher Qual ihrem Ende.
Aber sie behielt ihre Freude für sich, verzog ihr Gesicht zu einer Maske der Sorge und legte etwas in ihren Blick, was sich nur als Liebe deuten ließ. Sie war geübt darin, sich ältere Männer geneigt zu halten, nachdem sie bereits zwei todkranke Gatten auf dem Sterbebett gepflegt hatte. O ja, sie wusste, welche Opfer diese Rolle verlangte. Wie oft hatte sie das stinkende, von Geschwüren bedeckte Bein des Königs auf ihren Schoß genommen und mit warmen Umschlägen und Salben versorgt, ihn beruhigt und seine Schmerzen gelindert! Sie war die Einzige, die das bei ihm machen durfte.
»Meine Liebe«, flüsterte der König. »Ich habe eine letzte Pflicht für Euch.«
Sie nickte. »Der kleinste Wunsch Eurer Majestät ist diesem Land Gesetz.«
»Es gibt ein Geheimnis. Ich habe es lange Zeit bewahrt. Mein Vater hat es mir anvertraut. Ich möchte, dass es an Eduard weitergegeben wird, und bitte Euch, das zu tun.«
»Was auch immer ich für Euch tun soll, es wäre mir eine Ehre.«
Der König schloss die Augen, und sie sah, dass die wenigen Minuten ohne Schmerzen vorbei waren. Er riss den Mund auf und schrie: »Mönche. Mönche!«
In seinem Schrei lagen Angst und Entsetzen.
Hatten sich die Geister der verbrannten Kleriker um sein Bett versammelt und verhöhnten seine sterbende Seele? Heinrich hatte die Klöster geschleift, sich ihres Besitzes bemächtigt und ihre Bewohner abgestraft. Von ihrer ehemaligen Größe waren nur noch Ruinen und Leichen übrig.
Er schien sich wieder in die Gewalt zu bekommen und kämpfte die Vision zurück. »Auf dem Sterbebett hat mein Vater mir von einem geheimen Ort berichtet, der nur für die Tudors bestimmt ist. Ich habe diesen Ort hochgehalten und mir gut zunutze gemacht. Mein Sohn muss davon erfahren. Werdet Ihr es ihm sagen, meine Königin?«
Sie war erstaunt, dass dieser Mann, der im Leben so unbarmherzig hart gewesen war, der allem und jedem misstraut hatte, sie nun, in seiner Todesstunde, ins Vertrauen zog. Sie fragte sich, ob das wieder eine List war, um sie in die Falle zu locken. Das hatte er vor vielen Monaten schon einmal versucht, als sie ihn zu sehr wegen Religionsangelegenheiten bedrängt hatte. Bischof Gardiner von Winchester hatte diesen Fehler sofort ausgenutzt und sich die königliche Genehmigung verschafft, gegen sie zu ermitteln und sie einzusperren. Zum Glück hatte sie rechtzeitig von dem Plan erfahren, und es war ihr gelungen, sich wieder die Gunst des Königs zu verschaffen. Letztlich war es dann Gardiner gewesen, den man vom Hof verbannt hatte.
»Ich tue selbstverständlich gerne, was immer Ihr von mir verlangt«, erklärte sie. »Aber warum sagt Ihr es Eurem lieben Sohn und Erben nicht selbst?«
»Er darf mich nicht so sehen. Ich habe keinem meiner Kinder erlaubt, mich so zu sehen. Nur Euch, mein Liebling. Ich muss mir sicher sein, dass Ihr Eure Pflicht tut und diesen Auftrag ausführt.«
Sie nickte erneut. »Daran besteht kein Zweifel.«
»Dann hört mir zu.«
Cotton Malone wusste, dass eine Lüge besser wäre, beschloss aber, im Rahmen seiner neuen Strategie der Zusammenarbeit mit seiner Exfrau die Wahrheit zu sagen. Pam beobachtete ihn so angespannt, wie er das auch schon früher bei ihr erlebt hatte. Nur musste sie diesmal mit einer schwierigen Tatsache fertigwerden, und dadurch war ihr Blick weicher.
Er wusste etwas, das sie nicht wusste.
»Was hat der Tod Heinrichs VIII. mit dem zu tun, was dir vor zwei Jahren zugestoßen ist?«, fragte sie.
Er hatte angefangen, ihr die Geschichte zu erzählen, dann aber innegehalten. Sehr lange hatte er nicht mehr an diese Stunden in London gedacht, die auf mehr als nur eine Weise erhellend gewesen waren. Eine Vater-Sohn-Erfahrung, die nur ein Exagent des US-Justizministeriums überleben konnte.
»Vor ein paar Tagen haben Gary und ich die Nachrichten geschaut«, berichtete Pam. »Ein libyscher Terrorist, der Mann, der in den 1980ern für den Bombenanschlag auf das Flugzeug in Schottland verantwortlich war, ist an Krebs gestorben. Gary sagte, er wisse alles über ihn.«
Malone hatte im TV dieselbe Nachricht gesehen. Abdelbaset al-Megrahi war seiner Krankheit nun endlich erlegen. Der ehemalige Geheimdienstoffizier wurde 1988 des 270-fachen Mordes angeklagt, mit dem Vorwurf, die Maschine des Pan-Am-Flugs 103 über Lockerbie, Schottland, in die Luft gejagt zu haben. Aber erst im Januar 2001 verkündeten drei schottische Richter an einem Sondergericht in den Niederlanden den Schuldspruch und eine lebenslange Haftstrafe.
»Was hat Gary sonst noch erzählt?«, wollte Malone wissen.
Je nachdem, was sein inzwischen siebzehn Jahre alter Sohn preisgegeben hatte, könnte Malone sich entsprechend bedeckt halten.
Das hoffte er zumindest.
»Nur, dass ihr beide in London mit diesem Terroristen zu tun hattet.«
Das entsprach nicht ganz der Wahrheit, aber er war stolz auf das Ausweichmanöver seines Sohns. Jeder gute Geheimagent wusste, dass man mit offenen Ohren und geschlossenem Mund am weitesten kam.
»Alles, was ich bisher wusste, war, dass Gary vor zwei Jahren über die Thanksgiving-Ferien zu dir nach Kopenhagen geflogen war. Und nun erfahre ich, dass er stattdessen in London war. Keiner von euch beiden hat je ein Wort darüber verloren.«
»Du wusstest doch, dass ich dort auf dem Heimflug einen Zwischenstopp machen musste.«
»Ein Zwischenstopp? Sicher. Aber dieser Vorfall war mehr, das weißt du.«
Sie waren inzwischen seit vier Jahren geschieden. Nach achtzehn Jahren Ehe. Seine ganze Zeit als Navy-Offizier hatte er mit Pam verbracht. Als er dann auf Jurist umgesattelt und beim Justizministerium angefangen hatte, war er immer noch mit ihr verheiratet gewesen, aber seine Karriere als Agent des Magellan Billet hatte er zwölf Jahre später als ihr Exmann beendet.
Sie waren nicht im Guten geschieden.
Aber schließlich hatten sie ihre Probleme doch noch geklärt und sich arrangiert.
Das war vor zwei Jahren gewesen.
Bevor die Sache in London passiert war.
Vielleicht sollte er ihr alles erzählen.
Schluss mit den Geheimnissen, oder?
»Bist du dir sicher, dass du das hören willst?«
Sie saßen am Küchentisch des Hauses in Atlanta, in das Pam und Gary vor der Scheidung umgezogen waren. Unmittelbar nach dem Ende seiner Ehe hatte er Georgia verlassen und war in dem Glauben, die Vergangenheit hinter sich zu lassen, nach Dänemark gegangen.
Wie sehr man sich nur irren konnte.
Wollte er selbst sich eigentlich noch einmal anhören, was passiert war?
Eigentlich nicht.
Aber vielleicht war es gut für sie beide.
»Okay, ich erzähle es dir.«
ERSTER TEIL
Zwei Jahre zuvor
1
London
Freitag, 21. November
06.25 Uhr
Cotton Malone trat ans Fenster der Passkontrolle im Flughafen Heathrow und legte zwei Ausweise vor – seinen und den seines Sohnes Gary. Es gab jedoch noch ein Problem.
Den fünfzehnjährigen Ian Dunne.
»Der Junge hier hat keinen Reisepass«, erklärte er dem Beamten und erläuterte dann, wer er war und was er hier machte. Ein kurzer Anruf, und Ian erhielt die Genehmigung, wieder ins Land einzureisen.
Das überraschte Malone durchaus nicht. Heißt, er ging davon aus, dass die CIA den Jungen in England haben wollte und die erforderlichen Maßnahmen getroffen hatte.
Er war müde von dem langen Flug, auch wenn es ihm gelungen war, ein paar Stunden zu schlafen. Sein Knie tat ihm noch von dem Tritt weh, den Ian ihm im Flughafen von Atlanta versetzt hatte, bevor er zu fliehen versucht hatte. Zum Glück hatte Malones eigener, ebenfalls fünfzehnjähriger Sohn Gary das schottische Früchtchen zu fassen bekommen, bevor es aus der Abfertigungshalle entkommen konnte.
So war es halt, wenn man einem Freund einen Gefallen tat.
Damit gab es immer Probleme.
Diesmal hatte ihn seine ehemalige Chefin beim Magellan Billet, Stephanie Nelle, darum gebeten.
»Es ist dieCIA«, hatte sie ihm erklärt. Jemand vom Hauptquartier in Langley hatte selbst bei ihr angerufen. Irgendwie hatte man bei der Agency gewusst, dass Malone in Georgia war, und wollte, dass er den Jungen nach London zurückbegleitete und dort der Metropolitan Police übergab. Danach könnten er und Gary nach Kopenhagen weiterfliegen. Zum Ausgleich hatte er First-Class-Tickets bis Dänemark erhalten.
Nicht schlecht. Ursprünglich hatte er Economy-Class gebucht.
Vier Tage zuvor war er aus zwei Gründen nach Georgia geflogen. Die Anwaltsvereinigung von Georgia verlangte von allen zugelassenen Anwälten zwölf Stunden Fortbildung im Jahr. Auch wenn er seinen Dienst bei der Navy und beim Magellan Billet quittiert hatte, wollte er doch seine Zulassung nicht verlieren, und das bedeutete, dass er den Fortbildungsvorschriften nachkommen musste. Letztes Jahr hatte er in diesem Rahmen an einer Veranstaltung in Brüssel teilgenommen, einer dreitägigen Konferenz. Thema: multinationale Eigentumsrechte. Dieses Jahr hatte er sich für ein Seminar in Atlanta zum Thema internationales Recht entschieden. Nicht gerade die aufregendste Art, zwei Tage zu verbringen, aber er hatte zu hart für seine Zulassung gearbeitet, um sie jetzt einfach aufzugeben.
Der zweite Grund war ein persönlicher gewesen.
Gary hatte ihn gebeten, Thanksgiving bei ihm verbringen zu dürfen. Es waren Schulferien, und seine Exfrau Pam hatte die Reise nach Europa für eine gute Idee gehalten. Er hatte sich gefragt, warum sie so zurückhaltend war, und hatte es eine Woche zuvor herausgefunden, als Pam ihn in seinem Buchladen in Kopenhagen angerufen hatte.
»Gary ist wütend«, sagte sie. »Er stellt massenhaft Fragen.«
»Fragen, die du nicht beantworten möchtest?«
»Die Antwort wird mich einiges kosten.«
Das war eine Untertreibung. Vor einem halben Jahr hatte sie ihm bei einem anderen Anruf aus Atlanta eine nur schwer zu verdauende Tatsache enthüllt: Gary war nicht sein leiblicher Sohn. Der Junge war vielmehr vor sechzehn Jahren einer Affäre mit einem andern Mann entsprungen.
Nun hatte sie diese Tatsache auch Gary erzählt, und der war alles andere als glücklich. Für Malone war die Nachricht niederschmetternd gewesen. Er konnte sich gut vorstellen, wie schlimm sie für Gary sein musste.
»Keiner von uns beiden war damals ein Heiliger, Cotton.«
Das rief sie ihm gerne in Erinnerung – als ob er irgendwie vergessen hätte, dass ihre Ehe angeblich wegen seiner Fehler zerbrochen war.
»Gary möchte mehr über seinen leiblichen Vater erfahren.«
»Ich auch.«
Sie hatte ihm nichts über den Mann erzählt und ihm die Bitte um Auskunft abgeschlagen.
»Er hat nichts mit uns zu tun«, sagte sie. »Er ist uns allen vollkommen fremd. Genau wie die Frauen, mit denen du zusammen warst, nichts mit dem hier zu tun haben. Ich möchte diese Tür nicht aufmachen. Niemals.«
»Warum hast du es Gary erzählt? Wir waren uns doch einig, dass wir das zur rechten Zeit gemeinsam tun würden.«
»Ich weiß, ich weiß. Meine Schuld. Aber es musste sein.«
»Warum?«
Sie antwortete nicht. Aber er konnte sich den Grund denken. Sie hatte gerne die Kontrolle. Über alles. Und das war hier nicht der Fall. Nun, tatsächlich hatte die hier überhaupt niemand.
»Er hasst mich«, sagte sie. »Das sehe ich in seinen Augen.«
»Du hast das Leben des Jungen vollkommen durcheinandergebracht.«
»Er hat mir heute gesagt, dass er eventuell gern bei dir leben würde.«
»Du weißt, dass ich das niemals ausnutzen würde«, erwiderte er. Das musste er einfach sagen.
»Ja, ich weiß. Das alles ist meine Schuld, nicht deine. Er ist so wütend. Vielleicht würde es besser, wenn er eine Woche mit dir zusammen wäre.«
Malone war längst klar, dass er Gary keine Spur weniger liebte, nur weil er nicht der Träger seiner Gene war. Aber er würde sich selbst belügen, wenn er behauptete, dass die Tatsache ihm nicht zu schaffen machte. Es war jetzt ein halbes Jahr her, und doch tat ihm die Wahrheit noch immer weh. Warum? Das wusste er selbst nicht recht. Er war Pam in seiner Zeit bei der Navy nicht treu gewesen. Er war jung und dumm gewesen und ertappt worden. Aber jetzt wusste er, dass sie auch selbst eine Affäre gehabt hatte. Damals hatte sie kein Wort darüber verloren. Wäre es auch zu diesem Fehltritt gekommen, wenn er selbst ihr keinen Anlass dazu gegeben hätte?
Das bezweifelte er. Es entsprach nicht ihrem Charakter.
Er war also durchaus nicht schuldlos an dem gegenwärtigen Schlamassel.
Er und Pam waren schon seit mehr als einem Jahr geschieden, hatten aber erst letzten Oktober Frieden geschlossen. Was damals in Verbindung mit der Bibliothek von Alexandria geschehen war, hatte alles zwischen ihnen verändert.
Zum Besseren.
Aber nun das.
Der eine Junge, den er unter seiner Obhut hatte, war wütend und verwirrt; und der andere schien ein Kleinkrimineller zu sein.
Stephanie hatte ihm einiges berichtet. Ian Dunne war in Schottland geboren. Der Vater war unbekannt, die Mutter hatte ihn früh im Stich gelassen. Man hatte ihn nach London geschickt, um bei einer Tante zu leben, und dort hatte er sich viel auf der Straße herumgetrieben und war schließlich weggelaufen. Er war mehrmals verhaftet worden – wegen kleinerer Diebstähle, Hausfriedensbruch und Herumlungern. Die CIA suchte ihn, weil vor einem Monat einer ihrer Leute vor eine einfahrende U-Bahn gestoßen worden oder vielleicht auch selbst gesprungen war. Dunne war damals in der U-Bahn-Station Oxford Circus ganz in der Nähe gewesen. Laut Zeugenaussagen mochte er dem Toten sogar etwas gestohlen haben. Daher mussten sie mit ihm reden.
Gut war das nicht, aber es ging Malone ja nichts an.
In ein paar Minuten hatte er erledigt, worum Stephanie Nelle ihn gebeten hatte, und war hier fertig. Dann würden Gary und er den Anschlussflug nach Kopenhagen nehmen und die Woche genießen, oder auch nicht, je nachdem, wie viele unangenehme Fragen sein Sohn ihm stellen würde. Der kleine Haken war, dass der Flug nach Dänemark nicht von Heathrow abging, sondern von Gatwick, Londons zweitem Großflughafen, der eine Fahrstunde entfernt im Süden lag. Bis zum Abflug hatten sie noch mehrere Stunden Zeit, und so war das kein Problem. Er musste einfach nur ein paar Dollar in Pfund umtauschen und mit Gary ein Taxi nehmen.
Sie verließen die Passkontrolle und gingen zur Gepäckausgabe.
Sowohl er als auch Gary hatten leicht gepackt.
»Wird die Polizei mich abholen?«, fragte Ian.
»So hat man es mir gesagt.«
»Wie geht es mit ihm weiter?«, fragte Gary.
Malone zuckte mit den Schultern. »Schwer zu sagen.«
Das stimmte. Umso mehr, als die CIA involviert war.
Er schulterte seine Reisetasche und führte beide Jungen aus der Gepäckhalle.
»Kann ich meine Sachen haben?«, bat Ian.
Als Malone den Jungen in Atlanta übernommen hatte, hatte man ihm auch eine Plastiktüte ausgehändigt, in der ein Schweizermesser mit allen möglichen Werkzeugklingen, ein Halsband aus Zinn mit einem religiösen Anhänger, eine Pfefferspraydose, eine silbrig glänzende Schere und zwei Taschenbücher mit fehlenden Covern lagen.
IvanhoeundLe Morte d’Arthur.
Die Ränder zeigten Wasserflecken, und die Buchrücken waren von dicken, weißen Falten geädert. Bei beiden Büchern handelte es sich um über dreißig Jahre alte Ausgaben. Auf der Titelseite prangte der Stempel: Bücher, Secondhand und Antiquarisch, darunter eine Adresse am Piccadilly Circus in London. Er selbst versah seine Bestände mit einem ähnlichen Aufdruck. Bei ihm lautete er einfach: Cotton Malone, Buchhändler, Højbro Plads, Kopenhagen. Die Gegenstände in der Tüte gehörten alle Ian und waren ihm von den Grenzbeamten abgenommen worden, als er am Miami International Airport versucht hatte, illegal in die USA einzureisen.
»Das entscheidet die Polizei«, antwortete Malone. »Meine Anweisungen lauten, dass ich dich und die Tüte an sie übergeben soll.«
Er hatte das Bündel in seine Reisetasche gestopft, und dort würde es bleiben, bis die Polizei den Jungen übernahm. Insgeheim erwartete er einen Fluchtversuch von Ian, und so blieb er auf der Hut. Weiter vorn erblickte er zwei Herren in dunklen Anzügen, die auf sie zukamen. Der Mann zur Rechten, klein, untersetzt und braunhaarig, stellte sich als Inspector Norse vor.
Er reichte Malone die Hand, und dieser schüttelte sie.
»Dies hier ist Inspector Devene. Wir gehören zur Metropolitan Police. Man hat uns bereits informiert, dass Sie den Jungen begleiten würden. Wir sind hier, um Sie zum Flughafen Gatwick zu bringen und Master Dunne in unsere Obhut zu nehmen.«
»Vielen Dank für den Transport. Ich hatte mich nicht gerade auf ein teures Taxi gefreut.«
»Das ist das Mindeste, was wir tun können. Unser Wagen steht draußen. Eines der Privilegien als Polizist ist, dass wir parken können, wo wir wollen.«
Der Mann lächelte Malone an.
Sie gingen in Richtung Ausgang.
Malone fiel auf, dass Inspector Devene sich hinter Ian platzierte. Klug von ihm, dachte er.
»Haben Sie dafür gesorgt, dass er ohne Pass hier einreisen kann?«
Norse nickte. »Genau, zusammen mit noch ein paar anderen Leuten, die uns unterstützt haben. Ich denke, Sie wissen über sie Bescheid.«
Das war in der Tat der Fall.
Sie traten aus der Flughafenhalle in den kühlen Morgen hinaus; eine dichte Wolkendecke verlieh dem Himmel ein deprimierendes Grau. Am Straßenrand wartete eine blaue Mercedes-Limousine. Norse machte hinten auf, bedeutete Gary mit einer Geste, als Erster einzusteigen, und winkte dann Ian und Malone hinterher. Der Inspector blieb draußen stehen, bis sie alle saßen, und schloss dann die Tür. Norse saß auf dem Beifahrersitz, während Devene fuhr. Sie verließen den Flughafen rasch und bogen auf die Autobahn M4 ein. Malone kannte die Strecke, denn London war ihm recht vertraut. Vor Jahren hatte er einige Aufträge in England erledigt; auch in seiner Navy-Zeit war er ein Jahr lang hier stationiert gewesen. Der Verkehr wurde immer dichter, je mehr sie sich in östlicher Richtung der City näherten.
»Haben Sie etwas dagegen, wenn wir auf dem Weg nach Gatwick noch kurz wo vorbeifahren?«, fragte ihn Norse.
»Überhaupt nicht. Wir haben genug Zeit bis zu unserem Flug. Bei einer kostenlosen Fahrt ist das ja wohl das Mindeste.«
Malone musterte Ian, der aus dem Fenster schaute. Unwillkürlich fragte er sich, was wohl mit dem Jungen geschehen würde. Stephanies Prognose war nicht gut gewesen: ein Straßenjunge ohne Familie, ganz auf sich selbst gestellt. Im Gegensatz zum schwarzhaarigen Gary mit seinem dunklen Teint war Ian blond und hatte eine helle Haut. Trotz allem wirkte er wie ein netter Junge. Nur hatte er schlechte Karten bekommen. Aber wenigstens war er jung, denn Jugend eröffnete einem Chancen, und daraus konnte sich alles Mögliche ergeben. Was für ein Gegensatz zu Gary und dessen viel konventionellerem und sichererem Leben.
Ein warmer Luftzug wehte durch den Wagen; der vom Jetlag erschöpfte Malone gab der Versuchung nach und schloss die Augen.
Als er aufwachte, warf er einen Blick auf die Uhr und stellte fest, dass er etwa eine Viertelstunde geschlafen hatte. Er riss sich zusammen und zwang sich, munter zu werden. Gary und Ian saßen noch immer still da. Der Himmel hatte sich weiter zugezogen, ein Unwetter näherte sich der Stadt. Er begutachtete das Wageninnere, und zum ersten Mal fiel ihm auf, dass eine Funkausstattung fehlte. Auch die Fußmatten waren picobello und die Sitzpolster wie neu. In so einem Polizeiwagen hatte er noch nie gesessen.
Dann fasste er Norse näher ins Auge.
Das kastanienbraune Haar des Mannes war auf Höhe der Ohrläppchen geschnitten. Nicht gestuft, sondern unten dick und dicht. Sauber rasiert, ein wenig Übergewicht. Er war angemessen mit Anzug und Krawatte gekleidet, aber Malone fiel das linke Ohrläppchen auf. Es hatte ein Loch. Zwar steckte kein Ohrring darin, aber der Einstich war deutlich zu sehen.
»Was mir gerade durch den Kopf geht, Inspector. Darf ich vielleicht einmal Ihren Polizeiausweis sehen? Das hätte ich Sie schon am Flughafen fragen sollen.«
Norse antwortete nicht. Die Frage weckte Ians Aufmerksamkeit, und er betrachtete Malone mit einem neugierigen Blick.
»Haben Sie mich gehört, Norse? Ich würde gerne Ihren Polizeiausweis sehen.«
»Genießen Sie einfach die Fahrt, Malone.«
Diese kurz angebundene Art passte Malone gar nicht, und so zog er sich an der Rückenlehne des Vordersitzes vor, um seiner Frage Nachdruck zu verleihen.
An der Kopfstütze vorbei lugte ihm plötzlich ein Pistolenlauf entgegen.
»Reicht Ihnen das als Nachweis?«, fragte Norse.
»Eigentlich hatte ich auf einen Polizeiausweis mit Foto gehofft.« Er deutete auf die Waffe. »Seit wann wird die Metropolitan Police denn mit Glocks ausgerüstet?«
Keine Antwort.
»Wer sind Sie?«
Die Pistole schwankte zu Ian hinüber. »Sein Hüter.«
Ian griff an Gary vorbei und rüttelte am verchromten Griff der Tür, aber die ging nicht auf.
»So eine Kindersicherung ist was Feines«, meinte Norse. »Da können die lieben Kleinen sich nicht davonmachen.«
»Möchtest du mir erklären, was hier läuft, mein Junge?«, fragte Malone.
Ian erwiderte nichts.
»Diese Männer haben offensichtlich einen ganz schönen Aufwand betrieben, um deine Bekanntschaft zu machen.«
»Rutschen Sie nach hinten, Malone«, sagte Norse. »Die Sache geht Sie nichts an.«
Malone lehnte sich wieder hinten an. »Da sind wir uns einig.«
Nur war es halt so, dass auch sein eigener Sohn mit im Wagen saß.
Norse schaute sich immer noch zu ihnen um und hielt Blick und Waffe fest auf Malone gerichtet.
Der Wagen setzte seine Fahrt durch den morgendlichen Stoßverkehr fort.
Malone nahm die vorbeisausende Umgebung in sich auf und versuchte, sich so gut er konnte an die Geografie Nord-Londons zu erinnern. Er erkannte, dass sie gerade eine Brücke über den Regent’s Canal überquert hatten, ein korridorähnlicher Wasserweg, der sich durch London schlängelte und schließlich in die Themse mündete. Stattliche Bäume säumten die vierspurige Uferstraße. Es herrschte starker Verkehr. Dann ging’s zum berühmten Lord’s Cricket Ground. Malone wusste, dass die Baker Street mit Sherlock Holmes’ fiktiver Adresse nur ein paar Kreuzungen weiter lag. Little Venice war nicht weit entfernt.
Sie überquerten den Kanal erneut, und er blickte auf bunt bemalte Hausboote hinunter. Es wimmelte von diesen schmalen, langgezogenen Booten, die nicht höher als drei Meter waren, damit sie unter den niedrigen Brücken hindurchpassten. Eine lange Zeile georgianischer Häuser säumte den Boulevard hinter hohen, herbstkahlen Bäumen.
Devene lenkte den Mercedes in eine Seitenstraße. Zu beiden Seiten Haus an Haus. Es sah hier ganz ähnlich aus wie die Gegend, in der sein ehemaliges Haus in Atlanta stand. Nach weiteren drei Mal Abbiegen fuhren sie auf einen Hof, der auf drei Seiten von Hecken umgrenzt war. Der Mercedes hielt vor einer aus hellen Steinen errichteten Mews, einer ehemaligen Remise.
Norse stieg aus. Devene folgte ihm.
Beide Hintertüren wurden von außen entriegelt.
»Aussteigen«, sagte Norse.
Malone trat auf Kopfsteinpflaster mit smaragdgrünen Flechten in den Fugen. Gary und Ian krabbelten auf der anderen Seite heraus.
Ian versuchte wegzulaufen, doch Norse stieß den Jungen heftig gegen den Wagen.
»Nicht«, rief Malone. »Tut, was er sagt. Du auch, Gary.«
Norse setzte Ian die Pistole an die Kehle. »Rühr dich nicht vom Fleck.« Der Mann drängte den Jungen mit seinem Körper gegen den Wagen. »Wo ist der USB-Stick?«
»Was für ein Stick?«, fragte Malone.
»Stopf ihm das Maul«, knurrte Norse.
Devene rammte Malone die Faust in die Magengrube.
»Dad.« Garys Aufschrei verriet seine Panik.
Malone rang sich krümmend um Atem, machte Gary aber ein Zeichen, dass alles in Ordnung war.
»Der USB-Stick«, wiederholte Norse. »Wo ist er?«
Malone kam hoch, die Arme vor den Bauch gepresst. Devene holte zum nächsten Schlag aus, doch Malone rammte ihm das Knie in den Schritt und verpasste ihm dann einen Kinnhaken.
Auch wenn er nur ein Exagent war und zudem unter Jetlag litt, war er keineswegs hilflos.
Er fuhr rechtzeitig herum, um zu sehen, wie Norse mit der Waffe auf ihn zielte. Bevor ein einzelner Schuss loskrachte, hechtete Malone zu Boden, und die Kugel traf nur die Hecke hinter ihm. Er schaute über die Vordersitze des Mercedes hinweg und erblickte Norse durch die halb geöffneten Türen. Malone sprang auf, drückte sich in einer Schraube von der Motorhaube ab und stemmte die Beine durch das Wageninnere gegen die gegenüberliegende Tür.
Die flog auf, krachte gegen Norse und ließ den falschen Inspector rückwärts gegen die Remisenwand taumeln.
Malone stieß sich durch die offene Tür.
Ian rannte aus dem Hof und auf die Straße.
Malones Blick begegnete dem von Gary. »Lauf ihm nach. Verschwinde von hier.«
Jemand griff ihn von hinten an.
Er krachte mit der Stirn auf feuchten Stein. Eine Schmerzwelle durchfuhr ihn. Er hatte geglaubt, Devene sei außer Gefecht gesetzt.
Fehler!
Ein Arm umklammerte seine Kehle. Zwar versuchte er, sich aus dem Würgegriff zu befreien, doch er lag auf dem Bauch und konnte sich kaum bewegen, und Devene verdrehte ihm schmerzhaft die Halswirbel.
Ihm wurde fast schwarz vor Augen, die Häuser um ihn herum verschwammen.
Blut rann ihm von der Stirn und lief ihm in die Augen.
Das Letzte, was er sah, bevor er das Bewusstsein verlor, waren Ian und Gary, die um eine Ecke verschwanden.
2
Brüssel, Belgien
19.45 Uhr
Blake Antrim war kein Fan von extrem selbstbewussten Frauen. Er ertrug sie, da es in der CIA von Besserwisserinnen wimmelte, aber das bedeutete nicht, dass er sich auch noch nach Feierabend mit ihnen herumschlagen musste. Falls ein Teamführer, der die Verantwortung für neun Agenten in England und ganz Europa trug, überhaupt jemals wirklich Feierabend hatte. Denise Gérard war flämischer und französischer Abstammung, eine hochgewachsene, gertenschlanke Frau mit wunderschönem, dunklem Haar. Ihr Gesicht war ein Hingucker, und ihr Körper weckte das Verlangen, ihn zu umarmen. Sie hatten sich im Musée de la Ville de Bruxelles kennengelernt, wo sie entdeckt hatten, dass sie ihre Liebe zu alten Landkarten, historischer Architektur und Malerei teilten. Seitdem hatten sie viel Zeit miteinander verbracht und von Brüssel aus mehrere Reisen unternommen, unter anderem auch eine nach Paris, was sich als ein denkwürdiger Ausflug erwiesen hatte. Sie war leicht erregbar, verschwiegen und kannte keine Hemmungen.
Ideal.
Aber das war vorbei.
»Was habe ich getan?«, fragte sie mit sanfter Stimme. »Warum jetzt Schluss machen?«
In ihrer Frage lagen weder Trauer noch Bestürzung. Die Worte kamen nüchtern heraus, es war ihre Art, eine Entscheidung, die sie bereits getroffen hatte, auf ihn abzuwälzen.
Und das ärgerte ihn sogar noch mehr.
Sie trug ein frappierend schönes, kurzes Seidenkleid, das sowohl ihre festen Brüste als auch ihre langen Beine betonte. Er hatte immer ihren flachen Bauch bewundert und sich gefragt, ob sie Sport trieb oder ob da ein Schönheitschirurg die Finger im Spiel hatte. Aber ihm waren nie irgendwelche Narben aufgefallen, ihre karamellbraune Haut war glatt wie ein Kinderpopo.
Und wie sie erst duftete.
Wie süße Zitrone mit Rosmarin.
Sie arbeitete für einen großen Parfümhersteller. Antrim hatte sie ihren Job mal bei einer Tasse Kaffee in der Nähe der Grand-Place erklärt, aber er hatte damals nicht zugehört, da ihm eine gescheiterte Operation im westlichen Deutschland durch den Kopf gegangen war.
So was schien ihm in letzter Zeit oft zu passieren.
Ein Fehlschlag nach dem anderen.
Seine Position war die des Koordinators von Spezialoperationen der Spionage- und Terrorabwehr in Europa. Das klang, als kämpfte er in einem Krieg – und in gewisser Weise stimmte das auch. Der nicht erklärte Krieg gegen den Terrorismus. Aber er sollte sich nicht darüber lustig machen. Es gab reale Bedrohungen, und zwar aus den merkwürdigsten Richtungen. In letzter Zeit schienen sie mehr von Amerikas Verbündeten als von seinen Feinden zu kommen.
Das gab seiner Einheit ihr Ziel.
Spezielle Gefahrenabwehr.
»Blake, sag mir, wie ich die Dinge wieder in Ordnung bringen kann. Ich möchte dich gerne weiterhin sehen.«
Aber das meinte sie nicht wirklich, und er wusste es.
Sie spielte mit ihm.
Sie saßen in ihrer Wohnung in einem teuren Jahrhundertwendehaus mit Blick auf den Parc de Bruxelles, einer im geometrischen Stil angelegten Grünfläche, die an den Palais Royal und den Palais de la Nation grenzte. Durch die geöffnete Balkontür im dritten Stock sah er auf die typischen klassischen Statuen zwischen am Spalier gezogenen Bäumen. Jetzt, am Abend, waren all die Büromenschen, Jogger und Familien, die normalerweise im Park herumwimmelten, verschwunden. Vermutlich lag die Miete hierzulande bei mehreren tausend Euro im Monat. So was hätte er sich als Beamter niemals leisten können. Aber die meisten Frauen, mit denen er sich einließ, verdienten ohnehin mehr als er. Anscheinend fühlte er sich zum Business-Typ hingezogen.
Und zu Frauen, die ihn betrogen.
Wie Denise.
»Ich war gestern unterwegs«, sagte er. »In der Nähe der Grand-Place. Ich hatte gehört, dass das Manneken Pis als Drehorgelspieler eingekleidet werden sollte.«
Das berühmte Standbild befand sich nicht weit vom Rathaus, eine sechzig Zentimeter hohe Skulptur eines nackten Jungen, der ins Brunnenbecken pinkelt. Sie stand seit 1618 da und war ein nationales Wahrzeichen geworden. Mehrmals wöchentlich wurde der Bronzejunge mit einem Kostüm bekleidet, jedes einzigartig. Blake war in der Nähe gewesen, um einen Kontaktmann zu treffen und kurz mit ihm zu reden.
Und da hatte er Denise gesehen.
Mit einem anderen Mann.
Arm in Arm hatten die beiden die kühle Mittagsluft genossen und waren stehen geblieben, um das Schauspiel zu bewundern und sich zu küssen. Sie hatte vollkommen entspannt gewirkt, genau wie sonst mit ihm. In diesem Moment hatte er sich gefragt, mit wie vielen Männern sie zusammen sein mochte, und das fragte er sich immer noch.
»Auf Französisch nennen wir ihn Le petit Julien«, erklärte sie. »Ich habe ihn schon in vielen Kostümen gesehen, aber noch nie als Drehorgelspieler. War es nett?«
Er hatte ihr die Gelegenheit geboten, mit der Wahrheit herauszurücken, aber Unehrlichkeit war noch so ein gemeinsamer Nenner der Frauen, die ihn anzogen.
Er gab ihr noch eine letzte Chance.
»Du warst gestern nicht dabei?«, fragte er mit einer Spur von Unglauben in der Stimme.
»Ich hatte außerhalb der Stadt zu tun. Vielleicht legen sie ihm das Kostüm ja später noch mal an.«
Er stand auf, um zu gehen.
Sie erhob sich von ihrem Stuhl. »Vielleicht könntest du ja noch ein bisschen bleiben?«
Er wusste, was sie meinte. Ihr Schlafzimmer stand offen.
Aber heute nicht.
Er ließ zu, dass sie sich ihm näherte.
»Es tut mir leid, dass wir uns nicht mehr sehen«, sagte sie.
Ihre Lügen hatten eine vertraute Wut in ihm geweckt. Er versuchte, sich dagegen zu wehren, gab aber schließlich nach. Seine rechte Hand schoss hoch, und er packte sie an der Kehle. Er hob ihren schmalen Körper an und rammte ihn gegen die Wand. Ihren Hals noch fester packend, starrte er ihr in die Augen.
»Du bist eine verlogene Hure.«
»Nein, Blake. Du bist ein hinterlistiger Kerl«, quetschte sie heraus, die Augen frei von Angst. »Ich habe dich gestern gesehen.«
»Wer war das?«
Er öffnete seinen Griff so weit, dass sie sprechen konnte.
»Niemand, der dich was anginge.«
»Ich. Teile. Nicht.«
Sie lächelte. »Dann musst du dich umstellen. Reizlose Mädchen sind dankbar für Liebe. Uns attraktiveren Frauen ergeht es besser.«
Dass ihre Worte stimmten, machte ihn nur umso wütender.
»Du hast einfach nicht genug zu bieten, um alle anderen Männer auszuschließen«, sagte sie.
»Bisher hast du dich nicht beschwert.«
Ihre Münder hatten nur wenige Zentimeter Abstand. Er spürte ihren Atem und roch den süßen Duft, der von ihrer Haut ausging.
»Ich habe viele Männer, Blake. Du bist nur einer davon.«
Sie wusste von ihm nur, dass er für das US-Außenministerium arbeitete und an die amerikanische Botschaft in Belgien gesandt worden war.
»Ich bin ein wichtiger Mann«, erklärte er, die Hand noch immer an ihrem Hals.
»Aber nicht so wichtig, dass du als einziger Mann Anspruch auf mich erheben könntest.«
Er bewunderte ihren Mut.
Töricht. Aber trotzdem bewundernswert.
Er ließ sie los und küsste sie heftig.
Sie erwiderte seinen Kuss, ihre Zunge fand die seine und übermittelte die Botschaft, dass noch nicht alles verloren sein musste.
Er löste seine Umarmung.
Dann rammte er ihr das Knie in den Bauch.
Mit einem explosiven Keuchen schoss ihr Atem heraus.
Sie krümmte sich und umklammerte ihren Unterleib mit den Armen. Von Übelkeit ergriffen, begann sie zu würgen.
Dann ging sie in die Knie und erbrach sich auf den Parkettboden.
Mit ihrer Gefasstheit war es vorbei.
Er wurde von Erregung ergriffen.
»Du bist ein Wicht, ein Waschlappen«, stieß sie hervor.
Aber ihre Meinung spielte keine Rolle mehr.
Er ging.
Er betrat sein Büro in der amerikanischen Botschaft, die auf der Ostseite des Parc de Bruxelles lag. Auf dem Rückweg von Denises Wohnung hatte er sich befriedigt, aber auch verwirrt gefühlt. Er fragte sich, ob sie wohl die Polizei rufen würde. Wahrscheinlich nicht. Erstens gab es keine Zeugen, da galt seine Aussage so viel wie ihre, und zweitens würde ihr Stolz das niemals zulassen.
Außerdem hatte er ihr keine Prellungen zugefügt.
Frauen wie sie steckten einen solchen Knuff ein und zogen weiter. Aber sie würde künftig nicht mehr so selbstgewiss sein. Sie würde sich immer fragen: Kann ich mit diesem Mann spielen? Oder weiß er Bescheid?
Wie Blake Bescheid gewusst hat.
Es gefiel ihm, dass sie Zweifel haben würde.
Aber das mit dem Knie tat ihm leid. Warum sie ihn bis zur Weißglut gereizt hatte, wusste er nicht. Betrug war schon schlimm genug. Durch Ableugnen wurde er dann nur noch schlimmer. Sie war selber schuld. Trotzdem würde er ihr morgen Blumen schicken.
Blassblaue Nelken. Ihre Lieblingsblumen.
Er loggte sich in seinen Computer ein und tippte den Zugangscode des Tages ein. Seit dem frühen Nachmittag hatte er kaum Nachrichten erhalten, aber ein Blitzalarm vom Hauptquartier in Langley fiel ihm ins Auge. So etwas gab es seit Nine-Eleven. Besser, Informationen innerhalb des Geheimdienstes weitergeben, als sie für sich zu behalten und dann am Ende die Schuld zu bekommen. Die meisten Alarme betrafen ihn nicht. Sein Feld war die Spezielle Gefahrenabwehr, genau umgrenzte Aufträge, und das war per definitionem nicht die Norm. Alle waren streng geheim, und er erstattete ausschließlich dem Leiter der Abteilung Spionage- und Terrorabwehr Bericht. Derzeit hatte er fünf Missionen am Laufen, zwei weitere waren im Planungsstadium. Dieser Alarm war allerdings ausschließlich an ihn gerichtet und wurde automatisch von seinem Computer entschlüsselt.
Operation Königskomplott hat jetzt ein Zeitlimit. Resultate in den nächsten 48 Stunden erforderlich, andernfalls Operation einstellen.
Das kam nicht völlig unerwartet.
Die Dinge waren in England nicht gut gelaufen.
Bis vor ein paar Tagen, denn da hatte das Glück sich plötzlich gedreht.
Er musste mehr in Erfahrung bringen und griff nach dem Telefonhörer, um seinen Mann in London anzurufen. Der nahm nach dem zweiten Läuten ab.
»Ian Dunne und Cotton Malone sind auf dem Heathrow Airport gelandet«, hörte Blake.
Er lächelte.
Nach siebzehn Jahren bei der CIA wusste er, wie man Dinge in die Wege leitet. Dass Cotton Malone nun mit Ian Dunne in London war, war der Beweis.
Das hatte Blake persönlich so eingefädelt. Malone war einmal ein Star-Agent des dem Justizministerium unterstellten Magellan Billet gewesen und hatte dort zwölf Jahre gearbeitet, bis er nach einer Schießerei in Mexico City den Dienst quittierte. Inzwischen lebte Malone in Kopenhagen, wo er eine Buchhandlung besaß. Aber er hatte immer noch eine enge Beziehung zu Stephanie Nelle, der langjährigen Chefin des Billet. Diese Verbindung hatte Blake ausgenutzt, um Malone nach England zu lenken. Ein Anruf im Hauptquartier in Langley hatte zu einem Anruf beim Justizminister geführt, der hatte wiederum Stephanie Nelle kontaktiert, und diese hatte sich an Malone gewandt.
Blake lächelte erneut.
Wenigstens etwas war heute richtiggelaufen.
3
Windsor, England
17.50 Uhr
Kathleen Richards war noch nie in Windsor Castle gewesen. Für eine gebürtige Britin, die auch im Land aufgewachsen war, galt das als unverzeihlich. Aber wenigstens kannte sie die Geschichte des Schlosses. Eine erste Burg war im elften Jahrhundert errichtet worden, um die Themse zu bewachen und die normannische Herrschaft im Umland des neu gegründeten London zu sichern. Die Anlage diente dem englischen Königshaus also schon seit der Zeit Wilhelms des Eroberers. Hatte hier ganz zu Beginn nur eine Turmhügelburg gestanden, erhob sich an dieser Stelle inzwischen eine riesige Steinfestung. Selbige hatte den First Barons’ War im dreizehnten Jahrhundert überstanden, den Englischen Bürgerkrieg im siebzehnten Jahrhundert, zwei Weltkriege und einen verheerenden Brand im Jahr 1992. Nun war Windsor Castle noch immer das größte bewohnte Schloss der Welt. Während der dreißig Kilometer langen Fahrt von London war ein spätherbstlicher Regenschauer niedergegangen. Das Schloss überragte einen steilen Kalksteinfelsen, die grauen Mauern, Türmchen und Türme – eine bebaute Fläche von fünf Hektar – waren jetzt am Abend in den Regenfluten kaum auszumachen. Vor einer Stunde hatte ihr Chef sie angerufen und ihr befohlen, sich dorthin zu begeben.
Das hatte sie völlig überrumpelt.
Sie war vor zwanzig Tagen für dreißig Tage suspendiert worden, ohne Lohn.
Eine Operation in Liverpool, bei der es um illegale Waffen für Nordirland gegangen war, war aus dem Ruder gelaufen, als die Zielpersonen sich zur Flucht entschieden hatten. Sie hatte ihnen mit dem Auto ein Rennen geliefert und sie in die Enge getrieben, aber zwischenzeitlich war auf den dortigen Schnellstraßen ein Chaos losgebrochen. Achtzehn Autos waren kollidiert, dabei hatte es ein paar Verletzte gegeben, darunter einige Schwerverletzte, aber keine Toten. War das alles ihre Schuld gewesen? Ihrer Meinung nach nicht.
Aber ihre Chefs hatten das anders gesehen.
Und die Medien waren mit der SOCA nicht sanft umgesprungen.
Die Serious Organized Crime Agency, Englands Gegenstück zum amerikanischen FBI, kümmerte sich um Drogenkriminalität, Geldwäsche, Betrug, Computerkriminalität, Menschenhandel und Verstöße gegen das Waffengesetz. Kathleen arbeitete nun seit zehn Jahren dort. Bei ihrer Einstellung hatte man ihr erklärt, vier Eigenschaften müsse ein geeigneter Neuling mitbringen: Teamfähigkeit, Leistungsbereitschaft, Führungsqualitäten und Erfolgsorientiertheit. Sie meinte, glauben zu dürfen, dass sie sich in zumindest dreien dieser Eigenschaften auszeichnete. Die »Teamfähigkeit« war allerdings immer ein Problem gewesen. Nicht, dass man nicht gut mit ihr auskommen konnte, aber sie zog es einfach vor, allein zu arbeiten. Zum Glück war ihre Leistungsbewertung hervorragend, sie glänzte mit zahlreichen Überführungen; dreimal war sie sogar belobigt worden. Aber ihr rebellischer Geist – der einfach zu ihrem Charakter zu gehören schien – brachte sie immer wieder in Schwierigkeiten.
Und das nahm sie sich selbst übel.
So hatte sie auch in den letzten zwanzig Tagen mit sich gehadert, als sie in ihrer Wohnung herumgehockt und sich ständig gefragt hatte, wann ihre Polizeilaufbahn wohl enden würde.
Ja, sie hatte eine gute Stelle. War beruflich vorangekommen. Hatte Anrecht auf jährlich einunddreißig Urlaubstage und eine Pension, bekam Fortbildungen und Karrierechancen und könnte gegebenenfalls großzügigen Mutterschaftsurlaub und einen Kinderkrippenplatz beanspruchen. Nicht, dass sie die letzten beiden Optionen jemals brauchen würde. Sie hatte inzwischen akzeptiert, dass auch die Ehe möglicherweise nichts für sie war. Da musste man einfach zu viel teilen.
Sie fragte sich, wieso sie nun eigentlich über den geheiligten Boden von Windsor Castle marschierte und sich durch den Regen zur St. George’s Chapel geleiten ließ, einer gotischen Kirche, die im 15. Jahrhundert von Eduard IV. erbaut worden war. Hier lagen zehn englische Monarchen bestattet. Sie hatte keine Erklärung erhalten, warum man sie hier brauchte, und sie hatte nicht danach gefragt, da ein gewisses Überraschungselement nun einmal unweigerlich zum Beruf der SOCA-Agentin gehörte.
Sie trat ein, schüttelte sich den Regen von den Schultern und bewunderte das hohe Deckengewölbe, die Buntglasfenster und das reich verzierte Kirchengestühl zu beiden Seiten des langen Chors. Über jeder Bank hingen die bunten Fahnen der Träger des Hosenbandordens und bildeten zusammen zwei eindrucksvolle Reihen. Auf emaillierten Messingschildern standen die Namen der gegenwärtigen und der früheren Platzinhaber. Der Mittelgang war mit spiegelblanken Marmorplatten im Schachbrettmuster ausgelegt, doch vor der elften Bank im Chorgestühl klaffte ein Loch. Vier Männer waren darum herum versammelt, einer davon war Kathleens Direktor. Er kam ihr entgegen und führte sie von den anderen weg.
»Die Kapelle ist nun schon den ganzen Tag geschlossen«, erklärte er ihr. »Gestern Nacht hat es hier einen Vorfall gegeben. Eines der Königsgräber wurde geschändet. Die Täter haben SSP verwendet, um den Boden aufzubrechen und sich Zugang zu verschaffen.«
SSP kannte sie. Schlagsprengstoff erzeugte durch die Hitzeeinwirkung gewaltigen Schaden, während die Erschütterung und der Lärm auf ein Minimum beschränkt blieben. Beim Eintreten in die Kapelle hatte sie den Geruch wahrgenommen, ein scharfer Verbrennungsgestank. Es handelte sich um einen hochkomplexen Stoff, der nicht auf dem freien Markt zu bekommen war und nur dem Militär zur Verfügung stand. Und so lag die Frage auf der Hand: Wer hatte Zugang zu dieser Art Sprengstoff?
»Kathleen, Ihnen ist wohl klar, dass Ihre Entlassung kurz bevorsteht.«
Durchaus, aber es erschütterte sie, die Worte nun laut ausgesprochen zu hören.
»Wir hatten Sie bereits verwarnt«, erklärte er. »Sie ermahnt, sich zu zügeln. Meine Güte, Sie liefern wunderbare Ergebnisse, aber wie Sie die erreichen, das steht ja nun leider auf einem ganz anderen Blatt.«
In ihrer Akte gab es massenhaft Vorfälle, die denen in Liverpool ähnelten. Sie hatte eine korrupte Clique von Hafenarbeitern mit 37 Kilo Kokain erwischt, aber dabei waren zwei Schiffe versenkt worden. Sie hatte eine Feuersbrunst gelegt, um die Drogendealer aus ihrem Versteck zu treiben, und dadurch war ein wertvolles Anwesen zerstört worden, das man als beschlagnahmtes Gut für Millionen hätte verkaufen können. Bei der Festnahme einer Bande von Internet-Piraten waren vier Menschen erschossen worden. Und dann der schlimmste Fall: Ein Ring von Privatdetektiven hatte illegal vertrauliche Informationen gesammelt und an Firmen verkauft. Eine der Zielpersonen hatte Kathleen mit einer Waffe bedroht, und sie hatte ihn erschossen. Auch wenn dieser Schuss als gerechtfertigt betrachtet wurde – sie hatte in Selbstverteidigung gehandelt –, hatte sie Therapiesitzungen absolvieren müssen, und der Psychologe war zu dem Schluss gelangt, ihre unbegrenzte Risikobereitschaft sei ihre persönliche Art, mit einem unerfüllten Leben fertigzuwerden. Was immer das nun bedeuten sollte – der dämliche Quacksalber hatte es nie näher erläutert. Nach den vorgeschriebenen sechs Sitzungen war sie also nicht wieder hingegangen.
»Unter meinem Befehl stehen noch vierzehn weitere Agenten«, sagte ihr Chef. »Aber keiner bereitet mir so viel Kummer wie Sie. Wie kommt es, dass diese Leute ebenfalls Erfolge erzielen, aber ohne Kollateralschäden?«
»Ich habe den Männern in Liverpool nicht gesagt, dass sie abhauen sollten. Ich habe entschieden, sie aufzuhalten, und angesichts der Mengen an Munition, die sie geschmuggelt haben, war es das Risiko wert.«
»Auf der Schnellstraße hat es Verletzte gegeben. Vollkommen unschuldige Menschen, die mit dem Auto unterwegs waren. Was ihnen zugestoßen ist, ist unentschuldbar, Kathleen.«
Sie hatte schon genug Vorwürfe gehört, als man ihr ihre Suspendierung mitgeteilt hatte. »Warum bin ich hier?«
»Um etwas zu sehen. Kommen Sie mit.«
Sie kehrten dorthin zurück, wo die drei anderen Männer standen. Rechts des dunklen Lochs im Boden fiel ihr Blick auf eine schwarze Steinplatte, die säuberlich in drei handliche Teile zerbrochen worden war. Die Bruchstücke waren inzwischen zur ursprünglichen Form zusammengeschoben worden. Sie las die Inschrift:
IN DER GRUFT
UNTER DIESER MARMORPLATTE
RUHEN DIE STERBLICHEN ÜBERRESTE
VON
JANE SEYMOUR, KÖNIGIN HEINRICHS VIII.
– 1537 –
KÖNIG HEINRICH VIII.
– 1547 –
KÖNIG KARL I.
– 1648 –
UND
EINES SÄUGLINGS VON KÖNIGIN ANNE
——————
DIESER GEDENKSTEIN WURDE HIER
1837 IM AUFTRAG VON
KÖNIG WILHELM IV. AUFGESTELLT.
Einer der anderen Männer erklärte, Heinrich VIII. habe sich hier in der St. George’s Chapel ein bedeutendes Denkmal gewünscht, welches das seines Vaters in Westminster in den Schatten stellen sollte. Ein Standbild aus Metall und ein schwerer Kerzenleuchter wurden gegossen, doch Heinrich starb, bevor das Ganze vollendet war. Nach ihm kam eine Phase des radikalen Protestantismus, und in dieser Zeit wurden gewiss keine Denkmäler in Kirchen aufgestellt, sondern eher welche zerstört. Dann führte seine Tochter Maria England für kurze Zeit nach Rom zurück und wurde in Erinnerung an Heinrich VIII., den König der Protestanten, zur Gefahr für viele. Schließlich schmolz Cromwell das Standbild ein und verkaufte den Kerzenständer. Letztlich wurde Heinrich unter dem Boden bestattet, und nur die schwarze Marmorplatte kennzeichnete noch die Stelle.
Sie schaute in das Loch. Ein Elektrokabel schlängelte sich über den Boden und verschwand dort hinunter, und von unten sickerte ein schwacher Schein von Streulicht herauf.
»Bisher wurde diese Krypta erst ein einziges Mal geöffnet«, sagte ein anderer der Männer.
Kathleens Direktor stellte ihn als den Schlosswart vor.
»Am 1. April 1813. Damals wusste man nicht, wo der geköpfte Karl I. bestattet worden war. Doch da viele glaubten, seine sterblichen Überreste könnten bei denen von Heinrich VIII. und seiner dritten Frau, Jane Seymour, liegen, wurde die Gruft aufgebrochen.«
Nun war sie offensichtlich ein weiteres Mal geöffnet worden.
»Meine Herren«, sagte der Direktor. »Würden Sie Inspector Richards und mich bitte einen Augenblick allein lassen? Bitte entschuldigen Sie uns kurz.«
Die anderen Männer nickten und zogen sich zur zwanzig Meter entfernten Haupttür zurück.
Sie freute sich, ihren Titel zu hören. Inspector. Sie hatte hart dafür gearbeitet und fand es schrecklich, dass sie ihn nun vielleicht verlieren würde.
»Kathleen«, sagte der Direktor mit leiser Stimme. »Ich flehe Sie an, ausnahmsweise einmal den Mund zu halten und mir zuzuhören.«
Sie nickte.
»Vor sechs Monaten wurden aus dem Archiv im Hatfield House mehrere kostbare Bände gestohlen. Einen Monat später hat es in den National Archives von York einen ähnlichen Vorfall gegeben. Im Verlauf der folgenden Wochen kam es im ganzen Land zu einer Serie von Diebstählen historischer Dokumente. Vor einem Monat wurde ein Mann dabei erwischt, wie er in der British Library Dokumente abfotografierte, doch er entzog sich der Festnahme und konnte fliehen. Und jetzt das hier.«
In dem Maße, wie ihre Neugier zunahm, verflog ihre Angst.
»Dieser Vorfall hier«, erklärte der Direktor, »ist eine weitere Eskalation. In diese heilige Kirche einzudringen. In einem königlichen Schloss.« Er hielt inne. »Die Diebe haben eine eindeutige Absicht.«
Sie kauerte sich bei der Öffnung nieder.
»Nur zu«, sagte er. »Werfen Sie einen Blick hinein.«
Es kam ihr respektlos vor, die Ruhe von Verstorbenen zu stören, die vor so langer Zeit gelebt hatten. Auch wenn ihre Chefs bei der SOCA sie für draufgängerisch und rücksichtslos halten mochten, gab es doch gewisse Dinge, die sie sehr ernst nahm. Wie zum Beispiel die Achtung vor den Toten. Doch das hier war der Tatort eines Verbrechens, und so legte sie sich flach auf die schwarz-weißen Marmorfliesen und streckte den Kopf nach unten.
Die Krypta wurde von einem Backsteingewölbe gebildet, das vielleicht zweieinhalb Meter breit, drei Meter lang und anderthalb Meter hoch war. Sie zählte vier Särge. Der eine, blassgrau und aus Blei, trug die Inschrift »König Karl, 1648«. Ins obere Drittel des Deckels war mit chirurgischer Präzision eine quadratische Öffnung geschnitten. Zwei kleinere Särge waren vollkommen unversehrt. Der vierte war der größte, über zwei Meter lang. Eine fünf Zentimeter dicke, hölzerne Außenhülle war zu Bruchstücken zerfallen. Der innere Bleisarg hatte ebenfalls durchs Alter gelitten, schien aber nun auch in der Mitte mit gewaltsamen Schlägen bearbeitet worden zu sein.
Sie wusste, wessen Gebeine da zu sehen waren.
Die von Heinrich VIII.
»In den ungeöffneten Särgen liegen Jane Seymour, die als Königin bei ihrem Mann bestattet wurde, und außerdem ein Säugling von Königin Anne, der viel später gestorben ist.«
Sie rief sich in Erinnerung, dass Seymour die dritte Ehefrau des Königs gewesen war, die einzige der sechs Gattinnen, die ihm einen legitimen Sohn geschenkt hatte, Eduard. Der war dann König geworden und hatte sechs Jahre lang regiert, war aber kurz vor seinem sechzehnten Geburtstag gestorben.
»Es sind wohl Heinrichs Gebeine, die jetzt durchwühlt wurden«, sagte er. »Die Öffnung in Karls Sarg wurde schon vor zweihundert Jahren gemacht. Er und die anderen beiden waren anscheinend nicht von Interesse.«
Sie wusste, dass Heinrich VIII. zu Lebzeiten ein hochgewachsener Mann gewesen war, über ein Meter achtzig groß, aber gegen Ende seines Lebens war er ungeheuer fett geworden. Hier lagen die sterblichen Überreste eines Königs, der mit Frankreich, Spanien und dem römisch-deutschen Kaiser Krieg geführt und England von einer Insel am Rande Europas zu einem entstehenden Weltreich gemacht hatte. Er hatte Päpsten die Stirn geboten und den Mut gehabt, seine eigene Konfession zu gründen, die noch fünfhundert Jahre später wunderbar gedieh.
Das zum Thema Verwegenheit.
Sie stand auf.
»Hier geschehen ernste Dinge, Kathleen.«
Ihr Chef reichte ihr eine seiner Visitenkarten. Auf die Rückseite war mit blauer Tinte eine Adresse geschrieben.
»Fahren Sie dorthin«, sagte er.
Sie betrachtete die Adresse. Ein Ort, den sie gut kannte. »Warum können Sie mir nicht sagen, worum es hier geht?«
»Weil nichts von alldem meine Idee war.« Er reichte ihr das SOCA-Abzeichen und ihren SOCA-Ausweis zurück, die man ihr vor drei Wochen abgenommen hatte. »Wie schon gesagt, Sie standen kurz vor der Entlassung.«
Sie war verwirrt. »Und warum bin ich dann hier?«
»Man hat speziell um Sie gebeten.«
4
London
Ian wusste genau, wo er sich befand. Seine Tante wohnte in der Nähe, und er war oft genug durch Little Venice gestreift, vor allem an den Wochenendnachmittagen, wenn es auf den Straßen von Menschen wimmelte. Als er schließlich weggelaufen war, hatte er zwischen den schicken Villen und modernen Hochhausblocks gelernt, wie man als Straßenkind auf eigenen Beinen steht. Angezogen von den malerischen Straßen, den blauen Stahlbrücken und den vielen Pubs und Restaurants, strömten die Touristen in Scharen hierher. Hausboote und Wasserbusse durchpflügten von hier bis zum Zoo das braune Wasser des Kanals und boten damit genau die Art von Ablenkung, die beim Stehlen so nützlich war. Gerade jetzt brauchte er wirklich eine Ablenkung, die ihm helfen würde, Norse und Devene abzuschütteln, denn die beiden würden mit Sicherheit hinter ihm her sein, sobald sie mit Cotton Malone fertig waren.
Vielleicht würde ihm die Wohnung seiner Tante eine sichere Zuflucht bieten, aber bei dem Gedanken, auf ihrer Türschwelle zu stehen, drehte sich ihm der Magen um. Egal wie sehr er derzeit in der Klemme saß, die Aussicht, dieser fetten Idiotin zuhören zu müssen, erschien ihm schlimmer. Wenn außerdem die, die hinter ihm her waren – wer auch immer das sein mochte – sogar über ihn gewusst hatten, dass er heute zurückkehren würde, war seine Tante mit Sicherheit kein Geheimnis für sie.
Und so rannte er weiter von ihrem Haus weg auf eine breite Straße fünfzig Meter weiter vorn zu.
Gary blieb stehen und sagte heftig keuchend: »Wir müssen umkehren.«
»Dein Dad hat gesagt, dass wir abhauen sollen. Das sind böse Menschen. Ich weiß Bescheid.«
»Woher denn?«
»Sie haben versucht, mich umzubringen. Nicht diese beiden Arschlöcher, aber andere.«
»Deswegen müssen wir ja umkehren.«
»Machen wir auch. Aber erst müssen wir mal weiter weg.«
Dieser Amerikaner hatte keine Ahnung, wie es auf Londons Straßen zuging. Man blieb nicht stehen und wartete darauf, dass es Ärger gab, und man hielt mit Sicherheit auch nicht danach Ausschau.
Er entdeckte ein Schild mit dem rot-weiß-blauen U-Bahn-Symbol, doch da er weder eine Monatskarte noch Geld besaß und die Zeit zum Stehlen fehlte, half ihnen das nichts. Eigentlich gefiel ihm die Tatsache, dass Gary Malone verwirrt wirkte. Von der Großspurigkeit, mit der Gary ihn bei seinem Fluchtversuch zu Fall gebracht hatte, war nichts mehr übrig.
Dies hier war Ians Welt.
Hier kannte er die Regeln.
Und so übernahm er bei der Flucht die Führung.
Weiter vorn erblickte er das stillstehende Wasser des Beckens von Little Venice mit seiner Flotte gedrungener Boote, gesäumt von einer Ansammlung schicker Läden. Links ragten moderne Wohnblocks auf. Für einen Freitagabend kurz vor sieben war der Verkehr rund um die braungraue Wasserfläche recht ruhig. Die meisten Läden am Straßenrand waren noch offen. Mehrere Bootsbesitzer pflegten ihre vertäuten Fahrzeuge, spritzten die Seitenwände ab und polierten den Lack. Einer sang bei der Arbeit; Lichterketten schmückten über ihm das Becken.
Ian entschied, dass das seine Chance war.
Er lief zur Treppe und stieg vom Straßenniveau zum Rand des Beckens hinunter. Der stämmige Mann schrubbte eifrig an einem Teakholz-Rumpf herum. Sein Boot hatte genau wie alle anderen die Form einer dicken Zigarre.
»Fahren Sie zum Zoo?«, fragte Ian.
Der Mann unterbrach seine Arbeit. »Im Augenblick nicht. Vielleicht später. Warum fragst du?«
»Ich dachte, Sie könnten uns vielleicht mitnehmen.«
Die Bootsbesitzer waren für ihre Freundlichkeit bekannt, und es kam gar nicht so selten vor, dass Touristen oder Fremde einmal mitfahren durften. Zwei der Wasserbusse, die ihr Geld mit dem Transport von Passagieren verdienten, lagen in der Nähe. Die Kabinen waren leer, da das Wochenendgeschäft erst noch bevorstand. Ian bemühte sich, sich so zu verhalten, wie dieser Mann ihn sicherlich einschätzte – wie ein Junge, der sich nach einem Abenteuer sehnt.
»Bereiten Sie sich aufs Wochenende vor?«, fragte er.
Der Mann goss sich mit dem Schlauch Wasser über den Kopf und strich das schwarze Haar zurück. »Ich hab fürs Wochenende einen Ausflug geplant. Hier wird es bald von Leuten wimmeln. Das ist mir zu voll. Ich dachte, ich fahr mal nach Osten die Themse runter.«
Die Idee klang reizvoll. »Hätten Sie gerne Gesellschaft?«
»Wir können hier nicht weg«, flüsterte Gary.
Aber Ian beachtete ihn nicht.
Der Mann warf ihm einen erstaunten Blick zu. »Was hast du für ein Problem, mein Junge? Steckt ihr beiden in Schwierigkeiten? Wo sind denn eure Eltern?«
Zu viele Fragen. »Kein Problem. Machen Sie sich keine Sorgen um uns. Ich dachte nur, es würde Spaß machen, mal auf dem Fluss unterwegs zu sein.«
Ian blickte zur Straße hinauf.
»Du wirkst schrecklich nervös. Müsstest du eigentlich irgendwo sein?«
Ian wollte keine Fragen mehr beantworten und sagte nur: »Bis später mal.«
Er joggte über den Treidelpfad davon, der parallel zum Kanal verlief.
»Warum seid ihr beiden nicht zu Hause?«, rief der Mann ihnen nach.
»Schau dich nicht um«, zischte Ian.
Sie folgten dem Kiespfad weiter.
Rechts oben erblickte Ian einen blauen Mercedes, der auf die umlaufende Straße einbog. Er hoffte, dass es nicht der blaue Mercedes war, doch als Norse ausstieg, begriff er, dass sie in der Klemme steckten. Ihre Position unterhalb der Straße dicht beim Kanal war nicht gut. Fliehen konnten sie jetzt nur noch nach vorn und nach hinten, da rechts von ihnen das Wasser lag und sich links eine Steinmauer erhob.
Er sah, dass Gary ihre missliche Lage ebenso erkannt hatte.
Nun konnten sie nur noch am Kanal entlang über den Treidelpfad davonrennen, aber dort würden Norse und Devene sie mit Sicherheit erwischen. Ian wusste, sobald sie das Becken hinter sich gelassen hätten, würden sie das steile Ufer des Kanals kaum überwinden können, da die Grundstücke am Wasserweg entlang eingezäunt waren. Daher rannte er zu einer Treppe und stürmte sie, zwei Stufen auf einmal nehmend, hinauf. Oben wandte er sich nach rechts und hastete über eine Stahlbrücke, die den Kanal überspannte. Der nur für Fußgänger bestimmte Steg war schmal, und es war kein Mensch darauf zu sehen. Schräg gegenüber rollte der Mercedes heran und kam mit quietschenden Bremsen zum Stehen. Devene stieg aus und rannte auf die Brücke zu.
Ian und Gary machten kehrt, um auf dem Weg von eben zurückzufliehen, doch dort erwartete sie schon Norse, der nur noch zehn Meter entfernt war.
Die Verfolger schienen ihren Fluchtweg vorausgeahnt zu haben.
»Lass uns mit diesem Unsinn aufhören«, sagte Norse. »Du weißt, was ich will. Gib mir einfach den USB-Stick.«
»Den hab ich weggeworfen.«
»Gib ihn mir. Mach mich nicht wütend.«
»Wo ist mein Dad?«, fragte Gary.
»Dieser Ami ist nicht euer Problem. Wir sind euer Problem.«