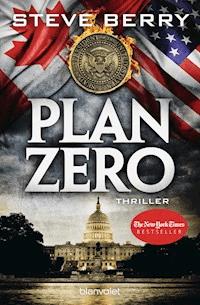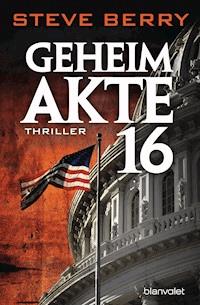
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Cotton Malone
- Sprache: Deutsch
Eine Enthüllung, die die Vereinigten Staaten von Amerika in den Ruin treiben könnte. Und nur 24 Stunden Zeit, um sie zu verhindern …
Cotton Malone hat sich aus dem aktiven Geheimagentenleben zurückgezogen. Doch dann bittet ihn seine ehemalige Chefin, einen Mann aufzuspüren, der in den Besitz hochbrisanter Geheimakten des amerikanischen Finanzministeriums gekommen ist. In den falschen Händen könnten diese Unterlagen die Vereinigten Staaten in die Knie zwingen. Die Spur führt von Venedigs Kanälen bis nach Nordkorea. Eine nervenzerfetzende Jagd beginnt, denn Malone bleibt nur ein Tag Zeit, um die Katastrophe zu verhindern ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 616
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Buch
Cotton Malone hat einen scheinbar einfachen Auftrag: Er soll einen pensionierten Beamten des amerikanischen Finanzministeriums beschatten. Doch der Fall ist komplizierter als gedacht. Denn auch ein nordkoreanischer Spion und eine Agentin des Ministeriums selbst beobachten den Beamten. Malone soll eigentlich über ihn nur den Aufenthaltsort eines Justizflüchtlings herausfinden, doch bald stellt sich heraus, dass viel mehr an der Sache dran ist. Denn die Geheimhaltung hochbrisanter Dokumente ist in Gefahr. Wenn diese in falsche Hände gelangen, steht die Stabilität und Sicherheit der ganzen Vereinigten Staaten von Amerika auf dem Spiel. Was als ein unspektakulärer Beschattungsauftrag für Cotton Malone beginnt, wird bald zu einer nervenzerfetzenden Jagd durch ganz Europa …
Autor
Steve Berry war viele Jahre als erfolgreicher Anwalt tätig, bevor er seine Leidenschaft für das Schreiben entdeckte. Mit jedem seiner hochspannenden Thriller stürmt er in den USA die Spitzenplätze der Bestsellerlisten und begeistert Leser in über 50 Ländern. Steve Berry lebt mit seiner Frau in St. Augustine, Florida.
Von Steve Berry bereits erschienen:
Die Napoleon-Verschwörung, Das verbotene Reich, Die Washington-Akte,
Die Kolumbus-Verschwörung, Das Königskomplott, Der Lincoln-Pakt, Antarctica
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und
www.twitter.com/BlanvaletVerlag
Steve Berry
GEHEIMAKTE 16
Thriller
Aus dem Amerikanischen
von Barbara Ostrop
Die Originalausgabe erschien 2015 unter dem Titel
»The Patriot Threat« bei Minotaur Books, New York.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
1. Auflage
Copyright © der Originalausgabe 2015 by Steve Berry
Published by Arrangement with MAGELLAN BILLET INC.
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur
Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen.
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2017 by Blanvalet Verlag,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Werner Bauer
Umschlaggestaltung: Johannes Frick, Neusäß
Umschlagabbildungen: Shutterstock.com/trekandshoot und STILLFX
JB · Herstellung: sam
Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach
ISBN: 978-3-641-20805-9V001
www.blanvalet.de
Für Sam Berry,
meinen Vater
Kein Gefühl der Welt ist größer,
edler oder heiliger als der Patriotismus.
– Kim Il-sung, Ewiger Präsident
der Demokratischen Volksrepublik Korea
Prolog
Weißes Haus
Donnerstag, 3. Dezember 1936
17:00 Uhr
Franklin Roosevelt empfand die Anwesenheit seines von ihm wenig geschätzten Besuchers als höchst unangenehm, aber er sah ein, dass sie miteinander reden mussten. Eine Amtszeit als Präsident hatte Roosevelt bereits hinter sich, und in drei Wochen stand das historische Datum seiner zweiten Inauguration an, die diesmal zum ersten Mal an einem 20. Januar stattfinden würde. Bisher war der Eid immer an einem 4. März abgelegt worden, im Gedenken an das Datum, an dem die Verfassung im Jahr 1789 in Kraft getreten war. Aber das hatte man nun durch den 20. Zusatzartikel geändert. Es war tatsächlich eine gute Idee, die Übergangsphase nach dem Wahltermin im November zu verkürzen, denn in dieser Zeit war der scheidende Präsident vollkommen machtlos. Roosevelt war gerne Teil des Wandels. Es missfiel ihm, sich ans Althergebrachte zu halten.
Und ganz besonders verabscheute er alle Vertreter der »alten Ordnung«.
Also Leute wie seinen Besucher.
Andrew Mellon hatte zehn Jahre und elf Monate das Amt des Finanzministers innegehabt. 1921 hatte er unter Präsident Harding in dieser Position begonnen, dann für Coolidge gearbeitet und war schließlich von Hoover aus dem Amt genötigt worden. Er rundete seinen Regierungsdienst mit einem Jahr als Botschafter in Großbritannien ab und zog sich schließlich 1933 ins Privatleben zurück. Mellon war ein strammer Republikaner, seit jeher einer der wohlhabendsten Männer des Landes, die lebende Verkörperung der »alten Ordnung«, die Roosevelt mit seinem New Deal verändern wollte.
»Dies hier, Mr. President, ist mein Angebot. Ich hoffe, es lässt sich verwirklichen.«
Mellon überreichte Roosevelt ein Blatt Papier.
Dieser hatte den Paria zum Nachmittagstee eingeladen, weil seine Berater ihn ermahnt hatten, man könne einen bissigen Hund nicht endlos treten.
Und Roosevelt hatte Andrew Mellon seit drei Jahren einen Tritt nach dem anderen versetzt.
Er hatte unmittelbar nach seiner ersten Inauguration damit begonnen und die Bundessteuerbehörde angewiesen, Mellons Steuererklärung von 1931 zu überprüfen. Es hatte in der Behörde Widerstand gegen diese Ausnutzung seiner präsidialen Macht gegeben – man hatte sich mit der Begründung gewehrt, die Bundessteuerbehörde solle nicht als politische Waffe eingesetzt werden –, aber dann hatte man Roosevelts Anweisung doch befolgt. Mellon hatte eine Steuererstattung von 139.000 Dollar gefordert. Die Regierung stellte dagegen fest, dass er dem Staat 3.089.000 Dollar schuldete. Er wurde der Steuerhinterziehung beschuldigt, doch eine Grand Jury lehnte die Anklage ab. Unbeeindruckt befahl Roosevelt dem Justizministerium, zivilrechtlich gegen Mellon vorzugehen, und es kam zu einem Prozess vor dem Board of Tax Appeals, der Steuerbeschwerdekammer. Vierzehn Monate der Beweisaufnahme und der Zeugenbefragungen folgten. Das Ganze stand nun kurz vor dem Abschluss.
Sie befanden sich im ersten Stock des Weißen Hauses, und zwar im Oval Study, dem Raum, in dem er am liebsten Geschäftliches besprach. Mit seinen vollgepackten Bücherschränken, den Schiffsmodellen und den überall verstreuten Papierstapeln wirkte er ein wenig überfüllt, doch sehr wohnlich. Im offenen Kamin loderte ein Feuer. Roosevelt hatte seinen Rollstuhl verlassen und saß auf dem Sofa, neben sich den Justizminister Homer Cummings. Mellon befand sich in Begleitung von David Finley, einem engen Mitarbeiter des ehemaligen Ministers.
Roosevelt und Cummings studierten Mellons Angebot.
Darin wurde die Errichtung eines Kunstmuseums vorgeschlagen. Es sollte an der National Mall liegen, der Museumsmeile im Zentrum der Hauptstadt Washington, und Mellon würde es auf eigene Kosten erbauen. Das Haus sollte nicht nur einen würdigen Rahmen für Mellons eigene riesige Sammlung bieten, sondern auch spätere Erwerbungen beherbergen.
Und man würde es die National Gallery of Art nennen.
»Nicht die Andrew W. Mellon Gallery?«, fragte Roosevelt.
»Ich möchte nicht, dass mein Name einen öffentlichen Bezug zu diesem Haus erhält.«
Roosevelt musterte seinen Besucher, der kerzengerade mit hocherhobenem Kopf dasaß, ohne einen einzigen Gesichtsmuskel zu verziehen, als beugten sich noch immer Präsidenten jeder seiner Launen. Roosevelt hatte sich immer gefragt, warum drei Amtsinhaber hintereinander denselben Minister in ihr Kabinett berufen hatten. Beim ersten konnte er es nachvollziehen – Harding war ein schwacher und unfähiger Dummkopf – und vielleicht sogar beim zweiten: Coolidge, der das Amt übernommen hatte, nachdem Harding so vernünftig gewesen war, in der Mitte seiner Amtszeit zu sterben. Aber warum hatte Coolidge, als er 1924 wiedergewählt wurde, nicht einen neuen Finanzminister berufen? Das wäre sinnvoll gewesen. Alle Präsidenten hielten es so. Dann wiederholte Hoover den Fehler und ernannte Mellon 1929 erneut, nur um sich drei Jahre später doch endlich von ihm zu trennen.
»Hier steht, dass das Museum von einem Kuratorium von neun Treuhändern geführt wird, von denen Sie fünf persönlich ernennen«, sagte Roosevelt. »Ich war davon ausgegangen, dass das Haus von der Smithsonian Institution verwaltet wird.«
»So soll es auch sein. Aber ich möchte, dass die internen Angelegenheiten völlig unabhängig von der Regierung geregelt werden, der das Smithsonian ja untersteht. Dieser Punkt ist nicht verhandelbar.«
Roosevelt warf einen Blick zum Justizminister, und der nickte billigend.
Mellons Angebot war schon vor einem Jahr erfolgt. Das Gebäude würde zwischen acht und neun Millionen Dollar kosten. Mellons eigene Kunstsammlung, deren Wert auf zwanzig Millionen Dollar geschätzt wurde, sollte den Kern des Museums bilden. Man würde weitere hochrangige Werke hinzuerwerben und ebenfalls ausstellen, um Washington, D. C., zu einer der größten Kunstmetropolen der Welt zu machen. Mellon wollte das Museum mit fünf Millionen Dollar ausstatten, deren Rendite für die Gehälter der obersten Verwalter und den Erwerb weiterer Kunstwerke bestimmt sein sollte. Den Unterhalt des Gebäudes und den laufenden Betrieb würde der Staat bezahlen. Monatelang hatte man hinter den Kulissen verhandelt, um die Details abzuklären, und nun war das abschließende Treffen gekommen. Justizminister Cummings hatte Roosevelt fortlaufend informiert, aber es hatte wenig Spielraum gegeben. Genau wie bei Geschäften war Mellon auch in Bezug auf Kunst ein harter Verhandlungspartner.
Ein Punkt war allerdings noch immer problematisch.
»Sie haben angeführt, dass alles Kapital für das Gebäude und die Kunstwerke aus Ihrer gemeinnützigen Stiftung kommen soll. Doch genau diese Stiftung schuldet den Menschen dieses Landes laut unserer Klage über drei Millionen Dollar an hinterzogenen Steuern«, sagte Roosevelt.
Mellons Züge blieben wie in Stein gemeißelt. »Wenn Sie das Geld wollen: Da ist es.«
Roosevelt merkte, dass er manipuliert wurde. Aber das war in Ordnung, schließlich hatte er um dieses Treffen gebeten. Und so …
»Ich würde gerne unter vier Augen mit Mr. Mellon sprechen.«
Roosevelt sah, dass dieser Vorschlag dem Justizminister zwar nicht behagte, er aber begriff, dass es sich nicht um eine Bitte handelte. Sowohl Cummings als auch Finley verließen den Raum. Roosevelt wartete, bis die Tür geschlossen war, und sagte dann: »Sie wissen natürlich, dass ich Sie verachte.«
»Als wäre es mir nicht vollkommen gleichgültig, was Sie denken. Sie sind ohne Bedeutung.«
Roosevelt lachte. »Man hat mich schon arrogant, faul und dumm genannt. Auch als manipulativ hat man mich bezeichnet, aber noch nie als bedeutungslos. Diese Beleidigung nehme ich tatsächlich übel. Ich bilde mir ein, für unsere Gesellschaft in ihrer gegenwärtigen ökonomischen Notlage durchaus von Belang zu sein. Eine Notlage, wie ich hinzufügen könnte, an deren Entstehung Sie nicht unbeteiligt sind.«
Mellon zuckte mit den Schultern. »Hätte Hoover auf mich gehört, wäre die Depression von kurzer Dauer gewesen.«
Jener schicksalhafte Freitag im Jahr 1929, an dem Märkte zusammengebrochen und Banken bankrottgegangen waren, lag inzwischen gut sieben Jahre zurück. Hoover war zwar abgewählt, aber noch immer hatten die Republikaner die Kontrolle über den Kongress und den Obersten Gerichtshof, und so konnten sie Roosevelts Politik des New Deal einen juristischen Schlag nach dem anderen versetzen. Er war auf so viele Hindernisse gestoßen, dass er beschlossen hatte, Frieden mit seinen Feinden zu schließen – und zu ihnen gehörte auch dieser Teufel hier. Aber erst würde er loswerden, was er zu sagen hatte.
»Schauen wir einmal, ob ich mich richtig erinnere. Als Finanzminister haben Sie Hoover den Rat gegeben, mit den Faktoren Arbeit, Aktienbesitz, Landwirtschaft und Immobilienbesitz gründlich aufzuräumen. Das System von allem Verdorbenen zu reinigen. Danach würden die Menschen härter arbeiten und ein … wie haben Sie es ausgedrückt? … anständigeres Leben führen. Und dann sagten Sie noch, unternehmerische Individuen würden den Staffelstab von den weniger befähigten übernehmen.«
»Das war ein kluger Rat.«
»Da er von einem Mann stammt, der Hunderte Millionen Dollar schwer ist, verstehe ich, dass Sie es so sehen. Vermutlich hätten Sie eine andere Einstellung, wenn Sie arbeitslos und hungrig wären und keine Hoffnung hätten.«
Mellons physische Erscheinung überraschte Roosevelt. Das Gesicht war hager geworden, und die hochgewachsene Gestalt war noch magerer, als er sie in Erinnerung hatte. Die Haut war aschfahl, und die müden Augen blickten sehnsüchtig. Zwei tiefe Furchen liefen von den Nasenflügeln zu den Mundwinkeln und wurden nur teilweise von dem charakteristischen Schnurrbart verdeckt. Roosevelt wusste, dass Mellon einundachtzig war, aber er kam ihm vor wie hundert. Eine Tatsache änderte sich jedoch nicht – dieser Mann war und blieb ein ernst zu nehmender Gegner.
Roosevelt nahm eine Zigarette aus einer Dose auf dem Beistelltischchen und schob sie in den Elfenbeinhalter. Das Bild, wie er die glatte Spitze zwischen den Zähnen hielt und die Zigarette in einem munteren Winkel nach oben stand, war zu einem Symbol seiner präsidialen Zuversicht, seines Optimismus geworden. Gott allein wusste, wie sehr das Land beides brauchte. Er zündete die Zigarette an und sog den Rauch tief ein. Es war starker Tabak, und beim Inhalieren spürte er einen tröstlichen Schmerz in der Brust.
»Ihnen ist klar, dass unser Standpunkt zu der Angelegenheit, die derzeit vor der Steuerbeschwerdekammer anhängig ist, sich nicht verändern wird. Ihr Geschenk wird keine Auswirkung auf diesen Rechtsstreit haben.«
»O doch.«
Jetzt war Roosevelt neugierig.
»Die National Gallery of Art wird erbaut werden«, sagte Mellon. »Das können Sie nicht ablehnen und werden es auch nicht tun. Mein Geschenk ist zu bedeutend, um einfach übergangen zu werden. Wenn das Museum einmal eröffnet ist, wird es zum großartigsten Ausstellungsort für Kunst werden, den unsere Nation besitzt. Ihr kleinlicher Steuerstreit wird dann längst Geschichte sein. Keiner wird überhaupt noch daran denken. Aber das Museum … das wird ewig Bestand haben und niemals vergessen werden.«
»Sie sind wirklich der Meisterdenker unter den reichen Übeltätern.«
»Ich erinnere mich, dass Sie mich schon einmal so genannt haben. Tatsächlich habe ich das damals als Kompliment aufgefasst. Aber da Sie ein professioneller Politiker sind, der ständig hinter Wählerstimmen her ist, ist es mir ohnehin gleichgültig, was Sie denken.«
»Ich rette unser Land vor Leuten wie Ihnen und Ihresgleichen.«
»Sie haben doch nur eine Massenvermehrung neuer Behörden und Ämter in Gang gesetzt. Die Aufgaben der meisten überlappen sich zudem mit denen bereits existierender Abteilungen. Abgesehen von einer Aufblähung der Staatsausgaben, die zu höheren Steuern führt, bleibt das alles wirkungslos. Das Endergebnis wird katastrophal sein. Mehr hilft niemals mehr, insbesondere dann nicht, wenn es um den Staatsapparat geht. Gott stehe diesem Land bei, wenn Sie mit ihm fertig sind. Zum Glück werde ich nicht mehr hier sein, um die schrecklichen Folgen zu sehen.«
Roosevelt genoss ein paar Züge seiner Zigarette, bevor er antwortete. »Sie haben recht, dieses Geschenk zurückzuweisen wäre politischer Selbstmord. Ihre Freunde im republikanisch dominierten Kongress würden das sehr übel aufnehmen. Und man hat mir gesagt, da es tatsächlich Ihr Geschenk ist, können Sie auch die Bedingungen festlegen. Und so wird Ihre große National Gallery erbaut werden.«
»Sie waren nicht der Erste, wissen Sie.«
Roosevelt fragte sich, was der alte Mann meinte.
»Ich habe es schon getan, als Sie noch gar nicht daran gedacht haben.«
Plötzlich begriff Roosevelt, worauf Mellon hinauswollte.
Er sprach von James Couzens, der nach vierzehn Jahren im US-Senat vor zwei Monaten gestorben war. Vor dreizehn Jahren hatte Senator Couzens den Kongress zu einer Prüfung von Steuerermäßigungen veranlasst, die bestimmten Firmen im Besitz des damaligen Finanzministers Mellon gewährt worden waren. Die Untersuchung ergab, dass Mellon die Kontrolle über diese Firmen nicht abgegeben hatte, wie er es vor seinem Eintritt in den Regierungsdienst gelobt hatte. Es hatte Rufe nach Mellons Rücktritt gegeben, aber er hatte die Sache ausgesessen, und 1924 hatte Coolidge ihn erneut zum Minister ernannt. Damals hatte Mellon die Bundessteuerbehörde auf Couzens angesetzt, dessen Überprüfung eine Steuerschuld von elf Millionen Dollar ergeben hatte. Doch die Steuerbeschwerdekammer hatte diese Entscheidung rückgängig gemacht und war zu dem Schluss gelangt, dass Couzens sogar eine Steuererstattung zustand.
»War das nicht die größte Demütigung für Sie?«, fragte Roosevelt Mellon. »Die Beschwerdekammer hat sich geschlossen gegen Sie gestellt. Ihr Rachefeldzug gegen Couzens wurde als das entlarvt, was er war.«
Mellon stand auf. »Haargenau, Mr President.«
Roosevelts Gast sah mit Augen wie Kohlestücken auf ihn herunter. Roosevelt war stolz darauf, immer die beherrschende Gestalt in einem Raum zu sein und in jeder Lage die Kontrolle übernehmen zu können, aber diese lebende Statue weckte ein unbehagliches Gefühl in ihm.
»Ich werde bald sterben«, sagte Mellon dann unvermittelt.
Das hatte Roosevelt nicht gewusst.
»Ich habe Krebs, und mein Tod ist noch vor dem Ende des nächsten Jahres zu erwarten. Aber ich war nie jemand, der weint oder klagt. Als ich über Macht verfügte, habe ich sie genutzt. Sie haben also mir, Ihrem offensichtlichen Feind, nichts anderes angetan als ich den meinen. Zum Glück verfüge ich immer noch über Geld und Mittel, um mich zu wehren. Eines allerdings möchte ich sagen. Ich habe meine Feinde vernichtet, weil sie versucht haben, mich zu vernichten. Ich habe immer nur zu meiner Verteidigung losgeschlagen. Ihr Angriff auf mich war dagegen eindeutig offensiv. Sie haben sich nur deshalb entschieden, mir Schaden zuzufügen, weil Sie es konnten. Ich hatte Ihnen nie etwas getan. Das ist der … Unterschied zwischen Ihrem Kampf und meinem.«
Roosevelt überließ sich wieder einem Schwall von beruhigendem Nikotin und sagte sich, dass er nicht das geringste Anzeichen von Angst oder Sorge zeigen durfte.
»Ich habe meiner Nation große Kunst als Geschenk übergeben. Das wird mein öffentliches Vermächtnis sein. Für Sie, Mr. President, habe ich noch ein anderes, privateres Geschenk.«
Mellon zog einen dreifach gefalteten Zettel aus der Innentasche seines Mantels und reichte ihn Roosevelt.
Dieser nahm die Notiz entgegen und las, was dort getippt stand. »Das ist purer Unsinn.«
Mellons Züge verzogen sich zu einem gerissenen Grinsen. Beinahe war es ein Lächeln. Was für ein ungewöhnlicher Anblick. Roosevelt konnte sich nicht erinnern, bei diesem Mann jemals etwas anderes als eine finstere Miene gesehen zu haben.
»Ganz im Gegenteil«, antwortete Mellon. »Es handelt sich um das Abenteuer einer Suche. Einer Suche, die ich eigens für Sie kreiert habe.«
»Wonach?«
»Es handelt sich um etwas, das sowohl für Sie als auch für Ihren New Deal das Ende bedeuten kann.«
Roosevelt hob den Zettel hoch. »Soll das eine Art Drohung sein? Vielleicht haben Sie ja vergessen, mit wem Sie sprechen.«
Der Fehler, den er zwei Jahre zuvor begangen hatte, war inzwischen überdeutlich. Wie lautete die Maxime noch? Versuche nicht, den König zu ermorden, es sei denn, du hast mit Sicherheit Erfolg. Aber Roosevelt war gescheitert. Justizminister Cummings hatte ihn bereits informiert, dass die Steuerbeschwerdekammer in allen Punkten gegen die Regierung und für Mellon entscheiden würde. Mellon hatte keine Steuerschulden. Er hatte alles korrekt abgerechnet.
Eine vollständige Niederlage!
Roosevelt hatte seinen Finanzminister angewiesen, dafür zu sorgen, dass die Verkündung der Entscheidung so lange wie möglich hinausgezögert wurde. Wie er das anstellte, war seine Sache, Hauptsache, es gelang ihm. Und doch hatte Roosevelt Zweifel. Wusste sein Besucher bereits Bescheid?
»Ein Mensch hat immer zwei Gründe für die Dinge, die er tut«, sagte Mellon. »Einen guten und den wahren. Ich bin heute auf Ihre Einladung hin gekommen, um offen und ehrlich mit Ihnen zu reden. Irgendwann werden alle Männer, die derzeit an der Macht sind, Sie selbst eingeschlossen, tot sein. Auch ich werde tot sein. Aber die National Gallery wird Bestand haben, und das ist etwas, was dieses Land braucht. Das war der gute Grund, aus dem ich gehandelt habe. Der wahre Grund aber ist, dass ich im Gegensatz zu Ihnen ein Patriot bin.«
Roosevelt lachte über die Beleidigung. »Und doch geben Sie bereitwillig zu, dass das, was ich in der Hand halte, eine Bedrohung für Ihr Staatsoberhaupt darstellt?«
»Ich versichere Ihnen, dass es Dinge gibt, die Sie nicht über diese Regierung wissen. Dinge, die sich als … vernichtend erweisen könnten. Und nun halten Sie, Mr. President, zwei davon in der Hand.«
»Warum erzählen Sie es mir dann nicht einfach und genießen das Vergnügen?«
»Warum sollte ich das tun? Sie haben mich drei Jahre lang durch die Mühle gedreht. Ich wurde öffentlich angeklagt, gedemütigt und als Gauner und Betrüger beschimpft. Während doch in Wirklichkeit Sie Ihre Macht und Amtsgewalt missbraucht haben. Da erscheint es mir nur gerecht, Ihnen den Gefallen zu erwidern. Aber ich habe mein Geschenk zu einer Herausforderung gemacht. Ich möchte, dass Sie dafür arbeiten müssen, genauso, wie auch ich arbeiten musste.«
Roosevelt knüllte das Blatt zusammen und warf es auf den Boden.
Mellon wirkte unbeeindruckt. »Das wäre unklug.«
Roosevelt zeigte mit dem Zigarettenhalter auf ihn, als wäre er eine Waffe. »Auf meiner Wahlkampftour 1932 habe ich immer wieder ein Plakat in den Schaufenstern gesehen. Wissen Sie, was darauf stand?«
Mellon schwieg.
»Hoover blies die Pfeife, Mellon rief die Stunde, Wall Street gab das Zeichen, das Land ging vor die Hunde. Hurra für Roosevelt. Das ist es, was das Land über mich denkt.«
»Da ziehe ich doch Harry Trumans Bemerkung über Sie vor: Das Problem mit dem Präsidenten ist, dass er lügt.«
Einen Augenblick herrschte ein angespanntes Schweigen.
Schließlich sagte Roosevelt: »Nichts ist mir lieber als ein guter Kampf.«
»Dann wird das hier Sie zu einem glücklichen Menschen machen.«
Mellon griff in seine Jacketttasche und brachte eine frisch gedruckte Dollarnote zum Vorschein. »Die hier ist eine der neuen. Wie ich hörte, haben Sie den Entwurf persönlich abgesegnet.«
»Ich dachte, das Geld könnte eine Generalüberholung gebrauchen. Die alten Scheine erinnern zu sehr an alten Misserfolg.«
Daher hatte das Finanzministerium einen neuen Eindollarschein in Auftrag gegeben, der zusätzlich das Große Siegel der Vereinigten Staaten und weitere stilistische Veränderungen aufwies. Die neuen Scheine waren inzwischen etwas über ein Jahr in Umlauf. Mellon nahm einen Stift aus der anderen Jacketttasche und trat zu einem der Tische. Roosevelt beobachtete, wie er Linien auf den Schein zeichnete.
Mellon überreichte ihm die Banknote. »Die hier ist für Sie.«
Roosevelt sah, dass Mellon zwei Dreiecke auf die Rückseite des Siegels gezeichnet hatte. »Ein Pentagramm?«
»Es hat sechs Spitzen.«
Roosevelt verbesserte sich. »Ein Davidstern also. Soll das irgendwas bedeuten?«
»Es ist ein Hinweis aus der Geschichte unserer Nation. In unserer Vergangenheit hat es Menschen gegeben, die wussten, dass einmal ein Mann wie Sie … ein tyrannischer Aristokrat … an die Macht kommen würde. Und so erscheint es mir passend, dass die amerikanische Geschichte und folgende eigenartige Tatsache« – Mellon deutete auf die Banknote – »am Anfang Ihrer Suchfahrt stehen. Wie Sie sehen, verbinden die Spitzen des Sterns fünf Buchstaben. O S A M N. Es handelt sich um ein Anagramm.«
Roosevelt betrachtete den Schein. »Mason. Die Buchstaben bilden das Wort Mason …Maurer.«
»In der Tat.«
Wider besseres Wissen konnte Roosevelt sich die Frage nicht verkneifen: »Was hat das zu bedeuten?«
»Ihren Untergang.«
Wie Mellon so hoch aufgerichtet dastand, den Kopf noch immer geneigt, schien er mit seiner soldatischen Körperhaltung die Behinderung seines Staatsoberhaupts, das nicht aufstehen konnte, zu verspotten. Ein Scheit im offenen Kamin brach zischend auseinander und besprühte sie mit Funken.
»›Ein seltsamer Zufall, nenn ich’s mit Worten, wie man sie heut hört allerorten.‹« Mellon hielt inne. »Lord Byron. Hier erscheint mir das gleichfalls passend.«
Roosevelts Gast begab sich zur Tür.
»Ich habe mein Gespräch mit Ihnen noch nicht beendet«, rief Roosevelt.
Mellon blieb stehen und drehte sich um. »Ich warte auf Sie … Mr. President.« Und damit ging er.
GEGENWART
1
Venedig, Italien
Montag, 10. November
22:40 Uhr
Cotton Malone warf sich zu Boden, als gleich mehrere Kugeln in die Glasscheibe einschlugen. Zum Glück zerbrach die transparente Trennwand zwischen den Räumen nicht. Er riskierte einen Blick in den großen Sekretariatsbereich und erblickte im Halbdunkel Lichtblitze, die aus der Mündung einer Maschinenpistole kamen. Die Glasscheibe zwischen ihm und dem Angreifer war offensichtlich besonders widerstandfähig, und er dankte seinem Glück stumm für diese vorausschauende Bauweise.
Viele Optionen hatte er nicht.
Er wusste wenig über die Räumlichkeiten im siebten Geschoss des Gebäudes – schließlich war er zum ersten Mal hier. Er war gekommen, um heimlich eine bedeutende finanzielle Transaktion mitzuverfolgen – 20 Millionen US-Dollar, die in zwei große Säcke mit dem Bestimmungsland Nordkorea gestopft wurden. Doch stattdessen hatte sich die Übergabe in ein Blutbad verwandelt. Vier Männer lagen tot in einem der Nachbarbüros, und ihr Mörder – ein als Sicherheitsmann verkleideter Asiate mit kurzem, dunklem Haar – hatte nun ihn selbst aufs Korn genommen.
Malone musste in Deckung gehen.
Wenigstens war er bewaffnet – er hatte die Beretta aus seiner Zeit beim Magellan Billet und zwei zusätzliche, geladene Magazine dabei. Die Genehmigung, bewaffnet zu reisen, hatte er der Tatsache zu verdanken, dass er nun wieder einen Mitarbeiterausweis des US-Justizministeriums bei sich führte. Er hatte den Auftrag angenommen, um Kopenhagen einmal den Rücken zu kehren und sich etwas Geld hinzuzuverdienen, da das Spionieren heutzutage gut bezahlt wurde.
Denk nach.
Der andere war besser bewaffnet, aber nicht intelligenter.
Kontrolliere deine Umgebung und kontrolliere das Ergebnis.
Gerade als eine weitere Salve nun schließlich doch die gläserne Trennwand zerschmetterte, warf er sich über den genarbten Terrazzoboden nach links in den Korridor. Er kam an einer Nische mit Toilettentüren vorbei und rannte weiter. Ein Stück weiter vorn im Korridor stand ein einsamer Putzwagen. Durch eine mit einem Keil geöffnete Tür zu einem Büro entdeckte er eine Frau im Kittel einer Reinigungsfirma, die in dem dunklen Raum kauerte.
»Kriechen Sie unter den Schreibtisch und verhalten Sie sich still«, flüsterte er auf Italienisch.
Sie tat wie geheißen.
Diese Zivilistin war ein Problem, er wollte sie nicht gefährden. Kollateralschaden hieß so etwas in den Berichten des Magellan Billet. Er hasste diese Bezeichnung. Denn tatsächlich handelte es sich um jemandes Vater, Mutter, Bruder oder Schwester. Unschuldige, die ins Kreuzfeuer geraten waren.
Nur ein paar Sekunden, dann würde der Asiate auftauchen.
Er bemerkte eine weitere Bürotür und huschte in den dunklen Raum. Die Möbel lagen umgeworfen herum. Eine zweite Tür führte in einen Nachbarraum, durch dessen halb geöffneten Eingang Licht fiel. Ein kurzer Blick ins Innere des Raums bestätigte, dass dieser wieder auf den Korridor hinausführte.
Das sollte funktionieren.
Er erschnupperte den Geruch einer Reinigungslösung, der aus einem wenige Schritte entfernten großen, geöffneten Metallkanister drang. Außerdem entdeckte er ein Päckchen Zigaretten und ein Feuerzeug auf dem Putzwagen.
Kontrolliere deine Umgebung.
Er schnappte sich beides und kippte dann den Metallkanister um.
Eine klare Flüssigkeit ergoss sich gluckernd auf den Boden des Korridors und schwappte in der Richtung, aus der der Asiate kommen würde, über die Fliesen.
Malone wartete.
Fünf Sekunden später lugte sein Angreifer, die Maschinenpistole voran, um die Ecke und fragte sich sicherlich, wo sein Opfer wohl steckte.
Malone verweilte noch ein paar Sekunden, damit sein Gegner ihn entdeckte.
Der Lauf wurde hochgerissen.
Malone stürzte ins Büro. Kugeln schlugen in ohrenbetäubenden Salven in den Putzwagen ein. Er ließ das Feuerzeug aufflammen und zündete das Zigarettenpäckchen an. Papier, Zellophan und Tabak begannen zu brennen. Eins. Zwei. Er warf das brennende Bündel durch die Tür auf den klaren Film der Reinigungslösung, die den Boden des Korridors überzog.
Ein kurzes Brausen, und die Reinigungslösung fing Feuer.
Eine Bewegung im Nachbarraum bestätigte, was Malone erwartet hatte. Der Asiate hatte sich vor dem brennenden Boden dort hineingerettet. Bevor sein Gegner die missliche Lage noch recht erkannte, stürzte Malone durch die Tür und riss den Mann zu Boden.
Die Maschinenpistole folgte krachend.
Mit der Rechten hielt Malone die Kehle seines Gegners umklammert.
Doch der war stark.
Und gewandt.
Sie wälzten sich über den Boden, bis sie gegen einen Schreibtisch stießen.
Malone tat alles, um den Gegner gepackt zu halten. Doch der Asiate schnellte hoch und katapultierte ihn mit den Füßen voran in die Luft. Während Malone den Mann noch umklammerte, flog er im Bogen über den Kopf seines Gegners hinweg. Der schleuderte ihn zur Seite und sprang auf. Malone machte sich zum Kampf bereit, doch der »Sicherheitsmann« stürzte aus dem Raum.
Malone packte seine Pistole und näherte sich mit hämmerndem Herzen keuchend der Tür. Auf dem Boden qualmten noch immer Reste der Reinigungslösung. Im Korridor war niemand, und eine feuchte Spur führte vom Büro weg. Er folgte ihr. An der Ecke blieb er stehen und lugte in den Quergang, entdeckte aber niemanden. Er näherte sich den Aufzügen und stellte fest, dass die Positionsanzeige bei beiden die Sieben zeigte – sein Stockwerk. Er drückte den Schalter nach oben und sprang mit entsicherter Waffe zurück.
Die Türen glitten auf.
Die rechte Kabine war leer. In der linken lag eine blutige Leiche, die nur noch die Unterwäsche trug. Vermutlich der echte Sicherheitsmann. Malone betrachtete sein verzerrtes Gesicht, das durch zwei klaffende Wunden fast bis zur Unkenntlichkeit entstellt war. Der Plan sah sicherlich nicht nur vor, alle Teilnehmer der Geldübergabe zu eliminieren, sondern auch, keine Zeugen zurückzulassen. Er spähte in die Liftkabine und stellte fest, dass die Schalterleiste zerstört war. In der anderen Kabine entdeckte er dasselbe. Nun konnte man nur noch über die Treppe nach draußen gelangen.
Er betrat das Treppenhaus und lauschte. Jemand stieg die Stufen zum Flachdach hinauf. Malone eilte so schnell nach oben, wie es die Vorsicht zuließ, da er dort mit Problemen rechnete.
Eine Tür ging auf und wurde wieder geschlossen.
Dann stand er selbst davor und hörte das unverkennbare Dröhnen eines Hubschraubers, der auf der anderen Seite startete.
Er öffnete die Tür einen Spalt weit.
Von ihm abgewandt, mit dem Leitwerk und der Heckflosse fast in Griffweite, stand ein Helikopter. Seine Kabine war zum Nachthimmel ausgerichtet. Die Rotoren drehten sich immer schneller, und der Asiate lud rasch die beiden Geldsäcke ein und sprang dann selbst an Bord.
Die Rotoren wirbelten noch schneller, und die Kufen hoben vom Dach ab.
Malone stieß die Tür zum Dach ganz auf.
Kalter Wind peitschte sein Gesicht.
Sollte er schießen? Nein. Sie wegfliegen lassen? Er war nur als Beobachter hergeschickt worden, aber die Sache war schiefgelaufen, und so musste er nun sein Geld verdienen. Er schob die Pistole in die hintere Hosentasche, knöpfte sie zu und rannte los. Mit einem Sprung packte er die nach oben entschwebende Kufe.
Der Hubschrauber flog donnernd in die Nacht hinaus.
Was für ein eigenartiges Gefühl, ohne den Schutz einer Kabine durch die Luft zu fliegen. Malone klammerte sich mit beiden Händen an der Metallkufe des Hubschraubers fest, der inzwischen beschleunigte, was das Festhalten noch schwerer machte.
Er schaute nach unten.
Sie flogen ostwärts, weg vom Festland und in Richtung der Lagune und der Inseln. Der Tatort der Morde lag an der italienischen Küste, ein paar Hundert Meter landeinwärts in einem unauffälligen Bürogebäude nahe beim Marco Polo International Airport. Die Lagune selbst war von schmalen, erleuchteten Landzungen eingeschlossen, die sich in einem weiten Bogen ans Festland anschlossen. In ihrer Mitte lag Venedig.
Der Hubschrauber ging in eine Rechtskurve und zog das Tempo an.
Malone schlang den rechten Arm um die Kufe, um besseren Halt zu finden.
Vor sich entdeckte er jetzt Venedig, dessen Türme und Kuppeln erleuchtet waren. Rundum war alles schwarz, woran man das Wasser erkannte. Weiter östlich lag der Lido, der die Lagune von der Adria trennte. Im Geist ging er die Geografie unten durch. Im Norden verrieten Lichter die Inseln Murano, Burano und ein Stück weiter weg Torcello. Sie lagen in der Lagune wie funkelndes Talmi. Er umklammerte die Kufe fest mit dem Arm und schaute nun zum ersten Mal in die Kabine hinauf.
Der »Sicherheitsmann« musterte ihn.
Der Hubschrauber schwenkte nach links, offensichtlich weil man versuchen wollte, den unwillkommenen Passagier abzuschütteln. Malones Körper wurde nach rechts geschleudert und schlenkerte dann zurück, aber er hielt sich fest und starrte ein weiteres Mal zu den eiskalten Augen hinauf. Er sah, dass der Asiate die Luke mit der Linken aufschob, die Maschinenpistole in der rechten Hand. Gerade bevor eine Salve auf die Kufen niederprasselte, schwang Malone sich mit einem Ruck quer über das Untergestell zur anderen Kufe hinüber.
Kugeln prallten gegen die linke Kufe und verschwanden in der Dunkelheit. Auf der rechten Seite war Malone vorerst sicher, doch seine Hände schmerzten, weil sein ganzes Gewicht an ihnen hing. Der Hubschrauber schwankte wieder hin und her, was Malone allmählich den letzten Rest von Kraft kostete. Er schwang das linke Bein über die Kufe und umklammerte seinen stählernen Halt. Vom kühlen Wind trocknete ihm die Kehle aus, und das Atmen fiel ihm schwer. Nur mühsam gelang es ihm, Speichel in seinem ausgedörrten Mund zu sammeln.
Er musste etwas unternehmen, und zwar schnell. Also betrachtete er die wirbelnden Rotoren, die mit ihren Blättern in die Luft droschen, und vom Stakkato der Turbinen dröhnten ihm die Ohren. Vorhin auf dem Dach hatte er gezögert, doch jetzt schien es keine Wahl zu geben. Er hielt sich mit den Beinen und dem linken Arm an der Kufe fest, führte den anderen Arm nach hinten und knöpfte die Hosentasche auf. Dann zog er die Beretta heraus.
Es gab nur noch eine einzige Möglichkeit, den Hubschrauber zum Abstieg zu zwingen.
Er gab drei Schüsse in die kreischende Turbine ab und traf sie unmittelbar unterhalb der Rotornabe.
Der Antrieb stotterte.
Aus dem Lufteinlass und dem Abgasstutzen schlugen Flammen, der Hubschrauber verlor an Geschwindigkeit. Seine Nase wippte beim Versuch, in der Luft zu bleiben, nach oben.
Malone blickte in die Tiefe.
Sie befanden sich noch immer dreihundert Meter über der Lagune, verloren aber in einem mehr oder weniger kontrollierten Sinkflug rasch an Höhe.
Vor ihnen entdeckte er jetzt eine Insel. An verstreuten Lichtern erkannte man ihren rechteckigen Umriss unmittelbar nördlich von Venedig. Er hatte sie einmal besucht: Isola di San Michele. Dort gab es nur ein paar Kirchen und einen riesigen Friedhof, auf dem man seit den Zeiten Napoleons die Toten begrub.
Erneut stotterte die Turbine.
Plötzlich eine Fehlzündung.
Dicke Rauchwolken quollen aus dem Abgasstutzen, und ein widerlicher Gestank nach Schwefel und brennendem Öl umfing Malone. Der Pilot versuchte offensichtlich, den Sinkflug zu stabilisieren. Der Hubschrauber bewegte sich schwankend auf und ab, und der Einstellwinkel der Rotorblätter wechselte mehrmals ruckartig.
Sie flogen dicht an der Kuppel der Hauptkirche vorbei über die Insel hinweg.
Als sie sich sechs Meter über dem Boden befanden, schien Malones Bemühen von Erfolg gekrönt. Doch der Hubschrauber ging in den Geradeausflug über und begann dann wieder zu steigen; die Turbine lief ruhiger. Unten war ein dunkler Fleck zu sehen, aber Malone fragte sich, wie viele Grabsteine ihn dort erwarten mochten. In der Finsternis war kaum etwas zu erkennen. Die Insassen des Hubschraubers wussten mit Sicherheit, dass sie immer noch einen Begleiter hatten. Warum sollten sie also landen? Klüger wäre es, wieder aufzusteigen und den Passagier aus der Luft abzusetzen.
Er hätte noch ein paarmal öfter in die Turbine schießen sollen.
So aber blieb ihm keine Wahl.
Und deshalb ließ er die Kufe los.
Der Sturz kam ihm ewig vor, doch wenn sein Gedächtnis ihn nicht trog, hatte ein Objekt im freien Fall eine Geschwindigkeit von knapp zehn Metern pro Sekunde. Sechs Meter entsprachen also weniger als einer Sekunde. Hoffentlich war der Boden weich und er fiel nicht auf Stein.
Er schlug mit den Füßen zuerst auf, seine Knie knickten ein, um den Aufprall abzudämpfen, wippten zurück und ließen seinen ganzen Körper vorwärts fallen und abrollen. Sofort tat sein linker Oberschenkel weh. Irgendwie schaffte er es, die Pistole in der Hand zu behalten. Sein Körper kam zur Ruhe, und er schaute wieder nach oben. Der Pilot hatte die volle Kontrolle zurückgewonnen. Der Hubschrauber stieg auf und kehrte zurück. Ein Bogen nach rechts, und der Angreifer hatte beste Sicht nach unten. Malone könnte wahrscheinlich davonhumpeln, aber er entdeckte hier unten keine Deckung. Er befand sich ungeschützt mitten zwischen den Gräbern. Der Asiate erkannte seine missliche Lage. Der Helikopter hing weniger als dreißig Meter entfernt in der Luft, und der Luftwirbel, den seine Rotoren erzeugten, ließ lose Erdbrocken aufstieben. Die Luke des Hubschraubers glitt auf, und der Angreifer legte einhändig die Maschinenpistole auf Malone an.
Malone stützte sich auf und zielte mit beiden Händen. Mehr als vier Schuss konnten nicht mehr im Magazin sein.
Schwer zu sagen, welche der Kugeln tatsächlich ihr Ziel fand, aber die Turbine explodierte. Ein leuchtender Feuerball erhellte den Himmel, und lodernde Trümmer stürzten in einem sengenden Wirbel fünfzig Meter entfernt auf den Boden. In der unvermittelten Helligkeit erblickte Malone Hunderte von Grabsteinen in dicht gedrängten Reihen. Er warf sich auf den Boden und legte schützend die Arme über den Kopf, während die Explosionen nicht enden wollten. Vor ihm türmte sich eine mächtige Masse aus verbogenem Metall, menschlichen Körpern und in Flammen aufgehendem Treibstoff.
Er blickte starr auf das Schlachtfeld.
Knisternde Flammen verzehrten den Hubschrauber, seine Insassen und zwanzig Millionen Dollar in bar.
Jemand würde ganz schön sauer sein.
2
Hafen von Venedig
23:15 Uhr
Kim Yong Jin stand auf der einen Seite des Bettes und hielt den Infusionsbeutel in der Hand. Seine Tochter Hana beobachtete ihn von der anderen Seite.
»So etwas hast du bestimmt schon gesehen, oder?«, fragte er leise auf Koreanisch.
Mit so etwas meinte er den Triumph der Starken über die vollkommen Entkräfteten. Und ja, er wusste, dass sie dergleichen schon unzählige Male miterlebt hatte.
»Kein Kommentar?«, fragte er.
Sie starrte ihn an.
»Nun, dann wohl nicht. Der Fisch würde nie am Haken zappeln, wenn er den Mund hielte, stimmt’s?«
Sie nickte.
Er belohnte ihr gutes Gespür mit einem Lächeln, wandte seine Aufmerksamkeit dann wieder dem Bett zu und fragte: »Liegen Sie bequem?«
Aber der alte Mann, der vor ihm lag, antwortete nicht. Wie denn auch? Die Droge hatte jeden Muskel gelähmt, die Nerven taub gemacht und den Geist befreit. Ein Schlauch schlängelte sich von dem Infusionsbeutel in Kims Hand zu einer Ader des Alten hinunter. Ein Ventil gestattete Kim, den Zufluss zu regulieren. Von der Injektion der Droge würde nie jemand erfahren, denn ihr Gefangener war Diabetiker, und eine weitere Einstichstelle würde gar nicht auffallen.
»Es spielt wohl keine Rolle, ob er bequem liegt oder nicht«, sagte er. »Eigentlich eine dumme Frage. Er kann ja nicht weglaufen.«
Gleichgültigkeit im Angesicht von Macht war eine Eigenschaft, die Kim von seinem Vater geerbt hatte – genau wie sein schütteres Haar, sein Übergewicht, den massigen Kopf und die geheime Leidenschaft für dekadentes Amüsement. Doch im Gegensatz zu seinem Vater, dem es gelungen war, der Nachfolger seines eigenen Vaters zu werden und Nordkorea beinahe ein Vierteljahrhundert lang zu führen, war Kim diese Möglichkeit verwehrt geblieben.
Und warum?
Weil er das Tokyo Disneyland besucht hatte?
Zwei seiner neun Kinder hatten sich gewünscht, dorthin zu fliegen. Und so hatte er falsche portugiesische Reisepässe besorgt und versucht, sich Zutritt zu verschaffen. Doch ein aufmerksamer Grenzbeamter am Narita International Airport hatte die Fälschung bemerkt, und man hatte ihn festgenommen. Um seine Freilassung zu erwirken, hatte sein Vater persönlich bei der japanischen Regierung intervenieren müssen.
Kim hatte einen hohen Preis dafür bezahlt.
Er war enterbt und von der Nachfolge ausgeschlossen worden.
Vorher war er der älteste Sohn gewesen, dazu bestimmt, die Zügel der Macht in die Hände zu nehmen, doch danach war er in Ungnade gefallen. Und als sein Vater vor zwölf Jahren endlich gestorben war, hatte Kims unehelicher Halbbruder seinen Platz als militärischer Oberkommandant, Vorsitzender der Nationalen Verteidigungskommission und Führer der Arbeiterpartei eingenommen und die absolute Macht über die Demokratische Volksrepublik Korea erlangt.
Was war daraus zu lernen?
Nur ein schlechter Ackersmann streitet sich mit seinem Ochsen.
Kim schaute sich in der Suite um.
Nicht so luxuriös wie sein Penthouse zwei Decks darüber, aber doch noch weit überdurchschnittlich. Hana und er hatten gerade eine zehntägige Kreuzfahrt an der Adria und im Mittelmeer hinter sich. Während das Schiff in Kroatien, Montenegro, Sizilien und Italien anlegte, hatten sie darauf gewartet, dass der alte Mann, der jetzt vor ihnen lag, die Initiative ergriff.
Doch es war nichts Entscheidendes geschehen.
Und so waren sie nun, am letzten Abend der Kreuzfahrt, als das Schiff in Venedig angelegt hatte und die mehrere Tausend Fahrgäste an Land gegangen waren, um die Sehenswürdigkeiten zu besichtigen, hierhergekommen, um Paul Larks einen Besuch abzustatten. Sie hatten einfach nur an die Tür klopfen müssen, und dann hatten sie Larks mühelos überwältigt.
»Mr. Larks«, sagte Kim mit freundlicher Stimme. »Warum machen Sie diese Reise?«
»Um ein Unrecht wiedergutzumachen und ein anderes zu beenden.«
Die Stimme klang gepresst, aber die Antwort kam ohne Zögern. So war das bei dieser Droge. Das Gehirn konnte nichts als die Wahrheit preisgeben. Die Fähigkeit zu lügen existierte nicht mehr.
»Welches Unrecht?«
»Eines, das mein Land begangen hat.«
Lästig war, dass unter dem Einfluss der Droge normalerweise nur die Frage direkt beantwortet und darüber hinaus kaum etwas gesagt wurde.
»Wie lange besitzen Sie die Dokumente schon, mit deren Hilfe sich dem Unrecht ein Ende setzen lässt?«
»Seit der Zeit meines Regierungsdienstes. In diesem Zeitraum bin ich auf sie gestoßen.«
Dieser Mann hatte einmal als Unterstaatssekretär des amerikanischen Finanzministeriums gearbeitet, war aber vor weniger als drei Monaten in aller Stille aus seinem Amt gedrängt worden.
»War das vor oder nach Ihrer Lektüre des Buchs?«, fragte Kim.
»Davor.«
Auch Kim hatte GEHEIMAKTE 16 von Anan Wayne Howell gelesen. Der Autor hatte das Buch vor zwei Jahren veröffentlicht, ohne die Werbetrommel dafür zu rühren, und kaum jemand hatte Notiz davon genommen. »Hat Howell recht?«
»Ja.«
»Wo befindet er sich?«
»Ich werde ihn morgen treffen.«
»Wo?«
»Ich wurde informiert, dass er mich nach dem Verlassen des Schiffs aufsuchen würde.«
»Waren Sie nicht auf dem Schiff, um sich während der Kreuzfahrt mit Howell zu treffen?«
»So war es ursprünglich geplant.«
Eine sonderbare Antwort. »Sollten Sie noch jemand anders treffen?«
»Den Koreaner. Aber dann entschieden wir uns dagegen.«
»Wer ist wir?«
»Howell und ich.«
Kim war verwirrt. »Warum?«
»Es ist besser, wenn die Sache unter Amerikanern bleibt.«
Jetzt war Kim aufgebracht, denn er selbst war der Koreaner. »Wo sind die Dokumente, mit denen sich das Unrecht wiedergutmachen lässt?«
Larks hatte seit dem ersten Tag der Kreuzfahrt immer eine schwarze Tumi-Aktentasche mit sich herumgetragen. An Deck. Bei den Mahlzeiten. Er hatte sie keinen Moment aus den Augen gelassen. Doch jetzt befand sie sich nicht in seiner Suite. Hana hatte diese bereits durchsucht.
»Ich habe sie Jelena gegeben. Sie hat mir das korrekte Passwort genannt.«
Der Name der Frau war Kim unbekannt. Aber er wollte mehr wissen.
»Nennen Sie mir das Passwort.«
»Mellon.«
»Wie englisch für Melone?«
»Nein. Wie Andrew Mellon.«
Der Sarkasmus hinter dieser Losung entging Kim nicht, aber er fragte dennoch, warum gerade dieses Passwort gewählt worden war.
»Mellon war der Hüter der Wahrheit.«
»Wann haben Sie Jelena die Dokumente gegeben?«
»Vor ein paar Stunden.«
Das war definitiv ein Problem, denn zum Teil war Kim gerade wegen dieser Papiere hier. Vor einigen Wochen hatte er versucht, sie Larks aus der Ferne abzuschwatzen, doch vergebens. Dann war er auf die Idee mit dem Treffen in Übersee gekommen. Bei dieser Begegnung würde er vielleicht nicht nur die benötigten schriftlichen Beweise in die Hand bekommen, sondern sie würde ihn auch zum Initiator der ganzen Angelegenheit führen. Zu Anan Wayne Howell. Dem Autor des Buchs GEHEIMAKTE 16.
»Weiß Jelena von Howell?«, fragte Kim.
»Ja.«
»Und wie wird sie ihm die Dokumente übergeben?«
»Sie wird Howell morgen nach dem Verlassen des Schiffs treffen.«
Die Dinge waren eindeutig nicht nach Plan gelaufen. Doch Kim hatte mit holprigen Stellen auf diesem trügerischen Weg gerechnet. Der Umgang mit eigenartigen Persönlichkeiten und verzweifelten Menschen war riskant.
»Wer sind Sie?«, fragte Larks plötzlich.
Kim schaute auf das Bett hinunter. Die Wirkung der Droge hatte rascher nachgelassen als vorhergesehen, aber er hatte absichtlich nur eine leichte Dosis verwendet, damit der Mann gesprächsfähig blieb.
»Ich bin Ihr Sponsor«, sagte er. »Der Koreaner.« Er verbarg seine Verachtung für dieses Etikett nicht.
Larks versuchte aufzustehen, doch Hana hielt ihn fest. Es war nicht schwierig, den alten Mann unten zu halten.
»Sie haben mich enttäuscht«, sagte Kim.
»Ich habe Ihnen nichts zu sagen. Das hier ist ein amerikanisches Problem. Wir brauchen keine Einmischung von Leuten wie Ihresgleichen.«
»Aber mein Geld haben Sie angenommen. Sie sind meiner Einladung zu dieser Reise gefolgt, und bisher habe ich keine Beschwerden gehört.«
Kim drehte am Ventil, um eine weitere Drogendosis ins Blut strömen zu lassen. Kurz darauf waren Larks’ braune Augen wieder verschleiert.
»Warum haben Sie sich gegen den Koreaner gewendet?«, fragte Kim.
»Das erschien Howell das Beste. Er war misstrauisch.«
»Wieso? War der Koreaner denn nicht Ihr Freund?«
»Dieses Unrecht hat nichts mit Ausländern zu tun.«
»Welches Unrecht?«
»Das Unrecht, das Salomon, Mellon, Howell und allen US-Bürgern angetan wurde und wird. Das müssen wir selbst in Ordnung bringen. Leider ist alles wahr.«
Kim verstärkte den Zufluss der Droge, um Larks auch den letzten Rest von freiem Willen zu nehmen.
»Was ist wahr?«, fragte er.
»Was in GEHEIMAKTE 16 steht.«
Kim kannte den Inhalt, doch da hatte es immer ein großes Fragezeichen gegeben. Entsprachen die dort gemachten Behauptungen der Realität, oder waren sie nur der Fantasie eines abgedrehten Autors entsprungen, der wilde Verschwörungstheorien spann? Kim verwettete buchstäblich sein Leben darauf, dass sie stimmten.
Sein Handy vibrierte in der Hosentasche.
Er reichte Hana den Infusionsbeutel über das Bett hinweg und zog das Gerät heraus.
»Der Hubschrauber ist über der Lagune explodiert«, berichtete ein Mann. »Wir waren zu weit weg, um genau zu verfolgen, wie es geschehen ist, aber wir haben gesehen, dass sich beim Abheben ein Mann an den Hubschrauber gehängt hat. Wir fahren jetzt mit dem Boot zur Explosionsstelle.«
»Zwanzig Millionen Dollar sind weg?«, fragte Kim.
»Es hat den Anschein.«
»Das ist nicht gut.«
»Als ob man uns das sagen müsste. Gerade ist unser Lohn in Flammen aufgegangen.«
Für den Auftragnehmer war eine fünfzigprozentige Beteiligung ausgehandelt gewesen.
»Finden Sie heraus, was passiert ist«, sagte Kim.
»Wir sind auf dem Weg.«
Noch mehr Probleme. Das war nicht das, was Kim hatte hören wollen. Er beendete den Anruf und dachte mit gesenktem Blick an die von Larks erwähnte Botin.
»Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, diese Frau zu finden«, sagte er zu Hana. »Diese Jelena.«
Sie gab ihm den Infusionsbeutel zurück.
»Morgen«, sagte er. »Wenn Howell auftaucht.«
Das bedeutete, dass Paul Larks keinen Nutzen mehr für Kim hatte.
Und so drehte er das Ventil vollständig auf.
3
Atlanta, Georgia
17:20 Uhr
Stephanie Nelle betrat das Kaufhaus und ging direkt zur Abteilung für Frauenbekleidung. Das Einkaufszentrum lag auf der Nordseite der Stadt, nicht weit vom Hauptquartier des Magellan Billet entfernt. Sie war gewiss keine Shoppingqueen, aber gelegentlich schaute sie sich abends oder samstagnachmittags gerne einmal ein paar Outfits an, um sich von der Arbeit abzulenken. Sie führte das Magellan Billet inzwischen seit sechzehn Jahren – seitdem sie die Geheimdienstabteilung selbst gegründet hatte. Diese bestand aus zwölf vom Justizministerium bezahlten Agenten, die nur mit den heikelsten Missionen betraut wurden.
Lauter gute Leute.
Aber irgendetwas war faul.
Und es wurde Zeit herauszufinden, was und warum.
Auf der anderen Seite der Abteilung entdeckte sie jetzt Terra Lucent und ging zwischen Kleiderständern hindurch zu ihr hinüber. Terra war eine zierliche Frau mit kupferrotem Haar, eine der vier Verwaltungsassistentinnen, die beim Billet angestellt waren.
»Sie wollen mir gewiss sagen, warum ich hier bin«, sprach Stephanie sie beim Nähertreten an. »Und sollten Sie jetzt nicht eigentlich schlafen?«
»Ich bin froh, dass Sie bereit waren, sich mit mir hier zu treffen. Wirklich. Ich weiß, dass es ungewöhnlich ist.«
»Das kann man wohl sagen.«
Stephanie hatte eine Notiz auf ihrem Schreibtisch gefunden, in der Terra sie gebeten hatte, um 17.30 Uhr zu Dillard’s zu kommen und niemandem davon zu erzählen. Terra arbeitete schon seit einigen Jahren für sie und hatte die Nachtschicht zugewiesen bekommen, weil sie so besonnen und zuverlässig war.
»Ma’am, die Sache ist wichtig.«
Stephanie bemerkte die Sorge im Gesicht der jungen Frau. Terra hatte sich vor Kurzem zum vierten Mal scheiden lassen. Bei der Liebe hatte sie ein bisschen Pech, aber sie war gut in ihrem Job.
»Ich muss Ihnen etwas berichten. Das, was da läuft, ist nicht richtig. Überhaupt nicht richtig.«
Stephanie sah, wie der Blick ihrer Mitarbeiterin weghuschte und durch den Laden wanderte. Es waren nur ein paar Angestellte und Kundinnen zu sehen.
»Erwarten Sie jemanden?«
Terra sah sie an und fuhr sich mit der Zunge über die Lippen. »Ich wollte einfach nur sichergehen, dass wir allein sind. Darum habe ich Sie gebeten hierherzukommen.«
»Und warum auf einem Zettel? Hätten Sie mich nicht anrufen können? Oder hätten Sie mich nicht einfach im Büro ansprechen können? Warum diese Geheimniskrämerei?«
»Anders ging es nicht.«
Die Worte ließen Schlimmes erahnen.
»Terra, was ist los?«
»Es war vor ungefähr zehn Tagen, da hatte ich mir spät in der Nacht in der Cafeteria etwas zu trinken geholt. Wir waren unterbesetzt, und so habe ich das Handy mitgenommen, falls jemand anruft. Ich rauche immer unten vor der Tür. Aber wenn ich ganz allein in der Abteilung bin … ich weiß, dass wir in den Räumen nicht rauchen dürfen … kann ich nicht lange weg, weil sonst keiner da ist. Darum lasse ich die Tür auf, damit ich es höre, wenn eine E-Mail eintrifft, und gehe zum Rauchen ans Ende des Korridors.«
Es war im Billet Vorschrift, dass sich immer jemand im Büro befinden sollte. Die Agenten erhielten Laptops und iPhones mit spezieller Software, da verschlüsselte E-Mails und Textnachrichten eines der schnellsten und sichersten Kommunikationsmittel waren.
»Warum rauchen Sie nicht einfach im Büro?«
Sie schüttelte den Kopf. »Das würde man riechen. Ausgeschlossen.«
Terras Vorliebe für alles, was Tabak enthielt, war kein Geheimnis und das Rauchen in öffentlichen Gebäuden halt gesetzlich verboten. »Vergessen Sie das mit den Zigaretten und kommen Sie zur Sache.«
»Vor zehn Tagen bin ich, wie gesagt, in die Nische am Ende des Korridors gegangen. Ich habe das Fenster aufgemacht, damit der Rauch abzieht. Als ich mit der Zigarette fertig war, bin ich ins Büro zurückgekehrt. Und da habe ich ihn entdeckt. Er hat mir seine Dienstmarke gezeigt und mich mit Drohungen eingeschüchtert. Er sagte, er komme vom Finanzministerium.«
»Wie ist dieser Mann denn ins Gebäude gelangt?«
»Ich habe am folgenden Tag die elektronischen Einlassdaten überprüft, und um diese Nachtzeit ist kein Besucher verzeichnet.«
Alle Türen waren mit einem elektronischen Schloss gesichert, das sich nur mit einer Schlüsselkarte öffnen ließ. Und das hieß, wer immer er war, er hatte Freunde in der richtigen Position.
»Was wollte er im Büro?«
»Zugang zu den Computern.«
»Und den haben Sie ihm gewährt?«
Terra nickte.
»Wie lange hat er sich in unseren Räumen aufgehalten?«
»Eine halbe Stunde. Er hat ein Gerät im Konferenzsaal benutzt. Als er wieder weg war, wollte ich mir seinen Verlauf anschauen, aber den hatte er gelöscht.«
»Und dann haben Sie bis jetzt gewartet, um mir davon zu berichten?«
»Ich weiß, Ma’am. Aber ich dachte, es handelte sich um eine einmalige Angelegenheit, einen Notfall.«
»Ich fasse es nicht, dass Sie das getan haben.«
Das Gesicht ihrer Mitarbeiterin umwölkte sich vor Enttäuschung. »Ich weiß. Aber … er hat dafür gesorgt, dass ich den Mund halte.«
Das klang überhaupt nicht gut.
»Ich habe einen ungedeckten Scheck ausgestellt, Ma’am. Das war während meiner letzten Scheidung. Das Geschäft hat damals einen Haftbefehl gegen mich beantragt. Ich habe meine Schulden dann beglichen, wurde aber trotzdem verhaftet. Dieser Mann, der im Büro war, wusste das alles. Er hat mir versprochen, darüber Stillschweigen zu wahren. Ich wollte meine Stelle nicht verlieren. Ich wusste, dass ich wegen der Verhaftung nicht mehr durch die Sicherheitsüberprüfung käme. Bei dem Scheck ging es um einen Betrag von 500 Dollar. Also ein Verbrechen. Die Vorwürfe wurden schließlich fallen gelassen, aber ich wollte kein Risiko eingehen. Meine Kinder müssen essen. Also habe ich getan, was ich tun musste, aber dann ist er zu weit gegangen.«
Stephanie hörte ihr gespannt zu.
»Er ist ein paar Tage später zurückgekommen und wollte erneut Zugang zum Computer … diesmal über meinenAccount.« Terra hielt inne. »Ich habe ihn ihm gewährt. Das alles war nicht richtig. Und er will nun erneut Zugang erhalten. Heute Nacht.«
Stephanie überdachte die erhaltenen Informationen und fragte dann: »Ist das alles?«
Terra nickte. »Es tut mir leid. Wirklich. Ich habe mich immer bemüht, meinen Job gut zu machen. Ich weiß, dass Sie mir vertrauen …«
»Sie haben jede Regel gebrochen.«
Terras Augen wurden feucht.
Derzeit brauchte Stephanie diese Frau als Verbündete, und so stellte sie klar: »Ich lasse es Ihnen durchgehen … vorläufig … vorausgesetzt, Sie tun dreierlei.«
»Was Sie wollen, Ma’am.«
»Erzählen Sie niemandem von dem, was Sie mir gesagt haben. Gewähren Sie dem Mann heute Abend Zugang. Und berichten Sie mir von jetzt an alles, was er sagt oder tut.«
Terras Miene hellte sich auf. »Natürlich. Das mache ich.«
»Und jetzt los. Gehen Sie hier raus und schlafen Sie erst einmal. In ein paar Stunden beginnt Ihre Schicht.«
Terra bedankte sich erneut und ging.
Das war noch nie da gewesen. Noch nie war die Sicherheit des Billet kompromittiert worden. Ihre Abteilung war immer straff geführt gewesen, es hatte nie einen Zwischenfall gegeben, und die Liste der Erfolge war weit größer als die der gescheiterten Bemühungen. Diese positive Bilanz hatte auch für Neid unter den Kollegen gesorgt. Aber das Finanzministerium? Was war in den Dateien des Billet so wichtig, dass man deswegen eine seiner Mitarbeiterinnen erpresste?
Was immer es war, Stephanie musste Bescheid wissen.
Sie begab sich gemächlich zum Ausgang des Kaufhauses. Terra marschierte dreißig Meter vor ihr in dieselbe Richtung. Sie betraten den hohen, von einer Glaskuppel überwölbten Innenhof des Einkaufszentrums, von dem aus die Besucher in vier Richtungen zu den auf zwei Geschossen verteilten Einzelhändlern gelangten.
Stephanie fiel im Obergeschoss ein Mann auf.
Er war schlank, hatte dünnes Haar und stand, mit einem dunklen Anzug und einem weißen Hemd bekleidet, auf das Geländer gestützt da. Er verließ seinen Platz sofort und ging los, parallel zu ihr, nur halt ein Geschoss höher. Terra eilte durch das wenig belebte Einkaufszentrum zu einem weiteren Innenhof, der die Restaurants beherbergte. Von dort führten Türen zu den Parkplätzen hinter dem Gebäude. Stephanie sah kurz nach oben und erhaschte einen Blick auf den Mann, der ihr immer noch folgte. Als sie in dem zweiten Innenhof ankamen, ging Terra nach links zum Ausgang, und der Mann hastete auf einer im Halbkreis geschwungenen Treppe nach unten. Während er zum Erdgeschoss hinunterstieg, zog Stephanie ihr Handy aus der Jackentasche.
Der Mann trat auf die letzte Stufe.
Sie richtete das Handy auf ihn, schoss ein Foto und ließ die Hand mit dem Gerät rasch sinken. Der Fotografierte wandte sich, unten angekommen, zum hinteren Ausgang des Einkaufszentrums. Kein Zweifel. Er folgte Terra. Stephanie bemerkte einen Wachmann, der an einem Tisch saß und Kaffee aus einem Becher trank.
Etwas Hartes bohrte sich ihr in die Rippen.
»Kein Ton, oder Ihre Mitarbeiterin dort vorn schafft es heute Nacht nicht mehr zur Arbeit.«
Stephanie erstarrte.
Terra verließ das Einkaufszentrum.
Der Mann vor ihr blieb stehen und drehte sich um. Ein breites Grinsen stand in seinem Gesicht. Stephanies Hand mit dem Telefon hing nach unten. Der erste Mann kam langsam auf sie zu und griff nach dem Gerät.
»Ich glaube nicht, dass Sie das noch brauchen.«
4
Venedig, Italien
Malone sprang von der Rasenfläche auf, die Lunge rau vom Keuchen in der trockenen Nachtluft. Zum Glück war er nicht auf eines der steinernen Grabmale gefallen, die ihn auf allen Seiten umstanden. Die Trümmer des Hubschraubers brannten noch immer, außer dem lodernden Gerippe waren von ihm nur noch verkohlte Einzelteile übrig. Der allmählich verglühende Schein der Flammen beleuchtete den Weg von den Gräbern zur Kirche. Dort musste es eine Anlegestelle geben, und vermutlich befand sich sogar ein Wächter irgendwo auf der Insel. Aber wo war der eigentlich? Der Hubschrauberabsturz konnte ihm unmöglich entgangen sein. Auf der anderen Seite der Lagune in Venedig war er bestimmt bemerkt worden. Bald würde sich die Polizei auf den Weg machen, vielleicht hatte sie bereits abgelegt. Es war keine gute Idee, auf sie zu warten. Er musste hier weg! Ursprünglich hatte er den Auftrag gehabt, die Vorgänge einfach nur zu beobachten und dann darüber zu berichten. Aber die Sache war verdammt schiefgegangen.
Einmal jährlich schickten die Versicherungsmanager Nordkoreas ihrem Geliebten Führer zum Geburtstag ein Geschenk von zwanzig Millionen Dollar in bar, Geld, das durch Betrug erworben worden war. Ihm lagen Transportunfälle, Fabrikbrände, Überschwemmungen und andere Katastrophen in Nordkorea zugrunde, die entweder frei erfunden oder aber künstlich herbeigeführt worden waren. Versicherungspolicen wurden in Nordkorea ausschließlich von der in Staatsbesitz befindlichen KNIC herausgegeben. Um die Haftung auf zusätzliche Schultern zu verteilen, suchte die KNIC auf der ganzen Welt Versicherungen, die bereit waren, als Gegenleistung für riesige Prämien einen Teil des Risikos zu übernehmen, und fand diese Gesellschaften in Europa, Indien und Ägypten. Natürlich ging jeder dieser Versicherungsgeber davon aus, dass die KNIC das Risiko geschätzt und die entsprechenden Werte in den Vertrag eingesetzt hatte, um die zu versichernde Deckungssumme so niedrig wie möglich zu halten. Das war schließlich die Idee hinter dem Geschäft der Versicherungen – so wenige Schäden wie möglich begleichen zu müssen. Doch hier lief der Hase anders. Die KNIC sorgte dafür, dass teure Versicherungsfälle eintraten, für die die Rückversicherer dann einstehen mussten. Je mehr Katastrophen es gab, desto besser. Um nicht unnötige Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, wurden systematisch Ansprüche gegen verschiedene Versicherer erzeugt. Im einen Jahr galt das Hauptaugenmerk Lloyd’s, im nächsten Munich Re und dann wieder Swiss Re. Jeder Anspruch wurde sorgfältig dokumentiert und dann durch vorgebliche Kontrollbüros in Pjöngjang geschleust, die niemals irgendetwas infrage stellten. Hilfreich war natürlich, dass die Gesetze Nordkoreas es den Rückversicherern unmöglich machten, die Schadensfälle vor Ort mit eigenen Leuten zu untersuchen.
Alles in allem war es die perfekte Betrugsmasche, die jährlich einen Gewinn von über fünfzig Millionen Dollar abwarf. Einen Teil davon behielt die KNIC, um die Trickserei am Laufen zu halten, und den Rest zahlte sie in die Taschen des Geliebten Führers.
In den letzten vier Jahren waren das jeweils zwanzig Millionen Dollar gewesen.
In Pjöngjang waren Säcke voll Geld aus Singapur, der Schweiz, Frankreich und Österreich eingetroffen. Dieses Jahr war Italien an der Reihe gewesen. Die Scheine wurden an eine Institution geschickt, die Büro 39 des Zentralkomitees der Koreanischen Arbeiterpartei hieß und geschaffen worden war, um Geld in harten Währungen einzusammeln und den Geliebten Führer mit Kapital auszustatten, das von der praktisch nicht existierenden Volkswirtschaft unabhängig war. Geheimdienstberichte wiesen darauf hin, dass dieses Geld in Luxusgüter für die Elite, Raketenbauteile und sogar das koreanische Kernwaffenprogramm floss. In alles, was ein unternehmungslustiger Diktator so gebrauchen konnte.
Stephanie hatte einen Zeugen für die diesjährige Geldübergabe schaffen wollen, da das bisher nie gelungen war. Der amerikanische Geheimdienst hatte den Schauplatz des Geschehens herausgefunden – Venedig –, und so hatte Stephanie Malone aufgetragen, das Kreuzfahrtschiff zu verlassen und sich an Land zu begeben.
Er hatte sich über dieses Zusammentreffen gewundert.
Wie kam es, dass die Geldübergabe gerade zu dem Zeitpunkt stattfand, da er sich seinerseits in Venedig aufhielt?
Die Antwort auf diese Frage war ihm nicht übermäßig wichtig erschießen, bis die Schießerei begann. Doch jetzt hatte das Geld sich in Asche verwandelt und alle Beteiligten waren tot. Daher würde er gerne Bescheid wissen.
Im Geist ging er alles durch, was er über seinen jetzigen Aufenthaltsort wusste.
Die Isola di San Michele war ursprünglich nur eine von zwei Inseln gewesen, doch das Wasser zwischen ihnen war vor langer Zeit aufgefüllt worden. Den Friedhof hatte Napoleon 1807 gegründet, als er den Venezianern verbot, ihre Toten weiterhin innerhalb der Stadt zu bestatten. Aus dieser Zeit waren eine Renaissancekirche und ein ehemaliges Kloster zurückgeblieben. Dessen Grenzen wurden von einer hohen Mauer bewacht, über die sich der dunkle Umriss von Zypressen erhob. Und noch eine ungewöhnliche Tatsache war Malone in Erinnerung. Die Beerdigungen folgten dicht aufeinander, und den Toten wurden dazwischen nur ein paar Jahre Ruhe gewährt. Nach einem Jahrzehnt wurden ihre Überreste exhumiert und in Beinhäusern gelagert, sodass Platz für neue Leichen entstand. Rechts von ihm stand eine der Anschlagtafeln, die die Zeitpläne für die Exhumierungen auflisteten.
Er zog das leere Magazin aus der Beretta und ersetzte es. Dann marschierte er zur Kirche, ohne sich um Geräuschlosigkeit zu bemühen. Die gepflasterten Wege waren von einer Anlage mit Zypressen und weiteren Grabmonumenten gesäumt. Manche der Gräber wiesen auffällige Kuppeln, Skulpturen und schmiedeeiserne Verzierungen auf. Andere lagen terrassenartig übereinander wie Akten in Ablagefächern. Erstaunlich, was die Leute sich gegenüber den Toten alles herausnahmen.
Der Schmerz in seinem Oberschenkel ließ allmählich nach. Er war verdammt noch mal zu alt, um von fliegenden Hubschraubern zu fallen. Eigentlich befand er sich doch in Rente – nachdem er seine Laufbahn in der Marine und dann, nach seinem Jurastudium, im Dienst des Justizministeriums verbracht hatte, wo er für Stephanie Nelles Magellan Billet arbeitete. Er hatte vor drei Jahren gekündigt und besaß inzwischen ein Antiquariat in Kopenhagen. Aber immer wieder war er in gefährliche Situationen verwickelt worden. Diesmal allerdings hatte er den Ärger selbst heraufbeschworen, als er bereitwillig Stephanies Angebot angenommen hatte, freiberuflich für sie zu arbeiten. Die letzten Wochen waren alles andere als angenehm verlaufen. Er hatte schon lange nichts mehr von Cassiopeia Vitt gehört. Sie waren im vergangenen Jahr ein Paar gewesen, hatten sich aber vor einem Monat getrennt, als sie wieder einmal in die Bredouille geraten waren, diesmal in Utah. Malone hatte geglaubt, wenn sie sich erst einmal beruhigt hätte, könnten sie das Problem aufarbeiten. Er hatte sie sogar einmal angerufen, aber sie hatte nicht abgenommen. Allerdings hatte er eine E-Mail erhalten, kurz und liebenswürdig:
Lass mich in Ruhe.
Offensichtlich hielt ihre Verbitterung auch weiterhin an.
Also hatte er ihren Wunsch befolgt, und die Gelegenheit, auf Staatskosten der US-Regierung zehn Tage lang durch die Adria und das Mittelmeer zu kreuzen, war ihm wie eine gute Atempause erschienen. Er hatte nichts weiter zu tun, als ein Auge auf einen gewissen Paul Larks, einen ehemaligen Mitarbeiter des Finanzministeriums, zu halten, und dieser würde ihn möglicherweise zu einer Person namens Anan Wayne Howell führen. Howell war aus den USA geflohen, und das Justizministerium suchte ihn. Also war Malone dicht an Larks drangeblieben. Der alte Herr ging auf die siebzig zu und hatte einen gebeugten Rücken, was Malone an seinen verstorbenen Freund Henrik Thorvaldsen erinnerte. Der Beobachtete hatte während der Kreuzfahrt mit niemandem Kontakt gehabt, was Malone zu der Überzeugung geführt hatte, dass die eventuelle Entwicklung, worin auch immer sie bestehen mochte, in Venedig eintreten würde. Doch dort hatte Stephanie ihn auf das italienische Festland geschickt.
Wo dann das Desaster gefolgt war.