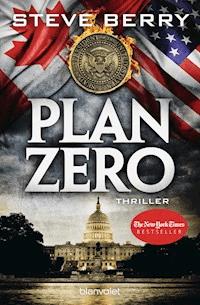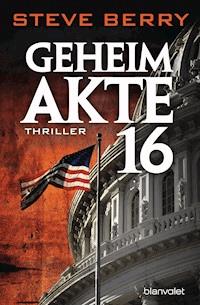8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Ein verschwundenes Gemälde, ein religiöser Geheimbund und eine Jahrtausende alte Verschwörung!
Nicholas Lees Job ist so einzigartig wie die Artefakte, die er beschützt: Für die UNESCO bewahrt er das kulturelle Erbe der Welt vor Kriminellen. Doch als ein Teil des weltberühmten Genter Altarbilds zerstört wird, führt ihn die Spur ausgerechnet in ein Nonnenkloster. Noch ahnt Lee nicht, was auf ihn zukommt, aber die Verschwörung reicht bis in die höchsten Kreise des Vatikans. Wieso sollte das Kunstwerk zerstört werden? Enthält es wirklich verschlüsselte Hinweise auf ein Jahrtausende altes Geheimnis, das die katholische Kirche in ihren Grundfesten erschüttern könnte?
Lassen Sie sich auch die »Cotton Malone«-Reihe von SPIEGEL-Bestsellerautor Steve Berry nicht entgehen, zum Beispiel »Das Kanzler-Komplott«, »Die sieben Relikte« oder »Die Vatikan-Intrige«!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 581
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Buch
Nicholas Lees Job ist so einzigartig wie die Artefakte, die er beschützt: Für die UNESCO bewahrt er das kulturelle Erbe der Welt vor Kriminellen. Doch als ein Teil des weltberühmten Genter Altarbilds zerstört wird, führt ihn die Spur ausgerechnet in ein Nonnenkloster. Noch ahnt Lee nicht, was auf ihn zukommt, aber die Verschwörung reicht bis in die höchsten Kreise des Vatikans. Wieso sollte das Kunstwerk zerstört werden? Enthält es wirklich verschlüsselte Hinweise auf ein jahrtausendealtes Geheimnis, das die katholische Kirche in ihren Grundfesten erschüttern könnte?
Autor
Steve Berry war viele Jahre als erfolgreicher Anwalt tätig, bevor er seine Leidenschaft für das Schreiben entdeckte. Mit jedem seiner hoch spannenden Thriller stürmt er in den USA die Spitzenplätze der Bestsellerlisten und begeistert Leser weltweit. Seine Bücher wurden mehr als fünfundzwanzig Millionen Mal verkauft und in über vierzig Sprachen übersetzt. Zusammen mit seiner Frau Elizabeth betreibt er History Matters, eine Organisation, die sich für den Erhalt historischer Stätten einsetzt. Sie leben in St. Augustine, Florida.
Von Steve Berry bereits erschienen (Auswahl)
Die »Cotton Malone«-Reihe:
Das Kanzler-Komplott · Die sieben Relikte · Die Vatikan-Intrige · Das Memphis-Dossier · Der goldene Zirkel
STEVE BERRY
Opus
Thriller
Deutsch von Wolfgang Thon
Die Originalausgabe erschien 2022 unter dem Titel »The Omega Factor« bei Hodder & Stoughton, New York.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright der Originalausgabe © 2022 by Steve Berry
Published by Arrangement with MAGELLAN BILLET INC.
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2023 by Blanvalet in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Werner Bauer
Umschlaggestaltung: Guter Punkt, München
Umschlagmotiv: iStock.com / Getty Images Plus (jessicahyde; Zenobillis; sqback); mauritius images / Bildarchiv Monheim GmbH / Alamy / Alamy Stock Photos
JS · Herstellung: sam
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-29935-4V001
www.blanvalet.de
Für Walt und Roy Disney, die mit ihrer Inspiration und Fantasie ein außergewöhnliches Vermächtnis hinterlassen haben.
»Wie ein Hund, der zu seinem Erbrochenen zurückkehrt, ist ein Narr, der zu seiner Torheit zurückkehrt.«
Die Sprüche Salomos 26:11
Prolog
Pyrenäen
Spätfrühling 1428
Seine Verfolger holten auf, und Jan van Eyck trieb das Pferd mit einem Tritt in die Flanken an. Das Tier schien ihre Notlage zu spüren, beschleunigte deshalb sein Tempo und schnaubte heftig bei jedem Atemzug in der kühlen Bergluft.
Jan war allein und wurde durch unbekanntes und feindliches Terrain gejagt. Als er vormittags zum ersten Mal die Mauren sichtete, hatte er neun Reiter gezählt; weitere zwei hatten sich seither der Verfolgung angeschlossen. Sein Auftrag war für seinen Wohltäter lebenswichtig, er durfte nicht in Gefangenschaft geraten, also trieb er das Pferd mit einem Ruck an den Zügeln weiter.
Er kannte sein Pferd gut. Schon oft hatte er erfahren, wie nützlich ein gutes, schnelles und wendiges Pferd sein konnte. Wenn ein Pferd erkrankte, wurde es mit mehr Sachverstand gepflegt, als den meisten Christenmenschen vergönnt war. Pferde ließen Königreiche erblühen, und die Courser, die Palfreys und vor allem die Destrier erwiderten Zuneigung mit unvergleichlicher Treue. Er wusste von einem Ritter, der, aus dem Krieg heimgekehrt, von seiner Verlobten nicht erkannt, aber von seinem treuen Hengst sogleich freudig begrüßt wurde.
Nervös spähte er in die Landschaft.
Um ihn herum ragten schroffe, schneebedeckte Berge in den Himmel. Im Westen erhob sich wie eine Sphinx in der Wüste ein schmaler Gipfel, dessen obere Falten in silbriges Weiß gehüllt waren; ein weiterer Ausläufer der steil aufragenden Pyrenäen lag weit hinter ihm im Dunkel. Er brauchte nicht anzuhalten und zu lauschen, um zu wissen, dass hinter ihm Hufe über das Grasland schlugen. Sein Plan war gewesen, sich unbemerkt nach Norden durchzuschlagen. Es war nur ein zweitägiger Ritt von Tormé auf der spanischen Seite der Berge nach Las Illas auf der französischen Seite. Die alte Stadt war erst vor Kurzem in eine Festung verwandelt worden, und er wusste, dass sich die Mauren durch ihre Nähe provoziert fühlten.
Obwohl Navarra und Aragonien von den Christen kontrolliert wurden, streiften die Mauren noch immer ungehindert durch Nordspanien. Langsam trieb die Reconquista die Araber in den Süden; Jahr für Jahr wurden Burgen und Städte zurückerobert. Irgendwann würden die Mauren gezwungen sein, sich einzuschiffen und nach Afrika zurückzukehren, was ein Ende der sechshundertjährigen Herrschaft bedeuten mochte. Doch in der Zwischenzeit verwüsteten sie weiterhin Kirchen, plünderten Klöster und überfielen Reisende, insbesondere jene, die sich zu weit in den Süden wagten und die Pyrenäen überquerten.
Jan dachte an die Krieger hinter ihm.
Mohr bedeutete einfach nur »dunkel«, und das tiefe Oliv ihrer Haut bildete einen starken Kontrast zu den locker sitzenden weißen Tuniken, den farbenprächtigen Turbanen und den bunten Seidentüchern, die ihre Hälse umhüllten. Sie waren ein rücksichtsloser Haufen, zweifellos gefährlich, und er wollte sich weder ihren halbmondförmigen Krummsäbeln noch ihren berittenen Bogenschützen stellen. Er hatte mit einem Pfeilhagel gerechnet, aber die Verfolgung hatte bisher durch dichte Tannen- und Kiefernwälder geführt – das hieß also: kein freies Schussfeld. Er hasste Bogenschützen. Ein wahrer Krieger sollte nur mit einer Axt und einem Schwert in der Hand in die Schlacht ziehen. Wie hatte es ein Dichter ausgedrückt?
Feige war er, der erste Bogenschütze.
Jan konzentrierte sich nicht mehr auf die Bodenbeschaffenheit, sondern auf den Weg, der vor ihm lag, und verließ sich darauf, dass sich sein Pferd um den sicheren Tritt kümmerte.
Eine heftige Bö fegte durch eine enge Schlucht in der Nähe und verlangsamte sein Tempo. Die Bäume ringsum begannen sich zu verändern, es gab weniger Tannen, jetzt dominierten hoch aufragende Kiefern. Die Stämme reckten sich kühn in den Himmel, viele waren wie unter Schmerzen verdreht, die meisten ohne ausladende Äste.
Der Verfolgte zuckte zusammen.
Für die Bogenschützen gab es nun mehr Möglichkeiten.
Das Pferd wurde langsamer und bahnte sich einen Weg durch die Kiefern, wobei es Granitblöcken auswich und eine deutliche Spur im zierlichen Edelweiß hinterließ. Stille umhüllte den düsteren Wald. Der modrige Geruch von Zweigen und Ästen stieg Jan in die Nase. Die Sonne schien warm, und die Wolken hingen tief, was bedeutete, dass ihm vielleicht der Regen zum Verbündeten werden würde. Aber im Moment war das Gewitter zu weit weg, um ihm nützlich zu sein.
Er hielt das Pferd an und riskierte einen Blick zurück. Niemand in Sicht.
Dann lauschte er nach irgendwelchen Geräuschen, die die Anwesenheit der Mauren hätte verraten können, aber das Grillenzirpen störte ihn. Er trat aus dem Schutz der Bäume hervor und suchte sich einen Pfad, der nach Osten führte.
Ein unterzeichnetes Dokument in seiner Satteltasche bestätigte, dass er der verbriefte Vertreter Philipps des Guten war, des regierenden Herzogs von Burgund. Von Beruf war er ein Künstler: Philipps Hofmaler. Aber jetzt fungierte er als ein Spion im Dienste des Herzogs. Sein aktueller Auftrag hatte ihn nach Spanien geführt, um die dortigen Straßen und Landschaften zu erkunden. Seine Kunst zeichnete sich durch seine Detailtreue, sein Geschick und seine Genauigkeit mit Feder und Pinsel aus. Der Herzog pflegte zu sagen, dass seine visuelle Auffassungsgabe unübertroffen sei. Aber im Gegensatz zu seinen Gemälden, bei denen die reale Welt nur inspirierte, was er darstellte, musste das, was er bei einer geheimen Mission erschuf, die Wirklichkeit exakt wiedergeben. Auf dieser Reise hatte er wertvolle Karten gezeichnet, die zu wichtigen Gebirgspässen führten – für Heerzüge ohne Zweifel von entscheidender Bedeutung.
Jan war breitschultrig und von kräftiger Statur. Sein braunes Haar war lang und zerzaust, sein Bart zottelig, was sein blasses Gesicht noch blasser aussehen ließ. Normalerweise wäre er glatt rasiert gewesen, aber in den letzten Wochen hatte er absichtlich darauf verzichtet, weil die Gesichtsbehaarung zu seiner Verkleidung gehörte. Sein Kopf war schmal, groß und kantig, wie manche sagten, mit einer hohen Stirn und einer feinen, geraden Nase. Es war hilfreich, dass er Spanisch sprach und die örtlichen Sitten kannte. All das machte ihn zu einem perfekten Spion.
Eine weitere Brise strich vorbei, also genoss er diesen ruhigen Moment. Seine Haut war feucht und heiß, die Beine schmerzten. Unter dem Mantel war er in eine massive Rüstung gekleidet; eine schwere Helmbrünne schnitt ihm in Hals und Kinn. Er hatte sich für den Kampf eingekleidet, bereit für alles, was auf ihn zukommen mochte, und elf maurische Reiter hatten die Herausforderung angenommen. Zum wiederholten Mal fragte er sich, ob ihn jemand aus dem letzten Dorf verraten hatte. Es war eine christliche Gemeinde gewesen, aber er war gewarnt worden, dass die Mauren überall Augen und Ohren hatten.
Wohlwollend tätschelte er seinem Pferd den Hals. Das Tier legte die Ohren an und ließ sich bereitwillig streicheln. In einem Baum in der Nähe zwitscherten Finken. Fast erwartete er Axtschläge oder Sägegeräusche, aber es gab keine Anzeichen dafür, dass sich jemand in der Nähe aufhielt. Vor ihm öffnete sich ein weiterer Pass, und dahinter breitete sich ein smaragdgrünes Tal aus. Deutlich schlängelte sich ein Pfad durch den dichten Buchenhain. Dann trieb er das Pferd an, richtete sich im Sattel auf und hoffte, dass er die Verfolger vielleicht abgehängt hatte. Er wäre sehr froh gewesen, hätte er seine schwere Metallkleidung ablegen und eine erholsame Nacht genießen können. Er wollte Las Illas unbedingt noch vor Sonnenuntergang erreichen.
Vor ihm, an einem der Bäume, erregte etwas seine Aufmerksamkeit. Er näherte sich und blieb stehen.
In den Stamm einer riesigen Buche war die Figur eines Vogels geschnitzt. Auf die Darstellung war große Sorgfalt verwendet worden. Das Gefieder und der Schnabel waren deutlich zu erkennen, die mächtigen Schwingen angezogen und flugbereit.
Diese Geierart war ihm bekannt.
Die Spanier nannten ihn Quebrantahuesos. Knochenbrecher.
Und er kannte den Grund dafür.
Schon oft hatte er staunend beobachtet, wie der große Raubvogel seine Beute aus der Luft auf Felsen fallen ließ, um die Knochen zu brechen und so leichter an das nahrhafte Knochenmark zu gelangen. Seltsam, dass sich jemand die Zeit genommen hatte, den Raubvogel hier so schön abzubilden. Unter dem Vogel waren Buchstaben zu sehen. Die Sprache war ihm nicht geläufig, aber er erkannte die arabischen Zeichen. Um ihn herum heulte der Wind durch die Felsspalten. Jan überlegte gerade, was er als Nächstes tun sollte, als die Stille durch ein leises Sirren unterbrochen wurde, das schnell lauter wurde.
Dieses Geräusch kannte er nur zu gut.
Pfeile, die durch die Luft sausten.
Im nächsten Augenblick bohrten sich drei Spitzen vor ihm in den Boden.
Sein Kopf ruckte herum.
Die Mauren waren um eine Wegbiegung gekommen und näherten sich schnell. Er trieb sein Pferd an. Ihre erste Salve war danebengegangen, aber bei der nächsten Gelegenheit würden sie es besser machen. Vorsorglich ließ er seine rechte Hand von den Zügeln gleiten, um sich zu vergewissern, dass seine Streitaxt noch an dem Lederriemen am Sattel befestigt war. Die Waffe würde er wohl bald brauchen.
Dann erreichte er den Bergpass.
Zu seiner Linken erhoben sich blendend weiße Klippen. Buchsbaumgestrüpp klebte an jeder Felsspalte. Rechts von ihm tauchte ein tiefschwarzer Wald auf. Beinahe hätte er das Pferd in die Bäume gelenkt, aber sein Vorsprung vor den Mauren war gut, und er hoffte, dass er ihnen vielleicht entwischen konnte. Entweder hinter oder nahe der Grenze musste er jetzt sein, und mittlerweile zweifelte er, ob die Mauren ihm in französisches Gebiet folgen würden.
Zielstrebig nahm er eine Wegbiegung und duckte sich unter einen ausgestreckten Ast. Sein Pferd lief im vollen Galopp, die Hufe flogen über den harten Boden. Vor sich sah er wieder einen geschnitzten Geier in einem Baumstamm, mit weiteren arabischen Zeichen. Gerade als er den Baum passierte, trafen die Vorderläufe des Pferdes auf ein mürbes Stück Schiefer, und sie stürzten zu Boden. Jan wusste, was ihn erwartete, also sprang er ab, als das Tier strauchelte, und hoffte, dass ihn sein Kettenhemd vor dem Schlimmsten bewahren würde.
Neben dem Pferd prallte er auf den harten Boden. Während er nach links abrollte, taumelte das Pferd weiter, wobei sein erschütterndes Wiehern anzeigte, dass das Tier Schmerzen hatte. Mehrere Male überschlug er sich. Das Kettenhemd drückte sich in sein Unterkleid aus Schaffell. Er verschränkte die Arme vor dem Kopf und schützte sein Gesicht vor den Felsen, als er vom Weg abkam. Und er stürzte weiter, bis er schließlich an den knorrigen Wurzeln einer Buche zum Halten kam.
Einen Moment lang saß er still da und begutachtete seine Verletzungen. Es tat weh, denn er hatte eine Vielzahl von Schnitten und Schürfwunden, allerdings nichts wahrlich Unerträgliches. Arme und Beine prüfen: Nichts schien gebrochen. Dann bewegte er seinen Kopf von einer Seite zur anderen: Sein Hals war nicht betroffen. Herrgott, allmächtiger Gott – er hatte Glück gehabt. Der Geruch von Schimmel und Moos stieg ihm in die Nase. Sofort lauschte er auf Geräusche der Mauren.
Aber da war nichts.
Der Gedanke an seine Verfolger ließ ihn sich wieder aufrichten.
Er schob die Bundhaube zurück und ließ die Kapuze in den schweißnassen Nacken sinken. Dann wischte er sich das Blut von der Stirn, dann taumelte er zurück auf den Weg. Das Pferd war auf den Beinen, anscheinend unversehrt.
Was für ein zäher Hengst!
Ein Blick nach rechts.
Die Mauren waren weiter unten auf dem Weg, immer noch im Sattel, und beobachteten ihn einfach nur. Zum Glück waren sie weit genug weg, sodass ihre Bögen nutzlos waren. An der Möglichkeit eines Angriffs ihrerseits zweifelte er keine Sekunde lang. Er würde eine leichte Beute sein, da sowohl sein Schwert als auch seine Axt beim Pferd waren. Das war auch gut so. Mit den Waffen an der Hüfte hätte er den Sturz vielleicht nicht überlebt. Mürrisch starrte er seine Feinde an und beschloss, in den Wald zu fliehen, falls sie weiter vorrückten, und auf sein Glück zu hoffen. Vielleicht konnte er einem von ihnen die Waffe abnehmen.
»Sie werden nicht näher kommen«, sagte unvermittelt jemand hinter ihm.
Eine Frau. Sie sprach Okzitanisch.
Er drehte sich um und erblickte eine schwarz gekleidete Nonne, die allein in der Mitte des Weges stand. Ihre Miene verriet keine Spur von Angst oder Besorgnis. Seltsam. Er konnte sich nicht entscheiden, was die größere Bedrohung war – die bekannten Gegner oder diese nachgerade unwirkliche Gestalt.
»Was meint Ihr?«, fragte er, wobei er beim Okzitanischen blieb, und wandte sich dann wieder den Mauren zu.
»Sie werden nicht näher kommen«, sagte sie erneut.
Er wandte seinen Blick nicht von dem wilden Haufen ab.
»Es besteht keine Gefahr«, erklärte die Nonne, und ihre Worte klangen ruhig wie der Hall einer Stimme aus dem Himmel.
»Diese Krieger sind sehr gefährlich«, stellte er klar.
»Nicht hier.«
Aber er war nicht überzeugt.
Also beschloss er, die Worte auf die Probe zu stellen, machte ein paar Schritte nach vorne und hob die Arme über den Kopf. Er schwenkte sie hin und her und schrie den Reitern in der Sprache Aragons zu, die sie sicherlich verstanden: »Tretet vor, ihr Feiglinge, und kämpft.«
Sie nahmen die Hausforderung nicht an.
»Habt ihr Angst vor einem einzigen unbewaffneten Mann? Und vor einer Nonne?« Keine Antwort kam aus ihren dunklen, verdrossenen Gesichtern.
Er ließ die Arme sinken.
»Bei Gott, ihr habt Angst!«, schrie er.
Einen Mauren herauszufordern bedeutete normalerweise, einen Kampf auf Leben und Tod zu riskieren. Die Araber hatten die Iberische Halbinsel nicht durch Schwäche erobert. Doch diese Heiden drehten sich einfach um und trabten mit ihren Pferden davon. Das war doch kaum zu glauben! Vorsichtshalber behielt er sie im Blick, bis sie hinter einer Biegung verschwanden und nur noch Staub in der Luft wirbelte. Er wandte sich wieder an die Nonne und wollte wissen: »Die geschnitzten Vögel in den Bäumen. Was bedeuten die arabischen Worte darunter?«
Irgendwie ahnte er, dass diese Frau die Frage beantworten konnte. »Der Teufel holt sich, was ihm zusteht.«
»Das sind ihre Worte?«
Die Nonne nickte. »Wir haben es von ihnen übernommen. Eine uralte Warnung.«
Jan trat näher heran und bemerkte die Kette um ihren Hals und das silberne Symbol daran. Eine fleur-de-lys. Eine stilisierte Lilie.
Er hatte Ritter, Könige und Herzöge gesehen, die sie trugen. Aber eine Nonne? Er zeigte auf sie. »Warum tragt Ihr das?«
Sie winkte mit dem ausgestreckten Arm. »Kommt, ich zeige es Euch.«
Gegenwart
Kapitel 1
Gent, Belgien
Dienstag, 08. Mai
20.40 Uhr
Nick Lee rannte auf den Rauch und die Flammen zu, und seine Besorgnis wuchs von Sekunde zu Sekunde. Er war nach Gent geflogen, um sich einer Erinnerung zu stellen, die ihn seit Langem verfolgte. Die Bilder von dieser Erinnerung waren so klar und lebendig, als wären sie von gestern, nicht von vor neun Jahren. Sie waren eine Woche verheiratet gewesen, aber ein gemeinsames Leben war ihnen nicht vergönnt. Stattdessen wählte sie einen anderen Weg, einen, der ihn nicht einschloss und niemals einschließen würde. Seine Worte waren ihm damals förmlich im Hals stecken geblieben. Ihre waren endgültig.
Ich habe keine andere Wahl.
Die Geschichte seines Lebens.
Eine unbeständige Mischung von Gut und Böse, Lust und Schmerz. Richtiger Ort, falsche Zeit? Auf jeden Fall. Falscher Ort, richtige Zeit?
Verdammt richtig.
Sogar öfter, als er zugeben wollte.
Bei der Army hatte er als MP angefangen und sich dann beim Justizministerium fürs Magellan Billet beworben, war dort aber nicht angenommen worden. Stattdessen stellte ihn das FBI ein, wo er fünf Jahre lang geblieben war. Jetzt arbeitete er für die Vereinten Nationen in der Organisation für Bildung, Wissenschaft und Kultur, besser bekannt als UNESCO. Diese Organisation, die von Anfang an Teil der UNO gewesen war, hatte den Auftrag, durch Bildung, Wissenschaft, Kultur und Kommunikation den Frieden zu fördern. Und wie? Vor allem durch Initiativen wie Weltkulturerbe-Stätten, eine globale digitale Bibliothek, internationale Bildungstage und tausend andere Programme, die die menschliche Kultur fördern, bewahren und erhalten sollten.
Er war bei einem kleinen Anhängsel dieses riesigen Ungetüms beschäftigt. Die kulturelle Verbindungs- und Untersuchungsbehörde. CLIO. Eine Anspielung auf die griechische Göttin Clio, die Muse der Geschichtsschreibung. Offiziell war er ein UN-Vertreter mit Dienstausweis, was ihm zweifellos Türen öffnete. In Wirklichkeit war er als Ermittler tätig. Geschulte Augen und Ohren. Ein Außenagent. Er wurde entsandt, um kunstgeschichtliche und kulturelle Probleme anzupacken, die nicht durch Telefonkonferenzen, Zeremonien oder Diplomatie gelöst werden konnten.
Manchmal muss man einfach ein bisschen Druck machen, hatte einer seiner Vorgesetzten gesagt. Er war dabei gewesen, als ISIS irakische Kirchen, Museen und Bibliotheken geplündert hatte. Vor Ort auf den Malediven, als Extremisten buddhistische Bauwerke gesprengt hatten. In Timbuktu, nach der Schlacht von Gao, als Teile dieser alten Stadt vom Krieg verwüstet waren. Seine Aufgabe bestand in erster Linie darin, jegliche Zerstörung von Kulturschätzen zu verhindern. Wenn das jedoch nicht möglich war, musste er sich um die Folgen kümmern. Er hatte gelernt, dass viele sogenannte kulturelle Säuberungsaktionen nur ein Vorwand für die hastige Beschlagnahme und den anschließenden Verkauf wertvoller Kunstwerke waren. Fanatiker waren keineswegs dumm. Für ihre Anliegen brauchten sie Geld. Seltene Artefakte konnten leicht in sprudelnde Geldquellen umgewandelt werden, die praktisch nicht zurückverfolgt werden konnten. Man brauchte sich keine Sorgen zu machen, dass Bankkonten beschlagnahmt oder von ausländischen Regierungen eingefroren werden könnten. Man brauchte nur Geschäfte mit diskreten Käufern zu machen, die bereit waren, Gold, Kryptowährung oder Bargeld als Gegenleistung für das scheinbar Unverkäufliche zu zahlen.
Zum Glück ging es bei dieser Reise nach Belgien nicht um etwas Bedrohliches, außer vielleicht um sein Herz. Er hatte sich darauf gefreut, Kelsey wiederzusehen. Sie war hier in Gent und tat das, was sie am besten konnte: Sie restaurierte Kunst. Es war die gemeinsame Liebe zur Kunst gewesen, die sie zusammengeführt hatte. Dann wurden sie von etwas zumindest aus seiner Sicht ganz und gar Unerwartetem auseinandergerissen. Er hatte es nicht kommen sehen. Hätte er es ahnen sollen?
Schwer zu sagen.
Neun Jahre waren vergangen, seit sie sich das letzte Mal von Angesicht zu Angesicht gesehen hatten. Bei ihrem Abschied hatte es keine tränenreichen Verabschiedungen, keine Umarmungen, keinen Händedruck, keine tröstenden oder ermutigenden Worte gegeben. Nicht einmal einen Streit oder Wut.
Einfach nur ein Ende.
Aber eines, das ihn fassungslos gemacht hatte.
Seitdem kommunizieren sie nur noch über die sozialen Medien. Und das auch nicht oft. Kommentare hier und da. Gerade genug, um in Kontakt zu bleiben. Sie hatte ihr Leben, und er hatte seins, und beides sollte sich niemals wieder vermischen. Er hatte sich oft gefragt, ob es eine gute Idee war, den Kontakt aufrechtzuerhalten, hatte aber nichts unternommen, um ihn einzuschränken. War er ein Masochist? Oder wollte er sie vielleicht einfach nur auf die eine oder andere Art in seinem Leben behalten?
Zwei Wochen zuvor hatte sie ihn in einer privaten Facebook-Message gebeten, nach Gent zu kommen. Eine Premiere. Die Einladung zu einem Besuch. Was ihn zum Nachdenken brachte. Eine gute Idee? Schlecht? Aber als sie ihm erzählt hatte, woran sie arbeitete, hatte er gedacht, was soll’s, warum nicht? Jetzt war er hier, und das Gebäude, zu dem sie ihm eine schriftliche Wegbeschreibung geschickt hatte, stand in Flammen.
War sie im Haus? Er lief schneller.
Jetzt befand er sich ein paar Blocks von der alten St.-Bavo-Kathedrale entfernt in einer dunklen Straße inmitten der Genter Altstadt. Alle Gebäude um ihn herum schienen eine Hommage an die flämische Architektur zu sein, eine Ansammlung von Backsteinhäusern mit Treppenaufgängen und Schornsteinen. Er war nicht weit von der berühmten Graslei entfernt. Ein beeindruckendes Ensemble von Zunfthäusern am Flussufer, die mehrere Jahrhunderte und Baustile überspannten. Einst Teil eines mittelalterlichen Hafens, einer der ältesten Abschnitte der Stadt aus dem fünften Jahrhundert, und ein wichtiger Umschlagplatz, als Gent noch das Zentrum des flämischen Weizenhandels gewesen war. Das Viertel war jetzt ein touristischer Hotspot mit einer hohen Dichte von Straßencafés. Er hatte gehofft, mit Kelsey in einem von ihnen zu Abend zu essen, nachdem er sich angesehen hatte, was sie ihm zeigen wollte.
Das brennende, rauchende Gebäude vor ihm ragte drei Stockwerke in die Höhe und hatte eine Treppengiebelfassade, aber das Feuer schien sich auf das Erdgeschoss zu beschränken. In der engen Straße hatte sich eine Menschenmenge angesammelt. Alle beobachteten das Geschehen, aber niemand rührte sich, um zu helfen. Er lief hin und fragte, ob die Feuerwehr benachrichtigt worden sei. Eine ältere Frau sagte auf Englisch, dass man sie angerufen hätte. Er hörte in der Ferne Sirenen und beschloss, nicht auf ihre Ankunft zu warten. Stattdessen stürmte er mit ein paar schnellen Schritten zur Haustür und schob die schwere Holzplatte nach innen.
Intensive Hitze! Rauch quoll hervor.
Er holte tief Luft und betrat ein großes Atelier, dessen Wände mit Metallregalen für Werkzeuge und Materialien zur Kunstproduktion ausgestattet waren. In der Mitte standen einige Tische. Alles passte zu der Werkstatt, in der Kelsey ihn treffen wollte.
Aber hier wütete kein Feuer.
»Kelsey!«, rief er.
Doch alles, was er hörte, war ein merkwürdiges Geräusch aus dem Nebenzimmer, und er eilte zur offenen Tür. Dort sah er Kelsey im Kampf mit einer anderen Person. Die Gestalt war schwarz gekleidet und trug enganliegende Kleidung; Kopf und Gesicht waren unter einer Kapuze verborgen. Durch den Rauch war kaum etwas zu erkennen, denn das einzige Licht kam von einem lodernden Feuer auf der anderen Seite des Raumes; die Flammen knisterten und züngelten wie trockenes Holz in einem Kamin.
Er wollte gerade eingreifen, als die schwarze Gestalt von Kelsey abließ und ihr einen Tritt in den Bauch versetzte, der sie zurücktaumeln ließ. Der Angreifer nutzte den Augenblick, um sich zu bücken, etwas vom Boden aufzuheben und dann im Rauch zu verschwinden. Nick blinzelte gegen das Brennen in seinen Augen und lief zu Kelsey.
Vorsichtig half er ihr vom Boden auf, und sie flüchteten aus dem Raum. »Bist du okay?«
Ihre Augen waren rot, feucht und panisch. Ihr Blick wechselte von Wut zu Angst, und schließlich erkannte sie ihn. »Nick.« Sie hustete den Rauch aus ihrer Lunge und nickte schnell. »Es geht mir gut. Wirklich. Mir geht’s gut.«
Bei ihm wurden Erinnerungen wach. Es war wieder wie vor neun Jahren, und die vertraute Verbindung rastete ein. Aber er zwang seine Gedanken in die Gegenwart zurück. »Wir müssen hier raus.«
Sie schüttelte den Kopf. »Ich muss das Feuer eindämmen.«
»Hilfe ist unterwegs. Die schaffen das. Lass uns gehen.« Sie rührte sich nicht von der Stelle. »Nick, lauf ihr nach.«
Ihr?
Zwei Polizisten stürmten in den Raum.
»Mir geht es gut«, sagte Kelsey. »Hol mir … meinen Laptop zurück.«
Einer der Uniformierten näherte sich, um zu helfen, und der andere hielt einen Feuerlöscher in den Händen, mit dem er die Flammen bekämpfte.
»Bitte«, sagte sie. »Geh.«
Einerseits wäre er lieber geblieben, um sich um Kelsey zu kümmern. Anderseits wusste er, was Kelsey wollte.
Und das waren weder Trost noch Schutz.
Also stürzte er sich in den Qualm.
Kapitel 2
Carcassonne, Frankreich
21.00 Uhr
Bernat de Foix ließ die Serviette auf den Teller fallen und richtete seine Aufmerksamkeit auf den jungen Mann, der ihm gegenübersaß. Sie hatten gerade ein dreitägiges Fasten gebrochen. Eine letzte Prüfung für etwas, auf das sie beide seit über einem Jahr hingearbeitet hatten. Es passte, dass es schließlich hier, in dieser alten Festungsstadt, stattfinden würde.
Seit der Jungsteinzeit lebten die Menschen auf diesem Hügel am Ufer des träge fließenden Flusses Aude. Es waren die Westgoten gewesen, die die große, ummauerte Stadt Carcassonne als eine befestigte Siedlung an den historischen Handelsrouten gründeten, die einst den Atlantik mit dem Mittelmeer verbanden. Doch der einstige Ruhm war dahin. Jetzt war alles nur noch ein fahler Abglanz der Geschichte. Die Hotels, Souvenirläden und Cafés wurden ganzjährig von Touristen besucht, die Geschichte erleben wollten. Das Hôtel de la Cité war das einzige Fünf-Sterne-Haus innerhalb der alten Mauern. Es war eine Mischung aus Neogotik und Art déco und lag in einer ruhigen Ecke neben der Basilika Saint-Nazaire. Heute Abend hatte er bewusst die beliebten Restaurants in der Stadt gemieden, in seiner Suite gegessen und André Labelle gebeten, ihm Gesellschaft zu leisten.
»Ich muss dem Hotelkoch sagen, wie gut mir das Essen geschmeckt hat«, sagte er zu dem jüngeren Mann.
Und er meinte das auch genau so, wie er es gesagt hatte.
Die gefüllte Zucchiniblüte in Tomatencreme war eine perfekte Vorspeise. Die Forelle aus der Region, gebacken mit Pilzen und Kalbsbries, ein idealer zweiter Gang, ergänzt durch etwas gebratenen Blumenkohl in Nussbutter. Das Dessert war besonders exquisit. Crème brûlée mit Haselnüssen, gekrönt von Schokoladensoße und einer Kugel Karamelleis.
Ein Festmahl, das diesem großen Anlass gerecht wurde. »Bist du bereit?«, fragte er.
André nickte. »Das bin ich schon lange.«
»Und willst du dich rückhaltlos darauf einlassen?«
»Das will ich.«
»Weißt du, was das bedeutet?«
»In jeder Hinsicht.«
»Deine vergangenen Sünden? Hast du für sie gebüßt? Bist du reumütig? Bist du bereit, von heute an ein vorbildliches Leben zu führen?«
»Das bin ich.«
Er war zufrieden. »Dann fahre fort.«
André erhob sich von seinem Stuhl und kniete pflichtschuldig auf dem Teppich nieder. »Du gerechter Gott aller guten Seelen, Du, der Du niemals täuschst, der Du niemals lügst oder zweifelst, gib mir zu wissen, was Du weißt, zu lieben, was Du liebst, denn ich bin nicht von dieser Welt, und diese Welt ist nicht von mir, und ich fürchte, dass ich in diesem Reich eines fremden, bösen Gottes den Tod finde.«
Die Erklärung war in perfektem Okzitanisch vorgetragen worden, der Sprache, in der das Gebet vor über achthundert Jahren zum ersten Mal aufgesagt worden war. Kostbare Worte, die einen krassen Gegensatz zwischen dem gerechten Gott aller guten Seelen und dem fremden, bösen Gott der materiellen Welt behaupteten.
»So Gott will«, sagte Bernat, »können gute Seelen wie du die Welt des Vaters erfahren. Ob wir die andere Welt in diesem Leben oder erst im nächsten kennenlernen können, wird sich erweisen.«
André hielt den Kopf gesenkt, die Augen waren ehrfürchtig und respektvoll auf den Boden gerichtet.
»Wünschst du das Consolamentum?«, fragte er.
»Von ganzem Herzen«, sagte André.
»Hast du dich gut vorbereitet?« Der junge Mann nickte.
»Ich bin bereit.«
»Für jede Aufgabe, die erforderlich sein könnte?«
»Jede.«
André hatte seine Reise vor drei Jahren als Credente, als einfacher Gläubiger, begonnen. Er hatte sich vielversprechend und gewillt gezeigt, und als er um eine weitere Ausbildung bat, um seinen Glauben durch strenge Prüfungen zu testen, waren die Ältesten zufrieden gewesen. Man hatte ihm erlaubt, am Seminar, der Maison des Hérétiques, teilzunehmen, wo seine Hingabe vertieft und auf die Probe gestellt worden war. Jetzt, nach langem Fasten, Wachen und Gebet, war er bereit für den letzten Schritt.
Nur ein Perfectus konnte das Consolamentum, die Handauflegung, vornehmen, was bedeutete, dass jeder neue Perfectus am Ende einer Kette stand, die sich bis zu den Aposteln und Christus selbst zurückführen ließ. Die Zeremonie markierte den Übergang vom Gläubigen zum Auserwählten. Kein Kleriker, kein Priester oder sonst jemand Besonderer, sondern einfache Gläubige, die sich entschieden hatten, Lehrer zu sein, um anderen Gläubigen dabei zu helfen, ebenfalls Teil der Perfecti zu werden. Jeder von ihnen lebte in der letzten Phase seines irdischen Daseins ein einsames Leben, in dem er sich in Verzicht übte und endlich die Zusicherung erhielt, nie wieder in die materielle Welt zurückzukehren. Vor langer Zeit war ihr Name als Schimpfwort geprägt worden, da die Heilige Römische Kirche sie als »perfekte Ketzer« betrachtete. Aber sie hatten die Bezeichnung trotzig als Ehrennamen übernommen, als ein Element der Vollkommenheit in ihrem spirituellen Leben.
»Sollen wir fortfahren?«, fragte er.
André nickte.
Beim Consolamentum zog der Heilige Geist in den Körper des Perfectus ein. Es symbolisierte den Tod der materiellen Welt und die Wiedergeburt im Geiste. Die Zeremonie war von ergreifender Schlichtheit. Im Gegensatz zu anderen religiösen Taufen waren weder Wasser noch Salböl erforderlich. Es gab keine hoch aufragenden Kirchen voller Heiligenbilder und -statuen und keine Priester in goldbestickten Gewändern. Nur der Glaube und die nötige Hingabe festigten den Bund, der meist im Wald, an einem See, in den Bergen oder vor dem Kamin im Haus der Erlösungswilligen besiegelt wurde. Bei jeder Abweichung vom rechtschaffenen Pfad verlor man seinen Status als Perfectus wieder, und der Weg zur Erlösung musste von Neuem beschritten werden. Das Consolamentum hatte makellos und ohne jeden Tadel zu sein – eine notwendige Maßnahme gegen korrupte Priester und Bischöfe, die es auch im dreizehnten Jahrhundert schon gegeben hatte und deren weltliches Trachten ungesühnt geblieben war. Die verfluchten Katholiken hatten den Ritus lange Zeit für eine entstellte Imitation ihres eigenen Taufrituals gehalten. Doch das war er nicht. Vielmehr ging das Consolamentum auf die frühchristliche Kirche zurück und wurde von Generation zu Generation ohne Einmischung von Priestern oder Päpsten weitergegeben.
»Gebe Gott, dass er einen guten Christen aus mir macht und mich zu einem guten Ende bringt«, wiederholte André dreimal.
Die Personen, die in den letzten drei Jahren mit André Labelle zusammengearbeitet hatten, hatten ihn umfassend über ihn informiert. Einunddreißig Jahre alt. Einige Festnahmen. Kleindiebstähle. Körperverletzung. Landfriedensbruch. Einst war er ein wilder, impulsiver Mann gewesen, der seine Fehler nie eingestand und ein liederliches, rücksichtsloses Leben führte, wie manche sagen mochten. Zum Glück war ein anderer Perfectus auf ihn aufmerksam geworden und hatte ihn auf den richtigen Weg gebracht. André war nicht weit entfernt im Süden geboren worden, im Roussillon, wo die Natur alles dominierte und Mythen eine große Rolle spielten. Ein außergewöhnlicher Ort mit einer reichen Vergangenheit voller Legenden und Geschichten, die von Mauren, Karl dem Großen und Roland handeln. André war ein typischer Vertreter jenes kernigen Menschenschlags, den jene Gegend hervorbrachte. Er war ein schlanker, muskulöser Bursche mit mattschwarzem, lockigem Haar und einer flachen Nase, die ihn wie einen harten Kerl aussehen ließ. Nur die dunklen Augen verrieten den Schmerz, der ihn immer noch verfolgte und sich über sein gequältes Gemüt legte. Aber jeder Bericht, den Bernat erhalten hatte, bescheinigte ihm einen vorbildlichen Lebenswandel und eine tiefe Hingabe an den Glauben. Der Weg zur Erlösung war lang und schmal und nur denen vorbehalten, die im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte waren und die Unterstützung der Ältesten genossen, die André sich verdient hatte.
Bernat erhob sich von seinem Stuhl. »Fahre mit dem Melhoramentum fort.« Ein okzitanisches Wort, das »Verbessern« bedeutet und mit der Erkenntnis beginnt, dass in dem Perfectus, der vor einem steht, der Heilige Geist wohnt. Ein Eingeweihter musste glauben, dass dies der Fall sei, denn sonst wäre bedeutungslos, was jetzt geschehen sollte.
André blieb auf dem Teppich knien, faltete die Hände und verbeugte sich dreimal.
»Segne mich, Herr. Bete für mich. Führe uns zu unserem gerechten Ende.«
Er gab die richtige Antwort. »In unseren Gebeten bitte ich Gott, aus dir einen guten Christen zu machen und dich zu deinem gerechten Ende zu führen.«
»Ich werde mich Gott und dem Evangelium widmen«, sagte André. »Ich werde kein Fleisch, keine Eier, keinen Käse und kein Fett mehr essen, außer Öl und Fisch. Ich werde keine Eide schwören und werde die Glaubensgemeinschaft niemals aus Angst vor Feuer, Wasser oder Tod verlassen.«
»Hast du etwas zu beichten?«
Die Reinigung der Seele war Teil der Zeremonie.
»Nur, dass mich manchmal noch mein Stolz und meine Arroganz übermannen können.«
»Wir könnten alle dasselbe sagen.«
»Aber ich muss diese Eigenschaften kontrollieren.«
»Dann tu das. Unbedingt. Bitte sage das Pater Noster auf.«
André murmelte das Vaterunser. Bernat nutzte den Moment, um zum Schreibtisch hinüberzugehen und seine Bibel zu holen. Er schlug das Johannesevangelium auf und hielt es über Andrés Kopf, wie es andere Perfecti seit Jahrhunderten getan hatten. »Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott.«
André begann zu zittern.
»Und das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst. Ein Mensch trat auf, von Gott gesandt; sein Name war Johannes. Er kam als Zeuge, um Zeugnis abzulegen für das Licht, damit alle durch ihn zum Glauben kommen. Er war nicht selbst das Licht, er sollte nur Zeugnis ablegen für das Licht. Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt. Er war in der Welt, und die Welt ist durch ihn geworden, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, allen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind.«
André hielt den Kopf tief gesenkt, er nahm den Heiligen Geist in sein Herz auf und bekräftigte damit seine Entscheidung, ein Perfectus zu werden.
Jetzt kam das Wichtigste.
»Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt, und wir haben seine Herrlichkeit geschaut, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. Johannes legt Zeugnis für ihn ab und ruft: Dieser war es, über den ich gesagt habe … Er, der nach mir kommt, ist mir voraus, weil er vor mir war. Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade über Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit kamen durch Jesus Christus.« Er hielt inne und ließ den Moment wirken. Schließlich fragte er: »Bist du im Frieden?«
André richtete sich, blieb aber auf den Knien.
»Absolut.«
»Erhebe dich.«
André stand auf, und Bernat trat dicht an ihn heran, legte ihm andächtig die Bibel auf den Kopf und küsste ihn einmal auf jede Wange.
Der Kuss des Friedens.
»Willkommen, mein Bruder. Du bist jetzt ganz und gar einer von uns.«
In den braunen Augen hatten sich Tränen gebildet. Dieser arrogante Kleinkriminelle gehörte nun zum einen, wahren Glauben. Allen neuen Perfecti wurde ein Sozius zugeteilt, ein Gefährte, der eine Zeitlang ihre Arbeit und ihre Mühen teilte. Er hatte ausdrücklich darum gebeten, es für André zu sein.
»Du wirst mir dienen«, sagte er. »Bis du dich selbst aufmachst, um allen Gläubigen zu dienen.«
André nickte.
Bernat legte die Bibel hin und ging zu den verglasten Türen, die auf eine große Terrasse führten. Er öffnete die Türflügel und bedeutete André, ihm nach draußen zu folgen. Kühle, frische Luft kitzelte seine Nasenflügel. Ein perfekter Frühlingsabend. In der Ferne konnte man den moderneren Teil von Carcassonne mit seinem Gewirr gepflasterter Straßen sehen. Die Dächer wurden nächtens angestrahlt. Er war geschichtskundig und wusste über alles Bescheid, was hier vor achthundert Jahren geschehen war. Jedes Detail. Das Gute und das Schlechte. Aus diesem Vermächtnis schöpfte er Kraft.
Die er in den kommenden Tagen brauchen würde.
»Es ist an der Zeit«, sagte er.
André nickte zustimmend.
Sie waren beide aus dem gleichen Grund hier in Carcassonne.
Er lächelte. »Es kann losgehen.«
Kapitel 3
Nick bahnte sich einen Weg durch Hitze und Rauch; es half, dass eine Tür offen stand und die Feuerwehrleute Fenster einschlugen, damit der Qualm abziehen konnte.
Einer der Polizisten folgte ihm.
Was ging hier vor sich? Schwer zu sagen. Aber was auch immer es war, es schien beabsichtigt gewesen zu sein. Er verscheuchte diese beunruhigenden Gedanken und stürzte hinaus in die belgische Nacht, um seine Lunge mit sauberer Luft zu füllen. In etwa fünfzig Metern Entfernung erblickte er die schwarze Gestalt, die die ruhige Straße hinunterrannte.
Mit einem Laptop unter dem Arm.
»Ich werde die Verfolgung aufnehmen«, sagte er dem Polizisten auf Englisch.
»Das ist eine Polizeiangelegenheit«, erwiderte der Mann ebenfalls auf Englisch. Gott sei Dank! Fremdsprachen waren eine Herausforderung für ihn.
Er holte seinen UN-Ausweis heraus und zeigte ihn vor. »Ich kann mich darum kümmern.«
Der Polizist musterte den Ausweis, nickte und zückte dann ein Funkgerät. »Ich werde Kollegen rufen, damit Sie Unterstützung bekommen.«
Gute Idee.
Nick rannte los.
Gent war ihm vertraut, denn er hatte die Stadt bereits zweimal besucht. Die Stadt liegt am Zusammenfluss von Schelde und Leie. Sie war einst die größte Stadt nach Paris und eine der reichsten Städte Nordeuropas gewesen. Eine Universitätsstadt war sie immer noch und eine Stadt der Kaufleute. Überall gab es Märkte, auf denen man von einem halben Pfund frischer Erdbeeren bis zu Dickens’ Gesammelten Werken alles finden konnte. Und das inmitten von gepflasterten Fußgängerzonen, einer tausend Jahre alten Festung, Kirchen, einer Kathedrale, mehreren mittelalterlichen Türmen und einer unablässigen Folge von großen Plätzen und hohen Zinnen. Jedes Jahr im Juli feierte die Stadt ein riesiges, neuntägiges Festival mit Musik, Kunst und Spaß, das er vor ein paar Jahren mal besucht hatte.
Er steigerte das Tempo und begann, den Abstand zu seinem Ziel zu verringern. Zum Glück war er in bester Verfassung. Sport war für ihn immer befreiend gewesen. Er liebte es, sich mit ein wenig Schmerz und viel Schweiß zu verausgaben.
Die schwarz gekleidete Gestalt bog um eine Ecke.
Er folgte und war nun von zwei Reihen mehrstöckiger, verchromter Fassaden umgeben. Keine Reklametafeln, kein Neon, keine Hochhäuser in Sicht. Nur der Charme der Alten Welt, eine unprätentiöse Schlichtheit, in der der Zahn der Zeit spürbar war. In den meisten Giebelhäusern befanden sich Hotels, Banken, Souvenirläden, Einzelhändler, Bars und Cafés, alles so gut genutzt, als wären es keine unbezahlbaren Relikte aus einer anderen Epoche. Es waren Wohnhäuser. Die Türen im Erdgeschoss waren dunkel, nur hier und da brannte Licht in den oberen Fenstern. Ein paar Autos parkten dort, denen er auswich, um mit der Frau vor ihm Schritt zu halten. Dass sie eine Frau war, wusste er nur durch Kelseys Worte.
Lauf ihr hinterher.
Einerseits wollte er alles tun, was sie von ihm verlangte. Manche Dinge änderten sich nie. Aber was war so wichtig an diesem Laptop? Er wusste es nicht und setzte diese Frage auf seine immer länger werdende Liste unbeantworteter Fragen.
In den letzten fünf Jahren hatte er die Welt bereist und versucht, die Geschichte zu bewahren und manchmal auch zu retten. Man könnte meinen, die Einheimischen würden ihr Erbe viel mehr zu schätzen wissen als er. Aber leider war das meistens nicht der Fall. Die größte Gefahr für den Erhalt des historischen Erbes ging von denen aus, die mit dem Ort oder der Sache am besten vertraut waren. Warum war das so? Erwuchs aus Vertrautheit Missachtung? Möglicherweise. Aber wahrscheinlich war es nur Gleichgültigkeit. Doch hier waren Brandstiftung, Sachbeschädigung und Diebstahl zusammengekommen. Ganz zu schweigen von dem Überfall auf Kelsey. Alles vorsätzlich. Er hoffte, dass das Feuer eingedämmt worden war, aber nach allem, was er gesehen hatte, schien wieder ein Kunstwerk verloren gegangen zu sein. Ein wertvolles Stück nach dem anderen verschwand. Es war sein Job, so etwas zu verhindern. Und er war gut darin, denn er war der einzige Außendienstmitarbeiter im Dienst der CLIO.
Ein Einzelgänger.
Das hatte ihm gefallen.
Sein persönliches Leben hatte sich in dieselbe Richtung entwickelt.
Nach Kelsey hatte es hier und da Beziehungen gegeben, aber keine hatte länger als ein paar Monate gehalten. Jede Frau war an ihr gemessen worden, und keine hatte den Ansprüchen genügt. Frustrierend für ihn, blieb Kelsey in seinem Gedächtnis fest eingebrannt. Ihr blasser, fast durchscheinender Teint. Hohe Wangenknochen, grüne Augen und zimtfarbenes Haar, das sie früher lang und glatt getragen hatte: in jeder Hinsicht eine schöne Frau. Er wusste, dass es … dumm war. Es war an der Zeit weiterzuziehen … der ganze Quatsch. Aber das war ihm schwergefallen. Also hatte er nichts getan. Hatte nur hart gearbeitet. War um die Welt gereist.
Und hatte gehofft, dass das Nächstbeste kommen würde.
Die Flüchtige nahm die nächste Biegung, und er eilte weiter. Der Abstand verringerte sich. Sie passierten eine Piazza mit feiernden Gästen. Die Frau hielt sich am Rand und verschwand in einer Seitenstraße. Er durfte sie nicht verlieren. Mit einigen Höflichkeitsfloskeln bahnte er sich den Weg und folgte ihr. Sie bogen wieder um eine Ecke und befanden sich nun am Flussufer, parallel zu einer hüfthohen Steinmauer. Er hatte den Eindruck, dass sie nicht einfach davonlief. Sie war auf dem Weg zu einem bestimmten Ort. Zum Glück waren nur wenige Menschen in der Nähe, die ihm in die Quere kommen oder gefährdet werden konnten. War ihr bewusst, dass er ihr folgte? Schwer zu sagen.
Plötzlich heulten Sirenen.
Drei Autos mit blinkenden Blaulichtern tauchten aus einer der Seitenstraßen auf. Sie bogen ab und fuhren auf einen kleinen gepflasterten Platz zu, der sich vor der Kaimauer erstreckte, und ihre Scheinwerfer warfen große Lichtkegel in die Dunkelheit. Es war, als spürten sie die schwarz gekleidete Gestalt, die nun eingekesselt war und nirgendwohin konnte.
Die Ortspolizei war schnell.
Er wartete in etwa hundert Metern Entfernung, blieb sprungbereit, um nach Bedarf loszusprinten oder sich hindurchzuwinden. Er keuchte, und sein Atem trocknete seinen Mund aus.
Die Frau drückte sich an die Steinmauer und sah sich um, als wollte sie die Situation einschätzen. Die Scheinwerfer schwenkten in ihre Richtung, und als sie sie voll erfasst hatten, warf sie den Laptop über die Mauer. In den Fluss?
Die Autos bremsten mit quietschenden Reifen. Die Türen öffneten sich.
Bewaffnete Männer stiegen aus und schrien auf Flämisch. Die Frau wirbelte herum und stellte sich, eine Hand hinter dem Rücken, den Polizisten.
Mehr Geschrei.
Der Arm kam wieder hinter ihrem Rücken hervor.
Ein Schuss krachte.
Von der Polizei.
Noch mehr Schüsse.
Sie trafen die Frau in die Brust und ließen ihren schlanken Körper wie den einer Tänzerin herumwirbeln. Ihm wurde schlecht von dem Anblick. Sicher, er hatte schon einiges an Gewalt gesehen, aber war das nötig gewesen?
Keine der beiden Hände hielt eine Waffe.
Sie zuckte wie eine tanzende Marionette und stürzte dann ungeschützt mit dem Gesicht voran neben einem Steinbrunnen hart auf das Pflaster.
Nick bewegte sich keinen Millimeter.
Glücklicherweise war er nicht nah genug, um Aufmerksamkeit zu erregen, und die Polizei konzentrierte sich auf die Leiche und rückte mit gezogenen Waffen vor. Er warf einen Blick über die Mauer. Auf dem Wasser lagen lange Schatten. Er nahm in der Dunkelheit eine verschwommene Bewegung wahr und sah die Umrisse eines Bootes, das von einem betonierten Steg am Rande des Flusses wegtrieb.
Hier würde er nichts mehr erfahren.
Also sprang er über die Mauer, hielt sich am Rand fest und ließ sich dann auf den Beton fallen.
Kapitel 4
Bernat verließ Carcassonne zusammen mit André und fuhr eine knappe Stunde in Richtung Osten nach Béziers. Die Stadt lag auf einer Klippe oberhalb des Flusses Orb, nur zehn Kilometer westlich der Mittelmeerküste. Sie war eine der ältesten Siedlungen Frankreichs. Steinzeitmenschen, Kelten, Gallier, Römer und Westgoten hatten alle irgendwann einmal hier gelebt. Stierkämpfe hatten die Stadt berühmt gemacht. Jeden August kamen eine Million Menschen in die Stadt, um dem Spektakel beizuwohnen. Doch am 29. Juli 1209, dem Festtag der heiligen Maria Magdalena, war hier etwas geschehen, das die Welt für immer veränderte.
Das Heer lagerte vor der Stadt, eine riesige Ausdehnung von Zelten und Biwaks, Unmengen von Männern, Pferden und Karren umlagerten die Festungsmauern. Das Heer war einen Tag zuvor aus Lyon vorgerückt, um 222 Ketzer, etwa zehn Prozent der Bevölkerung Béziers, gefangen zu nehmen, von denen man wusste, dass sie sich in der Stadt aufhielten. Die Krieger waren von Papst Innozenz III. zu den Waffen gerufen worden. Das Abendland war an päpstliche Kreuzzüge gewöhnt, die bereits seit 1095 durchgeführt wurden. Doch aller Hass war gegen Mauren gerichtet gewesen, und das Blutvergießen hatte weit entfernt im Heiligen Land stattgefunden. Dies hier sollte der erste Kreuzzug gegen Mitchristen sein, der sich mittenim Herzen Europas zutrug. Genauer gesagt im Languedoc, einer stolzen und unabhängigen Gebirgsregion, die sich von den Pyrenäen im Süden bis zur Provence im Norden erstreckte. Ein Land der Oliven, der Trauben, des Windes und des Meeres. Troubadoure und Kaufleute. Kulturell und sprachlich mit Aragon und Barcelona verbunden. Eine Hochburg unabhängiger Denker und Handel treibender Bürger, wo Christen, Juden und Mauren in Harmonie zusammenlebten und arbeiteten.
Hier blühte auch eine neue Religion auf. Eine pazifistische Ausprägung des Christentums, die lehrte, dass das Heil in der Loslösung von materiellen Gütern zu finden sei. Eine christliche Lehre, deren Ursprünge völlig unbekannt waren, die sich aber als wahrer Glaube bezeichnete, der älter als der Katholizismus sei und dessen Grundpfeiler Toleranz und Armut waren.
Die Lehre war aus dem Osten eingewandert, nachdem sie in Italien und im Rheinland Fuß gefasst hatte. Ihre Kernthese besagte, dass die Welt von einer dunklen, bösen Macht geschaffen worden sei – dem Rex Mundi, König der Welt. Diese Welt umfasste alles, was materiell, chaotisch und mächtig war. Alles Materielle war korrupt. Alles, was auf der Welt existierte, war verdorben. Weltliche Autorität war ein Betrug. Und wenn sich die Autorität auf irgendeine göttliche Fügung berief? So wie die Heilige Römische Kirche?
Das war noch schlimmer.
Die Anhänger glaubten, die Seele sei im Körper gefangen, eine unvollkommene Schöpfung im Reich des Bösen; das Ziel des Lebens bestehe darin, dieser Hölle auf Erden zu entkommen und den Gott des Lichts zu suchen, der das ewige Reich des Geistes beherrschte, das nicht von der Verderbnis der Materie befleckt war. Gläubige mussten der materiellen Welt entsagen. Wer es nicht tat, kehrte nach dem Tod immer wieder zurück, nahm einen neuen Körper an und durchlebte neue Leben, bis er schließlich bereit war, alles Physische zurückzuweisen. Sobald dies geschehen war, wurde er von einem bloßen Gläubigen zu einem Perfectus erhoben, der bei seinem nächsten Tod in ein glückseliges, ewiges Dasein aufsteigen konnte, das vom Gott desLichts regiert wurde.
Die Kosmologie war von Dualität bestimmt. Das Böse war sichtbar. Das Gute unsichtbar.
Es galtdie absolute Trennung von Geist und Materie.
Die Anhänger brauchten keine Sakramente, Kirchen, Bischöfe, Päpste, Zehnten oder Steuern. All das war Teil der materiellen Welt und zählte nicht. Frauen waren den Männern in jeder Hinsicht gleichgestellt. Keine Eide, keine heiligen Reliquien, keine Verehrung des Kreuzes, das nichts anderes als ein Folterinstrument war. Keine Gewalt und kein Militärdienst. Kein Verzehr von Speisen, die aus einem Zeugungsakt stammten. Die Heirat war sinnlos. Kinder in die Welt zu setzen war grausam, weil es eine weitere himmlische Seele ins Böse brachte. Christus war einst gekommen, aber nur als Erscheinung, um die Wahrheit über die Dualität von Gut und Böse zu verbreiten und die Kette der Gläubigen in Gang zu setzen, die sich seit Jahrhunderten ununterbrochen fortsetzte. Das Konzept war anziehend, verlockend und populär. In Italien nannten sie sich Cazzara, nach dem griechischen katharos. In Deutschland waren sie die Ketzer. In Frankreich bezeichnete man sie als Cathari. Lateinisch für »rein«. Daraus entwickelte sich der Name, der sich schließlich durchsetzte.
Katharer.
Die Heilige Römische Kirche versuchte 1179 erfolglos, sie zu verbieten. Sie behauptete, dass die Katharer einen unnatürlichen Vegetarismus praktizierten und die Ausrottung der Menschheit befürworteten und dass die Perfecti eindeutig homosexuell waren, da sie immer zu zweit reisten. Der Versuch, ihnen mit Priestern und Mönchen beizukommen, die die Abtrünnigen zu bekehren versuchten, scheiterte im Jahr 1203. Im Juli 1209 hatte sich die katharische Religion im Languedoc fest etabliert. Nicht nur bei den Bauern, sondern auch beim Adel, dem Bürgertum und vor allem den wohlhabenden Bürgern. Die örtlichen Katholiken, die von Rom und all seinen Regeln und Dogmen nicht begeistert waren, unterstützten Freunde und Nachbarn bei ihrer religiösen Entscheidung. Es half, dass die meisten katholischen Geistlichen korrupt waren und die Katharer tugendhaft lebten. Für die Menschen im Languedoc galt jeder als Feind, der die Autorität und Autonomie der mächtigen Vicomtes von Toulouse, Foix und Carcassonne infrage stellte. Und das tat die Heilige Römische Kirche routinemäßig. Der Katharismus verströmte eine Schlichtheit, die viele anziehend fanden. Liebe deinen Nächsten und den Frieden, den Güte und Ehrlichkeit bringen. Die Häuser der Katharer waren offen und gastfreundlich. Rom versuchte, sie als Abtrünnige zu geißeln, aber in Wahrheit verkörperten die Katharer weitaus mehr als eine abweichende Philosophie. Sie waren eine ernst zu nehmende, unverhohlene Konkurrenz.
Deren Einfluss wuchs.
Sie mussten ausgelöscht werden.
Das erklärt, warum ein Heer von zwanzigtausend Mann vor den Mauern von Béziers in Stellung gegangen war.
Sie waren von überall hergekommen: der Kirchenstaat in Italien, der Ritterorden der Miliz Jesu Christi, die Hospitaliter des Heiligen Geistes, die Ritter des heiligen Georg, die Herzogtümer von Burgund und der Bretagne, die Grafschaften von Nevers, Auxerre, Aurenja und Saint-Pol. Englische Freiwillige. Die Herzogtümer Österreich und Berg. Das Kurfürstentum Köln.
Sie sollten gegen die Grafschaften Toulouse, Valentinois, Astarac, Comminges und Foix antreten. Gegen die Vogteien von Béziers, Carcassonne und Albi. Die Herrschaften von Séverac, Menèrba, Tèrmes, Cabaret und Montségur. Die Markgrafschaft der Provence. Das Herrscherhaus von Aragonien. Und ein Heer von verbannten Rittern.
Kein einziger Katharer nahm daran teil, denn Gewalt war ihnen zuwider. Um einen blutigen Kampf zu vermeiden, wurde ein Ultimatum gestellt. Wenn die 222 Ketzer ausgeliefert würden, bliebe Béziers verschont. Das Angebot wurde geprüft und abgelehnt, denn einer der Bürger sagte, dass sie lieber in der Salzlake des Meeres ertrinken würden, als ihre Freunde zu verraten. Die Botschaft war deutlich. Die ortsansässigen Katholiken wollten nicht kooperieren.
So musste ein anderer Weg gefunden werden.
Die damalige Kriegsführung glich eher einer Belagerung als einer offenen Feldschlacht. Aber die Kreuzfahrer konnten sich keinen langen Aufenthalt erlauben, der die Ressourcen erschöpfen und dem Feind Zeit geben würde, sich zu organisieren. Viele weitere Schlachten würden erforderlich sein, und ihre Ritter waren nur für vierzig Tage zum Dienst verpflichtet. Die Adligen, die sie befehligten, misstrauten einander, und die angeheuerten Söldner waren völlig unberechenbar.
Doch nur eine Belagerung schien Erfolg zu versprechen.
Bis das Schicksal eingriff.
Eine kleine Gruppe von Männern aus Béziers wagte sich vor die Stadtmauern, um mit diesem Bravourstück den Feind zu verhöhnen. Sie beschimpften und töteten einen der Kreuzfahrer und warfen die Leiche in den Fluss Orb. Die Söldner – gottlos, gesetzlos und furchtlos, Männer, die nie eine Spur von Gnade zeigten – fühlten sich provoziert. Sie griffen an, barfuß, nur mit Hemd und Hose bekleidet und mit Handwaffen versehen. Es kam zu einem Scharmützel. Die Söldner rückten vor und schafften es, die Stadttore zu stürmen, die geöffnet worden waren, um den Bürgern den Rückzug zu ermöglichen.
Ein fataler Fehler.
Innerhalb weniger Minuten drangen Gruppen von Kreuzrittern in die Stadt ein.
Man befragte den Dominikanermönch Arnold Amaury, der als päpstlicher Legat den Oberbefehl innehatte, wie man sich vergewissern könne, ob jemand katholisch oder katharisch sei und ob er verschont oder hingerichtet werden solle. Amaury dachte über die Frage nach und erklärte dann, dass der Herr wisse, wer ihm gehöre. Tötet sie alle. Er wird die Seinen erkennen.
Und genauso ist es geschehen.
Panik und Raserei breiteten sich aus. Privathäuser wurden aufgebrochen, Kehlen durchgeschnitten, Frauen vergewaltigt, Beute gemacht. Viele der Bewohner suchten Zuflucht in den Kirchen. Aber die Türen wurden gewaltsam aufgebrochen und alle Anwesenden abgeschlachtet. Männer, Frauen, Kinder, Säuglinge, Invaliden, Priester. Das spielte keine Rolle. Alle wurden mit dem Schwert erschlagen, und die Stadt wurde niedergebrannt.
Zehntausende starben.
Innerhalb weniger Stunden war die große Stadt Béziers mit Leichen übersät und in Blut getränkt, und die Straßen waren voller Räuber, die sich um die Beute stritten.
Der Albigenserkreuzzug hatte begonnen.
Durch die Windschutzscheibe konnte Bernat die Lichter von Béziers sehen.
Wahrhaftig ein Symbol des Widerstands.
Die Stadt hatte die Jahrhunderte überdauert und war heute ein Zentrum der französischen Weinproduktion. Sie lag immer noch auf einem Hügel – mit ihrer Kathedrale, den großen Plätzen, der weitläufigen Esplanade und den malerischen Straßen. Bernat begeisterte sich für die Rugbymannschaft, die zwölf Meisterschaften für sich verbuchen konnte. In der Stadt lebten rund achtundsiebzigtausend Menschen. Momentan interessierte er sich aber nur für einen von ihnen.
Während Andrés Probezeit hatte man in Erfahrung gebracht, dass der jüngere Mann wie viele andere Katharer katholisch geboren und aufgewachsen war und eine kleine Gemeindeschule in Südfrankreich besucht hatte. Als Junge war er bei den katholischen Pfadfindern aktiv gewesen, wo er zum ersten Mal Pater Louis Tallard begegnet war, dem es über einen Zeitraum von zwanzig Jahren gelungen war, fast dreißig Pfadfinder sexuell zu missbrauchen, darunter auch André Labelle. Man erstattete Anzeige, und Tallard war längst aus seiner Pfarrstelle entlassen worden, er hatte aber in den aktiven Dienst zurückkehren dürfen – auf einen Posten in der Verwaltung –, nachdem er seine Sünden gebeichtet und Buße getan hatte, wie es hieß. Unglaublich war, dass zunächst keine strafrechtliche Verfolgung eingeleitet wurde. All dies verdeutlichte die Heuchelei und Überheblichkeit der modernen Heiligen Römischen Kirche. Keine andere Institution hatte in einem solchen Ausmaß Sexualstraftäter systematisch geschützt. Vor drei Jahren war Tallard nach großer Aufregung schließlich formell wegen mehrfachen sexuellen Missbrauchs und der Vergewaltigung von Minderjährigen angeklagt worden. Diese Fälle waren noch nicht abgeschlossen und zogen sich ohne Schuldspruch durch die Gerichte, während Tallard weiterhin den weißen Kragen eines Priesters trug.
Bernat umging das Zentrum von Béziers und fuhr einige Kilometer nördlich der Stadt auf einer Umgehungsstraße weiter in den dichter werdenden Wald hinein. Schließlich bog er von der Fernstraße auf einen Feldweg ab, der zerfurcht und staubig war und von zugewucherten Gräben und eingefallenen Holzzäunen gesäumt wurde. Das Bauernhaus, das er suchte, lag ganz hinten zwischen den Bäumen. Tallard war dort nach der Anklageerhebung untergetaucht, weil er darauf hoffte, allmählich vergessen zu werden.
In der Nähe des kleinen, schäbigen Hauses parkte Bernat. Ein anderes Fahrzeug war erwartungsgemäß bereits da. Er und André traten in die Nacht hinaus. Durch die schnell dahinziehenden Wolken am Himmel lugte der Mond. Bernat ging voran, als sie über kurzes Gras zur Haustür marschierten. Ein Mann wartete auf sie. Klein, stämmig, hellhäutig, bärtig.
»Ist er bereit?«, fragte Bernat ihn.
»Wie eine Weihnachtsgans.«
Er nickte bekräftigend und öffnete die Tür. Drinnen erwartete sie ein Sammelsurium von Einrichtungsgegenständen. Alles wirkte sehr unordentlich – ein Eindruck, der durch umgestürzte Möbelstücke und zwei zerbrochene Lampen noch verstärkt wurde. Es waren die Spuren eines Kampfes. Louis Tallard lag ausgestreckt rücklings auf einem Eichentisch, Hände und Arme an jedes der vier Tischbeine gefesselt, den Kopf über die Seite geneigt. Tallard war neunundfünfzig Jahre alt, klein, schlank, drahtig, mit kantigen Gesichtszügen und Vollbart. Ein Klebeband verhinderte, dass er sprechen oder durch den Mund atmen konnte. Die blauen Augen des Priesters hatten einen panischen Ausdruck. Das war auch angebracht. Er hatte allen Grund, Angst zu haben.
»Warten Sie draußen«, sagte er zu dem Mann, der die Tür hinter sich schloss und ging.
Das war der Vorteil bei bezahlten Helfern. Sie taten genau das, was ihnen gesagt wurde.
Er stand vor Louis Tallard, der den Kopf nach oben streckte. Der Mann trug ein schmutziges Sweatshirt und verblichene Jeans. Wenigstens kein Priestergewand oder einen weißen Kragen.
»Ich bin Bernat de Foix. Geboren und aufgewachsen bin ich im Comté de Foix, wie Sie auf Französisch sagen würden, oder im Comtat de Fois, wie ich es auf Okzitanisch ausspreche. Die Vorfahren meiner Mutter lebten dort vom elften bis zum fünfzehnten Jahrhundert. Der Grafentitel wurde erstmals 1064 von Roger de Foix angenommen, der die Stadt Foix und die angrenzenden Ländereien erbte und sie über Generationen hinweg an seine Nachkommen weitergab. Die Stadt und das Schloss stehen noch heute, aber die Ländereien gehören nicht mehr der Familie de Foix. Sie gingen vor langer Zeit verloren. Kennen Sie sie?«
Tallard schüttelte den Kopf schnell hin und her, was ein Nein bedeutete. »Das macht nichts. Ich hielt es nur für angemessen, dass Ihr Euren Inquisitor kennt. Das war eine Höflichkeit, die Ihre Priesterkollegen einst anderen erwiesen haben.« Er deutete mit dem Finger. »Erkennen Sie diesen jungen Mann?«
Ein weiteres heftiges Kopfschütteln für Nein.
»Das ist André Labelle. Vor siebzehn Jahren haben Sie ihn sexuell missbraucht.«
Noch mehr Kopfschütteln.
»Sie streiten die Anschuldigung ab?«, fragte er ungläubig. Tallard nickte bejahend.
»Das ist Ihr Recht. Also müssen wir jetzt die Wahrheit herausfinden.«
Der Albigenserkreuzzug hatte zwanzig Jahre gedauert. Obwohl er als Religionskrieg zur Ausrottung von Ketzern dargestellt wurde, war er nichts weiter als eine Landnahme und Machtergreifung unter dem Deckmantel der Religion.
Und ein Gemetzel.
Scheiterhaufen, Blendungen, Galgen, die Folter, sogar exhumierte und geschändete Leichen: Sie machten vor keiner Grausamkeit halt. Hunderttausende waren davon betroffen. Schließlich wurde das Languedoc politisch neu geordnet und in das Herrschaftsgebiet der französischen Krone eingegliedert, wodurch jeglicher Einfluss Spaniens zurückgedrängt wurde. Von 1209 bis 1215 waren die Kreuzzügler sehr erfolgreich gewesen, sie eroberten das Land der Katharer und verübten unsägliche Gewalttaten gegen die Zivilbevölkerung. Zwischen 1215 und 1225 konnten viele dieser Gebiete durch eine Reihe von Aufständen vom lokalen Adel zurückerobert werden. Ein neuer Kreuzzug führte zur Rückeroberung des Gebiets und trieb den Katharismus bis 1244 in den Untergrund. Nach dem Abzug der päpstlichen Heere folgte etwas anderes, ebenso Schlimmes: die Inquisition. Sie wurde ausgesandt, um alle Reste des katharischen Glaubens zu beseitigen, die der Kreuzzug übrig gelassen hatte. Die meisten Inquisitoren waren Dominikaner, wie Arnaud Amaury, der die Kreuzfahrer angeführt hatte. Im Jahr 1233 beauftragte Papst Gregor IX. die Inquisition mit der vollständigen Ausrottung der Katharer. Bald schlossen sich die Franziskaner den Bemühungen an, aber es waren die Dominikaner, die als Vermächtnis eine Verbitterung hinterließen, die bis in die Gegenwart andauerte.
»Wenn Ihre Priesterkollegen als Inquisitoren in die Stadt kamen«, sagte er zu Tallard, »kündigten sie ihre Ankunft Tage im Voraus an, und jeder wurde aufgefordert, seine Sünden zu beichten. Wenn man vergleichsweise kleine Verfehlungen gestand und bereit war, der Kirche die Treue zu schwören, und nützliche Informationen über andere zur Verfügung stellte, erhielt man eine kleine Buße, und die Sache war erledigt. Wenn man jedoch nicht beichtete oder nützliche Informationen über seine Familie oder Freunde lieferte, wurde es als fehlende Hingabe an die einzig wahre Kirche gewertet. Und entsprechend geahndet. Die meisten wurden auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Schrecklich, finden Sie nicht auch?«
Er wartete nicht auf ein Kopfschütteln als Antwort.
»Sie waren hinter den Perfecti her«, sagte er. »Die wenigen verbliebenen, treuen Katharer. Männer und Frauen, die unter keinen Umständen bereit waren, einen Eid zu schwören, geschweige denn der katholischen Kirche die Treue zu halten. Deshalb wurden jene, die sich weigerten, Informationen über die Perfecti zu liefern, hart angefasst.«
Er machte eine Bewegung, und André riss das Klebeband von Tallards Mund ab. Der Mann bewegte seinen Kiefer, schluckte ein paar Mal und holte wiederholt tief Luft. Dann schrie der Priester: »Was wollen Sie?«
»Gerechtigkeit«, erwiderte er.
»Für was?«
Er warf ihm einen durchdringenden Blick zu. »Für das Böse, das Sie getan haben.«
»Werden Sie mich töten?«
»Wir töten nicht.«
Der Priester schaute verwirrt drein. »Sind Sie Katharer?«
»Das sind wir«, antwortete er stolz.
»Diese Religion ist schon vor Jahrhunderten ausgemerzt worden.«
»Zu Ihrem Pech ist dieser Versuch, uns zu vernichten, gescheitert.«
Erleichterung blitzte in den Augen des gefesselten Mannes auf. »Die Katharer verabscheuten Gewalt. In jeder Form.«
»Das stimmt«, sagte Bernat. »Aber das bedeutet nicht, dass wir barmherzig sind.«
Kapitel 5
Nick landete weich, die Gummisohlen seiner Schuhe dämpften den Aufprall. Niemand hatte ihn über die Steinmauer rollen sehen, während über ihm blaue und rote Lichtblitze den Nachthimmel erhellten. Zum Glück war der Auflauf weiter unten am Kai, und die Dunkelheit bot ausreichend Schutz. Aber schon in wenigen Augenblicken konnte der ganze Fluss ausgeleuchtet sein. Das Boot mit dem Laptop trieb mit der Strömung davon. Er musste ihm folgen, also schlich er zu einem kleinen Holzboot, das an dem Betonsteg am Ufer angebunden war, löste die Leinen, mit denen es festgemacht war, und stieß sich ab – froh, dass zwei Paddel im Boot lagen.