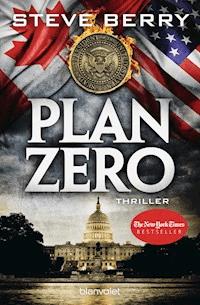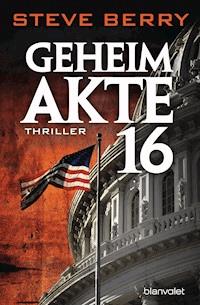9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Cotton Malone
- Sprache: Deutsch
Eine Legende wird Wirklichkeit, und ein uraltes Geheimnis beschwört einen Bürgerkrieg herauf!
Cotton Malone muss einen amerikanischen Agenten ausfindig machen, der bei dem Auftrag, einen Geschäftsmann zu observieren, spurlos verschwand. Er bekommt dabei unerbetene Hilfe von dem jungen, draufgängerischen Geheimdienstler Luke. Gleichzeitig werden in Utah Überreste der frühesten Mormonensiedlungen entdeckt, die bisher als bloße Legende galten. Der Fund bringt ganz Washington zum Brodeln, denn er scheint der Beweis zu sein für ein geheimes Abkommen, das auf Präsident Abraham Lincoln zurückgeht und das die Macht hat, die USA erneut in einen verheerenden Bürgerkrieg zu stürzen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 613
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Buch
Cotton Malone befindet sich auf einer Mission mit höchster Geheimhaltung: Er soll einen in Dänemark verschollenen US-Agenten finden. Dieser sollte im Auftrag des Weißen Hauses ein Dossier über den Geschäftsmann Salazar anfertigen, der unter der Beobachtung der amerikanischen Regierung steht, weil er fanatischer Anhänger der Mormonenkirche ist und deren Lehren auch in politischer Hinsicht vertritt. Doch Salazars Männer heften sich schon bald an Malones Fersen.
In Utah bahnt sich währenddessen eine Sensation an: In einem Nationalpark werden Überreste einer Mormonensiedlung aus dem späten 18. Jahrhundert entdeckt, die bis dahin als reine Legende galt. Gleichzeitig wird eine Geheimakte aufgefunden, die besagt, dass Präsident Lincoln im Sezessionskrieg einen geheimen Pakt mit den Mormonen einging – sollte dieser publik werden, wird er die USA erneut an den Rand eines Bürgerkrieges bringen …
Autor
Steve Berry war viele Jahre als erfolgreicher Anwalt tätig, bevor er seine Leidenschaft für das Schreiben entdeckte. Mit jedem seiner hochspannenden Thriller stürmt er in den USA die Spitzenplätze der Bestsellerlisten und begeistert Leser in über 50 Ländern. Steve Berry lebt mit seiner Frau in St. Augustine, Florida.
Von Steve Berry bereits erschienen
Antarctica · Der Korse · Das verbotene Reich · Die Washington-Akte · Die Kolumbus-Verschwörung · Das Königskomplott
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag
Steve Berry
DER
LINCOLN-
P A K T
Thriller
Aus dem Amerikanischen
von Barbara Ostrop
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
1. Auflage
Copyright der Originalausgabe © 2014 by Steve Berry
Published by Arrangement with MAGELLAN BILLET INC.
Dieses Werk wurde vermittelt durch die
Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen.
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2016 by Blanvalet
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Werner Bauer
Umschlaggestaltung: © Johannes Frick, Neusäß
Umschlagmotiv: © Shutterstock.com
BS · Herstellung: kw
Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach
ISBN 978-3-641-17004-2V001
www.blanvalet.de
Für Augustus Eli Reinhardt IV. –
einen ganz besonderen jungen Mann
Jedes Volk der Welt hat, wenn es dazu geneigt ist und die nötige Macht besitzt, das Recht, sich zu erheben, die existierende Regierung abzuschütteln und eine neue, ihm genehmere zu bilden. Dies ist ein äußerst wertvolles und heiliges Recht – ein Recht, das, wie wir hoffen und glauben, die Welt befreien wird. Dieses Recht ist auch nicht nur auf Fälle beschränkt, in denen das ganze Staatsvolk einer existierenden Regierung sich zu seiner Ausübung entschließt. Jeder Teil eines solchen Volkes, der dazu imstande ist, darf sich erheben und sich den Teil des Territoriums, den es selbst bewohnt, zu eigen machen.
Abraham Lincoln,
12. Januar 1848
Prolog
Washington, D.C.
10. September 1861
Abraham Lincoln zügelte seinen Zorn, obwohl die Frau, die ihm gegenüberstand, seine Geduld enorm strapazierte.
»Der General hat nur getan, was alle gerecht denkenden Menschen für richtig halten«, sagte sie.
Jesse Benton Fremont war die Frau des Armeegenerals John Fremont, der die Verantwortung für alle militärischen Angelegenheiten der Union westlich des Mississippi trug. Dieser Held des Mexikanisch-Amerikanischen Krieges und berühmte Entdecker hatte die Berufung in seine jetzige Position im Mai erhalten. Vor einem Monat hatte er angesichts des im Süden tobenden Bürgerkriegs eine einseitige Erklärung abgegeben, durch die den Sklaven bewaffneter Aufständischer die Freiheit verliehen worden war. Das war schon schlimm genug, aber Fremonts Erlass ging sogar noch weiter und verfügte, dass alle Kriegsgefangenen erschossen werden sollten.
»Madam«, sagte Lincoln mit leiser Stimme. »Ist Ihr Mann wirklich der Ansicht, dass alle gefangenen Rebellen zu töten sind?«
»Diese Männer müssen wissen, dass sie ihr Vaterland verraten haben, und Verräter werden seit jeher hingerichtet.«
»Ist Ihnen klar, dass die Konföderierten dann ihre eigenen Gefangenen, unsere Soldaten, zur Vergeltung ebenfalls erschießen werden? Mann für Mann. Und immer so weiter.«
»Sir, wir haben diesen Aufstand nicht begonnen.«
Die Uhr auf dem Kaminsims zeigte schon fast Mitternacht. Vor drei Stunden war eine knappe Botschaft ins Weiße Haus gekommen. Mrs. Fremont sei mit einem Brief des Generals Fremont und weiteren mündlichen Erläuterungen eingetroffen, die sie gerne schnellstmöglich dem Präsidenten überbringen würde. Würde der Präsident ihr wenn möglich noch einen Termin am selben Abend oder aber früh am nächsten Morgen einräumen?
In seiner Antwort hatte er sie gebeten, sofort zu kommen.
Sie standen sich im Roten Salon im Erdgeschoss des Weißen Hauses im hellen Licht eines Kronleuchters gegenüber. Er hatte von dieser eindrucksvollen Frau gehört. Die Tochter eines ehemaligen US-Senators war sehr gebildet, in Washington, D.C. aufgewachsen und politisch geschult. Gegen den Willen ihrer Eltern hatte sie mit siebzehn Jahren Fremont geheiratet und im Laufe der Jahre fünf Kinder zur Welt gebracht. Sie hatte ihren Mann bei seinen Expeditionen in den Westen unterstützt und stand ihm zur Seite, als er als Militärgouverneur Kaliforniens und als einer der ersten US-Senatoren dieses Bundesstaates diente. Sie war mit ihm auf Wahlkampftour gegangen, als er 1856 als erster Präsidentschaftskandidat der neu gegründeten Republikanischen Partei aufgestellt wurde. Er erhielt den Beinamen Pathfinder, und seine Kandidatur hatte die Begeisterung des Volkes neu entflammen lassen. Zwar war er von James Buchanan geschlagen worden, aber wäre die Abstimmung in Pennsylvania anders ausgegangen, wäre er Präsident geworden.
Für Lincoln, den ersten dann auch tatsächlich gewählten Präsidenten der Republikanischen Partei, hatte die Ernennung John Fremonts zum Kommandanten des Westens auf der Hand gelegen.
Inzwischen bereute er diese Entscheidung.
Er fragte sich, ob sein Leben überhaupt noch irgendwie schlimmer sein könnte.
Der ungeheure Stolz, den er im März beim Ablegen des Eides als sechzehnter Präsident empfunden hatte, war den Qualen des Bürgerkriegs gewichen. Elf Staaten hatten sich von der Union abgespalten und eine eigene Konföderation gegründet. Sie hatten Fort Sumter angegriffen und ihn gezwungen, alle Häfen im Süden zu blockieren und die Habeas-Corpus-Rechte aufzuheben. Die Armee der Union war entsandt worden, hatte aber bei Bull Run eine demütigende Niederlage erlitten – dieser verheerende Schlag hatte ihn überzeugt, dass der Krieg lang und blutig werden würde.
Und jetzt also Fremont und sein Erlass der Sklavenbefreiung.
Im Grunde stand Lincoln der Entscheidung des Generals gar nicht so ablehnend gegenüber. Die Aufständischen hatten die Truppen der Union im südlichen Missouri besiegt und rückten jetzt nach Norden vor. Fremont war isoliert, und die Zahl seiner Soldaten und seine Vorräte waren begrenzt. Die Situation hatte zum Handeln gezwungen, und so hatte er Missouri unter Kriegsrecht gestellt. Dann jedoch war er zu weit gegangen und hatte die Freilassung aller Sklaven der Aufständischen angeordnet.
Weder Lincoln selbst noch der Kongress waren derart kühn gewesen.
Der General hatte mehrere Botschaften und sogar einen direkten Befehl, den Erlass zu ändern, missachtet. Und nun hatte er also seine Frau geschickt, um einen Brief zu überbringen und seine Sache zu verfechten.
»Madam, hier sind Rücksichten zu nehmen, die weit über Missouri hinausreichen. Wie Sie selbst mir ja gerade vor Augen geführt haben, tobt in unserem Land ein Krieg. Leider sind die Streitfragen, die die gegnerischen Seiten dieses Konflikts trennen, nicht so eindeutig umgrenzbar.«
Das größte Missverständnis war dabei die Sklaverei.
Von Lincolns Standpunkt aus war die Sklaverei gar nicht das Thema. Er hatte den Sezessionisten bereits das Angebot gemacht, sie sollten ihre Sklaven behalten. Sie könnten sogar ihre eigene Flagge aufziehen, Abgeordnete nach Montgomery schicken und durchaus auch eine eigene Konföderation gründen – vorausgesetzt, sie ließen das Eintreiben der Hafenzölle durch den Norden weiter zu. Sollte der Süden sich von diesen Zöllen befreien, würde das der Industrie im Norden schaden, und die Regierung der Vereinigten Staaten wäre bald bankrott. Keine Armeen wären nötig, um sie zu besiegen. Die Ein- und Ausfuhrzölle waren die Haupteinnahmequelle des Landes. Ohne sie wäre der Norden am Ende.
Aber der Süden hatte Lincolns Angebot abgelehnt und das Feuer auf Ford Sumter eröffnet.
»Mr. President, ich war bei diesem grauenhaft heißen Wetter drei Tage mit dem Zug unterwegs. Es war keine schöne Reise, aber ich bin gekommen, weil der General Ihnen klarmachen will, dass hier nur noch die Rücksichtnahmen zählen, die von alles entscheidender Bedeutung für unsere Nation sind. Aufständische haben gegen uns zu den Waffen gegriffen. Ihnen muss man das Handwerk legen, und die Sklaverei muss abgeschafft werden.«
»Ich habe dem General geschrieben, und er weiß, was ich von ihm erwarte«, stellte er klar.
»Er sieht sich in dem großen Nachteil, Menschen zum Gegner zu haben, die Ihr volles Vertrauen genießen.«
Eine eigenartige Antwort. »Wen meinen Sie damit?«
»Er glaubt, dass Ihre Ratgeber, die Ihnen ja näherstehen, eher bei Ihnen Gehör finden als er.«
»Und das soll seine Gehorsamsverweigerung rechtfertigen? Madam, seine Anordnung der Sklavenbefreiung fällt nicht in den Bereich des Kriegsrechts und ist auch nicht durch die Notwendigkeit erzwungen. Er hat eine politische Entscheidung gefällt, und die steht ihm nicht zu. Erst vor wenigen Wochen habe ich meinen persönlichen Sekretär Mr. Hay zu ihm gesandt, um von ihm eine Änderung jenes Teils des Erlasses zu verlangen, durch den allen Sklaven in Missouri die Freiheit gewährt wird. Auf diese Forderung habe ich keine Antwort erhalten. Und nun hat der General Sie geschickt, um direkt mit mir zu reden.«
Schlimmer noch, Hays Berichten war zu entnehmen gewesen, dass Fremonts Truppe von Korruption durchsetzt war und am Rande der Rebellion stand. Eine Überraschung war das nicht. Fremont war eigensinnig, neigte zur Hysterie und handelte häufig überstürzt. Seine Laufbahn war bisher ein Fiasko nach dem anderen gewesen. 1856 hatte er den Rat der politischen Experten missachtet und die Sklaverei zum Hauptthema seines Wahlkampfs um das Präsidentenamt gemacht. Aber das Land war für eine solche Umwälzung noch nicht reif gewesen. Sie hatte zu dem Zeitpunkt nicht zur Stimmungslage gepasst.
Und das hatte ihn den Sieg gekostet.
»Der General ist überzeugt, dass es ein langer und grauenhafter Prozess sein würde, die Aufständischen allein durch Waffengewalt zu besiegen. Um uns die Unterstützung des Auslands zu sichern, müssen auch andere Erwägungen berücksichtigt werden. Der General weiß, dass die Engländer eine allmähliche Befreiung der Sklaven befürworten und dass bedeutende Männer in den Südstaaten den starken Wunsch verspüren, diesem Wunsch entgegenzukommen. Das dürfen wir nicht zulassen. Als Präsident ist Ihnen gewiss klar, dass England, Frankreich und Spanien kurz davor stehen, die Südstaaten anzuerkennen. England wegen seines Interesses an der Baumwolle. Frankreich, weil ihr Kaiser uns verabscheut …«
»Sie sind ja eine richtige Politikerin.«
»Ich weiß, wie es in der Welt zugeht. Vielleicht sollten auch Sie, ein Mann, der dieses großartige Amt nur mit Mühe errungen hat, genau darauf achten, was andere Menschen denken.«
Diese Beleidigung hatte er schon öfter gehört. Er hatte die Wahl von 1860 dank einer Spaltung der Demokratischen Partei gewonnen, die törichterweise zwei Kandidaten ins Rennen geschickt hatte. Und dann hatte die neu gegründete Constitutional Union Party sich ebenfalls für einen eigenen Kandidaten entschieden. Alle drei zusammen hatten achtundvierzig Prozent der Wählerstimmen und 123 Wahlmänner errungen. Mit seinen vierzig Prozent der Stimmen und 180 Wahlmännern war Lincoln damit als Sieger hervorgegangen. Gewiss, er war ein einfacher Rechtsanwalt aus Illinois, dessen Erfahrung in der nationalen Legislative sich auf eine einzige Amtszeit im Repräsentantenhaus belief. 1858 war er sogar beim Kampf um den Sitz im US-Senat seinem ewigen Gegner Stephen Douglas unterlegen. Jetzt aber, da er als Zweiundfünfzigjähriger für vier Jahre die Herrschaft im Weißen Haus errungen hatte, befand er sich plötzlich im Zentrum der größten Verfassungskrise, mit der die Nation je konfrontiert worden war.
»Ich muss Ihnen sagen, Madam, dass mir die Gedanken der anderen Menschen nicht entgehen können, da ich jeden Tag ihrem Sperrfeuer ausgesetzt bin. Der General hätte die Negerfrage niemals mit in diesen Krieg hineinzerren dürfen. Dies ist ein Konflikt um eine große nationale Sache, und die Negerfrage hat nichts damit zu tun.«
»Da irren Sie sich, Sir.«
Er hatte dieser Frau einen gewissen Spielraum eingeräumt, da ihm klar war, dass sie nur ihren Ehemann verteidigte, wie jede Gattin es tun sollte.
Doch nun hatten sich beide Fremonts in die Nähe des Verrats begeben.
»Madam, das Vorgehen des Generals hat Kentucky veranlasst, seine Allianz mit der Union noch einmal zu überdenken, da es sich nun vielleicht lieber den Aufständischen anschließen möchte. Maryland, Missouri und mehrere weitere Grenzstaaten wägen nun ebenfalls ihre Position neu ab. Wenn es in diesem Konflikt um die Befreiung der Sklaven gehen soll, werden wir ihn mit Sicherheit verlieren.«
Sie öffnete den Mund, um etwas zu erwidern, aber er brachte sie mit erhobener Hand zum Schweigen.
»Ich habe niemanden im Zweifel gelassen. Meine Aufgabe besteht darin, die Union zu retten. Dabei ist mir der kürzeste Weg im Rahmen der Verfassung der liebste. Je eher die Staatsgewalt wieder im gesamten Gebiet der Nation herrscht, desto mehr wird die Union wieder das werden, was sie einmal war. Könnte ich die Union retten, ohne einen einzigen Sklaven zu befreien, würde ich es tun. Könnte ich sie retten, indem ich alle Sklaven befreie, würde ich das auch tun. Und könnte ich sie retten, indem ich einige Sklaven befreie und andere nicht, würde ich das ebenfalls tun. Was ich in den Fragen der Sklaverei und der farbigen Rasse unternehme, tue ich nur unter dem Aspekt, inwieweit es hilft, die Union zu retten. Was ich unterlasse, unterlasse ich, weil ich nicht glaube, dass es helfen würde, die Union zu retten. Ich werde in dieser Frage weniger unternehmen, wenn ich glaube, dass ich sonst meinem eigentlichen Anliegen schade, und mehr, wenn ich glaube, dass es meinem eigentlichen Anliegen nützt.«
»Dann sind Sie nicht mein Präsident, Sir. Und auch nicht der Präsident derer, die Sie gewählt haben.«
»Aber ich bin der Präsident. Bringen Sie also Ihrem Mann folgende Botschaft zurück. Er wurde in den Westen geschickt, um die Armee nach Memphis und dann weiter ostwärts zu führen. Dieser Befehl gilt noch immer. Er soll ihn entweder ausführen oder er wird abberufen.«
»Ich muss Sie warnen, Sir, dass es schlimme Folgen haben könnte, wenn Sie sich dem General weiter entgegenstellen. Er könnte sich unabhängig machen.«
Die Staatskasse war leer, im Kriegsministerium herrschte Chaos, kein einziger Truppenteil der Union war marschbereit. Und nun drohten diese Frau und ihr unverschämter Mann mit Rebellion? Er sollte sie beide verhaften lassen. Doch leider hatte Fremonts einseitig verkündete Sklavenbefreiung Anklang bei den Abolitionisten und bei liberalen Republikanern gefunden, die ein sofortiges Ende der Sklaverei wünschten. Ein kühner Streich gegen ihren Fürsprecher könnte sich als politischer Selbstmord erweisen.
»Dieses Treffen ist vorbei«, sagte er.
Sie warf ihm einen wütenden Blick zu, der ihm klarmachte, dass sie es nicht gewohnt war, einfach weggeschickt zu werden. Doch er beachtete ihren finsteren Gesichtsausdruck nicht und öffnete ihr die Tür. Draußen saß sein persönlicher Sekretär Hay noch an seinem Schreibtisch, und ebenso wartete dort einer seiner Dienstleute. Mrs. Fremont ging grußlos an Hay vorbei, und der Bedienstete führte sie davon. Lincoln wartete ab, bis er die Haustür aufgehen und wieder zufallen gehört hatte. Dann winkte er Hay in das Empfangszimmer.
»Was für eine unverschämte Person«, sagte er. »Wir haben uns noch nicht einmal gesetzt. Sie hat mir gar keine Gelegenheit gelassen, ihr einen Stuhl anzubieten. Stattdessen hat sie mich so heftig in so vielen verschiedenen Punkten angegriffen, dass ich all meinen bescheidenen Takt brauchte, um nicht mit ihr in Streit zu geraten.«
»Ihr Mann ist keinen Deut besser. Als General ist er eine Fehlbesetzung.«
Lincoln nickte. »Fremont macht den Fehler, sich selbst zu isolieren. Er weiß nicht, wie es um die Frage, mit der er sich befasst, wirklich steht.«
»Und er hört nicht zu.«
»Seine Frau hat tatsächlich damit gedroht, dass er eine eigene Regierung bilden könnte.«
Hay schüttelte angewidert den Kopf.
Lincoln traf eine Entscheidung. »Der General wird abgesetzt. Aber erst, wenn wir einen geeigneten Ersatzmann gefunden haben. Suchen Sie einen. Natürlich in aller Stille.«
Hay nickte. »Verstanden.«
Lincoln bemerkte einen großen Umschlag, den sein Vertrauter in der Hand hielt, und zeigte darauf. »Was ist denn das?«
»Ist heute Abend aus Pennsylvania eingetroffen. Wheatland.«
Lincoln kannte dieses Haus und seinen Besitzer. Es gehörte seinem Vorgänger im Amt, James Buchanan. Ein Mann, der in den Nordstaaten sehr gescholten wurde. Man warf ihm vor, er habe South Carolina den Weg zur Abspaltung geebnet, indem er die Schuld daran der maßlosen Einmischung der Bürger des Nordens in die Frage der Sklaverei gab.
Für einen Präsidenten hatte er damit außerordentlich stark Partei ergriffen.
Danach war Buchanan noch weiter gegangen und hatte gefordert, man solle die Sklavenhalterstaaten ihre innerstaatlichen Einrichtungen nach eigenem Gutdünken regeln lassen. Außerdem sollten die Staaten des Nordens alle Gesetze zurücknehmen, die die Sklaven zur Flucht ermutigten. Andernfalls hätten die geschädigten Staaten nach Ausschöpfung aller verfassungsmäßig garantierten Mittel, um diesen Missstand auf friedlichem Wege zu beheben, das Recht, sich der Regierung der Union auf revolutionäre Weise zu widersetzen.
Das kam der präsidentiellen Billigung eines Aufstands gleich.
»Was will der ehemalige Präsident denn?«
»Ich habe den Brief nicht geöffnet.« Hay reichte ihm den Umschlag. Er war vorne mit der Aufschrift: NUR FÜR MR. LINCOLN PERSÖNLICH versehen. »Ich habe diesen Wunsch respektiert.«
Lincoln war müde, und die Begegnung mit Mrs. Fremont hatte ihm das letzte Quäntchen Energie geraubt, das ihm nach diesem langen Tag noch geblieben war. Aber er war auch neugierig. Buchanan hatte es gar nicht erwarten können, sein Amt endlich los zu sein. Am Tag von Lincolns Inauguration hatte er auf der Rückfahrt vom Kapitol seine Absichten klar ausgesprochen. Falls Sie über Ihren Einzug ins Weiße Haus so glücklich sind wie ich über meine Rückkehr nach Wheatland, sind Sie wirklich ein glücklicher Mensch, hatte er in der Kutsche erklärt.
»Sie können Schluss machen«, sagte Lincoln zu Hay. »Ich lese das hier noch und lege mich dann ebenfalls schlafen.«
Sein Sekretär ging, und Lincoln blieb allein im Salon zurück und setzte sich. Er brach das Wachssiegel des Umschlags und zog zwei Blätter heraus. Das eine war ein Pergament – vom Alter vergilbt, voller Wasserflecken, trocken und brüchig. Das zweite war ein glattes Velinpapier, das in einer energischen, männlichen Handschrift mit frischer schwarzer Tinte beschriftet war.
Als Erstes las er das Schreiben auf dem Velinpapier.
Ich habe Ihnen das Land in einem sehr bedauerlichen Zustand überlassen, und dafür entschuldige ich mich. Meinen ersten Fehler habe ich schon am Tag meiner Inauguration begangen, als ich erklärte, dass ich nicht für eine Wiederwahl zur Verfügung stünde. Doch mein Motiv dazu war rein. Ich wollte, dass nichts anderes meine Regierungsführung beeinflusst als mein Wunsch, dem Staat treu und fähig zu dienen und meinen Landsleuten in dankbarer Erinnerung zu bleiben. Doch er hat sich nicht erfüllt. An dem Tag, an dem ich nach dem Ablegen des Amtseides ins Weiße Haus zurückgekehrt bin, erwartete mich dort ein versiegeltes Päckchen, das diesem hier in Größe und Form ähnelte. Darin befanden sich ein Schreiben meines Vorgängers Mr. Pierce sowie jenes Dokument, das ich Ihnen nun ebenfalls beigelegt habe. Pierce schrieb, dass diese Anlage zuerst Präsident Washington selbst übergeben wurde. Dieser entschied, dass man das Dokument vom einen Präsidenten zum nächsten weiterreichen solle und jeder dann frei entscheiden könne, was er damit tun werde. Ich weiß, dass Sie und viele andere mir die Schuld an dem gegenwärtigen nationalen Konflikt geben. Aber bevor Sie mich noch weiter kritisieren, lesen Sie zuerst dieses Dokument. Ich halte mir selbst zugute, dass ich auf jede erdenkliche Weise versucht habe, seinen Auftrag zu erfüllen. Ich habe mir Ihre Rede am Inaugurationstag genau angehört. Sie haben ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Union dem Namen und der Verfassung nach unauflöslich ist. Seien Sie sich da nicht so sicher. Der Schein trügt. Ursprünglich hatte ich nicht die Absicht, dieses Dokument weiterzureichen. Vielmehr wollte ich es verbrennen. Doch fern der Aufregungen des Regierens und des Drucks der nationalen Krise bin ich im Verlauf der letzten Monate zu der Überzeugung gelangt, dass man der Wahrheit nicht ausweichen sollte. Als South Carolina sich von der Union abspaltete, habe ich öffentlich erklärt, dass ich möglicherweise der letzte Präsident der Vereinigten Staaten sein würde. Sie haben meine Bemerkung damals vor aller Ohren lächerlich genannt. Vielleicht werden Sie gleich einsehen, dass ich nicht so töricht war, wie sie glaubten. Nun habe ich das Gefühl, dass ich meine Pflicht treu erfüllt habe, auch wenn die Ausführung vielleicht unvollkommen war. Wozu immer es führen wird, ich werde mit der Überzeugung ins Grab gehen, dass ich jedenfalls nur das Beste für mein Land wollte.
Lincoln blickte von dem Blatt auf. Was für eine sonderbare Wehklage. Und eine Botschaft? Die vom einen Präsidenten an den nächsten weitergereicht wurde? Und die Buchanan ihm bis jetzt vorenthalten hatte?
Er rieb sich die müden Augen und griff nach dem zweiten Blatt. Dessen Tinte war verblasst, und die Schrift war verschnörkelter und schwierig zu entziffern.
Darunter standen mehrere Unterschriften.
Er überflog die gesamte Seite.
Dann las er sie Wort für Wort noch einmal.
Sorgfältiger.
Der Schlaf schien ihm plötzlich nicht mehr wichtig.
Was hatte Buchanan noch geschrieben?
Der Schein trügt.
»Das ist unmöglich«, murmelte er.
ERSTER TEIL
1
Vor der Küste Dänemarks
Mittwoch, 8. Oktober
19.40 Uhr
Ein einziger Blick genügte, und Cotton Malone wusste, dass es Ärger geben würde.
Im Öresund, der die nördliche dänische Insel Seeland von der südschwedischen Provinz Scania trennte – normalerweise eine der verkehrsreichsten Meeresstraßen der Welt –, war diesmal fast nichts los. So weit das Auge reichte, gab es auf der graublauen Wasserfläche derzeit nur zwei Boote – seines und dasjenige, das von der Seite her schräg auf ihn zuraste.
Er hatte das Fahrzeug schon unmittelbar nach ihrem Aufbruch aus dem Hafen des auf der schwedischen Seite der Meerenge gelegenen Landskrona bemerkt. Ein sechs Meter langes, rotes Motorboot mit zwei Innenbordern. Er selbst steuerte ein Boot, das er im Hafen von Kopenhagen auf der dänischen Seite gemietet hatte, fünf Meter lang und mit einem einzigen Außenbordmotor. Mit heulendem Motor pflügte er durch die leichte Dünung. Der Himmel war klar, der Abend kühl und frei von Wind – wunderschönes skandinavisches Herbstwetter.
Vor drei Stunden hatte er noch in seinem Buchantiquariat am Højbro Plads gearbeitet. Da hatte er einfach nur vorgehabt, wie fast jeden Abend im Café Norden zu Abend zu essen. Doch ein Anruf von Stephanie Nelle, seiner ehemaligen Chefin im Justizministerium, hatte das geändert.
»Ich muss dich um einen Gefallen bitten«, hatte sie gesagt. »Ich würde dich nicht fragen, wenn es kein Notfall wäre. Es geht um einen Mann namens Barry Kirk. Kurzes schwarzes Haar und spitze Nase. Du musst hinfahren und ihn abholen.«
Ihm entging nicht, wie dringend ihre Bitte klang.
»Einer meiner Agenten ist zu ihm unterwegs, aber er wurde aufgehalten. Ich weiß nicht, wann er dort ankommen wird, und wir müssen diesen Barry Kirk finden. Auf der Stelle.«
»Du wirst mir wahrscheinlich nicht erzählen, warum usw.?«
»Das darf ich nicht. Aber du bist am nächsten bei ihm. Er wartet auf der anderen Seite des Öresund in Schweden darauf, dass ihn jemand abholt.«
»Das riecht nach Ärger.«
»Ich habe im Moment keine Ahnung, wo mein Agent steckt.«
Diese Worte hasste Malone.
»Kirk weiß vielleicht, wo er sich befindet, darum ist es wichtig, ihn rasch in Sicherheit zu bringen. Ich hoffe, dass wir etwaigen Problemen zuvorkommen können. Bring ihn einfach in deinen Laden und lass ihn dort bleiben, bis mein Mann ihn holen kommt.«
»Ich kümmere mich um Kirk.«
»Noch etwas, Cotton. Nimm deine Pistole mit.«
Er war sofort in seine Wohnung im dritten Stock über dem Buchladen hinaufgegangen und hatte den Rucksack, den er immer bereithielt, unter seinem Bett hervorgezogen. Darin lagen Ausweispapiere, Geld, ein Handy und seine Beretta, die er seinerzeit vom Magellan Billet bekommen hatte und die er nach seinem Ausscheiden aus dem Dienst auf Stephanies Geheiß hatte behalten dürfen.
Jetzt steckte die Pistole unter seinem Jackett hinten im Hosenbund.
»Sie holen auf«, sagte Barry Kirk.
Als hätte Malone das nicht selbst gesehen. Zwei Motoren waren nun mal besser als einer.
Er hielt das Steuer fest in der Hand, der Gashebel war zu drei Vierteln umgelegt. Nun beschloss er, Vollgas zu geben, und beim Beschleunigen schoss der Bug hoch. Er warf einen Blick zurück. In dem anderen Boot befanden sich zwei Männer – der eine steuerte, der andere stand mit einer Waffe in der Hand neben ihm.
Das wurde ja immer besser.
Sie befanden sich noch immer im schwedischen Teil des Öresunds und lenkten das Boot schräg über die Meerenge in südwestlicher Richtung nach Kopenhagen. Er hätte auch mit einem Leihwagen die Öresundbrücke überqueren können, die Dänemark mit Schweden verband, aber das hätte eine Stunde länger gedauert. Auf dem Seeweg ging es schneller, und Stephanie hatte unter Zeitdruck gestanden. Daher hatte er das kleine Sportmotorboot vom selben Verleiher gemietet wie sonst auch immer. Es war viel billiger, ein Boot zu mieten, als selbst eines zu besitzen, insbesondere in Anbetracht der begrenzten Zeit, die er auf dem Wasser verbrachte.
»Was werden Sie unternehmen?«
Eine dumme Frage. Kirk war eindeutig ein Blödmann. Er hatte ihn genau am von Stephanie angegebenen Ort auf dem Kai angetroffen. Der Mann war dort unruhig hin- und hergetigert und hatte es eilig gehabt aufzubrechen. Beide hatten ein Codewort erhalten, an dem sie sich erkennen sollten. Joseph hatte das von Malone gelautet, Moroni das von Kirk.
Eine sonderbare Wahl.
»Kennen Sie diese Männer?«, fragte Malone.
»Sie wollen mich umbringen.«
Malone hielt das Boot weiterhin zur dänischen Küste ausgerichtet, der Bug schlug in wilden Sprüngen auf den Wellen auf und schleuderte Gischt in die Luft.
»Und warum wollen die Sie töten?«, fragte er über das Heulen des Motors hinweg.
»Wer sind Sie eigentlich genau?«
Malone warf Kirk einen kurzen Blick zu. »Der Kerl, der Ihnen den erbärmlichen Arsch rettet.«
Das andere Boot war nun keine dreißig Meter mehr entfernt.
Malone musterte den Horizont in allen Richtungen, entdeckte aber kein weiteres Fahrzeug. Die Dämmerung senkte sich herab und färbte den azurblauen Himmel grau.
Ein Knall.
Dann noch einer.
Er sah sich um.
Der zweite Mann in dem Verfolgerboot schoss auf sie.
»Hinlegen«, brüllte er Kirk zu. Auch er duckte sich, behielt aber Kurs und Geschwindigkeit bei.
Wieder zwei Schüsse.
Einer schlug links von ihm ins Fiberglas ein.
Das andere Boot war nun nur noch fünfzehn Meter entfernt. Malone beschloss, den Verfolgern etwas zum Nachdenken zu geben. Er zog seine Pistole hinten aus dem Hosenbund und feuerte in Richtung des anderen Bootes.
Das andere Boot schwenkte nach Steuerbord ab.
Sie waren noch über eine Meile von der dänischen Küste entfernt und befanden sich beinahe in der Mitte des Öresunds. Das Boot der Verfolger schlug einen Halbkreis um sie und näherte sich nun von rechts voraus, um ihnen den Weg abzuschneiden. Er sah, dass der Schütze die Selbstladepistole gegen eine MP eingetauscht hatte.
Jetzt gab es nur noch eine Option.
Er korrigierte seinen Kurs und steuerte direkt auf das andere Boot zu.
Zeit für eine Mutprobe.
Eine Geschossgarbe zischte durch die Luft. Malone warf sich auf den Boden, behielt aber eine Hand am Steuerrad. Kugeln zischten über ihn hinweg, und ein paar schlugen auch in den Bug ein. Er riskierte einen Blick. Das andere Boot war nach Backbord abgeschwenkt, schlug wieder einen Halbkreis und bereitete einen Angriff von achtern vor, wo das offene Heck wenig Deckung bot.
Malone beschloss, den Stier bei den Hörnern zu packen.
Einziger Haken: Das Timing musste stimmen.
Er ließ das Boot beinahe mit Vollgas weiterrasen. Der Bug ihrer Verfolger war genau auf sie ausgerichtet.
»Unten bleiben«, forderte er Kirk erneut auf.
Er brauchte sich keine Sorgen zu machen, dass der seinen Befehl missachten würde. Kirk presste sich in der Deckung der Seitenwand auf den Boden. Malone hielt noch immer seine Beretta in der Hand, aber verdeckt. Das Verfolgerboot kam immer näher.
Und zwar schnell.
Fünfzehn Meter.
Zwölf.
Zehn.
Malone riss den Gashebel in die Leerlaufposition zurück. Das Boot verlor sofort an Fahrt. Der Bug sank ins Wasser. Sie glitten noch ein paar Meter weiter und kamen dann zum Stillstand. Das andere Fahrzeug näherte sich rasch.
Jetzt war es neben ihnen.
Der Mann mit der Maschinenpistole zielte.
Doch bevor er schießen konnte, schickte Malone ihm eine Kugel in die Brust.
Das andere Boot bretterte vorbei.
Malone legte den Gashebel um, und der Motor erwachte wieder zum Leben.
Im Verfolgerboot bückte sich der Steuermann und hob die Maschinenpistole auf. Wieder lenkte er sein Fahrzeug in einem großen Halbkreis nach vorn, um ihnen den Weg abzuschneiden.
Malones Finte hatte einmal funktioniert, ein weiteres Mal würde das aber nicht klappen.
Zwischen ihnen und der dänischen Küste lag fast immer noch eine Meile, und er konnte dem anderen Boot nicht durch Geschwindigkeit entkommen. Vielleicht könnte er ein paar trickreiche Manöver fahren, aber wie lange würde das helfen? Nein. Er musste sich dem Kampf stellen.
Er schaute nach vorn und versuchte, sich zu orientieren.
Sie befanden sich fünf Meilen nördlich des Stadtrands von Kopenhagen, ganz in der Nähe des Ortes, an dem sein verstorbener Freund Henrik Thorvaldsen früher gelebt hatte.
»Schauen Sie sich das an«, hörte er Kirk sagen.
Er wandte sich um.
Das andere Boot raste aus dreißig Meter Entfernung auf sie zu. Aber aus dem immer dunkler werdenden Himmel im Westen kam eine einmotorige Cessna, ein Hochdecker, herangeflogen.
Ihr unverkennbares dreirädriges Landegestell zog mit nur zwei Meter Abstand über das Wasser hinweg, streifte beinahe das Verfolgerboot und hätte mit den Rädern um ein Haar den Steuermann umgerissen. Der warf sich zu Boden und ließ dabei offensichtlich das Steuer los, denn der Bug schwenkte ruckartig nach links.
Malone nutzte die Situation, um den Angreifer aufs Korn zu nehmen.
Das Flugzeug zog in einer Kurve nach oben und schwenkte dann zu einem erneuten Versuch herum. Malone fragte sich, ob dem Piloten klar war, dass sich eine Maschinenpistole an Bord befand, die sein Gegner nun gleich nach oben richten würde. Seinerseits fuhr Malone mit voller Kraft voraus auf die Gefahr zu. Das andere Fahrzeug trieb inzwischen ohne Fahrt im Wasser, da der Steuermann seine volle Aufmerksamkeit auf das Flugzeug gerichtet hatte.
Das gestattete Malone, sich rasch zu nähern.
Er war dankbar für das Eingreifen des Flugzeugs, aber die Situation schien nun auf eine Katastrophe zuzusteuern. Die Maschinenpistole war inzwischen auf das Flugzeug gerichtet.
»Aufstehen und herkommen«, brüllte er Kirk an.
Der Kerl rührte sich nicht.
»Soll ich etwa kommen und Sie holen?«
Kirk erhob sich.
»Übernehmen Sie das Steuerrad. Fahren Sie weiter geradeaus.«
»Ich? Was?«
»Tun Sie es einfach.«
Kirk packte zu.
Malone stellte sich mit beiden Beinen stabil am Heck auf und zielte.
Das Flugzeug kam zurück. Malones Gegner nahm es mit der Maschinenpistole ins Visier. Malone wusste, dass er selbst nur einige wenige Schuss hatte, und das aus dem über die Wellen bretternden, schwankenden Boot. Nun bemerkte sein Gegner plötzlich, dass Malones Boot sich ihm zur gleichen Zeit wie das Flugzeug näherte.
Beide stellten eine Bedrohung dar.
Was würde er tun?
Malone schoss zweimal, aber daneben.
Sein dritter Schuss traf das Boot.
Malones Gegner sprang nach rechts und kam offensichtlich zu der Entscheidung, dass das Boot die größere Gefahr darstellte. Malones vierter Schuss traf den Gegner in die Brust und schleuderte ihn über Bord in die Wellen.
Das Flugzeug flog so dicht über sie hinweg, dass die Räder sie fast streiften.
Malone und Kirk duckten sich.
Malone übernahm das Steuer, drosselte das Gas und lenkte das Boot langsam auf den Gegner zu. Sie näherten sich mit schussbereiter Waffe von achtern. Im Wasser trieb die eine Leiche, die zweite lag im Boot, klar. Sonst war niemand an Bord.
»Scherereien machen scheint Ihre Spezialität zu sein«, sagte er zu Kirk.
Die Ruhe war zurückgekehrt, und nur das Tuckern des Motors im Leerlauf störte die Stille. Das Wasser schlug plätschernd gegen beide Bootsrümpfe. Eigentlich müsste er die Polizei informieren. Die schwedische? Oder die dänische? Aber da Stephanie und das Magellan Billet involviert waren, war ihm klar, dass das Hinzuziehen der einheimischen Behörden keine Option darstellte.
Stephanie hasste es, zu so etwas gezwungen zu sein.
Er blickte in den Abendhimmel hinauf und sah, dass die Cessna auf einer Höhe von inzwischen wieder dreihundert Meter unmittelbar über sie hinwegflog.
Und dann sprang jemand aus dem Flugzeug.
Ein Fallschirm öffnete sich und entfaltete sich in der Luft, und der Mann, der daran hing, steuerte in einer engen Spirale nach unten. Malone hatte mehrere Fallschirmsprünge hinter sich und sah, dass dieser Mann wusste, was er tat. Mit Hilfe der Steuerleinen lenkte er den Schirm direkt auf sie zu und schleifte schließlich in weniger als fünfzehn Meter Entfernung mit den Füßen durchs Wasser.
Malone steuerte ihn längsseits an. Der Mann, der sich über die Bordwand hievte, war wohl Ende zwanzig. Sein blondes Haar wirkte eher geschoren als geschnitten, und das Gesicht war sauber rasiert und erstrahlte in einem breiten Lächeln mit blitzenden Zähnen. Er trug ein dunkles Polohemd und Jeans, die nass an seinem muskulösen Körper klebten.
»Ganz schön kalt, das Wasser«, sagte er. »Danke, dass Sie auf mich gewartet haben. Bitte entschuldigen Sie die Verspätung.«
Malone deutete auf das in der Ferne davonziehende Flugzeug. »Ist jemand an Bord?«
»Nein. Autopilot. Aber der Tank ist beinahe leer. In ein paar Minuten fällt es in die Ostsee.«
»Teurer Abfall.«
Der junge Mann zuckte mit den Schultern. »Der Kerl, dem ich es gestohlen habe, soll es nicht wiederkriegen.«
»Wer sind Sie überhaupt?«
»Oh, entschuldigen Sie bitte. Manchmal vergesse ich meine Manieren.«
Er reichte Malone die Hand.
»Luke Daniels. Magellan Billet.«
2
Kalundborg, Dänemark
20.00 Uhr
Josepe Salazar wartete, während der Mann vor ihm langsam zu sich kam. Sein Gefangener lag halb bewusstlos auf dem Zellenboden, aber er war doch genug bei Sinnen, um Salazar sagen zu hören: »Schluss damit.«
Der Mann hob den Kopf von den staubigen Steinplatten und stieß mühsam hervor: »Seit drei Tagen … frage ich mich … wie Sie nur so grausam sein können. Sie sind gläubig … vertrauen auf den Vater im Himmel. Ein Mann Gottes …«
Salazar erkannte darin keinen Widerspruch. »Die Propheten waren mit ebenso großen oder noch größeren Gefahren konfrontiert wie ich heute. Und doch haben sie niemals gezögert zu tun, was getan werden musste.«
»Du sprichst die Wahrheit«, ermunterte ihn der Engel.
Salazar blickte auf. Die Gestalt schwebte wenige Schritte entfernt in einem weiten weißen Gewand vor ihm, in Licht gebadet, so rein wie ein Blitz und heller als alles, was er je zuvor gesehen hatte.
»Zögere nicht, Josepe. Keiner der Propheten hat je gezögert zu tun, was getan werden musste.«
Er wusste, dass sein Gefangener den Engel nicht hören konnte. Das konnte keiner außer ihm selbst. Aber der Mann auf dem Zellenboden bemerkte, dass sein Blick sich auf die Rückwand der Zelle geheftet hatte.
»Wonach schauen Sie?«
»Ich sehe etwas Wundervolles.«
»Er kann nicht begreifen, was wir wissen.«
Salazar sah den Gefangenen an. »Ich habe Kirk.«
Er hatte zwar noch keine Bestätigung erhalten, dass in Schweden alles nach Plan verlaufen war, aber sein Mann hatte ihm berichtet, dass er die Zielperson gesichtet hatte. Endlich. Nach drei Tagen. Und genauso lange hatte dieser Mann hier ohne Nahrung und Wasser in der Zelle gelegen. Seine Haut war bleich und mit Prellungen übersät, die Lippen aufgesprungen, die Nase gebrochen, und die Augen lagen tief in den Höhlen; wahrscheinlich hatte er auch ein paar gebrochene Rippen. Um seine Qual zu steigern, stand ein gefüllter Wasserkübel vor dem Zellengitter, gut zu sehen, aber außer Reichweite.
»Mach Druck«, befahl ihm der Engel. »Er muss begreifen, dass wir keine Unverschämtheit dulden. Die Leute, die ihn geschickt haben, müssen wissen, dass wir kämpfen werden. Es ist noch viel zu tun, und sie haben sich uns in die Quere gestellt. Zerbrich ihn.«
Er beherzigte den Rat des Engels immer. Wie denn auch nicht? Er kam direkt vom Himmlischen Vater. Dieser Gefangene war allerdings ein Spion. Den ihm der Feind geschickt hatte.
»Wir sind mit Spionen immer hart umgesprungen«, sagte der Engel. »Anfangs gab es viele von ihnen, und sie haben großen Schaden angerichtet. Das müssen wir ihnen heimzahlen.«
»Aber soll ich ihn denn nicht lieben?«, fragte er die Erscheinung. »Er ist trotz allem ein Sohn Gottes.«
»Mit wem … reden Sie?«
Er sah den Gefangenen an und stellte die Frage, die ihn interessierte: »Für wen arbeiten Sie?«
Keine Antwort.
»Sagen Sie es mir.«
Er hörte selbst, dass er laut wurde. Das war ungewöhnlich für ihn. Man kannte ihn allgemein als jemanden, der freundliche Worte wählt und immer gelassen auftritt – und an diesem Bild arbeitete er hart. Gutes Benehmen sei eine vergessene Kunst, hatte sein Vater oft gesagt.
Der Eimer mit Wasser stand zu seinen Füßen.
Er füllte eine Schöpfkelle und schleuderte den Inhalt seinem Gefangenen durch die Gitterstäbe ins zerschlagene Gesicht. Der Mann leckte mit der Zunge alles auf, was er von dieser winzigen Erfrischung ergattern konnte. Aber drei Tage Durst waren nicht so schnell gestillt.
»Sagen Sie mir, was ich wissen will.«
»Mehr Wasser.«
Mitleid kannte er schon lange nicht mehr. Ihm war eine heilige Pflicht auferlegt, und das Schicksal von Millionen von Menschen hing von den Entscheidungen ab, die er traf.
»Es muss eine Blutsühne geben«,sagte der Engel. »Das ist die einzige Möglichkeit.«
Die Lehre besagte, dass es Sünden gab, für die ein Mensch weder in dieser Welt noch in der nächsten Vergebung erlangen konnte. Doch wenn man so jemandem die Augen für seine wahre Lage öffnete, wäre er gewiss bereit, sein Blut um der Vergebung willen hinzugeben.
»Das Blut des Gottessohnes wurde für die Sünden der Menschheit vergossen«, sagte der Engel. »Es bleiben noch immer Sünden, die wie in den alten Tagen durch ein Opfer auf dem Altar gesühnt werden können. Aber es gibt auch Sünden, die durch das Blut eines Lamms, eines Kalbs oder einer Taube nicht abzuwaschen sind. Hier muss zur Buße Menschenblut fließen.«
Sünden wie Mord, Ehebruch, Lüge, Bündnisbruch und Abtrünnigkeit.
Er ging in die Hocke und betrachtete den Widerspenstigen auf der anderen Seite des Gitters. »Sie können mich nicht aufhalten. Das kann keiner. Was geschehen wird, wird geschehen. Aber ich bin bereit, milde mit Ihnen umzugehen. Sagen Sie mir einfach, für wen Sie arbeiten und was Ihre Mission ist, dann bekommen Sie dieses Wasser hier.«
Er füllte eine weitere Kelle und streckte sie ihm hin.
Der Mann lag mit ausgebreiteten Armen auf dem Bauch und hatte das nasse Gesicht auf den Boden gelegt. Nun wälzte er sich langsam herum und schaute zur Decke hinauf.
Salazar und der Engel warteten.
»Ich bin ein Agent … des Justizministeriums. Wir sind … hinter Ihnen her.«
Die US-Regierung. Seit annähernd zwei Jahrhunderten machte die nichts als Ärger.
Aber woher wussten seine Feinde über ihn Bescheid?
Der Mann drehte ihm den Kopf zu und richtete den Blick seiner erschöpften Augen auf ihn. »Mich zu töten … bringt Ihnen … gar nichts. Es macht Ihre Lage … nur noch schwieriger.«
»Er lügt«, sagte der Engel. »Er glaubt, er könne uns Angst einjagen.«
Wie versprochen schob Salazar die Kelle zwischen den Gitterstäben hindurch. Der Mann griff hastig zu und schüttete sich das Wasser in den Mund. Salazar schob den Eimer näher, und der Mann goss sich noch mehr von dem Nass in die trockene Kehle.
»Bleibe fest«, sagte der Engel. »Er hat eine Sünde begangen, die ihn, wie er weiß, die Erhöhung kosten wird, nach der er sich sehnt. Die kann er nun nur noch durch Vergießen seines Blutes erlangen. Wird sein Blut vergossen, büßt er seine Sünde und wird gerettet und von Gott erhöht. Es gibt keinen einzigen Menschen, der nicht sagen würde: ›Vergieße mein Blut, damit ich gerettet und von Gott erhöht werde.‹«
Nein, einen solchen Menschen gab es nicht.
»In vielen Fällen wurden Menschen zu Recht erschlagen, um für ihre Sünden zu büßen, Josepe. Ich habe es Hunderte von Malen erlebt, dass jemand die Erhöhung hätte erlangen können, wenn ihm sein Leben genommen und sein Blut als duftender Weihrauch vor dem Allmächtigen vergossen worden wäre. Doch nun sind diese Personen Engel des Teufels.«
Ganz anders als der Gesandte des Himmels vor ihm, der mit Gottes Worten sprach.
»Genau dies heißt, seinen Nächsten lieben wie sich selbst. Wenn dein Nächster Hilfe braucht, reich ihm deine Hand. Wenn er der Errettung bedarf und es dazu nötig ist, sein Blut auf der Erde zu vergießen, vergieße es. Hast du eine Sünde begangen, deren Sühne das Vergießen von Blut erfordert, so raste und ruhe nicht, bis dein Blut vergossen ist, denn nur so kannst du die ersehnte Errettung erlangen. So erweist man der Menschheit seine Liebe.«
Er wandte den Blick von der Erscheinung ab und fragte den Gefangenen: »Wollen Sie Ihre Seele retten?«
»Warum interessiert Sie das?«
»Ihre Sünden sind groß.«
»So wie die Ihren.«
Doch bei Salazar war es anders. Eine Lüge auf der Suche nach der Wahrheit war keine Lüge. Jemanden um seines Seelenheils willen zu töten war ein Akt der Liebe. Er schuldete diesem Sünder den ewigen Frieden, und so zog er seine Pistole unter der Jacke hervor.
Der Gefangene riss vor Schreck die Augen auf. Er versuchte zurückzuweichen, doch für ihn gab es kein Versteck.
Es würde leicht sein, ihn zu töten.
»Noch nicht«, sagte der Engel.
Er senkte die Waffe.
»Wir brauchen ihn noch.«
Dann schwebte die Erscheinung nach oben und verschwand in die Decke hinein. Die Zelle war nun wieder düster, so wie vor dem Erstrahlen des Lichts.
Ein freundliches Lächeln spielte um Salazars Lippen.
In seinen Augen glänzte ein neues Licht, und das verbuchte er als himmlischen Dank für seinen Gehorsam. Er sah auf die Uhr und rechnete acht Stunden zurück.
In Utah war jetzt Mittag.
Er musste den Ältesten Rowan informieren.
3
Südliches Utah
12.02 Uhr
Senator Thaddeus Rowan stieg aus dem Landrover und ließ sich von der vertrauten Wärme der Sonne durchdringen. Er lebte seit seiner Geburt in Utah und war nach den dreiunddreißig Jahren, in denen er das Amt innegehabt hatte, inzwischen der dienstälteste US-Senator des Bundesstaates. Ein mächtiger und einflussreicher Mann war er, bedeutend genug, dass der Innenminister heute persönlich hergeflogen war, um ihn zu begleiten.
»Was für eine schöne Gegend«, sagte der Minister.
Die südliche Hälfte Utahs gehörte der Bundesregierung, hier lagen Nationalparks wie Arches, Capitol Reef oder Bryce Canyon. Der Zion National Park, in dem sie sich jetzt befanden, erstreckte sich über sechzigtausend Hektar zwischen der Interstate 15 und dem Highway 9 von Nordwesten nach Südosten. Hier hatten einmal die Paiute gelebt, aber ab 1863 hatten Heilige der Letzten Tage, die vom großen Salzsee kamen, sie vertrieben und der verlassenen Gegend ihren Namen gegeben – Zion. Isaac Behunin, der Heilige, der sich hier als Erster zusammen mit seinen Söhnen niederließ, berichtete, ein Mensch könne Gott in diesen großen Kathedralen ebenso gut anbeten wie in einer von Menschen errichteten Kirche. Aber nach seinem Besuch im Jahr 1870 beurteilte Brigham Young das anders und gab dem Landstrich den Spitznamen Nicht-Zion. Der blieb hängen.
Rowan hatte die zweihundertfünfzig Meilen von Salt Lake City im Hubschrauber zurückgelegt und war mit dem Minister im Nationalpark gelandet, wo dessen Superintendent sie erwartete. Als Vorsitzender des Haushaltsausschusses des Senats genoss Rowan viele Rechte. Nicht deren kleinstes war gewiss, dass ohne seine Zustimmung kein Cent an Bundesgeld ausgegeben werden konnte.
»Dies hier ist ein großartiges Land«, erwiderte er dem Minister. Er war schon oft in dieser Wüste voll roter Felsen gewandert, deren Slot Canyons so eng waren, dass kein Sonnenstrahl ihren Grund erreichte. In den abgelegeneren Ecken Utahs waren die Städte fast gänzlich von Heiligen bevölkert, oder von Mormonen, wie viele Leute sie gerne nannten. Manche Heilige, darunter auch er selbst, mochten dieses Etikett nicht besonders. Es stammte aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, als Vorurteile und Hass sie zu einer allmählichen Flucht nach Westen gezwungen hatten, wo sie schließlich die einsame Gegend am Großen Salzsee fanden. Seine Vorfahren hatten in den ersten Planwagen gesessen, die am 24. Juli 1847 dort eingetroffen waren. Damals hatte es dort nichts anderes gegeben als grünes Gras und, falls man der Legende Glauben schenkte, einen einzigen Baum.
Einsame Pracht. So hatte ein Heiliger den Landstrich beschrieben.
Als ihr Führer Brigham Young von Fieber geschüttelt und auf ein Lager in einem der Planwagen gestreckt dort eingetroffen war, hatte er sich, so hieß es, erhoben und verkündet: Dies ist der Ort.
Zehntausende weitere Siedler folgten ihnen, schlugen, die üblichen Strecken meidend, die Route ein, die die Pioniere der Saints markiert hatten, und säten unterwegs Getreide neu, damit spätere Trecks ebenfalls Nahrung vorfinden würden. An jenem Tag im Jahr 1847 aber fanden in der ersten Einwanderungswelle 143 Männer, 3 Frauen, 2 Kinder, 70 Planwagen, 1 Kanone, 1 Boot, 93 Pferde, 52 Maultiere, 66 Ochsen, 19 Kühe, 17 Hunde und einige Hühner ein neues Zuhause.
»Nur noch diesen Grat hinauf«, sagte der Superintendent und zeigte nach vorn.
Die Männer waren zu dritt mit dem Landrover vom Hubschrauber aus hergefahren. Sie trugen festes Schuhwerk, Jeans, ein langärmliges Hemd und einen Hut. Trotz seiner einundsiebzig Jahre hatte Rowan einen gesunden, kräftigen Körper – und er war bereit, den Marsch durch die abweisende Landschaft, die sich in alle Richtungen erstreckte, in Angriff zu nehmen.
»Wo befinden wir uns?«, fragte er. »Vierzig Meilen tief im Inneren des Parks?«
Der Superintendent nickte. »Eher schon fünfzig. Der Zugang ist normalen Besuchern verboten. Wandern oder Zelten ist nicht gestattet. Die Slot Canyons sind zu gefährlich.«
Rowan kannte die Zahlen. Zion hatte jährlich drei Millionen Besucher und war damit eine der beliebtesten Attraktionen Utahs. Für alles und jedes brauchte man eine Genehmigung, und das war so ausgeufert, dass Fahrer von Geländewagen, Jäger und Naturschutzgegner auf eine Abmilderung der Praxis drängten. Persönlich gab er ihnen vollkommen recht, aber er hatte sich aus diesem Streit herausgehalten.
Der Superintendent führte sie in einen Canyon mit steilen Wänden, dessen Grund mit Großzahnahorn bewachsen war. Zwischen wildem Senf und kräftigen Kreosotbüschen stand büschelweise drahtiges Gras. Hoch oben am klaren Himmel glitt hin und wieder ein kreisender Kondor ins Blickfeld.
»Die Sache ist nur durch die illegalen Wanderer ans Tageslicht gekommen«, berichtete der Superintendent. »Letzte Woche kamen drei Personen verbotenerweise in diesen Teil des Parks. Einer ist ausgerutscht und hat sich ein Bein gebrochen, woraufhin wir ihn bergen mussten. Dabei ist uns das hier aufgefallen.«
Der Superintendent deutete auf einen dunklen Spalt in der Felswand. Rowan wusste, dass Höhlen im Sandstein nichts Ungewöhnliches waren, das südliche Utah war von Tausenden von ihnen übersät.
»Im August hat es in dieser Gegend eine Sturzflut gegeben«, erklärte der Superintendent. »Drei Tage lang stand alles unter Wasser. Vermutlich ist diese Öffnung dabei freigespült worden. Davor war sie wohl lange Zeit verschlossen.«
Rowan warf einen Blick auf den Minister. »Und was haben Sie hier für ein Interesse?«
»Ich sorge dafür, dass der Vorsitzende des Haushaltsausschusses des Senats mit den Dienstleistungen des Innenministeriums zufrieden ist.«
Das bezweifelte Rowan, denn die Regierung von Präsident Danny Daniels hatte sich in den letzten sieben Jahren keinen Deut darum geschert, was der dienstälteste Senator Utahs dachte. Sie gehörten unterschiedlichen Parteien an, die von Rowan stellte die Mehrheit im Kongress, und Daniels war im Weißen Haus am Ruder. Normalerweise förderte eine solche Zweiteilung die Kooperation und den Kompromiss. Aber in den letzten Jahren war der Geist der Zusammenarbeit verschwunden. Eine Pattsituation, so nannte man das im Volksmund. Das Ganze wurde noch dadurch verkompliziert, dass Daniels ins letzte Jahr seiner zwei Amtszeiten eingetreten und die Nachfolge ungeklärt war.
Beide Parteien hatten eine Chance.
Aber für Wahlen interessierte Rowan sich nicht mehr. Er hatte größere Pläne.
Sie näherten sich der Öffnung im Fels; der Superintendent setzte seinen Rucksack ab und holte drei Taschenlampen heraus.
»Damit geht es besser.«
Rowan nahm seine Lampe entgegen. »Gehen Sie voran.«
Sie quetschten sich durch den Spalt und kamen in eine große Höhle, deren Decke sechs Meter hoch war. Er leuchtete den Eingang mit dem Strahl seiner Taschenlampe ab und stellte fest, dass er früher wesentlich breiter und höher gewesen sein musste.
»Diese Öffnung war einmal recht groß«, sagte der Superintendent. »Wie ein überdimensioniertes Garagentor. Aber sie wurde absichtlich kaschiert.«
»Woher wissen Sie das?«
Der Mann deutete mit dem Lichtstrahl nach vorn. »Das zeige ich Ihnen gleich. Aber seien Sie vorsichtig. So eine Höhle ist genau das Richtige für Schlangen.«
Das hatte Rowan sich schon gedacht. Sechzig Jahre der Erkundungstouren im ländlichen Utah hatten ihn Respekt vor dem Land und seinen tierischen Bewohnern gelehrt.
Zwanzig Meter tiefer in der Höhle zeichneten sich im Dunkeln Formen ab. Er zählte drei Wagen. Sie hatten mächtige Räder und waren vielleicht drei Meter lang und anderthalb Meter breit. Und sie waren hoch, obwohl der Aufbau aus Bögen und Planen längst verrottet war. Er trat heran und untersuchte einen von ihnen näher. Stabiles, nicht angefaultes Holz. Nur die Eisenreifen der Räder waren von Rost verkrustet. Solche Wagen waren früher von einem Gespann von vier oder sechs Pferden gezogen worden oder manchmal auch von Maultieren oder Ochsen.
»Original 19. Jahrhundert«, sagte der Superintendent. »Ich weiß etwas darüber. Durch die trockene Wüstenluft und den Schutz der Höhle sind sie gut erhalten geblieben. Sie sind unbeschädigt, was man äußerst selten findet.«
Rowan trat näher und sah, dass die Bettstätten leer waren.
»Sie müssen durch die Öffnung hereingeschafft worden sein«, erklärte der Superintendent. »Die muss damals also wesentlich größer gewesen sein.«
ENDE DER LESEPROBE