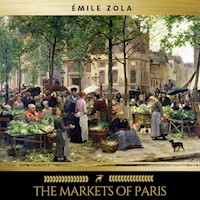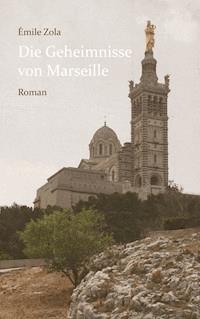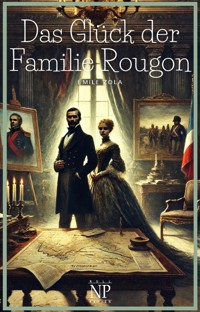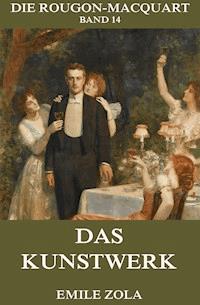
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Band 14 der Rougon-Macquard-Reihe, die Saga eine französischen Familie unter dem Zweiten Kaiserreich. In diesem Band geht es um den Maler Claude Lanier, dessen innerer Zwist und Selbstzweifel mittelfristig zu einer Katastrophe führen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 681
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Kunstwerk
Emile Zola
Inhalt:
Emile Zola – Biografie und Bibliografie
Das Kunstwerk
Erstes Kapitel.
Zweites Kapitel.
Drittes Kapitel.
Viertes Kapitel.
Fünftes Kapitel.
Sechstes Kapitel.
Siebentes Kapitel.
Achtes Kapitel.
Neuntes Kapitel.
Zehntes Kapitel.
Elftes Kapitel.
Zwölftes Kapitel.
Das Kunstwerk, Emile Zola
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN:9783849618186
www.jazzybee-verlag.de
Emile Zola – Biografie und Bibliografie
Namhafter franz. Romanschriftsteller, geb. 2. April 1840 in Paris, gest. daselbst 28./29. Sept. 1902, Sohn eines italienischen Ingenieurs, der den Bau des »Kanals Zola« in der Provence leitete, aber schon 1847 in Aix starb, verbrachte seine Jugend in Aix, besuchte seit 1858 das Lycée St.-Louis in Paris und trat dann, um sich dem Buchhandel zu widmen, in das Geschäft von Hachette ein. Seine Mußestunden zu schriftstellerischen Arbeiten benutzend, schrieb er literarische und theatralische Kritiken für verschiedene Zeitungen und versuchte sich bald auch auf dem Gebiete des Romans mit: »Les mystères de Marseille« und »Le vœu d'une morte«. Mehr Beachtung als diese Werke fanden schon seine »Contes à Ninon« (1864) und die »Confession de Claude« (1865), während »Thérèse Raquin« (1867) die Richtung des Autors sowie sein Talent, die Nachtseiten der menschlichen Natur mit grausamer Wahrheit zu schildern, unzweifelhaft bekundete. Nachdem er darauf »Madeleine Férat« (1868), eine Studie über die Fatalität der ererbten Anlagen, gleichsam als Vorspiel vorausgeschickt, begann er 1869 seinen berühmten, dasselbe Thema in systematischer Weise behandelnden Romanzyklus »Les Rougon-Macquart«, den er selbst als die »psychologisch-soziale Geschichte einer Familie unter dem zweiten Kaiserreich« bezeichnet. Derselbe umfaßt 20 Bände, nämlich: »La fortune des Rougon« (1871), »La curée« (1872), »Le ventre de Paris«, »La conquête de Plassans«, »La faute de l'abbé Mouret«, »Son Excellence Eugène Rougon«, »L'Assommoir«, die Folgen der Trunksucht in Pariser Arbeiterkreisen meisterhaft schildernd und Zolas Weltruhm begründend (1876), »Une page d'amour«, »Nana« (1880), »Pot-Bouille«, »Au Bonheur des dames«, »La joie de vivre«, »Germinal«, Roman der Kohlenminen (1885), »L'Œuvre«, »La Terre«, »Le Rêve«, »La bête humaine«, »L'Argent«, »La Débâcle«, Kriegsgeschichte von 1870 (1892), und »Le Docteur Pascal« (1893). Vom »Assommoir« an erlebten alle Romane der Serie erstaunliche Auflagen, die stärksten der eben genannte (162,000 Exemplare bis 1908 verkauft), »Nana« (203,000 Exemplare), »La Terre« (150,000 Exemplare) und »La Débâcle« (224,000 Exemplare). Über den leitenden Gedanken, der durch das Werk hindurchgehen soll, spricht sich Z. in der Vorrede zum ersten Band selbst aus. Er wolle, sagt er, durch Lösung der doppelten Frage des angebornen Temperaments und der umgebenden Welt den Faden zu verfolgen suchen, der mit mathematischer Genauigkeit von einem Menschen zum andern führe. Wie die Schwerkraft, so habe auch die Erblichkeit ihre bestimmten Gesetze. Die Art, wie Z. diese Aufgabe gelöst, hat ihm ebenso heftige Angriffe wie unbegrenzte Bewunderung eingetragen und ihn jedenfalls zum Chorführer der Naturalisten gemacht. Allein er hat die Anwendung des Grundsatzes der Realisten, daß der Schriftsteller alles solle darstellen dürfen, was die menschliche Handlungsweise bestimmt, daß er es der Wahrheit schuldig sei, nichts zu verschweigen und nichts zu beschönigen, fast mit jedem neuen Gliede der Kette gesteigert. Bei der Kurtisanengeschichte »Nana« glaubte man, er sei jetzt an der äußersten Grenze des Widerwärtigen angelangt; aber man irrte sich, wie »Pot-Bouille«, »Germinal« und namentlich »La Terre« bewiesen; im »Rêve« machte der Verfasser immerhin einige Anstrengung, um eine »weiße Symphonie« für sein junges Patenkind, die Tochter seines Verlegers Charpentier, zu schreiben. 127,000 abgesetzte Exemplare zeigen, daß Z. auch ohne Naturalismen im engern Sinne des Wortes zu interessieren versteht. Der Kritiker Z., der für den »Voltaire«, den »Figaro« und den in Moskau erscheinenden »Europäischen Boten« schrieb, solange der Roman ihm nicht ein hinreichendes Auskommen bot, zeichnete sich durch Rücksichtslosigkeit gegen alle anerkannten Größen und etwas einseitige Empfehlung der eignen neuen Richtung aus. Charakteristisch genug nannte er den ersten Band seiner gesammelten Abhandlungen über lebende Schriftsteller und ihre Werke »Mes haines« (1866, neue Ausg. 1879). Die übrigen Bände sind: »Le roman expérimental« (1880), »Les romanciers naturalistes«, »Le naturalisme an theâtre«, »Nos auteurs dramatiques«, »Documents littéraires« (1881), »Une campagne« (1880–81), »Nouvelle campagne« (1896). Z. hielt sich für berufen, wie dem Roman, so auch dem Theater neue Bahnen zu weisen, drang aber damit nicht durch, ob er seine Romane allein für die Bühne zustutzte oder mit Hilfe William Busnachs dem großen Publikum abschwächende Zugeständnisse machte. »Thérèse Raquin« und »Bouton de rose«, die er ohne fremde Mitwirkung ausführen ließ, wurden ausgezischt; »L'Assommoir« hingegen, »Le ventre de Paris« und »Nana« behaupteten sich lange auf dem Theaterzettel, während »Germinal«, bei dem Z., wie er hatte verkündigen lassen, das meiste tat, nach 17 Vorstellungen einging und »Renée« (Bearbeitung der »Curée«), für die er ganz allein verantwortlich war, nicht einmal einen Achtungserfolg erzielte. Als Z. sein Hauptwerk, die Geschichte der »Rougon-Macquart«, vollendet hatte, unternahm er die Städtetrilogie: »Lourdes«, »Rome«, »Paris« (1894 bis 1898), worin ein schwärmerischer junger Priester zum Sozialisten und Freidenker wird. 1898 griff Z. durch den Artikel »J'accuse« in der »Aurore« mit Wucht in die Dreyfusaffäre ein. Er wurde deshalb als Verleumder des Kriegsgerichts, das den wahren Verräter Esterhazy freigesprochen, von den Pariser Geschwornen verurteilt, appellierte und wurde in Versailles nochmals verurteilt, entzog sich aber durch die Flucht nach England der Haft. Er kehrte 1899 nach dem Revisionsbeschluß des Kassationshofes nach Paris zurück, lebte meist auf seinem Landgut in Médan und starb in Paris im Schlafe durch Kohlenoxydvergiftung, da der Ofen seines Schlafzimmers beschädigt war. Seine Leiche wurde 4. Juni 1908 im Panthéon beigesetzt und ein großes Denkmal wird in Paris 1909 enthüllt werden. Infolge der Dreyfusaffäre nahm auch Zolas Dichtung einen politisch lehrhaften, meist optimistischen Charakter an. Er kündigte »Les quatre Evangiles« an, vollendete aber nur drei: »Fécondité« (1899), »Travail« (1901), »Vérité« (1902). »Justice« blieb Projekt. Die Artikel zur Dreyfusaffäre vereinigte der Band »La Véritéen marche« (1899). Nachdem der Komponist A. Bruneau aus »Le Rêve« eine erfolgreiche Oper (1891) gemacht, schrieb Z. eigens für ihn die Opernbücher »Messidor« (1897), »L'Ouragan« (1901) und »L'Enfant-Roi« (1905 ausgeführt), die geringern Erfolg hatten. Drei Bände »Correspondance« erschienen 1907–08. Zu dem Sammelwerk »Les Soirées de Médan« (1882), das die Namen von Céard, Hennique, Huysmans, Alexis und Maupassant vereinigte, steuerte Z. die Novelle »L'attaque du moulin« bei, aus der Bruneau ebenfalls eine Oper (1892) machte. Zolas Bildnis s. Tafel »Medaillen VI«, Fig. 6. Vgl. P. Alexis, Émile Z., notes d'un ami (Par. 1882); J. ten Brink, Emil Z. und seine Werke (deutsch, Braunschw. 1887); die Schmähschrift von Ant. Laporte, Z. contre Z. (Par. 1896); Toulouse, Emile Z., enquête medico-psychologique (das. 1896); »Les personnages des Rougon-Macquart«, mit Vorrede von Ramond (1901); Vizetelly, Emile Z., novelist and reformer (Lond. 1904; deutsch, Berl. 1905); Brulat, Histoire populaire d'Émile Z (Par. 1907); Massis, Comment Émile Z. composait ses romans (das. 1906); M. G. Conrad, Émile Z. (Berl. 1906); Grand-Carteret, Z.en image (Par. 1908).
Das Kunstwerk
Erstes Kapitel.
Die Uhr des Rathauses, an dem Claude eben vorüberkam, schlug die zweite Morgenstunde, als das Gewitter losbrach. Er hatte sich in der heißen Julinacht lange in den Hallen herumgetrieben als Künstler und Bummler, der das Pariser Nachtleben so gern beobachtete. Plötzlich fielen die Regentropfen schwer und dicht, daß er zu laufen begann und wie toll das Gréveufer entlangrannte. Doch bei der Louis-Philipp-Brücke blieb er stehen, ergrimmt über seinen atemlosen Lauf; diese Furcht vor dem Wasser schien ihm albern. In der dichten Finsternis, gepeitscht von dem Wolkenbruch, der die Gaslaternen in einen Schleier hüllte, ging er langsam mit schlenkernden Armen über die Brücke.
Übrigens hatte Claude nur mehr einige Schritte zu machen. Als er am Bourbonufer in die Sankt-Ludwig-Insel einbog, beleuchtete ein greller Blitz die gerade und flache Zeile alter Häuser an der Seine am Rande der schmalen Straße. Der Blitz warf seinen fahlen Schein auf die Scheiben der hohen, nicht durch Läden geschützten Fenster und beleuchtete die vornehme Düsterheit der alten Vorderseiten mit ihren sehr scharf sich abhebenden Einzelheiten: einen steinernen Erker, ein Terrassengeländer, das in Stein gemeißelte Gewinde eines Giebels. Hier hatte der Maler sein Atelier unter dem Dache des alten Palastes der Martoy an der Ecke der Kopflosen Frauengasse. Das Ufer, das er einen Augenblick gesehen, war wieder in Finsternis versunken, und ein furchtbarer Donnerschlag hatte das ganze schlafende Stadtviertel erschüttert.
Vor seiner Haustür – einer alten, runden, niedrigen, eisenbeschlagenen Pforte – suchte der durch den Regen geblendete Claude tastend den Knopf der Klingel; er fuhr überrascht zusammen, als seine Hand auf einen lebenden Körper stieß, der in einem Winkel an das Holz der Tür lehnte. Bei dem jähen Aufleuchten eines zweiten Blitzes gewahrte er ein großes, junges Mädchen, schwarz gekleidet, ganz durchnäßt, zitternd vor Angst. Als der Donnerschlag alle beide durchrüttelt hatte, rief er:
»Ei, ist das eine Überraschung! ... Wer sind Sie, und was wollen Sie?«
Er sah sie nicht; er hörte sie bloß schluchzen und stammeln:
»Ach, mein Herr, tun Sie mir nichts zuleide. Der Kutscher, den ich auf dem Bahnhofe genommen, hat mich ohne weiteres vor diese Tür abgesetzt und verlassen ... Unser Zug ist bei Nevers entgleist, wir hatten vier Stunden Verspätung: ich habe die Person nicht mehr gefunden, die mich erwarten sollte ... Mein Gott, ich bin zum erstenmal in Paris und weiß gar nicht, wo ich bin ...«
Ein blendender Blitz schnitt ihr das Wort ab; ihre weitgeöffneten Augen überblickten mit Schrecken diesen Winkel einer ihr unbekannten Stadt, gleichsam die in einem fahlen, bläulich-roten Lichte jählings auftauchende Erscheinung eines phantastischen Ortes. Der Regen hatte aufgehört. Jenseits der Seine lag das Ormesufer mit seiner langen Reihe kleiner, grauer Häuser, mit dem bunten Farbengemisch der Ladentüren unten und den scharf sich abzeichnenden Dächern von ungleicher Höhe oben, während der Horizont weiter und heller wurde links bis zu dem blauen Schieferdach des Rathauses, rechts bis zur bleigedeckten Kuppel der Sankt-Paulus-Kirche. Besonders erschreckte sie das Flußbett, der tiefe Graben, in dem die Seine schwärzlich dahinfloß von den massigen Pfeilern der Marienbrücke bis zu den leichtgeschwungenen Bogen der neuen Louis-Philipp-Brücke. Seltsam geformte Massen bedeckten das Wasser, eine schlummernde Flotille von Kähnen und Jollen, ein schwimmendes Waschhaus und ein Baggerschiff, die am Ufer verankert waren; weiterhin am andern Ufer mit Kohlen und Mühlsteinen beladene Kähne, überragt von dem Riesenarm eines gußeisernen Krahns. Alldas versank sogleich wieder in Finsternis.
»Irgendeine leichte Haut,« dachte sich Claude; »eine Dirne, die man auf die Straße geworfen, und die nun einen Mann sucht.«
Er mißtraute den Weibern. Die Geschichte von dem entgleisten, verspäteten Zuge und dem rohen Kutscher schien ihm eine lächerliche Erfindung. Bei dem Donnerschlag hatte das Mädchen sich entsetzt wieder in den Torwinkel gedrückt.
»Sie können aber doch nicht da übernachten«, hub er jetzt laut wieder an.
Sie weinte noch stärker und stammelte:
»Ach, mein Herr, ich bitte Sie, führen Sie mich nach Passy ... Ich will nach Passy.«
Er zuckte die Achseln; hielt sie ihn für einen Tölpel? Mechanisch hatte er sich nach dem Célestinufer umgewandt, wo ein Droschkenstandplatz war. Nicht eine Laterne schimmerte.
»Nach Passy wollen Sie, meine Liebe ... Warum nicht gleich nach Versailles? Wo, beim Teufel, soll man zu dieser Stunde und bei solchem Wetter einen Wagen finden?«
Doch von einem neuen Blitz geblendet, schrie sie hell auf; diesmal hatte sie die düstere Stadt in einem Blutmeer zu sehen geglaubt. Ein ungeheures Loch hatte sich aufgetan, die beiden Enden des Flusses verloren sich in unendlicher Ferne inmitten einer roten Feuersglut. Die geringsten Einzelheiten wurden sichtbar; man unterschied die schmalen geschlossenen Fensterläden am Ulmenufer, die beiden Einschnitte der Mauerstraße und der Pfauenstraße, welche die Häuserzeile unterbrachen; bei der Marienbrücke hätte man die Blätter der großen Platane zählen können, die hier ein Dickicht von herrlichem Grün bilden; während auf der anderen Seite unter der Louis-Philipp-Brücke die in vier Reihen verankerten Kähne mit ihrer schweren Last von gelben Äpfeln in dem jähen Blitzesleuchten aufzulodern schienen. Man sah auch den Wirbel des Wassers, den hohen Schlot des schwimmenden Waschhauses, die unbewegliche Kette des Baggers, mehrere Sandhaufen auf dem gegenüberliegenden Landungsplatze, ein seltsames Wirrsal von Dingen, eine ganze Welt, die den riesigen Fluß erfüllte, diesen von einem Horizonte zum andern sich hinziehenden Graben. Der Himmel erlosch; unter dem Tosen des Donners schien die Flut nur Finsternis fortzuwälzen.
»Ach, mein Gott, ich bin verloren! ... Ach, mein Gott, was soll aus mir werden?«
Jetzt setzte der Regen wieder ein, so heftig und von einem solchen Winde gepeitscht, daß er mit der Gewalt einer geöffneten Schleuse am Ufer dahinfegte.
»Lassen Sie mich eintreten,« sagte Claude; »es ist nicht mehr auszuhalten.«
Beide waren naß geworden. Bei dem matten Schein der Laterne, die an der nächsten Straßenecke in die Mauer eingelassen war, konnte er sehen, wie das Mädchen durch den an die Haustür prasselnden Regen bis auf die Haut durchnäßt war, daß ihr das Kleid am Leibe klebte. Er ward von Mitleid ergriffen: er hatte ja an einem ähnlichen Gewitterabend einen verlaufenen Hund vom Straßenpflaster aufgelesen. Aber er ärgerte sich wegen seiner Rührung; niemals führte er Mädchen in sein Heim; als ein Mensch, der die Frauenzimmer nicht kannte, behandelte er sie alle mit einer leidenden Schüchternheit, die er unter einer prahlerischen Roheit zu verbergen suchte. Sie hielt ihn wirklich für gar zu dumm, daß sie sich so an ihn hängte und ihm diese abenteuerliche Geschichte aufzuhalsen suchte, die aus einer Posse geholt zu sein schien.
»Nun ist's genug, kommen Sie mit hinauf«, sagte er schließlich ... »Sie übernachten bei mir.«
Sie erschrak noch mehr und wehrte sich.
»Bei Ihnen? Oh, mein Gott! Nein, nein, das ist unmöglich! ... Ich bitte Sie, mein Herr, führen Sie mich nach Passy; ich flehe Sie mit gefalteten Händen an.«
Da ward er aufgebracht. Wozu diese Umstände! Er hatte sie doch auf der Straße aufgelesen! Schon zweimal hatte er die Glocke gezogen; endlich ward geöffnet, und er schob die Unbekannte hinein.
»Nein, nein, mein Herr, ich sage nein ...«
Doch abermals ward sie durch einen Blitz geblendet, und als der Donner krachte, flüchtete sie mit einem Satze, ihrer Sinne nicht mächtig, in das Haus. Die schwere Pforte fiel wieder ins Schloß; sie stand in vollständiger Finsternis unter einer geräumigen Torwölbung.
»Ich bin's, Frau Joseph«, rief Claude der Pförtnerin zu.
Zu dem Mädchen gewendet, setzte er leise hinzu:
»Geben Sie mir die Hand, wir müssen den Hof durchschreiten.«
Verwirrt und willenlos wie sie war, reichte sie ihm die Hand, ohne länger Widerstand zu leisten. Seite an Seite rannten sie im strömenden Regen durch den Hof. Es war der geräumige Hof eines Herrenhauses mit steinernen Bogengängen, die sich im nächtlichen Dunkel verloren. Sie erreichten einen schmalen, offenen Flur; er ließ ihre Hand los, und sie hörte, wie er fluchend Zündhölzchen an eine Wand rieb. Alle waren naß geworden; man mußte tastend die Treppen erklettern.
»Fassen Sie das Geländer an und geben sie acht; die Stufen sind hoch.«
Die sehr enge Stiege – eine ehemalige Bedientenstiege – hatte drei sehr hohe Stockwerke, welche das Mädchen strauchelnd mit ungelenken, müden Beinen erklomm. Dann sagte er ihr, daß sie einen langen Korridor zu durchschreiten hätten; sie folgte ihm, mit beiden Händen an der Mauer entlang tastend, durch den schier endlosen Gang, der nach der Vorderseite des Hauses zurückführte. Jetzt galt es, abermals eine Stiege zu erklettern; aber diese führte nach dem Dachboden. Es war eine rampenlose, hölzerne Stiege mit knarrenden, wackeligen, steilen Stufen, den plump gefügten Brettern einer Mühlenleiter gleich. Der Treppenabsatz oben war so schmal, daß sie an den jungen Mann stieß, der eben seinen Schlüssel suchte. Endlich öffnete er.
»Treten Sie nicht ein, warten Sie; sonst würden Sie wieder anstoßen.«
Sie rührte sich nicht. Keuchend stand sie da mit hoch klopfendem Herzen, summenden Ohren, durch diesen Aufstieg in der Finsternis völlig erschöpft. Ihr war, als habe dieser Aufstieg stundenlang gewährt durch ein solches Wirrsal von Stockwerken, Gängen und Treppen, daß sie nimmer wieder hinunter finden werde. Sie vernahm aus dem Atelier das Geräusch von schweren Tritten, von herumtastenden Händen, von zu Boden fallenden Sachen, begleitet von einem dumpfen Ausruf. Jetzt erhellte sich die Tür. »Treten Sie ein; wir sind zu Hause.«
Sie trat ein und schaute, ohne zu sehen. Die einzige Kerze gab nur ein schwaches Licht in diesem Bodenraum von fünf Metern Höhe; es war mit allerlei Gegenständen angefüllt, deren große Schatten sich von den grau getünchten Mauern abhoben. Sie erkannte nichts; sie erhob die Augen zu dem mit Glasscheiben versehenen Dachfenster, auf das der Regen mit einem betäubenden Getöse niederfiel. Doch eben in diesem Augenblicke flammte am Himmel wieder ein Blitz auf, und der Donnerschlag folgte so knapp darauf, daß das Dach des Hauses entzweizugehen schien. Stumm und bleich sank das Mädchen auf einen Sessel.
»Das muß in der Nähe eingeschlagen haben«, murmelte Claude, der ebenfalls ein wenig blaß war. »Es war Zeit, daß wir heraufkamen; man ist hier besser aufgehoben als auf der Straße unten; nicht wahr?«
Er ging zur Tür und schloß sie geräuschvoll, während sie mit verblüffter Miene seinem Tun folgte.
»So; wir sind zu Hause«, sagte er.
Das Ungewitter war übrigens vorüber; man vernahm nur noch vereinzelte, ferne Donnerschläge, und auch der Regen hörte bald auf. Claude ward jetzt verlegen und betrachtete das Mädchen von der Seite. Sie schien nicht unschön und war jedenfalls jung, höchstens zwanzig Jahre alt. Das machte ihn vollends mißtrauisch, wenngleich er sich eines Zweifels nicht erwehren konnte, einer unbestimmten Empfindung, daß sie vielleicht doch nicht ganz gelogen habe. In jedem Falle nützte ihr die Schlauheit wenig, und sie täuschte sich, wenn sie ihn schon festzuhalten glaubte. Er übertrieb noch seine mürrische Haltung und sagte mit rauher Stimme:
»Gehen wir schlafen; dabei werden wir trocken.«
Ein Angstgefühl nötigte sie aufzustehen. Jetzt betrachtete auch sie ihn, ohne ihm ins Gesicht zu schauen; dieser magere Bursche mit den knochigen Gelenken und dem starken, bärtigen Kopfe verdoppelte ihre Angst; er war wie eine Figur aus einer Räubergeschichte mit seinem Hut von schwarzem Filz und seinem alten, kastanienfarbenen Überrock, der vom Regen ganz verwaschen ins Grüne spielte.
»Ich danke; ich fühle mich hier wohl und werde angekleidet schlafen«, murmelte sie.
»Wie, angekleidet? In diesen wassertriefenden Kleidern? Machen Sie doch keine Dummheiten! Entkleiden Sie sich sofort!«
Er schob mehrere Sessel zur Seite, um eine halb durchlöcherte spanische Wand freizumachen. Hinter dieser spanischen Wand bemerkte sie einen Toilettetisch und ein kleines eisernes Bett, von dem er jetzt die Decke wegnahm.
»Nein, nein, bemühen Sie sich nicht; ich versichere Ihnen, daß ich hier bleibe.«
Da ward er wieder grimmig, fuchtelte mit den Händen und schlug mit den Fäusten auf die Möbel.
»Lassen Sie mich doch schließlich in Frieden!« rief er. »Ich überlasse Ihnen mein Bett, was wollen Sie mehr? Spielen Sie doch nicht die Schüchterne, das ist unnütz. Ich schlafe auf dem Sofa.«
Er hatte sich ihr mit einer drohenden Miene wieder genähert. Erschrocken und in der Meinung, daß er sie schlagen wolle, begann sie ihren Hut abzulegen. Von ihren Röcken rieselte das Wasser auf den Boden. Er brummte weiter, aber ein Bedenken überkam ihn, und er sagte schließlich, gleichsam um ein Zugeständnis zu machen:
»Wenn Sie einen Widerwillen haben, will ich die Betttücher wechseln.«
Schon riß er die Bettücher weg und schleuderte sie auf das Sofa, das am andern Ende des Ateliers stand. Dann holte er aus einem Schrank ein paar neue und machte selbst das Bett mit der Behendigkeit eines jungen Menschen, der mit diesen Verrichtungen vertraut ist. Mit sorgfältiger Hand schob er an der Mauerseite die Decke in das Bett, legte das Kopfkissen zurecht und schlug die Betttücher zurück.
»So, Ihr Lager ist bereit«, sagte er.
Weil sie noch immer stumm und unbeweglich dasaß und an dem Leibchen herumtastete, das sie nicht aufzuknöpfen wagte, schloß er sie hinter der spanischen Wand ein. Mein Gott, wie verschämt! Scheltend und brummend ging auch er schlafen; er warf die Bettücher auf das Sofa hin, hängte seine Kleider an eine alte Staffelei und streckte sich auf dem Rücken aus. Doch in dem Augenblicke, als er das Licht ausblasen wollte, fiel ihm ein, daß sie nicht genügend sehe, und wartete. Zuerst vernahm er keine Bewegung; ohne Zweifel stand sie noch an derselben Stelle, an das eiserne Bett gelehnt. Dann hörte er ein leises Geräusch von Stoffen, langsame, gedämpfte Bewegungen, als habe sie zehnmal wieder angefangen, auch ihrerseits horchend, beunruhigt durch das Licht, das nicht verlöschen wollte. Endlich hörte er nach langen Minuten ein leises Knirschen des Bettes, dann trat Stille ein.
»Liegen Sie bequem, Fräulein?« fragte Claude mit viel sanfterer Stimme.
Sie antwortete mit einem kaum vernehmlichen Hauche, noch zitternd vor Aufregung.
»Ja, mein Herr, es ist ganz gut so.«
»Gute Nacht denn!«
»Gute Nacht!«
Er blies die Kerze aus, der Raum verfiel wieder in tiefe Stille. Trotz seiner Müdigkeit öffnete er sogleich wieder die Augen; er fand keinen Schlaf und blickte nach dem breiten Fenster. Der Himmel war wieder sehr klar geworden; er sah in der heißen Julinacht die Sterne funkeln; trotz des Gewitters war die Hitze so groß geblieben, daß er schier zu vergehen glaubte, obgleich er die nackten Arme unter dem Bettlaken hervorgezogen hatte. Dieses Mädchen beschäftigte ihn; ein innerer Kampf wogte in ihm: die Mißachtung, die er so gern zur Schau trug, die Furcht, Schwierigkeiten zu haben, wenn er nachgebe, die Besorgnis, lächerlich zu erscheinen, wenn er die Gelegenheit nicht ausnütze. Doch die Mißachtung trug den Sieg davon; er hielt sich für sehr stark; er ersann einen ganzen Roman, der ihn um seine Ruhe bringen sollte, und lachte stillvergnügt, weil er die Versuchung zunichte gemacht. Die Hitze ward ihm unerträglich, und er zog auch die Beine hervor. Mit schwerem Kopfe verfolgte er im Halbschlummer am tiefblauen Grunde der blinkenden Sternlein verliebte, nackte Frauengestalten, das ganze lebendige Fleisch des Weibes, das er anbetete.
Dann verwirrten sich seine Gedanken noch mehr. Was machte sie? Lange hatte er geglaubt, sie sei eingeschlafen, denn er hörte sie nicht einmal atmen; jetzt aber hörte er sie sich umdrehen, – gleich ihm – mit unendlicher Vorsicht, mit zurückgehaltenem Atem. Wenig praktisch hinsichtlich der Frauen suchte er Vernunft in die Geschichte zu bringen, die sie ihm erzählt hatte, betroffen und verwirrt durch gewisse Einzelheiten; allein seine ganze Logik ließ ihn im Stiche. Was frommte es auch, sich unnützerweise den Kopf zu zerbrechen? Er wollte von ihr nichts, also war es ihm auch gleichgültig, ob sie die Wahrheit gesprochen oder gelogen habe. Morgen werde sie ihrer Wege gehen; guten Tag, gute Nacht; aus und vorüber; man werde sich trennen auf Nimmerwiedersehen. Erst bei Tagesanbruch, als die Sterne am Himmel erblaßten, fand er seinen Schlaf. Sie wälzte sich hinter ihrer spanischen Wand noch immer herum trotz der erdrückenden Müdigkeit; die schwüle Luft unter dem durchhitzten Zinkdache war ihr eine schwere Marter; sie tat sich jetzt weniger Zwang an, machte eine plötzliche Bewegung voll nervöser Ungeduld und stieß einen Seufzer aus, den Seufzer einer Jungfrau, die sich erregt und unbehaglich fühlte in der Nähe dieses schlafenden Mannes.
Als Claude am andern Morgen erwachte, blinzelte er mit den Augen. Es war sehr spät, und ein breites Feld von Sonnenlicht fiel durch das Glasfenster herein. Es gehörte zu seinen Ansichten, daß die jungen Freilichtmaler die Ateliers mieten müßten, die von den akademischen Malern verschmäht werden, die Kunstwerkstätten, welche die Sonne mit der lebendigen Flamme ihrer Strahlen aufsucht. Doch ein erstes Erstaunen zwang ihn sich aufzusetzen, wobei er die nackten Beine vom Sofa herabhängen ließ. Warum hatte er auf diesem Sofa geschlafen? Er blickte mit den noch schlaftrunkenen Augen in dem Raume herum und bemerkte ein Bündel Frauenröcke, hinter der spanischen Wand halb verborgen. Ach ja, dieses Mädchen! Er erinnerte sich jetzt. Er horchte und hörte die langen, regelmäßigen Atemzüge eines behaglich schlafenden Kindes. Gut; sie schlief noch immer und so ruhig, daß es schade wäre, sie zu wecken. Mit wüstem Kopfe saß er da und kratzte sich die Beine, verdrossen wegen dieses Abenteuers, das ihn um seine Vormittagsarbeit zu bringen drohte. Ihn ärgerte seine Mildherzigkeit; das beste wäre, sie abzuschütteln, damit sie sogleich ihrer Wege gehe. Indes streifte er sachte ein Beinkleid über, schlüpfte in seine Pantoffeln und begann auf den Fußspitzen im Atelier herumzugehen.
Als die Wanduhr die neunte Morgenstunde schlug, machte Claude eine unruhige Bewegung. Aber es rührte sich nichts; das ruhige Atemholen dauerte fort. Da dachte er, es sei das beste, wenn er an sein großes Gemälde gehe; er werde sein Frühstück später zu sich nehmen, wenn er sich freier bewegen könne. Doch er kam zu keinem Entschlusse. Er, der hier in einem abscheulichen Durcheinander zu leben gewohnt war, fühlte sich beengt durch die Frauenröcke, die in einem Bündel zu Boden geglitten waren. Von ihnen war Wasser abgeflossen, und die Kleider waren noch immer feucht. Ein Brummen unterdrückend, las er sie schließlich einzeln vom Boden auf und breitete sie im Sonnenschein auf Sesseln zum Trocknen aus. Wie konnte man nur so alles durcheinander hinwerfen! So werde es niemals trocknen und sie nicht fortgehen können! Er drehte diese Frauengewänder hin und her, verwickelte sich in dem Leibchen von schwarzem Wollstoff, kroch auf allen Vieren herum, um die Strümpfe zusammenzusuchen, die hinter einer alten Leinwand am Boden lagen. Es waren Strümpfe von aschgrauem schottischem Garn, lang und fein; er betrachtete sie, bevor er sie aufhob. Der Saum des Kleides hatte sie durchnäßt; er zog sie straff, suchte sie in seinen warmen Händen zu trocknen, um das Frauenzimmer sobald wie möglich loszuwerden.
Schon seitdem er aufgestanden, war Claude von der Neugier versucht, die spanische Wand zu entfernen und zu schauen. Diese Neugier, die er töricht fand, erhöhte noch seine üble Laune. Endlich ergriff er mit dem ihm eigentümlichen Achselzucken seine Pinsel; da ward ein Stammeln von unzusammenhängenden Worten und ein lautes Rauschen von Linnen hörbar. Dann begann das sanfte Atemholen wieder; diesmal gab er der Neugierde nach, legte die Pinsel hin und schaute über die spanische Wand. Doch was er erblickte, bannte ihn auf dem Flecke fest.
»Alle Wetter! Alle Wetter!« murmelte er in stillem Entzücken.
In der Treibhaushitze, die durch die Fensterscheiben hereindrang, hatte das Mädchen das Bettlaken zurückgeworfen; nach den schlaflos verbrachten Nächten von der Ermattung niedergedrückt schlief sie, in Licht gebadet, so bewußtlos, daß nicht das leiseste Zittern über ihre reine Blöße flog. Während der Aufregung und Schlaflosigkeit der ersten Stunden mußten die Achselknöpfe ihres Hemdes sich gelöst haben; der ganze linke Ärmel war herabgeglitten, so daß die Brust entblößt war. Es war ein goldangehauchtes Fleisch von der Feinheit der Seide, der Frühling des Fleisches, zwei feste, kleine Brüste, strotzend von Saft, mit zwei blassen Rosenknospen. Sie hatte den rechten Arm unter den Nacken gelegt, das schlafende Haupt fiel zurück, die Brust bot sich in einer reizend-lässigen Linie den Blicken dar; während ihre aufgelösten schwarzen Haare ihr gleichsam ein dunkler Mantel waren.
»Alle Wetter! ist sie aber sehr hübsch!«
Es war die Gestalt, vollkommen die Gestalt, die er bisher vergebens für sein Gemälde gesucht hatte; und sie hatte fast die gewünschte Pose. Etwas kindlich-schmächtig, aber so geschmeidig und jugendlich frisch! Dabei ein schon reifer Busen. Wo hatte sie ihn gestern verborgen, diesen Busen, daß er ihn nicht erraten hatte? Ein wahrer Glücksfund!
Claude eilte auf den Fußspitzen zu seiner Pastellbüchse und holte daraus ein Blatt Papier. Dann nahm er auf einem niedrigen Sessel Platz, legte einen Karton auf seine Knie und begann mit glückseliger Miene zu zeichnen. Seine ganze Verwirrung, seine fleischliche Neugier, sein unterdrücktes Verlangen: sie gingen in diesem Entzücken des Künstlers auf, in dieser Begeisterung für die schönen Töne und die wohlgebildeten Glieder. Schon hatte er das Mädchen vergessen; er war voll Entzücken über diesen schneeigen Busen, der dem zarten Ambraton der Schultern seinen hellen Schimmer lieh. Eine ängstliche Bescheidenheit machte ihn klein angesichts der Natur; er zog die Ellbogen ein und ward wieder ein kleiner Junge, sehr artig, aufmerksam und respektvoll. Das dauerte nahezu eine Viertelstunde; zuweilen hielt er inne und blinzelte mit den Augen. Doch er fürchtete, daß sie sich bewegen könne, und machte sich rasch wieder an die Arbeit, den Atem zurückhaltend, um sie nicht zu erwecken.
Doch während er der Arbeit oblag, durchschwirrten allerlei unklare Gedanken seinen Kopf. Wer mochte sie sein? Sicherlich keine Landstreicherin, wie er gedacht hatte; dazu war sie zu frisch. Aber warum hatte sie ihm eine so wenig glaubwürdige Geschichte aufgetischt? Er bildete sich noch andere Geschichten ein: ein unerfahrenes junges Mädchen, das mit dem ersten Liebhaber nach Paris geflohen und von ihm hier verlassen war; eine junge Person aus dem Bürgerstande, die von einer Freundin dem Laster zugeführt war und jetzt nicht zu den Eltern zurückzukehren wagte; oder ein noch verwickelteres Drama, ganz außerordentliche Ausschweifungen von jungen Mädchen, furchtbare Sachen, die er nie erfahren werde. Diese Vermutungen vermehrten noch seine Ungewißheit. Er ging jetzt daran, eine Skizze des Gesichtes anzufertigen und studierte sorgfältig die Schläferin. Der obere Teil des Gesichtes drückte große Güte und Sanftmut aus; die Stirn war von einer fast durchsichtigen Klarheit und spiegelglatt, die Nase klein mit feinen, nervösen Flügeln; man erriet ordentlich das Lächeln der Augen unter den Augenlidern, ein Lächeln, welches das ganze Gesicht erhellen mußte; der untere Teil des Gesichtes jedoch verdarb diesen Eindruck strahlender Zartheit; die Kinnlade sprang hervor, die Lippen waren zu dick und zu rot und ließen starke, weiße Zähne sehen. In diesen verschwimmenden Zügen einer kindlichen Zartheit lag gleichsam ein Zug von Leidenschaft, von unbewußt drängender Reife.
Plötzlich flog ein Zittern – gleich einem Kräuseln – über den Samt ihrer Haut. Vielleicht hatte sie endlich diesen forschenden Mannesblick gefühlt. Sie öffnete die Augen weit und stieß einen Schrei aus.
»Ach, mein Gott!«
Sie war starr vor Entsetzen, als sie diesen ihr unbekannten Ort erblickte und den jungen Mann in Hemdärmeln, der vor ihr hockte und sie schier mit den Augen verzehrte. Dann zog sie in wilder Hast die Decke herauf und preßte sie mit beiden Händen auf ihre Brust; ihr Blut ward von einer so schamhaften Beklemmung gepeitscht, daß die flammende Röte ihrer Wangen sich in rosiger Flut bis in die Spitze ihres Busens ergoß.
»Nun, was ist?« rief Claude verdrossen, mit dem Stift in der Luft. »Was ficht Sie an?«
Sie sprach nicht mehr, sie bewegte sich nicht mehr; die Decke bis an den Hals hinaufgezogen, drückte sie sich fest ins Bett, kaum eine Erhöhung auf dem Lager bildend.
»Ich fresse Sie nicht ... Seien Sie doch artig und nehmen Sie die frühere Lage wieder an.«
Ein neuer Blutstrom ergoß sich bis an ihre Ohren.
»O nein, o nein!« stammelte sie endlich.
Doch er wurde allmählich wütend und geriet in eine jener Zornesaufwallungen, die bei ihm häufig waren. Dieser Eigensinn schien ihm blöd.
»Was kann es Ihnen schaden?« fuhr er fort. »Welch' großes Unglück, wenn ich weiß, wie Sie beschaffen sind! Ich habe schon andere gesehen.«
Da brach sie in ein Schluchzen aus, und seine Wut stieg immer höher. Verzweifelt saß er da, außer sich gebracht durch den Gedanken, daß er seine Zeichnung nicht vollenden, daß die falsche Scham dieses Mädchens ihn hindern werde, eine gute Studie für sein Gemälde zu haben.
»Sie wollen nicht? Aber das ist dumm! Für wen halten Sie mich denn? Habe ich Sie auch nur berührt? Hätte ich an Dummheiten gedacht, so hätte ich in der Nacht wohl gute Gelegenheit gehabt ... Aber ich kümmere mich wenig um solche Dinge, meine Liebe! Sie können mir getrost alles zeigen ... Hören Sie, es ist nicht sehr artig von Ihnen, mir diesen Dienst zu verweigern; denn schließlich habe ich Sie doch von der Straße heraufgeholt, und Sie haben in meinem Bette geschlafen.«
Sie weinte jetzt noch stärker und hielt den Kopf ganz in Kissen verborgen.
»Ich versichere Ihnen, ich brauche diese Studie, sonst würde ich Sie nicht länger quälen.«
Die vielen Tränen überraschten ihn, und er schämte sich seiner Rauheit. Er schwieg verlegen und ließ ihr Zeit, sich ein wenig zu beruhigen. Dann begann er wieder mit sehr sanfter Stimme:
»Gut, wenn es Sie kränkt, reden wir nicht weiter davon ... Aber wenn Sie wüßten! Ich habe da eine Figur auf meinem Bilde, die nicht vorwärts wollte, und Sie waren so recht in der gesuchten Lage! Wenn es sich um dieses verdammte Bild handelt, könnte ich Vater und Mutter erwürgen ... Sie werden mich daher entschuldigen, nicht wahr? ... Wenn Sie liebenswürdig sein wollten, würden Sie mir noch einige Minuten schenken. Nein, nein, bleiben Sie ruhig; nicht den Rumpf, ich verlange nicht den Rumpf. Nur den Kopf; wenn ich wenigstens den Kopf beenden könnte! ... Ich bitte Sie, seien Sie liebenswürdig; legen Sie Ihren Arm wieder so, wie er war; ich will Ihnen mein Leben lang dankbar sein!«
Jetzt flehte er und fuchtelte in Mitleid erweckender Weise mit seinem Bleistift herum in der Erregtheit seines mächtigen künstlerischen Verlangens. Übrigens hatte er sich nicht von der Stelle gerührt; er saß noch immer auf seinen niedrigen Sessel fern von ihr. Da faßte sie endlich Mut und enthüllte ihr ruhiger gewordenes Antlitz. Was konnte sie machen? Sie war in seiner Gewalt, und er schien überdies so unglücklich! Aber noch zögerte sie in einer letzten Regung der Scham. Langsam, ohne ein Wort zu sagen, streckte sie ihren nackten Arm hervor und schob ihn von neuem unter ihren Kopf, während die andere, verborgen bleibende Hand sorgfältig die Decke um den Hals festhielt.
»Wie gütig Sie sind! Ich will mich sputen; Sie werden sogleich frei sein.«
Er hatte sich über seine Zeichnung gebeugt und warf ihr nur mehr seine hellen Malerblicke zu; das Weib war für ihn verschwunden, er sah nur noch das Modell. Zuerst war sie ganz rot geworden; die Empfindung ihres nackten Armes, dieses Wenigen ihrer selbst, das sie auf einem Ball ganz harmlos gezeigt hätte, erfüllte sie mit Verwirrung. Überdies schien ihr dieser junge Mann so vernünftig, daß sie sich beruhigte; ihre Wangen verloren die flammende Röte, ihr Mund die Spannung; ein schwaches Lächeln des Zutrauens kräuselte ihre Lippen. Jetzt beobachtete auch sie ihn zwischen den halbgeschlossenen Augenlidern. Wie sehr hatte er sie gestern erschreckt mit seinem starken Barte, seinem großen Kopfe, seinen zornigen Gebärden! Und doch war er nicht häßlich; sie entdeckte auf dem Grunde seiner braunen Augen eine große Zärtlichkeit, während seine Nase sie überraschte, eine zarte Frauennase, die sich in den starrenden Haaren des Schnurrbartes verlor. Ein unruhiges, nervöses Beben schüttelte ihn, eine fortwährende Leidenschaft, welche den Stift in seinen dünnen Fingern zu beleben schien und sie sehr rührte, ohne zu wissen warum. Das konnte kein schlechter Mensch sein; seine Rauheit war wohl nur die der Schüchternen. Sie konnte sich all dies nicht so deutlich erklären, aber sie fühlte es und beruhigte sich, als sei sie bei einem Freunde.
Das Atelier – allerdings – erschreckte sie noch immer. Mit klugen Blicken betrachtete sie den Raum und war erstaunt über ein solches Maß von Unordnung und Vernachlässigung. Vor dem Ofen lag noch die Asche vom letzten Winter in einem Haufen. Außer dem Bett, dem kleinen Toilettentisch und dem Sofa waren keine anderen Möbel da als ein alter, aus den Fugen geratener Schrank von Eichenholz und ein großer Tisch von weichem Holze, bedeckt mit Pinseln, Farben, schmutzigen Tellern und einer Spirituskochmaschine, auf der noch eine Schüssel mit Nudelresten stand. Zwischen wackeligen Staffeleien standen überall zerrissene Strohsessel herum. Neben dem Sofa lag die Kerze von gestern am Boden in einem Winkel, der wohl nur alle Monate einmal reingefegt wurde. Nur die große, mit roten Blumen bemalte Kuckucksuhr mit ihrem hellen Tick-Tack brachte einen sauberen, heiteren Ton in diesen Raum. Doch hauptsächlich erschreckten sie die an den Wänden hängenden rahmenlosen Skizzen, eine dichte Menge von Skizzen, die bis zum Boden reichten und sich daselbst zu einem Haufen bunt durcheinander hingeworfener Leinwand auftürmten. Niemals hatte sie eine so erschreckende, grobe, schreiende Malerei gesehen, so grell in den Farben, daß sie sie verletzte wie der Fluch eines Kärrners, der vor der Tür einer Schenke ausgestoßen wird. Sie senkte die Blicke, ward aber doch angezogen durch ein umgekehrtes Bild, sicherlich das große Gemälde, an dem der Maler arbeitete und das er jeden Abend an die Mauer schob, um es am nächsten Morgen mit der Frische des ersten Blicks besser beurteilen zu können. Was mochte dieses Bild verbergen, daß man nicht wagte, es zu zeigen? Und das Feld von flammendem Sonnenlicht, das durch die Glasscheiben hereinfiel, wanderte durch den Raum, nicht durch den kleinsten Vorhang gedämpft, wie flüssiges Gold ergoß es sich über all diese Möbeltrümmer, wodurch ihre sorglose Dürftigkeit nur noch mehr in die Augen gerückt wurde.
Claude empfand die Stille nachgerade drückend. Er wollte etwas sagen – gleichviel was – um höflich zu sein und sie in ihrer Lage zu zerstreuen. Aber er sann vergebens nach; er fand nichts als die Frage:
»Wie heißen Sie?«
Sie öffnete die Augen, die sie, wie von Schläfrigkeit wieder erfaßt, geschlossen hatte.
»Christine«, antwortete sie.
Er war erstaunt. Auch er hatte seinen Namen noch nicht genannt. Seit gestern abend befanden sie sich Seite an Seite, ohne einander zu kennen.
»Ich heiße Claude«, sagte er.
Als er sie in diesem Augenblicke betrachtete, sah er sie in ein allerliebstes Lachen ausbrechen. Es war der neckische Ausbruch eines noch kindlichen großen Mädchens. Dieser verspätete Austausch ihrer Namen schien ihr drollig. Dann wieder erheiterte sie ein anderer Gedanke.
»Schau, Claude und Christine: beide Namen beginnen mit demselben Buchstaben.«
Wieder trat eine Stille ein. Er blinzelte mit den Augen und vergaß sich; es wollte ihm nichts mehr einfallen. Aber er glaubte eine Regung ungeduldigen Mißbehagens an ihr wahrzunehmen und sagte aus Furcht, daß sie sich vielleicht bewegen könne, auf gut Glück, nur um sie zu beschäftigen:
»Es ist ein wenig heiß.«
Diesmal erstickte sie ihr Lachen, jene angeborene Heiterkeit, die gegen ihren Willen immer wiederkehrte und losbrach, seitdem sie sich beruhigt hatte. Die Hitze ward so stark, daß sie in dem Bette sich wie in einem Bade befand mit feuchter, erblassender Haut von der Milchblässe der Kamelien.
»Ja, ein wenig heiß«, erwiderte sie ernst, während ihre Augen sich aufheiterten.
Claude schloß mit gutmütiger Miene:
»Das macht die frei eindringende Sonne. Aber es tut so wohl, ein Stück Sonne auf die Haut. Gestern nacht unter dem Haustor hätte uns etwas Sonne wohlgetan, wie?«
Darüber lachten beide hell auf. Entzückt, endlich einen Unterhaltungsstoff gefunden zu haben, fragte er sie über ihr Abenteuer aus ohne Neugierde, unbekümmert um die Wahrheit, bloß um die Sitzung zu verlängern.
Einfach in wenigen Worten erzählte Christine die Begebenheiten. Gestern morgen hatte sie Clermont verlassen, um nach Paris zu kommen, wo sie als Vorleserin bei Frau Vanzade eintreten sollte, der Witwe eines Generals, einer sehr reichen alten Dame, die in Passy wohnte. Der Zug sollte fahrplanmäßig um neun Uhr zehn Minuten abends ankommen, und es waren alle Empfangsmaßnahmen getroffen; eine Kammerfrau sollte sie erwarten, man hatte sogar brieflich ein Erkennungszeichen vereinbart: eine graue Feder auf ihrem schwarzen Hute. Allein unterhalb Nevers war der Zug auf einen entgleisten Güterzug gestoßen, dessen Wagen die Bahn verlegten. Das war der Beginn einer ganzen Reihe von widrigen Zufällen und Verspätungen, vor allem mußten sie endlos warten in den festgehaltenen Wagen; dann war man genötigt, mit Zurücklassung seines Gepäcks auszusteigen und drei Kilometer zu Fuß zu gehen, um eine Station zu erreichen, wo man einen Hilfszug zusammenzustellen sich entschlossen hatte. Damit hatte man zwei Stunden verloren, weitere zwei Stunden durch die Verwirrung, welche der Eisenbahnunfall auf der ganzen Linie verursacht hatte; so daß man erst um ein Uhr morgens – mit vierstündiger Verspätung – in Paris anlangte.
»Das war ein Unglück!« sagte Claude noch immer ungläubig, aber doch von einem Zweifel erfaßt und überrascht von der natürlichen Art, wie die Verwicklungen dieser Geschichte sich lösten. »Natürlich hat Sie niemand mehr erwartet?«
In der Tat hatte Christine die Kammerfrau der Frau Vanzade nicht mehr angetroffen; sie war ohne Zweifel des Wartens überdrüssig geworden. Sie schilderte ihre Angst auf dem Lyoner Bahnhofe, in dieser großen, ihr fremden, schwarzen, leeren Halle, die zu dieser späten Nachtstunde sich alsbald leerte. Anfänglich hatte sie nicht gewagt, einen Wagen zu nehmen, war mit ihrer kleinen Tasche auf und ab gegangen in der Hoffnung, daß jemand kommen werde. Dann hatte sie sich dazu entschlossen, aber zu spät, denn es war nur mehr ein einziger Kutscher da, ein sehr schmutziger, betrunkener Kerl, der sie umschlich und mit höhnischer Miene seine Dienste anbot.
»Ja, ein Bummler«, sagte Claude, der sich jetzt interessierte, als sei er Zeuge der Verwirklichung eines Märchens. Und Sie sind in seinen Wagen eingestiegen?«
Die Augen zur Decke gerichtet, fuhr Christine fort, ohne ihre Lage aufzugeben:
»Er hat mich dazu genötigt. Er nannte mich seine ›Kleine‹, und ich hatte Furcht vor ihm. Als er erfuhr, daß ich nach Passy wollte, geriet er in Wut und hieb so grimmig auf sein Pferd ein, daß ich mich an die Wagentüren klammern mußte. Dann beruhigte ich mich ein wenig, denn die Droschke rollte sanft durch beleuchtete Straßen, und ich sah Menschen auf den Fußwegen. Endlich erkannte ich die Seine. Ich war noch niemals in Paris; aber ich hatte einen Plan der Stadt gesehen ... Ich dachte, er werde am Ufer entlangfahren, als ich zu meinem neuerlichen Schrecken wahrnahm, daß wir über eine Brücke fuhren. Es begann eben zu regnen, und der Fiaker bog an einen sehr finstern Ort ein, wo er plötzlich anhielt. Der Kutscher war vom Bocke gesprungen und wollte zu mir in den Wagen. Er sagte, es regne zu stark ...«
Claude lachte. Er zweifelte nicht länger; diesen Kutscher konnte sie nicht erfunden haben. Als sie verlegen schwieg, bemerkte er:
»Gut, gut, der Kerl machte sich einen Spaß.«
»Sogleich sprang ich durch die andere Tür auf das Pflaster. Da fluchte er und sagte mir, wir seien angekommen; er werde mir den Hut vom Kopfe reißen, wenn ich ihn nicht bezahlte ... Der Regen fiel in Strömen, das Ufer war völlig menschenleer. Ich verlor den Kopf, zog ein Fünffrankenstück aus der Tasche und reichte es ihm; er hieb auf sein Pferd ein und fuhr davon, wobei er meine Handtasche mitnahm, die glücklicherweise nichts anderes enthielt als zwei Taschentücher, einen halben Kuchen und den Schlüssel zu meinem unterwegs zurückgelassenen Reisekoffer.«
»Aber man merkt sich die Nummer der Droschke!« rief der Maler entrüstet.
Er erinnerte sich jetzt, von einer vorüberrasenden Droschke gestreift zu sein, als er vom Wolkenbruch gejagt, über die Louis-Philipp-Brücke geeilt war. Er war erstaunt, wie unwahrscheinlich doch oft die Wahrheit ist. Was er als einfach und logisch ersonnen hatte, war blöd neben diesem natürlichen Laufe der endlosen Verwicklungen des Lebens.
»Sie können sich denken,« schloß Christine, »in welcher Gemütsverfassung ich unter diesem Haustor Schutz gesucht hatte. Ich wußte wohl, daß ich nicht in Passy sei und hier in diesem furchtbaren Paris die Nacht werde zubringen müssen. Und diese Donnerschläge und diese Blitze! Ach, die blauen und roten Blitze, die mich so schreckliche Dinge sehen ließen!«
Ihre Augenlider hatten sich von neuem geschlossen; ein Frösteln ließ ihr Antlitz erbleichen; sie sah die Schreckensstadt wieder, die ungeheure Höhlung der Ufer, die sich in der Flammenröte eines Ofens verlor, den tiefen Graben des Flusses, der bleigraue Gewässer dahinwälzte und bedeckt war mit großen, schwarzen Körpern, mit Kähnen, die toten Walfischen glichen, mit unbeweglichen Krahnen, die ihre Galgenarme von sich streckten. War das ein Willkomm!
Stille trat ein. Claude hatte sich wieder an seine Zeichnung gemacht. Doch sie bewegte sich jetzt, ihr Arm war steif geworden.
»Den Ellbogen ein wenig tiefer, bitte.«
Wie um sich zu entschuldigen, fragte er dann in teilnahmsvollem Tone:
»Ihre Eltern werden durch die Nachricht der Katastrophe sehr bestürzt sein.«
»Ich habe keine Eltern.«
»Wie, weder Vater noch Mutter? Sie sind allein?«
»Ja, ganz allein.«
Sie war achtzehn Jahre alt, in Straßburg geboren als Tochter eines Kapitäns Fallegrain, der dort in Garnison war. Sie war nicht ganz zwölf Jahre alt, als ihr Vater, ein Gascogner aus Montauban, zu Clermont starb, wohin er infolge einer Lähmung der Beine sich zurückzuziehen genötigt gewesen. Ihre Mutter, eine Pariserin, hatte fast fünf Jahre lang in der Provinz von ihrer magern Pension gelebt und sich durch Fächermalereien etwas Geld verdient, um ihrer Tochter eine gute Erziehung geben zu können. Seit fünfzehn Monaten war auch die Mutter tot; sie hatte ihr Kind allein in der Welt zurückgelassen ohne einen Sou. Christine hatte keine andere Stütze als die Oberin des Klosters der Schwestern der Heimsuchung zu Clermont. Aus Freundschaft für ihre verstorbene Mutter hatten sie das verwaiste Mädchen im Kloster behalten. Von da war sie geradeswegs nach Paris gekommen, denn es war der Oberin gelungen, ihr einen Platz als Vorleserin bei ihrer alten Freundin, der fast ganz erblindeten Frau Vanzade, zu finden.
Claude blieb stumm, als er diese neuen Einzelheiten hörte. Dieses Kloster, diese wohlerzogene Waise, dieses romantische Abenteuer: sie versetzten ihn wieder in Verlegenheit, und er ward wieder linkisch in Worten und Gebärden. Er hielt in seiner Arbeit inne und heftete die gesenkten Blicke auf seinen Entwurf.
»Ist Clermont hübsch?« fragte er.
»Nicht sehr; eine schwarze Stadt. Ich weiß übrigens nicht; ich bin nur selten ausgegangen.«
Sie hatte jetzt den Ellbogen auf das Kopfkissen gestützt und fuhr in leisem Tone fort mit einer Stimme, durch die noch ihre Trauer hindurchklang.
»Mama war nicht stark und tötete sich durch die Arbeit ... Sie verzärtelte mich; nichts war für mich zu gut; ich hatte Lehrer für alle Fächer. Aber ich zog wenig Nutzen daraus; zuerst war ich krank geworden, dann war ich nicht aufmerksam genug, stets unbesonnen, zu Spiel und Scherz geneigt ... Die Musik langweilte mich; das Klavierspiel verursachte mir Krämpfe in den Armen. Mit der Malerei ging es noch am besten ...«
Er blickte überrascht auf und rief:
»Wie, Sie können malen?«
»O nein, ich kann nichts, gar nichts. Mama hatte sehr viel Talent und unterwies mich ein wenig in der Aquarellmalerei. Ich half ihr den Hintergrund auf den Fächern malen. Sie malte so schöne Fächer!«
Sie warf unwillkürlich einen Blick umher auf die erschreckenden Skizzen, die an den Mauern flammten; und ihre hellen Augen wurden durch das unruhige Erstaunen über diese grobe Malerei getrübt. Von fern sah sie umgekehrt die Studie, welche der Maler von ihr entworfen hatte, dermaßen verblüfft von den grellen Tönen, von den großen, durch die Schatten säbelnden Pastellstrichen, daß sie nicht den Mut hatte zu verlangen, die Skizze in der Nähe zu besehen. Sie fühlte sich übrigens unbehaglich in diesem heißen Bette und warf sich unruhig herum; es drängte sie fortzugehen und ein Ende zu machen mit diesen Dingen, die ihr ein seit gestern begonnener Traum schienen.
Ohne Zweifel bemerkte Claude diese ihre nervöse Ungeduld. Ein Gefühl der Scham und des Bedauerns überkam ihn plötzlich. Er ließ seine unvollendete Zeichnung im Stiche und sagte sehr rasch:
»Vielen Dank für Ihre Gefälligkeit, mein Fräulein ... Verzeihen Sie mir; ich habe Ihre Geduld mißbraucht. Stehen Sie auf, bitte; es ist Zeit, daß Sie Ihren Angelegenheiten nachgehen.«
Ohne zu begreifen, weshalb sie sich nicht entschließen konnte, vielmehr ihren nackten Arm verbarg, während er ihr so eifrig zuredete, wiederholte er, sie solle aufstehen. Dann machte er eine wütende Gebärde, stellte den Wandschirm wieder hin und eilte an das entgegengesetzte Ende des Ateliers in einem übertriebenen Schamgefühl, daß er mit seinem Kochgeschirr ein lautes Geklapper machte, damit sie vom Bette aufstehen und sich ankleiden könne, ohne Furcht gehört zu werden.
In dem Getöse, das er anrichtete, überhörte er ihre zögernde Stimme:
»Mein Herr! Mein Herr! ...«
Endlich lauschte er.
»Mein Herr, wenn Sie so gefällig sein wollten ... Ich finde meine Strümpfe nicht ...«
Er eilte hin. Wo hatte er nur seinen Kopf? Was sollte sie denn anfangen im Hemde hinter diesem Wandschirm ohne Strümpfe und ohne Röcke, die er zum Trocknen ausgebreitet hatte? Die Strümpfe waren trocken; er versicherte sich dessen, indem er sie sanft in den Händen rieb; dann reichte er sie über die dünne Wand hinüber, wobei er zum letzten Male den nackten Arm erblickte, einen frischen runden Arm von kindlicher Lieblichkeit. Dann warf er die Röcke auf das Bettende, schob die Schuhe näher hin und ließ nur den Hut an einer Staffelei hängen. Sie hatte gedankt und sprach nicht mehr; er konnte kaum das Rauschen des Linnens vernehmen, das dem Geplätscher eines leise bewegten Wassers glich. Doch er fuhr fort, sich mit ihr zu beschäftigen.
»Die Seife liegt in einer Schale auf dem Tische ... Öffnen Sie das Schubfach und nehmen Sie ein reines Handtuch ... Wünschen Sie noch Wasser? Ich reiche Ihnen die Kanne hinüber.«
Der Gedanke, daß er wieder in seine Ungeschicklichkeit verfiel, erbitterte ihn plötzlich.
»Jetzt ärgere ich Sie schon wieder«, rief er. »Tun Sie, als ob Sie zu Hause wären.«
Er kehrte zu seiner Hauswirtschaft zurück, und da begann ein neuer Kampf in ihm. Sollte er ihr ein Frühstück anbieten? Es war schwer, sie so ziehen zu lassen. Anderseits aber würde dann die Geschichte kein Ende nehmen und der Vormittag für die Arbeit ganz verloren sein. Ohne zu einem bestimmten Entschluß zu kommen, zündete er die Spirituslampe an, reinigte die Schüssel und begann Schokolade zu bereiten, die er für vornehmer hielt als die nach südfranzösischer Art bereiteten Ölnudeln. Noch mit dem Zerbröckeln der Schokolade beschäftigt, rief er plötzlich erstaunt aus:
»Wie? Schon?«
Christine hatte den Wandschirm weggeschoben und erschien sauber und nett in ihren schwarzen Kleidern, im Handumdrehen eingeschnürt, zugeknöpft, fertig angekleidet. Ihr rosiges Gesicht hatte selbst die Feuchtigkeit des Wassers nicht bewahrt; ihre schwere Haarflechte lag in ihrem Nacken, ohne daß auch nur das kleinste Haarbüschel hervorschlüpfte. Claude stand ganz verblüfft angesichts der wunderbaren Raschheit, der Geschicklichkeit einer kleinen Hauswirtin, sich schnell und gut anzukleiden.
»Ei, der Tausend! Wenn Sie alles so flink machen ...«
Er fand sie größer und schöner, als er geglaubt hatte. Hauptsächlich überraschte ihn ihre ruhige, entschlossene Miene. Sie hatte augenscheinlich keine Furcht mehr vor ihm. Es schien, als habe sie, aus diesem Bette steigend, wo sie sich wehrlos gefühlt, mit ihrem Kleide und ihren Stiefelchen zugleich ihre Rüstung wieder angelegt. Sie lächelte und schaute ihm fest in die Augen. Jetzt sagte er, was er bisher zu sagen gezögert hatte:
»Sie frühstücken mit mir, nicht wahr?«
Doch sie lehnte ab.
»Nein, ich danke ... Ich will nach dem Bahnhof eilen, wo mein Koffer sicher schon angelangt ist; dann will ich mich nach Passy bringen lassen.«
Vergebens wiederholte er, daß sie Hunger haben müsse, und daß es nicht vernünftig sei, so wegzugehen, ohne vorher etwas zu essen.
»Dann gehe ich hinab und hole Ihnen eine Droschke.«
»Nein, ich bitte Sie, geben Sie sich nicht die Mühe.«
»Aber Sie können doch einen solchen Weg nicht zu Fuß machen. Gestatten Sie mir wenigstens, Sie bis zum Wagenstandplatz zu begleiten; Sie kennen Paris nicht.«
»Nein, nein, ich bedarf Ihrer nicht. Wenn Sie liebenswürdig sein wollen, lassen Sie mich allein gehen.«
Es war ihr fester Wille. Ohne Zweifel erschreckte sie der Gedanke, selbst von unbekannten Leuten mit einem Manne gesehen zu werden. Sie wollte verschweigen, wo sie die Nacht zugebracht; wollte zu einer Lüge ihre Zuflucht nehmen und die Erinnerung an dieses Abenteuer für sich behalten. Er machte eine zornige Gebärde, als wolle er sie zum Teufel schicken. Es war ihm ganz recht, daß er sie los wurde und nicht hinabgehen mußte. Aber im Grunde war er verletzt; er fand sie undankbar.
»Wie es Ihnen beliebt, ich werde keine Gewalt anwenden«, sagte er.
Als Christine diese Worte hörte, verstärkte sich ihr Lächeln und zog die zarten Winkel ihrer Lippen herab. Sie sagte nichts, nahm ihren Hut und suchte einen Spiegel; als sie keinen fand, entschloß sie sich, die Hutbänder auf gut Glück zu einer Schleife zu binden. Mit erhobenen Ellbogen rollte und zog sie die Bänder, ohne sich zu beeilen, das Antlitz im goldigen Widerschein der Sonne gebadet. Claude war überrascht; er erkannte die kindlich-sanften Züge nicht mehr, die er gezeichnet hatte; der obere Teil des Gesichtes mit der durchsichtig-klaren Stirn und den zarten Augen schien verschwommen; jetzt trat der untere Teil mehr hervor, die leidenschaftliche Kinnlade, der rote Mund mit den schönen Zähnen. Und immer dieses rätselhafte Lächeln des jungen Mädchens, das vielleicht einen Spott ausdrücken wollte.
»Auf alle Fälle glaube ich, daß Sie mir keinen Vorwurf zu machen haben«, setzte er gereizt hinzu.
Da konnte sie ein Lachen nicht unterdrücken, ein halblautes, herzliches Lachen.
»Nein, mein Herr, nicht den geringsten«, sagte sie.
Er fuhr fort, sie zu betrachten, wieder im Kampfe mit seiner Schüchternheit und Unwissenheit, von der Furcht geplagt, lächerlich gewesen zu sein. Was wußte denn dieses große Fräulein? Ohne Zweifel, was die Mädchen in der Pension wissen: alles und nichts. Es ist das unergründliche, dunkle Erschließen des Fleisches und des Herzens, das niemandem zugänglich ist. War in dieser sorglosen Behausung eines Künstlers die züchtige Sinnlichkeit dieses Mädchens erwacht mit ihrer Neugierde und ihrer unklaren Furcht vor dem Manne? Fühlte sie jetzt, da sie nicht mehr zitterte, die einigermaßen verächtliche Überraschung, um nichts gezittert zu haben? Wie, nicht die geringste Galanterie? Nicht einmal ein Kuß auf die Fingerspitzen? Die rauhe Gleichgültigkeit, die sie aus dem Betragen dieses jungen Mannes herausgefühlt, mußte das Weib in ihr ärgern, das sie noch nicht war; und sie ging so von dannen, verändert, nervös, in ihrem Ärger die Mutige spielend, das unbewußte Bedauern um die unbekannten und furchtbaren Dinge mitnehmend, die nicht geschehen waren.
»Sie sagen, der Wagenstandplatz sei am Ende der Brücke an dem andern Ufer?« fragte sie, wieder ernst geworden.
»Ja, bei der Baumgruppe.«
Sie hatte jetzt ihre Hutschleife gebunden, die Handschuhe angestreift und war fertig; aber sie ging nicht, mit schlaffen Händen stand sie da und schaute vor sich hin. Als ihre Blicke die verkehrt an die Wand gelehnte große Leinwand trafen, hatte sie Lust, ihn zu bitten, ihr sie zu zeigen; aber sie wagte es nicht. Nichts hielt sie mehr zurück, aber sie schien noch etwas zu suchen, als habe sie das Empfinden, hier etwas zurückzulassen, eine Sache, die sie nicht hätte nennen können. Endlich wandte sie sich nach der Tür.
Claude öffnete, und ein Brötchen, welches auf die Tür gelegt worden, rollte in das Atelier.
»Sie sehen, Sie hätten mit mir frühstücken sollen«, sagte er. »Die Pförtnerin bringt mir das jeden Morgen herauf.«
Sie lehnte mit einem Kopfschütteln abermals ab. Auf dem Flur wandte sie sich um und blieb einen Augenblick stehen. Ihr heiteres Lächeln war wiedergekehrt, und sie reichte ihm zuerst die Hand.
»Dank, vielen Dank«, sagte sie.
Er hatte dieses beschuhte Händchen in seine breite, mit Pastellfarben befleckte Hand genommen. Beide blieben so einige Augenblicke eng beisammen stehen und schüttelten sich freundschaftlich die Hände. Das Mädchen lächelte noch immer; er hatte eine Frage auf den Lippen: »Wann werde ich Sie wiedersehen?« Aber ein Gefühl der Scham hinderte ihn zu sprechen. Nachdem er eine Weile gewartet, ließ er ihre Hand fahren.
»Leben Sie wohl!«
»Leben Sie wohl, Fräulein!«
Ohne aufzublicken stieg Christine bereits die Mühlenleiter hinab, deren Stufen krachten; Claude aber kehrte heftig in das Atelier zurück, warf die Tür zu und sagte laut:
»Die verwünschten Weiber!«
Er war wütend auf sich selbst und auf die anderen. Die Möbel, die er traf, mit dem Fuße wegstoßend, fuhr er fort, mit lauter Stimme sein Herz zu erleichtern. Wie sehr hatte er recht, niemals eine heraufkommen zu lassen! Diese Dirnen waren nur da, um die Männer zum besten zu haben! Wer bürgte ihm dafür, daß diese mit ihrer unschuldigen Miene ihn nicht ganz abscheulich genarrt hatte? Er war so einfältig gewesen, an die fabelhaftesten Geschichten zu glauben; alle seine Zweifel kehrten wieder; niemals werde man ihm die Generalswitwe, den Eisenbahnunfall und – vornehmlich – den Droschkenkutscher glaubhaft machen. Kommen denn solche Geschichten vor? Sie hatte übrigens einen Mund, dem nicht zu trauen war, und im Augenblicke des Scheidens machte sie eine so drollige Miene ... Wenn er noch begriffen hätte, weshalb sie log? Aber nein, es waren unnütze, unerklärliche Lügen; sie log, um zu lügen, und lachte sich jetzt wohl ins Fäustchen!
Heftig schob er den Wandschirm zusammen und schleuderte ihn in einen Winkel. Sie hatte ihm eine schöne Unordnung zurückgelassen! Als er feststellen konnte, daß alles in schöner Ordnung und rein war: das Waschbecken, die Serviette, die Seife, erboste er sich, weil sie das Bett nicht gemacht hatte. Mit übertriebener Anstrengung ging er daran, das Bett zu machen, ergriff mit beiden Armen die noch warme Matratze, schlug mit beiden Händen das noch duftende Kissen glatt, schier erstickt von dieser Wärme, von dem reinen Duft der Jugend, die von der Bettwäsche ausströmten. Dann wusch er sich reichlich, um seine Schläfen zu kühlen; und in dem feuchten Handtuch fand er den nämlichen erstickenden Duft wieder, diesen jungfräulichen Atem, dessen im Atelier umherschwebende Lieblichkeit ihn bedrückte. Fluchend aß er seine Schokolade aus der Schüssel, von einem so fieberhaften Arbeitseifer ergriffen, daß er in der Hast große Stücke Brot verschlang.
»Aber man muß ja hier umkommen!« schrie er plötzlich. »Die Hitze macht mich krank.«
Die Sonne war weitergezogen; es war jetzt weniger warm.
Claude öffnete eine Dachluke und sog mit großer Erleichterung den eindringenden Strom heißer Luft ein. Er hatte eine Zeichnung – Christinens Kopf – ergriffen und vergaß sich lange in seiner Betrachtung.
Zweites Kapitel.
Die Mittagsstunde war vorüber, und Claude arbeitete an seinem Gemälde, als eine bekannte Hand kräftig an der Tür pochte. Mit einer instinktiven Bewegung, die er nicht beherrschen konnte, schob der Maler Christinens Kopf – nach dem er seine große Frauenfigur verbesserte – in einen Karton. Dann entschloß er sich zu öffnen.
»Peter, bist du es schon?« rief er.
Sein Jugendfreund Peter Sandoz war ein Jüngling von zweiundzwanzig Jahren, sehr braun, mit rundem, eigensinnigen Kopfe, viereckiger Nase und sanften Augen in einem energischen Gesichte, das ein sprießender Rundbart einrahmte.
»Ich habe heute früher gefrühstückt und wollte dir eine ausgiebige Sitzung geben ... Alle Wetter, das geht ja schön vorwärts!«
Er stellte sich vor das Bild hin und setzte sogleich hinzu:
»Du änderst den Kopf der Frauenfigur!«
Ein langes Schweigen trat ein; beide betrachteten unbeweglich das Gemälde. Es war eine Leinwand von fünf Metern Breite und drei Metern Höhe, von dem Gemälde vollkommen bedeckt; doch hoben sich kaum einige Bruchstücke der Skizze ab. Diese in einem Zuge hingeworfene Skizze war von prächtiger Kraft, von einem flammenden Leben in den Farben. In eine Waldeslichtung, zwischen dichten Mauern von Grün, fiel eine breite Flut von Sonnenlicht; links verlief eine dunkle Allee, mit einem Lichtfleck in weiter Ferne. Hier lag im Grase, inmitten eines üppigen Junipflanzenwuchses ein nacktes Weib, einen Arm unter dem Haupte, mit schwellender Brust; und sie lächelte mit geschlossenen Augenlidern in der Flut goldigen Lichtes, in der sie badete. Im Hintergrunde waren noch zwei Frauengestalten, eine braune und eine blonde, gleichfalls nackt; diese rangen lachend miteinander und hoben von dem Grün des Laubes zwei wundervolle Fleischtöne ab. Und da der Maler im Vordergrunde einen dunklen Gegensatz benötigte, begnügte er sich damit, einen Herrn in schwarzer Samtjacke hinzusetzen. Dieser Herr wandte den Rücken; man sah von ihm nur die linke Hand, auf die er sich im Grase stützte.
»Die weibliche Figur ist sehr schön angedeutet«, sagte Sandoz endlich. »Aber, Sapristi! Das wird dir viel zu schaffen machen.«
Mit flammenden Augen sein Werk betrachtend, machte Claude eine zuversichtliche Gebärde.
»Bah,« sagte er, »von jetzt bis zur Ausstellung ist's Zeit genug. In sechs Monaten kann man viel arbeiten. Diesmal werde ich mir vielleicht doch den Beweis liefern, daß ich kein Rindvieh bin.«
Er begann laut zu pfeifen, entzückt – ohne es zu sagen – über die Skizze, die er von dem Kopfe Christinens entworfen, gehoben durch jene mächtigen Hoffnungsregungen, von denen er nur um so rauher in die Beklemmungen eines Künstlers zurückfiel, den die Leidenschaft für die Natur verzehrte.
»Vorwärts, nur keine Zeit verlieren!« rief er. »Du bist hier; laß uns anfangen.«