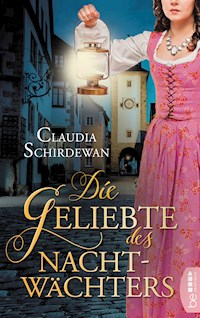7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Norderney, 1904: Clara Berlund träumt von einer großen Zukunft für die »Pension am Meer«, die ihre Eltern leiten. Sie arbeiten hart, um Schulden abzutragen, und Clara unterstützt ihre Familie finanziell mit dem Geld, das sie als Dienerin im Damenbad verdient. Am liebsten würde sie die kleine Pension zu einem modernen Kurhotel ausbauen, aber ihre Eltern scheuen das finanzielle Risiko. Als der junge Bankier Arthur Washeimer auf Norderney auftaucht, scheint es, als könnten Claras Träume vom Kurhotel doch noch wahr werden. Gemeinsam schmieden sie Pläne und kommen sich dabei immer näher. Bis Arthur eines Tages plötzlich verschwindet ...
Unterdessen kommt Helene Grothe auf der Insel an, um dort als Gemeindeschwester zu arbeiten. Die Inselbewohner sind jedoch skeptisch und legen ihr so manchen Stein in den Weg. Clara, die sich derweil mit Helene angefreundet hat, tut, was sie kann, um die neue Inselbewohnerin zu unterstützen. Aber die jungen Frauen haben nicht mit dem sturen Argwohn ihrer Mitmenschen gerechnet.
Können die beiden Frauen ihre Träume trotz aller Widrigkeiten verwirklichen?
Eine bewegende Geschichte über Liebe, Hoffnung und den Kampf für eine bessere Zukunft. Der zweite Band der Familiensaga über das Kurhotel auf Norderney.
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 437
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhalt
Cover
Grußwort des Verlags
Über dieses Buch
Titel
Widmung
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
Epilog
Nachwort
Über die Autorin
Weitere Titel der Autorin
Impressum
Liebe Leserin, lieber Leser,
herzlichen Dank, dass du dich für ein Buch von beHEARTBEAT entschieden hast. Die Bücher in unserem Programm haben wir mit viel Liebe ausgewählt und mit Leidenschaft lektoriert. Denn wir möchten, dass du bei jedem beHEARTBEAT-Buch dieses unbeschreibliche Herzklopfen verspürst.
Wir freuen uns, wenn du Teil der beHEARTBEAT-Community werden möchtest und deine Liebe fürs Lesen mit uns und anderen Leserinnen und Lesern teilst. Du findest uns unter be-heartbeat.de oder auf Instagram und Facebook.
Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich für unseren kostenlosen Newsletter an:be-heartbeat.de/newsletter
Viel Freude beim Lesen und Verlieben!
Dein beHEARTBEAT-Team
Melde dich hier für unseren Newsletter an:
Über dieses Buch
Norderney, 1904: Clara Berlund träumt von einer großen Zukunft für die »Pension am Meer«, die ihre Eltern leiten. Sie arbeiten hart, um Schulden abzutragen, und Clara unterstützt ihre Familie finanziell mit dem Geld, das sie als Dienerin im Damenbad verdient. Am liebsten würde sie die kleine Pension zu einem modernen Kurhotel ausbauen, aber ihre Eltern scheuen das finanzielle Risiko. Als der junge Bänker Arthur Washeimer auf Norderney auftaucht, scheint es, als könnten Claras Träume vom Kurhotel doch noch real werden. Während die beiden Pläne schmieden, kommen sie sich immer näher. Doch dann verschwindet Arthur plötzlich vom einen auf den anderen Tag ...
Unterdessen kommt Helene Grothe auf der Insel an, um dort ihre neue Position als Gemeindeschwester anzutreten. Die Inselbewohner sind jedoch skeptisch und legen ihr so manchen Stein in den Weg. Clara, die sich derweil mit Helene angefreundet hat, tut, was sie kann, um die neue Inselbewohnerin zu unterstützen. Aber sie haben nicht mit dem sturen Argwohn ihrer Mitmenschen gerechnet.
Können die beiden Frauen ihre Träume trotz aller Widrigkeiten verwirklichen?
Claudia Schirdewan
Das Kurhotel auf Norderney – Gezeiten des Schicksals
Für Frank
Prolog
Norderney, 1904
Die Julisonne strahlte vom Himmel und ließ die Gischt auf den Wellen funkeln. Es war noch nicht einmal Mittag und doch bereits so warm, dass sich zahlreiche Gäste am Strand tummelten. Einige Badekarren waren schon ins Wasser gezogen worden, und die spitzen Aufschreie, die von der Brise zu ihr herübergetragen wurden, verrieten Clara, dass das Meer kühler war, als die Badenden vermutet hatten. Die Achtzehnjährige hätte geschmunzelt, wenn sie nicht so schrecklich aufgeregt gewesen wäre. Ihr erster Arbeitstag!
Aber wo blieb Max? Er hatte versprochen, sie an der Promenade abzuholen und zu der Strandaufseherin zu bringen, die für die ordnungsgemäßen Abläufe im Damenbad zuständig war. Auf keinen Fall wollte Clara zu spät kommen, das würde nicht nur einen schlechten Eindruck machen, sondern womöglich würde sie ihre Stellung verlieren, bevor sie die Arbeit überhaupt aufgenommen hatte. Ach, Max!
Sie trat von einem Fuß auf den anderen und sah auf die Taschenuhr, die sie sich für diesen Tag von ihrem Vater geliehen hatte. Nur noch fünf Minuten, dann musste sie ihren Dienst antreten. Noch einmal suchten ihre seegrünen Augen, die sie von der Mutter geerbt hatte, die Promenade ab. Keine Spur von ihrem alten Freund. Clara raffte den blauen Baumwollrock, den ihre Mutter extra noch einmal geglättet hatte, obwohl sie ihn gleich gegen die Arbeitskleidung tauschen würde, streifte die Schuhe ab und lief durch den Sand auf den hölzernen Verschlag zu, welcher der Strandaufseherin Frauke Rass als Schreibstube diente.
Clara klopfte an die grob gezimmerte Tür. Das Salzwasser hatte dem Holz spürbar zugesetzt; die Tür fühlte sich feucht und modrig an. Frauke hielt sich vermutlich ohnehin kaum in diesem provisorischen Büro auf. Ihre Aufgabe war es, das gesamte Personal des Damenbades zu beaufsichtigen und darauf zu achten, dass die Gäste angemessen bedient wurden. Da wurde die Tür aufgerissen und Clara stand ihrer zukünftigen Vorgesetzten gegenüber, die sie bislang nur vom Sehen kannte.
Frauke war um die fünfzig Jahre alt und die Nichte des Inselpastors Hilrich Rass, der längst die achtzig überschritten hatte, sich aber noch guter Gesundheit erfreute. Er hatte einen Nachfolger, doch Hilrich war nicht für den Ruhestand geschaffen, und da er sich mit Johan Meyer, dem neuen Pastor, gut verstand, hielt er im Wechsel mit dem jungen Mann noch immer unermüdlich den Gottesdienst ab. Leider hatte Frauke von der stets nachsichtigen und gutmütigen Art ihres Onkels wenig geerbt. Sie galt als strenge und hart durchgreifende Vorgesetzte. Es wurmte Clara, dass sie vermutlich gleich zu Beginn einen Rüffel kassieren würde, weil sie nicht früher eingetroffen war.
Max konnte sich auf etwas gefasst machen!
»Gerade noch pünktlich.«
Wie befürchtet hob Frauke die Brauen und musterte ihre neue Mitarbeiterin von oben bis unten. »Du hättest heute gern etwas früher kommen können, Clara Berlund. Du musst dich schließlich noch umziehen, und das zählt nicht zur Arbeitszeit.«
»Natürlich, Frau Rass. Bitte entschuldigen Sie. Es ist nur so, ich hatte auf meinen Freund Max gewartet, der ...«
Die Strandaufseherin schnalzte mit der Zunge.
»Weniger reden, mehr arbeiten, wenn ich bitten darf. Ausreden und Entschuldigungen interessieren mich grundsätzlich nicht. Davon ist noch keine Dame schneller bedient worden, nicht wahr?«
Mit einem Blick schätzte sie Claras Maße ab, dann griff sie in ein Regal und drückte der neuen Mitarbeiterin ein helles Leinenhemd sowie die klassische rote Hose in die Hand. Claras Laune besserte sich, und sie lächelte. Mit den Fingerspitzen strich sie über den Stoff. Sie war tatsächlich eine Badedienerin. Eine Rothose!
Stolz durchflutete sie.
»Danke schön«, sagte sie leise. »Frau Rass, ich werde Ihnen beweisen, dass ich gut und hart arbeiten kann. Das verspreche ich!«
Frauke nickte, und für einen Moment erschien der Anflug eines Lächelns auf ihren schmalen Lippen. Clara drückte die frischen Kleidungsstücke an sich. Sie rochen nach Seife und Salzwasser.
»Komm, zieh dich um.« Frauke deutete in eine Ecke, die mit einem Vorhang abgetrennt war. »Und dann geh an die Arbeit. Fine weiß Bescheid, sie holt dich gleich ab und wird dich einweisen.«
Clara nickte und verschwand leichtfüßig hinter dem Vorhang. Sie hatte Arbeit, eine richtige Anstellung! Endlich konnte sie ihren Eltern helfen, die Schulden abzutragen, die auf der Pension lasteten. Clara Berlund beschloss, die beste Badedienerin zu werden, die Norderney je gesehen hatte. Die Gäste würden sie lieben, dafür würde sie sorgen. Clara schlüpfte aus ihrem Rock und streifte mit der Arbeitshose auch die Entschlossenheit über, ihre Eltern stolz zu machen und die Pension der Familie zu ungeahnter Blüte zu treiben. Egal, wie hart der Weg auch werden mochte – Clara würde ihn gehen.
1. Kapitel
Norderney, im Juli 1906
Max Janssen schloss die Augen und legte den Kopf in den Nacken. Er mochte das Gefühl, von der Sonne an der Nase gekitzelt zu werden, während er die nackten Zehen in den Schlick bohrte und seine Füße von der auch im Sommer angenehm kühlen Nordsee erfrischen ließ. Das Rauschen der Wellen, die im immer gleichen Rhythmus an den Strand schlugen, beruhigte ihn. Es war ein anstrengender Tag gewesen, und er genoss diesen Moment, der allein ihm gehörte.
Oft genug fing ihn sein Vater Sören, der als Strandaufseher im Herrenbad sein Vorgesetzter war, nach Feierabend ab und übertrug ihm Aufgaben, die liegengeblieben waren. Das Ausfegen der Badekarren, das Wegräumen vergessener Gegenstände. Dem Zwanzigjährigen kam es oftmals so vor, als wollte Vater um jeden Preis verhindern, dass andere Arbeiter auch nur auf die Idee kommen könnten, der Strandaufseher würde seinen Sohn bevorzugen. Max schnaubte bei diesem Gedanken leise. In Wirklichkeit war wohl eher das Gegenteil der Fall; kein Badediener schuftete härter als er.
»Max!«
Er erkannte die Stimme sofort. Mit einem Lächeln öffnete er seine Augen und zog eilig die Mütze zurecht, unter der ein paar schwarze Strähnen hervorlugten. Seine dunklen Haare bildeten einen lebhaften Kontrast zu den hellblauen Augen, und Max wusste sehr genau um seine Wirkung. Es war nicht so, dass er die Blicke, die viele der Mädchen ihm zuwarfen, nicht bemerkte. Auch seine hochgewachsene Gestalt und die muskulösen Arme, die er der harten Arbeit am Strand verdankte, machten ihn attraktiv. Max war dennoch nicht eitel. Es gab nur eine junge Frau, der er gefallen wollte – und die kam in diesem Moment auf ihn zugelaufen.
»Clara!«
Er winkte, nahm die Schuhe in die rechte Hand und stand auf, um ihr entgegenzugehen. Die Sonne stand Clara im Rücken und spielte mit ihren blonden Locken, die unter dem Kopftuch hervorschauten, das sie stets bei der Arbeit trug. Die rote Hose schlackerte um ihre schlanke Taille, aber sie vergaß immer wieder, sie enger zu nähen. Max schmunzelte. Selbst in ihrer Arbeitskleidung, mit Schweißperlen auf der Stirn und sandigen Füßen gab es nur ein Wort, das Clara zu beschreiben vermochte: hinreißend! Sie strahlte übers ganze Gesicht, ihre Wangen waren gerötet.
»Du hattest einen guten Tag, was?«, schloss Max aus ihrem Anblick, als sie endlich vor ihm stehen blieb.
»Allerdings«, meinte sie lachend, umfasste die Börse, die sie an ihrem Gürtel trug, und ließ die Münzen darin klimpern. »So viel Trinkgeld wie heute bekomme ich selten.«
»Es ist Abreisetag, da sind die Gäste meistens spendabler. Das ist bei den Herren auch so.«
»Als ob ich das nicht wüsste. Ich arbeite schon seit zwei Jahren hier, hast du das vergessen?« Clara hob einen Zeigefinger und warf ihrem Freund, nur halb im Scherz, einen strengen Blick zu. »Auch, wenn ich deinetwegen die Stelle beinahe schneller verloren hätte, als ich sie bekommen habe.«
Max seufzte. Er hatte tatsächlich noch immer ein schlechtes Gewissen, weil er Clara an ihrem ersten Tag nicht wie versprochen pünktlich zur Strandaufseherin des Damenbades gebracht hatte.
»Daran ist aber mein Vater schuld, wie du weißt«, entschuldigte er sich wie schon so viele Male zuvor. »Wenn er nicht drauf bestanden hätte, dass ausgerechnet ich diesen einen Badekarren noch ausfege, dann ...«
»Lass es gut sein, Max. Ich habe dir längst verziehen. Auch, wenn es deshalb unnötig lange gedauert hat, das Vertrauen von Frauke Rass zu gewinnen. Sie hat mich ganz schön strammstehen lassen.«
Clara hakte sich bei Max unter. Dem jungen Mann lief ein wohliger Schauer über den Rücken, doch sie zog ihn so unbeschwert mit sich, dass er davon ausgehen musste, dass diese Vertraulichkeit ihr nicht halb so viel bedeutete wie ihm. Würde sie in ihm immer nur den Spielkameraden aus Kindertagen sehen, mit dem sie im Sand herumgetollt hatte?
Beinahe hätte er laut geseufzt. Irgendwann würde er Clara gestehen, was er für sie empfand. Seit Jahren wartete er auf den richtigen Moment, und oft genug fragte er sich, warum er nicht endlich den Mut fand. Irgendwann würde sonst der Tag kommen, an dem jemand anders es tat, da machte Max sich nichts vor.
Clara wurde von Tag zu Tag hübscher, und die anderen jungen Männer auf der Insel waren nicht blind. Es war ja auch nicht so, dass er ihr nichts zu bieten hätte. Sören hatte kürzlich seinen sechzigsten Geburtstag gefeiert, und Max' ältere Brüder Klaus und Wilm waren längst in Lohn und Brot. Klaus, der mit seinen nunmehr achtundzwanzig Jahren der älteste Sohn der Familie Janssen war, hatte es auf das Festland verschlagen. Er arbeitete für den Norddeutschen Lloyd und hatte Erna, die Tochter eines Hafenarbeiters, geheiratet. Wilm, der mittlere Sohn, der vier Jahre älter war als Max, verdingte sich als Gehilfe in der Inselapotheke. Insofern hatte Max rosige Aussichten, in nicht allzu ferner Zukunft in die Fußstapfen seines Vaters zu treten und Strandaufseher zu werden. Er würde es schon schaffen, eine Familie zu ernähren.
Clara riss ihn aus seinen Gedanken. »Ich muss mich aber sputen. Ich habe Mutter versprochen, ihr heute Abend noch mit den Zimmern zu helfen. Wir bekommen morgen neue Gäste, und du kennst ja meine Mutter. Wehe, es wird auch nur ein Staubkörnchen übersehen.«
Clara verdrehte die Augen, aber Max war klar, dass sie eigentlich stolz auf ihre Mutter war. Sie arbeitete gern in der Pension ihrer Eltern, und er wusste, dass sie einen stattlichen Anteil ihres Lohns und der Trinkgelder zu Hause abgab, auch wenn ihre Eltern das nicht gern sahen und ihr immer wieder ein paar Mark zusteckten, damit sie sich auch einmal etwas gönnte.
»Ich begleite dich ein Stück«, schlug Max vor.
Gemeinsam schlenderten sie über die Promenade in Richtung Weststrand. An der Villa Fresena bogen sie in den Ortskern ab und erreichten bald darauf die Pension am Meer in der Luisenstraße.
Claras Mutter war gerade dabei, die Treppenstufen, die zu der vor einiger Zeit in einem frischen Grünton gestrichenen Eingangstür führten, mit einer Wurzelbürste und Seifenwasser zu bearbeiten. Als sie ihre Tochter und Max bemerkte, richtete Elisa sich auf und wischte mit dem Handrücken ein paar Schweißperlen von der Stirn. Sie war neununddreißig Jahre alt, doch ihr Gesicht war aller Arbeit zum Trotz beinahe so faltenfrei wie das eines jungen Mädchens. Ihre blonden Locken waren im Lauf der Jahre etwas dunkler geworden. Aber nur wenn das Licht direkt darauf fiel, verrieten ein paar graue Strähnen, dass die Zeit auch an Elisa Berlund nicht ganz spurlos vorübergegangen war.
»He, ihr zwei«, grüßte sie. »Ihr seht müde aus. War es ein harter Tag am Strand? Heute reisen viele Gäste ab, nicht wahr?«
Max nickte. »Ja. Und dann ist immer besonders viel zu tun. Alle nutzen die Gelegenheit, um die Badekarren auf Vordermann zu bringen und gründlich zu säubern.«
»Genau wie ich!« Elisa lachte und hob demonstrativ die Scheuerbürste. »Wenn ihr mögt, holt euch etwas zu trinken und ruht euch kurz aus. In der Küche steht frische Milch.«
»Danke, aber ich muss leider weiter«, entschuldigte sich Max. »Bei uns zu Hause muss ein Fenster ausgebessert werden. Ich habe meiner Mutter versprochen, mich heute darum zu kümmern.«
»Grüß sie schön!« Elisa ließ sich auf die oberste Treppenstufe fallen, während Clara dem Freund nachwinkte. Obwohl sie gerade erst gescheuert worden waren, hatte die Sonne die roten Backsteine schon wieder getrocknet.
*
»Ist Antje nicht da?« Clara ließ sich auf die oberste Treppenstufe fallen und streckte die Beine aus.
Elisa seufzte.
»Du kennst doch deine Schwester. Sie hat es gerade mal geschafft, das Unkraut zu jäten, dann sind ihr wieder Hummeln im Hintern herumgeflogen. Ich habe ihr erlaubt, bei Auguste vorbeizugehen, sofern sie auf dem Rückweg ein paar Sachen vom Krämer mitbringt.«
Clara schmunzelte. Ihre zwölf Jahre alte Schwester war gewiss nicht faul, aber in ihrem Alter waren Freundinnen, mit denen sie toben und manchmal schon wie ein Backfisch tratschen konnte, viel spannender als die Pension. Der Altersunterschied zwischen den Schwestern war groß genug, um Clara nachsichtig mit der Jüngeren sein zu lassen.
»Es ist so ein schöner Tag! Lass sie ruhig spielen, Mutti. Ich helfe dir gleich.«
»Komm du erst mal richtig an, du hast ja schon einen harten Tag hinter dir«, sagte Elisa. »Übrigens sitzt deine Großmutter in der Küche.«
Sie bückte sich zu ihrem Eimer hinunter, tauchte die Wurzelbürste in das Seifenwasser und machte sich daran, die nächste Stufe zu bearbeiten. Dabei kniff sie die Lippen zusammen, doch Clara bezweifelte, dass es an der Anstrengung lag.
»Ich sage ihr gleich guten Tag.«
Clara zupfte an ihrem Daumennagel, wie immer, wenn sie verunsichert war. Eine Angewohnheit, die sie von ihrer Mutter geerbt hatte. Sie fragte nicht laut, warum die Treppe gerade dann geschrubbt werden musste, wenn Großmutter zu Besuch war. Obwohl sie noch gut zu Fuß war, kam es nicht allzu oft vor, dass Elisas Mutter vorbeischaute.
Auch wenn nie offen darüber geredet wurde und sie auf die Fragen, die sie als Kind gestellt hatte, nur ein beredtes Schweigen geerntet hatte, war ihr klar, dass zwischen den beiden Frauen etwas vorgefallen sein musste. Etwas Gravierendes. Die beiden gingen steif miteinander um, auf eine unterkühlte Art und Weise, die so gar nicht zu ihrer Mutter passen wollte, die Clara noch heute so oft herzte und umarmte, dass es ihr manchmal schon unangenehm war. Auch mit dem Vater Julius verband Elisa nach all den Ehejahren noch immer ein liebevoller Umgang, und ihr Verhältnis zu ihrem Bruder Ferdinand, der nie geheiratet hatte, war ebenfalls herzlich. Onkel Ferdinand lebte mit Großmutter Wilma in einem Fischerhaus am Ortsrand. Elisa war dort aufgewachsen. Früher hatte Großmutter in dem Haus selbst eine kleine Pension betrieben, aber das war längst vorbei. Wilmas Mann war gestorben, als Clara keine vier Jahre alt gewesen war.
Sie konnte sich kaum an ihn erinnern, wusste aber, dass ihr Großvater Gottfried Fischer gewesen war. Heute lebten Onkel Ferdinand und Großmutter von dem Geld, das dieser als Handwerksgehilfe nach Hause brachte. Auf Norderney gab es immer etwas zu tun, und dank seiner geschickten Hände fiel es Ferdinand selten schwer, Arbeit zu finden. Clara war zudem sicher, dass ihre Mutter den beiden dann und wann etwas zusteckte. Das ging aber natürlich nur in der Hochsaison, wenn die Pension ausgebucht war. In den kälteren Monaten wurde es oft genug schwierig, zumal die Bank monatlich auf ihre Raten wartete. Clara seufzte. Irgendwann würde sie schon herausfinden, was zwischen den beiden Frauen vorgefallen war – und wenn sie noch so viel Geduld dafür aufbringen musste.
Sie erhob sich, strich ihren Rock glatt und ging ins Haus. Rechts neben dem Eingang befand sich der Empfangsbereich, der nicht mehr war als eine aus roten Backsteinen gemauerte Theke. Hier begrüßten die Berlunds ihre Gäste, füllten die Meldebögen aus und händigten Neuankömmlingen ihre Zimmerschlüssel aus, die an einem dahinter angebrachten Regalbrett verwahrt wurden.
Links davon führte eine Holztreppe in das Obergeschoss zu den Gästezimmern. Jedes der fünf Zimmer war mit einem Doppelbett ausgestattet. Die sonstige Möblierung war spärlich, aber die Berlunds verstanden es, mit Blumen und kleinen Aufmerksamkeiten dafür zu sorgen, dass die Gäste sich dennoch gleich in ihren Zimmern willkommen fühlten. Das Treppenhaus war, genau wie alle Zimmerwände, strahlend weiß gestrichen, und die Bilder an den Wänden zeigten die Dünen und den Strand.
Die Räumlichkeiten der Familie lagen im Erdgeschoss. Vom Flur ging es links in das Elternschlafzimmer, direkt daneben waren die Kammern von Clara und ihrer Schwester Antje. Es waren nur winzige Zimmer, die jeweils gerade eben Platz boten für ein Bett, einen Schrank und eine Kommode, die Onkel Ferdinand selbst angefertigt und ihnen geschenkt hatte. Trotzdem wusste gerade Clara es zu schätzen, dass sie ein Zimmer für sich allein hatte. Diese Kammer war ihr eigenes Reich, und sie achtete penibel darauf, sie ordentlich zu halten, und vergaß auch nie, eine frische Blume ins Fenster zu stellen. Zum einen, weil sie selbst kaum etwas so sehr liebte wie den süßen Geruch von Rosen, zum anderen aber auch, damit vorbeiflanierenden Gästen nicht entging, wie hübsch und einladend die Pension am Meer war.
Auf der anderen Seite des Flurs ging es hinter dem Empfang in die gute Stube, die aber fast immer verschlossen war. An den Feiertagen fanden sie sich hier zusammen, ansonsten wurde der Raum nur genutzt, wenn hochrangige Vertreter der Bank oder der Verwaltung ins Haus kamen – oder natürlich Claras Großeltern väterlicherseits, die regelmäßig kurz vor dem Beginn der Sommersaison zu Besuch weilten. Ihre Mutter wurde dann immer ganz nervös und gab sich alle Mühe, die Pension im besten Licht zu zeigen. Clara schüttelte darüber den Kopf, denn es gab wohl kaum liebere Menschen als die Großeltern vom Rhein, die jedes Mal eine Tasche voller Geschenke im Gepäck hatten und mit anpackten, wo sie nur konnten.
Neben der guten Stube befand sich das Speisezimmer für die Gäste. Es gab einen langen Tisch, auf dem stets eine Vase mit duftenden Wildblumen stand und der für Frühstück und Abendbrot mit dem guten blau-weiß gemusterten Porzellan eingedeckt wurde, das Elisa von ihren Schwiegereltern zur Hochzeit bekommen hatte. Der robuste Holzfußboden war mit einem warmen, in Blautönen gehaltenen Teppich ausgelegt, und die tiefen Fenster ließen viel Licht hinein, sodass die Gäste mit etwas Glück schon beim Frühstück die Sonnenstrahlen genießen konnten. An den Speiseraum schloss sich das Herzstück der Pension an, die Küche mit der angrenzenden Vorratskammer.
Clara lugte um die Ecke. Ihre Großmutter saß an dem hölzernen Tisch, an dem die Familie ihre Mahlzeiten einnahm. Die grauen Haare waren unter einer Haube verborgen, und obwohl sie es oft am Kreuz hatte, achtete sie immer darauf, kerzengerade zu sitzen. Sie hatte eine dampfende Tasse Tee vor sich stehen und starrte aus dem Fenster. Als sie Clara eintreten hörte, stand sie auf und breitete die Arme aus.
»Clara, mien Deern! Komm, lass dich drücken.«
»Großmutter! Schön, dass du uns mal wieder besuchst. Wie geht es dir?«
Clara erwiderte die Umarmung, führte Wilma zurück zum Tisch und setzte sich neben sie.
»Deine Mutter hat wohl wenig Zeit heute.« Wilma zuckte mit den Schultern.
»Es ist Abreisetag. Da ist leider immer sehr viel zu tun. Du kennst das ja.«
»Ich habe angeboten, in der Küche zu helfen, aber sie sagt, es gäbe nichts zu tun.«
Clara entging der vorwurfsvolle Unterton in der Stimme der Großmutter keineswegs, doch sie ging mit einem Lächeln darüber hinweg.
»Sie hat gestern schon Brotteig angesetzt, der muss noch gehen. Und abgespült haben wir heute Morgen schon in aller Frühe, bevor ich zum Strand bin.«
Wilma beugte sich vor. Ihre Augen funkelten auf einmal, und Clara ahnte schon, was jetzt kommen würde.
»War dein Max auch da?«
»Großmutter! Natürlich war er da, er ist doch auch Badediener. Aber er ist nicht mein Max.«
Wilma seufzte.
»Das überleg dir mal gut, Kindchen. Er wird irgendwann Strandaufseher. Der alte Janssen kann bestimmt nicht mehr lange schuften. Und der Max ist ein adretter Junge, würde ich sagen. Du musst auch sehen, wo du bleibst. Auf der Pension sind noch so viele Schulden! Du möchtest sicher nicht im Damenbad arbeiten, bis hier alles abbezahlt ist, bestimmt willst du irgendwann eine eigene Familie.«
Clara erhob sich.
»Ich hole noch Tee.«
Sie würde dieses Gespräch nicht führen. Nicht schon wieder!
2. Kapitel
Maria Sandner hatte darauf bestanden, mit dem Raddampfer Nixe nach Norderney zu reisen. Das Schiff war erst wenige Jahre alt und versprach ein schnelles Übersetzen auf die Insel. Die Sechzigjährige stand an Deck und beobachtete, wie Rauch aus den zwei Schornsteinen des Dampfers in den Himmel stieg und die schneeweißen Wolken, die sie auf ihrer Überfahrt begleiteten, immer wieder in einen grauen Schleier tauchte. Maria beugte sich ein Stück weit über die Reling und beobachtete mit einem Schaudern, wie die Wellen an den Bug schlugen. Was die Leute nur an der See fanden! Schon bei dem Gedanken daran, wie kalt das Wasser sein musste, fröstelte es sie.
Wie viel lieber wäre sie in die Berge gereist statt auf eine Insel. Aber dieser Quacksalber, der sich Arzt schimpfte, hatte ja nicht mit sich reden lassen. Er hatte einfach darauf beharrt, dass es bei Hautkrankheiten nichts Besseres gebe als die Seeluft. Und das, obwohl er nicht einmal in der Lage war, genau zu benennen, was ihr fehlte! Diesen Mann würde sie gewiss nicht aufsuchen, wenn er nicht gleich im Nachbarhaus praktizieren würde. Zudem leistete seine im Gegensatz zu ihm liebenswerte Frau ihr regelmäßig beim Tee Gesellschaft.
Maria richtete sich auf. Sie wusste, dass die Nixe fast sechshundert Passagieren Platz bot, dennoch schien der Dampfer an diesem sonnigen Julitag beinahe überfüllt zu sein. Wo Arthur nur blieb? Es war bestimmt schon eine Viertelstunde vergangen, seit sie ihren Neffen losgeschickt hatte, um nach einem ruhigeren Sitzplatz Ausschau zu halten. Hier, in der Mitte des Decks, herrschte für Marias Geschmack zu viel Trubel. Kinder sprangen umher, Säuglinge greinten und aufgeregte junge Leute schnatterten lautstark.
Gedankenverloren begann Maria, an ihrer rechten Hand zu kratzen, doch sofort fuhr sie zusammen. Das durfte sie nicht, das hatte der Arzt klipp und klar gesagt und damit vermutlich ausnahmsweise einmal richtiggelegen. Wie gut, dass sie den Handschuh trug. Obwohl der Stoff auf ihrer Haut das Jucken nur noch schlimmer zu machen schien. Verstohlen rieb sie über die Stelle, die ihr am meisten Missbehagen bereitete. Wenn sie den Handschuh auszöge, würden alle diese münzgroße, nässende Rötung bemerken. An den Armen und Beinen sah ihr Körper auch nicht besser aus. Ach, sie durfte gar nicht daran denken, sonst würde sie sich nur wieder kratzen.
Da bemerkte sie aus dem Augenwinkel eine junge Frau, die sie aufmerksam musterte. Maria spürte, wie ihr Gesicht rot anlief, und senkte den Kopf, denn die Dame hielt nun geradewegs auf sie zu. Um Himmels willen!
»Geht es Ihnen gut?«
Maria nickte und hob den Blick. Die Frau, die ihr gegenüberstand und sie aus braunen Augen besorgt musterte, musste um die zwanzig Jahre alt sein, also etwa im Alter von Arthur; fast noch ein Mädchen. Wo um alles in der Welt steckte er nur? Er würde ja wohl kaum über Bord gegangen sein!
»Ja, vielen Dank.«
Maria zwang sich zu einem Lächeln und betrachtete die junge Frau unauffällig. Die Fremde trug einen für die aktuelle Mode ungewöhnlich schmalen Hut auf den rotbraunen Haaren und hatte auf Schmuck gänzlich verzichtet. Sie hatte eines dieser neumodischen Reformkleider an, bei denen man das Korsett wegließ, weil es angeblich nicht nur bequemer, sondern auch gesünder war. Das Kleid aus hellblauem Musselin hing gerade an ihr herunter, wurde aber durch eine helle, taillierte Jacke in Marias Augen etwas aufgewertet. Sie verstand nicht, warum so viele ihrer Geschlechtsgenossinnen es heutzutage ablehnten, ein Korsett zu tragen, obwohl es fast jeder so eine schöne Figur zauberte. Da konnte man doch wohl mal ein wenig flacher atmen.
Was mochte die Fremde wohl nach Norderney führen? Ihr praktisches Erscheinungsbild ließ Maria vermuten, dass die Frau Arbeit vor sich hatte.
»Sie finden mich ein Stück weiter in Richtung Heck, falls Sie doch Hilfe benötigen oder es Ihnen nicht gut geht. Mein Name ist Helene Grohte, ich bin Krankenschwester.«
»Vielen Dank, Fräulein Grohte.« Maria erwiderte ihr Lächeln, stellte sich aber nicht vor. »Mir geht es wirklich gut. Ich will nicht abstreiten, dass ich froh bin, wenn ich wieder festen Boden unter den Füßen habe. Aber ansonsten ist alles in Ordnung.«
Fräulein Grohte blickte Maria skeptisch an und schien zu überlegen, ob sie den Worten der Älteren Glauben schenken sollte.
»Wenn Ihnen die Überfahrt nicht bekommt, schauen Sie am besten auf den Horizont. Manchen hilft es auch, etwas trockenes Brot zu kauen«, schlug die Krankenschwester vor.
Maria hätte am liebsten die Brauen hochgezogen, stattdessen schwieg sie. Trockenes Brot! Wer war sie denn, ein Häftling?
Helene Grohte begriff endlich, dass Maria weder nach einer Plauderei noch nach einer Visite zumute war. Sie verabschiedete sich freundlich, und sobald sie ihr den Rücken zugekehrt hatte, atmete Maria tief durch. Fräulein Grohte war sehr zuvorkommend, aber das Gespräch war ihr dennoch schrecklich unangenehm gewesen. War ihre Haut denn wirklich schon so schlimm, dass sie den lästigen Juckreiz nicht einmal mehr ein paar Minuten lang unterdrücken konnte? Fiel es jedem auf – oder lag es nur daran, dass Fräulein Grohte den Umgang mit Patienten offenkundig gewohnt war?
Maria war erleichtert, als Arthur endlich auftauchte und sich durch die Menge der Leute einen Weg zu ihr bahnte. Wie gut, dass der Junge hochgewachsen war, so würde sie ihn auch im Gedränge, das sicherlich am Hafen auf sie wartete, nicht verlieren. Er drückte den Sonnenhut, den er extra für den Aufenthalt auf Norderney gekauft hatte, fest auf seine dichten braunen Haare und zuckte entschuldigend mit den Schultern.
»Es tut mir leid, Tantchen, es ist überall gleichermaßen voll. Ein ruhiges Plätzchen werden wir wohl nicht finden. Aber schau nur.« Er deutete auf den Horizont. »Man kann Norderney bereits sehen. Die Fahrt sollte nicht mehr allzu lange dauern.«
»Ist schon gut, Arthur.« Maria rückte ein Stück zur Seite, damit ihr Neffe neben ihr auf der Bank Platz nehmen konnte. Sie verschränkte die Hände im Schoß.
»Sag, bereust du es schon, dass du mit deiner alten Tante auf Reisen gegangen bist?«
Arthurs hellblaue Augen blitzten fröhlich. »Aber Tante Maria! Du bist gerade einmal sechzig. Sagst du nicht immer, du möchtest hundert Jahre alt werden?«
Maria schüttelte den Kopf.
»Das war einmal. Mit deinem Onkel Ludwig hätte ich mir das vorstellen können. Wenn ich ihn noch hätte, könnte die Ewigkeit gar nicht lang genug sein. Aber seit er verstorben ist ...«
Sie brach ab. Es war fünf Jahre her, dass Maria Sandner ihren Mann beerdigt hatte, und noch immer gab es Tage, an denen sie meinte, ohne ihn die Welt keine Sekunde länger ertragen zu können. Nicht einmal Kinder hatte er ihr hinterlassen. Wenn die Arztgattin aus dem Nachbarhaus und Arthur nicht gewesen wären, dachte Maria, hätte sie die schlimmste Zeit der Trauer kaum überstanden. Wie gut, dass Arthur kurz nach dem Ableben seines Onkels seine Lehre beendet und eine Stelle bei einer Bank in Frankfurt angenommen hatte.
Seine Mutter, Marias Schwester Lene, hatte zwar mit Engelszungen auf ihren Sohn eingeredet, damit er in seiner Heimatstadt Bonn blieb. Doch Lenes Gatte Fritz war ein bodenständiger und pragmatischer Mann, der erkannt hatte, wo Arthur bessere Aussichten auf Wohlstand hatte – zumal er bei Maria, mit der er sich immer gut verstanden hatte, eine kostenfreie Unterkunft beziehen konnte.
Ludwig, der mit Kolonialwaren ein kleines Vermögen gemacht hatte, hatte seiner Frau eine Villa im Herzen Frankfurts vererbt, die für eine Person viel zu groß war. Arthur wohnte nun schon seit mehreren Jahren im Gästezimmer und wenn es nach Maria ging, würde sich daran so schnell nichts ändern. Als klar war, dass sie zur Erholung nach Norderney reisen musste, hatte der Junge nicht gezögert und seine Sommerfrische in ihre Reisezeit gelegt, damit sie nicht alleine auf der Insel weilen musste.
Gemeinsam beobachteten sie nun das bunte Treiben auf dem Dampfer. Marias Blick fiel auf die Krankenschwester, die sie vorhin angesprochen hatte. Helene Grohte. Sie war dabei, einen schwer anmutenden Lederkoffer aus einem Gepäckregal zu wuchten. Ein älterer Herr eilte ihr zu Hilfe, und sie bedankte sich mit einem Lächeln, bevor sie den Koffer neben sich abstellte und von einem Fuß auf den anderen trat, als könnte sie es kaum erwarten, an Land zu gehen. Maria neigte den Kopf zur Seite. War das reine Freude? Oder war die junge Frau aufgeregt? Nervös, wie sie selbst? Maria ließ den Blick noch einmal über die Menschenmenge schweifen. So viele fremde Gesichter. Ganz unterschiedliche Leute hatten sich hier zufällig zusammengefunden, weil sie alle dasselbe Ziel hatten: Norderney. Ein jeder von ihnen reiste mit Hoffnungen, Erwartungen oder auch Ängsten im Gepäck. Ob die Insel ihnen allen wohlgesonnen war?
»Komm, mein Junge.« Maria stand auf und strich ihren Rock glatt. »Wir legen an, denke ich. Es ist an der Zeit, herauszufinden, was Norderney uns zu bieten hat.«
*
Julius Berlund lehnte sich an die Mauer des Post- und Telegrafenamtes. Das hohe Gebäude mit der reich verzierten Fassade warf angenehm kühle Schatten auf die Straße. Er hatte soeben, neben ein paar Reservierungsbestätigungen, die seine Tochter Clara sorgsam auf der Schreibmaschine aufgesetzt hatte, einen Brief an seine Eltern in Köln aufgegeben. Zusammen mit einer Bauskizze für ein Gästehaus, das am Rheinufer entstehen sollte. Sein Vater war für die Hilfe dankbar gewesen, und Julius hatte die Arbeit gern auf sich genommen, denn spätestens im Winter würden sie das Zubrot gut gebrauchen können. Wenn er Elisa nicht kennengelernt hätte, wäre er in die Fußstapfen seines Vaters getreten und würde als Baumeister vermutlich besser dastehen denn als Pensionswirt.
Er holte tief Luft und schloss für einen Moment die Augen. Es gab Tage, an denen er Köln vermisste. Die Möglichkeiten einer großen Stadt, die Freunde, das pralle Leben am Rhein. Am meisten trieb ihn jedoch die Sorge um seine Eltern um. Von Besuch zu Besuch musste er erleben, wie die beiden älter und gebrechlicher wurden. Geschwister hatte Julius keine, und auch wenn Elisa mehr als einmal vorgeschlagen hatte, die beiden auf die Insel zu holen – sie waren in Köln ebenso fest verwurzelt wie seine Frau auf Norderney. Ein Umzug war für die zwei undenkbar, so gern sie Julius auch auf der Insel besuchten. Wie sollte er ihnen zur Seite stehen, wenn sie ihr Tagewerk irgendwann nicht mehr bewältigen konnten? Wenn sie nicht einmal mehr die Reise nach Norderney schaffen würden?
Julius verdrängte die düsteren Gedanken und betrachtete die Leute, die an ihm vorbeiflanierten. Elegant gekleidete Ehepaare, die einander untergehakt hatten, offenbar auf dem Weg zum Abendessen. Die Herren im Anzug, die Hosen mit makellosen Bügelfalten. Viele Damen hielten einen Sonnenschirm in der Hand, und manche trugen sogar einen Gesichtsschleier, um sich den hellen Teint nicht zu verderben. Julius schmunzelte. Was für ein unsinniges Vorhaben. Die Sonne Norderneys hatte noch jedem rosige Wangen und eine leichte Bräunung ins Gesicht gezaubert. Ein paar Kinder liefen ebenfalls umher, die meisten in den üblichen, praktischen Matrosenanzügen. Mahnende Blicke der Erwachsenen trafen sie, wenn sie sich gar zu sehr neckten oder laut kicherten.
»Julius! Komm rüber, trink ein Bier mit uns.«
Julius kniff die braunen Augen zusammen, die Abendsonne blendete ihn. Auf der anderen Straßenseite stand Gerd Eksen. Er war der Sohn von Michel, der eine gut besuchte Schenke unterhielt, in der auch Julius' Schwager Ferdinand seit Jahren verkehrte. Gerd hatte vor ein paar Jahren seine eigene Wirtschaft eröffnet, direkt hier in der Poststraße, aber in einem schmucklosen Häuschen, das die Gäste oft übersahen. Umso lieber jedoch frequentierten die Einheimischen das Lokal, um ganz unter sich das ein oder andere Glas zu heben und unbehelligt von ortsfremden Ohren über ihre Nöte zu reden.
Julius winkte und überquerte die Straße, wobei er den Passanten geschickt auswich. Er ging eigentlich nicht gern in Gaststätten, sondern verbrachte seine Zeit am liebsten mit seiner Frau und den Mädchen. Dennoch wusste er es zu schätzen, dass Gerd ihn einlud, deshalb würde er auf ein Bier einkehren. Elisa, da war er sicher, hätte ihn auch dazu ermuntert.
»Moin, Gerd«, grüßte er, als der Wirt ihm die Tür aufhielt.
»Komm rein, Julius. Magst du ein Bier? Oder etwas Stärkeres?« Er deutete auf die hölzernen Regale hinter sich, in denen sich Flasche an Flasche reihte. »Ist nicht viel los heute, aber ich habe auch gerade erst aufgesperrt.«
»Ein Bier kann ich vertragen. Danke.«
Julius nahm an einem der Tische Platz und sah darüber hinweg, wie klebrig die Holzplatte war, obwohl der Abend noch gar nicht richtig begonnen hatte. Gerd stellte ihm ein Glas hin, und Julius nahm einen Schluck von dem kühlen Getränk. Am Nachbartisch saßen zwei grauhaarige Fischer, die er nur vom Sehen kannte. Er nickte ihnen zu, doch die beiden hoben kaum den Blick von den Unterlagen, über denen sie die Köpfe zusammengesteckt hatten.
Am Tresen stand ein Mann, der sich nun zu ihm umdrehte. Sören Janssen, der Strandaufseher. Julius unterdrückte ein Seufzen. Mit den hellen Augen und den beinahe schwarzen Haaren sah er seinem Sohn ähnlich, wenngleich Max seinen Vater um einen halben Kopf überragte.
»Julius«, grüßte Sören, nahm sein Glas und schlenderte zu ihm herüber.
»Guten Abend, Sören.«
»Wie gehen die Geschäfte?«
Ohne zu fragen, ließ Sören sich auf den Stuhl gegenüber von Julius fallen. Dem war vollkommen klar, dass der Strandaufseher nicht aus Sympathie, ja nicht einmal aus Höflichkeit, sondern aus Neugier zu ihm gekommen war. Julius nahm betont langsam noch einen Schluck von seinem Bier. Sören wusste bestimmt genauso gut wie er, dass Max sich in Clara verguckt hatte. Seit der Junge sich um das Mädchen bemühte, strafte dessen Vater Julius immer wieder mit abschätzigen Blicken. Der Strandaufseher tat beinahe so, als hätten Elisa und Julius Clara ermutigt, Max schöne Augen zu machen. Als ob seine Tochter das nötig hätte!
»Danke. Es läuft alles gut. Am Strand auch, hoffe ich?«
Natürlich war Julius bekannt, dass Sören von der Gemeinde bezahlt wurde. Die Sorgen der Gastwirte, die nie wussten, wie hoch die nächsten Einnahmen ausfallen würden und ob das Geld reichen würde, um alle Rechnungen zu begleichen, kannte Janssen gar nicht. Und obwohl es die vielen Gäste waren, die ihm sein Auskommen sicherten, haderte Sören mit der Entwicklung der Insel. Sein Vater war Fischer gewesen, und wenn es nach Sören ginge, wäre Norderney noch immer ein kleines Fleckchen Erde, auf dem ein paar Einheimische in Ruhe ihren Angelegenheiten nachgingen. Mehr nicht. Ganz besonders viel hatte er gegen Leute wie Julius, die sich seiner Ansicht nach auf der Insel ins gemachte Nest setzten.
Egal, wie lange Julius auf Norderney lebte, wie viel er für den Wohlstand der Insel tat, für Männer wie Sören würde er immer ein Schmarotzer bleiben. Jemand, der nicht dazugehörte.
»Sicher«, beantwortete Sören nun die Frage. »Ist viel los am Strand. Es kommen immer mehr Gäste. Die pilgern ja geradezu hierher. Wir müssten alle über hundert Jahre alt werden, wenn das Seewasser und die Inselluft wirklich so heilsam wären, meinst du nicht?«
Er schnalzte mit der Zunge und beugte sich ein Stück zu Julius herüber, als wollte er ihm ein Geheimnis anvertrauen.
»Dir hat unsere Insel auch geholfen, nicht?«
Julius schluckte. Er nahm noch einen Schluck Bier, um Zeit zu gewinnen. Was bezweckte Sören mit seiner Frage? Wollte er ihn provozieren? Julius stellte sein Glas ab und drehte es zwischen den Fingern. Sören verlor die Geduld.
»Was ist los? Hat es dir die Sprache verschlagen? Ich habe nur gesagt, dass es dir besser geht, seit du hier wohnst. Stimmt das etwa nicht?«
»Doch. Natürlich. Mein Arzt hat mich damals hergeschickt. Es ist schon so, dass bei Lungen- und Hautkrankheiten ein Aufenthalt auf Norderney hilfreich ist.«
»Und darum bist du gleich ganz geblieben. Weil's so bequem war hier.« Es war eine Feststellung, keine Frage. Sören streckte die Beine aus und verschränkte die Arme vor der Brust.
Julius seufzte. »Ich bin wegen Elisa geblieben. Sie konnte ja nicht weg.«
Warum antwortete er dem Kerl überhaupt? Erstens kannte Sören die Geschichte ganz genau, zweitens ging es ihn einen feuchten Kehricht an.
»Ach ja, die fleißige Elisa und ihre Pension.« Das klang spöttisch. Julius' Finger schlossen sich noch fester um sein Glas. Der Strandaufseher schmunzelte.
»Manchmal denke ich ja, es wäre schön, wenn meine Ursula auch Geld ranschaffen würde. Aber ganz ehrlich, sie soll den Haushalt führen und es sich ansonsten gut gehen lassen. Ich gönne es ihr. Ich verdiene genug am Strand und muss mich nicht von meiner Frau oder meinem Kind aushalten lassen. Reicht schon, wenn ich mich mit all den Verrückten vom Festland abplagen muss.«
Julius hob sein Glas, leerte es in einem energischen Zug und knallte es auf den Tisch. Seine Finger zitterten, als er in der Tasche seiner Strickjacke, die eigentlich viel zu warm für den lauen Sommerabend war, nach ein paar Münzen kramte und sie neben das Glas legte.
»Ich sollte gehen.«
»Wieso? Hat Elisa etwa nicht alles im Griff? Das kann ich mir kaum vorstellen.«
Julius biss sich auf die Unterlippe. Er würde nichts erwidern. Es lohnte sich nicht. Ein uneinsichtiger Sturkopf war Sören, ein Ewiggestriger, mehr nicht.
»Oder musst du noch Handlanger für sie spielen? Bei was auch immer.«
Sören grinste anzüglich, und Julius schob kurz beide Hände in die Hosentaschen. Dann setzte er den Hut, den er neben sich auf dem freien Stuhl abgelegt hatte, wieder auf.
»Julius!« Gerd trat aus dem Lagerraum, ein kleines Fass in den Händen. Er hatte Sörens Tiraden offenbar nicht mitbekommen. »Willst du etwa schon los?«
»Ja, Gerd.«
Julius klopfte ihm auf die Schulter und deutete mit einem kaum merklichen Kopfnicken in Sörens Richtung. Im Flüsterton fuhr er fort: »Ist nicht meine Gesellschaft heute.«
Gerd runzelte die Stirn und öffnete den Mund, um etwas zu erwidern, doch Julius winkte ab.
»Lass gut sein. Beim nächsten Mal bringe ich mehr Zeit mit.«
Er ging aus der Tür, ohne sich noch einmal umzudrehen. In seinem Rücken spürte er Sörens Blicke wie Fackeln auf seiner Haut. Er lief ein paar Schritte die Straße entlang, um Abstand zu gewinnen, dann lehnte er sich an eine Hauswand. Tief durchatmen. Die Wut hinunterschlucken. Wie gut, dass er sich zusammengerissen hatte.
Es hatte keinen Sinn, einen Streit anzufangen. Dazu war die Insel zu klein, man lief sich ständig über den Weg. Vor allem, wenn die Möglichkeit bestand – und bei diesem Gedanken rann Julius ein Schauer über den Rücken –, dass Sören Claras Schwiegervater werden und bei ihnen ein und aus gehen könnte. Julius schluckte.
Clara durfte auf keinen Fall erfahren, wie Janssen über Elisa gesprochen hatte. Sie war wie ihre Mutter: Sie würde in die Luft gehen und die Familie mit ausgefahrenen Krallen verteidigen. Doch Clara sollte sich selbst eine Meinung über die Janssens bilden. Außerdem war ja nicht Sören auf Freiersfüßen, beruhigte Julius sich, sondern es war Max, der Interesse an Clara zeigte. Der sanftmütige Max, den er nie anders als wohlerzogen und höflich erlebt hatte. Der seit Jahren bei ihnen vorbeikam. Clara war eine kluge junge Frau. Wenn sie sich für Max entschied, würde das schon richtig sein. Und wenn nicht?
Bei dem Gedanken huschte ein Lächeln über Julius' schmales Gesicht. Nun, er wäre gewiss nicht traurig, wenn er Sören nicht in der Familie begrüßen musste. Ganz gewiss nicht.
3. Kapitel
Helene Grohte wischte sich mit dem Handrücken den Schweiß von der Stirn. Am liebsten hätte sie den Kragen ihres Kleides gelockert und sich den Hut von den kastanienbraunen Haaren gerissen, doch sie wollte keinesfalls einen schlechten Eindruck machen. Nicht gleich bei ihrer Ankunft! Also schleppte sie den Koffer, der mit jedem Schritt schwerer zu werden schien, weiter über die Georgstraße. Endlich tauchte der hohe Bau aus rotem Backstein vor ihr auf, der mit dem spitzen Giebel und den tiefen Fenstern beinahe herrschaftlich wirkte.
Helene blieb stehen, setzte den Koffer ab und drückte die Hände in den schmerzenden Rücken. Dann betrachtete sie das Gebäude. Das also war das Marienheim. Eine Erholungsstätte für Diakonissen, unter deren Leitung das Haus stand, vor allem aber für Kinder, die auf Norderney aufgepäppelt wurden. Das Heim gab es schon lange, aber der Neubau war erst vor wenigen Jahren entstanden, wusste Helene. Ob man sie willkommen heißen würde?
Die Krankenschwester biss sich auf die Unterlippe. Vielleicht war es keine gute Idee gewesen, sich darauf einzulassen, ein Zimmer im Marienheim zu beziehen. Für die Kirchengemeinde, in deren Diensten sie ab morgen stehen würde, war es wohl die einfachste Lösung gewesen, sie hier unterzubringen. Helene fürchtete jedoch, dass nicht alle Diakonissen ihr wohlgesonnen sein würden. Sie erinnerte sich an die mahnenden Worte, die ihre Mutter ihr in Bremen mit auf den Weg gegeben hatte. Bertha Grohte war felsenfest davon überzeugt, dass die Diakonissen, die doch auch in der Krankenpflege bewandert waren, ihr Steine in den Weg legen würden, wo es nur ging. Warum sollten sie es akzeptieren, dass auf einmal ein junges, beinahe noch gänzlich unerfahrenes Ding von außerhalb kam und in ihre Fußstapfen treten wollte?
Helene hatte immer abgewunken und die Augen verdreht, aber wenn sie ehrlich war, hatten die Warnungen der Mutter sie nicht kalt gelassen. Was, wenn ihr wirklich nur Feindseligkeit entgegenschlug?
Seufzend nahm Helene den Koffer wieder in die Hand. Jetzt war es für solche Überlegungen ohnehin zu spät, also konnte sie es auch gleich hinter sich bringen und anklopfen. Sie machte einen zaghaften Schritt auf die Treppe zu, die zu der hölzernen Eingangstür führte, als jemand ihren Namen rief.
»Fräulein Grohte? Sind Sie Helene Grohte?«
Sie blieb stehen und wandte sich um. Ein Mann, vermutlich nur wenige Jahre älter als sie selbst, eilte auf sie zu. Sein schmaler Körper steckte in ausgebeulten Hosen und einem Hemd aus grobem Leinen. Im Laufen zog er sich die Mütze vom Kopf. Mit zerzausten blonden Haaren und außer Atem, aber mit einem freundlichen Lächeln, das seine braunen Augen leuchten ließ, kam er vor ihr zum Stehen und deutete eine Verbeugung an.
»Willkommen auf Norderney. Mein Name ist Johan Meyer, ich bin der Pastor.«
Er musste Helenes überraschten Blick bemerkt haben, denn er kratzte sich verlegen am Kinn.
»Bitte entschuldigen Sie mein Auftreten. Ich muss zugeben, dass mir Ihre heutige Anreise beinahe entfallen ist.«
Der Pastor blickte so zerknirscht drein, dass er Helene an einen Hundewelpen erinnerte, den man bei einem Streich erwischt hatte. Sie unterdrückte ein Lachen. Obwohl sie sich alle Mühe gab, Meyer nicht in Verlegenheit zu bringen, lief sein Gesicht rosa an.
»Tatsächlich war ich gerade dabei, in meinem Garten ein wenig Ordnung zu schaffen. Ich ziehe Obst und Gemüse, wissen Sie.«
»Das ist doch nicht schlimm«, unterbrach Helene ihn. »Ich weiß selbst, wie schnell man manchmal in seiner Arbeit versinkt. Ehrlich gesagt, hatte ich auch gar nicht damit gerechnet, dass Sie mich persönlich begrüßen. Ich wollte mich gerade im Marienheim melden.«
Pastor Meyer drückte den Rücken durch.
»Es ist doch selbstverständlich, dass ich Sie begrüße. Wir freuen uns alle sehr, dass wir jetzt eine Gemeindeschwester haben.«
»Die Diakonissen auch?«, rutschte es Helene heraus.
Sie schlug die Hand vor den Mund. Herrje, sie hatte ihren neuen Vorgesetzten nicht gleich bedrängen wollen. Tatsächlich senkte Johan betreten den Blick und starrte für einen Moment auf die Spitzen seiner groben Stiefel, an denen noch Erde von der Gartenarbeit klebte. Dann räusperte er sich.
»Die meisten bestimmt.«
Der Pastor hob den Kopf, und nun lag eine gewisse Entschlossenheit in seinen grünen Augen. »Wissen Sie, die Diakonissen wollten nicht auf das Tragen ihrer Tracht verzichten. Das ist ihr gutes Recht, aber anscheinend nicht mit der Krankenpflege vereinbar. Mir persönlich wäre es einerlei gewesen, aber ...« Er zuckte mit den Schultern.
Helene nickte. »Man hat mir gesagt, dass aus Rücksicht auf die Kurgäste so entschieden wurde.«
»Das stimmt. Sonst hätten die lieben Schwestern sicher gerne weiterhin die Krankenpflege übernommen. Obwohl ihnen auch so genügend Arbeit bleibt. Die Versorgung der kranken Kinder im Sommer und dann in den kalten Monaten die Strickschule, die Verköstigung der armen Kinder, die Näh- und die Jungfrauenabende. Da bleibt ohnehin kaum Zeit.«
Johan bedeutete Helene, ihm zu folgen, als er ihren Koffer nahm und die Stufen zur Eingangstür hochstieg. Auf sein Klopfen hin öffnete eine Diakonisse in der üblichen schwarzen Tracht, die Haare unter einer Haube verborgen. Helene fiel ein Stein vom Herzen, als die Fremde nicht nur dem Pastor, sondern auch ihr ein freundliches Lächeln schenkte.
»Pastor Meyer, bringen Sie uns das Fräulein Grohte?«
»Ja, Schwester Gerlinde. Das ist Helene Grohte, unsere neue Gemeindeschwester.«
»Herzlich willkommen im Marienheim. Wir haben Ihr Zimmer schon vorbereitet. Bitte folgen Sie mir.«
»Ich darf mich dann verabschieden«, bemerkte der Kirchenmann jedoch und stellte den Koffer ab. »Fräulein Grohte, bitte melden Sie sich morgen um neun bei mir. Kommen Sie einfach zur Kirche, die ist nicht zu verfehlen. Dann können wir alles Weitere besprechen.«
»Sehr gerne. Vielen Dank noch einmal.«
Der Pastor wandte sich ab, und als hätten sie sich abgesprochen, griffen die Frauen gemeinsam nach dem Koffer. Gerlinde lachte.
»Ein schweres Trumm. Aber zu zweit schaffen wir es schon die Treppe hoch.«
Sie brachte Helene in den ersten Stock und führte sie durch einen hell gestrichenen Flur, der mit Linoleum ausgelegt war. Allenthalben gingen schwere, dunkle Holztüren davon ab.
»Auf diesem Flur haben die Diakonissen ihre Unterkünfte, und hier gibt es auch ein Isolierzimmer. Im letzten Sommer hatten wir zwei Kinder mit Diphtherie. Zum Glück ist es glimpflich ausgegangen.«
»Wo schlafen die Kinder?«
»Die Schlafsäle sind ein Stockwerk höher. Natürlich gibt es immer eine Aufsicht.«
Sie schüttelte lachend den Kopf. »Sie können sich gar nicht vorstellen, auf was für Gedanken die Kleinen sonst kommen. Wenn es nach ihnen ginge, würden sie die ganze Nacht lang spielen, aber sie sind natürlich hier, weil sie Erholung brauchen.«
Helene sah sich in dem Flur um. Einige Schränke und Kommoden waren an die Wände geschoben worden. Auf einem Regal stand Sandspielzeug, was Helene zum Schmunzeln brachte.
»Ach herrje«, meinte Gerlinde lachend, als auch ihr Blick auf das Eimerchen fiel, »das muss die kleine Ida gewesen sein. Das Mädchen vergisst irgendwann noch seinen eigenen Kopf! In den Schränken hier finden Sie übrigens jederzeit frisches Leinen, Fräulein Grohte. Sie dürfen sich gern bedienen. Für die benutzte Wäsche gibt es einen Korb in der Kammer neben der Küche.«
»Bitte, nennen Sie mich ruhig Helene.«
»Einverstanden. Ich bin Gerlinde. Wo kommen Sie her, wenn ich fragen darf?«
»Aus Bremen.«
»Ich bin aus Hannover und seit vier Jahren auf der Insel. Ist das hier Ihre erste Anstellung?«
»Nicht ganz. Ich habe schon ein paar Monate in einem Krankenhaus gearbeitet.«
Ihr Magen krampfte sich zusammen, als Gerlinde nun eine Tür öffnete und einen Schritt zur Seite machte, damit Helene ihr neues Zuhause in Augenschein nehmen konnte. Zögernd trat sie ein. Das Zimmer war klein, aber hell. Helene ging zu dem tiefen Fenster hinüber und schob den blütenweißen Vorhang ein Stück beiseite. Ihr Zimmer lag zur Georgstraße hinaus. Ein paar Kinder kamen offenbar gerade von einem Ausflug zurück und schnatterten so aufgeregt, dass Helene ihre Stimmen durch das geschlossene Fenster hören konnte, wenn sie auch nicht jedes Wort verstand. Eine Diakonisse begleitete die Kleinen und gab acht, dass sich alle gründlich die Schuhe abtraten, dann verschwanden sie im Marienheim. Helene schob den Vorhang wieder vor die Scheibe und drehte sich um, um den Rest ihres Zimmers zu begutachten.
Ein einfaches Bett, unter das ein Nachtgeschirr geschoben worden war, stand an der Wand. Es war mit sauberen weißen Laken bezogen. Daneben gab es einen schmalen Tisch mit verschnörkelten Eisenfüßen, auf dem ein Krug und eine Waschschüssel Platz gefunden hatten. Sogar ein kleines Stück Seife lag auf einem sorgfältig gefalteten Leinentuch parat. Bei diesem Anblick fühlte Helene sich auf einmal wieder staubig und schmutzig von der langen Reise. Sie konnte es kaum erwarten, sich frischzumachen. Ein Kleiderschrank aus Holz und ein Tisch mit einem einzelnen, aber bequem aussehenden Stuhl rundeten die Einrichtung ab. Selbst an eine Petroleumlampe war gedacht worden. Helene, die abends gern las, freute sich darüber.
»Das ist ein sehr schönes Zimmer. Vielen Dank«, sagte sie zu Gerlinde.
»Sehr gerne.« Die Diakonisse klatschte in die Hände. »Dann lasse ich Sie mal allein, damit Sie sich einrichten können. Wir essen um sieben. Der Speisesaal ist im Erdgeschoss, links der Treppe. Folgen Sie einfach dem Lärm.«
»Das mache ich. Nochmals vielen Dank!«
Sobald die Tür hinter Gerlinde ins Schloss gefallen war, ließ Helene sich aufs Bett sinken. Wie müde sie war! Die Reise hatte sie mehr angestrengt, als sie vermutet hätte. Sie zwang sich, sich aufrecht hinzusetzen. Auf keinen Fall durfte sie jetzt einschlafen. Der Koffer musste ausgepackt werden, und sie musste sich fürs Essen zurechtmachen. Außerdem wollte sie noch einen Brief an ihre Mutter aufsetzen, damit diese erfuhr, dass Helene gut angekommen war. Sie stand auf, öffnete ihren Koffer und hängte die Kleidungsstücke, die sie mitgebracht hatte, in den Schrank. Auch Mantel, Mütze, Schal und Handschuhe hatte sie eingepackt. Vermutlich kam der Winter schneller, als sie ahnte, und sie wusste, wie beißend kalt es hier an der See werden konnte, wenn der Wind um die Häuser toste und einem in die Haut schnitt. Er hatte so viel davon erzählt, dass sie die eisige Luft förmlich auf ihrer Haut gespürt hatte. Er ... nein, an ihn wollte sie jetzt nicht denken!
Helene legte das Nachthemd auf ihr Bett, dann streifte sie das Reisekleid ab, bürstete die braunen Haare aus und wusch sich mit dem angenehm kühlen Wasser, das man für sie bereitgestellt hatte. Die Seife roch herb und frisch zugleich. Beinahe wie die Luft der Insel. Ob sie auf Norderney hergestellt worden war?
Dann zog sie einen frischen Rock und eine schlichte Bluse an. Danach konnte sie allerdings der Versuchung nicht mehr widerstehen und legte sich kurz aufs Bett. Es tat so gut, sich nach der langen Reise auszustrecken. Helene gähnte. Wie weich das Kissen war! Nur ganz kurz würde sie die Augen schließen. Einen winzigen Moment.
Ein Klopfen an der Tür riss sie aus dem Tiefschlaf. Helene setzte sich auf und rieb sich die Augen. Wo war sie? Das Zimmer war ihr ganz fremd. Ach je, natürlich. Sie war auf Norderney, im Marienheim. Ihre neue Stelle. Und draußen dämmerte es bereits. Auf einen Schlag war Helene hellwach.
»Ich komme«, rief sie, denn das Klopfen hörte nicht auf. Im Gegenteil, das Hämmern wurde immer lauter. Helene schlüpfte eilig in ihre Schuhe. Wie gut, dass sie zumindest vollständig bekleidet eingeschlafen war. Sie fuhr sich kurz durch die Haare, dann eilte sie zur Tür.
»Entschuldigen Sie«, sagte sie zu der Frau, die ihr gegenüberstand und sie aus grauen Augen musterte. »Ich muss eingeschlafen sein. Wissen Sie, wie spät es ist?«
»Bereits viertel nach.« Die Diakonisse, sie mochte um die vierzig sein und überragte Helene beinahe um Haupteslänge, hob die Augenbrauen. »Das Abendessen wird um Punkt sieben serviert, wie Gerlinde Ihnen sicherlich mitgeteilt hat.«
Helene spürte, wie ihre Wangen rot anliefen, doch die Diakonisse war noch nicht fertig mit ihr.
»Sie können von Glück sagen, dass die Heimleiterin, Schwester Jella, heute noch einen Termin hat und Sie erst morgen kennenlernen wird. Sie legt großen Wert auf Pünktlichkeit.«
»Natürlich«, murmelte Helene. »Ich bitte um Verzeihung. Wirklich, ich kann es mir selbst nicht erklären. Aber die lange Reise ...«
»Sie sind doch noch jung. Was ist, wenn Sie demnächst nachts gerufen werden?« Die Diakonisse schien noch etwas hinzufügen zu wollen, biss sich dann aber auf die Unterlippe.
Helene lächelte zaghaft.