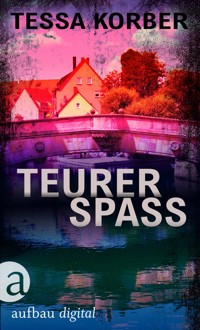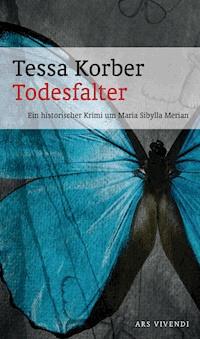17,99 €
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Frieda, freiberuflich arbeitende Grafikerin, wünscht sich nichts mehr als einen liebevollen Partner, doch bisher hat es nie geklappt. Nun mit Mitte fünfzig macht sich eine immer lauter werdende Sehnsucht in ihr breit. Und nur an die Macht des Schicksals zu glauben, führt zu gar nichts. Als ihre pragmatische Freundin Yvonne sich und Frieda kurzerhand bei »Herzmatch« anmeldet, bringt sie damit deren Seelenfrieden gründlich in Aufruhr. Arrangierte Dates sind Frieda ein Graus. Viel lieber würde sie die Katze aufnehmen, die seit einiger Zeit regelmäßig auf ihrem Balkon auftaucht. Friedas Versuche, den Mann fürs Leben zu finden, lösen eine Reihe komischer wie tragischer Situationen aus, die sie beinahe verzweifeln lassen. Doch Frieda ist nicht so allein, wie sie zu sein glaubt, denn es gibt jemanden, der ihr den richtigen Weg weist. »Unverblümt erzählt Tessa Korber von den verschiedenen Facetten des (Allein-)Lebens. Emotional und ehrlich.« FREUNDIN
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 396
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Frieda, freiberuflich arbeitende Grafikerin, wünscht sich nichts mehr als einen liebevollen Partner, doch bisher hat es nie geklappt. Nun, mit Mitte fünfzig, macht sich eine immer lauter werdende Sehnsucht in ihr breit. Und nur an die Macht des Schicksals zu glauben, führt zu gar nichts.
Als ihre pragmatische Freundin Yvonne sich und Frieda kurzerhand bei ›Herzmatch‹ anmeldet, bringt sie damit Friedas Seelenfrieden gründlich durcheinander. Arrangierte Dates sind ihr ein Graus. Viel lieber würde sie die Katze aufnehmen, die seit einiger Zeit regelmäßig auf ihrem Balkon auftaucht. Friedas Versuche, den Mann fürs Leben zu finden, lösen eine Reihe ebenso komischer wie tragischer Situationen aus, die sie beinahe verzweifeln lassen. Doch Frieda ist nicht so allein, wie sie zu sein glaubt, denn es gibt jemanden, der ihr den richtigen Weg weist.
© Cherima Nasa
Tessa Korber, 1966 geboren, hat Literaturwissenschaft und Geschichte studiert. Seit ihrem Bestseller ›Die Karawanenkönigin‹ ist sie freie Schriftstellerin. Ihr Roman ›Alte Freundinnen‹ erschien 2021 bei DuMont. Sie lebt mit ihrem Mann in Nürnberg.
Tessa Korber
Das Leben im Großen und Ganzen
Roman
Von Tessa Korber ist bei DuMont außerdem erschienen:
Alte Freundinnen
E-Book 2023
© 2023 DuMont Buchverlag, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Umschlagabbildung: © Sophia Radionov
Satz: Fagott, Ffm
E-Book Konvertierung: CPI books GmbH, Leck
ISBN E-Book 978-3-8321-6074-6
www.dumont-buchverlag.de
Für Luzie,
I
Das Leben im Großen
1
Geduld
Die Katze war da. So, wie nur eine Katze da sein kann. Die anderen Katzen in der Straße und dem umliegenden Revier waren sich dieser neuen Anwesenheit wohl bewusst und hielten einen von intensiven Blicken durchkreuzten Abstand. Die Vogelwelt war ebenfalls im Bilde, schwieg und ließ Raureif auf den letzten zu Boden schwebenden Tönen wachsen. Die Eichhörnchen turnten höher in die kahlen Straßenbäume und erwogen den kühnen Notsprung ins Nachbargeäst. Nur die Mäuse in den Kabelschächten raschelten weiter. Sie waren Fatalisten und kannten ihren Platz in der Nahrungskette. So viele, wie sie waren, würden sie weiterbestehen. Vielleicht hatten sie auch bemerkt, dass das Interesse des fremden Tieres in diesem Moment nicht ihnen galt.
Die schwarz hingeduckte Silhouette lag locker federnd auf vier vornehm weißen Pfoten. Der weiß belatzte Hals war leicht vorgereckt. Die Schwanzspitze zuckte. In der schwarz-weißen Maske des Gesichts saßen Augen, die bei Bedarf grün wie unreife Pflaumen leuchten konnten oder bernsteinfarben wie ein Spätsommernachmittag. Jetzt allerdings, an diesem blassgoldenen Märzmorgen, wirkten sie eher quittengelb; die Pupillen waren im hellen Licht der Spätwintersonne eng zusammengezogen. Ihnen entging nichts. Auch das war den anderen Katzen klar, ebenso den Vögeln, den Eichhörnchen und selbst den Mäusen.
Nur Frieda Fuchs, Voltastraße 47a, zweiter Stock links, in deren Blumenkasten das Tier an diesem Morgen zwischen abgestorbenen Sonnenblumenstängeln und lange erfrorenen Primeln hockte, diese Frieda bemerkte nicht, dass ein intensiver Blick jeder ihrer Bewegungen folgte.
Frieda war es gewohnt, unbeobachtet zu sein. Sie war Single und lebte allein. Frieda wusste alles über das Alleinsein, auf ihrem Nachttisch lagen die maßgeblichen Werke dazu. Sie hatte gelesen, dass Alleinsein nicht dasselbe zu sein brauchte, wie einsam zu sein. Dass man auf niemanden warten musste, um die schönen Dinge des Lebens in Angriff zu nehmen. Dass man sich Duftbäder gönnen, Kerzen auch ohne Anlass anzünden und sich selbst Blumensträuße schenken durfte. Und sie wusste, dass dies in manchen Momenten sogar zwingend notwendig war, um den Tag zu überleben. Außerdem stand in Friedas Büchern, dass das Alleinsein als Chance begriffen werden sollte, sich selbst mal so richtig zu finden.
Frieda fand sich nun seit beinahe fünf Jahren selbst. Und sie hatte viel aus ihren Büchern gelernt. Zum Beispiel morgens nach dem Aufstehen, wenn sie ins Bad tapste, das Radio anzustellen, damit die Wohnung sich nicht so leer anfühlte und die Musik ihre Lebensgeister in Schwung brachte.
Im Bad angekommen, zog Frieda ihrem Spiegelbild eine Grimasse und rieb sich die Wangen, auf denen die Falten in ihrem Laken so viele traumverwirrte Abdrücke hinterlassen hatten. Das reinste Labyrinth, durch das man erst einmal zurückfinden musste in den Tag. Als freie Grafikerin, die zumeist daheim arbeitete, musste sie in keinem Büro auftauchen, wo andere beurteilten, ob das »innere Leuchten ihrer Persönlichkeit«, das für Frauen ihres Alters gerne als relevant gepriesen wurde, durch ihre Krähenfüße nun beeinträchtigt wurde oder nicht. Ihre Freundin Yvonne meinte »Ja« und hatte ihr zum letzten Geburtstag ein Set aus teuren Tuben und Tiegeln geschenkt, dem Frieda noch nicht näher gekommen war. Staub sammelte sich auf der Geschenkfolie.
Frieda mochte es einfach. Am längsten dauerte an ihrer morgendlichen Toilette das Kämmen, denn ihre dunkle von zahlreichen silbernen Fäden durchzogene Krause war lang und widerspenstig.
Es ist nicht bekannt, ob es der zitternde Tanz dieser Kringellocken war, der die Katze so faszinierte. Doch sie betrachtete Frieda mit einer leichten, einer ganz leichten Bewegung des Kopfes – die in der Winterluft unsichtbare Energiewellen von höchster Dichte schuf –, um ihr mit Blicken in die Küche zu folgen. Dort setzte Frieda, noch im Schlafanzug, Teewasser auf und suchte einen anderen Sender, weil das fröhliche Morgengeplauder der Moderatoren sie jetzt, da sie sich im selben Raum wie das Radio befand und die Worte verstehen konnte, zunehmend nervte. Sie wählte einen Klassiksender, Barock, sprudelnd wie Schlossparkfontänen, passend zu dem Wintersonnenlicht, das durch die hohen Altbaufenster hereinfloss und den Raum prachtvoll leuchten ließ wie eine weiß gedeckte Geburtstagstafel.
Wenn sich die Katze in die andere Richtung wenden würde, zu der großen Tür direkt vor ihrer Nase, würde sie das Wohnzimmer von Frieda sehen, das eher ein Arbeitszimmer genannt werden musste. Friedas großer Grafikerinnen-Schreibtisch war dort aufgebaut, mit all den Bildschirmen, mit der freien Fläche fürs Zeichnen, den Stiftebechern, Messern, Scheren und Linealen. Frieda bastelte noch immer gerne von Hand. Das Sofa machte sich dagegen klein an der Wand aus, es war durchgesessen, aber gemütlich, das typische Möbel eines Menschen, der überwiegend selbst darauf sitzt. Ob die Katze erwog, wie es wohl wäre, sich dort in einer der Kuhlen zusammenzurollen? Es ließ sich nicht sagen.
Der Quittenblick ließ Frieda keine Sekunde los, verfolgte ihr Hantieren, das kurze Frühstück – bestehend aus einer Tasse Schwarztee mit Milch –, und schien sich, als Frieda in das auf der Nordseite der Wohnung liegende Schlafzimmer wechselte, durch die Wände zu bohren, sodass ihm nichts entging, bis Frieda bekleidet zurückkam. Sie verschwand in den Flur. Die Katze blinzelte einmal. Dann wandte sie sich um und reckte den Hals über die Brüstung zum Eingang.
Als Frieda in Mantel, Mütze und Handschuhen unten aus der Tür trat, lag der fremde Blick bereits in ihrem Nacken. Er folgte dem Flattern ihres villakunterbunten selbst gestrickten Schals, bis er um die Ecke mit dem Friseurladen verschwand.
Jetzt kam Leben in die Katze. Zwei Sprünge, etwas Geraschel, ein wenig Schwerkraft und ein Beben in dem Spalier, das der alten Glyzinie Halt gab, die den Ziegelbau umklammerte. Dann war die Katze auf der Straße. Die Eichhörnchen atmeten vorsichtig auf.
Katzen gehen nicht Gassi. Aber sie könnten. Sie sind in der Lage, sich durchgängig und kontinuierlich durch Straßen zu bewegen, auch an der Seite eines Menschen, falls die Neugier oder etwas anderes sie dazu treibt. Es ist nur eine andere Art des Gassigehens. Keines, das sich an Gehsteige hielte jedenfalls. Keines, das zwei Punkte durch eine Gerade auf kürzestem Wege verbindet. Wozu Geraden gut sein sollen, und Kürze vor allem, das sehen Katzen nicht ein. Vielleicht sollte man sich ihre Argumente dagegen einmal anhören.
Die schwarze Katze tat, was alle Katzen tun: Sie mäanderte. Um ihr Ziel herum, das sie keinen Moment aus Augen oder Sinn verlor, kreuzte sie Vorgärten, querte sie Hinterhöfe und schlich über Dächer; sie umkurvte Mülltonnen, glitt durch Kellerfenster hinab und schnürte Hintertreppen wieder hinauf. So kam sie voran, selbst unsichtbar wie ein Geist, manchmal so dicht hinter Frieda vorbeihuschend, dass sie sie beinahe berührte, manchmal als sachtes Rumoren hinter der Wand. Aber niemals, niemals auf dem ganzen verschlungenen Weg verlor sie Frieda auch nur einen Moment von ihrem Radar.
Die Katze mit der schwarz-weißen Maske verpasste keinen Satz des kurzen Gesprächs, mit dem Frieda den Obsthändler in seinem rot-weiß gestreiften Zelt zum Lachen brachte, ehe er sich wieder abwandte, um sich die Hände an seinem kleinen Maroni-Ofen zu wärmen. Sie bekam genau mit, wie Frieda dem Autofahrer fröhlich dankend zuwinkte, der an der Mündung der Falkenberger Gasse anhielt, um sie queren zu lassen, und wie ihr Schritt sich beschwingte, als der Fahrer zurückwinkte. Sie hörte genau, wie Frieda der Dame am Bankschalter ein Kompliment für ihr Seidentuch machte. Hörte sie es durch die Glasfront der Filiale? Oder las sie die Lippen? Vielleicht schloss sie auch nur alles aus dem verspäteten Lächeln, dass das trockene Gesicht der Dame überzog, als Frieda bereits auf dem Weg zur Tür war und ihre Auszüge einsteckte. Möglich auch, dass alle relevanten Nachrichten wie Telefonsignale einfach und unverschlüsselt an den mentalen Fäden entlangliefen, mit denen die Katze Frieda fest umsponnen hielt, dieses Tier, das leise vor sich hin schnurrend unter einem geparkten Wagen hockte, während Frieda auf der Bugwelle der guten Laune, die sie um sich verbreitete, mit vollen Segeln dahinschipperte. Sie befand sich wieder auf dem Heimweg.
Die Katze wusste das längst und kürzte ab. Als Frieda in der Straße mit den vierstöckigen Jahrhundertwendefronten auftauchte, den heruntergekommenen Torbogen durchschritt, der 47a von 47b und c samt ihren Torbögen trennte, und die Haustür aufschloss, die Wangen von der Kälte winterapfelrot, die Krauslocken feucht, die Hände zu klamm, um sofort zum Stift zu greifen, da kauerte die Katze bereits wieder im Blumenkasten, unbemerkt und ungeahnt. Sie betrachtete mit ihrem Raubvogelblick, wie Frieda sich eine Tasse von dem lauwarm gewordenen Tee holte, sich auf das Sofa setzte und unvermittelt in Tränen ausbrach.
Die Katze sah nicht erstaunt aus; sie blieb sehr gelassen. Aber sie beobachtete, beobachtete alles ganz genau. Ihre schwarze Silhouette ließ sich federnd ein wenig tiefer auf den vier vornehm weißen Pfoten sinken. Den Schwanz legte sie so ordentlich darüber wie einen Hut auf die Garderobe. Die Katze hatte ihren Posten eingenommen, und sie würde nicht weichen.
Die anderen Katzen, die Eichhörnchen und die Vögel begriffen, dass Geduld angesagt war.
2
Zwei Frauen, zwei Wege
Yvonne kam direkt aus dem Labor. Eine nur langsam nachlassende professionelle Kühle umwehte sie wie ein schwaches Nachbild ihres weißen Kittels. Sie sagte, noch während sie sich setzte: »Ich habe mich jetzt übrigens entschieden.«
»Natürlich hast du das«, erwiderte Frieda, die zusah, wie Yvonne das sandblonde Haar energisch aus dem Blusenkragen strich. Die Geste war so typisch für sie. »Sich entscheiden zu können gehört zu deinen größten Talenten.«
Aus Friedas Sicht war die beste Entscheidung, die Yvonne je getroffen hatte, die, dass sie beide Freundinnen waren.
Frieda war noch Studentin an der Hochschule für Gestaltung gewesen und hatte nebenher in der Kunsthandlung Schrüfer gearbeitet und schüchtern von einer Zukunft als Zeichnerin geträumt. Der schrüfersche Laden war nicht einfach ein Geschäft gewesen, vielmehr eine Institution. Hier gab es alles, was die lebhafte Szene der Stadt dem Inhaber ins Haus schleppte. Da der alte Schrüfer außerdem ein Weintrinker von Gottes Gnaden gewesen war, hatte er für Stammkunden immer eine Flasche parat gehabt. Daraus wuchs im Lauf der Zeit so etwas wie ein Gastronomiebetrieb. Irgendwann schleppte jemand eine topmodische italienische Kaffeemaschine an, die keiner bedienen konnte. Bis Yvonne auftauchte. »Euren Kunstscheiß könnt ihr behalten«, hatte sie forsch erklärt und stattdessen aus der Wein- und Kaffeeecke ein gut besuchtes Bistro gemacht.
»Nur bis zu meiner Hochzeit«, hatte sie Frieda erzählt, die damals noch ein wenig schüchtern gewesen war, ein wenig ätherisch und ganz der Kunst ergeben. Sie hob den Kopf nur selten von ihrem Zeichenblatt. Bei dem Wort »Hochzeit« dachte Frieda zu der Zeit ausschließlich an Bilder von Chagall.
»Du heiratest?«, hatte sie erstaunt gefragt und endlich einmal aufgeschaut.
»Klar«, hatte Yvonne gesagt und einen Espresso durch die Maschine gejagt, den sie sich selbst gönnte. »Sobald ich mit der Ausbildung durch bin. Hier jobbe ich nur für das Kleid. Apropos« fuhr sie nach einem zweiten Blick auf ihre stille Kollegin fort. Und in der Sekunde schien ihre Entscheidung zu fallen. »Hättest du nachher Zeit, es mit mir aussuchen zu gehen? Ich brauche eine zweite Meinung.«
»Okay«, hatte die staunende Frieda gestammelt. Und war mit der beinahe Unbekannten mitgegangen. Über Satin und Spitzen, Meerjungfrau- und Empire-Silhouetten hatte ihr Gespräch miteinander eingesetzt, so unmittelbar und lebhaft, als wäre es immer schon da gewesen. Und seither war es nicht verstummt. Es hatte Yvonnes Ehe und Scheidung hindurch angehalten, hatte das Aufwachsen ihrer Töchter und Friedas Trennungen begleitet, ihre beruflichen Träume verfolgt, ihre Niederlagen. Es hatte sich ausgeweitet auf alle Aspekte ihres Lebens, sogar auf den Kunstscheiß, wenn nötig. Dafür waren Freundinnen eben da.
»Ich habe beschlossen, mich bei ›Herzmatch‹ anzumelden«, sagte Yvonne. Eine zweite Meinung benötigte sie dafür offenbar nicht.
»Onlinedating, im Ernst?«, fragte Frieda aus der sicheren Entfernung der Küche. Sie betrachtete den Wasserstrom, der langsam in den Kessel floss, und nahm sich Zeit.
»Ich weiß auch von hier aus, was du denkst«, ließ Yvonne sich aus dem Wohnzimmer vernehmen. »Herrje, diese Couch hat aber auch schon bessere Tage gesehen. Sind das Sprungfedern?«
»Eine ist nach unten durchgebrochen. Ich hab erst mal zwei Bände vom Lexikon druntergeschoben.« Frieda drehte das Gas an und stellte den Kessel auf das Metallgestell des Herds. »Rutsch einfach nach links.«
»Hattest du nicht diesen großen Möbel-Versandkatalog-Auftrag?«, fragte Yvonne, als Frieda ins Wohnzimmer kam, um zwei Tassen und eine Milchflasche auf den Couchtisch zu stellen.
»Ach, die Sofas dort gefallen mir nicht. Und Prozente bekäme ich als freie Mitarbeiterin wahrscheinlich auch keine.«
»Du könntest das Geld auch woanders ausgeben.« Yvonnes Hartnäckigkeit war ein weiteres ihrer Talente.
»Ich hab mir diesen Band mit den Landschaftsbildern von Hopper gekauft.« Frieda lachte, als Yvonne in gespielter Verzweiflung die Arme hochwarf. »Ich bin im Museumsshop über ihn gestolpert; es musste einfach sein. Keine Sorge, das passende Sofa kreuzt schon auch noch meinen Weg.«
»Es würde sich eher ergeben, wenn du mal in ein Möbelhaus gingst«, rief Yvonne ihr nach, als Frieda wieder in die Küche verschwand. Sie zog ihr Kamerahandy heraus und prüfte ihr Aussehen. Als Frieda mit der Kanne wiederkam, versenkte sie alles in der Handtasche. »O Gott, stell den Zucker weg!«, rief sie. »Hab ich nicht eben gesagt, dass ich mich auf den Fleischmarkt begeben werde? Ich hab mich schon im Fitnessstudio angemeldet.«
»Für ›Herzmatch‹, ja?« Schon bei dem Wort zuckte es in Frieda. Für sie klang das nach zermatschten Herzen. Vor ihrem inneren Auge erblickte sie einem gewalttätigen Stiefel, der durch einen roten Sumpf marschierte, am Rand ein paar krümelnde Herzen, wie die Reste vom Muttertagskuchen. Sie nahm sich Zucker.
»Ich hab schon angefangen, die Fragebogen für das Profil auszufüllen«, erklärte Yvonne. »Die sind wirklich umfangreich, weißt du. Wer ich bin. Was ich suche.«
»Das sind ja gleich zwei Probleme auf einmal«, meinte Frieda, die sich nach all den Jahren immer noch nicht so ganz sicher war, wer sie denn war. An den meisten Tagen ergab sich das nach dem Aufstehen irgendwie. Und was um Himmels willen suchte sie? Das Ende der Einsamkeit? Den Himmel auf Erden? Irgendwas dazwischen? Ihre Mutter hatte immer gesagt: »Dir muss man erst noch einen backen.« Ziemlich erschreckend, wenn man weder kochen noch backen konnte.
»Du darfst nicht so eine Sache daraus machen«, meinte Yvonne, die ihre Freundin kannte. »Du weißt, dass dir Dunkelhaarige lieber sind als Weißblonde. Du fährst nun mal nicht Ski, und du willst ab und zu ins Theater. Das schreibst du da alles rein. Und dann sieht man weiter.« Sie nahm einen Schluck von ihrem Tee. »Man formuliert klar seine Ansprüche.«
»Schon daran würde ich scheitern«, behauptete Frieda.
»Weil du keine Ansprüche hast.«
Frieda seufzte. So viel zum Thema, wer sie denn war: jemand, dem man erst einen backen musste oder jemand Anspruchsloses. Wollte sie nun also zu viel oder zu wenig? Und wie sollte sie in Worte fassen, was sie sich ersehnte? Nichtraucher, Wintersportvermeider, kulturell interessiert – sollte das den Mann ihrer Träume beschreiben? Sie versuchte, ihn vor sich zu sehen, aber es gelang nicht. Im Geiste malte sie mit einem Bleistift ein großes Fragezeichen auf Packpapier.
Käme sie nicht auch mit einem Raucher wunderbar zurecht, notfalls sogar mit einem Skifahrer, wenn er nur dieselbe Begeisterung wie sie empfinden könnte – etwa beim Anblick einer Welle, die mit letztem Schwung den Sand hinaufläuft, eben noch da, ein dünner Spiegel, im nächsten Moment versickert?
Aber wäre ein Mann, der diesen Moment mit ihr zu teilen vermochte, auch automatisch ein warmherziger Mensch, der Kassiererinnen im Supermarkt zulächelte und einsame Freunde zum Abendessen einlud? Und war sie wirklich sicher, was ihr am Ende am wichtigsten war? Gab es vielleicht ein Bedürfnis, an das sie gar nicht dachte, etwas, das sie sogar vor sich selbst verbarg? Kannte man sich dafür je gut genug?
Frieda seufzte. Vermutlich hörte sich das verrückt an. Sie konnte seit jeher solche Dinge nicht wirklich ausdrücken. Sie kehrte zu ihrem geistigen Zeichenblock zurück, skizzierte auf das Packpapier einen Mann, der mit einem hochgekrempelten Bein im Wasser stand, mit dem anderen vor einer Supermarktkasse, über die er lächelnd der Kassiererin ein Herz reichte. Das Fragezeichen schwebte darüber in der Luft.
Niemand war doch durch einen Claim beschreibbar. Oder durch ein noch so ausgetüfteltes Raster von Begriffen. Wenn Frieda zeichnete, dann legte sie vorher auch keine Liste an von Dingen, die in dem Bild vorkommen sollten, von den Farben, die sie verwenden würde, von den Wirkungen, die sie damit zu erzielen wünschte. Sie sagte sich nicht: Ich werde etwas erschaffen, das dies und das ausdrücken wird. Sie saß einfach da. Wartete auf innere Bilder, folgte Eingebungen. Sie hatte die Erfahrung gemacht, dass ihre gelungensten Werke entstanden, wenn sie in ihrem Kopf nicht allzu viel Ordnung schaffte und alles ein wenig unscharf eingestellt ließ. Aber darüber redete sie nicht gerne.
Yvonne zupfte eine Fussel vom Sofaüberwurf. »Bei ›Herzmatch‹ werde ich jedenfalls eine große, wohlsortierte Auswahl finden. Die meisten Akademiker. Und alle geben zu, dass sie auf der Suche sind. Schluss mit den albernen Fassaden, der aufgesetzten Bedürfnislosigkeit, diesem verklemmten Herumeiern um den großen Skandal.« Sie hob die Hände und ließ sie wackeln. »›O weh, o weh, ich bin alleine und will es nicht sein.‹«
Frieda versuchte, das Wort »alleine« nicht allzu tief in ihre Seele sinken zu lassen.
»Weißt du noch«, fuhr Yvonne fort, »die ›Ü-40-Partys‹? Wo alle so taten, als wollten sie bloß tanzen?«
»Na, manche taten auch so, als wollten sie nur vögeln«, erwiderte Frieda. Ihr Lächeln wurde ein wenig kriegerisch. »Und bei einigen war es nicht einmal gelogen.«
Dirk. Yvonne formte den Namen nur mit den Lippen und zog dann eine Grimasse, als hätte sie in eine Zitrone gebissen. Das war nun wirklich eine unschöne Erfahrung gewesen für die arme Frieda. »Ich habe es dir gleich gesagt.«
»Hast du nicht.«
»Du hättest nicht zugehört. Jedenfalls beweist es, dass ich recht habe: Besser, man schafft eine sorgfältig von einem Algorithmus geprüfte Vorauswahl, als sich einfach seinen von schlechter Musik aufgepeitschten Hormonen zu überlassen. Los aufs Ziel, fokussiert und ohne Umwege.« Sie hob ihre Tasse, als wiese die den Weg.
Frieda allerdings quälte der Verdacht, dass es in der Liebe ausschließlich Umwege gab. Dass am Ende gar keine Wege existierten. Nur Sprünge ins Unterholz, Tänze im Nebel, das Balancieren auf einem Seil über einen Fluss, dessen anderes Ufer nicht zu sehen war. Sie behielt ihre Überlegungen für sich, das tat sie meistens. Ihr war schon klar, was Yvonne davon hielte. Wie hatte sie die Annäherung zwischen Mann und Frau einmal ironisch genannt? Den »Tanz der sieben Schleier«, eine zwangsläufige Täuschung, an deren Ende nur eine Enttäuschung stehen konnte. »Auch Salome hatte Orangenhaut«, würde Yvonne vermutlich sagen.
Vielleicht war es wahr, war alles wahr, was Yvonne vorbrachte, und ihre eigene Sehnsucht nach dem Zauber, nach einem nachhaltigen, lebenslang immer neu gewebten Zauber, war vergebens. Wenn es keinen Weg zurück in das Paradies gab, dann blieb vielleicht nur die Flucht nach vorne in die kalt ausgeleuchteten Gefilde des idealen Supermarktes. Sie schüttelte sich bei dem Gedanken.
Yvonne verstand die Regung falsch. »Bei Herzmatch gibt’s was Besseres als einen One-Night-Stand, glaub mir.«
»Danke«, sagte Frieda, »aber mein Leben ist toll, wie es ist.«
Yvonne nickte vielsagend. »Klar. Es sollte nur nicht so weitergehen.«
Frieda öffnete den Mund. Und schloss ihn wieder.
Yvonne hatte den kleinen Schreck in ihren Augen gesehen und lachte. »Gib zu, dass ich recht habe.«
»Ach, Yvonne, wieso bist du nur immer so …«, Frieda suchte nach einem Wort, »so furchtbar meinungsstark.« Ihrer Ansicht nach wurden Meinungen überschätzt.
Yvonne nippte leicht verstimmt an ihrer Tasse. Die ungesagten Sätze stapelten sich um sie herum auf dem Sofa und machten ihre Bewegungen eckig. Ihrer Ansicht nach war Meinungsstärke ein Vorzug, dazu bitter nötig für eine Frau, ein Ausgleich für fehlende Körperstärke und mangelnde sozioökonomische Repräsentanz. Wie sollte man vorwärtskommen, wenn man nicht einmal genau wusste, wohin man wollte? Frieda, fand sie, würde es kein Stück schaden, es auch einmal mit Zielstrebigkeit zu versuchen. Sie sah so gut aus, aber sie wusste es noch nicht einmal. Und sie machte sich nichts daraus. Sie war so enervierend richtungslos. Es hätte Frieda ganz gewiss eine Menge der Männer erspart, die Yvonne hatte kommen und gehen sehen, und jedes Mal hatte sie gleich Bescheid gewusst. Ihre eigenen Missgriffe waren ein anderer Fall. Es waren keine Katastrophen gewesen wie bei Frieda. Und sie litt auch nicht so, wie ihre Freundin das immer tat. Sie verarbeitete ihre Beziehungen ordnungsgemäß. Frieda war da ein wenig altmodisch. Frieda war überhaupt so anders. Aber sie mochte Frieda. Trotzdem. Oder gerade deshalb?
Versöhnlich legte Yvonne Frieda die Hand aufs Knie. »Keine Sorge. So wie du aussiehst, wird das ein Spaziergang. Wir schreiben einfach: unbelehrbares Schneewittchen. Mit Kirschaugen und Rabenlocken.« Sie tastete nach ihren eigenen, sorgsam blondierten Haaren, die schon ein wenig dünn, aber tadellos geschnitten und gepflegt waren. Wenn ihre Freundin nur etwas aus sich machen würde, dachte Yvonne. Dann könnte sie umwerfend aussehen. Aber sie hatte Frieda im Verdacht, sich die Haare selbst mit einer ihrer Bastelscheren zu kürzen. Dabei fiel ihr ein, dass sie vor dem Fotoshooting für ihr Profilbild auch einen Friseurbesuch brauchen würde. Sie holte ihr Mobiltelefon aus der Tasche.
»So. Bei Domenica, morgen um zehn. Willst du gleich mitkommen?«, fragte sie.
Keine Antwort.
Yvonne schaute vom Display auf. »Was ist jetzt? Frieda?«
»Da ist eine Katze.«
3
Lebenszeichen vom Balkon
»Was?« Das Mobiltelefon noch in Händen drehte Yvonne sich auf dem hubbeligen Sofa herum und folgte dem Blick ihrer Freundin nach draußen auf den Balkon.
Da saß die Katze, ein regloser schwarzer Umriss zwischen dem überfrosteten Grün des Balkonkastens, fast wie eine der mehr oder weniger lebensechten Dekofiguren aus Kunststoff, die Friedas Nachbarn so liebten. Ebenso starr und doch unübersehbar lebendig. Die Spitzen ihrer Pfoten leuchteten so weiß wie der Schnee, der dieses Jahr ausgeblieben war. Ihre Augen waren geschlossen, als schliefe sie oder lausche tief nach innen.
Sphinx, dachte Frieda. Schön und unerbittlich. Sie würde sich mit nicht weniger als der Lösung des Rätsels zufriedengeben.
Eine kleine Bewegung ging durch den Katzenkörper, ein Beben, ein fast unmerkliches Rollen der Muskeln, ein Spiegeln des Fells. Frieda war, als wäre das eine Reaktion auf ihre Gedanken; sie musste lächeln.
Yvonne dagegen betrachtete das Tier kritisch. »Sie sieht irgendwie krank aus«, sagte sie und machte rasch ein paar Belegaufnahmen. Als sie Friedas betroffenes Gesicht sah, begriff sie, dass das die falsche Bemerkung gewesen war. »O nein«, sagte sie etwas lauter. »Nein! Du wirst sie nicht hereinlassen, um sie gesund zu pflegen.«
»Aber ich hab doch gar nicht …«
»Du hast im Geiste schon überlegt, womit du sie fütterst, und einen Platz für das Körbchen gesucht, gib’s zu.«
»Ich habe mich nur gefragt, wie sie hier hochgekommen ist«, verteidigte Frieda sich und griff erneut nach der Teekanne.
»Das ist ein Streuner, die kommen überallhin. Aber im Ernst, Frieda.« Sie zeigte auf die Balkontür, hinter der das Tier ungerührt hockte. »Öffne diese Tür, und du wirst nie wieder Sex haben.«
Frieda, mitten im Einschenken getroffen von dem Satz ihrer Freundin, vergoss ein wenig Tee.
»Du weißt schon, dass es gegen die Genfer Konvention verstößt, Frauen über fünfzig mit so etwas zu drohen.«
»Hast du keinen Lappen?«, fragte Yvonne, die bereits nach ihrer Handtasche griff und ein Kosmetiktuch herausholte. »Das gibt Wasserringe auf dem Holz.« Sie wischte, ein automatisierter Vorgang, der sich nicht stoppen ließ von der Überlegung, dass die Liebesmüh an Friedas heruntergekommenem Mobiliar verschenkt war, auf dem mehr Flecken prangten als Sternbilder am Himmel.
»Das sind Lebenszeichen.« Frieda blies auf ihre Tasse und vernebelte mit dem Dampf die Umrisse der schwarzen Katze, die plötzlich von der Balkonbrüstung glitt wie ein Strom schwarzen Wassers und ihre Gestalt auf den Fliesen neu aufbaute, diesmal als ägyptisch angehauchte Sitzfigur mit langem, schlankem Hals und gespitzten Ohren. Jetzt konnte man sehen, dass die Hinterläufe ebenfalls weiß bestrumpft waren. Brust und Hals strahlten schwanengleich. »Sie ist wirklich wunderschön.«
»Es ist mein Ernst, Frieda. Männer mögen keine Katzenfrauen. Die sind in ihren Augen erotisch ausgelastet.« Yvonne nickte vielsagend. »Außerdem lässt eine Katze eine Frau eigenwillig aussehen, launisch und labil. Und rein statistisch gesehen: Die Hälfte von den Typen sind heutzutage Allergiker. Kannst du es dir erlauben, auf fünfzig Prozent der Auswahl zu verzichten?«
Frieda fand, dass sie es sich erlauben könnte, auf alle zu verzichten. Bis auf einen. »Nein, im Ernst, Yvonne …«
»O, es ist mein Ernst. Du bist viel zu jung für eine Katze.«
Frieda betrachtete das Tier. »Sie ist nicht krank«, sagte sie. »Ich glaube, sie hat ein Zuhause.«
Yvonne neigte kritisch den Kopf. »Woran willst du das erkennen?«
»Sie wirkt nicht wie jemand, der auf der Suche ist. Eher … Entschuldige.« Sie vollendete ihren Satz nicht, sondern machte sich auf die Suche nach ein paar Stiften und einem Block. Mit beidem kehrte sie zurück an den Couchtisch, wählte einen harten Bleistift für die Umrisslinien und machte sich daran zu zeichnen. »Das sind die Ohren. So. Und so …« Sie hob den Kopf, um noch einmal genau diesen unnachahmlich eleganten Schwung zu betrachten, mit dem der Kopf in den Rücken überlief.
Für einen Moment dachte sie, ihr Modell wäre verschwunden. Dann entdeckte sie die zitternde Schwanzspitze über dem Rand des großen Terrakottatopfes, in dem ihr Olivenbaum sich ums Leben bemühte. Ein totes Blatt wehte herab, eine Pfote schoss hervor und fixierte es, entschlossen und doch beinahe zärtlich. Frieda spürte, wie ihr eigenes Herz vor Freude klopfte.
»Du solltest es wirklich mit ›Herzmatch‹ versuchen«, sagte Yvonne hinter ihr. »Komm, wir machen ein Foto von dir.« Frieda spürte, wie die Freundin ihr in die Haare fasste und eine ihrer widerspenstigen Locken lang zog. Unwillkürlich schüttelte sie den Kopf frei.
»Du musst mal wieder färben«, stellte Yvonne fest und ließ die Strähne los, die wie eine Feder zurücksprang. »Das ist schon mehr Silber als Schwarz. Das müsstest du in Photoshop nachbearbeiten.«
»Ich habe überlegt, das Färben ganz zu lassen«, murmelte Frieda, in ihr Bild vertieft. Sie wechselte zu einem weicheren Stift für die Bauchpartie. »Diese Fernsehmoderatorin hat das doch auch gemacht.«
»Die ist älter«, sagte Yvonne und begann, an den Fingern abzuzählen. »Sie ist reich. Und prominent. Sie hat einen festen Partner. Und außerdem …« Dabei streckte sie den letzten Finger. »Sie wird es nie zugeben, aber sie wird es bereuen.«
Frieda hob kurz den Kopf und lächelte.
Yvonne neigte sich vor. »Komm, du und ich. Ich entwerfe dir auch ein Profil. Frieda Fuchs, Grafikerin, das klingt künstlerisch, aber nicht zu sehr. Und auch nicht zu qualifiziert. Ich nenn mich jetzt MTA. Bei ›Laborleiterin‹ hat keiner angebissen. Das Alter ist neunundvierzig, eine Fünf vorne kommt für Frauen nicht infrage. Und es sind doch auch nur ein paar Jahre, das merkt eh keiner. Wir machen ein hübsches Foto. Und dann …«
Aber Frieda hörte nicht mehr zu. Der Balkon war leer. Nur einen Moment lang hatte sie nicht hingesehen. Sie konnte nicht erkennen, ob das Tier noch da war. Als hätte er ihre Gedanken erspürt, ließ der Olivenbaum ein weiteres Blatt fallen.
4
Natürlich und perfekt?
Frieda kannte Bernd seit einer Ewigkeit, genau wie Yvonne. Sie hatten gemeinsam die Hochschule für Gestaltung besucht, sich mal mehr, mal weniger gesehen, aber nie aus den Augen verloren. Er hatte eine Weile in einer Kommune in den Pyrenäen verbracht, sie war von der einen oder anderen Beziehung aufgesogen worden. Unweigerlich liefen sie einander immer wieder über den Weg, und jedes Mal war es, als wäre dazwischen keine Zeit vergangen. Bernd gehörte zum Urgestein des Stadtteil-Kinovereins und hatte dafür gesorgt, dass Frieda ihnen seit einiger Zeit die Plakate entwarf.
Sie arbeiteten oft und gerne zusammen, ihr gemeinsamer Geschmack, ihre unaufgeregte Freundschaft waren dafür ideal. Im Moment saßen sie im Auftrag des Kulturamtes an einem Image-Fotoband über ihren Stadtteil, zu dem Bernd als Fotograf die Aufnahmen beisteuerte. Sie hatten sich für den späten Vormittag verabredet, um letzte Abstimmungen am Computer vorzunehmen. Frieda nahm ihm seine Pelzmütze ab, als er hereinkam. Das gute Stück sah aus, als hätte er sie aus einem überfahrenen Nagetier selbst gefertigt.
»Schau nicht so. Die leistet mir gute Dienste.« Lachend wickelte er sich aus seinem Schal. »Sie passt zu meinem Bart. Und sie kommt nie aus der Mode.«
»Das ist ja das Problem. Käme sie nur genug aus der Mode, käme sie irgendwann auch mal wieder in Mode, und man könnte sie als Vintage-Teil groß rausbringen.«
Aber Bernd wollte gar nicht groß rauskommen. Er war völlig zufrieden mit seinem Halbtagsjob bei der Zeitung, seinen Aufträgen zwischendurch und den Bildern, die er privat aufnahm und manchmal an jemanden verkaufte, manchmal nicht. Klick, schon hatte er ein Bild von ihr mit seiner Mütze in den Händen gemacht, auf dem es vermutlich so aussah, als hielte sie ein mutiertes Vogelnest.
»Sei froh, dass ich keine Haustiere habe«, sagte sie, warf das Ding auf die Garderobe und ging an den Computer. »Sie würden darin eine Familie gründen.«
»Wär doch nett«, meinte Bernd und holte sich einen Stuhl, um sich neben sie zu setzen. »Ich bin im Grunde ein Familienmensch. Allerdings Allergiker.«
Frieda, die wusste, dass Bernd noch immer in einer WG lebte und eine Reihe von turbulenten Kurzzeitbeziehungen hinter sich hatte, bei denen Familiengründung nie ein Thema gewesen war, vermutete, dass es sich um eine Bindungsallergie handelte. Aber sie sagte lieber nichts dazu. Mit Bernd redete man nicht, man ging in tschechische Filme der Sechziger oder installierte neue Fotobearbeitungsprogramme. Mit Bernd tat man Dinge. Auch das gemeinsame Nichtstun mit Bernd machte Spaß. Würde sie Bernd von dem erschreckenden Spruch ihrer Mutter erzählen, würde er nicht mit ihr über Selbstfindung diskutieren. Er würde ihr einen Pfefferkuchenmann backen. Und ihr würde es besser gehen. Es ging Frieda immer besser, wenn Bernd da war. Er war auf seine Weise ein fester Pfeiler ihres Lebens, ebenso wie Yvonne.
Er gab ihr den Stick mit seinen Bildern. »Dann wollen wir mal.«
Seine Aufnahmen der alten Häuser im Viertel waren voller Atmosphäre. Er hatte die totfotografierten Ecken gemieden und dafür Details in Szene gesetzt: einen von Efeu fast erdrückten Torbogen, Trauben aus gemeißeltem Sandstein mit vergoldeten Blättern unter einem Fenster, alte Bäume, die sich an Jugendstilfassaden schmiegen. Sogar aus dem abgeschabten kleinen Park mit den meist überquellenden Mülleimern hatte er das Beste herausgeholt. Die vielen Hunde dort waren im echten Leben ein Ärgernis, aber auf seinem Bild strahlten sie Lebensfreude aus. Ebenso wie die kichernden Mädchen, die die Sitzplätze und die Lehne einer Bank in dichter dynamischer Traube besetzt hatten. »Weiß ja keiner, dass du bei denen jederzeit gebrauchte Sonnenbrillen und Handys kaufen kannst«, meinte er.
»Oh, das weiß jeder«, erwiderte Frieda. »Aber sie sind so schön und wild. Wir nehmen das Bild. Allerdings wirst du nicht drumherum kommen, noch einen klassischen Schuss von der Wasserschlossfassade hinzuzufügen. Wir dürfen die musealen Höhepunkte nicht vernachlässigen. Tee?«
»Wenn ich dich nicht hätte.«
Frieda fand es schön, mal wieder einen Menschen in der Wohnung zu haben, eine andere Stimme, andere Bewegungen, die dem gesamten Raum neue Schwingungen verliehen und unwillkürlich ihren eigenen Gang leichter und lebhafter machten. Sie konnte selbst in der Küche noch fühlen, dass jemand nebenan saß. Alles war anders, und sie genoss es. Bernd war größer als sie, massiv gebaut, mit einem lustigen kleinen Bauch unter seinem Karohemd. Er hatte Hände wie Schaufeln, in denen die Maus fast verschwand, die sich aber weich anfühlten. Groß, breit, vertrauenerweckend.
»Mist!«, rief er gerade. »Ich hab irgendwo falsch geklickt. Der Textrahmen hat sich verschoben. Dieses InDesign ist echt die Hölle.«
»Kein Problem.« Sie kam mit Tee und einem Teller Biskuits zurück und löste das Chaos mit ein paar Arbeitsschritten wieder auf. »Hier. Kekse.«
Er tat geknickt und barg den Kopf an ihrer Schulter. Ein fremder, starker grellgrüner Geruch stach ihr in die Nase. Kam der aus seinen Kleidern? Aus dem Bart? Die verdächtige Mütze war doch weit weg? Sie schob ihn ein wenig fort und tarnte es als gespielte Strenge. »Kusch, aus«, kommandierte sie.
Er imitierte ein betrübtes Jaulen. Frieda musste lachen.
Als das Telefon klingelte, war es Yvonne. Sie bat um Hilfe bei ihrem Profilbild für »Herzmatch«, weil Frieda doch »ein Auge für so was« besäße. Selfies hatten sich als nicht ausreichend erwiesen. Es musste schon professionell wirken, meinte Yvonne, aber wieder nicht so professionell wie von einem Studiofotografen geschossen. »Schön, aber nicht glatt«, suchte Yvonne nach Worten. »Vielmehr richtig aus dem Leben. Mehr so intim. Und authentisch.« Sie machte eine Pause. »Aber natürlich perfekt.«
»Natürlich und perfekt ist ein Widerspruch in sich«, sagte Frieda, trocken.
»Ach, du weißt doch, was ich meine. Wann hast du Zeit?«
Frieda seufzte. Heute und morgen war sie mit dem Buch beschäftigt, übermorgen hatte sie einen Termin bei einem neuen Kunden, keine Ahnung, wie lange das dauern würde.
»Frieda, meine biologische Uhr tickt.« Die Stimme aus dem Hörer klang ungeduldig.
Frieda lachte. »So schnell wirst du schon nicht unvermittelbar.« Ihr Blick fiel auf Bernd, der immer noch mampfend Hündchen spielte und sie mit schief gelegtem Kopf anhechelte. Aber natürlich! Authentisch und aus dem Leben. Er war zweifellos kein Anblick für die perfektionsgewohnten Sucheraugen der »Herzmatch«-Kunden. Aber er würde doch prima zu Yvonne passen! Bernd war der Berge-Typ und würde sich gut in ihrer Wochenend-Wandergruppe machen. Außerdem konnte er tanzen, das wusste Frieda aus erster Hand. Vor Festivalbühnen entwickelte Bernd eine unbekümmerte, ungewohnt explosive Energie. War das nicht ideal für Yvonne, die mittwochs immer ihre Tango-Gruppe besuchte?
Donnerstags ging Yvonne dann zum Yoga. Und sommers segelte sie alljährlich mit einer Gruppe von Freunden in der Ägäis. Ob Bernd dabei auch mithalten könnte, da war sich Frieda nicht sicher. Aber man konnte nicht alles haben. Für ihren Geschmack waren das sowieso ein bisschen viele Gruppen. Warum nicht einige davon durch einen Spaziergang zu zweit ersetzen? Und Zweihandsegeln gab es doch auch. Da hätte dann jeder der beiden noch eine Hand frei.
Der Gedanke elektrisierte Frieda: Bernd und Yvonne. Und es würde der Freundin die demütigende »Herzmatch«-Erfahrung ersparen, wo man sich doch nur anbot wie billig Butter, gefärbt, trainiert, verjüngt. War das nicht ein einziger Albtraum?
»Du«, sagte sie zu ihrer Freundin, »ich hab da eine Idee. Hast du gleich in deiner Mittagspause Zeit?«
Bernd bellte, sie gab ihm einen Klaps. »Platz, Bernd.«
»Hast du da einen Hund?«, erkundigte Yvonne sich.
Frieda lächelte. »Etwas Besseres«, sagte sie. »Moment.« Sie wandte sich an Bernd: »Wir müssen was dazwischenschieben. Machen wir einen kleinen Spaziergang.«
»Eine Runde durch den Park, und du wirfst mir das Bällchen?«, fragte Bernd. »Komm schon, wir wollen das hier fertigkriegen.«
»Wir müssen zu einer Freundin«, erklärte Frieda. »Einer guten. Sie sucht einen Mann.«
Bernd hob die Brauen. »Und wie komme ich da ins Spiel?«
»Du machst die Fotos.« Vorerst, dachte Frieda. Aber sollten Yvonne und Bernd Gefallen aneinander finden, könnten sie später die Profilfotos, die er von ihr schießen würde, als erste Bilder in ihr gemeinsames Album kleben. Das wäre doch mal eine Kennenlern-Story, die sich erzählen ließe. Und Frieda würde keinen ihrer zwei besten Freunde aus den Augen verlieren.
Gutmütig, wie Bernd war, erklärte er sich einverstanden. Aber er schlug vor, Yvonne im Stadtpark zu »shooten«, weil dort das Licht besser wäre. »Drinnenbilder werden nicht wirklich gut, wenn du kein Studio zur Verfügung hast. Ich hole meine Mütze.«
Die Mütze war ein Problem. Aber Frieda beschloss, dass sie ein Problem nach dem anderen lösen würde.
»Selbst um diese Jahreszeit findest du hier schöne Stellen«, sagte Bernd wenig später, während sie durch die einsame Anlage stapften. Der Atem stand ihm wie Rauch vor dem Mund. Frieda lief neben ihm her, zu tief in Mütze und Schal vergraben für eine Antwort. Es waren mindestens zwei Grad unter null. Für das zweite Rendezvous würde Bernd sich etwas Besseres einfallen lassen müssen. Etwas Gemütlicheres. Aber er hatte recht, die Ecke war perfekt. Es gab dort das immergrüne Laub alter Rhododendren, von Reif überzuckertes Schmiedeeisen, alten Sandstein.
Zufrieden schaute er sich um. »So, da wären wir. Hier kommen auch die Hochzeitsfotografen immer her.«
»Fehlt nur noch die Braut«, meinte Frieda, stopfte die Hände tiefer in die Taschen und zog die Schultern hoch.
Yvonne kam zu spät, einen riesigen Ikea-Plastikbeutel in der Hand. »Verschiedene Schals«, erklärte sie den beiden. »Diverse Mützen. Eine alternative Jacke.«
»Dann mal los«, sagte Bernd, der ganz in der Aufgabe aufzugehen begann. »Versuchen wir es zuerst dort drüben, Viertelprofil. Und heb die Schulter.«
Frieda verkroch sich in ihren Mantel und wickelte den Schal dreimal ums Gesicht. Sie bemühte sich, ihren Enthusiasmus für dieses hoffnungsvolle Kennenlernen nicht einfach dahinfrösteln zu lassen, während Bernd mit der Geduld seiner Profession Bild um Bild machte, nach links winkte, dann nach rechts, dann näher ran und gerade zum gefühlt tausendsten Mal vorschlug, »doch noch etwas anderes auszuprobieren«.
Wenn es der Sache diente. Frieda hoffte sehr, Bernds Ausdauer wäre persönlich motiviert, damit das Leiden sich lohnte.
»Cheese«, rief Bernd in diesem Moment und drehte sich plötzlich zu ihr herum, um auch sie abzulichten. Frieda markierte einen Fluchtversuch, musste aber lachen.
Yvonne entspannte sich für einen Moment. Klick. Schon war auch sie erneut eingefangen. »Reingelegt«, meinte Bernd und überprüfte das Objektiv. »Die ungestellten Bilder sind einfach die besten.«
Endlich war er zufrieden; die beiden tauschten ihre Nummern aus, Yvonne tippte seine in ihr Smartphone und sandte gleich eine Probe-SMS, die er bestätigte. »Prima, dann schick ich dir die Fotos.«
»Bearbeite sie nicht zu sehr«, neckte Frieda sie. »Ich hab mir die Richtlinien von ›Herzmatch‹ durchgelesen; sie haben sich zu Safer Daten verpflichtet. Dazu gehört Authentizität.«
»Ach was, kein Mensch hat heute mehr Poren.« Yvonne lachte unbekümmert und streckte ihr die Zunge heraus, Bernd drückte ein letztes Mal ab. Es wurde ein toller Schnappschuss, aber natürlich kam er für die Suche nach dem Mann fürs Leben nicht infrage.
»Willst du deins auch haben?«, fragte Bernd Frieda. »Schau, ist toll geworden.« Er klickte herum, um es aufs Display zu bringen.
Frieda schüttelte abwehrend den Kopf. »Ich seh doch nie gut aus auf Fotos.«
»Schick es an mich«, meinte Yvonne. »Ich bearbeite es dann und …«
»O nein«, protestierte Frieda.
»… schenke es ihr zu Weihnachten«, ergänzte Yvonne ihren Satz.
5
Der Filmmoment
»Gehen wir alle zusammen noch was trinken?«, schlug Frieda vor.
Aber Bernd, der ahnungslose Idiot, wollte die Gelegenheit lieber nutzen, um noch beim Wasserschloss vorbeizuschauen, um es für ihr Buchprojekt aufzunehmen. »Wo ich schon mal draußen bin.«
Frieda würde also auf den SMS-Austausch der beiden setzen müssen.
Auf dem Heimweg gingen die beiden Freundinnen friedlich nebeneinanderher durch den kalten, klaren Februartag. Bernd hatte recht gehabt, der Stadtpark war auch um diese Jahreszeit erlebenswert. Der gefrorene Boden trug ein Spitzenmuster aus Reif und knisterte unter ihren Schritten, die Zweige bildeten Scherenschnittmuster vor dem emailleblauen Himmel. Alles wirkte in der Kälte klar und kompakt wie eine genau gezeichnete Miniatur, in die man gerne eintrat. Fast fühlte man sich selbst wie jemand, den ein Zeichner mit sicherem Stift festgehalten hatte, Linie um Linie, Kringel um Kringel, genau so, wie alles sein sollte.
Aus dem Stadtparkcafé duftete es verlockend nach Kaffee, und ihre Füße waren Eisklötze. »Lass uns reingehen«, schlug Frieda vor. Sie liebte Kaffeehäuser, dort konnte man in das Leben eintauchen, wurde davon umspült und hatte doch sein eigenes Tischrevier, dazu noch umsorgt von einer freundlichen Bedienung. Manchmal, wenn ihr zu Hause die Decke auf den Kopf fiel und sie die Stille nicht aushielt, packte sie ihre Sachen zusammen, Notizblöcke und Laptop, und ging für Stunden in ein Café arbeiten. Außerdem könnte sie Yvonne gleich noch ein paar begleitende Informationen zur richtigen Haltung und Pflege von Bernd geben.
Yvonne jedoch winkte ab. »Ich muss für die verlängerte Mittagspause eh schon eine Stunde nacharbeiten. Es wird finsterste Nacht sein, wenn ich heimkomme. Ciao.« Schon war sie fort.
Frieda fühlte noch den Kuss der Freundin auf der Wange. Dann eben nur sie.
Sie öffnete die Tür und ließ die Geräuschwoge des Lokals über sich hereinbrechen. Als sie sich in dem kleinen von Wintersonne erfüllten Glasaquarium orientiert hatte, steuerte sie einen freien Tisch am Fenster an. Die anderen Besucher waren zumeist Mütter mit Kindern oder Rentner. Eine spannende Begegnung schien nicht auf sie zu warten. Dafür aber Entspannung. Sie hob den Arm, um die Bedienung auf sich aufmerksam zu machen.
»Sie wünschen?«, fragte die Bedienung.
Tagträume und einen Klecks Seelenfrieden, dachte Frieda. Laut bestellte sie: »Latte macchiato und eine Zimtschnecke, bitte.«
Aus der Küche kamen Rufe und Geklirr. Eine Tür knallte. Die Kaffeemaschine zischte und gurgelte. Im Hintergrund lief Musik, durch den Nebel der Gespräche kaum mehr auszumachen. »Wie oft hab ich ihm schon gesagt …« »… zwei Stunden gewartet, nur für ein Rezept …« »… lass das sein, Sophie …« »… und mein Fersensporn …« »… echt? Also, ich finde ja …«
Frieda wollte nicht wissen, was die Person fand, verdrängte die Stimmen und schaute sich um. Ihre Hände strichen über die Tischdecke. Wie schön das ungebrochene Weiß doch war. Als Kind hatte sie gern mit der Gabel Spuren hineingezogen oder -gepikst, die sie als Schlittenspuren ausgab, als Mäusespuren – ganze Geschichten hatte sie sich auf diese Weise erzählt. Einmal mit der Messerschneide drüber, und alles war wieder fort. Tabula rasa. Fast wie im Leben. Aber da war ein Kaffeefleck. Und das hier sah nach Ei aus.
Während sie ihre Zimtschnecke aß, schweifte Friedas Blick weiter durch die klaren Scheiben, das kalte Grün, den Raureif auf den Moospolstern zwischen den Steinplatten draußen, über die ein paar rotnasige Kinder hüpften, deren Mütter irgendwo hinter ihr saßen. Frieda sah einen Schwarm brauner Spatzen, der durch einen Busch tobte, sie entdeckte eine Maus, die eilig eine Rille entlangwieselte, zurück in ihr Versteck. Dann bemerkte sie den Specht. Grün wie ein Edelstein, Grün und leuchtendes Rosenrot. Zum Atemanhalten. Unwillkürlich schaute sie sich nach jemandem um, dem sie es erzählen könnte. Der Impuls war so stark, fast hätte sie den Arm gehoben, den Finger ausgestreckt. »Guck doch mal, Mami.« Es war niemand da.
Frieda kramte in ihrer Tasche herum, fand ihren Notizblock und das Kästchen mit ihrem Zeichenzubehör. Nach wenigen Versuchen gelang es ihr, einen ziemlich guten Umriss des Spechts festzuhalten. Noch fehlten die Farben; der rote Stift war stumpf, und Frieda griff zu ihrem Messerchen, um das Holz um die Mine herum zurechtzuschneiden. Sie mochte Spitzer nicht, das Zuschneiden ermöglichte viel lebendigere Linien. Als sie die Holzspäne auf dem Tischtuch sah, begriff sie, wo das Problem lag. Sie hätte etwas unterlegen sollen. Hinter ihrem Rücken erklang plötzlich Gelächter.
Ertappt schaute Frieda auf.
Am Tisch schräg gegenüber saß ein Pärchen. Die beiden wirkten völlig ineinander versunken und schauten sich über ihren Kaffeetassen mit einem Ausdruck in die Augen an, der bedeutete, dass sie sich gleich vorneigen und küssen würden. Es war genau der Moment, den sie in Filmen immer in Großaufnahme brachten. Unwillkürlich zuckte es um Friedas Lippen, und sie schloss die Augen.
So saß sie eine Weile da, das Messerchen in der Hand. Die Bedienung kam und fragte, ob sie noch etwas wünschte.
»Die Rechnung«, sagte Frieda und wischte verstohlen die Späne zusammen. Auf dem Tischtuch blieb ein roter Schatten zurück, fast wie von Lippenstift. Frieda stellte den leeren Teller drauf und floh. Es wurde Zeit, dass sie wieder an die Arbeit ging.
6
Indian Summer mit Laubbläsern
Laubbläser am Morgen bringt Kummer und Sorgen, dachte Frieda anderntags und betrachtete etwas unglücklich das Warensortiment der Firma Stuhmpf.
Wenn man den Ausführungen des Salesmanagers glauben durfte, handelte es sich um Geräte in Profiqualität, genau wie bei den Elektrosägen, Rasenmähern, Akkuschraubern und Baumschneidern, die Frieda für einen Katalog ins rechte Licht rücken sollte. Seine Augen leuchteten, während er ihr stapelweise Abbildungen von seinen Waren vorlegte und deren Eigenschaften aufzählte. Extrem leistungsstark, kompakt, unbegrenzt aufladbar. Für harte Einsätze geeignet.
Frieda fühlte sich dieser Welt unterlegen.
Außerdem sahen die Sachen alle gleich aus. Und sie trugen Bezeichnungen wie 8732-1X. Mit Sorge betrachtete Frieda, wie der Stapel Bilder vor ihr wuchs und wuchs. Irgendwann gab sie das Mitschreiben auf. Sie würde schon irgendwie klarkommen. Aber was für eine Fitzelei, bis sie das alles auseinandersortiert und auf den Katalogseiten verteilt hätte! Frieda hoffte inständig, dass der extrastarke Schwarztee noch seine Wirkung entfalten würde, aus dem ihr Frühstück bestanden hatte. Mehr hatte sie um die Uhrzeit nicht runtergebracht. Sie schaute zu der großen Digitalanzeige über der Tür. Kaum acht. Handwerker standen wirklich früh auf.
Frieda bemühte sich, mit einigermaßen interessiertem Gesichtsausdruck allem zu folgen, was der Verkaufsleiter ihr zu sagen hatte. Er wirkte wie die Männer auf seinen Prospektfotos: quadratisch, praktisch, gut. Gleich nach der Begrüßung hatte er das Jackett abgelegt und die Ärmel aufgekrempelt. Sicher besaß er eine beneidenswert unkomplizierte, positive Lebenseinstellung. »Kein Problem« war sein Standardsatz. Und er wusste genau, was er wollte.
Frieda dagegen gingen gerade jede Menge Probleme im Kopf herum. Warum mussten Gewerbegebäude immer so hässlich sein? Wieso servierten sie hier nur Kaffee, der noch dazu grässlich schmeckte? Wozu brauchte die Welt Vertikutierer? Und wieso in aller Welt nur tat sie sich das an?
Nun, sie war alt und brauchte das Geld, ganz einfach. Also nickte sie tapfer zu allen Ausführungen. Wie ein Wackeldackel auf der Autoablage, dachte sie und skizzierte heimlich zwischen ihre Notizen eine Frieda mit einem an einem Häkchen aufgehängten Kopf und heraushängender Zunge. Als Nächstes zeichnete sie sich eine Motorsäge in die Hand. Mit großen Zähnen. Und drumherum unternehmungslustige Lärmlinien. Brumm, brumm. Was könnte sie denn als Erstes zerlegen?
»Stimmen Sie mir da zu?«, fragte Patrik Igel.
Frieda zuckte zusammen. Schnell schob sie das entstehende Bild unter ihre Mappe. »Kein Problem«, sagte sie. Sie hatte schon nach den ersten fünf Minuten beschlossen, dass es sinnlos wäre, hier eigene Vorschläge zu machen. Keine Einwände, keine Differenzierungen, keine kreativen Volten. Gott, würde die Arbeit langweilig werden. »Wir halten also das Layout sauber und sachlich.«
Sie überlegte gerade, ob sie es wagen sollte, statt der eintönigen weißen Hintergründe hellgrüne vorzuschlagen. Angesichts des letztjährigen Katalogs wäre das vermutlich eine Revolution. Sie wollte es gerade ansprechen, damit wenigstens irgendwas passierte, als ihr Mobiltelefon vibrierte. Unauffällig warf sie unter dem Tisch einen Blick auf die eingegangene Nachricht.
»Vier Smileys, ein Eisbrecher und eine Gesprächsanfrage«, lautete die kryptische Botschaft. Sie stammte von Yvonne. »Nicht schlecht für den Anfang, oder?«
Was sollte das heißen? Frieda runzelte die Stirn. Dass gleich am ersten Tag auf der Dating-Plattform sechs Männer Kontakt mit ihrer Freundin aufgenommen hatten? Der arme Bernd, war Friedas erster Gedanke. Sie liebte ihren Freund heiß und innig, aber er war irgendwie nicht der Typ, der mit sechs anderen konkurrieren konnte. Er war der eine oder keiner. Schade drum. Vielleicht wenn der Boom erst mal abgeflaut war? Denn abflauen musste er ja wohl.
Prompt kam eine Aktualisierung. »Sechs Smileys!« Armer Bernd. Und überhaupt: sechs Smileys, sechs? Yvonne konnte doch nicht mehr als ein paar Stunden online sein! Hatte sie etwa die ganze Nacht dort verbracht?
»Alles in Ordnung?«, fragte Patrik Igel.
»O ja«, erwiderte Frieda. »Ich finde das Thema Rasenkantenschneider sehr, äh, anregend.«