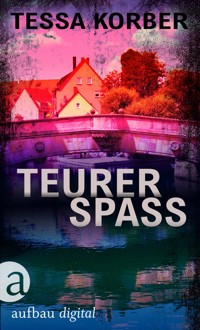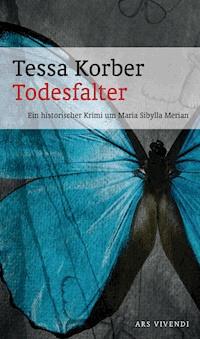
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: ars vivendi Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Sie malt, sie treibt Handel, sie verdient das Geld für die Familie. Und sie sammelt Raupen und Falter, von denen der Volksmund noch denkt, sie seien Teufelsgetier, entstanden in einer Art Urzeugung aus Fäulnis und Schmutz. Maria Sibylla Merian ist nicht eben das Lieblingskind der Nürnberger Stadtoberen. Das wird auch nicht besser, als sie auf der Suche nach Insekten die Leiche einer jungen Frau entdeckt. Ihren Forschergeist lässt der Fund nicht ruhen: Warum musste das Mädchen, eine einfache Magd, sterben? Hilfe erfährt Maria Sibylla einzig von ihrer munteren "Jungfern-Company", wohlhabende Bürgerstöchter, die bei ihr das Malen lernen und nebenbei auch das freie Denken. Sie helfen der Außenseiterin, in die Wirren städtischer Politik und Wirtschaftsinteressen einzudringen, um den Fall zu lösen. Doch die Schlinge aus Vorurteilen, Bigotterie und Feindseligkeit zieht sich immer enger um die Künstlerin.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 251
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Tessa Korber
Todesfalter
Ein historischer Krimi um Maria Sibylla Merian
ars vivendi
Vollständige eBook-Ausgabe der im ars vivendi verlag erschienenen
Originalausgabe (2. Auflage 2012)
© 2011 by ars vivendi verlag
GmbH & Co. KG, Cadolzburg
Alle Rechte vorbehalten
www.arsvivendi.com
Lektorat: Helga Blum
Umschlaggestaltung: Mascha Kirchner unter
Verwendung einer Fotografie von isses/istockphoto
Datenkonvertierung eBook: ars vivendi verlag
eISBN 978-3-7472-0083-4
Für Christian
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Nachwort
1
Am Milchmarkt, gegenüber dem Graff’schen Haus, gingen die in der Frühsonne blinkenden Fenster auf. Zwei Mägde steckten die Köpfe hinaus und betrachteten die nicht mehr ganz junge Frau, die drüben vor die Haustür getreten war und nun auf dem lehmigen Boden kauerte, die Röcke achtlos gerafft und offenbar ohne jeden Sinn dafür, dass ihre Säume sich im feuchten Lehm mit Schmutz vollsogen. Seltsame Schächtelchen hatte sie um sich herum verstreut, und an ihrem Gürtel hingen Gerätschaften, als ginge sie auf eine Expedition. Sie schien völlig in ihr Tun versunken zu sein.
»Was treibt sie denn da?«, fragte die eine Magd.
Die Hausherrin kam dazu, nicht weniger neugierig. Lieblos schaukelte sie ein Kleinkind auf ihrer Hüfte, während sie den Hals nach ihrer Nachbarin lang machte. »Sie hebt tatsächlich Würmer auf«, stellte sie fest. »Wie immer.«
»Igitt.« Die beiden Mädchen schüttelten sich. Die Jüngere lachte dumm, schlug sich aber rasch die Hand vor den Mund, als ihretwegen ein paar Tauben vom Dachrand aufflogen und mit laut schwirrenden Flügelschlägen in Richtung Burg aufflatterten, wo sie am blassen Frühlingshimmel hinter dem Turm verschwanden.
Die Wurmgräberin jedoch ließ sich nicht stören. Sie hob nicht einmal den Kopf mit dem dunklen Mittelscheitel, aus dem sich rundum krause Locken zu lösen begannen.
»Sie wühlt mit beiden Händen im Dreck.« Die ältere Magd schüttelte den Kopf. Dafür hatte sie kein Verständnis. Ihr ganzes Leben galt dem Kampf gegen Schmutz und Ungeziefer, den Mäusen in der Mehlkiste, den Motten im Schrank, den Würmern, die ihren Salat fraßen, den Rüben zerstörenden Käfern oder den Läusen auf den Köpfen der Kinder, die sie jeden Abend mit ihren Fingern zerdrückte, wenn sie vor dem Küchenfeuer hockte, die Bälger zwischen den Knien. Wie es zischte, wenn man die Viecher in die Flammen schnippte. Sie war die Feindin der streunenden Katzen, der Bettwanzen, die in den Alkoven lauerten, und der Schmetterlinge, die nach allgemeiner Ansicht die Butter verdarben. »Und die hebt sie auch noch auf! Tut sie in Kisten oder hängt sie an die Wand.«
»Kein Wunder, dass die Ehe nicht funktioniert.« Die Hausfrau nickte vielsagend mit dem Kopf. Ihre Wangen röteten sich in vorauseilender Schadenfreude.
»Wirklich?« Die Mägde wurden eifriger. »Hat man ihn wieder dabei gesehen?«
Die Weiber rückten enger zusammen: »Am Garten neben der Schlosskapelle. – Ist ja gut«, fuhr sie ihre Tochter an, die auf ihrer Hüfte zu plärren begonnen hatte. »Ach, das Kind. Hier Kunigunde, nimm’s und bring’s der Amme. Sie soll was tun für ihr Geld.«
Die Jüngere zog mit dem Säugling ab, widerwillig, weil ihr die pikanten Details nun fürs Erste entgingen.
Erwartungsvoll schaute die Ältere ihre Herrin an, die den Kopf ein wenig vom Fenster zurückzog, so als könne die ahnungslose Nachbarin etwas mithören. »Man lehnte an der Mauer und poussierte heftig. Es heißt, sie hatte die Röcke hochgerafft.« Sie deutete es mit einem Handgriff in der Luft an und hob vielsagend die Brauen. »Bis hierhin.«
»Die Frau ist doch selber schuld.« Die Magd war mitleidlos. »Schleppt Viehzeugs ins Haus und hängt des Nachts über Büchern.« Ihre Betonung ließ zweifelsfrei erkennen, dass Letzteres als die schlimmere Sünde galt.
Die Hausfrau nickte. »Gottgefällig ist es gewiss nicht.«
Die Magd war mit ihr aus tiefster Seele einig. »Weiß man, wer’s diesmal ist?«
Aber ihre Herrin hatte sich bereits aus dem Fenster gelehnt. »Gott zum Gruß, werte Frau Gräffin!«, rief sie mit einschmeichelnder Stimme.
Maria Sibylla, geborene Merian, nach ihrem Ehemann Andreas Graff nur die Gräffin genannt, bemerkte nun ihre Zuschauerinnen, richtete sich auf und wedelte zerstreut mit der Hand.
Betont freudig winkten die beiden zurück. »Was für ein schöner Tag, so früh im Jahr«, beeilte sich die Hausherrin zu bemerken.
»Zeit wurd’s ja nach dem vielen Regen.« Maria nickte, in Gedanken immer noch bei ihrem Fund, den sie eben in einer Spanschachtel verstaute.
»Und der Winter war so kalt.« Damit hatte man das Thema ausreichend behandelt. »Wo geht’s denn immer hin, Frau Nachbarin?«, erkundigte sich die Hausherrin leutselig.
»Zum Laufer Tor für heute, dort wartet schon meine Jungfern-Companie.«
»Ja freilich, das Fräulein Imhoff ist gewiss auch immer dabei?« Bei dieser Frage warf die Hausherrin ihrer Magd einen vielsagenden Blick zu. Fräulein Imhoff, die war aus einem guten Stall: altes Patriziat, ihr Vater saß im Rat, sie hatten ein Kontor in Venedig. Die Imhoffs zu kennen, das schadete keinem.
Maria Merian bestätigte es. »Natürlich, Clara gehört doch zu meinen besten Schülerinnen.«
»Grüßt das Fräulein doch von mir, sie erinnert sich gewiss an mich. Ich hab doch als Obfrau damals ihre Spende für das Findelhaus in Empfang genommen.«
»Das werd ich gerne«, versprach Maria und vergaß es im selben Moment wieder.
Ihre Nachbarin verschloss mit stolzgeschwellter Brust das Fenster und sperrte die blassgoldene Märzensonne aus. Ein wenig versöhnt stellte sie fest: »Ihr Treiben kann ja nicht völlig verkehrt sein, wenn die Familie Imhoff es duldet. Und das sage ich, weil ich die Leute persönlich kenne. Aber den Mann«, sie schüttelte den Kopf, »den Graff kann ich trotzdem verstehen. Ich sag dir eins: Gut enden wird das nicht.«
Die Magd nickte mit düsterem Gesicht und bekreuzigte sich.
2
Die Luft war klar und roch nach Wachstum und Gedeihen. Es prickelte in der Luft, als Maria Sibylla mit energischem Schritt durch die Gassen ging. Sie meinte, schon hier das drängende Leben all der Pflanzen und Tiere vor der Stadt zu spüren. Selbst das Moos auf den Dachtraufen hatte ausgetrieben. Die ersten Kirschbäume würden bald blühen. Maria liebte diese Jahreszeit. Für einen Moment blieb sie stehen und schloss die Augen, um die stärker werdende Kraft der Sonne auf Kopf und Schultern zu fühlen.
Sie bog oberhalb der Sebalduskirche rechts ab, eine kleine, schlanke, eilige Gestalt, die sich sehr aufrecht hielt. Ihr Haar trug sie in einem schmucklosen Knoten, und das Schönste an ihrem Gesicht waren die dunklen Augen, die ruhig und entschlossen die Dinge betrachteten. Sie lebte nunmehr seit vier Jahren in Nürnberg, der Stadt, aus der ihr Mann stammte. Die hiesigen Bürger hatten sie bisher vor allem im Laufschritt erlebt: Immer war sie am Arbeiten. Sie führte das Haus am Milchmarkt mit nur einer Magd, denn Geld war knapp im Hause Graff. Sie verkaufte Farben und Firnisse, die sie selbst herstellte, nahm Aufträge für Tischwäsche an, die sie bestickte oder bemalte, sie unterrichtete die höheren Töchter der Stadt in dieser Kunst, stach Blumenbilder, kolorierte und verkaufte sie.
Der Mann, ja der Mann! Sein Vater war ja seinerzeit Rektor am Egidianeum gewesen und ein gekrönter Dichter. Der Sohn dagegen war eher als Gast in den Nürnberger Schenken bekannt. Letzte Nacht war er schon wieder erst im Morgengrauen nach Hause gekommen.
Maria Sibylla wollte nicht darüber nachdenken. Im letzten Brief hatte ihre Mutter sie zum wiederholten Mal ermahnt, dass man sein Kreuz zu tragen habe, schweigend und mit Anstand, je schweigsamer, desto anständiger, so gereiche es der Frau zum Ruhme.
Maria war sich nicht sicher, ob sie auf diese Art von Ruhm erpicht war. Sie widersprach der Dulderthese, schon weil es ihre Mutter war, die sie aufstellte. Unternehmen allerdings tat sie nichts. Ich habe weiß Gott genug um die Ohren, sagte sie sich. Ich habe gar keine Zeit, wegen seiner Eskapaden auch nur verletzt zu sein. Der kleine Kloß im Hals, der sich bei diesem Gedanken einstellte, strafte sie jedoch Lügen.
Die Gasse zur Burg tat sich vor ihr auf, und Maria wandte sich abwärts. Ihr Herz schlug ein wenig schneller. Der gewählte Weg führte auch zum Laufer Tor, ebenso gut wie jeder andere, beschwichtigte sie sich selbst. Und meist war er ja auch gar nicht zu sehen. Sie wusste ohnehin nicht, was er von ihr wollte, dieser Südländer. Bestimmt war er zehn Jahre älter als sie, nicht groß, aber breitschultrig. Und Wimpern hatte er wie ein Mädchen, dachte sie, der kein Detail entging. Lange Wimpern über schwarzen Augen, in seinen selten gekämmten Locken hing der weiße Staub. Manchmal lehnte er am Fenster, einen Krug in der Hand, in Gedanken versunken während seiner Arbeitspause. Und wenn sie vorüberkam, folgte er ihr mit seinen Schwarzkirschaugen.
»Bella signorina …«, hatte er ihr einmal in seiner seltsamen Sprache nachgerufen. Es klang, als hätte er rollende Kügelchen im Mund, rau, fremdartig und schnell. Bella signorina! Wo es doch weiß Gott genug dralle Mägde gab, mit denen er hätte schäkern können. Maria begriff nicht, was er von ihr wollte. Einmal war sie dann doch stehen geblieben. »Ich bin keine signorina, ich bin eine signora«, hatte sie so würdevoll wie möglich erklärt. »Und bella bin ich auch nicht.« Da hatte er gelacht, und sie war mit rotem Kopf weitergegangen.
Auch heute standen die Fenster im zweiten Stock des Fembohauses weit offen. Wie immer hingen feiner Staub und der unverkennbare Geruch nach Gips und feuchtem Stein in der Luft. Sie hörte Männerstimmen, Gelächter, dann ein Lied in der fremden Sprache, deren Klang ihre Ohren mittlerweile begierig auffingen, kaum dass sie einen Hauch davon erhaschte. Aber am Fenster zeigte sich niemand. So ging sie weiter, enttäuscht, ohne es sich einzugestehen.
Maria vermied den Egidienplatz mit den vornehmen Häusern. Zu oft sprach sie dort als Bittstellerin vor in der Hoffnung, man habe Verwendung für ihre Dienste und sie könne die ewigen Lücken in der Haushaltskasse schließen. Denn sie bot an, Tischwäsche zu verschönern, Bordüren zu erfinden. Es war ein mühsames Geschäft, und sie hatte das Katzbuckeln satt. Nicht heute, sagte sie sich. Der Tag hatte schlimm genug begonnen. Erst das kalte Bett an ihrer Seite, dann die beiden Klatschbasen, nun das leere Fenster … Andererseits: Es konnte jetzt nur noch besser werden.
Vor dem Laufer Tor, durch das in dieser frühen Stunde schon die Bauernkarren zu den Märkten rumpelten, warteten ihre Fräulein auf sie. Die erste, die sie erkannte, weil ihr weißblondes Haar in der Sonne leuchtete und weil sie ihr heftig entgegenwinkte, war Magdalena Fürst. Magdalena stammte aus dem bekannten gleichnamigen Verlagshaus. Ihr Vater hatte sich vor acht Jahren umgebracht, seitdem betrachteten alle sie mit ein wenig vornehmem Mitleid und dachten, sie müsste ein trauriges, verhuschtes Wesen sein, was aber gar nicht der Fall war. Zwar blickten ihre sehr grünen Augen manchmal ein wenig verhangen und träge, aber ihr Mund blühte, weiblich und voll. Magdalena lachte dem Leben ins Gesicht, zum Ärger von mehr als einer säuerlichen Bürgersfrau. »Maria – hier sind wir!«
Maria Sibylla winkte ebenfalls.
Clara Imhoff kam auf sie zu und nahm die Lehrerin in den Arm. »Danke für den Firnis«, sagte sie. »Der Bote hat alles sicher überbracht. Du musst mir in der nächsten Stunde zeigen, wie ich ihn auftrage. Allein gelingt mir das einfach nicht.«
»Sicher, gerne«, erwiderte Maria, die innerlich aufatmete, weil sie sicher sein konnte, dass Imhoffs auch die Rechnung pünktlich zahlen würden.
Jemand drückte einen Kuss auf ihre Wange. Fast erschrocken wandte Maria sich um, vor ihrem inneren Auge erschien für einen kurzen Moment ein Männergesicht, umrahmt von dunklem Haar. Errötend stellte sie jedoch fest, dass es Dorothea Auer war, mehr Freundin als Schülerin. Die Auerin lachte, dass ihre langen, schwarzen Locken tanzten. »Was ist dir denn über die Leber gelaufen?«, fragte sie.
»Bestimmt eine Raupe«, rief Susanna Sandrart. Auch sie stammte aus einer Malerfamilie, ein hübsches Ding mit braunen Flechten und täuschend sanften Augen. Ihr Vater hielt wöchentlich in seinen Wohnräumen Sitzungen der Künstlerakademie ab, deren Besuchern Susanna mit schöner Regelmäßigkeit den Kopf verdrehte.
Ihre beste Freundin Barbara, die Tochter des Stadtrats Nützel, runzelte die Stirn. »Du bist frech«, stellte sie fest, wie immer beleidigt, dass andere sich solche Bemerkungen erlauben durften, während sie als Ratstochter stets besonders brav zu sein hatte.
Maria hakte sich zum Trost bei ihr unter. »Wenn wir eine Raupe übers Blatt laufen sehen, können wir schon froh sein. Ich fürchte, für die meisten ist es noch zu früh. Aber ich habe bereits einen Kohlweißling fliegen sehen.«
Die Mädchen sangen auf ihrem Weg hinaus ins Grüne, der bald auf beiden Seiten von blühendem Schlehengestrüpp dicht umgeben war. Waldstücke wechselten sich mit Wiesen voller Obstbäume ab, deren Knospen noch fest geschlossen waren. Gut bei dem Regen, dachte Maria, zu deren Füßen die herabgeschlagenen Schlehenblüten wie Schnee lagen und in der Frühsonne mit den Regentropfen um die Wette leuchteten. Sie forderte ihre Mädchen auf, nach der hellgrünen Raupe des Kleinen Zipfelfalters Ausschau zu halten, der so gerne auf Schlehen saß. Aber der kalte Regen schien sie alle verschreckt zu haben. Maria fröstelte ja selber. Endlich zeigte sich der erste Schmetterling im gaukelnden Flug.
»Da ist wieder einer!« – »Da!« – »Pass doch auf!« Hektische Bewegung kam in das Frauengrüppchen.
»Das ist kein Kohlweißling, das ist ein Aurorafalter.« Maria hatte Mühe, im Lärm des Geplappers durchzudringen. Als Barbara ihn fing und ihr brachte, untersuchte sie ihn genauer. »Das ist ein Weibchen, seht ihr die schwarze vordere Flügelspitze? Ein Männchen dagegen hätte Orange auf der vorderen Flügelhälfte. Vorsicht, Barbe.« Erschrocken zuckte das Mädchen zusammen, ließ ihr Netz fallen, und der Falter entkam.
»Ach, du Tollpatsch«, maulte Susanna und erhielt einen Stoß. Magdalena fand es zum Lachen, wie fast alles. Clara, die immer Vernünftige, schüttelte den Kopf und wollte schon dazwischengehen.
»Wartet!«, rief Maria, der das Durcheinander zu viel wurde. Langsam ging sie auf die Hecke zu, die der gelbweiße Sommervogel mit seinen schön marmorierten Flügeln angesteuert hatte. Da, dort unten hockte er ja und klappte die zarten Schwingen auf und zu, rasch und lautlos wie ein Wimpernschlag. Schon hatte sie ihr Netz gehoben, um ihn sacht wieder einzufangen, da erkannte sie, worauf er hockte. Es war ein weißer, nackter Zeh. Ein Frauenzeh.
Im selben Moment ging es Maria auf, dass der Tag sehr wohl noch viel schlimmer werden konnte.
3
Als Erstes scheuchte Maria ihre Mädchen zurück. Sie war ehrlich genug, sich einzugestehen, dass nicht nur die Angst um die Seelenruhe ihrer Jungfern sie dazu bewog, sondern auch die Sorge, deren Familien könnten ihr erzürnt die Schülerinnen entziehen, sollten sie je erfahren, dass es bei Maria Merian Leichen zu sehen gab. Das gehörte einfach nicht zum Bildungskanon einer Patriziertochter.
Alles jedoch konnte sie nicht verhindern. Sie hörte es an dem Schnattern und Kreischen hinter sich. Maria unterband das Schlimmste, indem sie Susanna und Magdalena nach der Wache am Tor schickte. Nützels Tochter erbot sich mitzugehen und gleich den Vater zu informieren: Über so einen Vorfall musste der Rat Bescheid wissen. Maria stimmte zu, wenn auch mit ungutem Gefühl. Es war ihr nicht wohl dabei, ihren Namen in diesem Zusammenhang genannt zu hören. Sie hatte auch so schon einen schweren Stand in der Stadt, in der sie bloß eine Zugereiste war. Aber was sollte sie tun?
Ganz sicher sollte ich mich aus der Sache heraushalten, dachte sie und hatte sich doch schon über den toten Körper geneigt, um ihn genauer in Augenschein zu nehmen. Mit dem ruhigen Auge der Wissenschaftlerin, die Leben und Tod mit derselben offenen Neugierde begegnete, betrachtete sie, was sie vor sich hatte.
Es war eine noch junge Frau, die Haare nass und verfilzt und völlig verfangen im dornigen Geäst der Schlehe, wie auch die Kleider eben erst im Morgenwind zu trocknen begannen. All das sagte Maria, dass die Frau die Nacht während des Regens schon da gelegen haben musste, aber kaum länger, da noch wenig Getier bei ihr war. Trotz der Kühle hätten Fliegen sie umsummen müssen.
Der Kleidung nach war es eine Dienstmagd. Allerdings trug sie einen Unterrock, der nicht zum groben Tuch von Rock und Schürze passte, mit Stickerei geschmückt, wenn sie auch billig war. Die Verzierung war an mehreren Stellen eingerissen, wohl, als ihr Mörder sie tiefer ins Gestrüpp geschoben hatte. Unwillkürlich zupfte Maria ein flatterndes Stück Stoff von einem Dorn und knüllte es in ihrer Hand. Die Art, wie die Röcke gerafft waren, ebenso die blauen Flecken an den Schenkeln sagten ihr genug.
»Ist sie …?«
Maria fuhr herum. Es war Clara, die neben ihr in die Knie gegangen war. Maria nickte nur.
»Armes Ding«, konstatierte die Patriziertochter.
»Du solltest das wirklich nicht sehen«, meinte Maria schwach.
»Und du?«, gab Clara zurück. »Der Tod gehört zum Leben dazu.«
Maria lächelte. »Manchmal bist du schrecklich erwachsen.«
»Ich bin deine Schülerin. – Was ist?«, fragte sie, als sie den Wechsel in Marias Gesichtsausdruck sah.
»Ich habe gerade überlegt, was deine Eltern wohl zu dieser Art Lektion sagen werden.«
»Nun, ich werde ihnen erzählen, dass du ganz züchtig und verantwortungsvoll gehandelt hast, damit unsere unschuldigen Seelen keinen Schaden nehmen.«
»Genau«, sagte Dorothea, die sich jetzt auch ins Gebüsch drängte. Prompt hatte sie mit ihren Haaren zu kämpfen, die sich in den Schlehendornen verfingen. Beim Anblick, der sich ihr bot, bekreuzigte sie sich. »Gott sei ihrer Seele gnädig.« Dann rief sie aus: »Schau, da sind schon die ersten Schnecken.«
Unwillkürlich folgten die beiden anderen ihrem Blick. Für einen kurzen Moment sahen sie auch den Falter wieder, der um den Kopf der Toten herumtorkelte. »Sind das Würgemale an ihrem Hals?«
Weder Maria noch Clara antworteten, um das Offensichtliche zu bestätigen. Dorothea murmelte ein hastiges Gebet. »Es war klug, Magdalena von ihr fernzuhalten«, fiel es ihr dann ein. »Sie spricht nie darüber – aber sie hat damals ihren Vater gefunden, wisst ihr das eigentlich?«
»Ist das dein Ernst?«, fragten Maria und Clara wie aus einem Mund.
Im selben Moment hörten sie draußen Magdalenas unverkennbare Stimme: »Nett von euch, aber nutzlos, ich kenne sie nämlich.«
So schnell sie konnte, krabbelte Maria rückwärts aus dem Gestrüpp. Auch ihr Rock nahm jetzt Schaden, sämtliche Gerätschaften am Gürtel klapperten, und an ihrer Frisur war mit Sicherheit nichts mehr zu retten. »Was hast du da gesagt?«, fragte sie. »Und was machst du schon wieder hier?«
Magdalena ignorierte die zweite Frage. »Na, dass ich die Frau kenne«, wiederholte sie und zog ihren berühmten Schmollmund.
»Du willst doch nur angeben.« – »Ist doch gar nicht möglich.«
Maria stellte die Ruhe wieder her. »Clara«, bat sie ihre Schülerin, »kannst du mit Dorothea mal ein paar Schritte auf und ab gehen?«
Magdalena schob schmollend die Unterlippe vor. Sie war zwar schon über zwanzig und alles andere als ein Kind, aber sie benahm sich auffallend gerne wie eines. Vielleicht, dachte Maria im selben Moment, war das ihre Art, mit dem, was ihr zugestoßen war, fertig zu werden.
»Willst du mir jetzt auch noch Vorhaltungen machen?«, fragte Magdalena und hob herausfordernd das Kinn.
Maria schüttelte den Kopf. Sie versuchte, ihre Locken in den Knoten zurückzustecken. »Nein, aber ich wäre dir dankbar, wenn du den Mädchen gegenüber nachher andeuten könntest, dass du da vielleicht ein wenig voreilig warst. Denk an den Ruf deiner Familie. Es ist nicht gut, in so etwas hineingezogen zu werden. Deshalb hatte ich dich ja zurück zum Tor geschickt«, fügte sie mit leisem Tadel hinzu.
Magdalena überging das und warf ihr einen Blick zu, der besagen mochte: Wie viel schlimmer kann das in unserem Fall noch kommen? Dann schien sie darüber nachzudenken. Nach einer Weile allerdings schüttelte sie den Kopf. »Meine Familie kommt da so oder so nicht heraus. Die Frau war Magd bei uns. Deshalb bin ich mir ja so sicher.«
»Magd?«
»Jungmagd. Blieb nicht lange. Die Mutter hat sie hinausgeworfen, weil sie gar zu sehr mit den Gesellen in der Werkstatt poussierte. Geschah ihr ganz recht.« Magdalenas Schmollen kehrte zurück.
Maria überlegte fieberhaft. Wenn sie den Mund hielten, geschah vielleicht überhaupt nichts weiter. Die Tote lag nicht einmal auf Stadtgebiet.
Langsam kehrten die anderen zurück. »Du mit deinem vorlauten Gerede«, zischte Clara. Magdalena streckte ihr die Zunge heraus. »Wenigstens hab ich mich nicht zum Gaffen dazugedrängt.«
»Mädchen!«, ermahnte Maria Sibylla sie. In ihrem Kopf summte es noch immer. Gerne hätte sie einen Weg gefunden, um aus der Sache herauszukommen. Noch einmal betrachtete sie die Tote. Ihre Augen waren weit geöffnet, noch konnte man erkennen, dass sie einst groß und blau gewesen sein mussten. Andreas’ Typ, ging es ihr flüchtig durch den Kopf. So sahen die jungen Frauen immer aus, mit denen er herumzog: weizenblond, üppig, mit strahlenden Puppenaugen. Es war nicht so, dass sie blind gewesen wäre. Wie oft hatte sie im Spiegel in ihre eigenen dunklen Augen, ihr unscheinbares Gesicht gestarrt und sich gefragt, warum er sie wohl genommen hatte, nicht eine wie diese. Maria Sibylla seufzte. Im selben Moment entdeckte sie genau das, weswegen sie eigentlich hergekommen war: hellgrün, mit cremefarbenen Streifen, glatt und beinahe durchscheinend. »Gebt mir die Schachtel«, flüsterte sie.
Clara wurde als Erste aufmerksam. »Die große?«
Statt einer Antwort streckte Maria die rechte Hand hinter sich und krümmte auffordernd die Finger. Mit der Linken langte sie nach vorne und zupfte ganz langsam und vorsichtig eine Raupe aus den Haaren der Toten.
»Was macht Ihr da?«
Clara ließ vor Schreck die Schachtel fallen.
Maria Sibylla hatte gerade noch die Geistesgegenwart, zuzupacken und die Hand vorsichtig um ihren Fund zu schließen.
4
»Die Gräffin!«
»Oh, Rat Nützel.« Maria Sibylla grüßte artig. »Dass Ihr Euch gleich selbst herbemüht.«
»Ich bin die vierzehn Tage Lochschöffe, gemeinsam mit dem Holzschuher. Und wenn es so ist, wie meine Barbara sagt, dann ist mein Amt hier gefragt.«
Maria Sibylla senkte den Kopf, nicht ohne zu bemerken, dass er sich sogar einen Schützen mitgebracht hatte. Der Rat selber war klein und mausäugig wie seine Tochter. Alles, was an ihr zierlich war, erschien an ihm trocken und zäh. Über sein Selbstbewusstsein sagte das allerdings gar nichts aus. Maria sah, wie er den Unterkiefer anspannte und mit den Zähnen knirschte.
»Ich fürchte wohl, es ist so«, bekannte sie und machte eine Geste hin zu der Toten.
Der Mann verschränkte die Hände auf dem Rücken und neigte sich vor. »Eine Landstörzerin«, stellte er abfällig fest. Maria Sibylla wunderte sich, wie er so rasch zu der Feststellung kommen konnte, nur weil das Weib vor der Stadt lag. Sie dachte an den teuren Unterrock, viel zu gut für eine Magd, der dem Mädel zu Lebzeiten sicher Ärger mit der Gerichtsbarkeit eingebracht hätte. Dann betrachtete sie verstohlen die sauberen Füße und die adrette Schürze. Wie konnte man so jemanden für eine Rumtreiberin halten? Sie wollte schon den Mund öffnen, da überlegte sie es sich noch einmal.
Aber Magdalena kam ihr zuvor. »Das ist die Beata, die war bis Heiligen Joseph Magd bei uns.«
19. März, notierte Maria Sibylla sich im Stillen.
Rat Nützel schaute verärgert auf. Sein Unterkiefer mahlte. Endlich fragte er: »Wo sie dann hin ist, wisst Ihr nicht, Jungfer Fürst?«
Magdalena zuckte mit den Schultern. »Sie wohnt irgendwo in Johannis, glaub ich.«
Maria sandte ein Stoßgebet zum Himmel. Wenigstens hatte sie nichts vom Poussieren mit den Knechten erzählt.
Nützel wandte sich an den Schützen. »Die Leiche kommt auf den Friedhof in Johannis. Der Totengräber soll einen Platz dafür finden, bis der Doktor sie anschauen wird. Hier kann sie nicht liegen bleiben. Ich werde versuchen, die Familie ausfindig zu machen.« Er richtete sich auf und strich sein Wams glatt. Langsam schien zu ihm durchzudringen, dass das turnusmäßig übernommene Amt ihm unerwartete Aufgaben, aber auch eine nicht unwillkommene Bedeutung bescherte. Die Lochschöffen wurden vom Rat bestellt für die Halsgerichtsbarkeit. Bei Mord und Totschlag oblag ihnen die Untersuchung des Falls, und Nützel ahnte schon, dass es hier viel zu untersuchen geben würde. Er würde zusammen mit seinem Kollegen an viele Türen klopfen, viele Fragen stellen müssen, bis der Fall aufgeklärt war. Der Gedanke schien ihm zu behagen.
Maria jedenfalls nahm an, er sei im Augenblick damit abgelenkt genug, um sich zu bücken und die Schachtel aufzuheben. Rasch und verstohlen verstaute sie ihren Fund, aber nicht rasch genug.
»Was ist das?« Barsch verlangte Nützel zu sehen, was sie da eingesteckt hatte.
»Die Raupe des Kleinen Frostspanners«, klärte Maria ihn auf, als er angeekelt das Tier betrachtete. Die grelle Farbe, sagte seine Miene, konnte nichts Gutes bedeuten. Er streckte einen dürren Zeigefinger aus, um sie zu berühren, zog ihn aber im letzten Moment zurück. »Teufelsgetier«, murmelte er. »Sagt, Gräffin, wo Ihr Euch doch mit so etwas auskennt: Ist es nicht ein schlechtes Omen, wenn in einem Jahr so früh schon die Raupen auftreten? Und so viele sollen es sein. Meine Frau sagt, sie wird der Viecher im Apfelgarten nicht mehr Herr.«
Der Schütze hinter ihm bekreuzigte sich unwillkürlich. »Man meint fast, da müsste bald auch Schlimmeres geschehen.«
Maria zuckte mit den Schultern und lächelte freundlich, doch sie wählte ihre Worte mit Bedacht. »Der Fraß an den Obstbäumen ist schlimm genug. Da braucht man nicht nach mehr zu verlangen oder zu suchen. Die Raupen tragen ihren Schaden in sich und weisen sonst auf nichts Böses hin, scheint mir, aber ich bin nur ein Weib.«
Nützel schaute sie ungnädig an. »Hm«, machte er. Dann wandte er sich ab. »Michael«, wies er den Schützen über die Schulter an, »mach Er’s, wie ich gesagt habe. Und Ihr, Gräffin, bringt besser Eure Schülerinnen von hier fort.« Nützel legte seiner Tochter die Hand auf den Nacken. »Mein Mädel bleibt für heute daheim. Vielleicht solltet Ihr die anderen auch fortsenden.«
Als er abgezogen war, schickte Dorothea ihm eine Grimasse hinterher. »Als ob wir kleine Kinder wären.«
Clara betrachtete die Raupe. »Ein Frostspanner«, meinte sie. »Und er sitzt auf Apfelbäumen? Vielleicht könnte ich einen zu dem Zweig mit Apfelblüten dazusticken, an dem ich gerade arbeite.«
»Es sind Nachtfalter, und sie fliegen erst im November«, antwortete Maria Sibylla mechanisch. »Aber du könntest eine der Raupen abbilden.«
»Das wäre hübsch«, mischte Dorothea sich ein. »Das frische Grün harmoniert gut mit dem Rosarot außen an den Blüten.« Die beiden fachsimpelten eine Weile über die Farbwahl. Magdalena hingegen blieb stumm.
Maria legte den Arm um sie. »Möglicherweise hat er recht, und wir sollten tatsächlich alle nach Hause gehen.«
»Wenn du mich loswerden willst – bitte«, stieß Magdalena hervor, befreite sich, ehe Maria etwas sagen konnte, und stürmte davon.
Verblüfft schaute die Malerin ihr nach.
»Launisch wie immer«, stellte Dorothea fest, verabschiedete sich ihrerseits mit einem Kuss auf die Wange, hakte Clara unter und zog die Freundin mit sich fort. »Es gibt viel zu viel zu erzählen«, meinte sie mit unerschüttertem Gemüt, »um jetzt an einem Stickrahmen still zu sitzen.«
»Ich schick am Abend eine Magd vorbei«, versprach Clara noch über die Schulter hinweg, ohne näher zu erläutern, warum und wozu.
Dennoch war Maria dankbar. Sie nickte und verabschiedete die beiden winkend. Dann stand sie alleine da, wenn man von dem Schützen absah, der bei der Toten Wache hielt, bis der Rat ihm Verstärkung schickte. Er hatte die Ermordete bei den Füßen ergriffen und war drauf und dran, sie auf den Weg zu ziehen, als er Maria bemerkte und ein wenig verschämt innehielt. Sie erlöste ihn aus der Verlegenheit mit einem Gruß, sammelte ihre restlichen Schachteln ein und marschierte heimwärts.
5
Daheim fand Maria Sibylla die Magd auf der Bank vor dem Hause. Sie atmete schwer, zu ihren Füßen stand der Holzeimer mit Wasser, das sie vom Brunnen geholt hatte. »Ist’s dir zu schwer?«, fragte die Malerin besorgt. Anna war nicht mehr die Jüngste; sie hatte schon im Haus von Marias Mutter gedient und war den langen Weg aus Frankfurt mit hierher gekommen. Viele ihrer Aufgaben fielen ihr nicht mehr leicht. Ein junges Mädchen anzustellen, das ihr helfen könnte, hatte Maria allerdings nicht das Geld. »Ich sag’s einem der Lehrbuben«, versprach sie, änderte aber im selben Moment ihre Meinung und hob den Eimer selbst hoch, um ihn ins Haus zu tragen.
Schon im Flur war das Geschrei aus der Werkstatt gut zu hören. Offenbar war ihr Mann endlich aufgestanden und hatte nicht alles so vorgefunden, wie er es sich wünschte. Maria Sibylla wusste, es war nicht ratsam, sich jetzt dort blicken zu lassen. Sie trug ihre Last in die Küche und wollte dann hinaufsteigen in ihre eigene Kammer, die nur so überquoll vor Büchern, Malutensilien und Präparaten. Und doch fand sich immer noch Platz für all die Schachteln, Schächtelchen und Schüsseln, in denen Maria Raupeneier, Raupen oder eingesponnene Puppen am Leben hielt, um sie zur Verwandlung zu bringen. Ein schreckliches Durcheinander herrschte dort, in dem nur sie selbst den Überblick behielt. Für sie war es ein Ort des Wunders, einer Verwandlung, die in ihrer Einzigartigkeit und Göttlichkeit dem Wunder der Eucharistie in nichts nachstand. Jedes Mal, wenn aus einer Lebensform eine andere, verwandelte Form entschlüpfte, fühlte sie sich verbunden mit der Allmacht des Gottes, der sich das ausgedacht hatte. Dann malte sie mit doppelter Hingabe und Fleiß, um auch nur ein wenig einzufangen von den wunderbaren Zusammenhängen, in denen der Herr ihre Welt gestaltet hatte.
Gerade heute sehnte sie sich nach diesem besonderen Gottesdienst, der ihr Ruhe gab und Gelassenheit. Ein wenig fühlte sie sich dort drinnen selbst wie eingesponnen, geborgen vor der Welt und in ruhiger Erwartung des Neuen, das von ihrer Hand dort geschaffen würde. Aber sie war noch nicht halb die Treppe hinauf, da krachte die Tür der Werkstatt gegen die Wand. Andreas Graff wankte heraus, ungekämmt, das Hemd und die Weste darüber noch offen, so, wie er irgendwann vor dem Morgengrauen ins Bett gesunken war. Man konnte den Wein noch riechen, mit dem er den Stoff getränkt hatte. Seine Augen blickten trübe, und der Mund war verzogen wie der eines trotzigen Kindes. »Pfuscherei«, brüllte er niemand Bestimmten an. Hinter ihm in der Werkstatt herrschte Stille. Er stieß die Tür zu. »Elende Pfuscher allesamt«, brummte er. Dann wankte er in Richtung Küche.