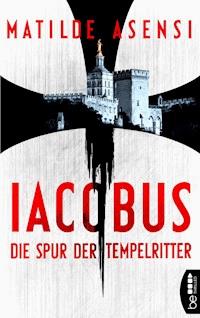9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
In Paris treffen sich fünf Experten, um eines der größten Rätsel der Kunstgeschichte zu lösen: Der Verbleib von Vincent van Goghs Porträt des Doktor Gachet, das 1990 für eine märchenhafte Summe versteigert und seither nie wieder gesichtet wurde. In einer abenteuerlichen Schnitzeljagd, die in den Katakomben von Paris beginnt und bis ins entfernte Japan führt, müssen die fünf mysteriöse Aufgaben lösen - und sich Widersachern entgegenstellen, die auch vor Mord nicht zurückschrecken ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 430
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
Über das Buch
In Paris treffen sich fünf Experten, um eines der größten Rätsel der Kunstgeschichte zu lösen: Der Verbleib von Vincent van Goghs Porträt des Doktor Gachet, das 1990 für eine märchenhafte Summe versteigert und seither nie wieder gesichtet wurde. In einer abenteuerlichen Schnitzeljagd, die in den Katakomben von Paris beginnt und bis ins entfernte Japan führt, müssen die fünf mysteriöse Aufgaben lösen – und sich Widersachern entgegenstellen, die auch vor Mord nicht zurückschrecken …
Über die Autorin
Matilde Asensi, 1962 in Alicante geboren, arbeitete nach dem Journalismusstudium für Rundfunk und Printmedien. Ihr Roman Wächter des Kreuzes aus dem Jahr 2001 entwickelte sich zu einem internationalen Bestseller, der von Kritikern hochgelobt wurde. Inzwischen ist ihre Leserschaft auf mehr als 20 Millionen Menschen weltweit angewachsen. Für ihre literarische Arbeit wurde Matilde Asensi mit mehreren Preisen ausgezeichnet. 2015 erschien mit Die Jesus-Verschwörung die lang ersehnte Fortsetzung ihres Erfolgsromans Wächter des Kreuzes.
MATILDE ASENSI
DAS LETZTE
MYSTERIUM
THRILLER
Übersetzung aus dem Spanischenvon Sybille Martin
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Titel der spanischen Originalausgabe:
»Sakura«
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2019 by Matilde Asensi/La esfera de los libros, S.L
This agreement c/o Schwermann Literary Agency, Essen.
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2021 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Ann-Catherine Geuder, Lübeck
Umschlaggestaltung: www.buerosued.de
Einband-/Umschlagmotiv: © www.buersosued.de
eBook-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-7325-9462-7
www.luebbe.de
www.lesejury.de
There’s nothing more dangerous than someone
who wants to make the world a better place.
Banksy
1DIE RACHE EINES TOTEN MANNES
Als ich in der Rue Clauzel Nummer 14 ankam, hatte ich so ein mulmiges, unsicheres Gefühl, und am liebsten hätte ich mich sofort wieder umgedreht und Reißaus genommen. Die ganze Geschichte erschien mir reichlich merkwürdig. Als ich erkannte, dass das Treffen in einer Kunstgalerie stattfinden sollte, auf deren Schaufenster in gelben Lettern PÈRE TANGUY stand, fühlte ich mich gleich wieder etwas besser. Die Fassade war in einem matten Irisch-Grün gestrichen, das im strahlenden Sonnenlicht dieses warmen Augustmorgens bläulich schimmerte. An den Wänden der Galerie hingen überall Bilder, doch es war keine Menschenseele zu sehen. Ich trat ein und entdeckte ein Schild mit einem Pfeil, der nach hinten wies. Jetzt machte ich mir doch wieder Sorgen und hatte umso mehr das Bedürfnis, schnell wieder zu verschwinden. Doch ich ging weiter und las auf einem Zettel an der Tür, dass das Treffen, zu dem ich eingeladen war, tatsächlich an diesem Tag und um diese Uhrzeit stattfinden sollte. Mit gespielter Entschlossenheit trat ich ein.
Es handelte sich um einen mittelgroßen Raum mit ein paar Klappstühlen, die im Kreis aufgestellt waren. Er wirkte wie ein Lager, das man für ein Sektentreffen umfunktioniert hatte. Ein paar Leute sahen mich neugierig an. Ich grüßte mit einem Kopfnicken und setzte mich mit einigem Abstand zu den Anwesenden. Eine Frau telefonierte leise mit der Hand vor dem Mund, damit wir sie nicht verstanden. Mein Gefühl der Unsicherheit verstärkte sich. Das Ganze wirkte ausgesprochen unheimlich.
Die Tür ging auf, und zu meiner Überraschung traten zwei lächelnde Japaner ein. Einer von ihnen war ziemlich groß, von der Statur eines Sumo-Ringers, und trug ein silbernes Schild am Hemd. Als er an mir vorbeiging, konnte ich lesen, dass er der Geschäftsführer dieser Galerie war. Der andere Japaner, klein, dünn und mittleren Alters, stellte sich vor den großen Monitor an der Wand und begrüßte die Anwesenden mit einer tiefen Verbeugung. Der riesige Geschäftsführer verkündete uns mit starkem Akzent auf Französisch:
»Darf ich vorstellen: Ihr Gastgeber und Förderer Monsieur Ichiro Koga.«
Noch war mir nicht ganz klar, was Monsieur Koga genau förderte, aber wenn dieser Mann mit dem kurzen, glatten Haar mir die vertraglich zugesicherte Geldsumme zahlen würde, könnte er mich auch bitten, mit verbundenen Augen von einer Klippe ins Meer zu springen. Für den üppigen Vorschuss, den er bereits auf mein Konto überwiesen hatte, sowie für die vereinbarte Gesamtsumme war ich mehr als bereit, ihm zuzuhören. Die anderen waren gewiss aus demselben Grund gekommen. Es handelte sich um zwei Männer und eine Frau. Der eine Mann war rothaarig und kräftig, Anfang zwanzig, der andere etwas älter, ein Mulatte mit glänzenden blauen Augen. Die Frau, die an die dreißig sein durfte, hatte Mandelaugen, braunes Haar und war nicht sehr groß. Alle drei wirkten ebenso verunsichert wie ich.
»Ohayō gozaimasu«, begrüßte uns Monsieur Koga und neigte den Kopf. »Danke, dass ihr zu unserem Treffen in der Galerie Boutique du Père Tanguy nach Paris gekommen seid.«
Und das im August, wo selbst am frühen Morgen schon eine mörderische Hitze herrschte. Aber dafür waren sämtliche Kosten übernommen worden … Wie sollte ich da nicht nach Paris kommen? Wo sonst konnte man seinen Jahresurlaub besser genießen?
»Es fehlt noch jemand«, erklärte Koga, der sich ganz zwanglos gab. Er schien daran gewöhnt zu sein, vor Publikum zu reden, und wirkte trotz seiner zarten Statur voller Energie. »Leider können wir nicht länger warten. Doch erlaubt mir vorab, euch einander vorzustellen, denn ihr kennt euch ja noch nicht.«
Der fensterlose Lagerraum mit seiner kalten Neonröhre war ziemlich klein, weshalb wir auf unseren Klappstühlen dicht beieinandersaßen. Monsieur Koga zeigte auf die einzige Frau, die kleine Dunkelhaarige, die sich noch kleiner machte und schüchtern lächelte.
»Odette Blondeau aus Marseille. Danke, dass du gekommen bist, Odette.«
Neuerliches Verbeugen, diesmal nur vor der armen Odette, die rot angelaufen war und uns entgeistert anstarrte. Koga wandte sich kaum wahrnehmbar dem kräftigen, rothaarigen Mann neben ihr zu, der sich so ruckartig aufsetzte, dass der Stuhl unter seinem beträchtlichen Gewicht knarrte. Er trug Vollbart und machte einen jämmerlichen Eindruck mit seinem alten Sweatshirt, den fleckigen Jeans und dem zerschlissenen Baseball-Cap.
»John Morris aus Warren, Michigan, USA. Danke, dass du die weite Reise gemacht hast, John.«
Der Amerikaner winkte gleichgültig ab. Nach der obligatorischen Verbeugung war ich an der Reihe. Alle starrten mich an. Ich schob meine Brille so brüsk nach oben, dass ich mir den Bügel fast in die Nasenwurzel rammte. Das hier schien das Treffen einer Sekte zu sein, und ich wollte weg.
»Hubert Kools aus Amsterdam, Niederlande. Danke, dass du gekommen bist, Hubert. Deine Erfahrung wird uns eine große Hilfe sein.«
Meine Erfahrung?, fragte ich mich überrascht. Ich war lediglich der Besitzer einer ganz ähnlichen Kunstgalerie wie diese hier. Welche Erfahrung meinte Koga? Na gut, solange die vereinbarte Summe bezahlt wurde, sollte das kein Problem sein. Meine Galerie, Kools Kunstgalerie, stand kurz vor der Pleite, die Schulden erdrückten mich, und womöglich würde ich auch meine Wohnung verlieren, weshalb Ichiro Kogas Angebot – vermittelt durch Kamidana, ein Geschäft für Künstlerbedarf, bei dem ich seit einiger Zeit Kunde war – mir die einmalige Chance bot, wieder auf die Beine zu kommen und mein Leben einigermaßen anständig weiterzuführen.
»Oliver Roos aus Liverpool, England. Danke für dein Kommen, Oliver.«
Besagter Oliver hatte etwas Außergewöhnliches an sich. Trotz eines schwarzen Vaters oder einer schwarzen Mutter hatte er die blauesten Augen, die ich je gesehen habe. Er trug eine Glatze und war schön wie ein Männermodel. Dieser fast zwei Meter große Engländer konnte kaum älter als fünfundzwanzig oder sechsundzwanzig sein, und obwohl seine Kleidung nicht sonderlich teuer wirkte, verstand er sie zu tragen. Ich war ebenfalls groß und noch immer athletisch, aber schon dreiunddreißig, und ich hatte bereits das eine oder andere graue Haar, nicht nur auf dem Kopf, sondern auch in meinem Schnurr- und Kinnbart. Jedoch fiel das bei meiner hellbraunen Haarfarbe kaum auf.
Plötzlich ging die Tür auf, und ein sehr blonder Kopf schaute sich um.
»Na endlich!«, rief Koga lächelnd. »Konnichiwa, Gabriella. Komm rein. Das ist Gabriella Amato aus Mailand. Jetzt sind wir vollzählig. Danke, dass du gekommen bist, Gabriella.«
Noch bevor mir Zeit blieb, darüber nachzudenken, wie komisch es war, dass wir alle aus unterschiedlichen Ländern stammten, verschlug mir besagte Gabriella, die sich betont kühl neben Oliver setzte, buchstäblich den Atem. Sie war eine beeindruckende Frau: groß, schlank, sehr blond, fast goldblond, mit wunderschön gebräunter Haut. Dazu grüne Augen und ein geradezu perfektes ovales Gesicht. Vermutlich so um die dreißig, sagte ich mir. Ich hätte gern Papier und Stift zur Hand gehabt und sie gezeichnet, obwohl das Zeichnen nicht gerade meine Stärke ist. Sie trug eine ärmellose Bluse in der Farbe ihrer Augen, eine helle, eng anliegende Hose und Sandaletten mit Absatz. Dazu lange, filigrane Ohrringe, die fast die Schultern streiften. Obwohl sie das blonde Haar zurückgebunden hatte, bewirkte das Neonlicht, dass die feinen Härchen, die sich aus der schicken Frisur gelöst hatten, eine Art Heiligenschein um ihren Kopf bildeten. Ich konnte meinen Blick nicht von ihr abwenden, und ich glaube, den anderen ging es genauso.
»Stellt eure Handys bitte stumm oder schaltet sie aus, was euch lieber ist«, sagte Koga und ergriff die Fernbedienung, die der Geschäftsführer der Galerie ihm hinhielt. »Ich muss euch leider daran erinnern, dass ihr für die Zeit dieses Auftrags eine Verschwiegenheitsklausel sowie die eingeschränkte Nutzung eurer Handys unterschrieben habt. Ihr dürft weder fotografieren noch Bilder oder Informationen ins Internet stellen über das, was wir tun werden, einverstanden? Gut, da wir jetzt vollzählig sind, können wir anfangen.«
Das Neonlicht erlosch, nur die im Boden angebrachten Strahler blieben an, und auf dem Monitor an der Wand erschien eines der letzten Gemälde van Goghs vor seinem Tod, das berühmte Bildnis des Dr. Gachet. Der Arzt hatte auf Empfehlung von Camille Pissarro Vincents Melancholie behandelt, und zwar in Auvers-sur-Oise, einem kleinen Dorf nördlich von Paris, zu jener Zeit knapp eine Stunde Zugfahrt entfernt. Als Vincent Doktor Gachet kennenlernte, schrieb er seinem Bruder in einem Brief, dass der Doktor ein ernstes Nervenproblem hätte und mindestens genauso krank sei wie er.
»Kennt ihr das Bild?«, fragte uns Koga.
»Nein«, platzte der Amerikaner Morris heraus. Wir anderen nickten stumm.
»Keine Sorge, John«, erwiderte Koga freundlich. »Es gehört nicht zu den bekanntesten Werken van Goghs. Alle Welt kennt die Sonnenblumen oder die berühmten Sternennächte, aber nur wenige wissen von diesem Bild, was vor allem dem Umstand geschuldet ist, dass es 1996 geheimnisvollerweise verschwand und man seither nichts mehr davon gehört hat. Und als wäre das nicht genug, waren die Umstände seines Verschwindens für viele Leute derart unangenehm, dass sowohl in der Kunstwelt als auch in der Politik bis heute eine Art Pakt des Schweigens darüber herrscht.«
Damit hatte er mich ertappt. Ich hatte keine Ahnung, dass das Bild verschwunden war, sondern war davon überzeugt gewesen, dass es hier in Paris im Musée d’Orsay hängt. Van Gogh ist natürlich einer meiner Lieblingsmaler, nicht nur, weil er mein Landsmann war, das auch, aber vor allem, weil er wirklich ein großer Künstler war. Zudem einer der wenigen weltberühmten Künstler mit einem eigenen Museum, und das befindet sich in Amsterdam. Van Gogh ist unbestritten der Stolz der Niederlande, und durch mein Kunststudium kannte ich ihn mittlerweile besser als meine eigene Familie. Hinzu kommt, dass Vincents Vater, Theodorus van Gogh, zum Ende des 19. Jahrhunderts viele Jahre als Pastor in der kleinen Kapelle des Dorfes Nuenen gearbeitet hat, wo ich geboren wurde und aufgewachsen bin. All das führte zu meiner großen Leidenschaft für Vincent van Gogh.
»Wenn du das Bild bei Wikipedia eingibst«, fuhr Koga mit seinen Erklärungen für John fort, »wirst du entdecken, dass das Bildnis des Dr. Gachet nicht 1996 verschwunden ist, wie ich eben sagte, sondern um 1997 herum von einem Sammler gekauft wurde – ob australischer oder österreichischer Herkunft ist umstritten –, der es Jahre später wegen finanzieller Nöte an einen Unbekannten weiterverkaufte. Das ist natürlich alles falsch. Das Bild wurde nicht mehr gesehen, seit es 1990 bei einer Versteigerung von Christie’s New York von dem japanischen Multimillionär und Papierfabrikanten Ryoei Saito für die bis dahin höchste Summe für ein Gemälde ersteigert wurde: 82,5 Millionen Dollar. Es blieb bis zu seinem Tod 1996 in Saitos Besitz. Danach verschwand es.«
Die Geschichte, die Ichiro Koga über das Bildnis des Dr. Gachet erzählte, musste wichtig sein und war offensichtlich auch der Grund, warum wir alle in diesem Raum saßen. Auf dem Monitor hatte Dr. Gachet sein tieftrauriges und leuchtend orangefarbenes Gesicht auf die rechte Faust gestützt und blickte uns gleichgültig und zutiefst melancholisch an. Sein Haar war ebenfalls orangefarben, und die schwarz eingefasste, kobaltblaue Jacke wies Schattierungen und drei limettengrüne Knöpfe auf. Auch der Himmel über seinem Kopf schimmerte in limettengrünen Tönen, und auf dem Tisch mit der knallroten Decke, auf den er sich stützte, befanden sich zwei gelbe Bücher und ein Glas mit einem Zweig mit großen grünen Blättern. Mit diesen leuchtenden Farben eindeutig ein echter Vincent van Gogh. Er war zweifelsohne der beste Kolorist aller Zeiten.
John Morris rutschte unruhig auf seinem Stuhl herum. Dem Armen mangelte es eindeutig an der nötigen Bildung, um schätzen zu können, was er gerade sah und hörte. Monsieur Koga schien das zu wissen und erklärte es ihm geduldig, als rede er mit einem Kind. Doch dann sah Koga auf und ließ seinen Blick von einem zum anderen wandern.
»Wir befassen uns jetzt mit der Rache eines toten Mannes«, fuhr er fort. »Deshalb habe ich euch alle eingeladen. Jeder von euch verfügt über eine besondere Fähigkeit, die ihn unentbehrlich macht. Keiner ist zu viel oder überflüssig. Früher oder später werden eure Kenntnisse, Fertigkeiten oder Erfahrungen sehr nützlich sein. Herr Ryoei Saito war nicht irgendwer. Er hatte in Japan große Macht erlangt, blieb dabei aber immer der raubeinige und impulsive Geschäftsmann aus der Provinz, ein extravaganter und unabhängiger Mensch. Heutzutage steht sein Name beispielhaft für die Wirtschaftskorruption, unter der Japan in den Achtziger- und Neunzigerjahren des zwanzigsten Jahrhunderts litt, und dennoch lässt sich nicht leugnen, dass Saito auch ein großer Kunstliebhaber und Nonkonformist war – originell, exzentrisch und zu allem Überfluss rachsüchtig. Extrem rachsüchtig. Und mit diesem Ryoei Saito werden wir uns befassen.«
»Aber, Monsieur Koga …«, stammelte die kleine Odette Blondeau schüchtern und ohne zu wissen, wie sie unseren Gastgeber ansprechen sollte. »Hatten Sie vorhin nicht gesagt, er sei 1996 gestorben?«
Das Bildnis des Dr. Gachet verschwand, und wir erblickten das Foto eines lächelnden, kräftigen Japaners im fortgeschrittenen Alter, der einen Dreiteiler trug und sein graues Haar auf dem quadratischen Schädel nach hinten gekämmt hatte.
»Ja, genau, er starb 1996«, bestätigte Koga. »Aber nennt mich doch bitte Ichiro. Ich gehöre auch zum Team.«
Er holte tief Luft und wandte sich dann wieder dem Foto des stolz und zufrieden dreinblickenden Ryoei Saito zu.
»Nachdem Saito 1990 das Bild von van Gogh bei Christie’s New York ersteigert hatte, brachte er es nach Japan. Der Weltpresse teilte er mit, das Gemälde ein paar Jahre lang behalten zu wollen, laut eigener Aussage aus reiner Liebe zur Kunst, und es später einem japanischen Museum zu schenken, damit alle Welt in seinen Genuss käme.«
Ichiro lächelte breit und sah uns mit blitzenden Augen an.
»Falls ihr es nicht wissen solltet: Japan liebt die Impressionisten und besonders Vincent van Gogh. Der Impressionismus ist stark beeinflusst von der japanischen Farbholzschnittkunst, dem ukiyō-e, was wörtlich übersetzt ›Bilder der fließenden Welt‹ heißt und das Mitte des neunzehnten Jahrhunderts mit unzähligen billigen Drucken und Holzschnitten in Europa Furore machte. Vincent van Gogh war der Künstler, der die meisten japanischen Motive kopierte, was so weit ging, dass alle seine Bilder aus seiner Pariser Zeit vollständig oder zumindest teilweise japanische Motive reproduzieren. Deshalb lieben wir Japaner van Gogh. Ryoei Saito war da keine Ausnahme, und als er das Bildnis des Dr. Gachet erstehen konnte, zögerte er keinen Moment. Er wollte, dass das Bild in einem japanischen Museum zu sehen ist, als Beispiel für Nationalstolz und Macht.«
Das Gesicht unseres Gastgebers wurde unvermittelt wieder ernst.
»Doch der Staat wollte nach Erwerb des Gemäldes, obschon er sich durchaus dankbar für diese Geste gezeigt hatte, 24 Millionen Dollar Steuern von ihm. Saito hatte jede Menge Immobilien verkauft und sich hoch verschuldet, um den van Gogh zu erwerben, weshalb der japanische Fiskus das viele Geld als Gewinn veranschlagte, obwohl Saito das Bild später dem Staat schenken wollte. Und das nahm Saito ganz schlecht auf«, unterstrich er.
Auf Ichiros Hemd bildeten sich langsam große Schweißflecken. Ich wusste nicht, ob es an der Hitze dieser ersten Augustwoche lag (obwohl der Raum klimatisiert war) oder an der Bedeutung, die die Geschichte für ihn hatte. Vermutlich eher Letzteres, denn er wirkte sichtlich betroffen.
»Am 13. Mai 1991«, fuhr Ichiro fort, »kurz nach der Zahlung dieser Steuerlast von 24 Millionen Dollar, schlug in der Weltpresse eine Bombe ein: Saito hatte eine internationale Pressekonferenz einberufen und verkündet, dass er das Bildnis des Dr. Gachet mit ins Grab nehmen würde.«
Auf dem Monitor war jetzt das Titelbild des Londoner Daily Telegraph zu sehen, auf dem in großen Lettern Ryoei Saitos Erklärung gedruckt war.
»Nach dem Ritual des japanischen Shintoismus werden nicht nur die Särge mit dem Körper des Verstorbenen verbrannt, sondern mit ihnen auch eine Vielzahl an Gegenständen, wertvolle Luxusgüter eingeschlossen, die die Familie zum Zeichen ihres Respekts in den Sarg legt. Saito verkündete, dass der van Gogh mit ihm eingeäschert würde, um seine Söhne davor zu bewahren, nach seinem Tod noch einmal ein Vermögen an Erbschaftssteuern an den japanischen Fiskus zahlen zu müssen. Natürlich hatte er – selbst wenn er das Bild letztendlich doch nicht verbrennen wollte – von der Idee, es einem öffentlichen Museum zu schenken, längst Abstand genommen. So erbost war er.«
Ichiro, der jetzt ordentlich schwitzte, drehte sich wieder um.
»Wie ihr dem Titel des Daily Telegraph entnehmen könnt, war die Weltöffentlichkeit, die im Jahr 1990 die Ersteigerung des Gemäldes verfolgt hatte, erschüttert über Ryoei Saitos Erklärung, aber nicht annähernd so erschüttert wie wir Japaner. Wisst ihr, warum? Weil alle Welt glaubte, das sei nur Wichtigtuerei und das Geschwätz eines erbosten Multimillionärs, aber wir Japaner wussten, dass Saitos Worte nichts mit Wichtigtuerei zu tun hatten. In Japan nahm man seine Erklärung für bare Münze, denn selbst noch in den modernen Neunzigerjahren ließen sich viele Wohlhabende mit ihren wertvollsten Kunstgegenständen verbrennen: Kaligrafien, Schmuck, Bilder der ukiyō-e-Künstler, Keramik … Wir Japaner wussten, dass seine Erklärung absolut ernst gemeint war und dass jemand wie Saito seine Meinung nicht ändern würde, da konnte er angesichts der empörten Reaktion des Okzidents noch so lautstark behaupten, dass er den Beamten der Obersten Finanzbehörde Japans nur einen Streich hatte spielen wollen. Der Rest der Welt atmete erleichtert auf und vergaß die Angelegenheit schnell wieder, während wir in Japan den Atem anhielten vor lauter Scham darüber, dass ein Landsmann ein großartiges Gemälde von van Gogh zerstören wollte.«
Ich war wie versteinert und wusste nicht, wie ich auf Ichiro Kogas Geschichte reagieren sollte. Auch die anderen nicht. Wie konnte jemand ein Kunstwerk zerstören, als wäre es Firlefanz oder unbedeutender Plunder? Nun ja, 2001 hatten die Taliban die wunderschönen Buddha-Statuen von Bamiyan in Afghanistan gesprengt, Statuen aus dem 5. Jahrhundert, die an der Seidenstraße standen. Aber das waren Fanatiker, die geistig im Mittelalter stecken geblieben waren. Von einem reichen Papierfabrikanten des 20. Jahrhunderts ist das nur schwer zu glauben, selbst bei einem Japaner. Oder genauer gesagt, gerade weil er Japaner ist, denn bei den Japanern denken wir immer an ihre schöne Tee-Zeremonie, die Kunst des Blumensteckens, die Kirschblüte im Frühling … oder an Sushi.
»Mein Vater Kentaro Koga«, erzählte Ichiro weiter, »war 1991 der Besitzer des größten Bestattungsunternehmens in der Präfektur Shizuoka, aus der neben der Familie Saito auch wir Kogas stammen. Tatsächlich kannten sich mein Vater und Herr Saito seit ihrer Kindheit. Sie waren zwar nicht befreundet, aber als der Skandal aufkam, sagte mein Vater, wie ich mich erinnere: ›Ryoei wird sich mit dem van Gogh verbrennen lassen.‹ Ich war damals siebzehn, hatte gerade das Abitur gemacht und schämte mich wie alle in Shizuoka und ganz Japan. Mein Vater wollte, dass ich auf die Universität gehe und Jura studiere, aber darauf hatte ich keine Lust, also begann ich im familiären Bestattungsunternehmen zu arbeiten.« Ichiro lächelte amüsiert. »Das ist ein gutes Geschäft, auch wenn es euch schwerfallen mag, das zu glauben. Weil in Japan das Sterben sehr teuer ist, extrem teuer, müssen sich enge Familienmitglieder, Freunde und geladene Gäste an den Beerdigungskosten beteiligen. Und deshalb ist ein Bestattungsunternehmen ein gutes Geschäft.«
Der japanische Geschäftsführer der Galerie Boutique du Père Tanguy hatte leise den Raum verlassen und kehrte jetzt mit einer kleinen Wasserflasche zurück, die er Ichiro mit einer Verbeugung überreichte. Der dankte ihm mit einer ebensolchen für seine Aufmerksamkeit, trank einen großen Schluck und stellte die Flasche auf einen freien Stuhl, bevor er weitererzählte.
»1990, im Jahr der Versteigerung, hatte Herr Saito, der schnell viel Geld für das Bildnis des Dr. Gachet brauchte, den Gouverneur der Provinz Miyagi bestochen, damit er einige der Wälder, deren Baumbestand er für die Papierproduktion seiner Firma Daishowa nutzte, zur Bebauung umwidmete. Anschließend verkaufte Saito fast den ganzen Baugrund, der jetzt wesentlich mehr wert war, investierte das Geld in den Kauf des Bildes und ließ auf der kleinen, übrig gebliebenen Parzelle einen Golfplatz errichten, den er Vincent nannte.«
Er lächelte ironisch und griff wieder zur Wasserflasche. Diesmal behielt er sie in der Hand.
»Im November 1993 wurde Saito mit siebenundsiebzig Jahren in seinem Haus in Tokio wegen der Bestechung des Gouverneurs von Miyagi festgenommen und ins Gefängnis gesteckt, woraufhin er seinen Posten als Direktor von Daishowa verlor. Die Fotos von seiner Verhaftung durch die Steuerfahndung des Distrikts Tokio gingen um die Welt.«
Auf dem Monitor war jetzt derselbe Mann fortgeschrittenen Alters zu sehen, der vorher so stolz gelächelt hatte, wie er von besagten Tokioter Steuerfahndern abgeführt wird, und auf dem nächsten Foto sitzt er mit eingezogenem Kopf im Fond eines Polizeiwagens, als wolle er sich verstecken.
»Einen Monat später, im Dezember, war er so krank, dass er aus dem Gefängnis entlassen werden musste und in ein Krankenhaus überstellt wurde. Er hat sich nie wieder erholt. Seine Firma Daishowa stürzte an der Börse ab und stand kurz vor der Pleite. Der Fall des mächtigen Ryoei Saito hat ganz Japan erschüttert. Der eiligst neu ernannte Direktor von Daishowa, Shogo Nakano, versuchte die Firma zu retten, aber es gestaltete sich schwierig, Saitos Besitz und Finanzen von denen des Unternehmens zu trennen. Es ist ihm in der Tat nicht gelungen. Alles in allem verebbte der Skandal rasch wieder, vor allem aus Respekt vor Ryoei Saito, der schon sehr alt und krank war, und weil alle Welt wusste, dass er nicht mehr lange leben würde.«
Bei Ichiros Geschichte fiel mir besonders die ständige Erwähnung von Respekt, Dankbarkeit, Höflichkeitsformeln, Ehre und Ehrverlust sowie Scham auf, all diese uns fremden orientalischen Traditionen gepaart mit westlicher Industrialisierung und Moderne. Denn die Welt, auch wenn heutzutage globale Wirkmechanismen am Werk sind und sie von Mal zu Mal kleiner wirkt, weist dennoch so große kulturelle Unterschiede auf, dass man die Länder ebenso gut für unterschiedliche Planeten halten könnte, die Millionen Lichtjahre voneinander entfernt sind.
Ichiro, der schon ein ganzes Weilchen redete, streckte den Arm aus und zeigte uns ein weiteres Bild. Ein langer Trauerzug mit geschmückten Wagen auf einer trostlosen Landstraße. Auch dabei handelte es sich um ein Schwarz-Weiß-Foto aus einer alten Tageszeitung.
»Ryoei Saito erlag am 30. März 1996 fast achtzigjährig einem schweren Herzinfarkt.« Er zeigte auf den ersten Wagen des Zuges. »Saitos Sarg befand sich in diesem großen Wagen mit den Trauerwimpeln zu beiden Seiten, den übrigens ich gefahren habe.«
Odette Blondeau schrie leise auf.
»Das Bestattungsunternehmen deines Vaters hat die Beisetzung ausgeführt …«, murmelte Gabriella nachdenklich, überschlug die Beine und stützte einen Arm so anmutig auf das Knie, dass mir ganz anders wurde. Wie es schien, hatte sie bereits ihre Schlüsse gezogen und war schon etwas weiter in der Geschichte.
»Genau«, bestätigte er. »Mein Vater kümmerte sich persönlich um die Bestattungszeremonie, die in Japan viel komplexer ist als im Westen, und ich fungierte als sein Assistent. Unsere Angestellten begleiteten uns oder standen vor Saitos Haus in Shizuoka an den Ausläufern des Bergs Fuji. An jenem Tag hatte mein Vater uns alle eingesetzt. Unter seiner Leitung übernahmen wir beide das rituelle Waschen des Körpers, das Ankleiden, Schminken und Parfümieren und legten ihn dann in den Sarg, der traditionell offen bleiben muss. Erst dann ließen wir die Familie ein. Wir befanden uns in einem sehr großen Saal, in den viele tatamis – Reisstrohmatten – passten und den wir als reianshitsu nutzen, soll heißen …« Ichiro suchte nach dem richtigen Wort auf Englisch. »Das ist eine Art Aufbahrungsraum für den Verstorbenen, und es kamen viele Angehörige und Freunde, die unsere Arbeit still betrachteten. Für die Zeremonie hatten wir den Altar mit Blumen und Weihrauch geschmückt und zu den Geschenken der Familie ein großes Foto von Ryoei Saito gestellt. Als wir der Familie sagten, dass sie jetzt Abschied nehmen könnte, trat als Erster sein ältester Sohn Kiminori, den ich aus dem Fernsehen kannte, an den Sarg. Er hielt eine Papprolle in den Händen und legte sie behutsam neben den Körper seines Vaters in den Sarg.«
»Das Bild von van Gogh …?«, entfuhr es dem neugierigen Oliver Roos. Dieser Typ, mit seinen blauen Augen, hatte etwas Argloses und Gutmütiges an sich. Er schien ein guter Mensch zu sein.
Ichiro lächelte ihn breit an.
»Ja, klar!«, rief er und lachte auf. »Die Papprolle mit dem Bild von van Gogh lag im Sarg. Aber lasst mich die Geschichte zu Ende erzählen. Es fehlt nicht mehr viel.« Er ging zögerlich vor dem Monitor auf und ab, als wüsste er nicht genau, wie er fortfahren sollte. »Ich springe jetzt weiter zu dem Zeitpunkt, als der Trauerzug auf dem Weg zum Krematorium von Shizuoka ist, wie ihr auf diesem Foto sehen könnt.« Er zeigte auf die Schwarz-Weiß-Aufnahme. »Ich fuhr den Leichenwagen, und mein Vater saß neben mir. Hinter uns der geschlossene Sarg voller Geschenke und wertvoller Gegenstände, die die Familie ihm zum Abschied mitgegeben hatte. Plötzlich drehte sich mein Vater, der damals siebenundvierzig war, nur wenige Jahre älter als ich heute, auf dem Sitz um und kletterte über die Rücklehne nach hinten in den Leichenwagen, der zum Glück schwarz getönte Scheiben hatte, wie ihr unschwer erkennen könnt.«
Ichiro atmete langsam aus und sah zu Boden.
»Ich war entsetzt und schrie ihn an, was er da mache. Aber er hieß mich schweigen. Im Rückspiegel konnte ich sehen, wie er den Sarg von Ryoei Saito öffnete, die Papprolle herausnahm und unter einer Arbeitsdecke versteckte und anschließend den Sarg wieder schloss. Ich habe mich wahnsinnig geschämt und wäre in dem Moment am liebsten gestorben. Als mein Vater wieder neben mir saß, konnte ich ihm nicht in die Augen schauen. Ich hätte mir niemals vorstellen können, dass mein Vater imstande wäre, solcherart unsere Familienehre zu beschmutzen. Vor lauter Angst zitterte ich am ganzen Körper, aber mein Vater sah es nicht einmal. Er sagt nur: ›Ich musste den van Gogh retten.‹ Dann schwieg er, mehrere Tage lang. Vor Scham wurde er depressiv. Er wagte nicht einmal, meine Mutter anzusehen, die uns beide mit zunehmender Sorge beobachtete. Die Papprolle lag verschlossen im Schrank seines Arbeitszimmers. Ryoei Saito wurde eingeäschert, aber sein van Gogh lag in unserem Haus, und ich hatte keine Ahnung, was mein Vater mit ihm vorhatte.«
Er verstummte einen Moment und fuhr dann fort:
»Es waren schwierige Tage. Ich glaube, ich habe unseren Familientempel nicht einmal zum Schlafen verlassen. In meiner Verzweiflung wollte ich nur, dass Saitos kami – sein Geist – meinem Vater verzieh. Aber mein Vater erlosch jeden Tag ein wenig mehr angesichts der einschüchternden Blicke seiner Frau und seines Sohnes. Seine Schuld würde ewig währen und seine Scham ebenfalls, das wusste er. Er hatte Saitos Geist und Familie beleidigt und sowohl deren Ehre als auch die unserer Familie beschmutzt.«
»Warum habt ihr das Bild nicht anonym den Behörden ausgehändigt?«, wollte Oliver wissen. Der Amerikaner Morris schnaubte daraufhin verächtlich, als wolle er damit sagen, dass er das Bild bestimmt nicht den Behörden gegeben hätte.
»Weil wir es nicht konnten«, erwiderte Ichiro. »Mein Vater erklärte mir an dem Tag, als wir endlich über die Sache sprachen, dass Saitos Familie selbst bei anonymer Herausgabe verpflichtet gewesen wäre, es als Opfergabe für den Toten zu verbrennen, um der Rache der Geister zu entgehen, und außerdem hätten sie sofort gewusst, wie das Bild aus dem Sarg verschwunden war. Wir konnten es den japanischen Behörden nicht geben, weil sie für Saitos unglückliches Ende verantwortlich und natürlich auch nicht die legitimen Besitzer waren. Mein Vater hatte große Angst vor der Rache von Ryoeis Geist!«
Wie kompliziert doch die Japaner sind, dachte ich. Die Welt der Geister, die Rache der Toten aus dem Jenseits … Wie schon gesagt, Planeten, die Millionen von Lichtjahren voneinander entfernt sind.
Da lachte Ichiro wieder auf und sah uns an.
»Ich weiß, für euch aus dem Abendland klingt das alles höchst seltsam, aber bitte versucht, es zu verstehen, und wenn ihr das nicht könnt, es wenigstens zu akzeptieren. Wie dem auch sei, unsere moralischen und geistigen Sorgen hielten nicht lange vor.«
Dem Bild mit dem Trauerzug folgte eines von der Leinwand, auf die van Gogh das Bildnis des Dr. Gachet gemalt hatte. Sie lag ausgerollt auf einem Holzboden, daneben ein Blatt Papier mit japanischen Schriftzeichen sowie ein kleiner Druck in derselben Größe, auf dem nur vage ein weiteres Van-Gogh-Bild zu erkennen war, ebenfalls ein sitzender Mann mit Hut und Gehrock, als würde er für ein Foto posieren.
»Das haben wir gefunden, als wir die Papprolle öffneten.«
Im Raum herrschte verblüfftes Schweigen. Ich betrachtete das Bild aufmerksam, weil mich etwas stutzig gemacht hatte, obwohl ich es nicht gleich benennen konnte. Erst nach längerem Hinsehen fiel bei mir der Groschen: Die Knöpfe des Gehrocks von Doktor Gachet waren nicht limettengrün, sondern gelb, und das Zinnoberrot der Tischdecke war einem Safrangelb gewichen, das der Haarfarbe des Doktors ähnelte.
»Es war eine Fälschung!«, entfuhr es mir.
Ichiro nickte zufrieden.
»Genau, Hubert. Er handelte sich um eine Fälschung. Aber das Wichtigste war der beiliegende Brief. Da ihr kein Japanisch könnt, habe ich ihn für euch übersetzt.«
Ehrfürchtig zog er ein Papier aus seiner Hosentasche und faltete es mit asiatischer Behutsamkeit auf. Nach einem Schluck Wasser begann er vorzulesen:
»Verehrte Richter von Tokio und verehrte Finanzbehörde, wenn Sie diesen Brief lesen, dann ist es Ihnen mit Gewalt gelungen, zu verhindern, dass das Bildnis des Dr. Gachet zusammen mit meinen sterblichen Überresten verbrannt wird, wie es mein Wunsch war. Wie groß muss Ihre Enttäuschung gewesen sein, als Sie entdeckten, dass es nicht der echte van Gogh ist. Ich verspotte Sie selbst noch aus dem Grab heraus. Sie haben mein Leben zerstört, mich erst in die Krankheit und dann in den Tod getrieben und glaubten gar, meinen letzten Willen verhindern zu können. Ich hatte nie die Absicht, das Bild zu verbrennen, ich wollte Sie nur dazu bringen, meinen Brief zu lesen, was ich hiermit erreicht habe. Ich habe geschworen, meinen Kindern Ihre schändlichen Erbschaftssteuern zu ersparen, und glauben Sie mir, auch das wird mir gelingen. Mit anderen Worten: Ich habe gewonnen. Sie wollen das Bild? Wenn Sie es finden, gehört es Ihnen. In der kurzen Zeit meines restlichen Lebens habe ich ein Spiel für Sie entwickelt, bei dem Sie sich auf der Suche nach meinem van Gogh amüsieren können. Schauen Sie sich den kleinen Druck vom Porträt des Père Tanguy, das Vincent 1887 in Paris malte, genau an. Sollten Sie es eingehender studieren wollen, das Original hängt im Musée Rodin. Fahren Sie nach Paris. Dort beginnt das Spiel. Viel Glück. Ihr Feind aus der Welt der Geister, Ryoei Saito.«
Ich kannte das Porträt des Père Tanguy, ich hatte oft in dem weißen Raum im ersten Stock des Musée Rodin gestanden und es betrachtet, wo es zwischen zwei Türen hing und von einem unvorteilhaften grünen Licht angestrahlt wurde. Für mich war es immer das fantastische Porträt eines Unbekannten gewesen. Das hatte sich gerade geändert. Denn jetzt saßen diese fremden Menschen und ich in einer Kunstgalerie mit dem Namen Boutique du Père Tanguy. Die Bilder begannen Gestalt anzunehmen und das Spiel schien hier zu beginnen.
2DAS REICH DES TODES
»Aha!«, rief Ichiro höchst zufrieden. »Ich sehe, ihr ahnt es schon. In der Tat, Saitos Spiel, oder besser gesagt seine Rache, beginnt hier in der Boutique du Père Tanguy. Bitte, Kazuhiko …«
Jetzt übernahm der Geschäftsführer der Galerie, und Ichiro nutzte die Gelegenheit, sich einen Moment hinzusetzen und auszuruhen.
»Der erste Besitzer dieser Galerie war im 19. Jahrhundert der Farbenhändler Julien Tanguy«, erklärte der Sumo-Ringer in gebrochenem Englisch, »aber alle kannten ihn unter dem Namen Père Tanguy oder Vater Tanguy, denn er behandelte die hungerleidenden impressionistischen Künstler, die billige Pigmente für ihre Bilder bei ihm kauften, in der Tat wie ein Vater. Monsieur Tanguy verkaufte seine Farben unter anderem an Monet, Renoir oder Cézanne und natürlich Vincent van Gogh. Da sie kein Geld besaßen, bezahlten sie ihn mit Bildern, die niemand haben wollte und die in diesem alten Lagerraum, in dem wir uns gerade befinden, oder draußen in der Galerie landeten, um hoffentlich irgendwann doch noch einen Käufer zu finden … Was selten geschah, wie ich hinzufügen muss. Vincent van Gogh freundete sich mit Monsieur Tanguy richtiggehend an, weil er als Einziger in ganz Paris seine Bilder ausstellte, und sie gingen oft zusammen aus, um lange Gespräche über die Farben der Impressionisten zu führen, die fast immer in schreckliche Streitereien ausarteten. Beide neigten dazu, leicht aufzubrausen, und beharrten gern auf ihrem jeweiligen Standpunkt.«
Ichiro streckte den Arm aus, und auf dem Monitor war eine Vergrößerung vom Porträt des Père Tanguy in bester Auflösung zu sehen. Der Farbenhändler saß wie ein Buddha in der Mitte, allerdings auf einem Stuhl. Das Einzige, was ihn von der Skulptur eines echten Buddhas unterschied, war die Haltung seiner angewinkelten Beine in einer braunen Hose, aber in allem anderen, einschließlich der aufeinandergelegten Hände, wirkte er wie ein echter Buddha mit Hut, einem zur Krawatte gebundenen gelben Tuch und einer leuchtend kobaltblauen Jacke mit schwarzer Umrandung und Schattierungen. Der gute Mann trug einen säuberlich gestutzten Vollbart, den van Gogh violett gefärbt hatte, während die buschigen Augenbrauen fast unter dem größtenteils dunkelgrünen Strohhut verschwanden. Die Haut von Gesicht und Händen war rosa-gelblich und stand im Kontrast zu den schwarzblauen Augen. Je nach Blickwinkel konnte man seinen Ausdruck als gutmütig oder ausdruckslos bezeichnen.
Während wir aufmerksam das Bild studierten, setzte sich der Geschäftsführer, und Ichiro stand wieder auf.
»Habt ihr erkannt, was ich vorhin mit van Goghs Liebe zu Japan meinte?«, fragte er stolz.
Seine Frage bewirkte, dass ich meinen Blick von der Figur Julien Tanguys abwandte und mich auf den Hintergrund konzentrierte, den ich lediglich als seltsames Durcheinander schriller Farben wahrgenommen hatte. Doch der Hintergrund war ebenfalls sorgfältig ausgestaltet. Van Gogh hatte die Figur Tanguy mit Motiven des japanischen ukiyō-e umrahmt. Also wirklich, der über Père Tanguys Kopf emporragende Berg Fuji war so augenfällig, dass er uns fast auf den Kopf fiel. Dem verschneiten Berg folgte im Uhrzeigersinn ein Flüsschen mit einem wunderschönen blühenden Kirschbaum, dessen rosafarbene Krone sich übers Wasser neigte. Darunter eine gesichtslose Frau in einem Kimono in leuchtenden Farben, die kleinere Version eines Van-Gogh-Bildes, das ich schon oft gesehen hatte. Links von Tanguys Beinen eine Art Füllsel mit einer horizontalen und mehreren vertikalen Linien und darüber eine Ansammlung von roten und lila Blumen und grünen Blättern. Auf dem nächsten Bild beugt sich eine weitere Frau im Kimono nach vorn, aus ihrem orangefarbenen Haar ragen seltsame Stäbchen. Und links neben dem Berg Fuji eine verschneite Landschaft mit einem wunderschönen blauen Himmel über gelben Häusern, an denen zwei Gestalten mit japanischen Schirmen entlangspazieren.
»Nachdem wir den Brief von Herrn Saito gefunden hatten«, referierte Ichiro weiter, »veränderte sich unser Leben radikal. Während ich an der Kunst- und Musikhochschule in Tokio studierte, mich auf Kunstgeschichte spezialisierte und meine Doktorarbeit über van Gogh, den Impressionismus und Postimpressionismus schrieb, reiste mein Vater zusammen mit meiner Mutter durch ganz Europa und besuchte Orte, an denen Vincent van Gogh gelebt hatte, diese Galerie eingeschlossen. Als er dann vor vier Jahren in Rente ging, gab ich meine Arbeit als Universitätsprofessor auf und übernahm das Familiengeschäft, damit meine Eltern ihre Forschungsreisen über Vincent van Gogh fortsetzen konnten. Wir waren regelrecht von ihm besessen und wollten das Bild unbedingt finden.«
Auf dem Monitor tauchte ein weiterer Japaner mit weißem Haar und Brille auf. Er wirkte wie ein Universitätsprofessor und sah Ichiro verblüffend ähnlich.
»Das ist mein Vater Kentaro Koga, kurz bevor er letztes Jahr einen Schlaganfall erlitt, der ihn für immer an den Rollstuhl fesselte. Jetzt ist er auf die Pflege meiner Mutter, die auch schon alt ist, und meiner Frau Midori angewiesen, die sich um beide kümmert, während ich weiter nach dem Bildnis des Dr. Gachet suche, um den einzigen Wunsch meines Vaters zu erfüllen.« In Ichiros Blick lag großer Kummer. »Aus diesem Grund haben wir euch beauftragt«, schloss er. »Deshalb habt ihr eine Klausel unterschrieben, die euch zu absolutem Stillschweigen über das Thema verpflichtet. Deshalb seid ihr heute hier in Paris und habt diese Geschichte erfahren.«
»Und er?«, fragte Morris und zeigte auf den Geschäftsführer. »Hat er auch so einen Vertrag unterschrieben wie wir?«
Die beiden Japaner sahen sich an und brachen in schallendes Gelächter aus.
»Oh nein!«, widersprach Ichiro schließlich und trocknete sich die Tränen. »Kazuhiko ist einer der Söhne meines Onkels, mein Cousin und mein bester Freund.«
Cousins …? Der riesige Sumo-Ringer und der mickrige Bestattungsunternehmer …? Einer von beiden musste adoptiert sein.
»Vor vielen Jahren«, fuhr Ichiro fort, »als ich noch studierte, ist Kazuhiko nach Paris gezogen, um die Geschäfte dieser Galerie zu übernehmen. Mein Vater war nach sorgfältiger Prüfung zu dem Schluss gekommen, dass das von Saito erwähnte Spiel hier beginnen musste. Mein Cousin Kazuhiko hat die Galerie Millimeter für Millimeter abgesucht, aber leider nichts gefunden.«
»Wenn er nichts gefunden hat«, insistierte Morris störrisch und nahm die Baseball-Kappe ab, um sich mit dem Arm den Schweiß von der Stirn zu wischen, »warum sollten wir dann etwas finden?«
Sein barscher Tonfall irritierte den höflichen Ichiro.
»Nun ja, vielleicht findest auch du nichts, John«, lautete seine Antwort, womit er ihn zum Dummkopf abstempelte, ohne dass Morris es merkte, »aber vielleicht die anderen. Wie eingangs schon erwähnt verfügt jeder von euch über Fähigkeiten, die euch bei der Suche unentbehrlich machen. Du zum Beispiel, John, bist in den USA ein Dienstleister, was hier in Europa ein Arbeiter und Handwerker in einer Person ist. Du kannst ein Haus bauen, Wasser- und Elektroleitungen verlegen, Möbel bauen, schleifen, streichen … Hubert ist Besitzer einer namhaften Kunstgalerie in Amsterdam … Oliver ist Maler …«
»Street-Art-Künstler«, korrigierte Oliver. »Ich arbeite mit Spray.«
Ichiro ließ sich nicht aus dem Konzept bringen.
»Street-Art-Künstler. Gabriella auch.«
»Nein, ich bin wirklich Malerin«, erklärte sie lächelnd. »Ich arbeite nicht mit Spray. Ich male zeitgenössische Kunst auf Leinwand und mache gelegentlich auch Skulpturen.«
Die Mischung war ein wenig seltsam. Kunst und Handwerk, könnte man sagen. Warum, zum Teufel, sollten wir ein Bild suchen, das ein alter, verbitterter Japaner irgendwo versteckt hatte? Wegen des Geldes, brachte ich mir sogleich in Erinnerung. Ich war wegen des Geldes hier, und wenn Ichiro verlangte, dass wir die Galerie Tanguy auf den Kopf stellten, dann würde ich das bis zur Erschöpfung tun.
»Warum fangen wir nicht gleich damit an?«, schlug Ichiro mit breitem Lächeln vor, als wäre uns der Erfolg bereits gewiss. »Kazuhiko hat in der Galerie ein Buffet vorbereitet und die Jalousien heruntergelassen. Wir könnten erst etwas essen und dann loslegen.«
»Aber womit anfangen?«, grunzte Morris ungnädig. »Was sollen wir denn eigentlich suchen?«
»Das Bild von van Gogh natürlich«, erwiderte Ichiro sichtlich überrascht. »Hast du nicht verstanden, was ich gerade erklärt habe?«
Der Amerikaner wurde rot wie eine Tomate.
»Ich habe dich ganz genau verstanden!«, dröhnte er und ballte die Fäuste. Dann beruhigte er sich wieder, als wäre ihm plötzlich etwas (das Geld) eingefallen. »Das Bild von van Gogh. Na schön. Dann suchen wir also das Bild von van Gogh.«
Wir machten uns über das Buffet her, das der Cousin unseres Gastgebers vorbereitet hatte, und griffen ordentlich zu. Dann schlenderte ich mit einem Erfrischungsgetränk durch die Galerie, in der jetzt unerklärlicherweise jede Menge Drucke vom Porträt des Père Tanguy hingen. Kleine, große, im Pop-Art-Stil, surrealistisch, hyperrealistisch, abstrakt, kubistisch … Doch alle zeigten ausschließlich die Figur Père Tanguy, denn auf den vielen Interpretationen, die im Laufe der Jahre von den unterschiedlichsten Künstlern davon angefertigt wurden, fehlten aus irgendeinem Grund die japanischen Hintergrundmotive. Seltsam war auch, dass ich am Morgen beim Betreten der Galerie nur Bilder wahrgenommen hatte. Mein Gehirn hatte nicht registriert, dass alle Bilder, oder fast alle, Reproduktionen dieses einen Van-Gogh-Motivs waren. Julien Tanguys buddhistisch anmutendes Gesicht war omnipräsent, sogar in der kleinen Toilette, in die ich aus Neugier kurz den Kopf steckte.
Oliver, der Engländer, betrat einen weiteren Lagerraum am Ende des kleinen Flurs. Ich folgte ihm. Odette plauderte angeregt mit Ichiro und seinem Cousin, und der Amerikaner war am Buffet hängen geblieben. Gabriella hatte uns beobachtet und war uns gefolgt. Ich spürte ihre Wärme hinter mir wie einen Heizstrahler. Als ich vor drei Jahren dahinterkam, dass meine Frau Annelien mit einem Arbeitskollegen schlief, hatte ich mich scheiden lassen. Seither war alles den Bach runtergegangen: mein Leben, meine Galerie … Sie hatte wieder geheiratet und ich hatte kurz vor meiner Reise nach Paris erfahren, dass sie ein Kind erwartete. Also flog ich in die Stadt der Liebe und schleppte mein verwundetes Herz durch die verwaisten, brütend heißen Straßen. Zumindest würde diese Suche die Leere des bevorstehenden Urlaubsmonats füllen, die Galerie war geschlossen, ich hatte nichts zu tun und keine Lust zu gar nichts.
Dieses Lager war in etwa doppelt so groß wie das andere und ziemlich schmutzig. Oliver stellte eine Holzkiste beiseite, die vor einer Wand gestanden hatte, und wischte sich die staubigen Hände an den Hosenbeinen ab.
»Das ist der perfekte Ort«, sagte Gabriella hinter mir.
Oliver und ich drehten uns um. Sie war mit Abstand die attraktivste Frau, die ich je gesehen hatte.
»Wenn in dieser Galerie etwas versteckt ist«, ergänzte sie, »muss es hier irgendwo sein.«
»Dann mach dich darauf gefasst, ordentlich schmutzig zu werden«, erwiderte Oliver, der mühelos die nächste Kiste anhob und sie ihr hinhielt. »Es ist ekelhaft.«
Sie lächelte und nahm furchtlos die schmutzige Kiste entgegen, wobei sie ein wenig in die Knie ging. Schon nach kurzem Herumräumen sahen wir grässlich aus: Haar, Gesicht, Hände, Kleidung, Brillengläser … Alles dreckig. Aber gefunden hatten wir nichts. Irgendwann tauchten auch Ichiro und Kazuhiko auf, sie lehnten am Türrahmen und sahen uns zu.
»Ihr wollt euch die Hände wohl nicht schmutzig machen, was?«, stichelte Gabriella.
»Wir haben sie uns schon oft schmutzig gemacht«, antwortete Kazuhiko freundlich. »Vorsicht mit den Kisten. Darin sind Monsieur Tanguys alte Werkzeuge und Muster von alten Farben in Schweinsblasen. Darunter auch welche in weichen Zinntuben, die Mitte des 19. Jahrhunderts aufkamen. Alles in diesen Kisten hat großen historischen Wert.«
»Das merkt man«, erwiderte Oliver und fuhr sich mit dem Handrücken über die Nase.
Gabriella war gerade dabei, energisch über einen großen Schimmelfleck an der Wand zu reiben.
»Das ist nur die Wand«, versicherte ihr Kazuhiko.
Ichiro stieß ihn mit dem Ellenbogen heftig in die Seite. Der Sumo-Ringer zuckte zusammen.
»Kazuhiko«, knurrte er seinen Cousin an. »Lass sie doch selbst suchen, und misch dich nicht ein. Sie könnten etwas finden, das uns entgangen ist.«
Der Riese nickte. Dann stieß Oliver einen Schrei aus, und wir alle fuhren herum. Er zeigte auf Gabriella. Nun ja, nicht direkt auf Gabriella, sondern auf den Schimmelfleck, an dem sie rieb.
»Schaut euch das an!«, rief er mit tellerrunden Augen und ging näher. Mit zwei Schritten war ich bei ihm und starrte auf die kleine Zeichnung an der Wand.
»Das ist eine Ratte«, sagte Ichiro, der sie schon gesehen haben musste.
Dieses Schablonenbild einer schwarzen Ratte gab es in Paris überall zu sehen. Ihr Schwanz war nach oben gebogen, der Körper gereckt und die Pfoten ausgestreckt, als würde sie fliegen.
Aber Oliver schien nicht eine erbärmliche Ratte zu sehen, sondern die Pietà von Michelangelo. Er fiel vor dem Bild auf die Knie und kratzte mit seinen schmutzigen Fingern ein wenig Gips ab.
»Ist das wertvoll?«, wunderte sich Ichiro.
»Blek le Rat!«, murmelte Oliver voller Ehrfurcht. »Das ist die Signatur von Blek le Rat. Hier muss es ein Werk von ihm geben.«
»Wer ist Blek le Rat?«, fragte Gabriella neugierig.
Ichiro suchte bereits in seinem Smartphone danach.
»Aber hallo, der scheint ja wirklich bedeutend zu sein!«, murmelte er, während er auf das Display starrte und mit seinem sauberen Finger weiterscrollte.
»Sehr bedeutend!«, bestätigte Oliver und suchte weiter. »Ich brauche einen Meißel oder Stichel! Oder einen Cutter, verdammt noch mal! Da drunter ist ein Werk von Blek le Rat!«
Während Kazuhiko ins andere Lager eilte, um dem ungeduldigen Oliver eines dieser Werkzeuge zu holen, konsultierten Gabriella und ich ebenfalls unsere Handys bezüglich dieses verflixten Bleks. Und tatsächlich, Blek le Rat war ein berühmter französischer Street-Art-Künstler, der seit 1983 die Straßen von Paris verschönerte. Ein Teil seines Werkes war gerade im Museum George Pompidou zu sehen. Offensichtlich war er ein Pionier und der künstlerische Vater des berühmten Graffiti-Künstlers Banksy, dessen Werke auf dem Kunstmarkt Preise erzielten, die schlicht nicht zu ignorieren waren, und den sogar ich kannte. Doch von diesem Franzosen, der sogar besser als Banksy zu sein schien, hatte ich noch nie gehört. Tja, wenn man in Nordamerika oder England geboren worden war, dann konnte man ohne größere Anstrengung auf der ganzen Welt erfolgreich sein. Künstler aus anderen Ländern mussten sich mit dem zweiten Rang auf dem Kunstmarkt zufriedengeben, selbst wenn sie besser waren. Und Blek le Rat war zweifelsohne viel besser. Was ich sah, gefiel mir ausgesprochen gut.
Kazuhiko brachte Oliver einen Cutter, und der begann, ganz vorsichtig die Gipsschicht vom Werk des französischen Künstlers zu schaben. Sie bröckelte bereits an etlichen Stellen. Kaum dass er den Cutter ansetzte, fielen große Placken ab. Odette und Morris hatten sich ebenfalls zu uns gesellt, und alle zusammen beobachteten wir, wie Oliver die Wandmalerei sorgfältig freilegte. Er hätte sich den Cutter eher ins Herz gerammt, als das zu zerstören, was unter dem Schimmel nach und nach zum Vorschein kam: ein buntes Street-Art-Kunstwerk.
»Schon wieder dieser Tanguy?«, schnaubte Morris.
In der Tat, es war eine weitere Reproduktion vom Porträt des Père Tanguy in Originalgröße, aber diesmal im Graffiti-Stil mit Schablone angefertigt. Und darunter die schwarz-weiße Ratte.
»Das ist ein Werk von Blek le Rat!«, wiederholte Oliver, als er mit glänzenden Augen ein paar Schritte zurücktrat und dann wieder näher heranging. Er war sichtlich gerührt und bat Ichiro, es fotografieren zu dürfen, der es ihm nur unter der Bedingung erlaubte, es nicht ins Internet zu stellen, zumindest noch nicht. Oliver begann wie ein Verrückter mit seinem Handy zu fotografieren. Wir anderen taten es ihm natürlich gleich. Das Bild war wirklich gut, und ich musste an den Fall von Adolphe Monticelli und Vincent van Gogh denken. Kein Mensch erinnerte sich an Monticelli, aber alle Welt bewunderte van Gogh, der sich an Monticellis Stil orientiert hatte und ein großer Bewunderer von ihm war, ebenso wie kaum jemand Blek le Rat kannte, aber alle Welt Banksy verehrte.
»Was könnte dieses Bild wert sein?«, fragte ich aus beruflicher Neugier. Aus Olivers blauen Augen traf mich ein vorwurfsvoller, empörter Blick.
»Kunst hat keinen Preis«, tönte er von seinem Elfenbeinturm der künstlerischen Überlegenheit herab. Ich überhörte das – er war noch ein naiver Träumer. Für die armen Hungerleider, die wie die Impressionisten versuchten, von ihrer Kunst zu leben, hatte Kunst keinen Preis. Für viele andere wie für Ryoei Saito besaß Kunst einen Wert von Millionen oder Milliarden Dollar. Denn ich handelte mit Kunst. Das war mein Beruf und der von Millionen Galeristen und Händlern auf der ganzen Welt. Kunst zu verkaufen, damit andere Menschen sie in ihre Wohnungen hängen und wie Musik oder Bücher genießen konnten.
»Ich schätze, zwischen zehn- und fünfzigtausend Euro«, antwortete mir Gabriella. »Bin mir aber nicht sicher. Wäre es ein Banksy, eher Millionen.«
Kurioserweise sprach diese Frau dieselbe Sprache wie ich, auch wenn sie wie Oliver zur Welt der träumenden Künstler gehörte.
»Auf der Ratte stehen Zahlen«, sagte Odette und ging etwas näher.
»Das sind römische Zahlen …«, erklärte Oliver und bückte sich. »MCM … 1995. In dem Jahr hat er es gemalt. Es ist selten, dass Street-Art-Künstler ihre Werke datieren, und noch seltener mit römischen Ziffern.«
In meinem Kopf klingelte es, und noch bevor mir klar wurde, warum, stand Morris schon neben Oliver und fuhr mit seinen groben Händen über das Bild. Was er berührte, begann zu glänzen (was ein Glück, dachte ich, dass ich bei der Vorstellung nicht seine fettige Hand schütteln musste), als würde er das Bild lackieren. Eine Art Ölschicht, egal, ob menschlich oder pflanzlich.
»Da ist eine Kante«, murmelte er. »Das Ding ist in die Wand eingelassen. Es gehört nicht dazu.«
»Das Ding ist ein Kunstwerk!«, korrigierte ich ihn auf Englisch.
»Okay, wenn du das sagst«, schnaubte Morris, legte seine Hände auf Julien Tanguys Hände und drückte kräftig zu.
»Was machst du da?«, rief Oliver empört und schubste ihn weg. Oliver mochte ja ein athletischer Kleiderständer von zwei Metern Größe sein, aber Morris war ein großer, dicker Ami, der sich gewiss von Hamburgern ernährte.
»Weg da, du Idiot«, erwiderte er und legte seine Hände rechts und links von Tanguys Kopf. Wir hörten ihn dabei knurren und keuchen. »Es lässt sich bewegen«, stellte er fest. »Helft mir!«
Wir alle stürzten uns auf Blek le Rats Werk und hinterließen überall schmutzige Handabdrücke. Die Frauen wichen irgendwann zurück und der kleine Japaner ebenfalls. Aber Morris hatte recht: Dieses Stück Wand gab nach. Jetzt konnten wir schon die unregelmäßigen Kanten erkennen, weil es ein paar Zentimeter eingedrückt war. Ich drückte mit meiner ganzen Kraft auf Tanguys linken Arm und fand mich nach einem metallischen Klicken in einem Knäuel aus Armen und Beinen wieder. Das Wandstück mit Blek le Rats Bild hatte vollständig nachgegeben und sich wie eine Tür zu einem weiteren kleinen Lagerraum geöffnet.
Ich befreite mich von Morris Armen in meinem Nacken, von Kazuhikos Hand auf meinem Gesicht und von Olivers Beinen an meinem Rücken und rappelte mich verstaubt bis zu den Wimpern auf. Meine Brille hatte sich bei dem Sturz in den Nasenrücken gebohrt und war verbogen; ich musste sie abnehmen und mir genauer ansehen. Inzwischen waren Gabriella, Odette und Ichiro durch die Öffnung gegangen und suchten nach einem Lichtschalter. Ichiro schaltete die Handylampe ein.
Zum Glück ließ sich der Bügel meiner Brille wieder zurechtbiegen, und die Gläser waren heil geblieben, also wischte ich sie an meinem Hemd ab und hatte wieder Klarblick. Alle befanden sich bereits in dem Raum und schalteten nacheinander ihre Handylampen ein.
Ich fand aus meiner Verblüffung nicht heraus. Das von Blek le Rat gemalte Bild von Tanguy hatte sich als Geheimtür entpuppt, die achtundzwanzig Jahre lang unentdeckt geblieben war. Klar, man hatte sie mit einer feinen Gipsschicht überzogen und anschließend jede Menge schmutziger Kisten davor gestapelt. Im Laufe der Jahre hatte die Wand Schimmel angesetzt, der wiederum Gabriellas Aufmerksamkeit erregt hatte. Da standen wir also – Saitos verfluchtes Spiel hatte offensichtlich begonnen.
»Wir müssen da runter«, sagte Morris und zeigte auf die Steintreppe, die in einen dunklen Schacht zu führen schien.
Odette und Gabriella blickten sich ein wenig erschrocken an.
»Woher wissen wir, dass wir da runtergehen sollen?«, fragte Odette zögerlich.
Ichiro, der schon einen Fuß auf die erste Stufe gesetzt hatte, drehte sich mit strahlendem Gesicht zu ihr um.
»Ich habe nicht den geringsten Zweifel daran, dass diese verborgene Tür Saitos Werk ist«, sagte er überzeugt. »Es ist seine Handschrift: Werk eines Künstlers, Jahr, Ort … Alles passt, Odette.«
Kazuhiko ergriff seinen Cousin am Arm, als wolle er ihn zurückhalten.
»Was soll ich tun? Soll ich mitgehen?«
Ichiro überlegte kurz und schüttelte dann den Kopf.