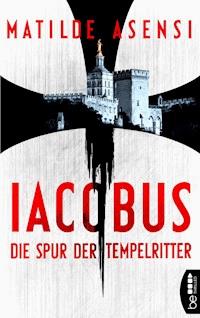
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Eine fesselnde Schatzsuche auf dem wichtigsten Pilgerweg des Mittelalters!
Frankreich, im Jahr 1317: Drei der mächtigsten Männer Frankreichs sind tot. Starben sie eines natürlichen Todes, oder ließ der jüngst verbotene Tempelritterorden sie aus Rache ermorden? Diese Frage lässt Papst Johannes XXII. keine Ruhe - und es gibt nur einen, der Licht ins Dunkel bringen kann: Ritter Galcerán de Born, einer der klügsten Köpfe und tapfersten Ritter seiner Zeit. Was Galcerán nicht ahnt: Er soll vor allem das wertvolle Gold der Tempelritter aufspüren, das seit der Zerschlagung des Ordens verschwunden ist. Alle Spuren führen ihn auf den Jakobsweg, doch die Suche des Ordensritters bleibt nicht unbemerkt ... Wird seine Zeit reichen, um die Rätsel der Templer zu entschlüsseln?
Dieser herausragende historische Thriller verwebt spannende Fakten mit einer packenden Handlung vor mystisch mittelalterlicher Kulisse! Jetzt endlich wieder als eBook erhältlich!
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 565
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Widmung
Prolog
EINS
ZWEI
DREI
VIER
FÜNF
EPILOG
Leseprobe
Über dieses Buch
Frankreich, im Jahr 1317: Drei der mächtigsten Männer Frankreichs sind tot. Starben sie eines natürlichen Todes, oder ließ der jüngst verbotene Tempelritterorden sie aus Rache ermorden? Diese Frage lässt Papst Johannes XXII. keine Ruhe – und es gibt nur einen, der Licht ins Dunkel bringen kann: Ritter Galcerán de Born, einer der klügsten Köpfe und tapfersten Ritter seiner Zeit. Was Galcerán nicht ahnt: Er soll vor allem das wertvolle Gold der Tempelritter aufspüren, das seit der Zerschlagung des Ordens verschwunden ist. Alle Spuren führen ihn auf den Jakobsweg, doch die Suche des Ordensritters bleibt nicht unbemerkt … Wird seine Zeit reichen, um die Rätsel der Templer zu entschlüsseln?
Über die Autorin
Matilde Asensi, 1962 in Alicante geboren, arbeitete nach dem Journalismusstudium für Rundfunk und Printmedien. Ihr Roman »Wächter des Kreuzes« aus dem Jahr 2001 entwickelte sich zu einem internationalen Bestseller, der von Kritikern hochgelobt und weltweit sechs Millionen mal verkauft wurde.
MATILDE ASENSI
IACOBUS
Die Spur der Tempelritter
Aus dem Spanischen von Silvia Schmid
beTHRILLED
Digitale Erstausgabe
»be« - Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2000 by Matilde Asensi
Titel der spanischen Originalausgabe: »Iacobus«
Originalverlag: Plaza & Janés Editores S. A., Barcelona 2000
This agreement c/o Schwermann Literary Agency, Essen and Bookbank Literary Agency, Madrid
Für die deutschsprachige Erstausgabe:
Copyright © der deutschen Übersetzung 2002 by
Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG,
München
Titel der deutschsprachigen Erstausgabe: »Iacobus«
Verlag: Deutscher Taschenbuch Verlag, München
Die Übersetzung der Zitate aus dem »Codex Calixtinus« wurde entnommen:
»Der Jakobsweg. Mit einem mittelalterlichen
Pilgerführer unterwegs nach Santiago de Compostela«
Ausgewählt, eingeleitet, übersetzt und
kommentiert von Klaus Herbers, Tübingen 1998
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2017 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat/Projektmanagement: Rebecca Schaarschmidt
Covergestaltung: © www.buersosued.de
eBook-Erstellung: 3w+p GmbH, Ochsenfurt
ISBN 978-3-7325-5307-5
Weitere Titel der Autorin:
Wächter des Kreuzes
Die Jesus-Verschwörung
Der verlorene Ursprung
Dieses eBook enthält eine Leseprobe des in der Bastei Lübbe AG erscheinenden Werkes »Die Jesus-Verschwörung« von Matilde Asensi.
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2015 by Matilde Asensi/Editorial Planeta, S.A.
Titel der spanischen Originalausgabe: »El regreso del Catón«
Originalverlag: Editorial Planeta, S.A.
This agreement c/o Schwermann Literary Agency, Essen and Bookbank Literary Agency, Madrid
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2017 by Bastei Lübbe AG, Köln
Übersetzung: Sybille Martin
Covergestaltung: © www.buerosued.de
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Für meinen kleinen Freund Jacobo C. M.,der fest davon überzeugt ist,dass ich ihm diesen Roman gewidmet habe.
Prolog
Es scheint zum jetzigen Zeitpunkt unerklärlich, dass ich, Galcerán de Born, bis vor kurzem noch Ritter des Ordens des Hospitals vom Heiligen Johannes zu Jerusalem, Zweitgeborener des edlen Geschlechts derer von Taradell, der im Heiligen Land das Kreuz genommen und Vasall unseres Königs Jaime II. von Aragón war, noch immer an die Existenz eines unausweichlichen, hinter den scheinbaren Wechselfällen des Lebens verborgenen Schicksals zu glauben vermag. Wenn ich jedoch an all das zurückdenke, was sich in den letzten vier Jahren zugetragen hat – und ich denke fast unentwegt daran –, gelingt es mir nicht, mich von der Vermutung zu lösen, dass ein mysteriöses Fatum, vielleicht jenes supremum fatum, von dem die Kabbala spricht, die Fäden der Ereignisse mit einer hellsichtigen Zukunftsvision verknüpft, ohne auch nur im Geringsten unsere Wünsche und Vorhaben gelten zu lassen. Deshalb nun, in der Absicht, meine verworrenen Gedanken zu ordnen, und in dem Wunsch, die sonderbaren Einzelheiten dieser Geschichte festzuhalten, damit sie von zukünftigen Generationen verlässlich erkannt werden, beginne ich diese Chronik im Jahre unseres Herrn 1319, in dem kleinen portugiesischen Ort namens Serra d’El-Rei, wo ich unter anderem als Medikus tätig bin.
EINS
Kaum war ich von der robusten sizilianischen Galeere an Land gegangen, auf der ich die lange und erschöpfende Reise von Rhodos hierher zurücklegte – unterwegs hatten wir zudem die Häfen von Zypern, Athen, Sardinien und Mallorca angelaufen –, und hatte meine Schreiben in der Komturei meines Ordens in Barcelona vorgelegt, ließ ich auch schon eiligst die Stadt hinter mir, um meine Eltern aufzusuchen, die ich seit zwölf Jahren nicht mehr gesehen hatte. Obwohl ich gern einige Tage bei ihnen geblieben wäre, konnte ich doch nur wenige Stunden dort verweilen, da mein eigentliches Ziel, das ich möglichst bald erreichen wollte, das Mauritiuskloster von Ponç de Riba war, welches zweihundert Meilen weiter südlich in einer Gegend lag, die noch bis vor nicht allzu langer Zeit in den Händen der Mauren gewesen war. Ich hatte an jenem Ort etwas sehr Wichtiges zu erledigen, etwas so Vordringliches, dass es meine Abreise von der Insel, das Verlassen meines Heims und meiner Arbeit rechtfertigte, obgleich ich offiziell nur nach Spanien zurückgekehrt war, um einige Jahre dem gewissenhaften Studium einer Reihe von Büchern zu widmen, die sich im Besitz des Klosters befanden und die mir dort dank des Einflusses und des Ersuchens meines Ritterordens zur Verfügung gestellt werden sollten.
Mein Pferd, ein schönes Tier mit kräftiger Vorder- und Hinterhand, strengte sich wahrhaft an, um dem Rhythmus gerecht zu werden, den ihm meine Unrast aufzwang, während wir durch die Weizen- und Gerstenfelder galoppierten und dabei rasch zahlreiche Dörfer und Weiler hinter uns ließen. 1315 war kein gutes Jahr für die Ernte, und die Hungersnot breitete sich wie die Pest über alle christlichen Reiche aus. Dennoch ließ mich die lange fern meiner Heimat verbrachte Zeit alles wie mit den Augen eines blind Verliebten betrachten, so dass mir die Gegend so herrlich und fruchtbar wie eh und je vorkam.
Schon sehr bald erspähte ich die ausgedehnten Besitztümer der Mauritiusbrüder in der Nähe der Ortschaft Tora und gleich darauf die hohen Mauern der Abtei mit den spitzen Türmen ihrer schönen Kirche. Ohne den geringsten Zweifel wage ich zu behaupten, dass Ponç de Riba, vor rund 150 Jahren gegründet von Ramón Berenguer IV., eine der größten und erhabensten Klosteranlagen ist, die ich jemals gesehen habe. Seine ansehnliche Bibliothek ist im Abendland einzigartig, denn sie besitzt nicht nur die außergewöhnlichsten geistlichen Codices der Christenheit, sondern auch fast die gesamten wissenschaftlichen jüdischen und arabischen Schriften, die von der kirchlichen Hierarchie verdammt worden waren, hatten sich die Mönche des heiligen Mauritius doch glücklicherweise immer dadurch ausgezeichnet, einen für jegliche Art von Reichtum aufgeschlossenen Geist zu besitzen. In den Archiven von Ponç de Riba habe ich unglaubliche Dinge zu Gesicht bekommen: hebräische chartularia, Papstbullen und Briefe muslimischer Herrscher, die selbst den unerschütterlichsten Gelehrten beeindruckt hätten.
Ein Ritter des Hospitaliterordens ist an einem solch ehrwürdigen, dem Studium und Gebet geweihten Ort ganz offensichtlich fehl am Platz. Doch mein Anliegen war außergewöhnlich, denn – sah man einmal von dem tatsächlichen, geheimen Grund ab, der mich nach Ponç de Riba geführt hatte – mein Orden zeigte besonderes Interesse daran, sich zum Allgemeinwohl unserer Spitäler Wissen über die schrecklichen, fieberhaften Blattern anzueignen, die von den arabischen Medizi so ausgezeichnet beschrieben worden waren, sowie Kenntnisse über die Zubereitung von Sirupen, alkoholischen Essenzen, Pomaden und Salben zu gewinnen, von denen wir in den Jahren unserer Gegenwart im Königreich Jerusalem gelegentlich gehört hatten.
Im Besonderen verspürte ich einen glühenden Eifer, den Atarrif des Albucasis von Córdoba zu studieren, ein Werk, das nach seiner Übersetzung ins Lateinische durch Gerardo de Cremona auch unter dem Titel Methodus medendi bekannt war. Aber eigentlich war es mir einerlei, in welcher Sprache die Abschrift des Klosters verfasst worden war, da ich etliche fließend beherrsche, gleichwie all jene Kreuzritter, die in Syrien und Palästina kämpfen mussten. Ich hoffte, bei der Lektüre dieses Buches hinter das Geheimnis der schmerzlosen Inzisionen bei lebendigem Leib und der in Kriegszeiten so wichtigen Kauterisation zu kommen und alles über das wunderbare medizinische Instrumentarium der persischen Ärzte zu erfahren, das vom großen Albucasis so minutiös beschrieben worden war, um es nach meiner Rückkehr auf Rhodos bis ins kleinste Detail nachbauen zu lassen. Deshalb würde ich also an jenem besagten Tag Wams, Kettenhemd und meinen schwarzen Mantel mit dem weißen lateinischen Kreuz ablegen und Helm, Schwert und Wappen durch Schreibfeder, Tinte und scrinium ersetzen.
Gleichwohl dies durchaus ein fesselndes Vorhaben war, so bildete es, wie ich bereits erwähnte, nicht den eigentlichen Grund, weshalb ich in das Kloster gekommen war; der wahre Grund, der mich dorthin geführt hatte – eine höchst persönliche Angelegenheit, die der Seneschall von Rhodos von Anfang an gebilligt hatte, war, dass ich an jenem Ort jemand sehr Wichtigen treffen musste, über den ich allerdings nicht das Geringste wusste; weder wie er hieß, noch wer er war oder wie er aussah … nicht einmal ob er zu jenem Zeitpunkt noch dort lebte. Trotzdem vertraute ich auf mich und auf die göttliche Vorsehung, dass mir bei solch heikler Mission Erfolg beschieden war. Nicht umsonst nennt man mich Perquisitore, den Spurensucher.
Im Schritt ritt ich durch das Klostertor und stieg bedächtig von meinem Pferd, um ja nicht einen ungestümen Eindruck an jenem Hort des Friedens zu erwecken. Bruder Cellerarius, der über mein Kommen unterrichtet war, eilte mir entgegen – später erfuhr ich, dass ein Novize stets die unmittelbare Umgebung vom Turm der Kirche aus überwachte, ein Brauch, den man dort noch aus den nicht allzu fernen Zeiten der maurischen Herrschaft bewahrt hatte. Begleitet vom kleinwüchsigen cellerarius führte ich dann mein Pferd am Halfter in den Klosterhof, wobei mir die mustergültige Aufteilung des Klosterkomplexes bewusst wurde, um dessen großen Kreuzgang herum die unterschiedlichen Bauten vortrefflich angeordnet waren. Ferner war noch ein kleinerer und wesentlich älterer Kreuzgang, das claustrum minus, links von einem kleinen Gebäude zu sehen, welches das Spital zu sein schien.
Schließlich blieben wir vor der Hauptpforte der Abtei stehen, wo mich der Subprior höflich empfing. Der junge, ernsthafte Mönch von vornehmem Äußeren und unbestritten hoher Abkunft, wie ich aus seinen Umgangsformen schließen konnte, führte mich augenblicklich zum schönen Haus des Abts. Auch dieser und der Prior hießen mich respektvoll willkommen; man merkte, dass sie hochgestellte Persönlichkeiten waren, gewohnt, illustre Gäste zu empfangen, doch sie zeigten sich noch weitaus gastfreundlicher und liebenswürdiger, als sie mich wieder aus meiner Gastzelle treten sahen, bekleidet mit einem Habit, das dem der Brüder des heiligen Mauritius so ähnlich schien, wie sie es nur finden konnten, ohne ihren Ordensregeln zuwiderzuhandeln: Ich trug nun einen weißen Talar mit Mantel, jedoch ohne Skapulier und Gürtel, und an den Füßen ein paar ungefärbte Ledersandalen, die sich von ihren geschlossenen schwarzen deutlich unterschieden. Als ich danach durch den Kreuzgang schritt, stellte ich fest, dass diese Gewänder sehr gut gegen die Kälte schützten und viel wärmer hielten als mein Wams mit den weiten Ärmeln und mein Chorhemd, so dass meine schwielige Haut, die an alle Unbilden der Witterung gewöhnt war, sich schnell mit der Aufmachung abfand, die von nun an mein Habit sein sollte.
Der Winter näherte sich, und obwohl in Ponç de Riba Schneefälle nicht ungewöhnlich waren, so war jenes Jahr doch unbeschreiblich hart, nicht nur für das Land und die Ernte, sondern auch für die Menschen. Der Heilige Abend überraschte uns Bewohner des Klosters mit einer unendlichen weißen Schneedecke, die alles verbarg.
Während der folgenden Wochen versuchte ich mich so weit wie möglich von dem Leben und den Intrigen des Klosters fernzuhalten. Obwohl von anderer Wesensart, so kam es selbst in den Ordenshäusern der Hospitaliter gelegentlich zu gespannten Situationen, und auch dort aus fast immer nichtigen Gründen … Ein guter Abt oder Prior – wie ein guter Großmeister oder Seneschall – zeichnet sich gerade durch die Autorität aus, die er gegenüber der Gemeinschaft besitzt, um solche Schwierigkeiten zu umgehen.
Trotzdem konnte ich mich nicht vollkommen vom klösterlichen Leben distanzieren, da ich als Mönchsritter den gemeinschaftlichen Gottesdiensten beizuwohnen hatte und in meiner Eigenschaft als Arzt einige Stunden des Tages im Spital an der Seite der kranken Brüder verbrachte. Natürlich – und ich überspringe hier das, was nur meine privaten Angelegenheiten waren – war ich keineswegs dazu verpflichtet, irgendetwas zu tun, was nicht meinen Neigungen entsprach. Laudes, Prima, Tertia, Sexta, Nona, Vesper und Komplet bestimmten meine täglichen Studien, die Mahlzeiten, Spaziergänge, Arbeit und Schlaf mit mathematischer Präzision. Ergriffen von Unruhe und dem Heimweh nach meiner fernen Insel wandelte ich manchmal unermüdlich durch den Kreuzgang und betrachtete seine einzigartigen Kapitelle. Oder ich stieg auf den Kirchturm hinauf, um dem wachhabenden Novizen Gesellschaft zu leisten. Oder ich streifte ziellos zwischen der Bibliothek und dem Kapitelsaal, dem Refektorium und den Schlafsälen, den Badestuben und der Küche umher, in dem Versuch, mein Gemüt zu beruhigen und die Hast zu mäßigen, die ich verspürte, um endlich auf jenen Menschen zu treffen, den ich in meinem tiefsten Inneren Jonas getauft hatte, nicht nach jenem Jonas, der angstvoll vom Walfisch verschluckt wurde, sondern nach jenem, der aus dessen Bauch wieder frei und erneuert ausgespien wurde.
Eines schönen Tages vernahm ich während der Messe unter den Gesängen einen kindlichen, röchelnden Husten, der mich zusammenzucken ließ; wenn es nicht so eindeutig gewesen wäre, dass jener Husten nicht aus meiner Brust drang, so hätte ich schwören können, dass ich es war, der sich da räusperte und keine Luft mehr bekam. Aufmerksam blickte ich in Richtung jenes Bereichs des Chorgestühls, von wo aus die pueri oblati unter dem wachsamen Blick des mit einer Engelsgeduld gesegneten Novizenmeisters gähnend der Liturgie folgten, aber ich konnte nichts weiter als eine Gruppe unruhiger, schmächtiger Schatten erspähen, denn das Kirchenschiff war in Finsternis getaucht, nur spärlich erleuchtet von einigen Dutzend dicker Wachskerzen.
Als ich am folgenden Tag frühmorgens ins Spital kam, untersuchte der mit der Krankenpflege betraute Bruder gerade sorgfältig ein Kind, das schon fast das Jünglingsalter erreicht hatte und alles ringsherum mit abweisender und misstrauischer Miene beobachtete. Unauffällig in einen Winkel gedrückt führte ich aus der Ferne meine eigene ärztliche Untersuchung des Patienten durch. Gewiss hatte der Junge eine ungesunde Gesichtsfarbe und tiefliegende Augen, seine Wangen waren ein wenig eingefallen und Schweiß stand ihm auf der Stirn, doch er schien an nichts Außergewöhnlichem zu leiden. Er hatte lediglich eine Erkältung; sein schmächtiger Brustkorb hob und senkte sich mühsam und gab ein schwaches Pfeifen von sich, und der Junge litt unter krampfhaftem trockenen Husten. Am besten wäre es, ihn ins Bett zu stecken und ihn einige Tage auf der Grundlage von heißer Brühe und Wein zu ernähren, damit er die schlechten Säfte ausschwitzte …
»Es wird am besten sein«, urteilte jedoch der Krankenpfleger, während er dem Knaben leicht auf den Rücken klopfte, »ihn zur Ader zu lassen und ihm ein leichtes Abführmittel zu geben. Innerhalb einer Woche wird er wieder wohlauf sein.«
»Seht Ihr?«, rief Jonas und drehte sich zum Novizenmeister um, »seht Ihr, wie er mich zur Ader lassen will? Ihr habt mir versprochen, dass Ihr es nicht zulassen werdet!«
»So ist es, Bruder«, gab jener zu, »ich habe es ihm versprochen.«
»Nun, dann bekommt er eben das stärkste Abführmittel, das ich habe.«
»Nein!«
Es ist erstaunlich, wie die Natur mit dem eigenen Fleisch und Blut von Generation zu Generation ihre Scherze treibt. Obwohl Jonas nicht einen einzigen meiner Gesichtszüge geerbt hatte, besaß er eine Stimme, die der meinen sehr glich. Zwar war sie noch kindlich, doch überschlug sie sich aufgrund des Stimmbruchs schon ab und zu und klang dann so tief, dass niemand mehr den Unterschied zwischen ihm und mir hätte feststellen können.
»Wenn Ihr gestattet, Bruder Borell«, wandte ich mich jetzt an den Bruder des Spitals, während ich mich dem Schauplatz des Dramas näherte, »so könnten wir vielleicht das Abführmittel durch eine exudatio ersetzen.«
Ich hob nun Jonas’ rechtes Augenlid, um den Grund seiner Iris zu untersuchen. Sein allgemeiner Gesundheitszustand war ausgezeichnet, vielleicht war er gerade etwas schwach, aber eine richtige Schwitzkur und viel Schlaf würden ihm hervorragend bekommen. Ich konnte nicht umhin zu bemerken, dass Jonas’ Augen wie die seiner Mutter von einem hellen, mit Grau durchsprenkelten Blau waren, Augen, welche die beiden von einem entfernten französischen Vorfahren geerbt hatten … Denn auch wenn Jonas dies nicht wusste, so war seine mütterliche Linie doch von edlem Geschlecht, und er war Nachkomme des leonesischen Zweigs der Jimeno und des alavesischen Hauses der Mendoza, und alt und königlich war auch seine väterliche Linie, die, obgleich verarmt, dennoch nicht ihren Ursprung bei Wifredo el Velloso vergaß. Durch seine Adern floss das Blut der Begründer der spanischen Königreiche, und in seinen Wappen – wenn er auch noch nicht wusste, dass er Wappen besaß – waren in den Heroldsstücken Burgen, Löwen und Tatzenkreuze zu sehen. Wenn, wie ich vermutete, jener Knabe wirklich Jonas war, so würde er nie, unter gar keinen Umständen, Mönch werden, so sehr er jetzt auch puer oblatus sein mochte; ihm war ein weitaus erhabeneres Schicksal beschieden, und niemand – nicht einmal die Kirche selbst – konnte verhindern, dass es sich erfüllte.
»Von Schwitzkuren halte ich nicht viel«, murrte Bruder Borell, während er nur widerwillig die Segel strich. »Gegen die üblen Körpersäfte der Galle zeigen sie kaum Wirkung.«
»Aber, Bruder!«, protestierte ich. »Schaut genau hin, und Ihr werdet sehen, dass dieser Junge nicht an schwarzer Galle leidet, sondern nur eine einfache Erkältung hat, und außerdem steckt er mitten im Wachstum, im Übergang zum Mannesalter. Auf alle Fälle könnt Ihr ihm jedoch ein Heilpflaster aus gemahlenem Bimsstein, Schwefel und Alaun auflegen, das ihm das Ausschwitzen erleichtern wird. Und bereitet ihm auch einige Pillen gegen den Husten zu mit geringen Dosen an Opium, Castoreum, Pfeffer und Myrrhe …«
Durch diesen Vorschlag überzeugt, der seine hochgeschätzte Begabung auf dem Gebiet der Kräuterheilkunde auf die Probe stellte, zog sich Bruder Borell nach hinten in seine Apotheke zurück, um die Mischungen zuzubereiten, während Jonas und der Novizenmeister mich bewundernd ansahen.
»Ihr seid der Hospitalitermönch, der seit einigen Wochen in unserem Kloster weilt, nicht wahr?«, fragte der Alte. »Ich habe Euch schon oft bei unseren Gebeten beobachtet. Es gehen so viele Gerüchte von Euch in unserer Gemeinschaft!«
»Gäste erregen immer Neugierde«, begnügte ich mich mit einem Lächeln anzumerken.
»Die Jungen reden ständig über Euch, und mehr als einen musste ich bereits von den Fenstern der Bibliothek wegzerren, wenn Ihr Euch zum Studium dorthin begabt. Habt Ihr es nicht bemerkt? Dieser hier zum Beispiel, der mehr einer Katze denn einem Kind gleicht, hat deswegen schon viele Kopfnüsse davongetragen.«
Als ich jetzt Jonas’ schwärmerischen Gesichtsausdruck bemerkte, der mich wortlos anstarrte, begann ich zu lachen. Aufgrund meiner Körpergröße und der wohlausgebildeten Muskulatur, die der ständige Gebrauch des Schwerts meinen Armen und Schultern verliehen hatte, musste ich ihm wie eine Art Herkules oder Samson vorkommen, vor allem, wenn er mich mit den Mönchen der Gemeinschaft mit ihren Tonsuren verglich, die stets nur fasteten und Buße taten.
»So, so, du hast mich also durch das Fenster beobachtet …«
Meine Stimme weckte ihn aus seiner Versunkenheit und ließ ihn hochschrecken. Er raffte die Schöße seines Habits, sprang vom Tisch herunter und rannte los, sauste durch die Tür wie ein geölter Blitz und verlor sich in den Gängen des Gebäudes.
»Bei Gott!«, schrie der Novizenmeister auf und machte sich an seine Verfolgung. »Er wird sich noch eine Lungenentzündung holen.«
Von der Apotheke her entwich Bruder Borell, der den übel riechenden Wundverband in seinen Händen hielt, ein resignierter Seufzer.
Das Herz der Bibliothek stellte das Skriptorium dar, ein Herz, das mächtig unter dem steinernen Gewölbe schlug und den wertvollen Codices Leben einhauchte, welche die Brüder scriptores mit so viel Ehrerbietung und Geduld abschrieben und illuminierten. Jeder, der im Kloster wohnte, sei er monacus, capellanus oder novicius, konnte sich darin unterweisen lassen, falls er dies wünschte. In einem angrenzenden Gebäude, in das man durch eine niedrige Tür gelangte, verwahrte man sorgfältig das Hauptarchiv, jenen großen dokumentarischen corpus, in dem Tag für Tag selbst die kleinsten Vorfälle der Abtei verzeichnet wurden. Wahrscheinlich konnte ich dort die nötige Auskunft über Jonas finden, weshalb ich den Prior um Erlaubnis bat, jene Chronik einsehen zu dürfen.
»Worauf ist Euer überraschendes Interesse an den Annalen des Klosters zurückzuführen?«
»Das ist eine lange Geschichte, verehrter Prior, aber ich kann Euch versichern, dass hinter meiner Bitte keine bösen Absichten stecken.«
»Ich wollte Euch mit meiner Frage nicht zu nahe treten, Bruder«, erwiderte er sofort verlegen, »selbstverständlich gestatte ich Euch, das Archiv zu konsultieren. Ich wollte mich lediglich eine Weile mit Euch unterhalten … Bald werden es zwei Monate sein, dass Ihr in unserem Kloster lebt, und bisher habt Ihr mit keinem der Mönche Freundschaft geschlossen, nicht einmal mit dem Abt, der sich bemüht hat, Euch in allem entgegenzukommen, soweit er es vermochte. Es ist uns bewusst, dass an einem Ort wie diesem, der nur dem Studium und der Kontemplation geweiht ist, außer unseren Büchern nichts Eure Aufmerksamkeit fesseln kann, doch wir hätten uns gewünscht, dass Ihr uns über Eure Reisen und Euer Leben berichtet.«
Immer das gleiche Lied, dachte ich beunruhigt. Ich musste mich in Acht nehmen, oder wir Hospitaliter würden wie die Tempelherren enden …
»Ihr müsst mich entschuldigen, verehrter Prior. Meine Zurückhaltung rührt nicht von meinem Stand eines Hospitaliters. Ich war schon immer so, und ich glaube nicht, dass ich mich jetzt noch ändern werde. Allerdings habt Ihr Recht, vielleicht sollte ich mich den Brüdern mehr öffnen. Tatsächlich erzählte mir der Novizenmeister kürzlich von dem Interesse, das mir die pueri oblati entgegenbringen. Scheint es Euch angebracht, dass ich mich in den Ruhezeiten hin und wieder mit ihnen unterhalte?«
»Bruder, die Jungen haben eine überbordende Phantasie! Eure Abenteuer würden sie nur über Gebühr erregen und ihnen den Schlaf rauben, der in ihrem Alter so vonnöten ist … Nein, es tut mir leid, solchem Ansinnen kann ich nicht zustimmen. Jedoch …«, fügte er dann nachdenklich hinzu, »… jedoch glaube ich, dass es gut wäre, wenn einer der älteren pueri als Adlatus in Eure Dienste treten würde; Ihr könntet ihm die Grundkenntnisse Eurer Wissenschaft vermitteln, so dass er später das Spital und die Krankenstation zu übernehmen in der Lage wäre.«
»Zweifellos eine großartige Idee, verehrter Prior«, bestärkte ich ihn in seinem Vorhaben. »Soll ich ihn auswählen, oder bestellt Ihr ihn selbst zu meinem Adlatus?«
»Oh, das hat keine Eile, wirklich nicht! Sprecht mit dem Bruder Novizenmeister und sucht selbst den novicius aus, der dafür das größte Talent zu besitzen scheint.«
Jener Mönch war nicht zufällig Prior geworden, dachte ich angenehm überrascht.
Noch am selben Nachmittag ging ich in die Bibliothek und zog aus den Regalen des Archivs die entsprechenden chartae des Jahres unseres Herrn 1303 hervor, Jonas’ Geburtsjahr. Neben dem schönen Exemplar der Kommentare zur Apokalypse, In apocalypsim libri duodecim, des Abts Beatus von Liébana und einem Collectaneorum de re medica von Averroes breitete ich auf meinem Schreibpult eine Unmenge an Urkunden aus über Schenkungen, begonnene Arbeiten für den Bau von Kornkammern, über Einkünfte, Ausbesserungen des Kirchenschiffs, Ernten, Todesfälle und Geburten von Bediensteten, Testamente, Käufe und Verkäufe sowie eine Vielzahl von offiziellen und langweiligen Angelegenheiten. Zwei Tage lang suchte ich mit unendlicher Geduld, bis ich schließlich auf die Aufzeichnungen über die vor den Toren der Abtei ausgesetzten Kinder stieß. Da freute ich mich, nicht zu wissen, welchen Taufnamen die Mönche dem jungen Jonas gegeben hatten, denn es waren drei Säuglinge, deren Fälle es zu untersuchen galt, und so konnte keine Vorahnung meine Lektüre trüben.
Eines der Kinder hob sich glücklicherweise gleich von Anfang an von den anderen ab: Am 12. Juni 1303, in aller Früh, fand der Bruder Operarius, der vor den Klostermauern den beschädigten Flügel einer Mühle instand setzen wollte, vor der Pforte in einem Korb ein Neugeborenes, das in kostbare Tücher gewickelt war, die allerdings keine besonderen Merkmale oder Stickereien aufwiesen. Um den Hals trug das Kind ein kleines Amulett aus silbern eingefasstem Gagat in Form eines Fisches – was die Mönche zunächst beunruhigt hatte, fürchteten sie doch, dass es von Juden abstammte –, und zwischen den Windeln war ein Vellum ohne jegliches Siegel versteckt, auf welchem man um die Gunst bat, den Knaben auf den Namen García zu taufen. Ich suchte nicht weiter; ich besaß alle nötigen Beweise. Nun musste ich nur noch bestätigt finden, dass jener García der Dokumente und Jonas aus der Krankenstation ein und dieselbe Person waren, weshalb ich, sobald es mir möglich war, zum Noviziat ging, um meinen zukünftigen Adlatus auszusuchen. Indes, warum so zögerlich?, meinte das Schicksal höhnisch, so dass, kaum hatte ich die Pforte durchschritten, ein Schrei plötzlich all meine Fragen beantwortete:
»Garcííííía!«
Und García schoss an mir vorbei wie der Blitz, rannte so schnell wie damals, als er aus dem Spital floh, mit hochgerafftem Habit, damit es sich nicht in seinen Beinen verwickelte.
Und wieder wurde es Weihnachten. In jenem Jahr begingen wir das Fest mit der traurigen Nachricht vom Tod des Abts von Ponç de Riba. Zwar hatte ich mich bemüht, die Schmerzen seiner letzten Tage mit großen Dosen Schlafmohn zu lindern, allerdings hatte es nicht viel genützt: Als ich seinen Bauch abtastete, geschwollen wie der einer Gebärenden und gleichermaßen hart, wusste ich, dass für ihn keine Hoffnung mehr bestand. Um ihm Mut einzuflößen, schlug ich ihm vor, jenes bösartige Geschwür zu entfernen, doch er weigerte sich schlichtweg, und unter großer Pein überantwortete er Gott seine Seele am Dreikönigsfest des Jahres 1317. Der entsetzliche Lärm der Ratschen war drei Tage lang hinter den Klostermauern zu vernehmen und ließ die Trauer, in die sich die Klostergemeinschaft versenkte, noch überwältigender wirken.
Die pompösen und prunkvollen Trauerzeremonien, an denen auch die Prälaten der Bruderabteien aus Frankreich, England und Italien teilnahmen, zogen sich über mehrere Monate hin. Anfang April zog sich schließlich die Gemeinschaft unter dem Vorsitz des Abts des Mutterhauses, des französischen Klosters Bellicourt, zurück, um unter ihnen allen einen neuen Abt zu wählen. Die Beratungen wurden tagaus, tagein fortgesetzt, ohne dass die wenigen, die ausgeschlossen waren, auch nur das Geringste darüber erfuhren, was im Kapitel vor sich ging; nach Ablauf einer Woche hatten wir uns jedoch an die Situation gewöhnt, ja, genossen sie sogar, denn die Anwesenheit des Abts von Bellicourt trug dazu bei, dass sich sowohl die Güte als auch die Menge unserer Mahlzeiten steigerte: An den Tagen, an denen es Fleisch gab, erhöhte der Küchenbruder die Portionen Kuh-, Hammel- oder Lammfleisch fast auf das Doppelte, und da es auf den Sommer zuging, reichte er dazu eine Petersiliensoße oder Agrest; mittwochs und samstags tischte er badulaque, ein Gericht aus zerkleinerten Innereien, auf, und die tägliche Brotration wuchs von einem halben auf ein ganzes Pfund für jeden an.
Wir befanden uns schon in der dritten Woche des Kapitels, als an einem warmen Vormittag, an dem völlige Stille herrschte, der auf dem Kirchturm wachhabende Novize kräftig die Glocken zu läuten begann, um Besuch anzukündigen. Der Subprior verließ die geschlossene Gesellschaft, um sich um die Neuankömmlinge zu kümmern, und Bruder Cellerarius ließ aus dem Klostergarten einige dienende Brüder kommen, denen er die Gastgeberpflichten der abwesenden Mönche übertrug.
Jonas und ich arbeiteten gerade in der Schmiede. Wir feilten dort an einigen feinen, chirurgischen Instrumenten herum, die wir ungeschickt und hingebungsvoll nach den Abbildungen des Meisters Albucasis hergestellt hatten. Weil Bruder Schmied nicht zugegen war, erforderte diese Aufgabe höchste Aufmerksamkeit, da unsere Legierungen und das Schmieden selbst viel zu wünschen übrig ließen und die Instrumente immer wieder zwischen unseren Fingern wie Tonfiguren zerbrachen. So groß war unsere Konzentration auf das, was wir da gerade taten, dass wir nicht zum Empfang der Gäste eilten, wie dies angebracht gewesen wäre; es dauerte indessen nicht lange, bis sie sich ihrerseits in der Schmiede einstellten.
»Ritter Galcerán de Born!«, brüllte eine mir bekannte Stimme. »Wie könnt Ihr es wagen, den schmutzigen Lederschurz eines Schmieds in Gegenwart anderer fratres milites Eures Ordens zu tragen!«
»Joanot de Tahull! … Gerard!«, rief ich aus und hob ruckartig den Kopf.
»Ihr werdet vom Provinzialmeister aufs härteste gerügt werden!«, scherzte mein Bruder Joanot, während er mich heftig umarmte; der Lärm seines eisernen Kettenhemds und die Schläge seiner Schwertscheide gegen die Beinschienen weckten mich brüsk aus einem langen Traum.
»Brüder!«, stammelte ich, ohne aus meinem Staunen herauszukommen. »Wie kommt ihr denn hierher?«
»Mit der Ruhe ist es jetzt vorbei, Bruder, du musst zurück an deine Arbeit«, meinte Gerard lachend und umarmte mich ebenfalls.
»Deinetwegen sind wir gekommen, damit du nicht noch mehr einrostest und Fett ansetzt bei diesem sorglosen Leben eines Klostermönchs.«
Überwältigt ließ ich mich auf einen der Schemel fallen und betrachtete begeistert meine Brüder. Da standen, mir genau gegenüber, die beiden ehrenwertesten und redlichsten Hospitaliter der christlichen Welt in ihren schwarzen Mänteln, mit ihren langen aus der Brünne quellenden Bärten und ihren geweihten Schwertern am Gürtel. Wie viele Schlachten hatten wir Schulter an Schulter geschlagen, wie viele Meilen des Weges waren wir zusammen fast bis in den Tod geritten, wie viele Stunden des Studiums, der harten militärischen Übung, des gemeinsamen Dienstes hatten wir zusammen verbracht! Und ich hatte bis dahin nicht einmal bemerkt, wie sehr ich sie vermisste, wie sehr ich meine Heimkehr ersehnte …
»Ist ja gut«, erklärte ich und richtete mich auf, »gehen wir, hier habe ich alles gelernt, wozu ich hergekommen bin!«
»Halt ein! Wohin willst du?« Den Kettenhandschuh gegen meine Brust gestemmt, hielt mich mein Bruder Gerard zurück.
»Habt ihr nicht eben gesagt, ich müsse abreisen?«
»Doch nicht nach Rhodos, Bruder. Du fährst vorerst noch nicht nach Hause.«
Ich zog vermutlich ein ziemlich dummes Gesicht.
»Das kommt ja nun wirklich nicht in Frage!«, bemerkte Joanot. »Mein Wort darauf: Ich ertrage keine Tränen in den Augen eines Hospitaliters!«
»Sei kein Dummkopf, Bruder. Tränen werden in euren hinterlistigen Augen glitzern, wenn ich mein Schwert erst wieder in Händen halte … und sobald ich natürlich wieder die Kraft habe, es zu schwingen.«
»Du tust gut daran, Bruder, denn du siehst aus wie ein …«
»Seid jetzt endlich still, ihr beiden!«, brüllte Gerard. »Und du, Joanot, gib ihm die Briefe!«
»Briefe? Was …?« Ich hielt inne und blickte Jonas streng an. »Jonas, geh hinüber ins Noviziat.«
Widerwillig, weil er sich jene interessante Unterhaltung eigentlich nicht entgehen lassen wollte, trottete Jonas davon. Erst als er weit genug entfernt von uns war, fuhr ich fort:
»… Was für Briefe?«
»Drei sehr wichtige, Bruder Galcerán: einen des Seneschalls von Rhodos höchstpersönlich, unter dessen Befehl du stehst; der zweite vom Großkomtur der Hospitaliter von Frankreich, dem du in Zukunft zur Verfügung stehen wirst; und schließlich einen dritten von Seiner Heiligkeit Papst Johannes XXII., den der Herr beschützen möge und der die Schuld an diesen ganzen Briefen trägt.«
Ich konnte nur noch ein trauriges »O Gott!«, murmeln, bevor ich wie ein Sack ohnmächtig auf meine armseligen chirurgischen Instrumente sank.
Die Schreiben duldeten keinen Widerspruch. Das des Seneschalls forderte mich auf, mich noch vor Ende Mai den Befehlen des Großkomturs von Frankreich unterzuordnen; das des Großkomturs von Frankreich, ich hätte mich vor dem 1. Juni am Papstsitz in Avignon einzufinden, und das Seiner Heiligkeit Papst Johannes XXII. enthielt meine Ernennung zum päpstlichen Gesandten mit allen Rechten und Würden, die dies umfasste, im Besonderen – wie er explizit herausstellte – das Recht, die schnellsten Pferde benutzen zu können, die ich in den Stallungen eines jeden Klosters oder jeder Pfarrei oder christlichen Wohnstätte von Ponç de Riba bis Avignon vorfinden würde … oder was, kurzgefasst, auf dasselbe herauskam, dass ich binnen zwei Wochen dort einzutreffen hatte … Erstaunlich.
Ich kümmerte mich persönlich darum, meine Brüder in den Zellen des Pilgerhauses unterzubringen, und danach, der Abend war schon vorgerückt, zog ich mich in die Kirche zurück, um nachzudenken. Man sollte nie etwas tun, ohne vorher alle möglichen Spielzüge zu überdenken, alle Eventualitäten durchzuspielen – die wahrscheinlichsten zumindest –, ohne vorher genauestens Gewinne und Verluste abzuwägen oder an die eventuellen Konsequenzen und Auswirkungen auf das eigene Leben und das derjenigen zu denken, die von einem abhängen … selbst wenn sie, wie in Jonas’ Fall, nichts davon wissen sollten. So verbrachte ich den Rest des Abends und die ganze Nacht allein in der Kirche und hüllte mich ein letztes Mal in das weiße Klosterhabit, das ich bei Tagesanbruch ablegen sollte, um wieder in meine eigene Ritterrüstung zu schlüpfen, jene, die Galcerán de Born wiederauferstehen ließ, der siebzehn Monate zuvor in Barcelona an Land gegangen war.
Ich betete mit den Mönchen im Kapitelsaal die Frühmette und bat dann den Prior, er möge mich für einige Augenblicke in seiner Zelle empfangen, um ihn über meine überstürzte Abreise aus dem Kloster in Kenntnis zu setzen. Nie hätte ich ihm Näheres über die Gründe dafür dargelegt, hätte ich nicht im Gegenzug dazu etwas viel Wertvolleres von ihm zu erhalten gedacht, weshalb ich nun also vor seinen Augen das Schreiben des Papstes entrollte, was ihn vollkommen verblüffte. Ich ließ ihn in dem Glauben, dass ich mich ihm wie einem Freund anvertraute, als ich ihm gestand, wie sehr mich jene besagte Ernennung verwirrte und wie sehr mir meine Abreise von Ponç de Riba missfiel, gerade jetzt, wo er zum Abt gewählt werden würde. Bevor er noch den Mund aufmachen konnte, so fassungslos und überwältigt wie er war, bat ich ihn um die Erlaubnis, den Novizen García mitnehmen zu dürfen, um seine Ausbildung nicht unterbrechen zu müssen, und ich versicherte ihm, dass ich den Jungen zweifellos noch vor Ablauf eines Jahres gereift und gebildet zurückschicken würde, bereit, die klösterlichen Weihen zu empfangen. Ich schwor ihm, dass der Junge immer im nächstgelegenen Mauritiuskloster nächtigen und er sämtlichen Verpflichtungen nachkommen und die Regeln seines Ordens befolgen würde.
Es erübrigt sich zu sagen, dass ich wissentlich einen Meineid beging und jener ganze Wortschwall nichts weiter war als ein Gespinst aus lauter Lügen, eine größer als die andere; doch ich musste den Prior überzeugen, dass er mir Jonas in die Obhut gab, um ihn aus jenen Mauern rauszuholen, hinter die er selbstverständlich nie wieder zurückkehren würde.
Unter der sengenden Mittagssonne verließ ein Gefolge aus drei Hospitalitern, zwei ebenfalls dem Orden der Hospitaliter angehörenden Schildknappen, den so genannten armigeri, einem Mauritiusnovizen, der kurz vor seinem vierzehnten Lebensjahr stand, und zwei mit Gepäck beladenen Mauleseln das Kloster in Richtung Norden, nach Barcelona.
ZWEI
Die ständigen Auseinandersetzungen zwischen den beiden römischen Adelsfamilien Gaetani und Colonna, die Rom in ein blutiges Schlachtfeld verwandelt hatten, zwangen Papst Benedikt XI. dazu, sich außerhalb Italiens in Sicherheit zu bringen. Sein Nachfolger, Clemens V., der vor seiner Wahl durch das Konklave das Amt des Erzbischofs von Bordeaux innehatte, beschloss angesichts der politischen Wirren im Kirchenstaat, Frankreich nicht eher zu verlassen, bis sich die Lage in Rom beruhigt hatte, wodurch jene Zeit anbrach, die man, ohne genau zu wissen warum, als die »babylonische Gefangenschaft« bezeichnet. Doch die Dinge wurden keineswegs besser, und Johannes XXII., der zwei Jahre nach dem Tod Clemens’ V. zum Papst gewählt wurde – Jahre, in denen der Petrusstuhl erstmalig in seiner Geschichte vakant geblieben war –, zog es vor, in seiner Residenz in Avignon zu bleiben, die so zum Zentrum der Christenheit wurde. Nach zwei französischen Päpsten, wer konnte da schon wissen, ob das Pontifikat je wieder nach Italien zurückkehren würde?
Keineswegs ungewiss war hingegen in jenen letzten Tagen des April 1317, dass Jonas und ich vierhundertsiebzig Meilen auf dem Rücken unserer Pferde, quer über die gefährlichen Bergpässe der Pyrenäen, zurücklegen mussten und wir keine Zeit vergeuden durften. Dennoch hielten wir uns länger als wünschenswert in Barcelona auf, um uns von Joanot und Gerard zu verabschieden, die nach Rhodos zurückkehrten.
Im Nu durchquerten Jonas und ich dann Foix und das Languedoc und machten erst in Narbonne wieder halt, um ein paar Tage auszuruhen und die Pferde und Maulesel zu wechseln. Fast immer übernachteten wir am Wegesrand, bereiteten uns im Schutz eines lodernden Feuers aus unseren Umhängen ein Lager, und auch wenn der Junge sich anfangs etwas über die ungewohnten Unannehmlichkeiten beklagte, so fand er dennoch bald Gefallen daran, unter dem Sternenhimmel zu schlafen und seinen Körper Mutter Erde anzuvertrauen. Zwar konnte ich ihm vorerst nicht erklären, wie wichtig die Verbindung zu den geheimen Kräften des Lebens war, da er noch nicht initiiert war, jedoch sah ich ihn innerhalb kurzer Zeit wie eine Pflanze im Frühling erblühen, und der dürre und blasse Novize von Ponç de Riba, der nun fast schon so groß war wie ich, verwandelte sich vor meinen Augen in einen kräftigen armiger, den Schildknappen, auf den ein jeder Hospitaliter von Standes wegen Anrecht hatte.
In fliegendem Galopp ließen wir bald Béziers hinter uns und erreichten von Montpellier aus in nur einer Tagesreise Nîmes, das antike Nemausus der Provinz Galia Narbonensis. Schließlich, am späten Abend des 31. Mai, die Sonne hinter unserem Rücken war noch nicht ganz untergegangen, trafen wir in der strategisch zwischen Frankreich, dem Deutschen Reich und Italien gelegenen Grafschaft Venaissin ein, die sich im Besitz des Papstes befand, und unsere Tiere setzten ihre Hufe endlich auf die wunderbare Pont St-Bénézet, die über die schwarze Rhône führte.
Das bischöfliche Palais, Zentrum der christlichen Welt, war das erste der beeindruckenden Gebäude, auf das wir gleich hinter den Mauern von Avignon stießen; wir warfen allerdings nur einen erschöpften Blick darauf und setzten dann unseren Ritt gemäßigten Schrittes Richtung jüdisches Viertel fort, hinter dem sich die Komturei der Ritter vom Hospital des Heiligen Johannes befand.
Ein dienender Bruder öffnete uns das Tor und nahm uns die Pferde ab, woraufhin ein armiger uns hineinführte.
»Wo wollt Ihr Euren Schildknappen unterbringen?«, fragte er, ohne den Kopf zu wenden.
»Nehmt ihn mit zu Euch, Bruder. Er soll bei den armigeri schlafen.«
Jonas zuckte zusammen und schaute mich beleidigt an.
»Es tut mir leid, Frère Galcerán«, sagte er, »aber ich kann nicht in einem Ordenshaus der Hospitaliter übernachten.«
»Ach nein?«, entgegnete ich amüsiert, während ich unbeirrt den breiten, mit kostbaren Tapisserien ausgeschmückten Flur entlangging. »Und wo willst du dann schlafen?«
»Wenn es Euch nichts ausmacht, so würde ich gern zum nächstgelegenen Konvent der Mauritiusmönche gebracht werden. So habt Ihr es dem Prior meines Klosters zugesichert, und Ihr habt Euer Versprechen im Laufe unserer Reise schon ziemlich oft gebrochen, meint Ihr nicht auch?«
Seine Unverschämtheit war so schnell gewachsen wie sein Körper, trotzdem wollte ich ihn lieber so ertragen, als ihn in einen unterwürfigen Klosterbruder von Ponç de Riba verwandelt zu sehen.
»In Gottes Namen, geh. Aber morgen bei Tagesanbruch möchte ich dich hier im Innenhof abmarschbereit und mit gesattelten Pferden stehen sehen.«
Der armiger räusperte sich.
»Bruder …«
»Sprecht.«
»Es tut mir leid, Eurem Schildknappen sagen zu müssen, dass es in Avignon keine Klostergemeinschaften des heiligen Mauritius gibt.« Er blieb vor einer wunderschön gearbeiteten Tür stehen und hielt mit beiden Händen die Türknaufe fest. »Wir sind da.«
»Sehr gut, Jonas, also hör zu«, sagte ich und drehte mich erbost zu ihm um. »Du wirst jetzt diesem dienenden Bruder hier folgen und bei den Knappen schlafen, und morgen früh wäschst du dich dann am ganzen Körper gründlich mit kaltem Wasser, säuberst dich vom Schmutz der Reise und schaffst mir dieses alte Klosterhabit aus den Augen … und nun, verschwinde.«
Drinnen im Saal erwarteten mich der Großkomtur von Frankreich, der Prior von Avignon und weitere Würdenträger meines Ordens. Mein äußeres Erscheinungsbild schickte sich nicht gerade für eine Begegnung auf solcher Rangebene, doch sie schienen meinem schmutzigen Habit, dem schlechten Geruch und dem mehrtägigen Bart keine sonderliche Bedeutung beizumessen. Schließlich handelte es sich lediglich um einen kurzen Willkommensgruß und darum, mich darüber ins Bild zu setzen, wie die bevorstehende Audienz beim Papst verlaufen würde: Einzig der Großkomtur, Robert d’Arthus-Bertrand, Herzog von Soyecourt, und ich würden zu dem Empfang des Pontifex eilen. Zu meiner Überraschung erklärte mir der Herzog, dass wir uns dazu als Franziskaner verkleiden – zu denen Seine Heiligkeit, nebenbei bemerkt, aufgrund deren Thesen von der Armut unseres Herrn Jesus Christus keine besonders guten Beziehungen unterhielt – und zu Fuß gehen würden, ohne uns zu erkennen zu geben, bis wir seine privaten Gemächer erreicht hätten, wo er uns zur Stunde der Frühmette erwartete.
»Zur Stunde der Frühmette!«, rief ich erschreckt. »Mein edler Herr Robert, seid barmherzig und lasst mir schnellstens ein Bad bereiten! So, wie ich aussehe, kann ich nicht vor dem Heiligen Vater erscheinen. Auch würde ich gern noch etwas essen, wenn es uns die Zeit gestattet.«
»Ruhig, Bruder, beruhigt Euch. Das Abendmahl steht bereit, und hinter dieser Tür wartet schon der Barbier. Seid unbesorgt; noch bleiben uns drei Stunden.«
Es war tiefe Nacht, als der Großkomtur und ich, plötzlich in ein paar poverellos di Francesco verwandelt, uns den Fragen der päpstlichen Wachen stellten, welche die nächtlichen Posten der Zitadelle abschritten. Mit dem größten Gleichmut entgegneten wir schlicht, man habe uns von der Kathedrale Notre-Dame des Doms rufen lassen, in deren Sakristei eine alleinstehende Alte mit dem Tode rang. Unsere Antwort war absurd, und wenn die Soldaten gründlich darüber nachgedacht hätten, wäre ihnen aufgefallen, dass zu jener nächtlichen Stunde nicht einmal mehr die Franziskaner wegen einer alten Frau ihr Kloster verließen, zumal die Alte bereits sehr gut von irgendeinem Prälaten der Kirche, in der sie angeblich im Sterben lag, mit Sakramenten und seelischem Beistand versehen worden wäre. Aber sie wurden sich dessen nicht bewusst, so dass sie uns ohne weiteres passieren ließen.
Notre-Dame des Doms, die unmittelbar neben dem bischöflichen Palais in dem von alten römischen Mauern umgrenzten Bezirk lag, war ein ideales Ziel, denn es erlaubte uns, die richtige Richtung einzuschlagen, ohne Verdacht zu erregen. Schließlich ließen wir die Kathedrale links liegen, und nach einem kleinen Umweg standen wir auf einmal vor den Toren der päpstlichen Stallungen.
»Schaut genau hin«, flüsterte Bruder Robert mir zu, »sie sind nur angelehnt.«
Es schien sich niemand in unmittelbarer Nähe zu befinden, so dass wir die Holztore aufdrücken und hineinschleichen konnten. Drinnen war es warm und feucht. Einige Tiere wurden auf uns aufmerksam und wieherten und tänzelten unruhig. Doch glücklicherweise erschien keine Menschenseele, um nachzusehen, was dort vor sich ging.
Eine Laterne, die wohlweislich in der Sattelkammer aufgehängt worden war, wies uns den rechten Weg. Ähnlichen Zeichen folgend schlichen wir durch die Flure, bis wir schließlich durch eine Geheimtür, die auf der anderen Seite von einem schweren Wandteppich aus Damast verborgen wurde, in die Privatgemächer des Papstes gelangten. Ein prasselndes Kaminfeuer erwärmte den Raum. In der Mitte stand ein riesiges Bett mit Baldachin, dessen Vorhänge mit dem päpstlichen Wappen bestickt waren. Auf einem einfachen Holztisch zeigten uns drei goldene Becher und ein Silberkrug voll Wein, dass wir erwartet wurden und dem Eintreffen unseres Gastgebers nun entgegenzusehen hatten.
»Das Seltsame daran ist …«, meinte Bruder Robert flüsternd – ich überragte ihn um einen ganzen Kopf, so dass er mich schwerlich anschauen konnte, wenn er das Wort an mich richtete –, »… dass man ein bischöfliches Palais so leer stehen lassen kann, ohne dass jemand darauf kommt, Fragen zu stellen.«
»So hört doch«, erwiderte ich, »sie sind alle unten, Sire. Vernehmt Ihr nicht die Gesänge der Matutin zu Euren Füßen? Der Papst muss wohl alle zum Gebet gerufen haben, um uns unbehindert Zutritt zu verschaffen.«
»Ihr habt Recht. Dieser Papst ist ein schlauer Fuchs … Wusstet Ihr, dass er trotz seines fortgeschrittenen Alters in weniger als einem Jahr die Zügel der Kurie in die Hand genommen und die leeren Schatzkammern des Apostolischen Stuhls wieder gefüllt hat? Man spricht von Millionen von Florinen …«
»Ich habe fast eineinhalb Jahre hinter den Mauern eines Mauritiusklosters verbracht«, entschuldigte ich mich für meine Unwissenheit, »und ich weiß nicht viel über die Dinge, die inzwischen in der Welt vorgefallen sind.«
»Nun, man ist allgemein der Ansicht, dass die Konzilsväter beschlossen, sich mit dem kleineren Übel abzufinden und endlich einen Schlussstrich zu ziehen, als sie nach zwei Jahren hinter den verschlossenen Türen des Konklave noch immer zu keiner Entscheidung gelangt waren. Obwohl er also letztlich aus Überdruss zum Papst ernannt worden war, erwies sich Johannes XXII. als exzellente Wahl: Er ist ein Mann von Charakter, äußerst wagemutig und zäh, und er löst eine Schwierigkeit nach der anderen, welche die Kirche noch vor seiner Wahl hatte.«
Während Bruder Robert mir in offensichtlicher Bewunderung die aufsehenerregenden Großtaten des neuen Papstes darlegte, bemerkte ich, wie kurz darauf die Gebete verstummten und nun auf den Fluren wieder die diskreten Schritte und erstickten Stimmen der Dienerschaft zu hören waren. Wir mussten denn auch nicht lange warten, bis sich die Tür öffnete und Seine Heiligkeit Johannes XXII. im Schlafgemach erschien. Ein strebsamer und emsiger cubicularius eilte ihm voran.
Johannes XXII., mit weltlichem Namen Jacques Duèse, war ein Mann von kleiner Statur und unscheinbarem Äußeren, der sich mit Sanftheit und Eleganz bewegte, als vollführe er einen geheimnisvollen Tanz, dessen Musik nur er hören konnte. Er hatte kleine, runde, sehr eng zusammenstehende Augen, und sein ganzes Gesicht – Ohren, Nase, Lippen – verschmälerte sich zum Kinn hin, was ihm das seltsame Aussehen eines gefährlichen Raubvogels verlieh. Gekleidet war er mit einem purpurnen Umhang, dessen Schleppe er hinter sich herzog, als hinge ein Hund an den Fersen seines Herrn. Als er seinen Kardinalshut abnahm, kam ein edler, kleiner Kopf, so blank und rund wie ein Ball, zum Vorschein. Trotz unseres Franziskanerhabits beugten Bruder Robert und ich die Knie in militärischem Gestus und senkten unsere Häupter in der Erwartung seines Segens, eines Segens, der bis zur Erschöpfung auf sich warten ließ, denn der Pontifex setzte sich erst einmal gemächlich in einen mit Brokat überzogenen Sessel, wies daraufhin seinen cubicularius an, seine Gewänder sorgfältig zu richten, und trank anschließend einen großen Becher heißen Wein, ohne unserer Gegenwart auch nur die geringste Aufmerksamkeit zu schenken. Erst dann räusperte er sich und bot uns seinen nur aus einem einzelnen großen Rubin gearbeiteten Bischofsring zum Kusse an.
»Pax vobiscum …«, murmelte er unwillkürlich.
»Et cum spiritu tuo«, entgegneten Robert und ich einstimmig.
»Erhebt Euch, Ritter vom Hospital, und nehmt Platz.«
Der cubicularius bewirtete uns gleichfalls mit Bechern voll heißen Weins, die wir begierig zwischen beide Hände nahmen. Dann setzten wir uns zurecht, um zu hören, was der Heilige Vater zu sagen hatte.
»Ihr müsst Galcerán de Born sein«, begann er, »den man auch den Perquisitore nennt.«
»So ist es, Eure Heiligkeit.«
»Ihr könnt stolz auf Euch sein, Galcerán de Born« – seine Stimme klang scharf und spitz, und beim Sprechen trommelte er mit den Fingern auf die Sessellehnen –, »Euer Seneschall auf Rhodos hebt Euch wahrhaft in den Himmel. Auf unser Bittgesuch hin antwortete er, er habe genau den geeigneten Ritter für die heikle Mission, mit der ich Euch betrauen werde. Er meinte, dass Ihr nicht nur ein ehrfürchtiger Mönch, sondern auch ein findiger und mit großer Schläue ausgezeichneter Mann seid, der hinter jede Wahrheit komme. Und Ihr könntet Euch nicht nur eines guten Rufs als weiser, verantwortungsvoller und kompetenter Arzt erfreuen, sondern verstündet es darüber hinaus auch, Probleme anzupacken und zu lösen, wie dies kein Zweiter vermag. Ist dem so, Sire Galcerán?«
»Ich würde nicht so weit gehen, Heiligkeit …«, murmelte ich überwältigt, »jedoch entspricht es der Wahrheit, dass ich mit gewissem Erfolg an der Aufdeckung einiger Rätsel mitgewirkt habe. Wie Ihr wisst, sind wir letztendlich auch nur Menschen, selbst wenn der Heilige Geist sich der Rettung unserer Seelen annimmt.«
Der Papst winkte gelangweilt ab und raffte gedankenverloren den Faltenwurf seines Mantels. Ich glaubte, zu viel geredet zu haben, und sagte mir, dass kein Laut mehr über meine Lippen käme, bis man es nicht ausdrücklich von mir verlangte.
»Nun gut, Sire Galcerán, ich zähle auf Eure Fähigkeiten, um eine gewichtige Entscheidung zu treffen, die den Lauf meiner Herrschaft verändern könnte. Natürlich darf von dem, was heute hier besprochen wird, nicht das Geringste nach außen dringen. Ich berufe mich auf Euer Gehorsamkeitsgelübde.«
»Bruder Galcerán de Born wird schweigen, Eure Heiligkeit«, bekräftigte Herzog Robert meine Ergebenheit.
Der Papst nickte.
»So sei es. Ich vermute, Ihr seid über die unangenehmen Vorfälle im Bilde, die meinen Vorgänger Clemens V. dazu bewegten, den gefährlichen Orden der Templer aufzulösen, nicht wahr?«, fragte er mich und blickte mir dabei tief in die Augen.
Für einen flüchtigen Augenblick stand mir wohl ungläubige Überraschung und tiefstes Missbehagen im Gesicht geschrieben, als ich mir aber dessen bewusst wurde, gewann ich schnell die Fassung zurück. Stand die Mission, mit der mich Seine Heiligkeit betrauen wollte, etwa in Zusammenhang mit den Templern? Gott behüte! Wenn dem so war, hatte ich mich soeben in die Höhle des Löwen begeben.
So viele Male hatte ich deren Geschichte schon gehört, kannte sie bis in alle schrecklichen Einzelheiten, dass mir nun all jene Ereignisse durch den Kopf schossen, während mich Johannes XXII. mit kaltem und inquisitorischem Blick von oben bis unten maß.
Drei Jahre zuvor, am 19. März 1314, waren Jacques de Molay, Großmeister des verbotenen Templerordens, und Geoffroy de Charney, Präzeptor der Normandie, auf dem Scheiterhaufen verbrannt, angeklagt des Meineids und der Ketzerei. Dies war der tragische Höhepunkt von sieben Jahren Verfolgung und Folter gewesen, die dem mächtigsten Ritterorden der Christenheit ein Ende setzten. Zwei Jahrhunderte lang hatten die Tempelherren über mehr als die Hälfte der europäischen Territorien geherrscht und dabei so große Reichtümer angehäuft, dass niemand jemals deren Ausmaß zu schätzen vermochte. Der Templerorden war de facto der wichtigste Bankier des Adels und der bedeutendsten christlichen Reiche des Abendlandes gewesen, und in seinen Händen lag seit der Regentschaft Ludwig IX. des Heiligen der Staatsschatz von Frankreich. Wie man sich erzählte, und das völlig zu Recht, so war genau dies der Anlass für seinen Untergang gewesen, denn der Enkel des heiligen Ludwig, Philipp IV. der Schöne, der unter ständigem Geldmangel litt und sich durch dieses wirtschaftliche Vasallentum gedemütigt fühlte, hatte seinen Siegelbewahrer und Vertrauten Guillaume de Nogaret mit der Aufgabe betraut, nach und nach die Voraussetzungen für die Auflösung und endgültige Vernichtung des Templerordens zu schaffen. Die ersten Verhaftungen waren daraufhin im Oktober 1307 erfolgt.
Um einen solchen Affront gegen den allmächtigen Orden vor den überraschten europäischen Fürsten zu rechtfertigen, behauptete Philipp, in seiner Macht befänden sich untrügliche Beweise, die seiner Meinung nach zeigten, dass die Templer zahlreiche Verbrechen begangen hatten, die von Ketzerei, Freveltaten und Sodomie bis zu Götzendienst, Blasphemie, Zauberei und Glaubensabfall reichten. Es kam zu insgesamt vierzehn Anklagen, die auf unter Folterqualen abgelegten Geständnissen von Brüdern des Ordens beruhten. Doch während die Monarchen Englands, des Deutschen Reichs, Aragóns, Kastiliens und Portugals solche Anschuldigungen stark in Zweifel zogen, beschloss Seine Heiligkeit Papst Clemens V. – von König Philipp, der ihm zur Papstwürde verholfen hatte, stark unter Druck gesetzt –, den Orden der Tempelherren mittels der Bulle Considerantes dudum aufzulösen, und gleich darauf zwei weitere, Pastoralis praeementiae und Faciens misericordiam, zu erlassen, mittels derer er sämtliche christlichen Reiche zwang, alle Templer, die sich in ihren Hoheitsgebieten befanden, der Heiligen Inquisition zu überantworten.
Von diesem Zeitpunkt an fühlte sich der französische Monarch rechtmäßig dazu befugt, seine persönliche Rache an ihnen zu stillen; zu diesem Zweck erteilte er seinem königlichen Siegelbewahrer Guillaume de Nogaret vollkommene Handlungsfreiheit. So starben sechsunddreißig fratres militiae Templi während der Verhöre, vierundfünfzig erlitten den Feuertod, jene, die sich weigerten, ihre Verbrechen zu gestehen, wurden zu lebenslanger Kerkerhaft verurteilt, und nur die, die aus freien Stücken öffentlich ihre Schuld bekannten, wurden 1312 freigelassen, woraufhin sie im Laufe der folgenden Tage eiligst aus Paris und ganz Frankreich flohen.
An all das dachte ich, als die Stimme Seiner Heiligkeit Johannes XXII. mich wieder in die Realität zurückholte:
»Folglich werdet Ihr auch über die Diaspora der französischen Templer in wohlgesonneneren Reichen als das der Kapetinger Bescheid wissen und über die mit unserer Erlaubnis erfolgte Gründung neuer, kleinerer und ungefährlicherer Ritterorden, die jetzt einen Teil der Dienste übernommen haben, die früher die Tempelherren leisteten. Nun gut, all dies ist jetzt in einem seltenen Gemisch miteinander verbunden, welches das heikle politische Gleichgewicht erheblich stört, das zurzeit zwischen den christlichen Königreichen besteht. Ihr wisst, dass die portugiesischen Tempelherren eine wesentlich andere Behandlung erfuhren als ihre Brüder in anderen Ländern …«
Beifällig nickte ich.
»Tatsächlich war Portugal das einzige Reich der ganzen Christenheit, das sie nicht der Inquisition überantwortete und sie so vor der Folterbank und den Beinschrauben rettete. Warum dieses Reich allen päpstlichen Befehlen zuwiderhandelte? Weil Don Dinis, der portugiesische König, ein glühender Verfechter des Templergeistes ist … Und jetzt beabsichtigt er«, schrie Seine Heiligkeit plötzlich entrüstet auf, »jetzt beabsichtigt er, noch weiter zu gehen und uns gar zum Gegenstand seines Spotts zu machen!«
Er leerte den Inhalt seines Bechers in einem Zug und setzte ihn dann mit Wucht auf dem Tisch ab. Eilfertig schenkte ihm sein cubicularius nach.
»Hört mir nun aufmerksam zu, Bruder: Vor kurzem sprach bei uns ein Emissär von Don Dinis vor, der uns um die Erlaubnis bittet, in Portugal einen neuen Ritterorden ins Leben zu rufen, den er Orden der Ritter Christi zu nennen gedenkt. Die Unverschämtheit des portugiesischen Königs geht sogar so weit, uns als Abgesandten einen bekannten Templer zu schicken, João Lourenço, der in der Zitadelle geduldig auf unsere Antwort wartet, wie auch immer sie ausfallen möge, um damit in gestrecktem Galopp zu seinem König zurückzukehren. Was denkt Ihr darüber, Galcerán de Born?«
»Ich glaube, dass der König von Portugal äußerst wohlüberlegten Plänen folgt, Heiliger Vater.«
»Wie das, Bruder?«
»Es liegt auf der Hand, dass er vorhat, den Fortbestand des Templerordens in seinem Reich zu gestatten, und die Tatsache, einen Templer als Boten entsandt zu haben, beweist, dass er sich nicht im Geringsten davor fürchtet, Euch mit seinem Ungehorsam zu beleidigen.« Angesichts des offensichtlichen Interesses des Papstes beschloss ich, mit meinen Überlegungen fortzufahren. »Wie Ihr wisst, lautete der ursprüngliche Name des Templerordens ›Orden der armen Ritter Christi‹; die Bezeichnung ›Templerorden‹ geht zurück auf seinen ersten Sitz im Heiligen Land, den Tempelbezirk von Salomo, einem Geschenk König Balduins II. von Jerusalem an die neun Gründer. Deshalb besteht der Unterschied zwischen den Namen, jenem, den er gründen will, ›Orden der Ritter Christi‹, und jenem aufgelösten, nur in einem Wort, welches wohlweislich getilgt wird, denn die Templer waren offenkundig alles andere als arm … Zumindest in diesem Punkt erweist sich der König von Portugal als Ehrenmann.«
»Und was weiter?«
»Wenn er gestattet, dass der Templerorden in seinem Reich fortbesteht, wird er nicht nur den Namen ändern, sondern ihnen auch ihre alten Besitztümer zurückgeben müssen. Und wem gehören diese gerade?«
»Dem König!«, rief der Papst voll Groll aus. »Er ließ die Templergüter beschlagnahmen, wie dies die Bullen unseres Vorgängers, Clemens V., anordneten, und nun teilt er uns seelenruhig mit, dass er dem neuen Orden besagte Güter stiften möchte. Aber nicht genug damit: Mit noch größerer Unverschämtheit gibt er uns kund, dass die Christusritter den Regeln des Ordens von Calatrava folgen werden, die sich wiederum auf die der Zisterzienser stützen und die – und hier merkt erneut auf, denn das sagt der König von Portugal nicht, nein, das verschweigt er! – vollkommen mit denen der Pauperes commilitones Christi templique Salomonis übereinstimmen.«
Der Papst nahm erneut einen großen Schluck aus seinem Becher, leerte ihn bis zum Grund und ließ ihn wiederum mit einem dumpfen Schlag auf den Tisch fallen. Er war so entrüstet und wütend, dass sogar seine Augen blutunterlaufen waren. Zweifellos war er von sanguinischem und wohl auch cholerischem Temperament, was im Grunde genommen in auffälligem Widerspruch zu dem Bild gleichmütiger Sanftheit stand, das er bei seinem Eintreten ausgestrahlt hatte, und es konnte mich nun nicht weiter in Erstaunen versetzen, was mir Bruder Robert über seine schnellen Triumphe und sein tatkräftiges Wesen erzählt hatte.
»Ihr werdet Euch jetzt fragen: Was soll das alles? Nun, wenn wir einmal die Kleinigkeit beiseitelassen, dass Don Dinis uns vor der ganzen Welt demütigen und sich über die Kirche und ihren Hirten lustig machen will, so bleiben doch noch einige Fragen offen. Stellt Euch einmal vor, dass wir ihm aus diesen beschämenden Gründen unsere Bestätigung verweigern. Was würde dann geschehen?«
»Ich weiß nicht, was …«, unterbrach ich ihn, ohne es zu merken.
»Wir sind noch nicht fertig, Bruder!«, stieß er aufbrausend aus. »Also, falls ich dem Templerorden seinen Wunsch versage, in Portugal wieder wie Phönix aus der Asche zu erstehen, wird er womöglich auf den Gedanken kommen, einen neuen Papst anzustreben, der seinen Plänen gewogener scheint. Wir schließen auch nicht die Möglichkeit aus, dass sich außer diesem João Lourenço, den Don Dinis uns gesandt hat, in der Zitadelle noch weitere getarnte Templer befinden, die unsere Antwort erwarten, um uns dann, falls erforderlich, ein schnelles Ende zu bereiten.«
»Wenn dem so wäre, Heiliger Vater«, wagte ich zu äußern, »würde der Templerorden Gefahr laufen, dass der nachfolgende Pontifex ihm ebenfalls die Erlaubnis verweigert. Und dann, was würde er dann tun …? Einen Papst nach dem anderen ermorden, bis einer seinen Wünschen entspräche?«
»Ja, ja, ich weiß schon, worauf Ihr hinauswollt, Sire Galcerán, allein Ihr irrt Euch! Es handelt sich nicht um den nächsten Pontifex oder einen der nächsten fünfzig … Es geht um uns, Bruder, um unser armseliges, Gott und der Kirche geweihtes Leben! Die Frage lautet: Werden die Templer es wagen, uns zu töten, wenn wir ihnen die Bestätigung des neuen Ordens verweigern? Vielleicht ja nicht, vielleicht sind die Gerüchte über den Orden auch übertrieben … Erinnert Ihr Euch an den Fluch Jacques de Molays? Habt Ihr davon reden gehört?«
Wie die Legende berichtet, die in der ganzen Welt von Mund zu Mund ging, hatten sich bei der Hinrichtung plötzlich durch einen Windstoß die Flammen des Scheiterhaufens geteilt, auf dem Jacques de Molay, der letzte Großmeister der Templer, lebendig verbrannte, so dass der Angeklagte kurz zu sehen war. Und genau in diesem Augenblick schrie der Großmeister mit voller Lunge Folgendes zum Palastfenster hinauf, von dem aus der König, der Papst und der königliche Siegelbewahrer das Geschehen beobachteten:
»Nekan, Adonai! … Chol-Begoal! Papst Clemens … Ritter Guillaume de Nogaret … König Philipp: Ich rufe Euch auf, noch vor Ablauf eines Jahres vor Gottes Thron zu erscheinen, um Eure gerechte Strafe zu empfangen … Verdammt sollt Ihr sein! … Verdammt! … Verdammt seid Ihr bis zur dreizehnten Generation Eures Geschlechts!«
Eine bedrohliche Stille setzte seinen Worten ein Ende, noch bevor sich seine Erscheinung für immer in den Flammen verlor. Das Furchtbare daran war, dass tatsächlich alle drei vor Ablauf dieser Frist starben.
»Vielleicht sind die Gerüchte, die darüber in Umlauf sind, ja nichts anderes als Hirngespinste, Geschwätz des Pöbels oder durch den Templerorden selbst verbreitete Lügen, um sein Ansehen als bewaffnete, geheime und einflussreiche Macht, der niemand entkommen kann, noch zu erhöhen. Was meint Ihr, Bruder?«
»Das ist gut möglich, Eure Heiligkeit!«
»Ja, es ist möglich … Doch uns behagen diese Unwägbarkeiten ganz und gar nicht, und wir wünschen, dass Ihr die Wahrheit herausfindet. Dies ist die Mission, mit der wir Euch betrauen: Wir wollen Beweise, Bruder Galcerán, Beweise, die untrüglich belegen, dass der Tod von König Philipp, seinem Vertrauten de Nogaret und Papst Clemens V. Gottes Wille war oder eben im Gegenteil dem Willen jenes unseligen Jacques de Molay gehorchten. Euer Stand als Medikus und Eure wohlbekannte Hartnäckigkeit sind für diese Aufgabe von unschätzbarem Wert. Stellt Eure Begabung in den Dienst der Heiligen Kirche und bringt uns die Beweise, die wir fordern. Falls die Todesfälle Wille unseres Herrn waren, können wir Don Dinis’ Ansinnen ruhigen Gewissens ablehnen, ohne Angst haben zu müssen, selbst ermordet zu werden; falls sie allerdings das Werk der Templer waren … dann ist das Leben der ganzen Christenheit bedroht vom mörderischen Schwert einiger Verbrecher, die sich Mönche nennen.«
»Das ist eine unheimlich schwierige Aufgabe, Eure Heiligkeit«, protestierte ich; ich spürte, wie mir der Schweiß über den Körper strömte und das Haar an meinem Hals klebte. »Ich glaube nicht, dass ich sie bewältigen kann. Was Ihr von mir verlangt, vermag ich unmöglich herauszufinden, vor allem, wenn es tatsächlich die Templer waren, die sie umbrachten.«
»Dies ist ein Befehl, Bruder Galcerán de Born«, flüsterte mir da der Großkomtur von Frankreich sanft, doch mit Bestimmtheit ins Ohr.
»So ist es, Ritter Galcerán, beginnt so bald wie möglich! Wir verfügen über nicht viel Zeit; denkt daran, dass der Templer in der Zitadelle wartet.«
Ohnmächtig schüttelte ich den Kopf. Die Mission war in jeder Hinsicht unmöglich zu erfüllen, jedoch befand ich mich in einer ausweglosen Lage: Ich hatte einen Befehl erhalten, dem ich mich unter keinen Umständen widersetzen konnte, weshalb ich also meinen Unwillen beschwichtigen und mich den Anordnungen fügen musste.
»Ich werde einige Dinge benötigen, Eure Heiligkeit: Erzählungen, Chroniken, medizinische Gutachten, die kirchlichen Dokumente bezüglich des Todes von Papst Clemens … und auch die Genehmigung, bestimmte Zeugen befragen zu dürfen, Archive zu konsultieren, um …«
»Für all dies ist bereits gesorgt, Bruder.« Johannes XXII. hatte die nervenaufreibende Angewohnheit, andere nicht ausreden zu lassen. »Hier habt Ihr die Berichte, Geld und alles, was sonst vonnöten sein wird.« Und er überreichte mir ein ledernes chartapacium, das er aus einer Truhe unter dem Tisch hervorzog. »Selbstredend werdet Ihr darin nichts finden, was Euch als päpstlichen Abgesandten ausweist, und Ihr werdet auch nicht auf meine Rückendeckung zählen können, falls man Euch auf die Schliche kommen sollte. Euer eigener Orden wird Euch mit allen Vollmachten, die Ihr benötigt, ausstatten müssen. Ich nehme an, Ihr versteht … Habt Ihr noch eine letzte Bitte?«
»Nein, Eure Heiligkeit.«
»Wunderbar. Ich erwarte Euch also baldmöglichst zurück.«





























