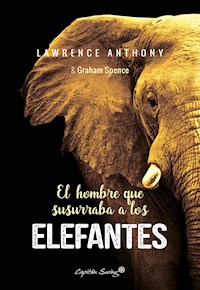12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: mvg Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Als der Naturschützer Lawrence Anthony erfährt, dass nur noch einige wenige Nördliche Breitmaulnashörner in freier Wildbahn leben, ist er fest entschlossen, die Rhinos vor dem Aussterben zu retten. Doch die starke Nachfrage nach ihren Hörnern gefährdet nicht nur das Leben dieser erhabenen Tiere, sondern auch das der Ranger, die sie beschützen wollen. Unerschrocken stellt Anthony sich Wilderern, berüchtigten Rebellengruppen und einer unbeweglichen Regierungsbürokratie entgegen und muss dabei auch noch um das Überleben seiner eigenen Tiere in seinem Naturschutzreservat in Südafrika kämpfen, das von einer schrecklichen Dürre heimgesucht wird. Ein mutiger Kreuzzug, der sich wie ein Safari-Abenteuer, eine Geschichtsstunde und eine Warnung an die Menschheit liest. Mit beeindruckenden Fotos aus Afrika.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 494
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Lawrence Anthony
mit Graham Spence
Das letzte Nashorn
Vom Autor des internationalenBestsellers Der Elefantenflüsterer
Lawrence Anthony
mit Graham Spence
Das letzte Nashorn
Was ich von einer aussterbenden Tierart über das Leben lernte
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de/ abrufbar.
Für Fragen und Anregungen:
2. Auflage 2023
© 2020 by mvg Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH
Türkenstraße 89
80799 München
Tel.: 089 651285-0
Die englische Originalausgabe erschien 2012 bei Thomas Dunne Books, St. Martin’s Publishing Group unter dem Titel The Last Rhinos. © 2012 by Lawrence Anthony and Graham Spence. All rights reserved.
Dieses Werk wurde im Auftrag von St. Martin’s Publishing Group durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover, vermittelt.
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.
Übersetzung: Elisabeth Liebl
Redaktion: Dr. Sybille Beck
Umschlaggestaltung: Marc-Torben Fischer
Umschlagabbildung: shutterstock.com/Andres Mena Photos
Satz: Helmut Schaffer, Hofheim a. Ts.
Druck: CPI books GmbH, Leck
ISBN Print 978-3-7474-0210-8
ISBN E-Book (PDF) 978-3-96121-566-9
ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-96121-567-6
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter
www.mvg-verlag.de
Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de.
Dieses Buch ist diesen mutigen Menschen gewidmet:
Ian Player, Nick Steel, Kes und Frazer Hillman-Smith und all jenen tapferen Männern und Frauen, die ihr Leben der Aufgabe widmen, eines der wunderbarsten Geschöpfe zu schützen und zu retten, die je die Erde beehrt haben: das Nashorn.
Der Autor verurteilt mit aller Schärfe die früheren und gegenwärtigen Regierungen von Vietnam, China, Myanmar, Indonesien, Thailand, Südkorea, Taiwan und Malaysia.
Sie alle haben es versäumt, die abergläubische Verwendung des Rhinozeroshorns in der sogenannten traditionellen Medizin effektiv zu verhindern. Ihre kriminelle Gleichgültigkeit hat das Nashorn in allen Teilen der Welt nahezu zum Aussterben verurteilt.
Inhalt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Bildteil
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Bildnachweis
Über die Autoren
1
Es war kaum hell geworden, als das Funkgerät knisternd zum Leben erwachte.
»Code Red! Code Red! Lawrence, bitte kommen. Over.«
»Hier Lawrence!«
»Der Tag fängt schlecht an.« Der Funker machte eine Pause. »Wir haben ein totes Nashorn am Hlaza Hill. Ein Weibchen. Over.«
Angst ließ mir das Blut in den Adern gefrieren. Ich richtete den Blick in den Himmel über dem fernen Hlaza Hill, dem höchsten Punkt des neuen Wildreservats, das an Thula Thula grenzt, mein eigenes Reservat und mein Zuhause im südafrikanischen Zululand. Es waren weder Geier noch Gewehrschüsse gemeldet worden. Letztere nämlich hallen bei entsprechendem Wind wie Donnerschlag über die afrikanische Ebene.
»Todesursache?«, fragte ich und fürchtete das Schlimmste.
»Wilderer. Beide Hörner sind weg. Der ganze Boden ist blutig. Das waren Profis. Sieht aus, als hätten sie ein AK-47 verwendet oder vielleicht ein altes Militär-R1.«
Ich spürte, wie meine Fäuste sich zusammenballten. Nashorn-Wilderer – das schlimmste Übel der Wildnis, das sich mittlerweile zur Pandemie ausgewachsen hatte.
»Wie lange ist sie schon tot?«
»Können höchstens ein paar Stunden sein. Vermutlich haben sie sie um Mitternacht erlegt. Der Mond war ja hell genug.«
»Okay, ich fahre gleich los. Ende.«
Ich warf einen Blick auf die Pumpgun-Schrotflinte, die auf dem Beifahrersitz meines Landrovers lag, griff nach der Munitionskiste und stopfte mir ein paar Handvoll SG-Patronen in die Taschen.
Gegen jede Hoffnung wünschte ich mir, die Wilderer wären noch auf dem Gelände des Reservats.
Die Schmeißfliegen sammelten sich schon, als ich am Tatort ankam. Die Luft roch metallisch nach Blut. Das Rhinozeros lag völlig atypisch auf der Seite, die Beine unnatürlich vom steifen Körper abgespreizt.
Ich stieg aus dem Landrover und ging zu den drei Rangern hinüber. Niemand sprach ein Wort. Der Schock über den Abschuss, die Gegenwart des gewaltigen toten Körpers, ließen uns die Worte im Hals ersterben.
Nashörner besitzen eine alte, ewige Schönheit. Von ihren massigen Körpern, geschützt von dicken Panzern, als wären sie Kreaturen der Vorzeit, und ihrem krummsäbelartigen Vorderhorn geht ein ganz eigener Zauber aus. Sie wiegen bis zu dreieinhalb Tonnen und erreichen ungefähr einen Meter achtzig Körpergröße. Das macht sie – nach den Elefanten – zu den größten Landsäugetieren der Welt.
Im Tod aber war diese Schönheit nun verschwunden. Die majestätischen Hörner waren von scharf geschliffenen Macheten abgehackt worden – pangas, wie wir sie in Afrika nennen. Das schöne Antlitz förmlich entweiht. Die Augen starrten leer in die Welt. Rund um den grotesk verstümmelten Kopf war das Blut in großen Lachen geronnen. Ohne ihr Horn sah die mächtige Kreatur aus wie ein hilfloses Baby.
Ich konnte sehen, dass die Wildhüter ebenso erschüttert waren wie ich. In Afrika ist der Kampf gegen die Wilderer etwas zutiefst Persönliches. Dabei gibt es zwei Arten von Wilderern: Die örtlichen Stammesmitglieder erlegen etwas Kleines, das den Kochtopf füllt. Die Schwergewichte aber, die professionellen Killer, machen Jagd auf die Hörner von Nashörnern und das Elfenbein der Elefanten. Diese Typen erschießen auch Wildhüter und prahlen dann noch damit. Jede Form von Wilderei ist ein Verbrechen, doch wer ein Nashorn oder einen Elefanten tötet, will damit nicht seine Familie ernähren. Hier geht es um Blutgeld. Und diese Art von Gewalt geht uns alle an.
»Wer hat das tote Tier gefunden?«
Bheki, dem ich von all meinen Wildhütern am meisten vertraute, schaute auf und zeigte auf einen Wächter namens Simelane, einen jungen Zulu, der ein wenig abseitsstand. Ich winkte ihn zu mir herüber.
»Sawubona, Simelane«, grüßte ich ihn. »Was ist hier passiert?«
»Sawubona, Mkhulu. Ich war auf Patrouille, als ich das tote Nashorn sah«, antwortete er ruhig und starrte zu Boden.
»Wer war bei dir?«
»Ich war allein.«
»Du bist hier ganz allein auf Patrouille gewesen?«, fragte ich überrascht. Eine Wildhüterstreife bestand gewöhnlich aus zwei bewaffneten Männern.
»Ja, ich war allein.« Sein Flüstern war kaum zu hören.
Ich wollte eben mit der Befragung weitermachen, als eine laute Zulustimme mich übertönte.
»Mkhulu, hier ist viel zu viel Blut.«
Es war Bheki, der vor dem Kopf des Tieres kniete, um ihn genauer in Augenschein zu nehmen.
»Zu viel Blut«, wiederholte er. »Das heißt, sie hatten es eilig. Sie haben die Hörner abgeschnitten, als sie noch gelebt hat. Sie war vielleicht bewusstlos, aber noch am Leben.«
Einen Augenblick starrten wir Bheki nur entsetzt an. Dann erst begriffen wir. Diese Ungeheuer hatten einem lebendigen Tier die Hörner abgesäbelt.
»Wohin sind sie verschwunden?«, fragte ich Bheki, mit dem zusammen ich mir in den letzten zehn Jahren mehrere Feuergefechte mit Wilderern geliefert hatte.
Er zeigte nach Osten. »Vor vier oder fünf Stunden vielleicht.«
Das hieß: Wenn sie sich nicht irgendwo versteckt hielten, wären sie schon fast an der Grenze des Reservats. Sie würden auf die Townships zuhalten, wo wir sie nie im Leben erwischen würden. Doch das bedeutete nicht, dass wir es nicht versuchen würden. Zumindest würden wir so unsere angestaute Wut los.
»Okay, wir kennen ja alle die Vorgehensweise«, sagte ich. »Diese Kerle haben vermutlich Maschinenpistolen, und wir wissen, was das bedeutet. Wenn wir sie stellen können und sie auch nur daran denken, ihre Gewehre anzuheben, schießt schnell und schießt zuerst. Denn sie haben Automatikfeuerwaffen.«
Ich blickte in die feierlichen Gesichter. Wir hatten nur normale Gewehre und Lee-Enfield-Repetiergewehre Kaliber .303 aus dem Zweiten Weltkrieg. Was die Waffenstärke anging, waren wir vollkommen unterlegen, aber das würde diese entschlossenen, engagierten Männer nicht einen Augenblick davon abhalten, sich an die Verfolgung zu machen. Die Gegner hatten automatische Waffen, die schneller feuerten, als wir nachladen konnten. Sie können sich nicht vorstellen, wie viel Mut das von einem verlangt. Ich hatte eine Pumpgun-Schrotflinte, die schnell und tödlich war und in kürzestem Abstand neun Patronen nacheinander ausspuckte. Unsere Waffen ergänzten sich gut. Die .303 hatte eine größere Reichweite als ein AK, die Pumpgun-Schrotflinte wiederum traf auf kurze Distanz im Busch selten daneben. Vereint konnten sie den illegalen AK-47-Maschinenpistolen, die bei den Wilderern so beliebt waren, durchaus Paroli bieten. »Nehmt euer eigenes Wasser mit und lasst die Waffen gesichert. Auf geht’s!« Wir würden im dichten Busch so schnell fahren, wie wir konnten. Ich wollte nicht, dass sich bei dem Gerüttel aus Versehen ein Schuss löste und einen Wildhüter tötete.
Die Verfolgungsjagd war anstrengend. Mitten am Vormittag kämpften wir uns auf kaum noch erkennbaren Wegen durch den Busch. Die Sonne brannte erbarmungslos herunter, typisch für Zululand. Der Schweiß lief uns übers Gesicht, brannte in den Augen und durchnässte unsere Kleidung. Aber wir waren vollgepumpt mit Adrenalin und ließen uns von der glühenden Sonne nicht abschrecken. Wenn wir jetzt Pause machten, dann wäre selbst die minimale Chance vertan, die wir hatten, um die Kerle noch zu erwischen.
Es ist schwer, ruhig zu bleiben, wenn man gesehen hat, dass ein Nashorn brutal abgeschlachtet wurde nur wegen seines Horns, das nur aus Keratin besteht – dem selben Faserprotein, das auch den Hauptbestandteil unserer Haare und Fingernägel bildet. Da ist ruhig bleiben eigentlich unmöglich. Man möchte am liebsten vergehen vor Zorn, doch das nützt auch nichts. Dem Horn des Rhinozeros werden in diversen Ländern Asiens geheimnisvolle medizinische Wirkungen nachgesagt, weswegen es dort zu den traditionellen Heilmitteln zählt. In der klassischen chinesischen Medizin heißt es zum Beispiel, das Horn des Nashorns würde Fieber lindern. Mit dem wachsenden Reichtum in diesen Ländern wuchs auch die Nachfrage nach den Hörnern. Zehntausende Nashörner wurden in Afrika getötet, einige der Unterarten stehen kurz vor der Ausrottung. Diese Nachfrage hat ein Jagdfieber ähnlich dem kalifornischen Goldrausch im neunzehnten Jahrhundert ausgelöst, und das aus verständlichem Grund. Auf den Straßen von China und Vietnam ist eine Unze (ca. dreißig Gramm) Rhinozeroshorn wertvoller als Gold. Wenn Sie wirklich begreifen wollen, wogegen wir Naturschützer hier kämpfen, dann stellen Sie sich einen Wilderer und seinen Blick auf das Nashorn vor: Er sieht hier zwei Hörner aus purem Gold vor sich. Die Wildhüter in unseren Reservaten befinden sich in der wenig beneidenswerten und extrem gefährlichen Situation, dass sie reines Gold vor gierigen Händen beschützen müssen. Was eigentlich sicher in einen Tresor geschlossen werden sollte, läuft hier frei auf vier Beinen durch den Busch.
Es ist keine Übertreibung, wenn ich sage, dass jedes Nashorn auf dieser Erde mittlerweile in Lebensgefahr schwebt. Wenn sich nicht grundlegend etwas ändert, und zwar schnell, dann wird bald das letzte Rhinozeros auf diesem Planeten den Tod gefunden haben.
Wir fuhren so schnell wir konnten, hielten zwischendrin immer wieder Ausschau nach den Spuren der Wilderer – Fußabdrücke, Stellen, wo das Gras niedergedrückt war, ein markierter Baum, Blutflecken, die vermutlich von den Hörnern stammten, die die Wilderer in einem Jutesack mit sich trugen. Zeichen, die zeigten, dass wir auf der richtigen Fährte waren, verliehen uns das nötige Durchhaltevermögen. Bheki ermahnte uns immer wieder zur Eile.
Simelane, der junge Ranger, der das tote Nashorn gefunden hatte, bereitete mir jedoch Sorgen. Zweimal lief er allein in den Busch, als er falschen Spuren folgte, und kostete uns damit noch mehr wertvolle Zeit. Möglicherweise verhielt er sich ja so merkwürdig, weil eine solche Verfolgungsjagd stets großen Stress bedeutet. Immerhin konnten wir jederzeit in einen Hinterhalt geraten.
Tatsächlich war dies meine größte Sorge. Wenn Sie in Südafrika ein Nashorn töten, erwartet Sie eine Gefängnisstrafe von fünfzehn Jahren. Das würden die Wilderer nicht riskieren. Sie wussten es und wir wussten es. Sollten die Wilderer Wind davon bekommen, dass sie verfolgt wurden, würden sie uns auflauern und mit Sicherheit in ein tödliches Feuergefecht verwickeln – in einen Nahkampf, im dichten Busch, mit schlechter Sicht und maximalem Chaos.
Schließlich forderte das hohe Tempo seinen Tribut. Ich befahl einen kurzen Stopp und schickte einen der Wildhüter auf eine Anhöhe, um nach den Wilderern Ausschau zu halten.
»Nichts«, kam die Antwort von der Anhöhe. »Ich sehe gar nichts.«
Der frustrierte Ausdruck auf Bhekis Gesicht sagte mir, dass die Spur mittlerweile kalt war. Wir waren zu spät dran. Als wir einige Stunden später am Zaun ankamen, der das Reservat schützt, fanden wir nur einen Schlitz, den die Wilderer hineingeschnitten hatten, wobei sie sorgsam alle elektrisch geladenen Drähte vermieden hatten. Sie waren wohl wirklich weg.
»Nächstes Mal«, hörte ich Bheki flüstern, als er seine .303 entlud. »Nächstes Mal werden wir sie schnappen, Mkhulu.«
Ich nickte stumm, während ich mein Gewehr entlud. Dann machten wir uns auf den Rückweg.
Zu Hause meldete ich den Vorfall, zuerst der Polizei, dann der für unser Reservat zuständigen Behörde, der KwaZulu-Natal Wildlife. Gerade der letzte Anruf war schlimm, denn man hatte das ermordete Tier gerade für ein Projekt gespendet, das ich leitete. Ich habe mein Reservat, Thula Thula, mit den weitläufigen Stammesgebieten der Zulu vereint, um hier eines der, wie wir glaubten, besten Reservate Afrikas zu schaffen. Es sollte Royal Zulu heißen und stellte eine einzigartige Zusammenarbeit mit den örtlichen Stämmen dar. Das Projekt würde den armen Gemeinden rundherum wirklich etwas bringen, denn das Reservat schuf Arbeitsplätze, zusammen mit dem Ökotourismus, den wir hier betreiben wollten. Die Zulustämme würden an der Zukunft Afrikas mitarbeiten. In den Jahren der Apartheid waren Reservate nur Weißen vorbehalten gewesen. Viele ländliche Zulus hielten Naturschutz also für eine »Weißensache« und zeigten deshalb wenig Interesse dafür. Wir aber hatten es uns zur Aufgabe gemacht, die traditionellen spirituellen und kulturellen Bindungen der Zulu an den Busch wiederzubeleben, die einst so wichtig waren. Wir wollten ihnen zeigen, dass Wilderei vielleicht Nahrung für eine Woche bot, der Schutz der Tiere aber Jobs für immer. Lebendig sind diese Tiere so viel mehr wert als tot. Natürlich mussten wir in den örtlichen Gemeinden erst einmal Überzeugungsarbeit leisten, damit sie auch wirklich mitmachten. Sonst hätten wir Naturschützer letztlich keine Chance – wie der enthornte Fleischberg, der nun in der Sonne verrottete, deutlich bewies.
KZN Wildlife hatte uns im Rahmen des Royal-Zulu-Projekts vier Breitmaulnashörner gespendet, die die Grundlage des Zuchtbestands bilden sollten. Der Manager, dem ich die schlechte Nachricht mitteilte, war verständlicherweise nicht begeistert. Ich wusste, was nun kommen würde.
»Lawrence«, sagte er, »das ist wirklich schlimm. Wir machen uns Sorgen um die Sicherheit. Ich meine, du hast noch drei andere Nashörner dort, und die wollen wir ja nicht auch noch verlieren.«
»Ich weiß. Ich habe unsere impimpis angesetzt«, antwortete ich. Damit waren die Informanten bei den örtlichen Stämmen gemeint, die bezahlt wurden, um Informationen über Diebstahl und Wilderei zu sammeln. »Und ab morgen werden noch mehr Patrouillen fahren. Ich werde diese Bastarde erwischen, und wenn es das Letzte ist, was ich tue.«
»Nun ja, viel Glück. Aber ich glaube, in der Zwischenzeit sollten wir versuchen, die Tiere in sichereres Gelände zu bringen, bis sich alles wieder beruhigt hat. Nashörner sind für diese Wilderer heutzutage ja wie ein verdammter Magnet.«
»Ja, ich verstehe, was Sie meinen«, entgegnete ich. »Aber sie wurden ja gerade erst zu uns gebracht. Woher sollte denn jemand wissen, dass sie hier waren? Das muss ein Tipp von eurer Seite gewesen sein. Wie sollen wir wissen, ob sie bei euch sicherer sind?«
Er seufzte. »Das ist überhaupt mein schlimmster Albtraum.«
Er war ein anständiger Kerl, den ich gut kannte. Ich verstand auch, was er sagen wollte, aber es schmerzte mich wirklich, zu hören, dass wir diese drei Nashörner zurückgeben sollten. Unsere Sicherheitsvorkehrungen waren schon gezwungenermaßen die besten im Umkreis. Schließlich schützten wir hier schon seit mehr als zehn Jahren eine Herde Elefanten. Heute aber ist im Busch nichts mehr sicher, wenn Nashorn-Wilderer unterwegs sind, schon gar nicht das eigene Leben.
Aber ich konnte nichts tun. Wenn die Behörde, die für das Reservat zuständig war, die Tiere zurückhaben wollte, dann war es eben so. Unglücklicherweise bedeutete das aber, dass nur noch ein einziges Nashorn übrig bleiben würde. Ein Weibchen. Ein deutscher Tourist hatte sie Heidi genannt, und der Name war ihr geblieben. Ein Elefant hatte vor einigen Jahren ihre Mutter getötet. Ein tragisch ungleicher Kampf um das Wegerecht. Sie war durch einen einzigen wütenden Angriff umgekommen. Ich weiß noch, wie ich neben dem toten Körper stand und im Busch eine Bewegung wahrnahm. Es war Heidi. Kaum entwöhnt, hatte sie den Kampf ihrer Mutter bis zu deren Tod wohl beobachtet. Ich kam näher, um zu sehen, ob mit ihr alles in Ordnung war, aber sie lief vor mir in den Busch davon.
Dann ertrank unser anderes Nashorn in einer Sturzflut. Eine Tragödie, wir konnten nichts dagegen tun. Und dann war also nur noch Heidi übrig.
Seitdem war Heidi, die es genoss, mit einer Herde Gnus zu grasen, mit uns aufgewachsen. Sie war der Liebling aller Ranger und Spurenleser. Sie hatte sich zu einem wunderschönen Geschöpf entwickelt und liebte das Spiel mit den Autos, in denen wir die Besucher der Lodge herumfuhren, damit sie Afrikas Wildnis kennenlernten. Sie verzauberte alle mit ihren Possen, kam näher, zog sich zurück, und spähte uns dann kurzsichtig aus, nur um kurz darauf wieder auf ihre umwerfende, hüpfende Nashornart davonzurennen. Wir mussten jetzt tun, was wir konnten, um Heidi zu beschützen.
Trotzdem: Am Tod des von KZN Wildlife gespendeten Weibchens war etwas höchst eigenartig, aber ich kam nicht so recht dahinter. Daher ließ ich Simelane ins Büro rufen, den Wächter, der das tote Tier entdeckt hatte.
»Mhkulu«, sagte er, als er näherkam. Wir schüttelten uns die Hand. Mkhulu heißt so etwas wie »Großvater« oder »Onkelchen«. Es ist mein Zulu-Spitzname. In ländlichen Zulugemeinden gibt man nahezu allen Menschen Spitznamen, und einige nehmen auf recht bissige Weise Bezug auf unsere körperlichen oder sozialen Mängel. Ich hatte Glück gehabt. Zumindest war mein Spitzname nett. Ich habe einen Freund, der sich im Sitzen manchmal mit den Händen auf die Schenkel trommelt. Ihn nannte man Thathazele oder »der Nervöse«. Und der Name blieb ihm auch. Und doch gehört er zu den tapfersten Männern, die ich kenne.
»Guten Tag, Simelane. Gut gemacht, dass du das tote Rhino gefunden hast.«
»Yebo.« Das hieß »ja«.
»Wie hast du es denn gefunden?«
»Ich wusste einfach, dass es da ist.«
»Hast du den Schuss gehört?«
Er schüttelte den Kopf: »Aibo.« Nein.
»Hast du Hyänen gesehen oder vielleicht Geier?«
Wieder schüttelte er den Kopf.
»Aber das Tier lag doch ganz schön weit weg von deiner Route, über einen Kilometer. Warum warst du denn in dieser Gegend?«
»Ich wusste einfach, dass etwas nicht stimmte. Also bin ich hin, um nachzusehen.«
»Aber du hast quasi sofort den richtigen Ort gefunden. Wie hast du das angestellt?«
»Ich habe es gespürt. Irgendetwas stimmte nicht an diesem Morgen.«
»Okay. Danke«, sagte ich und beendete ganz bewusst das Gespräch.
Simelane ging. Und ich war extrem misstrauisch geworden. Natürlich konnte er auch einfach die Wahrheit gesagt haben. Zulu haben manchmal einen sechsten Sinn für den Busch. Vielleicht hatte er nur einfach gedacht, dass etwas nicht stimmte. Aber irgendwie passte das alles nicht zusammen. Ich kannte meine Aufpasser recht gut. Sie wichen nur sehr selten von ihren geplanten Routen ab. Und wenn, dann nie allein.
Ich rief Bheki auf dem Handy an. »Bleib Simelane auf den Fersen«, sagte ich. »Versuch, sein Vertrauen zu gewinnen. Bis er dir etwas über sich und das Rhinozeros erzählt. Ich kann ihm nicht mehr vertrauen.«
Am nächsten Tag läutete das Telefon. Es war die Polizei.
»Ja, Lawrence, wir haben da vielleicht was«, sagte der Sergeant, mit dem wir schon früher zu tun gehabt hatten. »Es geht das Gerücht um, dass eine Bande – wir glauben aus Johannesburg – hierherkam und einen professionellen Schützen anheuerte. Sie gaben ihm eine Zeichnung von einem Nashornkopf, wo genau eingezeichnet war, wohin er schießen musste. Ein X markierte die Stelle. Es hieß, man habe ihm fünftausend Rand bezahlt [etwa siebenhundert US-Dollar]. Das Horn können Sie aber vergessen. Ein Schiff aus Taiwan, das die ganze letzte Woche in der Richards Bay vor Anker gelegen hat, ist gestern ausgelaufen. Passt doch perfekt, oder? Das ist mittlerweile sicher auf hoher See, und du kannst dein ganzes Reservat darauf verwetten, dass sie das Horn dabeihaben.«
Fünftausend Rand? Das Horn würde in Asien ein Vermögen bringen. Die Tatsache, dass die Bande aus Johannesburg kam, das ungefähr sechshundert Kilometer weit entfernt lag, sprach Bände. Das hieß, dass wir es mit Jungs zu tun hatten, die wirklich das große Rad drehten. Profis. Keine örtlichen Wilderer, die ohnehin meist nur für den eigenen Kochtopf jagten. Nein, das war entweder die Burenmafia – wie man die hauptsächlich Afrikaans sprechende Organisation nannte, die die chaotischen Zustände in Südafrika nach der Apartheid zu nutzen wusste, um mit Jagd und Wilderei das große Geld zu machen – oder ein Syndikat aus dem Fernen Osten, das Scharfschützen von außerhalb einflog, um sie die Drecksarbeit machen zu lassen.
»Wir haben das Tier seziert«, fuhr der Sergeant fort. »Sie haben ein R1 benutzt, ein ganz ähnliches Kaliber wie die AK. Eine Kugel aus nächster Nähe direkt ins Gehirn.«
Auch das war interessant. Das R1 war ein örtlich hergestelltes halbautomatisches Sturmgewehr. Die südafrikanische Armee benutzte es während der Grenzkonflikte, bevor die Apartheid abgeschafft wurde. Das konnte bedeuten, dass jemand mit guten Kontakten zur Armee dem Scharfschützen die Waffe geliefert hatte. Auch dies war ein Hinweis auf die Burenmafia, die buchstäblich mit allem handelte: vom Dosenlöwenschießen – dabei werden Käfigtiere von Fahrzeugen aus erschossen –, bis Elfenbein und Rhinozeroshorn.
Am nächsten Morgen rief ich Vusi Gumede, meinen Wildhüter, der für dieses Gebiet verantwortlich war, und bat ihn, Simelane in mein Büro zu schicken. Vusi kam zehn Minuten später zurück.
»Simelane ist heute nicht zur Arbeit erschienen.«
Bingo.
»Okay, nimm dir ein paar Wildhüter mit und geh zu ihm nach Hause. Schleif ihn mit Gewalt her, wenn es sein muss.«
Eine Stunde später kam Vusi zurück. Simelane hatte all seine Sachen gepackt und war abgehauen. Selbst seine Frau wusste nicht, wo er war.
Simelane, der das Reservat gut kannte, hatte die Killer vermutlich direkt zu dem Nashorn geführt. Vielleicht hatte er auch geschossen. Ich meldete es der Polizei.
Am Abend begaben wir uns auf Patrouille. Nur vier von uns: ich, Bheki und zwei mutige Wildhüter namens Thulani und Nkonka. Wir alle hofften auf ein Treffen. Wir wollten diese Wilderer unbedingt stellen.
Wir patrouillierten die ganze Nacht am Zaun entlang oder saßen stundenlang an den Aussichtspunkten. Still suchten wir das Reservat nach dem verräterischen Flackern einer Taschenlampe ab, gaben uns ständig gegenseitig Bescheid, indem wir in unsere Walkie-Talkies flüsterten. Aber wir fanden nichts. Als die Sonne aufging, fiel ich erschöpft in mein Bett. In der folgenden Nacht waren wir wieder unterwegs.
Und in der darauffolgenden ebenfalls.
Der zunehmende Dreiviertelmond schimmerte wie ein Leuchtturm – Wilderer arbeiten mit Vorliebe in hellen Nächten. Wir waren schon gut fünf Stunden Patrouille gegangen. Der Morgen würde nun bald heraufdämmern, jene Zeit der Nacht, in der die Lebensgeister am müdesten sind. Bheki und Thulani durchforsteten den Busch in ungefähr hundert Metern Entfernung. Plötzlich packte Nkonka mich am Arm und deutete mit dem Finger auf einen Punkt in der Landschaft. Ich ging sofort in die Knie. Er deutete noch einmal, und da sah ich es: ein winziges Aufblitzen von Licht unten am Hügel. Darauf hatten wir gewartet. Langsam entsicherte ich meine Schrotflinte, während wir den Hügel hinab auf es zuliefen.
Wir nahmen unsere Position ein und bezogen Deckung hinter zwei großen Elefantenbäumen an einem Wildbach. Dann warteten wir geduldig. Das Adrenalin schoss uns heiß durch die Adern, als sich in dreißig Metern Entfernung zwei Gestalten aus dem Dunkel schälten. Sie sahen uns und fingen an, zu laufen. Wild feuernd rannten sie direkt auf Nkonka zu. Dieser verließ seine Deckung, stand auf und schoss aus der Hüfte mit seinem Lee-Enfield-Repetiergewehr Kaliber .303. Die Hölle brach los, als die Nacht in lauten Schüssen und Schreien explodierte. Es fühlte sich an wie eine Ewigkeit, dauerte aber wohl höchstens zehn Sekunden. Ich schwang meine Schrotflinte hin und her, immer nach einem Ziel Ausschau haltend, aber von meinem Standpunkt aus waren nur Schatten zu sehen. Ich konnte nicht einfach losfeuern, sonst hätte ich vielleicht Nkonka verletzt.
Plötzlich Stille. Sie waren fort, in den Busch abgetaucht.
»Nkonka!«, flüsterte ich. »Alles okay mit dir?«
»Yebo, Mkhulu. Alles gut.« Es war ein Wunder. Er war voll in den Kugelhagel geraten und erwiderte ihr Feuer mit einem Gewehr, das jedes Mal manuell nachgeladen werden musste. Und er hatte nicht eine Schramme abbekommen.
»Gott sei Dank. Gut gemacht.«
Bheki und Thulani kamen auf uns zugelaufen. Ich sah Bheki an, wie enttäuscht er war, dass er das Ganze verpasst hatte.
»Schaut mal«, sagte Nkonka. Der Kegel seiner Taschenlampe fiel auf eine Blutlache. Einer der Wilderer war verwundet.
»Los«, meinte Bheki. Er schaltete die Taschenlampe ein und folgte der Spur. Manchmal verlor er sie, dann mussten wir nochmal zurücklaufen, um sie wieder aufzunehmen.
Aber selbst im hellen Licht des Mondes war es schwer, sich einen Weg durchs Gelände zu bahnen, und auf dem harten Boden hielten sich kaum Spuren, weshalb wir widerstrebend beschlossen, nach Hause zu fahren.
Am nächsten Morgen schickte ich Bheki raus. Er sollte sehen, ob er die Spur wiederaufnehmen konnte. Tatsächlich verfolgte er sie zu einem Loch im Zaun, durch das die Wilderer entkommen waren. Seiner Ansicht nach waren es drei.
Dann zeigte er mir noch etwas – eine der Fußspuren passte exakt zu der, die wir vor wenigen Tagen verfolgt hatten. Es war also dieselbe Bande, die unser gespendetes Nashorn getötet hatte. Unsere Hoffnungen hatten sich erfüllt, obwohl ich es kaum glauben konnte, dass die Wilderer so dreist waren, so schnell wieder zurückzukommen, um noch ein Tier zu erlegen. Offensichtlich waren sie hinter Heidi her.
Nkonkas Schüsse hatten das Feuergefecht für uns entschieden und der Bande zumindest einen Verlust zugefügt. Nun war klar: Thula Thula war gewappnet für jeden, der dort Elefanten oder Nashörner töten wollte.
2
Etwa eine Woche später, ich war gerade in der Safari Lodge, läutete das Telefon.
Am Apparat war Julie Laurenz, eine der Top-Fernsehjournalistinnen Südafrikas. Sie lebt mit ihrem Mann, dem Fotografen Christopher, in Durban, einem der schönsten Ferienorte Südafrikas, ungefähr zwei Autostunden südlich von Thula Thula gelegen. Die beiden arbeiteten an einem Artikel über die Nashornwilderei in Südafrika und hatten von dem Tier gehört, das in unserem Reservat umgekommen war, und auch von Nkonkas mutigem Feuergefecht. Ich berichtete kurz, was passiert war, und wir sprachen über den Ernst der Lage. Nicht nur waren die Lieferwege nach Asien kürzer als je zuvor, weil Afrika immer mehr Handel mit dem Fernen Osten trieb. Julie erzählte mir auch, dass vermehrt professionelle Banden ihr Unwesen trieben, die die Tiere zuerst vom Hubschrauber aus betäubten und dann mit Automatikwaffen erledigten. Die Hörner wurden zwischen legalen Waren versteckt außer Landes geschmuggelt – nicht selten, so hieß es, auch in Diplomatenköfferchen.
Als Journalistin an vorderster Front besaß Julie immer die aktuellsten Informationen. Von ihr erfuhr ich etwas, das mir das Blut in den Adern gefrieren ließ: Sie hatte glaubwürdige Berichte erhalten, wonach es nicht einmal mehr fünfzehn wild lebende Nördliche Breitmaulnashörner gab. Und diese wenigen noch existierenden Exemplare lebten im Garamba-Nationalpark in der Demokratischen Republik Kongo (DR Kongo). Der Nationalpark liegt im Nordosten des Landes, an der Grenze zum Sudan. Etwa dreitausendfünfhundert Kilometer von hier entfernt.
Ich wusste, dass das Nördliche Breitmaulnashorn schon seit einiger Zeit gefährdet war, aber nicht einmal mehr fünfzehn Exemplare?
»Sind Sie sicher, dass die Zahl stimmt?«, fragte ich.
»Ja, möglicherweise sind es sogar noch weniger«, antwortete Julie. »Die Behörden lassen den Nationalpark im Stich. Wenn kein Wunder geschieht, ist hier Schicht im Schacht.«
Ich dankte Julie und legte auf. Wieder eine wichtige Lebensform verschwunden, dachte ich, während der Rest der Welt nicht einmal mit der Wimper zuckt. Das Nördliche Breitmaulnashorn existierte schon seit Millionen von Jahren, sein Lebensraum hatte sich quer über das Zentrum Afrikas, den Tschad, die Zentralafrikanische Republik, den Kongo, Sudan und Uganda erstreckt. Und nun gab es nur noch fünfzehn Exemplare, die einen wahren Holocaust überlebt hatten. Diese Nachricht erschütterte mich.
In Südafrika lebt das Südliche Breitmaulnashorn, wie unsere Heidi eines ist. Es sieht fast genauso aus wie sein nördlicher Verwandter, unterscheidet sich jedoch genetisch von ihm. Das Südliche Breitmaulnashorn stand bis vor Kurzem ebenfalls vor der Ausrottung. In den 1960er-Jahren gab es nicht einmal mehr fünfhundert Exemplare, die in dem weltweit bekannten Umfolozi-Nationalpark in der Provinz KwaZulu-Natal lebten.
Dann kam der vermutlich beeindruckendste Naturschützer aller Zeiten hierher: Dr. Ian Player, ein absolut furchtloser Mensch, dem die Wildnis sozusagen im Blut steckte, mehr als jedem anderen, den ich je kannte. Player leitete das Umfolozi-Reservat. Er scharte eine Reihe nicht minder furchtloser Männer um sich und rief die »Operation Rhino« aus, um die letzten Tiere zu retten. Auf seinem Kreuzzug zur Rettung dieser wunderbaren Geschöpfe legte er eine gewisse Verachtung für bürokratischen Klinkerkram an den Tag und verfolgte Wilderer gnadenlos. Dank seines Muts und seiner Vision konnte der Genpool erhalten werden. Heute leben unglaubliche dreiundneunzig Prozent der weltweiten Nashorn-Population in Südafrika.
Doch nun drohten die neuen Hightech-Wilderer Players Werk zu zerstören.
Das Bild, wie das abgeschlachtete Tier mit seinem knittrigen Gesicht und abgehackten Horn auf unserem Land lag, ließ mich nicht mehr los. Ich wusste, dass die Massaker auf dem Kontinent immer schlimmer wurden. Das trieb mich um. Wenn wir helfen konnten, die letzten Nördlichen Breitmaulnashörner zu retten, würden wir ein Beispiel setzen und den Genpool vielleicht erhalten können. Gut, es würde einige Generationen brauchen, bis er sich erholt hätte, aber diese wunderbare Gattung würde überleben.
Ich wusste, ich musste es versuchen.
Anfang 2006 liefen die Lodges in Thula, die meine Frau Françoise managte, sehr gut und warfen auch Geld ab. Die Projekte für die umliegenden Zuludörfer funktionierten und die von mir gegründete Naturschutzorganisation Lawrence Anthony Foundation expandierte. Sie wird auch heute noch von hoch motivierten Mitarbeitern geführt, denen das Wohlergehen des afrikanischen Tier- und Pflanzenreichs wichtiger ist als persönlicher Gewinn. Doch natürlich musste all das kontrolliert und verwaltet werden, und dieses neue Projekt würde mich viel Zeit kosten.
Aber manchmal muss man im Leben einfach loslegen. Wenn man dauernd nur herumsitzt und überlegt, passiert nie etwas. Das wurde mir plötzlich klar.
Ich rief also meine Söhne Jason und Dylan an, die eine Umweltschutzorganisation in Durban leiteten, und erklärte ihnen, was ich vorhatte. Wir wollten uns am nächsten Tag in Durban treffen.
Als ich in ihr Büro kam, hatten die beiden schon einiges organisiert. Grant Morgan, ein Logistikexperte, und Marga Marzalek, eine fähige Verwaltungskraft, schlossen sich uns an. Sie waren sofort einverstanden mit dem Projekt. Alle waren Feuer und Flamme für die Idee, die Nashörner vor dem Aussterben zu retten. Wir waren uns einig: Wir mussten es versuchen, weil es ein hehres, dringendes und lohnendes Projekt war. Also stellten wir erste Nachforschungen an, bemühten uns um Fundraising und um die Logistik des Ganzen, inklusive der behördlichen Genehmigungen, um die Nashörner zu fangen und sie in ein Schutzgebiet im Kongo oder nötigenfalls auch in Kenia oder Südafrika zu bringen.
Wir würden uns in den gesetzeslosen Teil Afrikas vorwagen, dorthin, wo es keine nennenswerte Verwaltung gab und wo es ständig zu Bürgerkriegen oder Stammesfehden kam. Die Demokratische Republik Kongo und ihre Nachbarn in der Gegend um die Afrikanischen Großen Seen waren nunmehr seit gut drei Jahrzehnten in Aufruhr. Das Leben dort war kurz, hart und grausam. Hier würden wir auf jeden Fall gut ausgebildetes Militär brauchen, um etwas zu erreichen. Das Projekt würde mit den Sicherheitsvorkehrungen stehen und fallen.
Und ich wusste genau, an wen ich mich diesbezüglich wenden musste: JP Fourie, einen ehemaligen Special-Forces-Agent mit einer großen Liebe zur Natur Afrikas. Mittlerweile war er ein erfolgreicher Geschäftsmann in der Luftfahrtbranche. Aber er hatte in Afrika immer noch gute Kontakte, vor allem in der DR Kongo. Und er wusste auf sich aufzupassen, wenn es hart auf hart kam. Wichtiger noch: Er wusste, wie man Ärger aus dem Weg ging.
»JP«, sagte ich, als ich ihn anrief. »Ich versuche gerade, ein Team zusammenzustellen, um die Ausrottung des Nördlichen Breitmaulnashorns im Kongo zu verhindern. Es gibt nur noch einige wenige Exemplare, und wenn die nicht überleben, ist es aus. Wir müssen in den Norden des Landes, ins Garamba-Reservat. Das ist Niemandsland, daher ist Sicherheit ein gewaltiges Problem. Ich brauche eine rechte Hand.«
»Hört sich gut an«, antwortete er. »Reden wir doch mal drüber.«
Jason und ich nahmen sofort einen Flug nach Pretoria, Südafrikas schöne Hauptstadt im Norden des Landes, wo wir JP treffen wollten.
Mit seinen sechsunddreißig Jahren sah er auf eine raue Weise gut aus. Muskulöse ein Meter achtzig, grüne Augen und lockiges braunes Haar. Seine immer noch soldatische Disziplin verband sich mit dem Scharfsinn des Geschäftsmanns und einem warmherzigen Sinn für Humor, den er allerdings für Freunde aufsparte. Er war von oben bis unten ein Profi.
Er dachte kurz darüber nach, was wir von ihm wollten: in einen gewaltgebeutelten Teil der Welt zu reisen, um Tiere zu retten, und das ohne jede Garantie auf Erfolg.
»Diese verdammt armen Nashörner«, sagte er mit seinem stark vom Afrikaans geprägten Akzent. Sein Blick wanderte über den gut besuchten Biergarten, in dem wir uns verabredet hatten. »Da müssen wir ernst machen, Lawrence. Das ist kein Cowboyabenteuer. Ich habe ein paar Anrufe getätigt, dort sind kriminelle Banden unterwegs. Mitten im Niemandsland. Es gibt keine Polizei, keine Armee, kein Gesetz, kein Nichts. Dafür Rebellen, aufständische Stämme und alle haben sie Maschinengewehre. Ich habe gehört, dass man die Naturschützer mit Gewalt aus Garamba vertrieben hat. Aufseher, Wildhüter, Manager, Verwaltungsmitarbeiter – sie sind weg, weil es für sie zu gefährlich war. Das ist ein Paradies für Wilderer, wie es im Buche steht.«
»Ja, das habe ich auch gehört.«
»Sie versuchen jetzt zwar, wieder zurückzukehren, aber ansonsten war lange Zeit niemand vor Ort.«
JP fuhr fort und zählte nacheinander die einzelnen Probleme an seinen Fingern ab: »Zunächst einmal brauchen wir ein Flugzeug und einen Hubschrauber. Dann müssen wir überlegen, wie wir die Treibstoffversorgung organisieren. Im Umkreis von achthundert Kilometern gibt es keine Möglichkeit, Flugzeuge aufzutanken. Also werden die Versorgungswege relativ lang sein. Wir können keine Gewehre einführen, folglich müssen wir sie vor Ort besorgen. Das lässt sich aber arrangieren.«
Er atmete kurz durch. »Es wäre verrückt, zu versuchen, über Uganda in den Kongo zu kommen. Auf dem Weg stoßen wir direkt auf das Gebiet, das von der Lord’s Resistance Army (LRA) kontrolliert wird. Das sind schwer bewaffnete Guerillakämpfer aus Uganda, die Yoweri Museweni, den ugandischen Präsidenten, absetzen wollen. Sie sind im Norden und Osten des Garamba-Parks aktiv und wirklich eine fiese Truppe. Niemand weiß genau, wo sie sich aufhalten, und wenn du dich auch nur ein paar Meter auf ihr Gebiet vorwagst, schießen sie dein Flugzeug ab. Sie haben gerade zwei UN-Kampfhubschrauber außer Gefecht gesetzt. Das heißt, wir müssen den langen Weg nehmen, über den Süden und dann über Kinshasa. Der Flug von Kinshasa in den Garamba-Nationalpark dauert in einer kleinen Maschine etwa neun Stunden, falls wir einen Piloten finden, der verrückt genug ist, dorthin zu fliegen. Sobald wir drin sind, sind wir immer wieder für längere Zeit am Boden und damit angreifbar. Ich hab’s ja schon gesagt: Das ist echt verrückt.«
»Genau deshalb müssen wir es ja tun«, antwortete ich.
JP sah mich an und lächelte: »Meine Quellen sagen mir, dass es noch eine weitere Naturschutzorganisation gibt, die den Behörden der DR Kongo unter die Arme greifen will und vielleicht sogar schon vor Ort ist. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht, wie du siehst. Diese Leute haben vermutlich die besten Absichten, aber glaub mir, die werden alle Hände voll zu tun haben. Sie wissen nicht, was ihnen blüht. Wenn sie der LRA in die Hände fallen, ist das das Ende – für sie und für die Nashörner. Mann, ich weiß nicht mal, ob wir das schaffen werden.«
Er lehnte sich auf seinem Stuhl zurück und seufzte.
»Wir schaffen das«, sagte ich. »Wir müssen. Wenn wir scheitern, hat das Nördliche Breitmaulnashorn keine Chance. So einfach ist das. Dies ist die einmalige Chance, etwas wirklich Wichtiges und Wertvolles zu tun. Dieser Kampf lohnt sich.«
»Vielleicht«, gab er zurück und fuhr dann fort: »Wir werden einen Trupp der besten – und ich meine allerbesten – Kämpfer überhaupt brauchen. Wir brauchen Angriffswaffen, mindestens ein paar Heckler & Koch Sturmgewehre, MP3S-Maschinengewehre, Berettas und einen 20-mm-Granatwerfer. Vielleicht sogar ein paar RPG-Panzerbüchsen, wenn wir die Erlaubnis bekommen.«
JP sah mir direkt in die Augen. »Der einzige Grund, weshalb diese paar Nashörner noch am Leben sind, ist die Tatsache, dass sie tief im Busch leben und schwer zu finden sind. Wenn wir all diese Nashörner an einen Ort bringen, wird sich die Nachricht wie ein Lauffeuer verbreiten und wer weiß, wer sich dann dafür interessiert. Die Hörner sind ein Vermögen wert.«
»Wie sieht es überhaupt mit Geld aus?«, fragte er. »Das wird ganz schön was kosten.«
»Ich glaube, das bekomme ich hin. Sicher weiß ich das in ein paar Tagen.«
»Lawrence, bist du dir wirklich sicher, dass du das machen willst? Ich weiß, dass du wegen deiner Tiere auch vorher schon ein paar ziemlich heikle Situationen überstanden hast. Aber das ist noch mal eine ganz andere Sache.«
»Ich mache das«, entgegnete ich. »Ich muss diese Expedition einfach auf die Beine stellen.«
»Wie lange wird es dauern?«
»Nun, wir müssen rein und ein Basislager aufschlagen«, antwortete ich. »Dann müssen wir per Hubschrauber die noch verbliebenen Nashörner aufspüren. Es ist ein ziemlich großes Gebiet, also werden wir vermutlich eine Woche brauchen. Dann müssen wir sie betäuben und in einen sicheren Pferch schaffen, eine Boma. Die sollte so nah wie möglich an der Landebahn sein. Und wir brauchen einen Hubschrauber, der schwere Lasten transportieren kann, um die Tiere dorthin zu bringen. Sobald sie sich alle in der Boma befinden und gesundheitlich stabil sind, bringen wir sie in ein Transportflugzeug, das groß genug ist – so was wie eine C-130 –, und fliegen sie raus. Also drei bis vier Wochen insgesamt. Wenn alles glatt geht.«
JP sagte gut eineinhalb Minuten lang kein Wort. Ich schwieg ebenfalls. Er brauchte Zeit, um seine Entscheidung zu treffen, und ich wollte ihn dabei nicht drängen. Dann stand er langsam auf, sah mir wieder direkt in die Augen und streckte mir seine Hand entgegen.
»Okay«, kam es von ihm. »Wenn du das durchziehst, bin ich mit dabei. Du besorgst das Geld. Und ich werde für deine Sicherheit sorgen, während du deine Nashörner fängst.«
Wir umarmten uns. Das war wirklich kein kleiner Gefallen.
JP liebte Abenteuer, und er liebte die Wildnis – beides würde ihm das Kongoprojekt bieten, und zwar im Überfluss. Er hatte auch gute Kontakte zur Botschaft der DR Kongo, was ein nicht zu unterschätzender Vorteil war. Dass ich einen Vollprofi wie ihn für mein Projekt gewinnen konnte, hob meine Lebensgeister ganz beträchtlich, und so fuhr ich zurück nach Thula, geradezu beseelt von meinem Plan.
Unsere Unternehmung bestand also aus zwei operativen Einheiten: der Expedition selbst und dem Backup-Team, das von zu Hause in Südafrika für den Nachschub und die Logistik sorgen würde. Jason, mein ältester Sohn, würde die Expedition begleiten, JP sich um die Security kümmern und ich mich um die Tiere. Ich würde die Betäubung und das Einfangen beaufsichtigen, was zudem hieß, dass wir einen guten Wildtierarzt brauchten. Dylan, mein jüngerer Sohn, würde hierbleiben, um die gesamte Operation zu leiten und unsere Aktivitäten zu koordinieren. Grant Morgan war für die Logistik zuständig, für den Nachschub und die Ausrüstung, Marga für Kommunikation und Verwaltung.
Als ich zu Hause eintraf, überbrachte Jason mir weitere gute Nachrichten. Der Bergbaukonzern BHP Billiton interessierte sich für unser Vorhaben und stellte uns erhebliche Mittel zur Verfügung.
Die Politik der »Kooperativen Ökologie«, die wir vertraten, machte sich nun bezahlt. Wir glaubten, dass die kategorische Dämonisierung von Wirtschaft und Industrie, die für die grüne Bewegung in der Vergangenheit typisch war, ein Ende haben musste. Die Menschen auf diesem Planeten müssen leben können. Das heißt, dass beide Seiten ein besseres gegenseitiges Verständnis entwickeln müssen, aber auch eine höhere Wertschätzung der Natur. Wenn die Tierrechtler sich gegen die Bergbaukonzerne wenden, dann müssten sie logischerweise in ihrem Leben auch auf alles aus Metall oder Glas verzichten. Die Achtung der Biodiversität muss ein Teil der Industrie werden, und natürlich müssen kritische Bereiche vor Ausbeutung geschützt werden. Aber dazwischen bleibt immer noch genug Raum für Kooperation und Kompromisse.
Mein nächster Termin war mit Dr. Ian Raper, hochkompetenter Präsident der South Africa Association for the Advancement of Science (S2A3), Afrikas ältester Akademie der Wissenschaft. Ian, der in Pretoria lebte, hatte ausgezeichnete Kontakte zur afrikanischen Wissenschaftswelt. Und die konnten wir wirklich gebrauchen.
»Das ist eine absolut unerlässliche Unternehmung«, meinte er, nachdem wir uns lange über meine Pläne unterhalten hatten. »Viel wichtiger noch, als ich anfangs dachte. Ich werde einen Brief an die Regierung der DR Kongo richten und empfehlen, dass sie euch unterstützt und zu dem Projekt beiträgt. Und ich werde mit unserer Regierung reden. Das ist mehr als eine simple Rettungsaktion. Hier braucht es eine dauerhafte Kooperation zwischen der DR Kongo und Südafrika. Nach der Aktion werde ich vorschlagen, dass unsere Organisation Stipendien ausschreibt, damit engagierte Studenten in den Regionen um den Nationalpark arbeiten können.«
Nach diesem Gespräch wusste ich, dass das alles tatsächlich klappen konnte.
Zehn Tage später waren Jason und ich wieder in Pretoria, um JP und Ian zu treffen. Wir vier suchten die Botschaft der DR Kongo auf und sprachen mit dem Botschafter Bene M’Poko. Wie das bei afrikanischen Führungskräften so häufig der Fall ist, war auch er gekleidet wie aus dem Ei gepellt. Sein schicker europäischer Anzug bildete einen scharfen Kontrast zu meinem Khaki-Buschanzug. Er hatte etwas Ernsthaftes und Würdevolles an sich, was mir Vertrauen einflößte, denn wir würden ja so heikle Themen wie die Anarchie im Garamba-Park ansprechen müssen und ihre Auswirkung auf unser Projekt.
»Der Garamba-Nationalpark wurde von unserem Management verlassen«, meinte der Botschafter, nach den Vorstellungen und dem unvermeidlichen Small Talk. »Wir werden zurückkehren, und wir haben auch schon eine Naturschutzorganisation, die uns dabei hilft. Aber die Umstände dort sind immer noch schwierig, und wir können jede Hilfe gebrauchen, die wir bekommen können. Die Situation der Nashörner ist wirklich kritisch und, wie Sie wissen, haben wir ernsthafte Sicherheitsbedenken.«
Er hielt inne und goss uns aus einem sehr zarten und repräsentativen Porzellanservice Tee ein.
»Wir haben von Ihrer Organisation gehört. Wir wissen von Ihrer Arbeit für die Wildtiere im Irak, als die Koalition der Willigen dort einfiel. Und wir haben Ihre Dokumentation mit Interesse gelesen«, meinte er und legte die Hand auf unsere Projektbeschreibung, die vor ihm auf dem Tisch lag. »Im Übrigen hat unsere Regierung auch von dem Präsidenten Ihrer Akademie der Wissenschaften einen Brief erhalten«, fügte er an und nickte Ian zu.
Er lehnte sich zurück.
»Ihr Hilfsangebot ist sehr willkommen. Es kommt gerade zur rechten Zeit. Ich habe das mit unserem Umweltminister besprochen. Die Initiative ist genehmigt, und alles ist bereit, damit Sie den Minister in Kinshasa aufsuchen können, der Sie mit seinen Mitarbeitern bekannt machen wird. Gleich danach werden Sie eine erste Reise nach Garamba unternehmen können, um die Lage zu überprüfen. Das Ministerium wird Sie dabei unterstützen. Ich habe mit meinen Kollegen in Ihrer Regierung Kontakt aufgenommen. Es handelt sich dabei um eine gemeinsame Operation unserer beiden Länder. Sind Sie damit einverstanden, meine Herren?«
Waren wir. Alle standen auf und schüttelten einander die Hände. Ich persönlich fand ja, es wäre passender gewesen, wir hätten uns abgeklatscht, aber wir waren ja schließlich in einer Botschaft. Wir hatten das Projekt in Rekordzeit auf die Beine gestellt und nun war der Startschuss gefallen.
Ich hätte wissen sollen, dass die Dinge in Afrika selten so einfach waren.
3
Ich kam gerade rechtzeitig zum Frühstück nach Thula Thula zurück. Meine französische Frau Françoise erwartete mich wie immer mit strahlendem Gesicht.
Wir hatten uns zufällig kennengelernt, als wir beide vor zwanzig Jahren in London ein Taxi anhielten. Seitdem hatte sie eine bemerkenswerte Veränderung durchgemacht, von den Straßen und Bistros des kosmopolitischen Paris in den afrikanischen Busch. Und doch: Je länger sie in Afrika lebte, desto stärker schien ihr französischer Akzent zu werden.
Hinter Françoise kamen die Hunde angelaufen. Bijou, ihr frecher kleiner Malteser, in unserer häuslichen Hackordnung direkt über mir stehend, ließ sich dazu herab, kurz von mir Notiz zu nehmen. Bijou glaubte, nicht ganz zu Unrecht, dass sie, was Françoise anging, die wichtigste Lebensform im Reservat war, und benahm sich entsprechend.
Der Nächste, der mich begrüßte, war Big Jeff, der dabei deutlich mehr Begeisterung an den Tag legte als Bijou. Jeff ist vermutlich eine Kreuzung aus einem Labrador und einem Seehund. Zumindest sieht er so aus und benimmt sich so. Wir haben ihn vor seinen brutalen Haltern gerettet, und er dankt uns das mit bedingungsloser Treue und Loyalität, die er uns meist entspannt von seinem Lieblingsplatz am Swimmingpool aus erweist. Ich habe schon überlegt, ob ich ihn nicht zum Wettbewerb um den schläfrigsten Hund aller Zeiten anmelden sollte, aber das wäre unfair den anderen Bewerbern gegenüber.
Und dann gab es noch Gypsy, einen schwarzen Rettungshund, den wir von der Gesellschaft zur Verhütung von Grausamkeit gegenüber Tieren bekommen haben. Gypsy war ein ganz wunderbarer Mischling, eine Promenadenmischung mit einem Herzen so groß wie Afrika. Sie schlief auf unserem Bett und brachte die Nacht meist damit zu, so lange herumzurollen, bis ihr Hinterteil genau in mein Gesicht starrte. Ihr ganz persönliches Guten-Morgen-Geschenk.
So bunt gemischt unser Hunderudel auch war, wir liebten sie alle. Meine beiden Söhne Jason und Dylan stammen aus einer früheren Ehe, aber Françoise hatte nie Kinder gehabt. Bijou, Jeff und Gypsy waren ihre Familie in Südafrika. Sie behandelte uns alle gleich, zumindest fast. Wenn ich zum Kühlschrank pilgerte, um zu gucken, was es zum Abendessen gab, war ich mir nie ganz sicher, was für uns war und was für die Hunde. Manchmal entschied ich mich für das Hundefutter. Françoise ist eine ganz wunderbare französische Köchin – die Beste der Welt, wenn man mich fragt. Daher beschwert sich hier niemand.
Max, meinen wunderbaren Staffordshire Terrier, der vor einigen Jahren gestorben war, hatten wir ganz in der Nähe von unserem Cottage beerdigt. Ich dachte oft an ihn, an seinen Mut und die wundervollen Buschabenteuer, die wir gemeinsam erlebt hatten. Wäre Max noch am Leben, hätte er mich im Jahr zuvor zum Schusswechsel mit den Wilderern begleitet. Bei der kleinsten Gelegenheit hätte er seine Zähne in eines der Wildererbeine geschlagen. Und Staffies lassen niemals wieder los.
Nach einem köstlichen französischen Frühstück (mittlerweile habe ich mich an Croque Monsieur und Croissants gewöhnt) fiel ich ins Bett und schlief wie ein Stein. Ich hatte heute Nacht wieder Dienst. Die Patrouillen würden nicht mehr enden, bis wir entweder die Wilderer gefasst hatten oder sie die Gegend verließen.
Es waren hektische Wochen gewesen, vom Feuergefecht mit den Wilderern bis hin zum Plan für die Rettung der Nashörner aus dem Kongo. Als ich aufwachte, beschloss ich, mir einen Nachmittag freizunehmen und zur Abwechslung mal tagsüber in den Busch zu fahren. Ich steuerte die abgelegenste Ecke von Thula Thula an, ließ den Landrover stehen und wanderte durch die Savanne zu meinem Lieblingsplatz am Ufer des Nseleni-Flusses.
Die Sicherheit des Fahrzeugs aufzugeben und allein und unbewaffnet in den Busch vorzudringen, gibt dem Leben gleich eine neue Perspektive. Plötzlich sind Sie vollkommen von der Menschheit isoliert und tauchen ein in die lebendige Wildnis. In eine ursprüngliche Welt. Manche Menschen reagieren darauf angespannt, andere genießen es. An jenem Tag war es genau das, was ich brauchte.
Der alte Fluss schleppte sich träge durch sein Bett. Da und dort bildeten sich Wasserbecken. Die rutschigen, schlammigen Ufer schoben sich aus dem wirren Unterholz hinein ins dunkle, stille Wasser.
Eine eiserne Regel in Afrika lautet, jeden Wasserlauf als potenzielle Heimat von Nilkrokodilen zu betrachten. Ich suchte mir also einen bequemen, hochgelegenen Felsen am Ufer, von dem aus ich die Wasserbecken überschauen konnte. Und dann sog ich die Umgebung ein. Es war ein strahlend heißer afrikanischer Tag unter einem azurblauen Himmel, an dem da und dort strahlend weiße Nimbuswölkchen standen wie Wattebauschen. Nicht genug für Regen, aber gerade so viel, um der Hitze den Stachel zu nehmen. Einen Augenblick lang überlegte ich, wie lange wir schon kein Gewitter mehr gehabt hatten, das den Boden durchtränkt hätte. Aber der Tag war vollkommen, und so hörte ich auf, mir Sorgen zu machen.
An einem Fluss müssen Sie sich so lange still verhalten, bis seine Bewohner merken, dass Sie ihnen nichts Böses wollen. Sobald Sie akzeptiert werden, nimmt das Leben munter wieder seinen Gang auf.
Den Anfang machen immer die Frösche. In der Nahrungskette ganz unten zu stehen hat so seine Herausforderungen, vor allem, wenn das laute Gequake, das eigentlich Paarungspartner anlocken soll, Fressfeinde per Audiosignal zu ihrem Versteck lotst. Daher haben die Frösche eine kluge Verteidigungsstrategie entwickelt. Sie hocken zusammen im Schilfbett und posaunen ihre Rufe so laut in die Welt hinaus, dass sich ein geheimnisvolles Echo entwickelt. Dieser Widerhall verbirgt ihre genaue Position vor Vögeln, Eidechsen und Welsen, welche die Frösche nur zu gern verspeisen würden, würden sie nur ihr Versteck kennen. Nur die Weibchen fallen nicht auf die akustische Irreführung herein.
Als Nächstes kamen zierliche metallisch-blaue Malachit-Eisvögel heraus, die über den Becken schwebten und herumschwirrten, das Wasser beim Eintauchen kräuselten und manchmal mit einer dicken Kaulquappe oder, wenn sie Glück hatten, einer winzigen Brasse wieder an die Oberfläche kamen. Libellen in leuchtendem Orange, Blau, Grün und tiefstem Schwarz flatterten mit ihren transparenten Flügeln. Wie immer spähte der Hammerkopf im seichten Wasser nach Beute. Seine scharfen Augen hinter dem mitleidlosen Schnabel glitten über die glatte Oberfläche. Der legendäre Wasservogel mit der braunroten Federhaube baut große Baumnester aus Schlamm und Zweigen, die das Gewicht eines Mannes tragen können. Ein eher makabrer Aberglauben der Zulu besagt, dass wenn während eines Sturms ein Hammerkopf auf einem Hausdach landet, bald jemand aus der Familie sterben wird.
Ein kleiner Wirbel im Wasser verriet mir das erste Krokodil. Es hatte meine Ankunft bemerkt und war leise mit seinem ganzen Reptilienkörper untergetaucht. Ich konnte es unter Wasser sehen, ein riesiger Schatten unter der Oberfläche, der sich langsam näherte, wohl in der Hoffnung, ich könnte ihm als Mittagessen dienen. Mir lief es kalt über den Rücken. Ganz egal, wie viele Krokodile ich schon gesehen hatte, sie lösten in mir stets eine geradezu absurde Faszination aus. Mittlerweile aber sterben sie in Afrika zu Hunderten, weil der Mensch immer weiter in ihren Lebensraum vordringt. Daher könnten auch sie bald auf der Liste der vom Aussterben bedrohten Tierarten stehen. In Thula Thula werden sie geschützt, wie jede Tierart. Irgendwann beschloss mein Krokodil, dass ich wohl außer Reichweite war. Allerdings blieb es im Schilf, denn es könnte ja sein, dass ich irgendwas Dummes anstellte wie zum Beispiel mich nahe ans Ufer zu begeben. Das wäre dann so ziemlich das Letzte, was ich in diesem Leben tun würde.
Zwei Sumpfschildkröten, ufudu, wie die Zulu sie nennen, schoben sich in eines der Wasserbecken vor, um zu sehen, ob sie irgendwo Würmer oder andere Schildkrötenleckerbissen finden würden. Alle Tiere, selbst Krokodile, gehen ihnen aus dem Weg, denn sie sind sozusagen die Stinktiere des Wassers. Sie bespritzen Fressfeinde mit übel riechendem Urin, den man nicht einmal mit Karbolseife so einfach wieder abbekommt.
Das geschäftige Leben am Fluss bezauberte mich für ein paar Stunden und linderte den Stress der vergangenen Tage. Vollkommen in die Wildnis einzutauchen ist die reinste und natürlichste Therapieform überhaupt. Und das Beste: Sie müssen nichts weiter tun, als präsent zu sein. Was Sie dort sehen und hören, ist Balsam für die Seele, und die Düfte des afrikanischen Buschs sind Aromatherapie pur.
Dann kamen einige der großen Jungs des Buschlandes vorbei. Eine Herde riesiger, erhitzter und staubiger Afrikanischer Büffel kamen sehr viel leiser, als man denken würde, näher. Sie nahmen das größte Wasserbecken in Beschlag, drängten bis zum Bauch ins Wasser und stillten mit absoluter Krokodilverachtung ihren Durst. Ich sah mich kurz um und merkte mir, wo der nächste Baum stand, auf den ich klettern konnte, falls sie mir zu nahe kämen. Aber sie interessierten sich kein bisschen für mich und zogen ihrer Wege.
Und manchmal hat man einfach riesengroßes Glück. In einem Seitenarm des Flusses erkannte ich eine schwache Bewegung und beugte mich vor. Ich erkannte die Form zunächst kaum, dann konnte ich es fast nicht glauben. Voilà! Eine Python unter Wasser, den langen Körper reglos im Ried. Nur ihre Nasenspitze lugte heraus. Möglicherweise lauerte sie dort schon seit Tagen, unbeweglich und mit einer Geduld, die in der Natur ihresgleichen sucht, auf die richtige Beute und den richtigen Augenblick. Dann würde sie zuschlagen, schnell und tödlich, indem sie viereinhalb Meter tödliche Muskeln um ihr Opfer schlang und innerhalb weniger Minuten alles Leben aus ihm herausquetschte. Je nachdem, wie groß ihre Beute ausfiel, würde sie wochenlang, manchmal sogar monatelang, nichts mehr zu essen brauchen.
Zeiten wie diese machten mir immer wieder deutlich, wie wichtig die Naturschutzprogramme waren, die wir vor Ort durchführten. Ohne diese Bildungsangebote wäre diese wunderbare Welt, die vor meinen Augen lag, innerhalb weniger Generationen verschwunden. Doch selbst diese Programme boten keine Garantie.
Der faule Nachmittag hatte ein Ende, als ich plötzlich spürte, dass etwas nicht stimmte. Ein Prickeln auf der Haut sagte mir, dass ich beobachtet wurde. Ich habe es aufgegeben, diese instinktiven Gefühle infrage zu stellen, dieses von der Natur eingebaute Alarmsystem. Also setzte ich mich auf der Stelle auf und sah mich um, suchte jeden Baum, Busch und Strauch nach etwas Unüblichem ab. Nichts.
Unzufrieden stand ich auf und drehte mich halb um, um einen Blick hinter mich zu werfen. Und erstarrte zur Salzsäule. Hinter mir, keine zwanzig Meter entfernt, standen zwei massige, schlammbedeckte Büffelbullen, die wir Dagga Boys nennen. Sie gehören unbestreitbar zu den gefährlichsten Tieren Afrikas – und sie musterten mich aufmerksam. Ich brach den Augenkontakt sofort ab und sah weg. Ich zwang mich, vollkommen reglos zu bleiben, während mein Gehirn die Alternativen durchspielte.
Eigentlich hatte ich keine. Sie standen zu nah an dem Fluchtbaum, den ich mir ausgesucht hatte. Diese Option fiel also schon mal flach. Auf der anderen Seite das wenig einladende dichte Unterholz des Flusses. Auch kein Fluchtweg. Der einzige Weg, der mir offenstand, war der zum glitschigen Flussufer, wo das Krokodil immer noch lauerte. Und um meine nicht gerade beneidenswerte Lage noch zu zementieren, wurde mir klar, dass ich, selbst wenn ich unbeschadet am Kroko vorbeikäme, mitten zwischen den anderen Tieren der Büffelherde landen würde.
Ich tat das Einzige, was ich tun konnte. Ich drehte mich sehr, sehr langsam um und ging von den Büffeln weg Richtung Ufer, so weit, wie ich sicher gehen konnte. Dort ging ich in die Hocke, lauschte auf Signale eines bevorstehenden Angriffs und behielt das Wasser im Auge, falls das Krokodil näherkommen sollte.
Nichts geschah. Sie waren nicht aggressiv, nur neugierig, was ich in ihrem Revier so trieb. Sobald ich mich ihnen gegenüber respektvoll verhielt, trabten sie wieder davon und schlossen sich der Herde an. Mein Herz klopfte mir bis zum Hals, und ich musste mich ermahnen, nie wieder mein Gewehr im Wagen zu lassen. Nicht um zu töten. Oft reicht ein Warnschuss, um ein gefährliches Tier zu verscheuchen, sodass man dann schnell abhauen kann. Aber eine Feuerwaffe ist in dieser Umgebung so ein fremdartiges Gerät, dass ich so etwas nicht gerne mit mir herumschleppte.
Die Sonne stand schon tief, als ich mich widerwillig vom Fluss löste und zum Landrover zurückging.
In Zululand gibt es kein langsames Hinüberdämmern in die Nacht wie in den höheren Breitengraden. Die Dämmerung dauert nur kurz. Die Sonne geht in einem Farbenrausch unter, der einem fast das Herz stehen bleiben lässt. Und zack, ist es dunkel. Als die letzten Sonnenstrahlen lachsrosa übers Land glitten, kam ich allmählich zurück in die wirkliche Welt und wollte gerade den Landrover anlassen.
Da hörte ich einen Knall wie von einem Gewehrschuss. Ich drehte mich um und sah, wie der Wipfel einer riesigen Akazie im Todeskampf hin und her wippte. Dann brach er ab und fiel in einem Wirbel von Zweigen und Blättern nach unten.
Elefanten. Kein anderes Tier auf der Welt bringt so etwas fertig. Kein Landsäugetier ist so stark, nicht im Entferntesten. Die Herde war ganz in der Nähe.
Ich streckte die Hand aus dem Fenster, um den Luftzug zu fühlen. Eine sanfte Brise aus Südwest platzierte mich sicher gegen den Wind, sodass neugierig schnuppernde Rüssel mich nicht aufspüren konnten. Ich stieg aus, verlangsamte meinen Schritt ganz bewusst auf Elefantengeschwindigkeit und wartete. Fünf Minuten später hatte ich Glück. Nana, die Matriarchin der Herde, tauchte mit ihrem massigen Körper langsam aus dem Baumbestand auf, hob den Rüssel und prüfte die Witterung.
Ich hielt den Atem an angesichts dieses wundervollen Geschöpfes, das mir so viel über ihre Art beigebracht hatte.
Doch selbst in der hereinbrechenden Nacht konnte ich sehen, dass da etwas nicht stimmte. Nana ließ die Herde zurück, um von dem gefällten Baum zu fressen, und verließ das Dickicht. Sie schien rechterhand ein wenig Schlagseite zu haben.
Dann kam Frankie heraus, die Nummer Zwei der Herde, und nahm ihren Platz neben Nana ein. Sie wandte ihr den Kopf zu, die beiden mächtigen Häupter hatten höchstens dreißig Zentimeter Abstand. So blieben sie lange Zeit stehen, völlig bewegungslos, als würden sie meditieren. Dann drehte Frankie sich so langsam um, als ließe sie sich von der Eigendynamik ihrer fünf Tonnen Gewicht ziehen. Sie nahm nun die Führungsposition ein. Nana folgte ihr, und der Rest der Herde versammelte sich hinter den beiden.
Das hatte ich wirklich noch nie gesehen. Nana war die Matriarchin. Sie leitete die Herde. Als Führungsgestalt war sie immer deutlich sichtbar. Sie diktierte jede Bewegung, die die anderen machten.
Hatte es etwa einen Staatsstreich gegeben? Oder war Frankie gerade in einem uralten Dickhäuterritual zur Nachfolgerin bestimmt worden?
Das schien doch recht unwahrscheinlich. Nana war eine allseits respektierte und bewunderte Leitkuh. Ihre Entscheidungen – stets weise und wohlwollend – waren Gesetz. Frankie mochte die sprunghafteste und aufbrausendste der Gruppe sein, aber sie würde nie Nanas Autorität infrage stellen.
Ich sah zu, wie die Gruppe sich ihren Weg über die Lichtung bahnte. Ihre gewaltigen Schultern hoben und senkten sich, bis der gezackte Horizont des Buschlands sie verschluckte. Vielleicht täuschte ich mich ja, aber es schien, als ob ET, eine der jüngeren Elefantenkühe, Nana immer wieder anstupste, damit sie in die richtige Richtung ging. Auch das war noch nie da gewesen. Nana hatte noch nie Hilfe gebraucht. Tatsächlich war sie es gewesen, die die anderen immer unterstützt hatte. Nana war ET beigestanden, als die traumatisierte junge Elefantenkuh zur Herde kam. Sie trug am Ohr eine Marke, was bedeutete, dass man sie zum Abschuss freigegeben hatte. Glücklicherweise schafften wir es, die Lizenz des Jägers für ungültig erklären zu lassen. Wir konnten ET also gerade noch rechtzeitig retten.
Trotzdem war sie in schlechtem Zustand, als wir sie bekamen. Man hatte sie ganz allein in einem Reservat ausgesetzt, in dem sogenannte »Großwildjäger« die Big Five Afrikas abknallen konnten – Elefanten, Nashörner, Afrikanische Büffel, Löwen und Leoparden. Die Kleine schrie, bis sie heiser war. Als sie zu uns kam, war sie fast stumm. Ihre Stimmbänder waren für immer zerstört. Statt zu trompeten, stieß sie einen seltsam knarrenden Laut aus. Wir nannten sie »Enfant terrible« (französisch für »schlimmes Kind«, kurz »ET«), weil sie mich ständig angegriffen hatte, als sie nach Thula Thula kam. Sie hasste Menschen einfach. Erstaunlicherweise hatte Nana eingegriffen. Sie stellte sich ihr mit der vollen Breitseite ihres Körpers entgegen. Oder tappte mit dem Rüssel so lange auf ETs Stirn, bis die Jüngere lernte, dass ich ihr nichts tun würde. Dass sie nun Nana half, hatte eine ganz eigene Qualität.
Aber nun machte ich mir große Sorgen. Was war da los? Was war Nana passiert? War sie vielleicht verletzt? Oder krank? Nana war über die letzten zehn Jahre meine Freundin und Inspiration gewesen. Die Vorstellung, dass mit ihr etwas nicht stimmte, war schrecklich.
Mein Handy war stumm geschaltet, aber ich spürte, wie es in meiner Tasche vibrierte. Ich nahm es heraus und schaute auf die Nummer. Es war eine SMS von Françoise, die mir sagte, dass das Abendessen fertig war.