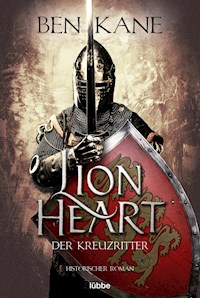9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Rom gegen Makedonien - zwei Imperien vor dem Abgrund
Griechenland, im Jahr 198 v. Chr. Er hat sich noch nicht von der Niederlage erholt, die ihm die Makedonier zugefügt haben. Dennoch zieht der römische Heerführer Flamininus seine Männer für den finalen Schlag gegen den übermächtigen Feind zusammen. Er und seine Legionäre wissen: Wer diesen Krieg gewinnt, wird über Griechenland herrschen. Das Imperium des Verlierers hingegen wird untergehen. Interne Machtkämpfe und die aufsässige Bevölkerung stellen Flamininus auf die Probe. Doch er ist bereit zu kämpfen, bis das letzte Schwert gefallen ist ...
Der Bestseller-Erfolg aus England - endlich auf Deutsch
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 707
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über dieses Buch
Über den Autor
Titel
Impressum
Widmung
Zitat
1. KAPITEL
2. KAPITEL
3. KAPITEL
4. KAPITEL
5. KAPITEL
6. KAPITEL
7. KAPITEL
8. KAPITEL
9. KAPITEL
10. KAPITEL
11. KAPITEL
12. KAPITEL
13. KAPITEL
14. KAPITEL
15. KAPITEL
16. KAPITEL
17. KAPITEL
18. KAPITEL
19. KAPITEL
20. KAPITEL
21. KAPITEL
22. KAPITEL
23. KAPITEL
24. KAPITEL
25. KAPITEL
26. KAPITEL
27. KAPITEL
28. KAPITEL
29. KAPITEL
30. KAPITEL
31. KAPITEL
32. KAPITEL
33. KAPITEL
34.KAPITEL
35. KAPITEL
36. KAPITEL
NACHBEMERKUNG
GLOSSAR
Über dieses Buch
Rom gegen Makedonien – zwei Imperien vor dem Abgrund
Griechenland, im Jahr 198 v. Chr. Er hat sich noch nicht von der Niederlage erholt, die ihm die Makedonier zugefügt haben. Dennoch zieht der römische Heerführer Flamininus seine Männer für den finalen Schlag gegen den übermächtigen Feind zusammen. Er und seine Legionäre wissen: Wer diesen Krieg gewinnt, wird über Griechenland herrschen. Das Imperium des Verlierers hingegen wird untergehen. Interne Machtkämpfe und die aufsässige Bevölkerung stellen Flamininus auf die Probe. Doch er ist bereit zu kämpfen, bis das letzte Schwert gefallen ist …
Der Bestseller-Erfolg aus England – endlich auf Deutsch
Über den Autor
Ben Kane wurde in Kenia geboren und wuchs in Irland auf, im Heimatland seiner Eltern. Bevor er sich ganz dem Schreiben widmete, arbeitete er als Tierarzt. Schon als Kind übte die Geschichte Roms eine große Faszination auf ihn aus, weshalb mit der Veröffentlichung seines Debüts »Die Vergessene Legion« ein lang gehegter Traum in Erfüllung ging. Mittlerweile ist Ben Kane Bestsellerautor und lebt mit seiner Familie in North Somerset, England.
BEN KANE
DAS LETZTE SCHWERT
HISTORISCHER ROMAN
Aus dem Englischen von Dr. Dietmar Schmidt
Vollständige E-Book-Ausgabedes in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Deutsche Erstausgabe
Für die Originalausgabe:Copyright © 2019 by Ben KaneTitel der englischen Originalausgabe: »The Falling Sword«Originalverlag: Orion Books, an imprint of The Orion Publishing Group Ltd
Für die deutschsprachige Ausgabe:Copyright © 2020 by Bastei Lübbe AG, KölnTextredaktion: Rainer Delfs, ScheeßelUmschlaggestaltung: Massimo Peter-BilleUnter Verwendung von Motiven von © Little Demon Creative und © blacksheep-uk.comE-Book-Produktion: two-up, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-8624-0
www.luebbe.dewww.lesejury.de
Für alle, die an Park in the Past* beteiligt sind, besonders Paul »Whirlwind« Harston von Roman Tours UK und sein ganzes Team
*Park in the Past befindet sich in Chester, Nordwestengland. Dort wird ein Fort wie aus dem 2. Jahrhundert v. Chr. gebaut. Interessiert? Schauen Sie sich die Website an: parkinthepast.org.uk/ – und wenn Sie es können, spenden Sie bitte auf: localgiving.co.uk/park-in-the-past. Herzlichen Dank!
Auf die Frage, wie er die Griechen im Zaum halte, antwortete Alexander der Große: »Indem ich nichts, was heute getan werden sollte, auf morgen verschiebe.«
1. KAPITEL
Nahe Elateia in Phokis, Herbst 198 v. Chr.
Obwohl das Jahr dahinschwand, badete warmes Sonnenlicht die schmale phokische Ebene. Im Norden wurde sie von Bergen begrenzt, auf deren anderer Seite die Thermopylen lagen, die »heißen Tore«, an denen Leonidas und seine Spartaner im Kampf gegen die Perser gefallen waren. Südlich dieser Bergspitzen breitete sich flaches Land aus, von einer Straße geteilt, die nun genauso wichtig war wie während der Persischen Kriege vor fast drei Jahrhunderten. Wiederum südlich lag Athen, ungeschützt gegen einen Angriff. Die Erntezeit war noch nicht lange vorbei, überall bedeckten noch goldene Stoppeln die Äcker. Stellenweise säumten ordentliche Reihen von Weinstöcken die Straße. Ihre schweren Trauben aus blau-purpurnen Beeren luden den durstigen Reisenden ein – oder den Soldaten.
Staubfahnen hingen in der Luft und kündeten vom Vormarsch des Heeres unter Titus Quinctius Flamininus. Seit seiner Niederlage vor der makedonischen Festung Atrax, achtzig Meilen nach Nordwesten entfernt, waren sechs Tage vergangen. Nachdem das Heer seine Toten begraben und die Verwundeten auf Wagen geladen oder zurückgelassen hatte, war es nach Südosten marschiert, um die römische Flotte zu schützen, die in der Nähe ankerte. Von den Geiern abgesehen, die in der Luft den Legionen folgten, waren nur wenige Geschöpfe unterwegs. Das Nahen eines solchen Heerbanns bedeutete vieles, nichts davon war gut. Die Bauern waren mit ihren Familien und ihrem Vieh geflohen. Die meisten hatten in Elateia Zuflucht gesucht, wo sich die ersten Einheiten aus Flamininus’ Legionen bereits aufstellten.
Die römische Vorhut war ausgeschwärmt und hatte einen Schutzschild gebildet, hinter dem sich das übrige Heer bewegte. Unter den Principes stand ein Mann mit freundlichem Gesicht namens Felix. Er hatte schwarze Haare und blasse Haut. Die meisten seiner Kameraden überragte Felix um Haupteslänge. Wie sein Bruder und seine Kameraden starrte auch er mit finsterem Groll auf die Mauern Elateias. Die Stadt, deren Verteidiger auf den Wällen standen, erinnerte die Legionäre mit Schärfe daran, dass der Krieg keineswegs vorüber war. Mancher von uns wird hier sterben, dachte Felix grimmig. Vielleicht nicht jeder, aber einige.
Weil ihr einstweiliger Centurio Livius nicht weit von ihnen stand, beschwerte sich keiner. Stattdessen stützten sich die Principes auf ihre Schilde, tranken verstohlen Wein und warteten – auf Befehle und das Verstreichen der Zeit.
Nichts würde vor dem kommenden Tag geschehen, sagte sich Felix. Nach der Reiterei und den Kundschaftern, die vor dem Heer marschierten, gehörte sein Manipel zu den ersten, die eintrafen, was bedeutete, dass wenigstens drei weitere Stunden vergingen, bevor das Ende der meilenlangen Kolonne aufgeholt hatte. Die Wagen des Trosses, mit Vorräten und den zerlegten Katapulten beladen, kamen nur langsam voran, und die zwanzig Kriegselefanten ebenso. Nachzügler würden noch eintreffen, wenn die Sonne unterging, und bis man ihnen etwas anderes sagte, mussten Felix und seine Kameraden die Augen nach einem Ausfall von Elateias Verteidigern offen halten.
Niemand rechnete ernsthaft mit solch einem Gegenangriff, denn sie hatten keine große Festung vor sich, wie sie Makedoniens Grenzen schützten, sondern eine kleine Stadt mit einer befestigten Mauer. Der Großteil der Garnison bestand sicher aus Bäckern und Tischlern, Schmieden, Sattlern und Weinhändlern, aber nicht aus Soldaten. Sie wären gewiss nicht so schlimm wie die Phalangiten in Atrax, an deren langen Lanzen, den Sarissen, sich die Wellen der Legionäre gebrochen hatten wie die Brandung an einer Hafenmauer. Ihr Centurio Pullo gehörte zu den bestürzendsten Verlusten, aber viele einfache Soldaten der Centurie waren ebenfalls gefallen, unter ihnen Felix’ immer vergnügter Freund Matthaeus. Andere waren in anderen Schlachten früher im Sommer gestorben. Von den zehn Mann, die Felix’ Contubernium gebildet hatten, waren nur noch drei am Leben: er, sein Bruder Antonius und Fabius, der mürrische Veteran, der jeden anfuhr, der ihn fragte, ob er mit Fabius dem Zögerer verwandt sei.
»Nicht mehr lange«, sagte eine Stimme.
Felix fuhr zusammen. Livius war ein Optio, aber er beherrschte die unheimliche Eigenschaft der Centurionen, aus dem Nichts aufzutauchen, wenn man am wenigsten mit ihm rechnete. Seit Pullos Tod führte er die Centurie. Felix sah ihn neugierig an. »Bis was, Optio?«
Livius grinste, und die Lücke zwischen seinen Vorderzähnen wurde sichtbar. »Bis ihr mit dem Graben anfangen könnt. Die zweite Hälfte der Legion ist fast da.«
Den Graben auszuheben, der ihr Lager umgeben würde, und danach den Wall zu errichten war besser, als zu kämpfen, aber Felix verspürte keinerlei Begeisterung. »Jawohl, Optio«, murmelte er.
»Es war ein langer Marsch. Ich sorge dafür, dass heute Abend Wein ausgegeben wird.« Livius ging davon, und Felix blieb mit offenem Mund stehen. Der Marsch von der Festung, in der Pullo gefallen war, hatte durch leichtes Gelände geführt und war nichts Besonderes gewesen. Die einzige Erschwernis war die Trauer, die auf ihnen lastete, und, wenn auch nicht direkt, Livius hatte sie soeben anerkannt.
»Er wäre ein guter Centurio«, sagte Felix leise.
»Umso trauriger, dass er nicht unser Centurio wird«, sagte Antonius. Sein Bruder war kleiner, ernster als Felix und vier Jahre älter.
Es hieß, die Befehlshaber wären beeindruckt von der Art und Weise, wie Livius die angeschlagene Centurie nach Pullos Tod zusammengehalten hatte. Dass jemand für solch eine tapfere Tat zum Centurio befördert wurde, war nicht unbekannt, aber kein einziger der Principes wollte, dass Livius befördert wurde, denn das hätte bedeutet, dass sie ihn ebenfalls verloren.
»Mögen die Götter geben, dass er bei uns bleibt«, sagte Fabius und rieb sein Phallus-Amulett. Im Normalfall blieben überlebende Optionen bei ihrer Centurie.
»Wer wird denn neuer Centurio?«, fragte Felix.
Seine Ohren vernahmen die im Chor gesprochenen Worte »Weiß ich doch nicht«, und er verzog das Gesicht. Warum sollten seine Kameraden auch mehr wissen als er? Hoffentlich kein fieser Hund wie Matho, dachte er. Sein Bruder und er hatten im Krieg gegen Hannibal in der Legion gedient. Fünf Jahre zuvor waren sie von dem boshaften Centurio Matho nach der Schlacht von Zama unehrenhaft entlassen worden. Das Zivilleben war ihnen nicht bekommen, und als der Krieg gegen Makedonien erklärt wurde, hatten sie ihr Leben riskiert, indem sie sich erneut zur Armee meldeten. Kapriziös, wie sie war, hatte die Göttin Fortuna bewirkt, dass sich ihr Weg mit dem Mathos kreuzte. Bei ihrem letzten Zusammenstoß mit Matho hatte der Centurio den Tod gefunden, und der einzige Zeuge war ein makedonischer Jüngling gewesen, der ebenfalls nicht mehr lebte.
»Wir brauchen auch neue Männer«, sagte Fabius. »Wer hätte je von einem Contubernium aus drei Mann gehört?«
»Kann mir nicht vorstellen, dass das so bald geschieht«, stellte Antonius fest.
»Eher legen sie uns mit einer anderen Zeltgruppe zusammen, die in der gleichen Lage ist.« Felix hob die Stimme, damit er gehört wurde. »Hoffen wir bloß, dass es nicht die Bande von Bastarden aus der nächsten Reihe ist.« Er grinste über den Hagel aus Beleidigungen und Drohungen, den er zur Antwort erhielt.
Die nächsten Stunden verbrachten sie auf ähnliche Weise. Livius, der wusste, dass sie der Ablenkung von der grimmigen Wirklichkeit des Lebens bedurften, ließ sie gewähren. Vom gelegentlichen Aufblitzen eines Helms im Sonnenlicht abgesehen, tat sich nichts auf Elateias Wällen. Das war ermutigend, genauso wie Antonius’ Feststellung, dass sich die Verteidiger einnässten bei dem Gedanken an das, was ihnen in den kommenden Tagen bevorstand.
Dunkelheit hüllte die phokische Ebene ein. Innerhalb der Mauern Elateias bellten die Hunde einander in der aufreizenden Art an, mit der sie es bei Nacht tun. Frieden herrschte über den großen Feldlagern, die Flamininus’ Legionen errichtet hatten. Posten schritten auf den Wehrgängen auf und ab und wurden immer wieder von den Optionen kontrolliert. Hinter dem der Stadt zugewandten Graben standen die Katapulte, die schon bald die Abwehranlagen Elateias zerschmettern würden. Die Stunde war spät, und die meisten Männer schliefen. Zwischen den ordentlichen Reihen der Principes-Zelte glühte noch eine Handvoll Feuer, darunter das von Felix, Antonius und Fabius. Bei Sonnenuntergang waren die Befehle gekommen. Am nächsten Tag war ein Angriff auf Elateia geplant. Die Principes würden daran teilnehmen. Wegen dieser unwillkommenen Neuigkeit hatten sie den Wein, der ihnen von Livius gebracht worden war, nicht ausgetrunken. Niemand war so dumm, sich am Vorabend einer Schlacht zu betrinken. Einer unausgesprochenen Übereinkunft folgend, erwähnte niemand den Angriff.
»Was macht ihr nach dem Krieg?« Fabius schob die Zehen dichter an die glühenden Kohlen und musterte Felix und Antonius, die sich auf der anderen Seite des Feuers auf ihren Decken ausgestreckt hatten. »Ihr habt euren Hof verlassen – könntet ihr noch mal dorthin zurück?«
»Ich will es noch mal versuchen«, sagte Antonius wie jedes Mal während der Feldzüge der beiden zurückliegenden Sommer, wenn das Thema zur Sprache kam. »Nach dem Krieg müsste ich genug gespart haben, um Maultiere und einen Sklaven zu kaufen. Das sollte das Leben um einiges leichter machen.« Mit einem Seitenblick auf Felix versuchte er, dessen Interesse einzuschätzen, doch der tat so, als würde er es nicht bemerken.
Fabius wusste nur, dass ihr Leben als Bauern brutal hart gewesen war, und grunzte. Sein Blick fiel auf Felix. »Und du?«
»Was wirst du machen, alter Mann?«, entgegnete Felix.
»Ich? Das, wovon ich immer rede. Ich kaufe mir eine Taverne und trinke mich langsam zu Tode.«
Felix schnaubte. »Wie lange wird das dauern?«
»Viele Jahre, hoffe ich.« Ein seltenes Lächeln erschien auf Fabius’ Gesicht. »Warum macht ihr beide nicht mit? Ihr seid jung und stark – eine Taverne braucht Männer wie euch. Wenn ihr dabei seid und mich aufrecht haltet, werde ich bestimmt über sechzig.«
»Schlimmer als unsere letzte Erfahrung mit dem Gewerbe kann es nicht werden«, gab Antonius zu. »Meine Rippen tun mir weh, wenn ich nur daran denke.«
Felix rieb sich das Kinn, das tagelang geschmerzt hatte nach dem Kampf gegen einen viehischen Menschen, der sie fast beide besiegt hätte. »Wo wäre das denn?«
Fabius sah ihn nur an. »Ich komme aus Rom. Wo sonst soll man eine Taverne aufmachen?«
»In Rom gibt es eine ganze Menge beschissener Ecken«, entgegnete Felix herausfordernd.
»Meinst du etwa, ich wäre mit dem letzten Regen auf die Erde gekommen?«, gab Fabius zurück. »Ich weiß das. Wir einigen uns gemeinsam auf den Ort.«
Felix tauschte einen Blick mit Antonius und sah Fabius wieder an. »Gleichberechtigte Partner?«
»Solange ihr jeder ein Drittel aufbringen könnt, ja.« Fabius spuckte sich in die Hand und hielt sie Felix hin.
Felix ergriff sie nicht. »Was hältst du davon, Bruder? Eine Taverne zu führen muss doch besser sein, als tagein, tagaus hinter dem Pflug zu gehen. Besser als die Knochenarbeit zur Erntezeit.«
Antonius sah ihm in die Augen und blickte Fabius an, der ermunternd nickte, dann wandte er sich wieder seinem Bruder zu. »Gut, warum nicht?«, murmelte er. »Wenn es schiefgeht, haben wir immer noch den Hof.«
Grinsend schüttelten die drei sich die Hände. Fabius holte einen Weinschlauch hervor, was so selten vorkam, dass Felix erklärte, das allein sei für sich genommen ein weiterer Grund zum Feiern. Unter normalen Umständen hätte die Stichelei Fabius so sehr verärgert, dass er nichts von seinem Wein abgegeben hätte, aber an diesem Abend begnügte er sich damit, über Jungspunde zu murren, die keinen Respekt vor dem Alter hätten. Der Weinschlauch machte am Feuer die Runde, und die drei Kameraden nahmen kleine Schlucke, während sie ihr neues Unternehmen besprachen.
Fabius nickte als Erster ein. Gerade begeisterte er sich noch über die Weine, die er von einem alten Bekannten mit einem Gut südlich von Rom kaufen könne, im nächsten ruhte sein Kinn auf seiner Brust, und er schnarchte leise. Antonius reagierte nicht darauf, und amüsiert entdeckte Felix, dass seinem Bruder ebenfalls die Augen zufielen. Felix raffte sich auf. Es war nicht kalt, aber das Feuer war heruntergebrannt. Zwar hüllte die Wärme des Weins ihn ein, aber das Zelt war nur wenige Schritte entfernt, und es lohnte sich, dafür aufzustehen. Er hob den Weinschlauch und trank die letzten Tropfen. Ein anständiger Jahrgang.
Er stieß Antonius und Fabius an, bis sie wieder wach waren, und ging zum Latrinengraben dicht am Wall gegenüber Elateia, um seine Blase zu leeren. Als er damit fertig war, strich Felix seine Tunika glatt und machte kehrt, um auf dem gleichen Weg zurückzugehen. Sein Blick streifte den Wehrgang. Ihm fiel ein, dass er die Schritte des Postens nicht gehört hatte, während er sich erleichterte. Er konnte niemanden entdecken, was seltsam war. Er ging ein Stück zurück, damit er mehr vom Erdwall sehen konnte, der so hoch war wie zwei Männer. Keine Menschenseele.
Unruhe befiel ihn. Er schlurfte mit den Füßen, damit seine genagelten Stiefel kein Geräusch verursachten, und folgte dem Wall erst zwanzig, dann fünfzig Schritte weit. Kein einziger Wächter war zu sehen, aber als er den verräterischen liegenden Umriss auf dem Wehrgang entdeckte, bekam er einen trockenen Mund. Felix musterte die nächststehenden Zelte, aber er sah oder hörte nichts, was darauf hindeutete, dass Angreifer ins Lager eingedrungen wären. Einen Moment lang rang er mit sich. Schlug er fälschlich Alarm, wurde er bestraft. Besser, er sah nach dem Mann, entschied er und schlich zur nächsten Leiter.
Mit pochendem Herzen stieg er hinauf. Sein Blick zuckte nach links und rechts über den Wehrgang. Auf halbem Wege bemerkte er eine weitere Gestalt, die in Sitzhaltung zusammengesackt war. Sie musste ein anderer Posten sein. Hier stimmt eindeutig etwas nicht, dachte Felix. Sein Puls ging schneller. Die Elateier waren also doch nicht ohne Rückgrat. Unter die Schanzpfähle auf dem Wehrgang geduckt, eilte er zum nächsten Posten. Der Mann lag mit dem Gesicht nach unten, reglos wie ein Stein. Eine dunkle Lache unter seinem Hals verriet das grimmige Schicksal, das ihn ereilt hatte. Felix tauchte die Fingerspitzen in die Flüssigkeit, um sich zu vergewissern, und wünschte sogleich, er hätte es gelassen. Ein Kletterhaken lag in der Nähe, und von ihm schlängelte sich ein Seil über die Brustwehr – so war der Feind, der den Posten getötet hatte, hochgeklettert. Felix sah auf dem ganzen Wehrgang niemanden, was bedeutete, dass der Wall unverteidigt war, doch bizarrerweise zeigte sich noch immer kein Anzeichen für Angreifer im Lager.
Er wagte einen Blick über die Brustwehr, und seine Augen weiteten sich. Bei den beiden großen Katapulten, die eine Bresche in die Wälle von Atrax geschlagen hatten, hielten sich Dutzende von Gestalten auf. Fackeln flackerten in ihren Händen. Mit der Luft drang der unverkennbare Geruch nach Pech in seine Nase.
Felix sprang auf und brüllte, so laut er konnte, Alarm.
Bei den Angreifern wandten sich ihm Köpfe zu, und sie strengten sich umso eiliger an, die Katapulte in Brand zu setzen.
Felix hörte, wie Posten auf den anderen Wällen auf seinen Ruf näher hasteten. In den Zelten regten sich Männer. Aber es ging langsam, viel zu langsam. Flammen züngelten an einem Katapult hoch, und die Angreifer eilten zur zweiten Belagerungswaffe. Er fragte sich, ob er Antonius und Fabius wecken sollte, aber das hätte zu lange gedauert. Sich selbst als Narr verfluchend, nahm Felix dem toten Posten Wehrgehänge und Schwert ab. Pilum und Schild des Toten warf er in den Graben, prüfte den Sitz des Wurfhakens und kletterte über die Brustwehr. Hinunter ging es, Hand über Hand, die Füße am Wall. Am Boden blieb er stehen und sah nach den Angreifern. Einer schien seinen Abstieg bemerkt zu haben. Nicht dass sie sich wegen eines Mannes sorgen müssten, dachte Felix grimmig. Er spähte in den Graben und dachte: Ein falscher Schritt, und ich trete auf einen Krähenfuß, wenn nicht auf zwei. Aber es ließ sich nicht ändern. Er setzte sich auf den Hintern, die Hände am Rand, und ließ sich hinuntergleiten.
Vorsichtig suchte er sich sicheren Boden, kauerte sich nieder und hielt nach Schild und Pilum Ausschau. Fortuna war ihm gewogen – sie waren in der Nähe gelandet. Mit den Fingerspitzen nach Krähenfüßen tastend, nahm er Schild und Pilum an sich und wuchtete sie über den Rand des Grabens. Er betete, dass ihn dort keiner erwartete, um ihm den Schädel einzuschlagen, und stieg eilig aus dem Graben.
Niemand hatte ihn bemerkt, dabei stand das erste Katapult lichterloh in Flammen und spendete gutes Licht. Die Angreifer waren darin vertieft, auch das zweite Katapult in Brand zu setzen. Aus irgendeinem Grund hatte es sich nicht genauso leicht entzündet wie das erste, aber angesichts der hektischen Bemühungen konnte es nicht mehr lange dauern, bis es ebenfalls in Flammen aufging. Felix zögerte. Er hatte Alarm geschlagen. Das Feuer konnte er nicht allein löschen, und die Angreifer wurden bald vertrieben. Warum sollte er sein Leben riskieren?
Einer der Angreifer drehte sich um und entdeckte ihn.
Felix blieb die Zeit, sich zu erinnern, was für ein altes Miststück Fortuna doch sei, dann winkte er imaginäre Kameraden heran und brüllte: »Auf geht’s, Brüder! Mir nach!« Er warf das Pilum und spießte damit einen Angreifer zwischen den Schulterblättern auf. Mit einem Gebrüll, als wäre er eine ganze Centurie Legionäre, zückte er das Schwert und rannte auf die brennenden Katapulte zu.
Der Mann, der ihn gesehen hatte, zitterte sichtlich. Sein schlecht gezielter Wurfspieß surrte vorbei und kam Felix nicht einmal nahe.
Felix stürzte sich unmittelbar auf ihn. Der Schildbuckel warf den Mann zurück auf sein Hinterteil. Felix ließ von ihm ab und näherte sich einem zweiten Mann, der, von seinem wilden Gesichtsausdruck verängstigt, davonlaufen wollte. Felix trieb ihm das Schwert in den Rücken und drang weiter vor. Zwei Angreifer nahmen Felix in die Zange, einer von rechts, der andere von links. Ich bin ein toter Mann, dachte er. Sie haben gesehen, dass ich allein bin. Er entschied sich rasch. Der links von ihm war nur ein Jüngling. Er sprang vor, schlug mit dem Schild, stach mit Schwert zu. Der junge Kerl ging zu Boden. Er greinte wie ein Säugling, den die Mutter von der Brust nimmt.
Felix fuhr herum zum zweiten Angreifer. Der Mann hielt sich jedoch zurück. Er hatte einen Schmerbauch und hielt Speer und Schild wie ein Rekrut. Ein Soldat war er nicht. Felix empfand einen Hoffnungsschimmer. Er griff an, ohne die weggeworfene Fackel vor seinen Füßen zu sehen. Er rutschte aus, verlor das Gleichgewicht, fiel nach vorn und prallte mit dem Gesicht auf den Boden. Sein Gegner stieß einen Triumphschrei aus, trat vor und hob den Speer.
»Roma!« Der Ruf kam aus einiger Entfernung, aber er drang aus Dutzenden von Kehlen. »Roma!«
Felix verzog gequält das Gesicht. Vor dem Speer in den Rücken würde ihn das kaum bewahren.
Der Stoß kam nicht. Füße trampelten. Männer schrien einander etwas auf Griechisch zu.
Felix rollte sich herum. Er konnte sein Glück kaum fassen. Ein ausgebildeter Soldat hätte ihn getötet, bevor er die Flucht ergriff, aber der schmerbäuchige Mann war seiner Angst erlegen und rettete nur die eigene Haut.
Eine merkwürdige Stille senkte sich herab. Holz knisterte. Hitze strahlte von den Katapulten ab. Felix rappelte sich auf. Beide Katapulte standen in Flammen. Wenn er versuchte, den Brand zu löschen, würde er sich nur schwer verbrennen. Er trat zurück. Für einen Abend hatte er Fortuna genügend in Versuchung geführt.
Die Belagerung von Elateia wurde nun schwieriger als angenommen.
2. KAPITEL
Tempe, an der makedonischen Grenze
Eine Hügellandschaft markierte die nördliche Grenze der thessalischen Ebene. Von West nach Ost verlief sie bis ans Ägäische Meer. Wolkenumhüllte Gipfel erhoben sich dahinter, Teile des Berggürtels, der Makedonien umringte. Etwa siebzig Stadia landeinwärts, weitab von jedem Dorf, bildete ein Pass einen der seltenen Wege nach Norden. Ein Zeichen der Zeit war es, dass Dutzende von Peltasten dort Wache standen, Thraker mit wilden Gesichtern, achtsame Makedonen und Thessalier. Ihre Pferde weideten auf dem kurzen Gras in der Nähe.
In der Mitte des Vormittags etwa brach Tumult aus, als ein halbes Dutzend Reiter aus dem schmalen Pass preschte. An ihrer Spitze ritt auf einem kühnen grauen Hengst Philipp, fünfter seines Namens, Herrscher von Makedonien. Er war schlank und hatte helle Augen. Ein gepflegter Bart bedeckte sein Kinn, und er trug einen schlichten Chiton und Soldatenstiefel. An dem einen Wehrgehänge über seiner Schulter baumelte eine Kopis in einer schlichten Scheide. Die Ehrenbezeigungen und Grüße der Posten erwiderte er mit freundlichem Winken.
»Etwas zu berichten?«, fragte Philipp.
Der nächststehende Mann eilte zu ihm. »Nichts, mein König.«
»Berisades!«, rief der Herrscher mit aufrichtiger Freude. Der Peltast war alt genug, um sein Vater zu sein, schon seit gut zwei Jahrzehnten diente er im Heer.
»Grüße, mein König.« Berisades grinste breit. Er war groß und schlaksig, seine Haut von der Sonne walnussbraun gefärbt. Er trug nichts weiter als einen gegürteten Chiton und Sandalen.
Philipp beugte sich aus dem Sattel, um Berisades’ Hand zu umschließen. »Es ist gut, dich zu sehen.«
»Ganz meinerseits, mein König. Kommst du, um uns nach Süden zu führen? Jeder spricht von nichts anderem als deinem jüngsten Erfolg. Die Männer können es nicht erwarten, den Römern die nächste Schlappe beizubringen.«
»Nichts wäre mir ein größeres Vergnügen.« Philipp hielt sich den Handrücken vor den Mund und wisperte vernehmlich: »Aber würdest du dir nicht lieber zu Hause die Knochen am Feuer wärmen?«
»Nein, mein König, ich würde dir folgen«, antwortete Berisades. Als er Philipps Lächeln sah, fügte er kopfschüttelnd hinzu: »Du machst dich über mich lustig, mein König.«
»Nur weil ich weiß, dass du das Herz eines Löwen hast, Berisades.« Philipp blickte über seine Schulter zu seinen Gefährten und rief: »Seht ihr diesen Mann? Von allen meinen Soldaten ist er der tapferste. Dreimal zwanzig Jahre hat er gesehen, und noch immer marschiert er in den Krieg. Treu und tapfer, wie er ist, soll Berisades’ Name für alle Zeit geehrt werden.«
Unbehaglich scharrte Berisades mit seinen schwieligen bloßen Füßen. »Das brauchtest du nicht zu sagen, mein König.«
»Nie habe ich wahrer gesprochen«, sagte Philipp voll Wärme. »Ich muss mich nun verabschieden – vergib mir, Berisades –, aber wenn die Götter es wollen, werden wir bald wieder reden. Haltet die Augen auf nach Wagen. Vor Sonnenuntergang treffen Wein und Wildbret für euch alle ein. Sorge dafür, dass jeder weiß, es kommt von mir – eine kleine Geste der Dankbarkeit für die Tage, die ihr hier gewacht habt.«
Von Ohr zu Ohr strahlend verbeugte sich Berisades tief. »Tausend Dank, mein König.«
Philipp hob die Hand zum Abschied und ritt weiter. Nach kurzer Strecke auf der Ebene zügelte er sein Pferd. »Menander?«
»Hier bin ich, mein König.« Ein untersetzter Edelmann am Ende des mittleren Alters lenkte sein Ross zu Seiten des Herrschers. »Das war gut gemacht, mein König.«
Philipp sah ihn an. »Bessere Männer als Berisades gibt es kaum.«
»Und du hast ihn gerade noch fester an dich gebunden, mein König. Noch Tage wird er von nichts anderem sprechen als dir. Und seine Kameraden ebenfalls. Sie hätten es nach deinem Besuch ohnedies getan, aber der Wein und das Fleisch – das war sehr geschickt.«
»Zeig deinen Männern, dass sie dir etwas bedeuten, und sie kämpfen besser.«
»So war es immer deine Art, mein König.« Menanders Augen waren von Respekt erfüllt.
Philipp wies mit einer umfassenden Armbewegung auf die Landschaft aus Stoppelfeldern und sanften Hügeln. Weit im Südwesten waren eben noch die Mauern von Larisa zu erkennen. »Ein wunderbarer Anblick.«
»Das ist wahr, mein König, und noch besser, weil er frei ist von Römern.«
»In der Tat.« Philipp erlebte die Genugtuung noch einmal, die er empfunden hatte, als er die bedeutungsschwere Neuigkeit aus Atrax hörte. Nach einem Sommer voller Rückschläge war der Sieg sehr notwendig gewesen. Bedauerlich, dass der Erfolg nicht vollkommen gewesen war. Der römische Konsul Flamininus hatte große Verluste erlitten, aber überwältigend waren sie bei Weitem nicht. Um alles schlimmer zu machen, zog sich der Feldzug in die Länge, obwohl er sich eigentlich dem Ende zuneigen sollte. Nach den letzten Stürmen und Regenfällen hatte für die Jahreszeit unüblich warmes Wetter eingesetzt, und es sah so aus, als würde es sich noch für einige Zeit fortsetzen. Infolgedessen waren die Legionen noch immer im Marsch. Philipp sah Menander an. »Gibt es schon Nachrichten?«
»Jawohl, mein König. Wie du weißt, ist Flamininus’ Heer nach Süden marschiert. Die jüngsten Berichte deuten darauf hin, dass es dem Golf von Malia gefolgt ist und vor zwei Tagen die Thermopylen durchquert hat.«
»Er will Elateia belagern, ganz wie ich dachte. Beherrscht er die umliegenden Gebiete, wird es uns unmöglich, über Land von Chalkis aus nach Böotien vorzustoßen.« Chalkis, die königliche Festung auf der Insel Euböa, war lebenswichtig für Makedonien. Wie es schien, war Flamininus sich dessen bewusst.
»Du überlegst, ob du mehr Soldaten nach Elateia hättest schicken sollen, mein König.« Wenige Tage zuvor hatte eine Speira Phalangiten abgestellt, die nach Süden marschieren und die Garnison verstärken sollte.
»Du kennst mich gut.« Philipp lächelte wehmütig.
»Und wenn du es getan hättest, mein König, und die Stadt fiele dennoch?«
»Ich weiß, aber mir ist der Gedanke zuwider, sie zu verlieren.« Er verzog das Gesicht. »Selbst wenn wir die Stadt hielten, wäre es wohl recht riskant, Truppen von Chalkis dorthin zu verlegen.«
»Mit Glück hören wir aufmunternde Neuigkeiten aus Elateia, mein König. Die Städter haben vor einigen Tagen berichtet, sie hätten die Absicht, bei einem nächtlichen Ausfall Flamininus’ Katapulte in Brand zu setzen.«
»Mögen die Götter mit ihnen sein. Aber selbst wenn es ihnen gelingt, Elateia ist keine Festung.«
»Das ist es nicht, mein König, und durch die Belagerung bleibt das Schicksal von Phokis ungewiss. Und von Böotien.« Die beiden griechischen Regionen, historisch Makedonien gegenüber freundlich, lagen im Süden, an der Straße nach Athen.
»Innerhalb von fünfhundert Stadia muss jeder sich fragen, wann Flamininus bei ihm an die Tür pocht.« Philipp ballte frustriert die Hand zur Faust. »Es gibt so wenig, was ich tun kann, um ihnen zu helfen. Entsende ich mehr Soldaten, schwäche ich mein eigenes Heer.«
»Ich weiß, mein König.«
Philipps Gedanken schweiften schon wieder. Zum zweiten Mal wies er auf die leere Ebene. »Wenn wir nach Süden marschierten, bestände eine gute Möglichkeit, dass wir die Legionen vor Elateia überraschen könnten.«
»Auf ebenem Boden würde die Phalanx die Römer niedermetzeln, mein König, aber gut denkbar, dass es nicht einfach wird. Was, wenn Flamininus Kundschafter zurücklässt, die die Thermopylen bewachen, oder ein geldgieriger Einheimischer ihm unseren Vormarsch verrät? Wenn die Legionen sich darauf verlegten, uns aus dem Hinterhalt zu überfallen, wäre das Heer weit weg von zu Hause.«
»Besonnene Häupter waren von jeher die Geißel der Überraschungstaktik.« Philipp schüttelte bedauernd den Kopf. »Doch in diesem Fall hast du einmal mehr recht, Menander. Sollte Elateia fallen, hätte ich eine einzige Speira verloren und eine verbündete Stadt, aber wird die Phalanx besiegt, wäre Makedonien wehrlos. Das darf ich nicht riskieren – noch nicht.« Menander sah erleichtert aus, und Philipp lachte.
Wie sehr er wünschte, er hätte in vergangener Zeit mehr auf Menander gehört als auf Herakleides, den eloquenten, aber niederträchtigen Tarentiner. Wenigstens lebte Herakleides nicht mehr. Als Verräter entlarvt, war der Tarantiner unter der Hand des Folterers gestorben, während Philipp zusah.
»Ich weiß«, sagte er wieder. »Ich muss Flamininus vorerst vergessen, und Phokis und Böotien ebenso. Vor dem Wintereinbruch wird er nicht mehr gegen Makedonien vorrücken. Das gibt uns Zeit, unsere Möglichkeiten zu überdenken, unsere Truppen zu sammeln und uns auf das Frühjahr vorzubereiten.«
»Ein weiser Entschluss, mein König.«
»Es wäre schön, wenn die achaiische Neutralität fortbestände, hm? Aber so wird es nicht kommen. Sie sind in einer unhaltbaren Position. Die römische Flotte steht an ihrer Nordküste, und Flamininus ist nicht viel weiter entfernt. In der Zwischenzeit streicht Nabis von Sparta an ihren südlichen und östlichen Grenzen umher wie ein hungriger Wolf.« Achaia und Sparta lagen beide auf dem Peloponnes.
»Mich würde es nicht überraschen, wenn die Achaier schon bald Makedonien die Treue brächen, mein König.«
»Genug von den Dreckskerlen. Ich werde auch keinen Atem an Ätolien verschwenden. Ätolien wird jeden Mann aussenden, den es entbehren kann, damit er sich Flamininus bei seinem Angriff auf Makedonien anschließt.« Die Polis Ätolien war der bitterste Feind des Königs. Philipp machte eine ungeduldige Geste. »Wie immer sind wir von Feinden umgeben oder Zauderern, die sich nicht für die eine oder andere Seite entscheiden wollen.«
»Vergessen wir nicht Akarnanien, mein König. Es bleibt dir treu«, sagte Menander.
»So herzlos es klingt, aber Akarnanien liegt zu weit entfernt, als dass ich ihm helfen könnte. Die Götter mögen verhüten, dass es jemals um Hilfe bittet. Mehr als ermutigende Worte könnte ich dorthin nicht senden.«
Ein unbehagliches Schweigen senkte sich herab.
»Ungefähr zu dieser Zeit im vergangenen Jahr sind wir gemeinsam auf die Jagd gegangen, erinnerst du dich? Ich hatte Peritas bei mir.« Der Gedanke an seinen Lieblingshund zauberte einen flüchtigen Ausdruck des Glücks in Philipps Gesicht.
»Ich erinnere mich daran, mein König. Die Hunde haben einen prächtigen Keiler gestellt.«
»Und wir sprachen über das Gleiche.«
Menander sah, wie Philipps Stimmung sich verdüsterte. »Vor einem Jahr hattest du Flamininus noch nicht geschlagen, mein König. Atrax mag den Krieg nicht gewonnen haben, aber es hat die Schwäche des Gegners offenbart. Auf flachem Gelände oder auf beengtem Raum vermag die Phalanx die Legion zu besiegen.«
»Umso trauriger, dass die Götter Griechenland und Makedonien mit Bergen bedeckt haben, was?«
Sie lachten beide.
Philipp schwenkte den Arm von links nach rechts, über die ganze Ebene. »Thessalien hat ausreichend geeigneten Boden. Wenn Flamininus überzeugt oder, besser ausgedrückt, verleitet werden kann, sich dort der Schlacht zu stellen, haben wir Aussichten auf einen Sieg.« Trotz seiner kämpferischen Worte wusste Philipp genau um seine schwächere Stellung. Fast jedes Verbündeten beraubt und effektiv in Makedonien festgesetzt, konnte er wenig tun, außer auf Flamininus’ Rückkehr zu warten. Diese Prüfung wäre weit schwieriger zu ertragen als die Schlachten des Sommers, der gerade zu Ende ging. »Der Römer ist kein Narr.«
»Mein König?«
»Ihn zu verleiten, hier seine Legionen einzusetzen, bedürfte einer List, die selbst Zeus würdig wäre.«
»Die Omen sind in letzter Zeit günstig gewesen, mein König.«
»Jeder weiß, wie wenig die schönen Worte der Priester bedeuten«, entgegnete Philipp leise. »Wir müssen, so gut wir es können, unser Schicksal selbst schmieden. Die Götter werden tun, was ihnen beliebt, so wie immer.«
Ein kurzes Schweigen folgte, dann sagte Philipp: »Es besteht eine andere Möglichkeit, über die wir noch nicht gesprochen haben.«
»Mein König?«
»Antiochos.«
»Der Seleukidenherrscher?«
»Der und niemand anderer.« Antiochos gebot über ein gewaltiges Reich, das Kleinasien und Syrien umfasste und bis nach Indien ging. Er war kein großer Freund Philipps, aber dennoch hatten sie in der Vergangenheit eine Übereinkunft erreicht. »Er wird sich über Roms Absichten sowohl hier als auch in Griechenland im Klaren sein.«
»Er reibt sich deswegen die Hände, mein König, oder ich schätze ihn völlig falsch ein. Dein Verlust ist sein Gewinn – denk nur an die Berichte deiner Spione über seinen Pakt mit den Rhodiern. Gemeinsam beabsichtigen sie, jede einzelne deiner Städte in Kleinasien und auf den Kykladen zu erobern.«
Bedrückt räumte Philipp ein: »Dass es so kommt, war abzusehen, da ich hier durch Flamininus gebunden bin. Um Antiochos’ Aufmerksamkeit von Kleinasien abzulenken, werde ich ihm ein Militärbündnis gegen Rom anbieten.«
»Bei allem Respekt, mein König, er wird deine Lage als, sagen wir, prekär beurteilen«, warnte Menander. »Selbst wenn er geneigt wäre zuzustimmen, sähe es ihm doch ähnlich, wenn er viel verspricht, nichts davon hält und aus sicherer Entfernung zuschaut, wie sich der Krieg gegen Flamininus entwickelt.«
»Ganz gewiss käme es so.«
»Aber wieso erwägst du dann, dich mit ihm zu einigen?«
»Selbst ein Seleukidenherrscher kann sich nicht auf seinen Lorbeeren ausruhen, Menander. Antiochos’ Vorgänger verloren im vergangenen Jahrhundert die Hälfte ihrer Ländereien durch Aufstände. Er hat Jahre gebraucht, um sie zurückzuerobern. Er muss sehen, dass Roms Legionen – angestachelt von ihrem Sieg über Hannibal – ein furchterregender Feind sind. Ihm muss auch klar sein, dass Rom seine Aufmerksamkeit nach Osten richten wird, auf sein Reich, sobald Makedonien gefallen ist. Antiochos braucht nur einen Bruchteil seines Heeres nach Griechenland zu entsenden, und gemeinsam könnten wir Flamininus’ Legionen zermalmen und dadurch sein Reich schützen.«
Menander strich sich den Bart, seine Gewohnheit, wenn er tief in Gedanken versank.
»Nun?«
»Wenn er zustimmt, mein König, und du Flamininus schlägst, könnte Antiochos seinen Rückhalt auf griechischem Boden einsetzen, um zu versuchen, dich zu vernichten.«
»Das könnte er allerdings. Nur ist das lediglich ein mögliches Problem, während Flamininus’ Legionen genau in diesem Moment in Phokis stehen.«
Menander seufzte. »Wenn du dir sicher bist, mein König. Ich hätte nie gedacht, dass ich den Tag erlebe, an dem wir uns mit den Seleukiden verbünden.«
»Ich genauso wenig, und dennoch könnte es gehen. Wir haben wenig zu verlieren. Wenn Antiochos uns zurückweist, bleibt unsere Lage, wie sie ist – prekär. Stimmt er zu, wird unsere Position um einiges stärker, auch wenn wir uns anschließend vor seiner Tücke hüten müssen.«
»Wie wahr, mein König.« Menander senkte den Kopf.
Philipp konnte sich vorstellen, wie eine gewaltige Phalanx die thessalische Ebene füllte – zusammengenommen, dachte er, würden seine und Antiochos’ Phalangiten leicht fünfundzwanzigtausend Köpfe zählen.
Flamininus’ Legionen könnten ihnen niemals widerstehen.
3. KAPITEL
In Elateia
Das Morgengrauen war noch nicht lange vorüber. Der zweite Tag seit Erscheinen der Legionen vor der Stadt brach an. Demetrios stand auf dem Wehrgang und betrachtete das feindliche Feldlager. Sonnenlicht blitzte auf dem Stück seines bronzenen Brustpanzers, das unter dem Umhang hervorschaute. Er war von durchschnittlicher Größe und muskulös, hatte strubbelige braune Haare und ein breites, freundliches Gesicht. Sein Helm lag auf seiner Apsis, dem Schild, der an der Brustwehr lehnte, seine lange Sarissa lag auf dem Wehrgang, parallel zu der Lanze seines Freundes Kimon, dem nächsten Posten links von ihm.
Demetrios stapfte auf der Stelle. Die Nacht war lang gewesen, ohne Schlaf. Nach dem erfolgreichen Brandanschlag auf die Katapulte hatte jeder mit einem Vergeltungsangriff der Römer gerechnet. In Erwartung dessen hatte der Befehlshaber der Garnison, ein Graubart namens Damophon, nächtliche Doppelwachen angeordnet. Nichts jedoch war geschehen.
Demetrios sah Kimon an, der herzhaft gähnte. »Bist du dran mit Brot kaufen?«
»Das hättest du wohl gern. Du bist an der Reihe, und das weißt du genau.« Kimon hatte lange Haare und eine beeindruckend große Nase. Er betrachtete jeden als Freund, bis das Gegenteil erwiesen war, ein Charakterzug, den Demetrios mochte, auch wenn er ihn nicht teilte. In seinen Augen musste Freundschaft immer wieder aufs Neue verdient werden.
»Nein, bin ich nicht«, widersprach er. »Antileon, du musst dran sein.«
Der große, muskelbepackte Mann mit den lockigen Haaren war der Dritte in ihrem kleinen Bund, und er schnaubte. Antileon mochte nichts lieber, als wegen einer Nichtigkeit ein Streitgespräch zu beginnen. Demetrios behauptete oft, Antileon würde selbst mit einer Statue noch diskutieren. Trotz dieser Neigung war er tapfer und ein treuer Freund. »Ich kaufe das Brot – wenn du mir Geld gibst.« Er streckte eine fleischige Pranke aus.
Sie lachten, froh über die heitere Abwechslung. Der Sieg bei Atrax hatte ihre Moral gehoben. Dass Philipp persönlich ihre Speira nach Elateia entsandt hatte, war als Anerkennung ihrer Leistung erschienen, aber seit der Ankunft von Flamininus’ Legionen war die Stimmung der Phalangiten gedämpft. Der Tartaros lockte erneut.
Im feindlichen Lager wurden Trompeten geblasen, und Demetrios empfand das vertraute Rumoren der Angst in den Eingeweiden. Eifrig bemüht, sie nicht Überhand gewinnen zu lassen, gab er zu: »Du hast mich ertappt. Ich bin wirklich an der Reihe.«
»Als wärst du damit durchgekommen, so zu tun, als wäre es anders«, sagte Kimon, während Antileon höhnisch lachte.
Demetrios hatte ihre Ablösung entdeckt. Sie konnten nun gefahrlos ihren Posten verlassen. Um seine Gedanken von den Legionen vor den Mauern abzulenken, beschloss er, seinen Freunden einen Streich zu spielen. »Ihr wollt, dass ich das Brot kaufe? Dann fangt mich!«, rief er, schob sich an Kimon vorbei, bevor der reagieren konnte, und rannte los.
Die beiden anderen setzten ihm sofort nach. Als am weitesten entfernt Stehender war Antileon im Nachteil, aber seine schiere Kraft ließ ihn bald zu Kimon aufschließen und ihn überholen. Demetrios’ Vorsprung schrumpfte rasend schnell zusammen. Der Wehrgang war schmal und, weil etliche Ziegel locker waren, auch unsicher. Alle dreißig bis vierzig Schritt stand ein Posten, und nicht jeder von ihnen sah Demetrios nahen. Den ersten wich er aus, aber einer war aufmerksamer, hielt ihn für einen Dieb, ergriff ihn beim Arm und rief Kimon und Antileon zu, dass er den Dreckskerl gefangen habe.
Demetrios’ Einwände waren vergebens. Erst als der wohlmeinende Phalangit sah, wie heftig die Freunde lachten, konnte er sich wieder losreißen. Sein Vorsprung war dahin, und Kimon hätte ihn fast gepackt, indem er einen für ihn ganz untypischen Spurt hinlegte. Demetrios entkam ihm nur dank eines Eckturms. Er jagte durch die erste Tür, vorbei an drei erschrockenen Männern, die um ein wärmendes Kohlebecken saßen, und es gelang ihm, die zweite Tür Kimon vor der Nase zuzuschlagen.
Sie rannten die Nordmauer entlang, und Demetrios rief den Posten zu, den Weg freizumachen. Ein magerer Straßenköter, von denen in den Gassen der Stadt viele lebten, glaubte, Demetrios hätte es auf ihn abgesehen, und huschte mit eingeklemmtem Schwanz eine Treppe hinunter. Tauben stoben in die kühle Luft auf. Ein amüsierter Graubart, der gekommen war, um den Feind zu beobachten, verbeugte sich ernst vor ihm. Demetrios hob zur Antwort die Hand an die Stirn.
Als er den Turm zurückgelassen hatte, der die Nord- und die Ostmauer verband, gab Kimon auf und blieb stehen. Antileon setzte grimmig die Verfolgung fort, aber jedes Mal, wenn er aufschloss, sprintete Demetrios los. Mittlerweile sicher, dass er das Wettrennen gewonnen hatte – das Brot müsste dennoch er kaufen, aber das war unwichtig –, lief er ein wenig langsamer. Und das war gut. Ein Tetrarchos, den Demetrios erkannte, erschien an der nächsten Treppe, um nach seinen Leuten zu sehen. Glücklicherweise zog eine große Gruppe Römer, die an der Mauer vorbeimarschierten, die Aufmerksamkeit des Befehlshabers über vier Glieder auf sich. Demetrios schlich sich vorbei und grinste den nächststehenden Wachtposten breit an.
In seiner Siegesgewissheit war er sich seines knurrenden Bauchs umso deutlicher bewusst und sah schon die Leckereien vor Augen, die in seiner Lieblingsbäckerei verkauft wurden. Obwohl sich schon bald die Folgen der Belagerung zeigen würden, war noch nichts knapp geworden. Für Antileon und Kimon je ein Stück Honiggebäck, für sich selbst zwei, entschied Demetrios. Wenn sie mehr wollten, sollten sie es aus eigener Tasche bezahlen.
Als er die Stelle erreichte, an der das Rennen begonnen hatte, warf er einen Blick auf das römische Feldlager. Wenig ging dort vor, zumindest bislang. Er entdeckte Kimon erst, als es schon zu spät war. Sein Freund sprang ihn an und warf ihn auf den Wehrgang. »Wer ist jetzt der Schlaukopf?«, wollte Kimon triumphierend wissen.
Demetrios grinste reumütig, als er sich aufrappelte. »Ich nicht.«
Antileon kam heran und knuffte ihn zweimal nicht allzu sanft. »Klugscheißer.«
»Wollt ihr etwa kein Honiggebäck, ihr Arschgesichter? Ach was, jetzt doch?« Demetrios schubste Antileon. »Dann seid mal lieber nett zu mir.«
»Da steh’n sie, die Staubfüße, und blöken wie die Schafe, die sie sind«, sagte eine Stimme. »Immer das Gleiche.«
»Verpiss dich, Empedokles!«, riefen Kimon und Antileon unisono.
»Du kommst spät«, sagte Demetrios verächtlich. Die Zeit der Ablösung war vorüber. Empedokles und die anderen mussten am unteren Ende der Treppe geschwatzt haben, während er und seine Freunde den Wettlauf über die Mauern machten.
Er sah zu, wie Empedokles hochstieg. Der untersetzte Phalangit mit dem welligen Haar hatte von Anfang an etwas gegen ihn gehabt. Seine Abneigung hatte sich verfestigt, als Demetrios ihn überraschend in zwei ihrer fünf Runden Pankration besiegte. Einige Monate später hatte Empedokles versucht, ihn bei einem Übungskampf ernsthaft zu verletzen, dann hatte Demetrios beinahe zugelassen, dass Empedokles von Dieben in einer Gasse die Kehle durchgeschnitten wurde. Danach war es mit ihrem Verhältnis bergab gegangen.
Empedokles sah hoch und verzog höhnisch den Mund.
»Als Simonides zuletzt von dir sprach, Empedokles, sagte er, du kommst von einem Bauernhof«, stichelte Demetrios. »Damit bist du selber ein Staubfuß. Oder hat Simonides gelogen?« Ihr Gliedführer war ein stiller, aber grimmiger Kämpfer, mit dem sich niemand unnötig anlegte.
Empedokles murmelte etwas.
»Das habe ich nicht verstanden.« Demetrios bemerkte die ermutigenden Gesten seiner Freunde.
»Simonides ist kein Lügner.«
»Also bist du wirklich auch ein Staubfuß!«, krähte Demetrios. Er hörte, wie Andriskos und Philippos, die beiden Kameraden, die mit Empedokles auf die Mauer gekommen waren, in das Gelächter einfielen. Es wärmte Demetrios das Herz. Empedokles war einer der vier vordersten Männer in ihrem Glied, aber wegen seiner verächtlichen, unangenehmen Art alles andere als beliebt.
»Hört euch den Maulhelden an«, rief Empedokles. »Ein, zwei Ründchen Pankration, und du tönst nicht mehr so rum. Wollen wir nachher?«
»Ich habe dich vor vier Jahren fast besiegt«, entgegnete Demetrios. »Ich bin mir sicher, dass ich es auch jetzt kann, und im Faustkampf genauso. Sag einfach, wann.«
Ein Laut der Geringschätzung. »Simonides würde es verbieten.« Das war Empedokles’ übliche Antwort.
»Er muss ja nichts davon erfahren«, versetzte Demetrios und tat so, als wüsste er nicht, was Simonides davon halten würde. Weil dem Lochagos ihre Feindschaft bewusst war, hatte er ihnen den Ring-, Faust- oder Pankration-Kampf gegeneinander verboten, weil, wie er sagte, es damit enden würde, dass einer von ihnen verstümmelt oder tot wäre.
»Warum könnt ihr beiden eure Streitigkeiten nicht beilegen? Ihr steht fast hintereinander im Glied, habt einen gemeinsamen Feind und all das.« Philippos, der gleich hinter Empedokles stand, ließ sein tiefes Lachen dröhnen. Der große Mann mit dem großen Herzen war für Demetrios fast zu einer Vaterfigur geworden. »Andriskos und ich, wir kommen gut miteinander aus. Bis auf seine Furzerei natürlich. Jedes Mal, wenn wir im Glied stehen, muss ich seinen Gestank einatmen.«
Sogar Empedokles lachte jetzt.
Andriskos, der eine Reihe unter Philippos stand, grinste, unternahm aber keinerlei Versuch, dessen Vorwurf zurückzuweisen. Ein ausgezeichneter Soldat, gut aussehend, stand Andriskos hinter Simonides als Zweiter im Glied. Philippos kam als Nächster, dann Empedokles hinter ihm. Danach kam der neue Viertelgliedführer Taurion, der Ersatz für Dion, der bei Atrax gefallen war.
Freundschaft steht außer Frage, dachte Demetrios, während er Empedokles grimmig ansah. Zu vieles war vorgefallen. Wenn er der unangenehmen Lage etwas abgewinnen konnte, dann den Umstand, dass er als sechster Mann im Glied hinter Empedokles stand und nicht vor ihm.
Ein schwacher Trost.
Demetrios war nicht überrascht, als ungefähr eine Stunde nach seinem Wettlauf gegen Kimon und Antileon die Trompeten alle Phalangiten auf die Mauern riefen. Obwohl er seine Katapulte verloren hatte – vielleicht gerade deswegen –, trieb der römische Konsul Flamininus ungeduldig die Belagerung voran. Auch andere Faktoren mochten ihn beeinflusst haben. Bei Morgengrauen hatte der Tau schwer auf jedem Zelt gelegen. Der feuchte Herbstgeruch in der Luft war unverkennbar. Vom Meer trieben große Bänke regenschwerer Wolken heran, eine deutliche Erinnerung an den Wechsel der Jahreszeiten. Wenn Flamininus Elateia vor dem Frühjahr einnehmen wollte, musste er sich beeilen.
Der Klang der Trompeten war noch nicht verhallt, als Simonides die Stimme erhob und seinen Männern befahl, sich auf der Stelle bereitzumachen.
Demetrios verschlang einen letzten Bissen, er hatte sich das Honiggebäck für den Abschluss aufgespart. »Wenigstens sind unsere Bäuche voll, oder?«
»Genau.« Antileon fuhr mit dem Finger über den Teller und nahm die letzten Honigreste auf. »Eine Schande, dass es nicht mehr gab.«
»Kauf uns so viele du willst, wenn du an der Reihe bist«, sagte Kimon und blinzelte Demetrios zu.
Gutmütige Beleidigungen flogen zwischen den Freunden hin und her, während sie sich ankleideten und wappneten. Niemand hatte es eilig. Was immer Flamininus vorhatte, seine Legionen brauchten Zeit, um aus ihren Lagern zu marschieren. Kimon und Antileon trugen die Kettenhemden, die sie im vergangenen Jahr bei Pluinna toten Römern abgenommen hatten. Einfache Pilos-Helme schützten ihre Köpfe. Demetrios hatte eine ähnliche Panzerung besessen, aber nun war er stolzer Besitzer einer guten, vollständigen Rüstung, ein Geschenk Philipps dafür, dass er dem König das Leben gerettet hatte.
Bald war die ganze Speira bereit, nur die Phalangiten, die auf Posten standen, fehlten. Die Glieder formierten sich, Aspiden und noch demontierte Sarissen lagen auf den Schultern der Männer. Von ihren Lochagoi angeführt, marschierten die Phalangiten von der Agora, dem einzigen Platz in Elateia, der groß genug war, um ihre Zelte aufzunehmen. Simonides’ Glied hatte eine Position an der Westmauer, die dem größten römischen Feldlager zugewandt war.
Der Marsch war schon vertraut. Erst ging es an den Amtsgebäuden der Stadtverwaltung vorbei, dann an einem Tempel des Zeus. Danach folgte die gepflasterte Straße, die zum Westtor führte. Sie war von Läden gesäumt. Weinhandlungen und Speiselokale mit offener Front, beides sehr beliebt bei den Phalangiten, standen neben den Geschäften der Eisenwarenhändler, der Töpfer, Zimmerleute und Sattler.
Die Straße war voll. Wie es schien, hatte sich die ganze Einwohnerschaft versammelt – abgesehen von denen, die ohnedies auf den Mauern standen –, um zuzusehen, wie die Phalangiten zur Verteidigung der Stadt antraten. Eine ernste Stimmung herrschte. Einige Männer riefen ermutigende Worte, aber die meisten Menschen beobachteten nur. Krumme Graubärte tuschelten untereinander. Vetteln mit haarigem Kinn murmelten Gebete, baten die Götter um ihren Segen. Frauen im gebärfähigen Alter, deren Männer der Garnison angehörten, sahen in besorgtem Schweigen zu. Kleine Mädchen versteckten sich halb hinter ihren Müttern und starrten großäugig auf die einschüchternden Reihen der Soldaten, während ein paar von den kühneren Knaben neben ihnen hergingen, Spielzeug-Sarissen aus Holzstücken geschultert.
Die gedämpfte Stimmung war unangenehm, und es bedeutete eine willkommene Erleichterung, als eine füllige alte Frau aus der Menge schlurfte und jedem Phalangiten, den sie erreichen konnte, feuchte Küsse ins Gesicht drückte. Demetrios beschleunigte den Schritt und konnte ihren Aufmerksamkeiten ausweichen, genau wie die nächsten Männer. Kimon jedoch entkam ihr nicht. Lärmender Beifall erhob sich von seinen Kameraden, als die Vettel ihn umarmte. Er rang sich ein gequältes Lächeln ab. Ermutigt kniff sie ihm in den Hintern und erklärte, wenn er später Zeit habe, könne er mit ihr ein paar schöne Stunden verbringen.
Während des ganzen restlichen Gangs zur Mauer schenkten Demetrios und die anderen Kimon keinen Augenblick Frieden.
»Die Schlacht zu gewinnen lohnt sich allein schon dafür, zusehen zu können, wie ihr beiden die Nacht zusammen verbringt«, stieß Antileon hervor und wischte sich die Lachtränen ab.
»Ich mag sie üppig«, brummte Kimon. »Von Großmüttern hab ich nie was gesagt.«
Am oberen Ende der Treppe war es aus mit der Heiterkeit, denn dort wartete Stephanos, der Kommandeur ihrer Speira, mit grimmigem Gesicht. »Stellt euch zwischen die Städter«, befahl der Speirarchos. »Ein Phalangit auf drei Einheimische.«
Keiner mochte es, von seinen Kameraden getrennt zu stehen, aber der Befehl leuchtete ein. Unter zehn Elateiern war vielleicht ein ausgebildeter Soldat. Wenige Gesichter auf dem Wehrgang zeigten etwas anderes als Angst.
Die Besorgnis der Elateier ist verständlich, dachte Demetrios grimmig, als er eine Stelle in der Mitte der Mauer fand. Das flache Terrain vor der Stadt war mit Feinden übersät. Wenn auch nur ein Bruchteil auf die Wehrgänge gelangte, würde Elateia fallen. Wieder hatten sie die Gunst der Götter dringend nötig, und doch wies nichts darauf hin, dass ihnen solch ein Glück noch einmal beschieden wäre. Gut denkbar, dass dieser Ort zur Stätte seines Grabes wurde.
Sein Nachbar zur Rechten, ein kräftiger Mann mit schlecht sitzendem Leinenpanzer, war wenigstens zehn Jahre älter als Demetrios und sah aus, als hätte er seinen Speer mit der rostigen Klinge länger nicht mehr eingesetzt – wenn überhaupt je. Der Mann lehnte sich an die Zinnen und streckte eine schwitzige Hand vor. »Eurykleides.«
»Demetrios.« Er schlang einen Arm um die beiden Teile seiner Sarissa, damit sie nicht zu Boden fielen, und ergriff Eurykleides’ Rechte.
»War es schlimm in Atrax?«
»Weit schlimmer.«
Eurykleides sah ihn ungläubig an. »Dort waren zweitausend von euch. Wir zählen weniger als die Hälfte.«
»Ja, aber wir hatten ein verflucht großes Loch in der Mauer. Die Römer mussten nur ein wenig klettern, und schon waren sie in der Burg. Hier sind ihre Katapulte nur noch Aschehaufen, und sie müssen mit Leitern und Rammböcken auskommen, wenn sie überhaupt welche haben. Wir brauchen bloß die Tore zu halten und sie von den Mauern in den Graben zu schleudern.« Demetrios war klar, dass er große Angst haben mochte, Eurykleides sich jedoch in viel schlimmerer Verfassung befand. »Das haben wir im Aoos-Tal vierzig Tage lang getan, und wir hätten damit weitergemacht, wenn die Hurensöhne keinen Weg hinter unsere Feldbefestigungen gefunden hätten.« Er setzte ein zuversichtliches Grinsen auf.
Eurykleides sah einen Augenblick lang etwas fröhlicher drein, dann trat Zweifel in seine Miene. »Sie können jederzeit neue Katapulte bauen.«
»Können sie natürlich, aber schau doch – sie tun es nicht. Die Zeit spielt gegen Flamininus. Er braucht einen schnellen Sieg, damit seine Männer ins Winterlager gehen können, ohne dass wir ihnen im Nacken sitzen.«
»Was, wenn sie die Elefanten einsetzen?« Eurykleides erschauerte.
Demetrios hatte es auch nicht gefallen, die großen grauen Tiere zu sehen, aber er war sich sicher, dass sie hier nicht eingesetzt werden konnten. Er schüttelte den Kopf. »Flamininus wird sie für wichtigere Schlachten schonen.«
»Du glaubst, wir können siegen?«
Auf dem Wehrgang war es still, und Eurykleides’ bebende Stimme trug weit. Männer drehten die Köpfe.
Anderthalb Jahre zuvor hätte Demetrios vielleicht der Mut verlassen. Jetzt nicht. Er hatte mehrere brutale Schlachten überlebt, und ihn trennte ein Abgrund von Eurykleides und seinen Nachbarn. Die Ehrfurcht in den Augen des kräftigen Mannes war der beste Beweis.
»Wir müssen ja gar nicht siegen, das ist es doch!«, rief Demetrios.
»Ich – das verstehe ich nicht.« Eurykleides sah zu den nächsten Männern, einem Kerl mit stachliger Frisur, der genauso verängstigt wirkte wie er selbst, und einem zahnlückigen Graubart, der zu gebrechlich wirkte, um noch auf dem Wehrgang zu stehen. Als Antwort erhielt er Schulterzucken und wandte sich wieder Demetrios zu.
»Unsere Pflicht ist, die Bastarde daran zu hindern, in die Stadt zu gelangen, mehr nicht. Wenn wir sie ein halbes Dutzend Mal zurückwerfen und genug von dem Abschaum umbringen, verpissen sie sich bald.« Das klang gut, aber jeder wusste, dass die Zahl der umliegenden Ortschaften, die von den Legionen eingenommen wurden, mit jedem Tag wuchs. Nichts garantierte, dass Flamininus hier keine neuen Katapulte bauen ließ – das hatte er schon getan. Die Artillerie der Verteidiger bestand aus zwei Bolzenschleudern, die in armseligem Zustand waren. Selbst wenn sie nicht zusammenbrachen, konnten die Waffen dem Feind nur wenige Verluste zufügen. Doch die verängstigten Gesichter, die ihn ansahen, mussten glauben können, dass noch nicht alles verloren war. Demetrios sah jeden Verteidiger zwingend an. »Jeder Römer dort draußen war auch bei Atrax, vergesst das nicht. Hunderte ihrer Kameraden sind dort gefallen. Sie haben nicht den Mumm für einen Kampf, der sich lange hinzieht. Standhalten – mehr brauchen wir nicht zu tun.«
»Ja.« Ein Licht strahlte in Eurykleides’ Augen auf. Er schlug Stachelhaar auf den Rücken und nickte dem Graubart grimmig zu. »Ja. Sie daran hindern, auf die Mauern zu kommen. Das können wir schaffen.«
»Das ist der richtige Geist.« Demetrios war erleichtert, dass auch die Männer, die weiter entfernt standen, ein wenig ermutigt wirkten. Kaum sah Eurykleides weg, suchte er mit einem Blick Kimons Aufmerksamkeit. Sein Freund senkte den Kopf, um zu sagen, er habe verstanden, was Demetrios versuchte, dass er das Gleiche tun werde und es an Antileon weitergebe, der als nächster Phalangit rechts kam. Philippos, der links von Demetrios stand, redete bereits mit seinen Nachbarn.
Demetrios hätte den Händler küssen können, der kurz darauf mit einer Reihe von Sklaven im Schlepp eintraf. Sie brachten Wein für jeden Mann auf der Wehrmauer. »Eine kleine Geste der Dankbarkeit!«, rief der Händler. Er hätte den Zeitpunkt seiner Ankunft nicht besser wählen können. Eine gelöstere Stimmung kehrte ein.
Stephanos war der Nächste, der die Mauern entlangkam. Der Speirarchos vergewisserte sich, dass alle Sarissen zusammengesetzt und die langen, gegabelten Stangen, die er angefordert hatte, an Ort und Stelle waren. Ganz der vorbildliche Offizier, ermutigte er seine Männer, scherzte mit ihnen und tauschte mit jedem Städter einige Worte.
»Demetrios.« Kimons Ton verlangte Aufmerksamkeit.
Demetrios schaute über die Mauer, und es gelang ihm, seine Zunge zu hüten und nicht laut loszufluchen. Bei Atrax hatte Flamininus seine Verbündeten vorgeschickt, wilde epirotische, illyrische und dardanische Krieger. Erst als sie gescheitert waren, hatten die Legionäre angegriffen. Heute war es anders. Die Einheiten, die den Mauern am nächsten standen, waren Principes – einige der besten Soldaten in den Legionen.
Demetrios’ Vater hatte immer gesagt, ein Mann solle niemals seine Zukunft planen, denn jedes Mal, wenn er es tue, würden sich entweder die Götter oder die Moiren einmischen. Er hätte von genau diesem Augenblick reden können, dachte Demetrios erbittert. Seine Worte an Eurykleides wirkten nun unfassbar hohl.
Ihr Schicksal hing von Anfang an in der Schwebe.
Eine weitere Stunde verstrich, während sich die Römer auf allen vier Seiten Elateias aufstellten und bewiesen, wie versessen Flamininus darauf war, die Stadt zu erobern. Erst als der Ort umstellt war, begann der Angriff. Zwei Rammböcke bildeten die ernsthafteste Bedrohung. Einer wurde vor das Westtor geschafft, nicht weit von Demetrios’ Standort entfernt, der andere nach Norden gebracht. Mit den Worten, dass Brandpfeile mit den Rammböcken schon fertig wurden und erhitzter Sand ihre Bedienungen vertreiben würden, bereitete Demetrios Eurykleides und dessen Gefährten auf den Kampf vor.
Den gebrechlichen Graubart, der auch Dion hieß, ließ er mit Eurykleides die Plätze tauschen, sodass er direkt rechts von Demetrios stand. Er wusste nicht, ob Eurykleides und Protogenes, der Mann mit den stachligen Haaren, allein standhalten konnten, aber wenigstens waren sie körperlich tauglich. Dion atmete rasselnd und hatte Mühe, seinen Speer aufrecht zu halten. Eine Kopis hing in einer schlichten Scheide an einem Wehrgehänge von seiner knochigen Schulter, und Demetrios bezweifelte, dass er die nötige Kraft hätte, das Hiebschwert zu führen.
Er hätte den Graubart am liebsten von der Mauer geschickt, ehe der Kampf begann, aber nachdem Dion erzählt hatte, wie sein Sohn im vergangenen Sommer bei Ottolobus den Tod fand, brachte er es nicht übers Herz.
»Ein Peltast war er. Konnte auch gut mit dem Wurfspieß umgehen.« Ein Anfall schleimigen Hustens. Dion verzog das Gesicht. »Und ein guter Steinmetz war er. Ich tue mein Bestes, aber meine Werkstatt ist ohne ihn nicht das Gleiche. Seine Frau wollte nicht, dass ich hierhergehe, aber ich sagte zu ihr, mein Sohn betrachtet mich von der anderen Seite. Was für ein Vater oder Großvater wäre ich, wenn ich meine Familie nicht beschützen würde?«
Demetrios versuchte sich vorzustellen, wie er sich fühlen müsste, wenn er unausgebildet wäre wie so viele hier, und seine – lange toten – Eltern lebten in einem Haus irgendwo in der Stadt. Er brauchte nicht lange für den Schluss, dass er zutiefst verängstigt wäre.
»Das ist meine einzige Möglichkeit.« Dion richtete den Blick seiner trüben Augen auf Demetrios.
»Du tust das Richtige«, sagte Demetrios, und er meinte es ernst. »Ich würde das Gleiche tun. Gemeinsam werden wir erfolgreich sein.« Zeus, betete er, lass es wahr werden.
»Da kommen sie!«, rief Kimon.
Demetrios leckte sich die Lippen. In ordentlichen Reihen marschierten die Principes auf Elateia zu. Grob geschätzt kamen drei für jeden Mann auf den Mauern. Die Legionäre wirkten ruhig und entschlossen. Sie trugen Dutzende Leitern.
Zweihundert Schritt entfernt schwirrte das einsame Katapult auf der Westmauer. Sein Bolzen summte über die Köpfe der Römer hinweg und verschwand. Der zweite Schuss ging ebenfalls daneben. Am liebsten hätte Demetrios seine Enttäuschung hinausgebrüllt. Sie hatten keine Aussicht, den Feind wie am Aoos zurückzuschlagen, bevor er die Mauer erreichte, aber selbst ein paar Verluste hätte die Städter ermutigt – und die Phalangiten ebenfalls.
Jubel erhob sich, als ein dritter Bolzen einen Schild durchschlug und sich in den Princeps bohrte, der ihn trug. Noch mehr fielen den Geschossen der Bolzenschleuder zum Opfer, aber die Reihen der Principes erreichten den Graben in einer Ordnung, als wären sie bei einer Parade. Offiziere brüllten. Gruppen von Männern hoben die Leitern über den Graben, während andere daneben hineinkletterten.
Zwei Leitern drohten in Demetrios’ Abschnitt an die Mauer zu schlagen. Er befahl Eurykleides und Protogenes, die rechte mit der gegabelten Stange abzuwehren, die sie hatten, und sagte zu Dion, er möge sich für die linke bereithalten.
»Was, wenn eine dritte kommt?«, fragte der Graubart.
»Gibt dir alle Mühe, sie umzuwerfen. So die Götter es wollen, gelingt es dir. Wenn nicht, springen entweder Eurykleides oder ich dir so schnell zur Seite, wie wir können.«
Demetrios drehte seine Sarissa, sodass ihre Spitze nach außen zeigte. Er schob sie Hand über Hand vor, bis sie über dem Feind hinunterhing. Die nächststehenden Principes wichen zurück, und er lächelte grimmig. Die lange Lanze war wie dazu geschaffen, eine Mauer zu verteidigen. Augenblicke später spießte er den ersten Princeps auf der Leiter auf, aber die Lanzenspitze blieb im Rückgrat des Mannes stecken. Als er sich bemühte, sie zu befreien, hob ein anderer Princeps das Schwert und hackte die Spitze ab.
Sie wissen noch, was am Aoos passiert ist, dachte Demetrios düster.
Ihm gelang es, einen weiteren Römer mit dem zersplitterten Ende von der Leiter zu schlagen, aber dann packten zwei Principes den Lanzenschaft und trennten ein langes Stück ab. Fluchend warf Demetrios die zerstörte Sarissa in den Graben und konzentrierte sich stattdessen auf die Leiter. Von Eurykleides und Protogenes war keine Hilfe zu erwarten. Sie kämpften noch immer, um ihre Leiter von der Mauer zurückzustoßen.
Splitter bohrten sich Demetrios in die Finger, als er das raue Holz packte, aber er achtete nicht darauf. Der Princeps, der heraufzuklettern versuchte, war ein fleischiger Kerl mit schweren Knochen. Demetrios brauchte eine Weile, um ihn hinunterzuschütteln. Rasch stieß er die Leiter zur Seite und sah befriedigt zu, wie sie einen Princeps am Fuß der Mauer verletzte.
»Wieder eine Leiter!« Dions Stimme bebte.
Demetrios eilte dem Alten zur Seite. Die Leiter ragte drei Handspannen weit über die Brustwehr. Er packte sie und versuchte, sie zu sich zu ziehen. Als ihm das nicht gelang, bemühte er sich, sie nach rechts zu drücken, aber auch das ging nicht. Er spähte über die Mauer und entdeckte, dass Flamininus’ Männer etwas gelernt hatten. Die Leiter wurde auf beiden Seiten von je einem Princeps gestützt, der einen gegabelten Stock hielt, eine kleinere Version der Stangen, die die Verteidiger benutzten. Nichts, was Demetrios tat, konnte die Leiter um mehr als wenige Fingerbreit bewegen. Er gab seine Versuche auf, packte Dions Speer, und als der kletternde Princeps in Reichweite war, spießte er ihn auf.
»Eurykleides!« Demetrios wagte nicht, den Blick von der Leiter zu nehmen. Ein anderer Princeps war schon zwei Sprossen hochgestiegen.
»Ja?«
»Wie kommst du zurecht?«
»Wir halten stand.« In der Stimme des Elateiers lag Stolz.