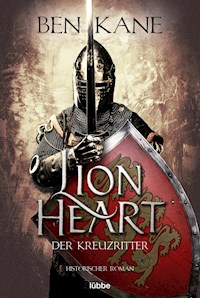9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Löwenherz
- Sprache: Deutsch
Kriegsherr, Gefangener, König - Richard Löwenherz kehrt zurück
Herbst 1192. Viele Jahre hat Richard Löwenherz auf seinen Kreuzzug ins Heilige Land verwendet und doch nicht mehr erreicht als einen Friedensvertrag. Jetzt braucht ihn sein eigenes Land: England wird von Unruhen heimgesucht, und Richards Erzfeind Philippe Capet von Frankreich und sein verräterischer Bruder John wollen die Macht an sich reißen. Alles scheint sich gegen Richard Löwenherz verschworen zu haben: Er erleidet Schiffbruch und gerät in die Fänge Heinrichs VI., der für seine Freilassung weit mehr Lösegeld verlangt, als Königin Alienor aufbringen kann. Philippe Capet und Prinz John hingegen sind bereit, viel Geld zu zahlen - damit der König noch länger in Gefangenschaft bleibt ...
Der abschließende 3. Teil der beliebten Reihe um Richard Löwenherz, erzählt aus der Sicht seines treuen Knappen
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 640
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
Cover
Inhalt
Über das Buch
Über den Autor
Weitere Titel des Autors
Titel
Impressum
Widmung
PERSONENVERZEICHNIS
PROLOG
ERSTER TEIL
KAPITEL I
KAPITEL II
KAPITEL III
KAPITEL IV
KAPITEL V
KAPITEL VI
KAPITEL VII
KAPITEL VIII
KAPITEL IX
KAPITEL X
KAPITEL XI
ZWEITER TEIL
KAPITEL XII
KAPITEL XIII
KAPITEL XIV
KAPITEL XV
KAPITEL XVI
KAPITEL XVII
KAPITEL XVIII
KAPITEL XIX
KAPITEL XX
KAPITEL XXI
KAPITEL XXII
KAPITEL XXIII
KAPITEL XXIV
KAPITEL XXV
DRITTER TEIL
KAPITEL XXVI
KAPITEL XXVII
KAPITEL XXVIII
KAPITEL XXIX
KAPITEL XXX
KAPITEL XXXI
KAPITEL XXXII
KAPITEL XXXIII
Nachbemerkung des Autors
Über das Buch
Kriegsherr, Gefangener, König – Richard Löwenherz kehrt zurück
Herbst 1192. Viele Jahre hat Richard Löwenherz auf seinen Kreuzzug ins Heilige Land verwendet und doch nicht mehr erreicht als einen Friedensvertrag. Jetzt braucht ihn sein eigenes Land: England wird von Unruhen heimgesucht, und Richards Erzfeind Philippe Capet von Frankreich und sein verräterischer Bruder John wollen die Macht an sich reißen. Alles scheint sich gegen Richard Löwenherz verschworen zu haben: Er erleidet Schiffbruch und gerät in die Fänge Heinrichs VI., der für seine Freilassung weit mehr Lösegeld verlangt, als Königin Alienor aufbringen kann. Philippe Capet und Prinz John hingegen sind bereit, viel Geld zu zahlen – damit der König noch länger in Gefangenschaft bleibt ...
Über den Autor
Ben Kane wurde in Kenia geboren und wuchs in Irland auf, im Heimatland seiner Eltern. Bevor er sich ganz dem Schreiben widmete, arbeitete er als Tierarzt. Schon als Kind übte die Geschichte Roms eine große Faszination auf ihn aus, weshalb mit der Veröffentlichung seines Debüts „Die Vergessene Legion“ ein lang gehegter Traum in Erfüllung ging. Mittlerweile ist Ben Kane Bestsellerautor und lebt mit seiner Familie in North Somerset, England.
Weitere Titel des Autors:
Forgotten Legion-Chronicles
Die Vergessene Legion
Der silberne Adler
Der blutige Weg
Eagles of Rome-Reihe
Kampf der Adler
Rache der Adler
Sturm der Adler
Aus der Reihe um Flamininus
Kampf der Imperien
Das letzte Schwert
Aus der Reihe um Richard Löwenherz
Lionheart – Im Dienste des Löwen
Lionheart – Der Kreuzritter
BEN KANE
DERPREISDESTHRONS
HISTORISCHER ROMAN
Übersetzung aus dem Englischen von Dietmar Schmidt
Vollständige E-Book-Ausgabedes in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Deutsche Erstausgabe
Für die Originalausgabe: Copyright © 2022 by Ben Kane Titel der englischen Originalausgabe: »Lionheart – King« Originalverlag: Orion
Für die deutschsprachige Ausgabe: Copyright © 2023 by Bastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6–20, 51063 Köln Textredaktion: Dr. Frank Weinreich, Bochum Covergestaltung: Thomas Krämer Covermotiv: © Nejron Photo /shutterstock; © Nik Keevil /Arcangel Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-7517-4228-3
Sie finden uns im Internet unter luebbe.de Bitte beachten Sie auch: lesejury.de
Für Mama und Dada mit all meiner Liebe.
PERSONENVERZEICHNIS
(Historische Persönlichkeiten sind durch einen Asterisk* gekennzeichnet.)
Ferdia Ó Catháin/Rufus O’Kane, ein irischer Edelmann aus Nord-Leinster
Rhys, Rufus’ walisischer Knappe
Katharina, österreichische Köchin
Jean, Waisenjunge aus Rouen
Robert FitzAldelm, Ritter und Bruder des verstorbenen Guy FitzAldelm
Henry, Soldat aus Southampton (verstorben)
Königshaus von England:
Richard*, König von England, Herzog von Aquitanien
Berengaria*, Tochter König Sanchos VI. von Navarra, Richards Gemahlin
John*, Graf von Mortain, Richards Bruder, auch bekannt als »Lackland« (Johann Ohneland)
Alienor (Eleonore) von Aquitanien*, Richards Mutter und Witwe Henrys II. FitzEmpress* (Heinrich II.), König von England, Herzog der Normandie und Graf von Anjou (verstorben)
Joanna* (Johanna von England), Königin von Sizilien, Tochter Henrys II.
Mathilda* (Mathilde von England), Richards Schwester (verstorben), war mit Heinrich dem Löwen* verheiratet, dem ehemaligen Herzog von Sachsen und von Bayern
Henry (»Hal«, »der junge König«)*, ältester Sohn Henrys II. (verstorben)
Geoffrey*, Graf der Bretagne und dritter Sohn Henrys II. (verstorben)
Constance* von der Bretagne, Geoffreys Witwe
Arthur*, Geoffreys junger Sohn
Alienor*, Geoffreys junge Tochter
Am englischen Königshof und in England:
André de Chauvigny*, Ritter und Cousin von König Richard
Baudouin de Béthune*, Ritter
William de Longchamp*, Bischof von Ely, Richards Kanzler
Hugh de Puiset*, Bischof von Durham
Geoffrey*, unehelicher Sohn Henrys II., Richards Halbbruder und Erzbischof von York
William Marshal*, einer von Richards Justiciars
Guillaume Bruyère* und John de Pratelles*, ebenfalls Justiciars Richards
Kirchenbeamte: Erzbischof Walter de Coutances* von Rouen, Bischof Hubert Walter* von Salisbury, John d’Alençon*, Archidiakon von Lisieux, Abt John* von Boxley, Abt Stephen* von Robertsbridge, Bischof Savaric de Bohun* von Bath, Ralph Besace* und Bruder Peter, priesterliche Ärzte
Adlige: Robert, Earl von Leicester*, Guillaume des Roches*, Robert de Turnham*, Guillaume, Jean und Pierre de Préaux*, Henry Teuton*, William de l’Etang*, Ritter
Mercadier*, Söldnerhauptmann
Robert de Nunat*, Bruder des Bischofs von Coventry
Richard de Drune, Waffenknecht (verstorben)
Henri, Knappe König Richards
Andere Figuren:
William*, König von Schottland
Philippe Capet* (Philipp II. August), König von Frankreich
Alys Capet*, Philippes Schwester, als Kind mit Richard verlobt worden
Bischof von Beauvais*, Cousin des französischen Königs
Dreux de Mello*, Edelmann
Raymond*, Graf von Toulouse
Hugues*, Herzog von Burgund, Cousin des französischen Königs (verstorben)
Baudouin*, Graf von Flandern
Henri de Blois*, Graf der Champagne und Cousin sowohl Richards als auch Philippe Capets
Österreich, Italien, Deutschland und andere Orte:
Leopold V.*, Herzog von Österreich
Heinrich VI. von Staufen*, römisch-deutscher König und Kaiser des Heiligen Römischen Reiches
Heinrich der Löwe*, ehemaliger welfischer Herzog von Sachsen und von Bayern
Philipp von Schwaben*, dessen Bruder, der nach dem Tod Heinrichs VI. im Jahr 1197 den Thron beanspruchte
Konrad der Staufer*, Pfalzgraf bei Rhein und Heinrichs Onkel
Agnes von Staufen*, Konrads Erbtochter Erbin
Engelbert III.*, Graf von Görz, der sich mit seinem Bruder Meinhard II.*, Graf von Görz und Vogt der Kirche von Aquileia, die Herrschaft teilte
Roger d’Argentan*, Ritter
Abt Otto von Moggio
Bertolf, Novize
Friedrich III. von Pettau*, österreichischer Ministerialadliger
Wladislaw Heinrich*, Herzog von Böhmen und Markgraf von Mähren
Hadmar von Kuenring*, Burgherr von Dürnstein
Albrecht von Löwen (Albert von Lüttich)*, Bischofskandidat in Lüttich (verstorben)
Papst Coelestin III.*, Oberhaupt der katholischen Kirche von April 1191 bis Januar 1198
Papst Innozenz III.*, Oberhaupt der katholischen Kirche von Januar 1198 bis Juli 1216
Otto von Braunschweig*, Sohn Heinrichs des Löwen und Mathildas, der Schwester Richards, 1198 zu einem von zwei römisch-deutschen Königen gewählt
Richenza*, Heinrich* und Wilhelm*, Ottos Geschwister
Alienor, Hofdame an Ottos Hof
Isaakos Komnenos*, ehemaliger Kaiser von Zypern
Beatrice*, »Maid von Zypern«, Isaakos’ Tochter, in Richards Obhut
Pietro di Capua (Petrus Capuanus)*, päpstlicher Legat
Sancho*, Bruder Königin Berengarias und Thronfolger von Navarra
Guillaume II. de Hauteville* (Wilhelm II. von Sizilien), König von Sizilien (verstorben)
Gilbert de Vascœuil*, Burgherr von Gisors
Graf Adémar Taillefer* von Angoulême
Geoffroy de Rançon*
Aimar*, Vicomte von Limoges
Hugues de Corni*
Bernard de Brosse*
Pierre Basile*, Waffenknecht
Bertrand de Gurdon, Seneschall von Châlus
Abt Milo* von Poitiers
Tancrède de Lecce* (Tankred von Lecce), ehemaliger Herrscher über Sizilien (verstorben)
Guy de Lusignan* (Guido von Lusignan), ehemaliger König von Jerusalem (verstorben)
Isabella von Jerusalem*, ehemalige Königin von Jerusalem
Onfroy de Toron*, ihr Ehemann
Conrad de Montferrat* (Konrad von Montferrat), in Italien geborener Herrscher von Tyrus, Cousin des französischen Königs Philippe (verstorben)
Boniface de Montferrat*, Conrads Bruder
Saladin*, Al-Malik al-Nasir Salah al-Dīn, Abu’ al-Muzaff ar Yusuf ibn Ayyū, Sultan von Ägypten (verstorben)
PROLOG
Ich stand im Hof der großen Burg Chinon. Helles Sonnenlicht strahlte von einem gewaltigen blauen Himmel, und in den Bäumen jenseits der Mauern sangen fröhlich die Vögel. Entzückte Rufe eines Kindes vermischten sich mit dem Bellen eines Hundes. Rhys war nirgendwo zu sehen; ich war wirklich allein, was mir merkwürdig erschien. Da waren weder Pagen, die eilig ihren Aufgaben nachgingen, noch Soldaten auf dem Wehrgang oder Wäscherinnen, die mit Dienerinnen tratschten. Nicht einmal ein Reitknecht oder Stalljunge war vor den Ställen zu sehen.
Während mein Blick sich zum Tor des Donjons verschob, kam der König herausgeritten. Ich lächelte und öffnete den Mund zum Gruß, aber zu meiner Verblüffung ritt der schwarzhaarige Robert FitzAldelm gleich hinter ihm. Er war ein weiterer enger Gefährte Richards und mein Todfeind; mehr als einmal hatte er versucht, mich zu ermorden. Mein größter Wunsch war es, FitzAldelm sterben zu sehen, aber ich hatte geschworen, ihn nicht zu töten.
Der König kam näher. Sein Gesicht ließ den gewohnten freundlichen Ausdruck vermissen.
Bleib ruhig, sagte ich mir. Du hast keinen Grund zur Sorge.
»Guten Morgen, Sire.« Ich beugte das Knie.
Ich erhielt keine Antwort, und Furcht erfasste mich. Ich stand auf, aber ich grüßte FitzAldelm nicht. Er grinste höhnisch. Obwohl mir die Gräuel durch den Kopf schossen, die ich ihm so gern zugefügt hätte, beherrschte ich meine Miene.
»Robert hat eine ernste Anschuldigung gegen Euch erhoben, Rufus.« Richards Tonfall war kalt.
Mein Herz setzte einen Schlag aus. Er konnte mir nur eines vorwerfen, aber ich wollte verdammt sein, wenn ich es zugab. FitzAldelm hatte keinen Beweis – dafür hatten Rhys und ich gesorgt. Ich setzte meine beste fragende Miene auf. »Wirklich, Sire?«
»Er sagt, Ihr hättet vor zehn Jahren in heimtückischer Weise seinen Bruder Guy in Southampton ermordet.« Richards Blick wechselte zu FitzAldelm, welcher nickte, und kehrte zu mir zurück. »Nur Stunden, nachdem Ihr und ich einander begegnet waren.«
Nachdem du mein Leben gerettet hattest und ich das deine, dachte ich, aber das konnte ich nicht aussprechen.
»Nun?«, fragte der König.
»Das ist nicht wahr, Sire.« Ich habe in Notwehr gehandelt, wollte ich rufen.
»Er lügt!«, schrie FitzAldelm. »Er hat Guy ermordet, Sire, das steht unumstößlich fest.«
»Ich habe nichts Derartiges getan, Sire, und Rhys wird das bestätigen. Er war die ganze Nacht hindurch bei mir.«
In Richards Gesicht deutete sich etwas an, das ich für Zweifel hielt, aber schon im nächsten Augenblick wurde meine Hoffnung zermalmt.
»Robert sagt, er habe einen Zeugen«, fuhr der König gepresst fort. »Jemanden, der Euch in der Sündenmeile gesehen hat, wie Ihr in der gleichen Schenke trankt wie sein Bruder.«
»Einen Zeugen, Sire?« Ich konnte mir den leisen Spott nicht verkneifen. Der Soldat Henry war lange tot. Anders als FitzAldelms Bruder hatte ich den in der Tat kaltblütig ermordet; ich hatte dem Soldaten die Kehle durchtrennt und seine Leiche mit Rhys’ Hilfe tief in einer Abfallgrube versteckt. Die Aussicht, dass man nach so vielen Jahren noch jemanden fand, der sich an mich erinnerte, war sehr gering. Ein Ding der Unmöglichkeit. Richard wandte sich FitzAldelm zu, und ich ebenfalls.
»Henry!«, rief mein alter Feind. Laut. Zuversichtlich.
Nein, dachte ich entsetzt. Das kann doch nicht sein.
Ein Mann erschien im Tor. Selbst auf die Entfernung war sein Bart deutlich zu sehen. Er trat näher. Der spatenförmige Umriss des Bartes war unverkennbar. Auch das Gesicht war mir vertraut.
Ich begann zu zittern. Du bist tot!, wollte ich rufen. Ich habe dich mit eigenen Händen getötet und begraben. Das Entsetzen umschlang mich, während ich zusah, wie Henry sechs Schritt vor Richard auf die Knie fiel und den Kopf neigte. »Sire.«
»Erhebe dich«, befahl Richard. Er wandte sich an FitzAldelm: »Das ist er?«
»Jawohl, Sire.«
Ein knappes Nicken, und er betrachtete den Neuankömmling. »Name?«
»Henry, Sire. Ein Soldat bin ich, aus Southampton.«
Mich fragte der König: »Kennt Ihr diesen Mann?«
»Nein, Sire«, log ich und unterdrückte irgendwie das Beben meiner Stimme.
»Ihr habt ihn nicht in der Nacht, in der Sir Roberts Bruder getötet wurde, in der Schenke gesehen?«
Erleichtert sagte ich wahrheitsgemäß: »Nein, Sire.«
»Er aber sah Euch. Ist das nicht richtig?«
»Es stimmt, Sire.« Henry begegnete meinem Blick.
Übelkeit stieg mir in die Kehle. Henry war tot und begraben, bis auf die Sehnen und Knochen verfault. Und doch stand er hier, und sein Zeugnis sollte mein Schicksal so sicher besiegeln wie die Klinge eines Feindes.
»Sieh gut hin«, riet Richard ihm. »Es ist viele Jahre her. Das Aussehen der Menschen verändert sich.«
»Ich bin sicher, Sire«, sagte Henry. »Sein roter Haarschopf ist unverkennbar, und das grobknochige Gesicht ebenso. Das ist der gleiche Mann, und das werde ich auf eine Reliquie schwören.« Einen heiligeren Eid konnte er nicht anbieten.
In FitzAldelms Augen glitzerte boshafter Triumph.
»Sagt uns, was Ihr gesehen habt«, forderte der König ihn auf.
»Er hat sich sehr für zwei Männer interessiert, die sich eine Hure geteilt hatten, Sire. Als sie gingen, schlich er ihnen hinterher. Einer der beiden, Sire, war Messire Roberts Bruder.«
»Woher weißt du das?«, fragte der König scharf.
Henry sah FitzAldelm an. »Sie gleichen sich – glichen sich – wie zwei Erbsen aus einer Schote, Sire.«
»So war es, das ist richtig.« Richards Blick heftete sich auf mich. »Nun? Was habt Ihr zu sagen?«
Verunsichert bekam ich es mit der Panik und setzte an: »Sire, ich …«
»Wart Ihr in der Schenke?«
Ich sah Henry an, FitzAldelm, den König. Ich kam mir vor wie eine Ratte in einer Falle. Verdattert stotterte ich: »Das … das war ich, Sire.«
»Ich habe es gewusst!«, trumpfte FitzAldelm auf.
Richards Miene stand auf Sturm. »Und Ihr seid Guy und dessen Knappen gefolgt?«
Ich erwog zu lügen, doch mein Gesicht, das tiefrot angelaufen war, hatte mich schon verraten. Ich wollte mich nicht noch mehr versündigen. »Das habe ich, Sire, aber das macht mich nicht zum Mörder! Wie sollte ich so etwas zuwege bringen – ein Mann gegen zwei?« Ich verabscheute mich für meinen Tonfall; meine Stimme war so schrill wie die eines Fischweibs.
»Weil Euer dreckiger Knappe draußen wartete, um Euch zu helfen!«, schrie FitzAldelm. »Sire, ich habe einen weiteren Zeugen, der gesehen hat, wie Rhys nicht lange nach Rufus das königliche Quartier verließ.«
Ein schwarzer, bodenloser Abgrund öffnete sich vor meinen Füßen. In seinen Tiefen erblickte ich einen rötlich-orangenen Schimmer. Höllenfeuer, dachte ich, das darauf wartet, mich zu verschlingen. Mich zu verzehren für das, was ich getan habe.
Taub vor Schock stand ich da, während ein Stallknecht mit struppigen Haaren hereingerufen wurde, ein Mann, an den ich mich nicht erinnerte, der dem König aber bekannt war. Seine Aussage war vernichtend. Er hatte beobachtet, wie Rhys mir nachschlich, und am folgenden Morgen hatte er belauscht, wie wir über meinen verletzten Arm sprachen.
»Nun?«, grollte Richard. »Was sagt Ihr dazu?«
Ich hatte nichts zu verlieren. »Ich habe Guy FitzAldelm getötet, aber es war Notwehr.«
»Ihr seid ihm in die Gasse nachgeschlichen, und dann hat er Euch angegriffen?« Im Gesicht des Königs lagen Hohn und Unglaube im Widerstreit.
»So war es, Sire«, betonte ich.
Richard achtete nicht auf mich. Er rief nach seinen Wachen. Stämmige Waffenknechte in königlicher Livree erschienen so geschwind, als hätten sie nur darauf gewartet, dass man sie rief.
Ich wurde abgeführt und beteuerte dabei meine Unschuld. Tief in den Eingeweiden des Donjons wurde ich in eine fensterlose, stinkende Zelle mit Steinfußboden geworfen. Mit dem Eindruck der Endgültigkeit knallte die Tür zu. Ich hämmerte mit den Fäusten gegen die Bohlen. »Lasst mich raus!«
Ein mitleidloses Lachen war meine Antwort. Es stammte von Robert FitzAldelm – er war den Soldaten gefolgt.
Ich hämmerte erneut gegen die Tür. »Ich bin kein Mörder!«
»Sagt das dem Scharfrichter.«
»Der König wird solch einen Befehl niemals erteilen!«
Ein amüsiertes Schnauben. »Dann kennst du ihn nicht so gut, wie du glaubst. Das Datum steht schon fest.«
Mehr als einmal in meinem Leben hatte ich gesehen, wie ein Mann einen Hieb in die Magengegend gleich unterhalb des Brustkorbs bekam. Ein Treffer an dieser Stelle trieb ihm sämtliche Luft aus der Lunge und warf ihn benommen und mit schlaffem Kinn zu Boden. FitzAldelms Worte trafen mich mit der gleichen Wirkung. Meine Knie gaben nach, und ich sackte auf den Steinplatten zusammen. Ich lehnte den Kopf an die dicken Bohlen der Tür und hörte schwach, wie FitzAldelms Schritte sich entfernten.
Ich besaß nicht mehr die nötige Kraft, um mich aufrecht zu halten. Mit einer Hand stützte ich mich nach hinten ab, damit ich nicht stürzte und mir den Kopf anschlug, dann legte ich mich hin. Wollte, dass die Schwärze mich nahm. Wollte nie wieder erwachen und mich dem grausamsten Schicksal stellen, das mein Lehnsherr befohlen hatte, den ich liebte wie einen Bruder.
Ich schloss die Augen.
Eine Hand ergriff meine Schulter, und Entsetzen durchfuhr mich wie der Stich einer Lanze.
Ich erwachte schwitzend, in Panik. Statt kaltem Stein spürte ich Planken unter mir. Hörte Holz knarren und Wasser leise gegen den Rumpf platschen. Meine Sinne kehrten zurück. Die Schwärze ringsum rührte von der Nacht, nicht von einer fensterlosen Zelle. Ich war auf See, auf dem Rückweg vom Heiligen Land, und Rhys war es, der mich geweckt hatte.
Er kauerte neben mir, das Gesicht vor Sorge verzerrt. »Pst«, zischte er. »Jemand hört dich noch.«
Aber zu meiner großen Erleichterung hatte mich niemand vernommen. Die Konfrontation mit Richard und FitzAldelm war nur ein lebhafter Albtraum gewesen. Mein dunkles Geheimnis war sicher.
Vorerst.
ERSTER TEIL
KAPITEL I
Das istrische Ufer des Adriatischen Meeres, Dezember1192
Kaltes Meerwasser schmatzte in meinen Stiefeln. Hemd und Beinlinge klebten durchtränkt an mir. Zitternd zog ich den nassen Mantel enger und wandte den Rücken im vergeblichen Wunsch gen Süden, dass ich damit den eisigen Wind abhalten könnte, der mir über den von Gänsehaut überzogenen Leib strich. Von den zwanzig Gefährten des Königs war ich der einzige Unglückliche, der ins Wasser gefallen war, als wir unser gestrandetes Schiff verließen. Richard stand ein Dutzend Schritte entfernt und hielt dem Piratenkapitän eine Strafpredigt, der uns an diesen gottverlassenen Ort gebracht hatte, einen eintönigen Küstenstreifen ohne Dörfer oder Ansiedlungen in Sichtweite. Soweit das Auge reichte, erstreckten sich Schlickgras und Gezeitentümpel voller Salzwasser und deuteten auf einen langen Marsch ins Landesinnere hin.
»Wechsle deine Kleider jetzt, solange du es noch kannst.«
Meine mürrische Aufmerksamkeit kehrte zu Rhys zurück, der über mein Missgeschick genauso laut gelacht hatte wie die anderen. Wahrlich, ich konnte es weder ihm noch sonst jemandem verübeln. Das Wasser war nicht tief, und außer, dass ich durchnässt wurde, war mir nichts geschehen. Und nach den Mühen der zurückliegenden Wochen konnten wir einen Moment der Heiterkeit weiß Gott gut gebrauchen. Dennoch, mein Stolz war verletzt. Ich antwortete mit einem nichtssagenden Grunzen.
»Du erkältest dich, bis wir einen Lagerplatz für die Nacht finden.« Nun klang Rhys tadelnd. Er hatte bereits begonnen, in meiner hölzernen Truhe zu wühlen, und zog ein Bündel trockener Kleidungsstücke hervor. »Nun mach schon.«
Mit klappernden Zähnen musterte ich die Gruppe. Wenige Männer schenkten uns Beachtung, denn sie waren damit beschäftigt, das Zeug auszuwählen, das sie tragen konnten. Wir waren alle Soldaten, überlegte ich. Gemeinsam hatten wir im Heiligen Land gelitten und geschwitzt, geblutet und mit angesehen, wie Kameraden wahllos den sarazenischen Feinden zum Opfer fielen oder an Durst oder Sonnenstich starben. Wir hatten die Köpfe unserer Freunde im Schoß gewiegt, während das Leben aus ihnen wich, sie an ihrem Blut erstickten oder nach ihren Müttern riefen.
Angesichts dessen spielte es keine Rolle, wenn ich meinen Hintern entblößte.
Ich zog Stiefel und Kleider aus, zupfte dankbar an den neuen Gewändern und überhörte die Kommentare Baudouin de Béthunes, der bemerkt hatte, was ich tat. Er war ein guter Freund und gehörte wie ich zu den engsten Vertrauten des Königs. Mit einem Stich dachte ich an de Drune, einen anderen Freund, der sich die Gelegenheit zu sticheln ebenfalls nicht hätte entgehen lassen. Aber der zähe Waffenknecht machte keine Scherze mehr. Bei dem ersten der Stürme, die uns seit unserem Aufbruch aus dem Heiligen Land vor mehr als zwei Monaten plagten, war er über Bord gegangen. Ich hoffte, dass sein Ende schnell gekommen war.
»Zweihundert Mark, und ausgerechnet hier werft Ihr uns an Land?« Richards Jähzorn hatte in keinerlei Hinsicht nachgelassen. Mit einem mordlustigen Blick maß er den Piratenkapitän, der sich klugerweise auf sein Schiff zurückgezogen hatte. Wenn am Abend die Flut kam, würden er und seine Mannschaft ihr Bestes tun, um den langen, niedrigen Rumpf ins tiefere Wasser zu schieben. Wir würden nicht säumen, um ihnen zu helfen.
Der Pirat war ein Schurke, und der Preis, den er für unsere Überfahrt verlangt hatte, konnte nicht anders als erpresserisch genannt werden, aber für den Strand, auf dem wir standen, traf ihn keine Schuld. »An dem Sturm vermochte er nichts zu ändern, Sire.«
Richard sah mich wütend an, aber ich hatte die Wahrheit ausgesprochen.
Grimmige Herbststürme hatten unseren großen Einmaster den ganzen Weg vom Heiligen Land hierher gebeutelt; wir konnten von Glück reden, dass wir nicht allesamt ertrunken waren. Auf Sizilien hatte der König entschieden, dass das offene Meer zu gefährlich sei, daher nahmen wir Kurs auf Korfu. Geplant hatten wir, die ruhigere Adria hinaufzufahren, aber noch mehr Schlechtwetter und eine Begegnung mit den Piraten hatten dazu geführt, dass Richard dem Korsarenkapitän einen Handel vorschlug. Seine beiden Galeeren waren seetüchtiger als die dickbauchige Bucia, mit der wir das Heilige Land verlassen hatten. Zumindest waren wir dieser Ansicht gewesen.
Starker Wind – die Bora – hatte kurz nach unserem Aufbruch von Korfu zugeschlagen und uns hilflos die Adria hinaufgetrieben; drei Tage lang, oder waren es gar vier? Auf mein Gedächtnis war kein Verlass, so erschöpft und übermüdet war ich. Stunde um Stunde war es ununterbrochen auf und ab gegangen, war ich auf die eine Seite und die andere, nach vorn und nach hinten geworfen worden. Ich hatte mich erbrochen, bis es mir vorkam, als würgte ich zuletzt noch den Magen selbst die wunde Kehle hinauf. Dazwischen hatten kurze, unbehagliche Ruhepausen gelegen, aber sie hatten nicht genügt. Ich hatte vergessen, wann ich zum letzten Mal Nahrung herunterbekommen hatte. Als das Schiff im seichten Wasser auf Grund lief, hatte ich nichts anderes empfunden als Erleichterung. Ich konnte es kaum erwarten, trockenes Land unter den Füßen zu haben, gab nicht ausreichend Acht, als ich mich fürs Ausschiffen bereitmachte, und fiel ins Wasser.
»Wahrlich, es lässt sich nichts daran ändern, wo wir jetzt sind«, sagte der König. »Und hier herumzustehen bringt uns auch nicht nach Sachsen. Lasst uns gehen.«
Er war nun nicht die göttergleiche Gestalt, als die er im Heiligen Land so oft erschienen war. Keine helle Sonne blitzte auf seinem Ringpanzer, kein tänzelnder Hengst hob ihn hoch über uns alle. Selbst in schlichtem Hemd und Beinlingen blieb Richard jedoch ein imposanter, charismatischer Mann. Er war mehrere Zoll größer als sechs Fuß und breitschultrig. Vom Wind zerzaustes rotgoldenes Haar umgab sein stattliches Gesicht. Er sah aus wie ein König. Er benahm sich auch wie einer: reizbar, majestätisch und furchtlos.
Als er voranging, folgten wir zwanzig ihm bereitwillig.
Mich überraschte nicht, dass Rhys als Erster eine Frage stellte. Halblaut sprach er mich an: »Wie weit ist es bis Sachsen?«
»Das weiß ich nicht. Hunderte von Meilen. Viele Hunderte.«
Ich sagte ihm das nicht zum ersten Mal, aber trotzdem verdüsterte sich Rhys’ Miene.
»Das schaffen wir nicht zu Fuß. Wir müssten Pferde kaufen.«
Er rollte mit den Augen. »Wären wir nur früher aufgebrochen. Dann wären wir vielleicht mit dem Schiff bis nach Hause gekommen.«
»Das war niemals zu erwarten.« Erneut erklärte ich ihm, dass die Winde und Strömungen, die uns nach Osten über die Griechische See getragen hatten, zu stark seien, um uns die Fahrt nach Westen durch die schmale Meerenge zu gestatten, die Spanien von Afrika trennt.
Rhys verfiel in Schweigen, und ich, niedergeschlagen wegen der langen Reise, die vor uns lag, begann zu brüten. An der spanischen oder französischen Küste zu landen wäre eine Möglichkeit gewesen, war aber wegen Richards alter Feindschaft zum Grafen von Toulouse unmöglich, der zusammen mit seinen spanischen Verbündeten die Region beherrschte. Wir konnten auch nicht Italien hinaufreisen, weil die meisten der dortigen Fürsten mit dem staufischen Kaiser des Heiligen Römischen Reiches verbündet waren. Heinrich VI., einer der mächtigsten Monarchen ganz Europas, hatte nicht viel für Richard übrig, weil dieser einen anderen Heinrich unterstützt hatte; Heinrich den Löwen, den ehemaligen Herzog von Sachsen und von Bayern. Und in jüngerer Zeit hatte sich der Graben zwischen Richard und dem Staufer noch vertieft. Der französische König Philippe Capet hatte sich bei seiner Rückkehr aus dem Heiligen Land mit dem Kaiser getroffen, Heinrich VI. für sich gewonnen und ein neues Bündnis geschmiedet.
Der Gedanke an Heinrich den Löwen weckte eine wehmütige Erinnerung an Alienor, die blonde Schönheit, die Mathilda gedient hatte, Heinrichs verstorbener Frau und Richards Schwester. Dass ich Alienor zuletzt gesehen hatte, lag Jahre zurück, und doch brachte allein der Gedanke an sie mein Blut in Wallung. Es bestand sogar die Aussicht, dass wir uns begegneten. Nachdem unsere umständliche Route uns zunächst durch Ungarn führte, würden wir nach Sachsen gehen, das von Richards Neffen beherrscht wurde, und weiter nordöstlich in das Land von Heinrich dem Löwen. Ich betete, dass Alienor noch lebte und in Heinrichs Diensten stand. Mich befiel ein Schuldgefühl, weil ich an sie dachte, obwohl ich noch in Joanna, die Schwester des Königs, verliebt war, und verbannte Alienor aus meinen Gedanken.
Nur gut, dass ich mich entschieden hatte, meine trockenen Ersatzstiefel nicht zu tragen. Eine Stunde oder mehr stapften wir durch sandiges Sumpfland, dessen einzige Bewohner die Meeresvögel waren, die kreischend in die Lüfte stiegen, sobald wir uns näherten. Nun hatte ich die Oberhand und lachte über de Béthune und die anderen, wenn sie bis zu den Knien in die Salzwassertümpel einsanken und ihre durchtränkten Stiefel verwünschten. Als wir endlich das Ufer erreichten, kamen wir an eine Ansammlung heruntergekommener Hütten, die kaum verdient hatte, dass man sie als Weiler bezeichnete.
Während Richard zurückblieb – denn ein Mann seiner Größe und Haltung musste sich jedermanns Gedächtnis einprägen –, gingen de Béthune und ich mit dem Standartenträger des Königs, Henry Teuton, in den Flecken, um uns zu erkundigen, wo wir waren, und alle Pferde zu kaufen, die wir bekommen konnten. Dank der Soldaten, die wir im Heiligen Land kennengelernt hatten, sprachen de Béthune und ich ein wenig Italienisch, und Henry Teuton beherrschte fließend die deutsche Sprache seines Vaters. Gemeinsam kamen wir zurecht, und die Silbermünzen, die ich anbot, halfen ebenfalls, die Zungen zu lösen. Das Gebiet, in dem wir uns wiederfanden, gehörte zur Grafschaft Görz. Ich dachte mir nichts dabei, aber mir fiel de Béthunes Miene auf, als der Name ihres Fürsten erwähnt wurde, Meinhard II.
Der Schmied befahl seinem Lehrjungen, die Pferde zu holen, die er hatte, und erklärte, Meinhard herrsche gemeinsam mit seinem Bruder Engelbert III., dem Herrn der nächsten Stadt, die ebenfalls Görz hieß. Sie lag einige Meilen entfernt am Fuße des Gebirges.
Während wir über die Rösser feilschten, riskierte de Béthune viel, indem er danach fragte, wie Meinhard und Engelbert zum Kaiser Heinrich VI. standen. Der Schmied legte Zeigefinger und Mittelfinger zusammen, was bedeutete, dass sie enge Verbündete waren, und meine Besorgnis nahm zu.
Doch der König lachte nur, als de Béthune ihm berichtete, was er herausgefunden hatte. »Wir haben uns von Anfang an auf feindlichem Boden befunden«, verkündete er, »ganz, wie es im Heiligen Land war, als Saladins Mannen uns ohne Unterlass bedrohten.«
Nachdem er mit seinen Worten unsere Zuversicht gestärkt hatte, grinsten wir einander an.
William de l’Etang, ein anderer enger Vertrauter des Königs, runzelte die Stirn. »Der Name Meinhard ist mir bekannt, Sire.«
»Sprecht«, bat ihn der König.
»Ich bin mir sicher, dass er mit Conrad de Montferrat verwandt ist, Sire. Sein Neffe, wie ich glaube.«
De Béthune und ich tauschten wieder einen Blick; Richards Miene spannte sich an.
Conrad war ein ehrgeiziger italienischer Adliger gewesen, der in der Gesellschaft des Heiligen Landes hoch aufgestiegen und im vergangenen Frühjahr zum König von Jerusalem gekrönt worden war. Binnen einer Woche hatte er bei einem Mordanschlag den Tod gefunden. Jeder im Heiligen Land wusste damals, dass die Assassinen – eine geheimnisvolle muslimische Sekte – hinter dem Mord an Conrad steckten, aber hartnäckig hielt sich ein böswilliges Gerücht, das von Philippe Capet und seinen Anhängern verbreitet wurde. Nicht allein Conrads Familie glaubte deshalb, dass Richard für den Mordanschlag verantwortlich war.
»Wir sollten lieber nicht vorgeben, wir wären Templer«, entschied Richard. Das war sein ursprünglicher Plan gewesen. »Wir würden unerwünschte Aufmerksamkeit auf uns ziehen. Unsere Köpfe müssen noch tiefer unter die Mauerkrone gezogen werden. Pilger sollen wir also sein, die aus dem Heiligen Land zurückkehren. Ich werde mich Hugues von der Normandie nennen. Für Euch besteht kein Anlass für einen falschen Namen, Baudouin. Ihr werdet als der militärische Anführer der Gruppe auftreten.«
Mir erschien es als die bessere List, meine Erleichterung bestand jedoch nur vorübergehend. Denn mit seinem nächsten Atemzug befahl der König Henry Teuton, eines unserer vier neuen Pferde zu nehmen und nach Görz vorauszureiten. Dort sollte er um sicheres Geleit bitten, einen Führer und eine Behandlung nach dem Gottesfrieden: Der Kirchenerlass schützte alle, die das Kreuz genommen hatten, vor körperlicher Gewalt. Richard zog einen prächtigen Rubinring vom Finger und reichte ihn Henry mit den Worten, dass dieser ein Zeichen seiner Gutwilligkeit sei.
Die meisten von uns waren mit dem Gedanken bei prasselndem Feuer und warmem Essen und bemerkten es kaum.
Ich konnte indes nicht fassen, welches Risiko der König einging. »Ist das seine Vorstellung davon, unerkannt zu reisen?«, flüsterte ich de Béthune zu.
»Ich gebe Euch recht, Rufus, aber so ist unser Herr.« Als er mein Gesicht sah, fügte er hinzu: »Widersetzt Euch ihm, doch Ihr tut es auf eigene Gefahr. Er ist in einer heiklen Stimmung.«
De Béthune sah es genau richtig. Des Königs Jovialität an Bord des Schiffes war durchaus echt gewesen, aber Richard hatte es schwer getroffen, dass das Fahrzeug mitten im Nirgendwo strandete. Dazu kamen der lange, beschwerliche Marsch zu dieser Achselgrube von Dorf und die spatkranken Pferde mit ihren Senkrücken – mehr war hier nicht zu haben. Nun erwies sich Meinhard auch noch als Conrads Neffe. Wenn er kein stolzer Templer sein konnte, stellte ein wohlhabender, einflussreicher Pilger die nächstbeste Rolle dar. Und seinem hochmütigen Gesicht nach würde Richard sich nicht umstimmen lassen. Ich beschloss eine andere Vorgehensweise.
»Sire, lasst mich ebenfalls gehen.« Ich fügte hinzu, dass ich mein Deutsch üben wollte und Henry ein guter Lehrer sei. Das genügte. Richard gab mir sogar eines der drei verbliebenen Pferde, einen Fuchs, bei dem man die Rippen zählen konnte.
Wir brachen sofort auf. Das Verhör begann, bevor wir auch nur hundert Schritt geritten waren.
»Ihr wollt Deutsch lernen?« Henry hatte einen schweren, kaum verständlichen Akzent.
»Richtig.« Meinen eigentlichen Grund wollte ich nicht zugeben. Henry war ein nüchterner, direkter Mann, bei dem ich mir gut vorstellen konnte, dass er geradewegs in die Burg Görz einritt und lauthals Richards Bitten verkündete. Ich beabsichtigte, diskreter vorzugehen und wenn irgend möglich den Rubinring verborgen zu halten.
Davon konnte ich Henry nichts sagen – pflichtbewusst und starr, wie er war, würde er die Anweisungen des Königs buchstabengetreu ausführen wollen. Meine Strafe bestand daher in einer langen, von drohenden Fingern erfüllten Lektion in den Grundlagen der deutschen Sprache, die sich den gesamten Ritt nach Görz hinzog. Doch ich klinge undankbar; Henry war in der Tat ein halbwegs brauchbarer Lehrer, und ich lernte auf diesen Meilen mehr als während der ganzen Reise durch das Heilige Land.
Görz lag am Fuße eines Berges, von dem die Burg aufragte, Engelberts Festung. Eine eigene Mauer umgab die Stadt, und am Haupttor standen Wächter, aber zu meiner Erleichterung konnten wir ungehindert passieren.
»Schaut Euch nicht so viel um«, sagte Henry halblaut.
Ich beherrschte mich. Nach zwei Monaten auf See, mit nur einem kurzen Zwischenspiel in Ragusa, gab mir selbst ein unbedeutendes Kaff wie Görz Anlass, mich mit großen Augen umzusehen wie ein neugieriges Kind. Obwohl Henry recht hatte, mir unseren Auftrag in Erinnerung zu rufen, fand ich, wir hätten es nicht so eilig, dass wir nicht noch eine nahe Bäckerei aufsuchen konnten. Ich war schimmeliges Brot und Salzfleisch leid, und unwiderstehliche Düfte kitzelten mir in der Nase. Trotz Henrys Einwänden zügelte ich meinen Fuchs, ging hinein und kam kurz darauf begeistert zurück, in den Händen vier Honigpasteten.
»Zwei für Euch und das Gleiche für mich«, sagte ich, um seinem Ausbruch zuvorzukommen. »Wir können essen, während wir zur Burg hochgehen.«
Besänftigt hörte Henry mit dem Grummeln auf und haute tüchtig rein.
Die Wächter am Burgtor waren ein schlampiger Haufen, ihre Ringpanzer von braunen Rostflecken übersät; sie schenkten uns genauso wenig Beachtung wie ihre Kameraden am Stadttor. Ihr Mangel an Interesse erklärte sich durch die Menge auf dem Burghof, wo wir zu unserer Freude entdeckten, dass Graf Engelbert in der Wohnhalle zu Gericht saß.
Wir ließen unsere Pferde in der Obhut eines spindeldürren Jungen mit scharfen Gesichtszügen von ungefähr zwölf Jahren. Sein Blick klebte auf den beiden Silberpennys, die Henry ihm als Belohnung hinterher versprach, und er schwor, dass er die Pferde mit seinem Leben beschützen werde.
»Das tust du auch besser«, warnte Henry ihn ruhig, »sonst jagen wir dich und schlitzen dich von den Eiern bis zum Kinn auf – das haben wir schon mit vielen Sarazenen so gemacht.«
Mit bleichem Gesicht nickte der Bursche.
Wir schlossen uns der Warteschlange der Bittsteller an; Einheimische, die Engelbert ihre Anliegen vortragen wollten, der mit den Füßen auf dem Tisch dasaß und träge mit einem Dolch spielte. Er war die fleischgewordene Langweile. Die Reihe kam nur im Schneckentempo voran, aber weil wir darauf bedacht waren, keine Aufmerksamkeit zu erregen, wagten wir nicht, uns vorzudrängen. Wenn wir miteinander sprachen, dann leise; je weniger Umstehende Französisch oder mein schlechtes Deutsch hörten, desto besser. Die Zeit kroch dahin. Ich lauschte auf die Gespräche ringsum und versuchte, etwas aufzuschnappen. Zu meinem Verdruss erkannte ich nur gelegentlich ein Wort, aber nie die volle Bedeutung des Gesagten. Auf unserer langen Reise wäre gewiss Zeit genug für weitere Lektionen Henrys, versicherte ich mir.
Zwei Fälle waren abgehandelt, als ich hörte, wie die Kirchenglocken in der Stadt eins schlugen. Meine Hoffnung versiegte. Engelbert war in keiner Weise verpflichtet, jeden in der Schlange anzuhören. Er konnte das Gericht jederzeit beenden, wenn ihm die Geduld ausging. Zu unserem Glück jedoch geriet er über einen händeringenden Bauern in Zorn. Henrys belustigter Übersetzung zufolge beklagte der arme Kerl den Diebstahl seiner Hühner – durch einen Nachbarn, das behauptete er zumindest. Von der Behauptung nicht überzeugt, befahl Engelbert dem unglückseligen Bauern, ihm aus den Augen zu gehen. Er weigerte sich auch, das Anliegen des nächsten Mannes anzuhören – ein Kaufmann, dessen Gestammel ihn verärgerte –, und gelangte in dem darauffolgenden Fall zu einem Urteil, kaum dass er ihm vorgetragen worden war. Wir rückten drei Plätze in der Warteschlange vor und standen nun so nahe, dass wir Engelbert betrachten konnten.
Er war vielleicht fünfunddreißig Jahre alt, hatte schüttere braune Haare und eine markante Stirn. Obwohl er bei dem Bauern die Beherrschung verloren hatte, war sein Gesicht freundlich, und gerade lachte er über das, was immer der letzte Kläger gesagt hatte. Trotzdem durften wir es nicht an Vorsicht missen lassen; Engelbert war ein Feind.
Endlich kamen wir an die Reihe. Gelangweilt und fröstelnd vom Herumstehen – wie alle Wohnhallen war der Saal so zugig wie eine Scheune – setzte ich eine unterwürfige, aber zuversichtliche Miene auf, als uns ein Vogt heranwinkte, und wir traten vor Engelberts Tisch. Wie vereinbart, verbeugten wir uns beide tief. Schmeichelei konnte unseren Absichten nur dienen.
Sein erster Blick bezeigte Desinteresse. Als er dann unsere schlammbespritzte Reisekleidung und unsere Dolche bemerkte, durch die wir uns von den anderen Bittstellern abhoben, schärfte sich sein Gesicht. Wir waren nicht allein Fremde, wir waren bewaffnete Fremde. Er zog eine Braue hoch und sagte etwas auf Deutsch.
Henry antwortete, und ich hörte »Heiliges Land« heraus, Wörter, die er mir auf dem Ritt nach Görz beigebracht hatte. Er teilte Engelbert mit, dass wir Pilger auf dem Weg in die Heimat seien.
Die Miene des Grafen belebte sich. Er stellte eine Frage, noch eine und wieder eine. Ich hörte, wie von Jerusalem gesprochen wurde, von Saladin, Leopold und Richard.
Henrys Antworten, ruhig und gemessen, beanspruchten einige Zeit. Ich stand neben ihm und wünschte mir, dass ich mehr vom Gesagten verstand. Je weniger er verrate, hatte ich Henry beim Warten eingeschärft, desto besser. Tragt unser Anliegen mit schlichten Worten vor, hatte ich gesagt, und betont, er solle weder de Béthune noch den Kaufmann Hugues erwähnen, solange es nicht unbedingt erforderlich wäre.
Der Graf stellte wieder eine Frage, und Henry antwortete. Diesmal hörte ich »Akkon« und »Joppa« heraus. Erinnerungen an unseren brutalen Marsch vom ersten zum zweiten Ort und an die titanische Schlacht gegen Saladin vor Arsur traten mir in den Sinn. Ich warf einen Blick auf Henry, dessen Gesicht die eigene Gefühlsbeteiligung verriet; auch er war dort dabei gewesen. Ich machte mir immer größere Sorgen, dass er unbeabsichtigt etwas über Richard offenbaren könnte. Halte es einfach, beschwor ich ihn in Gedanken.
Ein Bote trat zu Engelbert und schenkte mir eine Gelegenheit, mit Henry zu sprechen. »Habt Ihr um sicheres Geleit gebeten?«, fragte ich. »Hat er es gewährt?«
»Gebeten habe ich ganz zu Anfang darum, aber er stellte sofort eine Frage nach der anderen. Der Heerzug gegen Saladin fasziniert ihn. Was sollte ich anderes tun, als ihm davon zu berichten?«
Darauf wusste ich keine Antwort. Weigerte er sich, auf Engelberts Fragen einzugehen, riskierte er, dass dieser uns sicheres Geleit und Führer versagte. Lieferte er zu viele Einzelheiten, erkannte der Graf vielleicht, dass nicht de Béthune unser Anführer war, sondern jemand weit Bedeutenderes. Auf der Reise waren wir in so viele Häfen eingelaufen, dass sich die Nachricht vom Nahen unseres Königs bis hierher verbreitet haben mochte.
Als Engelbert mit dem Boten fertig war, wandte er seine Aufmerksamkeit erneut Henry zu. Nun fiel mehrmals das deutsche Wort Herr, das sie anstelle von Messire oder Lord benutzten. Henry antwortete; er sprach von »de Béthune« und »Hugues«. Wieder bat er um sicheres Geleit, so viel verstand ich, und hängte ein »bitte« an, das von Herzen kam.
Beunruhigt, dass er allzu verzweifelt klingen mochte, wandte ich wie beiläufig den Kopf zu Henry. Er sah mich nicht. Ich schob meinen Fuß seitwärts, und als ich seinen Stiefel spürte, trat ich sachte dagegen.
Er blickte mich an, und ich hauchte lautlos: Gebt ihm den Ring nicht.
Er runzelte die Stirn. Seine Lippen bildeten ein Was?
Himmel!, dachte ich.
Eine Frage von Engelbert; der Graf zog die Brauen zusammen.
Henry antwortete nicht sofort.
Ich warf die Vorsicht in den Wind. »Was sagt er?«
»Er sagt, er könne uns sicheres Geleit und Gottesfrieden anbieten, aber erfahrene Bergführer seien schwer zu finden. Ich glaube, er will Geld.«
Wir tauschten einen grimmigen Blick. Wir hatten nur die Silbermünzen in unseren Geldbeuteln; genug, um Essen zu kaufen, aber bei Weitem nicht die Summe, die erforderlich wäre, um die Gunst eines Mannes wie Graf Engelbert zu erkaufen.
Henry war wie ich ein Mann der Tat. Die Muskeln seines Kiefers schwollen an, dann griff er in den Beutel. Hervor kam der Ring.
Engelbert konnte seine Habgier nicht verbergen. Der Rubin im Herzen des Ringes war tiefrot und von der Größe einer großen Erbse. Sein Wert stellte auch für den reichsten Mann ein Vermögen da. Engelbert streckte die Hand aus. Schweigen herrschte, während er ihn begutachtete, und nach einigen angespannten Augenblicken zeigte er ein breites Lächeln.
Henry und ich sahen uns erleichtert an.
Der Graf dankte Henry und sagte etwas anderes. Davon verstand ich nur zwei Wörter, und die reichten mir, denn sie waren König und Löwenherz. Mir gefror das Blut in den Adern.
»Er sagt, dass kein Edelmann – und ein Kaufmann schon gar nicht – solch ein kostbares Geschenk anbieten würde«, murmelte Henry.
»Da hat er recht«, zischte ich und wünschte, ich hätte dem König widersprochen und um einen Beutel goldener Bezants anstelle dieses prächtigen und allzu offensichtlichen Geschenks gebeten. »Aber Ihr müsst ihn vom Gegenteil überzeugen! Erzählt ihm, dass wir den Ring einem toten türkischen Emir auf dem Schlachtfeld abgenommen hätten.«
Mit salbungsvoller Stimme redete Henry dem Grafen gut zu.
Mitten im Satz legte Engelbert den Ring mit einem nachdrücklichen, metallischen Schlag auf den Tisch. »Nein!«, sagte er. »Nein. Euer Herr ist ein König. König Richard.«
Henry verstummte. Mein Blick zuckte zu den Wächtern, die hinter dem Grafen standen. Ich rechnete durchaus damit, dass er ihnen befahl, uns festzunehmen. Eine Aussicht, uns freizukämpfen hatten wir nicht; wir waren ungepanzert, die Dolche unsere einzigen Waffen. Was aus uns wurde, scherte mich nicht, aber der König musste gewarnt werden.
Statt einen Befehl zu erteilen, lächelte Engelbert. Sein Lächeln war offen, ohne eine Spur von Boshaftigkeit. Er redete schnell und in ernstem Ton weiter. Ich hörte die Worte Kaiser und Heinrich heraus. Ich atmete heftig, mir war übel vor Anspannung. Aber ich hielt mich zurück, damit er zu Ende sprechen und Henry dolmetschen konnte.
Henry grinste mich an. »Er besteht darauf, dass Richard unser Herr sein muss. Er bewundert den König sehr für das, was er im Heiligen Land erreicht hat, und wünscht in keiner Weise, ihm zu schaden. Für seinen Bruder Meinhard oder Kaiser Heinrich gelte jedoch nicht das Gleiche.«
»Kann Engelbert uns einen Führer stellen?«
Henry schüttelte den Kopf. »Er hat keine Zeit, jemanden zu suchen. Wir müssen Görz heute verlassen.«
»Stehen die Dinge so schlimm?«, fragte ich. Meine Hoffnung auf ein bequemes Bett in einer geheizten Herberge schwand.
»Das sagt er. Meinhard würde jedem eine hohe Summe zahlen, der ihm Löwenherz übergibt. Wir können niemandem in der Stadt trauen.«
Wir dankten Engelbert und verabschiedeten uns. An der Tür sah ich zurück. Der Graf hatte nicht den nächsten Bittsteller zu sich gerufen, sondern sprach angeregt mit seinem Vogt. Als spürte er meinen Blick, drehte er den Kopf. Unsere Blicke trafen sich für einen Herzschlag. Engelbert lächelte, aber seine Augen waren so kalt und berechnend wie die eines Falken.
Ich schilderte Henry, was ich beobachtet hatte. Wir mussten davon ausgehen, entschieden wir, dass Engelbert seinen Bruder über den Aufenthalt des Königs benachrichtigen würde.
»Tadhg an dá thaobh, so würde man ihn in Irland nennen«, sagte ich.
»Tie-gh on daow …?« Henry verstümmelte die Wörter. »Das verstehe ich nicht.«
Leise lachend erklärte ich: »Timothy auf beiden Seiten. Engelbert steht mit einem Fuß in beiden Lagern.«
Henry sah niedergeschmettert aus. »Ihr hattet recht. Ich hätte ihm den Ring nicht anbieten dürfen.«
»Betrachtet es als eine Segnung«, sagte ich. »Hättet Ihr es nicht getan, hätten wir Quartier in Görz gemacht, und es ist gut denkbar, dass unsere Anwesenheit gemeldet worden wäre. Ohne Engelberts Warnung wären wir vielleicht hier ergriffen worden.«
Die Erkenntnis bot nur geringen Trost, als wir nach Süden ritten, um wieder zu unseren Gefährten zu stoßen. Der Wind schnitt so scharf wie ein Messer. Gelbgraue Wolken drohten mit Schnee; als ich den Blick hob, fielen kleine Flocken vom Himmel.
Gott allein wusste, ob wir heute Nacht Unterkunft fanden.
KAPITEL II
Friaul, auf der Straße nach Udine
Am nächsten Tag befanden wir uns ein gutes Stück nordwestlich von Görz.
Die Straße, falls die furchige, unebene Fläche, auf der wir uns bewegten, so genannt werden konnte, war meist leer. Wegen des schlechten Wetters waren nur wenige Reisende unterwegs; jene, denen wir begegneten, vermieden den Blickkontakt und waren froh, unbeschadet an einer großen Gruppe Bewaffneter vorbeizukommen. Unsere Hände entfernten sich nie weit von den Waffen, während wir ständig Ausschau hielten, ob sich in der welligen Landschaft etwas bewegte.
Henry Teuton und ich hatten den König am Vortag erst kurz vor Einbruch der Nacht erreicht. Richard war erbost gewesen, als er von Engelberts Doppelzüngigkeit hörte, aber auch dankbar für dessen Warnung. Statt unseren Weg im Schneetreiben fortzusetzen, hatten wir uns einen Unterschlupf gesucht. Einen Häusler abseits der Straße hatten wir mit einer Handvoll Silbermünzen überredet, uns in seiner Scheune übernachten zu lassen. In unsere Decken gekauert aßen wir das Brot, das ich gekauft hatte, bevor wir Görz verließen, und hielten Kriegsrat.
Der König gelangte rasch und entschlossen zu einer Entscheidung. Da Meinhard II. von seiner Anwesenheit wusste und wir vermutlich bereits gejagt wurden, war es viel zu gefährlich, der mäandrierenden Route zu folgen, für die sich Richard zuerst entschieden hatte. Statt nach Ungarn zu reisen, würden wir einen kürzeren nordöstlichen Weg nehmen und Österreich über die Alpen erreichen. Von dort würden wir die Donau nach Mähren überqueren, dessen Fürst Wladislaw kein Freund des Kaisers war, und unsere Reise nach Sachsen und darüber hinaus fortsetzen. Richard entschied auch, dass wir erneut behaupten würden, Templer zu sein. Zur Größe unserer Gruppe und unserem unverkennbar soldatischen Gebaren passte diese Täuschung weit besser, als wenn wir vorgaben, Kaufleute zu sein.
Lange vor dem Morgengrauen brachen wir auf und hatten Görz umgangen, während seine Bewohner noch alle in ihren Decken lagen. Wir waren hungrig, denn das Abschiedsmahl des Bauern hatte aus einer Schüssel dünner, geschmackloser Suppe bestanden, von der jeder nur zwei Mundvoll abbekam. Kalt war uns außerdem. Der Schneefall war recht leicht, aber der Wind ließ nicht nach und heulte mit grimmiger, unnachgiebiger Schadenfreude vom Gebirge herab. Mein Gesicht war schon längst taub geworden, und jeder Windstoß, der an meinem Mantel zupfte, schnitt glatt hindurch bis ins Fleisch.
»Das erinnert mich an den Ritt nach Gorre.«
Erschrocken, denn in meinem Sinnen hatte ich nicht bemerkt, dass der König auf einmal an meiner Seite war, wiederholte ich: »Gorre?«
»Habt Ihr’s vergessen?«
Irgendwie gestatteten mir meine gefrorenen Wangen ein Lächeln. »Wie könnte ich, Sire? Das war der grausamste Vorfall meines ganzen Lebens.«
»Genau. Es war schlimmer als das hier.« Richard klang, als müsste er sich selbst überzeugen.
Beunruhigt, denn er drückte nur sehr selten irgendwelche Zweifel aus, sagte ich nachdrücklich: »Weit schlimmer, Sire. Stimmt’s, Rhys?« Ich sah auf meinen Knappen herunter, der neben mir herging. Henry Teuton und mir war es zwar gelungen, in Görz noch drei Pferde zu kaufen, aber wir hatten trotzdem noch nicht genug Reittiere für alle Ritter, geschweige denn für die Männer von geringerem Rang.
»Da war mir wärmer, weil ich nämlich zwei Mäntel hatte, Messire.« So sprach er mich nur an, weil Richard dabei war. »Mehr zu essen hatte ich auch – Brot und Schinken.«
Ich ächzte. »Erinnere mich bloß nicht.«
»Ihr seid gut im Beschaffen von Vorräten?« In Richards Gesicht lag ein wissender Ausdruck. Soldaten mussten oft für sich selbst sorgen.
»Ich pflege in dieser Hinsicht einigen Erfolg zu haben, Sire.« Eine von Rhys’ Händen verschwand unter seinem Mantel; er eilte um die Hinterteile unserer Pferde herum, kam auf der rechten Seite des Königs aus und reichte ihm eine Käseecke hoch. »Möchtet Ihr?«
Richard lachte leise. »Ob der Häusler Euch in diesem Moment verflucht?«
»Das wäre möglich, Sire.« Rhys’ Lippen zuckten.
Richard brach sich ein Stück Käse ab und bestand darauf, dass Rhys den Rest zurücknahm. Als er protestierte, sagte der König ihm, es sei seiner – er möge ihn beim nächsten Halt mit allen teilen.
Rhys warf mir einen traurigen Blick zu, aber wie er später zugab, war der Befehl nur zu vernünftig. Wir steckten gemeinsam in dieser Hölle.
Udine erreichten wir in der Dämmerung. Die Torwächter waren misstrauisch und versperrten uns den Weg. Zwanzig bewaffnete Männer stellten eine mögliche Bedrohung von Ruhe und Ordnung dar. Sie akzeptierten aber Henry Teutons in höchst höflichem Ton vorgebrachte Erklärung, wir seien Templer, die aus dem Heiligen Land zurückkehrten.
Sie winkten uns durch und nickten dankend, als Henry ihnen Gottes Segen wünschte. »Versucht es in der Weizengarbe, gleich die Straße hinunter«, rief einer. Henry dolmetschte uns den Rest: Die Weizengarbe sei die größte Taverne in der Ortschaft und vermutlich die einzige, die genügend Platz für uns hätte.
Richard hatte bereits dem Vorschlag zugestimmt, den de Béthune und ich gemacht hatten. Unsere große Gruppe zog zu viel Aufmerksamkeit auf sich. Zwanzig Mann reichten nicht aus gegen die Männer, die man auf uns hetzen würde, daher spielte es keine Rolle, wenn wir nur zehn wären. Die nackten Zahlen unterstrichen den Ernst unserer Lage nur. Von chaotischen Augenblicken in der Schlacht abgesehen musste ich noch nie in Betracht ziehen, ich könnte unfähig sein, Richard zu beschützen. Nun hing mein Erfolg nicht von Mut oder Waffenkunst ab, sondern von meiner Verschlagenheit und Arglist. Schmachvoll kam es mir vor, und ein König, mein Lehnsherr, sollte nicht so reisen müssen. Bloß ließ sich nichts daran ändern, daher biss ich die Zähne zusammen, bat Gott um seinen Schutz und ritt weiter.
Nicht weit vom Stadtplatz entfernt hatte ein halbwegs anständiges Gasthaus, das »Mond und Sterne« hieß, ein sehr großes Zimmer. Hier sollte der König wohnen, unterstützt von Henry Teuton; dazu ich, Rhys, William de l’Etang, Robert de Turnham, Anselm, der Kaplan des Königs, und vier weitere Männer. De Béthune übernahm den Befehl über die Übrigen und machte sich auf die Suche nach einer anderen Herberge.
Unzufrieden – ich war mehr als zwei Jahre nicht von de Béthune getrennt gewesen – folgte ich Richard auf den Stallhof des »Mond und Sterne«. Wir ließen unsere Pferde in der Obhut eines mageren Stallknechts und gingen in das zweistöckige Hauptgebäude. Wie viele andere Häuser in Udine war es ein Fachwerkbau mit Strohdach.
Weil ich damit rechnete, dass unsere Ankunft Aufmerksamkeit erregen würde, schlug ich dem König vor, dass Henry Teuton und ich vorgingen, während er fast zuletzt eintreten sollte, ein wenig gebeugt, um seine Körpergröße zu verbergen. Den Mienen unserer Gefährten nach zu urteilen hätte keiner es gewagt, dem König solch ein Ansinnen zu unterbreiten, aber Richard willigte ein. Er war still, gedämpft geradezu, was mir Schmerz bereitete.
Die Herberge glich ähnlichen Häusern in Frankreich und England. Binsen lagen auf dem Boden verstreut; dem Geruch von schalem Bier und Fett nach zu urteilen waren sie schon seit einiger Zeit nicht mehr gewechselt worden. Jemand sang falsch. Zwei Hunde stritten um einen Knochen, während neben ihnen, ohne sie zu bemerken, ein Betrunkener mit dem Gesicht auf dem Tisch schnarchte. Der Wirt hatte einen stechenden Blick und ohrfeigte gerade einen Schankjungen, weil er Bier verschüttet hatte. Sodann eilte er mit einem servilen Lächeln zu einem Kaufmann auf einem Eckplatz.
Aller Blicke waren auf uns gerichtet, als wir uns Plätze in der Ecke suchten, die am weitesten von der Tür entfernt lag. Wir sprachen leise und achteten darauf, dass unsere Mäntel die Schwerter immer verdeckten. Ungeduld befiel den König, weil wir nicht sofort bedient wurden. Sein Jähzorn, der ohnehin immer kurz vor dem Ausbruch stand, flammte auf, als eine Schankmaid nicht sah, wie er ihr winkte. Er brüllte nach einem Krug des besten Weines, der ihm auf der Stelle gebracht werden möge. Köpfe wandten sich uns zu, als er die Beherrschung verlor, und ich seufzte innerlich. Ich hatte nicht darauf hoffen dürfen, dass Richard einmal nicht gleich alle Blicke auf sich zog. Bei seinem schweren Körperbau und der auffälligen rotgoldenen Haarmähne fiel er zwischen uns auf wie ein bunter Hund.
Weitere Gäste kamen herein, und allmählich löste sich die Aufmerksamkeit wieder von uns. Als das Gefühl in unsere tauben Hände und Füße zurückkehrte, verlegten sich die Gedanken aufs Essen und Trinken. Die Schankmaid brachte dem König seinen Wein und dazu Krüge mit dem hiesigen Bier, das zu meiner Überraschung recht gut war. Danach kamen Schüsseln mit Suppe und Platten mit Brot und Käse, die wir begeistert entgegennahmen. Als mein Bauch voll war, sah ich mich beiläufig in der Gaststube um. Zu meiner Erleichterung schien niemand uns zu beobachten.
Nachdem unser Hunger befriedigt war, verweilten wir nicht im Schankraum. Wie ich zum König sagte: Je weniger Leute uns sahen, desto besser. Unser Zimmer lag im ersten Stock, vier Betten und eine Kleidertruhe bildeten die einzige Einrichtung. Das beste Bett nahm der König. Anselm, der Kaplan, bekam ein anderes. William de l’Etang, Robert de Turnham und ich warfen eine Münze um die beiden übrigen, und ich verlor. Heute Nacht gab es sowieso nicht viel Schlaf, sagte ich mir. Die Männer auf dem Fußboden müssten dicht an dicht liegen wie Salzheringe in einem Fass, und mit den unvermeidlichen Besuchen beim Nachttopf weckte man alle anderen. Der König erklärte, er sei müde, und legte sich sofort hin. Auf seiner Stirn stand Schweiß; ich betete, dass das verfluchte Quartanfieber, das ihn schon so sehr geplagt hatte, nicht wieder zurückkehrte. Während Rhys sich als Wächter neben die Tür setzte, machten die anderen es sich bequem, stellten still nasse Stiefel an den kleinen Kamin oder ölten und schärften ihre Klingen.
Ich wollte mich noch nicht schlafen legen und war auch nicht in der Stimmung für ein Gespräch. Ich setzte mich auf den Fußboden, hörte der Unterhaltung mit einem Ohr zu und verfiel ins Brüten. Still verwünschte ich unser Pech: die Feinde hinter jeder Ecke, die Stürme, die uns vom Kurs abgebracht hatten. Ich verwünschte das schlechte Wetter und die lange Reise, die vor uns lag; ich verwünschte Engelbert, Meinhard, Herzog Leopold und Kaiser Heinrich. Ich verwünschte den Schlafraum, in dem wir uns befanden, mit seinen schimmeligen Wänden, und schließlich auch die Flöhe, die sich an uns laben würden, sobald wir schliefen.
Lange dauerte es nicht, und ich entschied, dass ich in der Nacht keinen Schlaf finden würde, solange ich keinen klaren Kopf hatte. Ich warf einen Blick auf den König. Er hatte die Augen geschlossen und atmete gleichmäßig. Zufrieden nahm ich meinen Mantel und suchte mir einen Weg zur Tür.
»Wohin gehst du?«, fragte Rhys.
»Wir brauchen mehr Pferde. Wenn der Stallknecht keine zu verkaufen hat, weiß er jemanden, bei dem wir sie erhalten.«
Er war schon auf den Beinen. »Ich komme mit.«
»Nicht nötig. Ich werde nicht lange fort sein.«
»Es ist unklug, allein zu gehen. Wenn du mich nicht mitnimmst, dann wenigstens Henry Teuton.«
Ich lehnte ab und wusste dabei, dass meine schlechte Stimmung der einzige Grund dafür war.
Rhys schenkte mir einen Blick, der ausdrückte: Sag hinterher nicht, ich hätte dich nicht gewarnt.
Ich achtete nicht darauf, schlüpfte hinaus in den Korridor und die knarrende Treppe hinunter in den warmen, schwitzigen Mief der Schankstube. Ich musste mich dem plötzlichen Drang widersetzen, mich bis zur Besinnungslosigkeit zu betrinken, um meine Sorgen zu vergessen, dann ging ich hinaus.
Mein Gedanke, den mageren Stallknecht anzusprechen, zahlte sich aus. Nach zähem Feilschen kaufte ich um einen hohen, aber nicht erpresserischen Preis fünf Pferde, die aussahen, als könnten sie uns wirklich durch die Berge tragen. Von den Schindmähren, die wir an der Küste erworben hatten, konnte man das Gleiche nicht behaupten. Zufrieden, aber noch immer hellwach entschied ich mich, das Gasthaus aufzusuchen, in dem de Béthune und die Übrigen untergekommen waren; ich wusste, wo es zu finden war, weil zwei seiner Soldaten es uns berichtet hatten, während wir aßen. Mein Freund hatte vielleicht auch ein paar Pferde gefunden, überlegte ich. Zumindest aber konnten wir uns einen Krug Wein teilen und besseren Zeiten nachhängen.
Der Wind hatte nachgelassen, und ein dicker Mond hing silbern am Himmel; in seinem Licht kam ich gut voran durch die leeren Sträßchen und Gassen. Unter meinen Stiefeln knirschte der Frost. Ich ging schnell und selbstbewusst, die Hand am Heft meines Schwertes, und sah immer wieder hinter mich. Als ich nach »einmal links, über die Kreuzung und zweite rechts« meine Herberge nicht fand, begriff ich, dass ich mich verlaufen hatte.
Ich machte auf dem Absatz kehrt und entdeckte einen Schatten, der hinter mir in einer Gasse verschwand, die ich kein Dutzend Herzschläge zuvor passiert hatte. Wütend, nicht bemerkt zu haben, dass ich verfolgt wurde – ich gebe es zu –, hob ich einen Stein auf und eilte auf die schmale Öffnung zu. Ich blieb kurz davor stehen und schleuderte ihn um die Ecke. Als der Stein von einer Hausmauer abprallte, nahm ich an, dass er Ablenkung genug sei, und stürmte, den Dolch in der Hand, in die Gasse.
Eine Gestalt stand dort, schmal, in dunkle Gewänder gekleidet. Sie fuhr zu mir herum – mein Wurf hatte seinen Zweck erfüllt –, und ich sah, wie sie erschrocken den Mund öffnete. Mondlicht glänzte auf einer Klinge. Ich wich zur Seite aus, und der Messerstreich, der mich ausgeweidet hätte, zerteilte nur die Luft.
»Wer bist du?«, schnarrte ich auf Deutsch.
Ich erhielt keine Antwort. Stattdessen zischte wieder die Klinge im Bogen heran.
Ich zögerte nicht länger, sondern stürmte vor, als der Arm meines Gegners das Ende des Schwungs erreicht hatte. Mit dem linken Arm umschlang ich seinen rechten, in dessen Hand er das Messer hielt, und hoffte, sie festzuhalten, bevor er reagieren konnte. Wir näherten uns, bis wir Brust an Brust standen, und ich schmetterte meinen Kopf gegen seinen. Ich spürte ein befriedigendes Knirschen, als seine Nase brach. Er stieß einen Schmerzensschrei aus und torkelte zurück. Vielleicht hätte ich ihn entwaffnen können, aber das war gar nicht mein Wunsch. Ich hob den rechten Arm und stieß mit dem Dolch zu. Eisen scharrte über Knochen, dann drang die Klinge ein und versank tief in seiner Brust. Er keuchte, ein leiser überraschter Laut, und ich stach erneut zu, zweimal, aber nun in die Halsbeuge.
Er war schon tot, als er zusammenbrach. Blut spritzte aus den beiden Stichen am Hals und färbte rasch den Reif auf meinen Stiefeln. Mit pochendem Herzen sah ich mich um, mein Blick suchte in den Schatten nach einem zweiten Feind. Dort war jedoch niemand.
Ich bückte mich, um die Leiche zu untersuchen. Halb erwartete ich, einen Agenten Meinhards vorzufinden, der den König belauern sollte, aber die zerlumpte Kleidung und die nackten Füße des Mannes erzählten eine andere Geschichte. Ich hatte einen gewöhnlichen Verbrecher vor mir, einen Straßenräuber. Ich zog ihn ins Mondlicht, damit ich sein Gesicht besser erkennen konnte. Kaltes Grauen überfiel mich. Ein bartloses Gesicht starrte mit leerem Blick zum sternenbesetzten Himmel hoch. Ich hatte einen Jüngling getötet, nicht älter als dreizehn oder vierzehn.
In diesem schuldbeladenen Moment hätte mich nicht überrascht, wenn Henry, der Soldat aus meinem jüngsten Albtraum, vor mir erschienen wäre. Ich hätte nicht die Kraft besessen, mich zu verteidigen.
Schritte näherten sich von der Straße, und ich huschte zur Ecke. Stand mir ein weiterer Kampf bevor? Aber es war Rhys. Ich empfand leise Belustigung – er hatte die Angewohnheit, Befehle zu missachten und genau im richtigen Augenblick aufzutauchen.
»Ich habe einen Kampf gehört«, sagte er. »Bist du verletzt?«
»Nein.«
Er sah an mir vorbei. »Ist er tot?«
»Ja«, sagte ich bitter. »Ein Junge. Ich habe einen Jungen getötet.«
»Er griff dich an?« Rhys ging an mir vorbei und stellte sich vor die Leiche.
Ich erzählte ihm, was geschehen war.
Rhys bückte sich und hob die tückisch schmale Klinge. »Er hätte sie dir vermutlich in den Rücken gestoßen.«
»Da wirst du wohl recht haben.«
»Und in der Finsternis. Wie solltest du da ahnen, dass er ein Junge war?«
»Das stimmt.«
»Wenn du ihn nicht getötet hättest, könntest du jetzt hier liegen.«
Er hatte recht, und ich wusste es. Was mich bedrückte, war das Frohlocken, das ich bei dem kurzen, aber wilden Kampf empfunden hatte. Von meiner düsteren Stimmung beherrscht, hatte ich keine Gnade gezeigt, war vollkommen unbarmherzig gewesen, genau wie vor all den Jahren gegenüber Henry.
»Töte oder werde getötet.«
Ich zuckte zusammen. »Was?«
»So einfach ist das: dein Leben oder seines. Akzeptier das.«
»Ja«, sagte ich, aber ich fühlte mich wie die schlimmste Art von Mörder.
Kurz darauf fanden wir de Béthunes Herberge und teilten uns mit ihm einen Krug Wein. Er hatte zwei weitere Pferde gekauft, was bedeutete, dass wir nun für mehr als die Hälfte von uns ein Reittier besaßen. Darüber erfreut, vom Wein und guter Gesellschaft aufgeheitert, zerrte ich Rhys hinaus, damit wir den Rückweg zum »Mond und Sterne« suchten.
Auf dem Hof des Gasthauses war es ruhig; niemand rief mich an, als ich an den Ställen vorbeiging, um Rhys unsere neuen Pferde zu zeigen. Ich hätte begreifen sollen, dass er wenig beeindruckt wäre, denn er musste nach wie auf Schusters Rappen reiten. Verdrossen ging er weiter zur Herberge, während ich das beste der neuen Tiere suchte, einen dunklen Grauen. Er hatte den Kopf über die halbhohe Tür gesteckt, und als ich näher trat, drückte er mir die samtige Schnauze in die Hand und knabberte mit den Lippen.
»Ich habe keinen Apfel für dich«, flüsterte ich, während ich ihn streichelte. Ich musste an Pommers denken, meinen treuen Destrier, und empfand tiefen Schmerz. Seit Korfu waren wir getrennt. Auf dem Piratenschiff war kaum genug Platz für zwanzig Passagiere gewesen; Richard hatte ein Vermögen dafür bezahlt, dass unsere Pferde versorgt und im kommenden Frühjahr in die Normandie gebracht wurden.
Pommers geht es sicher gut, sagte ich mir. Er wurde von niemandem gejagt, ganz im Gegensatz zu Richard.
Weil ich den Verdacht hegte, dass Rhys sich auf einen letzten Schluck in die Schankstube geschlichen haben könnte, streckte ich den Kopf hinein und entdeckt ihn an der Theke, wo er mit einer Schankmagd schäkerte. Mir gelang es, seinen Blick aufzufangen, und bedeutete mit einer knappen Kopfbewegung, dass er herauskommen sollte. Er drückte der Magd einen Kuss auf die Lippen – sie erhob keine Einwände – und stolzierte zu mir herüber.