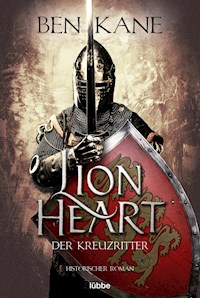9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Löwenherz
- Sprache: Deutsch
Rebell, Anführer, Bruder, König - Richard Löwenherz!
1179: Heinrich II. Plantagenet herrscht über England und Teile Frankreichs. In seinem Haus aber herrscht Unruhe, sogar zur Rebellion kommt es. Ausgerechnet Ferdia, ein irischer Adliger, der als Geisel an den Hof kam, rettet seinem Sohn Richard das Leben. Zum Dank wird er Richards Knappe und darf ihn fortan begleiten. Sie ziehen in den Krieg, kämpfen hart und siegen, und Richard macht sich als Löwenherz einen Namen. Doch bald erkennt Ferdia: Sein Herr schwebt erneut in Gefahr, denn der Ruhm sorgt für Neider, auch in Richards eigener Familie ...
Auftakt einer neuen Reihe um Richard Löwenherz, erzählt aus der Sicht seines treuen Knappen
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 689
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über das Buch
Über den Autor
Titel
Impressum
Widmung
Personenverzeichnis
Prolog
ERSTER TEIL
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
Kapitel IV
Kapitel V
Kapitel VI
Kapitel VII
ZWEITER TEIL
Kapitel VIII
Kapitel IX
Kapitel X
Kapitel XI
Kapitel XII
Kapitel XIII
Kapitel XIV
Kapitel XV
Kapitel XVI
Kapitel XVII
Kapitel XVIII
Kapitel XIX
Kapitel XX
DRITTER TEIL
Kapitel XXI
Kapitel XXII
Kapitel XXIII
Kapitel XXIV
Kapitel XXV
Kapitel XXVI
Kapitel XXVII
Kapitel XXVIII
Kapitel XXIX
Kapitel XXX
Kapitel XXXI
Kapitel XXXII
Kapitel XXXIII
Anmerkungen des Autors
Glossar
Über das Buch
Rebell, Anführer, Bruder, König – Richard Löwenherz! 1179: Heinrich II. Plantagenet herrscht über England und Teile Frankreichs. In seinem Haus aber herrscht Unruhe, sogar zur Rebellion kommt es. Ausgerechnet Ferdia, ein irischer Adliger, der als Geisel an den Hof kam, rettet seinem Sohn Richard das Leben. Zum Dank wird er Richards Knappe und darf ihn fortan begleiten. Sie ziehen in den Krieg, kämpfen hart und siegen, und Richard macht sich als Löwenherz einen Namen. Doch bald erkennt Ferdia: Sein Herr schwebt erneut in Gefahr, denn der Ruhm sorgt für Neider, auch in Richards eigener Familie …
Auftakt einer neuen Reihe um Richard Löwenherz, erzählt aus der Sicht seines treuen Knappen
Über den Autor
Ben Kane wurde in Kenia geboren und wuchs in Irland auf, im Heimatland seiner Eltern. Bevor er sich ganz dem Schreiben widmete, arbeitete er als Tierarzt. Schon als Kind übte die Geschichte Roms eine große Faszination auf ihn aus, weshalb mit der Veröffentlichung seines Debüts Die Vergessene Legion ein lang gehegter Traum in Erfüllung ging. Mittlerweile ist Ben Kane Bestsellerautor und lebt mit seiner Familie in North Somerset, England.
BEN KANE
IM DIENSTE DES LÖWEN
HISTORISCHER ROMAN
Aus dem Englischen von Dietmar Schmidt
Vollständige E-Book-Ausgabedes in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Deutsche Erstausgabe
Für die Originalausgabe:Copyright © 2020 by Ben KaneTitel der englischen Originalausgabe: »Lionheart«Originalverlag: OrionFirst published in Great Britain in 2020 by Orion Fiction, an imprint of The Orion Publishing Group Ltd., an Hachette UK Company
Für die deutschsprachige Ausgabe:Copyright © 2021 by Bastei Lübbe AG, KölnTextredaktion: Rainer Delfs, ScheeßelTitelillustration: © Henry SteadmanUmschlaggestaltung: Thomas KrämereBook-Erstellung: two-up, Düsseldorf
ISBN 978-3-7517-0400-7
luebbe.delesejury.de
Für Joe Schmidt, Rugby-Trainer ohnegleichen, mit tiefstem Respekt
Trotz der Enttäuschung von Japan werden die irischen Rugby-Fans Sie und Ihr Vermächtnis niemals vergessen. Ich wünsche Ihnen für die Zukunft alles Gute und jeden Erfolg, und sollte mir eines Tages das große Glück beschieden sein, Sie kennenzulernen, gehen die Drinks auf mich!
(PS: Ein passenderer Titel für ein Buch, das ich Ihnen widmen möchte, will mir nicht einfallen.)
PERSONENVERZEICHNIS
(Historische Persönlichkeiten sind durch einen * gekennzeichnet.)
Ferdia Ó Catháin/Rufus, ein irischer Edelmann aus Nord-Leinster.
AUF STRIGUIL
Robert FitzAldelm, »Stiefel und Fäuste«, Ritter.
Richard de Clare, Earl von Pembroke (verstorben).*
Aoife (Eva von Leinster), seine Witwe.*
Isabelle, ihre Tochter.*
Gilbert, ihr Sohn und Erbe.*
Rhys, walisischer Waisenjunge.
Hugo, Walter, Reginald und Bogo, Knappen.
Big Mary, Wäscherin.
FitzWarin, Ritter und Freund Robert FitzAldelms.
Gilbert de Lysle, Bote von Herzog Richard.
Guy FitzAldelm, Ritter und Bruder Robert FitzAldelms.
DAS HAUS VON ANJOU UND SEINE GEFOLGSLEUTE
Henry II. (Heinrich II.), König von England und Graf von Anjou.*
Alienor (Eleonore) von Aquitanien, seine Gemahlin.*
Henry (»Hal«), der Junge König, ältester überlebender Sohn Henrys II.* (William, der älteste Sohn, starb 1156 mit 3 Jahren.)
Richard, Herzog von Aquitanien und zweiter Sohn Henrys II.*
Geoffrey, Graf der Bretagne und dritter Sohn Henrys II.*
John »Lackland« (Johann Ohneland), jüngster Sohn Henrys II.*
Matilda*, eine von Henrys Töchtern, verheiratet mit Heinrich dem Löwen*, ehemaliger Herzog von Sachsen und Bayern.
Alienor, Juvette, Zofen Matildas.
Beatrice, Zofe Königin Alienors.
Geoffrey, unehelicher Sohn Henrys II. und sein Kanzler.*
Geoffrey de Brûlon, Ritter.*
Maurice de Graon, Ritter.*
Hawise (Isabel) von Gloucester, Braut Prinz Johns.*
RICHARDS HAUSHALT
André de Chauvigny, Ritter und Cousin von Herzog Richard.*
Jean de Beaumont, Ritter.
John de Mandeville, Louis, »Wiesel« John, Knappen.
Philip, Knappe und Freund von Rufus.
Owain ap Gruffydd, walisischer Ritter.
Richard de Drune, englischer Waffenknecht.
DER HAUSHALT DES JUNGEN KÖNIGS
William Marshal, Ritter.*
Adam d’Yquebeuf, Ritter.*
Thomas de Coulonces, Ritter.*
Baudouin de Béthune, Ritter.*
Simon de Marisco, Ritter.*
Heloise von Kendal, Mündel William Marshals.*
Joscelin, Knappe William Marshals.
Jean d’Earley, Knappe William Marshals.*
ANDERE FIGUREN
Philippe Capet* (Philipp II. Augustus), König von Frankreich und Sohn von Louis Capet* (König Ludwig VII. der Jüngere, verstorben).
Bertran de Born, Troubadour.*
Graf Vulgrin Taillefer von Angoulême.*
Matilda, seine Tochter.*
Guillaume und Adémar Taillefer, Vulgrins Brüder.*
Graf Aimar von Limoges, ihr Halbbruder.*
Philippe, Graf von Flandern.*
Guillaume des Barres, einer von Philippes Rittern.*
Graf Raymond von Toulouse.*
Graf Hugues von Burgund.*
Pierre Seillan, enger Berater Graf Raymonds.*
PROLOG
An die Großen erinnert sich die Geschichte, an Könige und Kaiser, an Päpste. Gewöhnliche Menschen wie Ihr und ich hingegen sinken namenlos in ihr Grab. Kein Erzbischof zelebriert bei unserer Trauerfeier das Hochamt, kein prächtiges Monument steht auf unserer letzten Ruhestätte. Dennoch waren einige von uns dabei, als das Schicksal von Königreichen in der Schwebe hing und sich in Schlachten, die schon verloren schienen, das Kriegsglück wendete. Stets vergessen von den Historikern und den Chronisten der Klöster, halfen wir doch den Mächtigen auf ihrem Weg zu Ansehen und ewigem Ruhm.
So weißhaarig und bucklig ich nun sein mag, in meiner Zeit führte ich an der Seite der besten Männer das Schwert. Die ganze Christenheit kennt Richard, König von England, Herzog der Normandie, Graf der Bretagne und von Anjou – Richard Löwenherz. Nur sehr wenige haben je von Rufus gehört, und noch weniger von Ferdia Ó Catháin. Mich betrübt das nicht. Gedient habe ich Richard weder für Reichtum noch Ruhm. Treue machte mich zu seinem Mann, und sein Mann bin ich noch immer, auch wenn er seit dreißig Jahren tot ist, Gott sei seiner Seele gnädig.
Mein Augenlicht schwindet, meine Muskeln erschlaffen. Einst war es mir eine Wonne, in vollem Harnisch auf dem Schlachtross zu reiten. Heute freue ich mich, wenn ich zur Bank vor der Tür schlurfen und meine Knochen in der Sonne wärmen kann. Der Tod wird auch zu mir kommen, wenn nicht in diesem, so im nächsten Winter. Ich bin bereit für ihn, aber ich bete, dass die Mönche genügend Zeit haben, um meine Geschichte aufzuzeichnen, wie sie sich begeben hat, bevor ich meinen letzten Atem aushauche.
Dreimal zwanzig und noch zehn Jahre sind eine weit längere Spanne, als sie besseren Männern vergönnt war. Mein Leben ist reich gewesen. Ich habe die exquisite Wonne wahrer Liebe erfahren, die vielen anderen verwehrt blieb. Ich kannte sie, und mir ging das Herz auf, als ich meine Söhne und meine Tochter neugeboren in den Armen hielt. Ich hatte Waffengefährten, die mir näherstanden als auch nur einer meiner leiblichen Brüder. Mehr als einmal drang Kummer in mein Leben, und die Tragödie ebenso. Sie sind nur Prüfungen, an denen der Herr unseren Glauben misst. Seine Last erneut zu schultern und weiterzumachen, mehr kann ein Mann dann nicht tun. Es heißt, die Wege Gottes seien unerforschlich, und für meinen Weg gilt das mit Sicherheit. Aus einem wenig bekannten Teil Irlands gelangte ich nach England, wo ich in die Dienste des größten Kriegers unserer Zeit treten durfte – Richard Cœur de Lion. Gemeinsam haben wir Burgen belagert und ein Dutzend Schlachten geführt. Ich habe für Richard geblutet und getötet. Dass ich für ihn auch gemordet habe, darauf bin ich nicht stolz. Ich habe diese Sünden gebeichtet, aber in meinem Herzen bin ich unbußfertig. Gott möge mir vergeben, aber wenn ich die Kraft dazu hätte, ich würde jene Männer erneut töten.
Ich werde fortfahren, sonst geht die Sonne unter, und wir sprechen noch über meine Seele. Ich war dabei, als Richard zum letzten Mal seinem Vater begegnete, Henry II. Ich stand in der Westminster-Abtei, als er gekrönt wurde. Auf Zypern kam ich beinahe zu Tode, als ich seine Königin rettete. Bei Arsuf kämpften wir Seite an Seite und besiegten Saladin. Nicht lange darauf marschierten wir bis fast vor die Tore Jerusalems. Nachdem Richard auf seiner Heimreise aus dem Heiligen Land verraten worden war, saßen der König und ich im selben Verlies. Ich half ihm, seinem Bruder John, diesem Hund, wieder abzunehmen, was rechtmäßig Richard gehörte. John ist jetzt genauso tot wie Richard, und wenn Gott gerecht ist, schmort er in der Hölle.
Aber ich habe mich vergaloppiert und beinahe das Ende der Geschichte vor ihrem Beginn erzählt. Die geneigte Leserschaft mag sich wundern: Ein Ire soll dem englischen König gedient haben? Den Heiligen sei gedankt, dass mein Vater gestorben ist, ohne je davon zu hören! Habe ich es jemals bereut? Hin und wieder vielleicht, aber einmal geleistet, ist ein Eid heilig, und das Band der Kameradschaft, das im Krieg geknüpft wird, lässt sich nicht durchtrennen. Vielleicht ergibt, was ich sage, keinen Sinn. Verzeiht die Abschweifungen eines alten Mannes.
Gehen wir ein halbes Jahrhundert zurück und beginnen die Geschichte auf ein Neues …
ERSTER TEIL
> 1179 <
KAPITEL I
Zehn Jahre lag es zurück, dass der verräterische einstige König von Leinster, Diarmait Mac Murchada, die Engländer nach Irland geholt hatte. Die Eroberung der Insel war keineswegs abgeschlossen, aber die Grauen Fremden, wie wir sie nannten, besaßen die Oberhand. Das zeigte sich nicht nur an dem Streifen der Ostküste, den sie hielten, sondern auch daran, dass viele irische Provinzkönige dem englischen Monarchen Henry den Lehnseid angeboten hatten. Vor vier Jahren dann waren all unsere Hoffnungen wie von einem Hammerschlag zerschmettert worden, als auch König Ruairidh von Connacht ihm Gefolgschaft schwor.
Mein Vater war ein niederer Adliger und saß im Norden Leinsters. Nachdem Diarmaits Bündnis mit den Engländern besiegelt worden war, hatte er Ruairidh die Lehnstreue angeboten. Als sich nun auch Connacht den Grauen Fremden zuwandte, betrachtete Vater das als Verrat und tat wütend das Unvorstellbare: Er schloss sich unserem alten Feind an, dem König von Ulster, den die Invasoren noch nicht überrannt hatten. Vaters Entscheidung erwies sich als unbedacht. Als der Feind in unser Land einfiel, beantwortete Ulster unseren Hilferuf nicht. Wir kämpften tapfer, aber schon bald waren wir besiegt.
Mich nahm man zur Geisel, um das Wohlverhalten meiner Familie zu erzwingen, und brachte mich nach Dublin. Von dort reiste ich auf einer robusten Kogge übers Meer nach Süden und nach Osten an die wolkenverhangene walisische Küste, an der sich auf ganzer Länge eine Burg an die andere reihte. Überziehe ein Land mit solchen Festungen, dachte ich grimmig, und die Einheimischen können nirgendwohin ausweichen. Sie sind gezwungen, sich zum letzten Kampf zu stellen, genau wie meine Familie. Wieder stand mir der Sturmangriff der englischen Ritter vor Augen, eine unaufhaltsame Welle, die unsere leicht gepanzerten Krieger zermalmt hatte.
Unsere Reise endete in Sichtweite zu England an der Burg, die sie Striguil nannten. Heimstatt der Familie de Clare, steht sie auf einer Klippe über dem Fluss namens Wye, und sie war die größte Burg, die ich bis dahin gesehen hatte. Den mächtigen rechteckigen Turm umgab eine Mauer, die sich um den Gipfel des Hügels schlängelte. Wie ich entdecken sollte, umlief die Burg ein Wehrgraben, nur nicht an der Seite, die dem Wye zugewandt war. Ich ließ es mir nicht anmerken, aber ich war beeindruckt. Wenn dies der Stammsitz eines Earls sein sollte, wie wahrhaft beachtlich musste erst König Henrys Donjon sein. Die Engländer waren nicht nur Könner im Kampf, erkannte ich, sondern auch geschickte Baumeister. In mir regte sich die Befürchtung, dass Irlands Häuptlinge und Könige die Invasoren niemals ins Meer zurücktreiben könnten. Ich unterdrückte das Gefühl, denn mir schien, dass es meine Lage nur verschlimmern konnte, wenn ich aufkommender Verzweiflung nachgab. Solange ich davon träumen konnte, die Engländer in meinem Land zu besiegen, ließ sich das Elend, das auf mich gehäuft wurde, ertragen.
Ich war neunzehn Jahre alt, überragte die meisten, hatte einen zerzausten, unbändigen Haarschopf und eine knochige Gestalt. Von der Arroganz der Jugend erfüllt, sprach ich damals nur wenig Französisch und kein einziges Wort Englisch. Seit mein Vater mich mit steinerner Miene in die Gefangenschaft ausgeliefert hatte, ertrug ich klaglos schwierige Zeiten. Seine Abschiedsworte: »Gib nur dann nach, wenn du nicht anders kannst – tu nur das, was du tun musst« hatte ich mir zu Herzen genommen und weigerte mich, auch nur einen Befehl zu befolgen. Am ersten Tag nannte ich den ungeschlachten Ritter mit dem eckigen Schädel, in dessen Obhut ich gegeben worden war, eine Flohtöle und fügte hinzu, dass seine Mutter sich in den dreckigen Hintergassen von Dublin verkaufe. Welche Folgen das für mich haben könnte, hatte ich nicht bedacht. Einige Matrosen waren Iren, und vom Ritter eingeschüchtert, dolmetschten sie ihm, was ich gesagt hatte.
Meine Schmähungen an diesem ersten Tag handelten mir eine Abreibung ein, mit meiner Sturheit danach erwarb ich mir keinen Respekt, sondern nur mehr Prügel und karge Rationen. Blicke ich heute zurück, wundere ich mich nicht nur über mein starrköpfiges Verhalten, sondern vor allem über meine Kurzsichtigkeit. Als die Reise zu Ende ging, waren mir die Stiefel und die Fäuste des Ritters alte Bekannte. Unauslöschlich brannte in mir die Wut über die Demütigung, und wäre mir eine Waffe in die Hände gefallen, hätte ich den Ritter in die See geworfen oder ihm noch Schlimmeres angetan. Doch trotz meines jugendlichen Draufgängertums war ich so klug zu wissen, dass ich ihm nach solch einer Tat auf den Grund des Ozeans gefolgt wäre, also vergrub ich meinen Hass tief in mir und hoffte auf eine Gelegenheit zur Rache.
»Rufus.«
Ich achtete nicht darauf, dass ich angeredet wurde, weil ich noch nicht an den Namen gewöhnt war, den meine Geiselnehmer mir gegeben hatten – finster nahm ich an, sie seien unfähig oder eher unwillig, Ferdia richtig auszusprechen. Mein Blick hing an den Gestalten, die auf dem hölzernen Landesteg unterhalb der Burg standen. Wie es schien, war die Nachricht von unserem Kommen uns vorausgeeilt. Ich hatte keine Vorstellung, wer uns an Land in Empfang nehmen würde, aber es würde nicht der alte Burgherr sein, Richard de Clare, der Earl von Pembroke, einer der Anführer der Invasion Irlands. De Clare war tot, Gott sei gelobt. Aber hätte der Earl noch gelebt, hätte er sich bestimmt nicht herabgelassen, der Ankunft eines Gefangenen wie mir beizuwohnen. Das Gleiche galt für seine Gemahlin, die Gräfin Aoife, die seit seinem Tod auf der Burg herrschte. Sie sei von großer Schönheit, hieß es, und ich hatte nachts angenehme Träume mit ihr heraufbeschworen, um mich von meiner dünnen Decke und den harten Planken abzulenken.
»Rufus, du Hund!« Stiefel und Fäuste – mein Spitzname für Robert FitzAldelm, den hohlköpfigen Ritter, der unsere Gruppe anführte – klang verärgert.
Endlich erlangte er meine Aufmerksamkeit. Ich erkannte »Rufus«. Ich wusste, was chien bedeutete. Ich bin so hochgeboren wie du, dachte ich voll Verachtung. Von seinem letzten Übergriff schmerzten mir noch die Rippen, und dennoch, störrisch bis zuletzt, hielt ich den Blick auf den nahen Anlegesteg gerichtet und blieb mit den Gedanken bei Aoife. Als Tochter von Diarmait Mac Murchada, des Königs von Leinster, und Witwe von Richard de Clare war sie die Herrin meines Geschicks.
»Rufus!«
Ich beachtete ihn nicht.
Schmerz traf meinen Kopf wie ein Felsblock. Mir verschwamm die Sicht. Die Kraft des Hiebes warf mich zur Seite. Torkelnd prallte ich gegen einen Matrosen. Er stieß mich fluchend weg, meine Knie gaben nach, und ich stürzte aufs Deck. Stiefel und Fäuste stürzte sich mit seinem üblichen Eifer auf mich, wie immer sorgsam bedacht, mir nicht ins Gesicht zu treten. Schlau wie ein Fuchs war er, und er wusste genau, dass jene, die über ihm standen, die Bestrafungen nicht geduldet hätten, welche er großzügig austeilte, seit wir von Dublin ausgelaufen waren.
»Arrêtez!« Die Stimme klang grell, aber befehlsgewohnt. Eine Mädchenstimme.
Dieses französische Wort erkannte ich: Es bedeutete »aufhören«.
Mein Herz pochte. Kein weiterer Tritt traf mich.
Das Mädchen ergriff erneut das Wort und stellte ärgerlich eine Frage, die ich nicht verstand.
Stiefel und Fäuste rückte von mir ab, während er antwortete. Er klang respektvoll, aber widerwillig. Ich konnte seinen Worten nichts entnehmen.
Mir schwindelte zwar noch, aber ich öffnete die Augen und schaute zur Seite. Eine Reihe eiserner Nagelköpfe. Lücken zwischen den Planken. Unter mir schäumendes Wasser von mehreren Fingerbreit Tiefe, das in dem Raum unter dem Deck stand. Der Gestank nach verfaultem Essen und Urin – den Befehlen des Schiffers zum Trotz erleichterten sich einige Männer nicht gern über die Bordwand. Stiefel und Schuhe schritten über die Planken, Erstere von den Soldaten getragen, Letztere von Matrosen mit schwieligen Händen. Eine Taurolle. Die Böden von Fässern, in denen sich Wasser, Met und gepökeltes Schweinefleisch befanden.
Stiefel und Fäuste ließ mich in Frieden. Ich entschied, dass ich mich ungefährdet erheben konnte, und setzte mich auf. Stechender Schmerz schoss mir aus Bauch und Rücken, Armen und Beinen durch den Leib. Ich versuchte dankbar zu sein, dass es sich beim einzigen Teil von mir, den er verfehlt hatte, um meine Leisten handelte. Ich warf einen Blick zu Stiefel und Fäuste, der sich noch mit dem Mädchen auf dem Steg unterhielt. Wir hatten rasch angelegt, und Männer machten das Schiff mit dicken Tauen fest. Beim Aufstehen hielt ich mich an der Bordwand fest und sah zu meinem Erstaunen, dass das Mädchen noch ein Kind war. Sie trug ein Kleid in der Farbe von Maulbeeren und darüber einen dunkelgrünen Mantel mit silberner Borte, und sie konnte nicht älter sein als sechs Jahre. Lange rote Zöpfe, von einem helleren Ton als meine eigenen Haare, umschlossen ihr ernstes ovales Gesicht.
Der Blick ihrer grauen Augen fiel auf mich. Irgendwie ahnte ich, dass sie die Tochter Richard de Clares und Aoifes war. Was sie hier allein suchte, ging über mein Begreifen. Ich schützte Respekt vor, den ich nicht empfand, indem ich den Kopf neigte, und stellte mich ihrer unverwandten Musterung.
»Bist du verletzt?«, fragte sie.
Mir sank die Kinnlade herunter. Das Mädchen hatte mich nicht auf Französisch, sondern in meiner eigenen Zunge angesprochen.
»Mutter sagt, dass es unhöflich ist, sein Maul so aufzusperren. Wenn sonst nichts passiert, kommen Fliegen rein.«
Ich schloss den Mund, fühlte mich töricht und brachte hervor: »Ich bitte um Entschuldigung. Ich habe nicht damit gerechnet, hier Irisch zu hören.«
»Mutter besteht darauf, dass wir es lernen. ›Ihr mögt halb-englisch sein‹, sagt sie, ›aber ihr seid auch halb-irisch.‹«
Meine Ahnung hatte mich nicht getrogen. Ich setzte ein Lächeln auf. »Wie es klingt, ist deine Mutter eine weise Frau. Um deine Frage zu beantworten, ich glaube nicht, dass er mir etwas gebrochen hat.« Am liebsten hätte ich Stiefel und Fäuste, der sein Möglichstes tat, um zu verstehen, was wir sprachen, mit einem bösen Blick bedacht, aber ich entschied, dass es klüger sei, darauf zu verzichten. »Meinen Dank für dein Einschreiten.«
Ein knappes Nicken.
Sie war ein Kind, aber sie strahlte Würde aus. Das war kein Wunder, entschied ich, wenn man ihre Abkunft bedachte.
»Wie heißt du?«
»Ferdia Ó Catháin.«
Zu meiner Überraschung sprach sie meinen Familiennamen richtig aus, als sie ihn wiederholte: das »C« hart wie ein K, das »t« stumm, den Rest des Wortes wie »heun«. Mit einem Aufblitzen der Freude dachte ich: Ihre Mutter ist stolz auf ihre irischen Wurzeln.
Stiefel und Fäuste knurrte etwas auf Französisch. Ich verstand davon nur »Rufus«.
»Er sagt, sie nennen dich Rufus.« Das Mädchen neigte den Kopf zur Seite. »Ich verstehe, wieso.«
Trotz meiner Schmerzen amüsiert, hob ich die Hand an den Kopf. »Mutter pflegte zu sagen, dass mich die Feen an den Fersen über einen Topf mit Färberkrapp gehalten haben müssen, anders könnte ich so rote Haare nicht bekommen haben. Dich haben die Feen wohl etwas schneller wieder freigelassen.«
Das ernste Gebaren des Mädchens verflüchtigte sich, und es lachte auf. »Ich werde dich auch Rufus nennen!« Sie musste mir etwas am Gesicht angesehen haben, denn ihre Miene änderte sich. »Es sei denn, es ist dir lieber, wenn ich es nicht tue?«
Erneut unterbrach Stiefel und Fäuste. Obwohl ich kaum Französisch verstand, wurde mir klar, dass er mich vom Schiff haben wollte. Die Soldaten standen schon auf dem Steg und nahmen ihre Schilde und in Leder gewickelte Waffenbündel entgegen, die ihnen die Matrosen anreichten.
Ohne auf das Unbehagen zu achten, das die Bewegung hervorrief, schwang ich ein Bein über Bord und ließ mich auf den Steg rutschen. Stiefel und Fäuste folgte. Er wies auf den Weg, der durch eine Ansammlung von Häusern zur Burgmauer führte, und sagte wieder etwas auf Französisch.
Verflucht, dachte ich. Ich muss ihre Sprache lernen, sonst wird mein Leben unmöglich. »Er will, dass ich hinaufgehe?«, fragte ich das Mädchen.
»Ja.« Ihr gebieterisches Gebaren von vorhin war verflogen. Fast war es, als würde sie die Grenzen ihrer Macht genau kennen. Sie konnte verhindern, dass ich misshandelt wurde, aber an meinem Schicksal als Gefangener vermochte sie nichts zu ändern.
Ich widerstand dem ersten Stoß in den Rücken, den Stiefel und Fäuste mir versetzte. »Wie heißt du?«
»Isabelle!« Die Stimme – die Stimme einer Frau – kam von irgendwo hinter der Palisade. Sie klang schrill und missmutig. »I-sa-belle!«
Ein schelmisches Lächeln. »Isabelle. Isabelle de Clare.«
Meine Ahnung hatte mich nicht getrogen. Ich neigte ein zweites Mal den Kopf, williger diesmal, denn das Mädchen hatte das Herz am rechten Fleck. Damit die Iren unter dem Schiffsvolk mich nicht verstanden, senkte ich die Stimme und sagte: »Ich schulde dir meinen Dank, dass du den Amadán gehindert hast, mich zu Brei zu treten.«
Sie kicherte. »Sei vorsichtig, wie du FitzAldelm nennst. Er könnte ein paar Brocken Irisch verstehen.«
»Er versteht kein Wort.« Zuversichtlich, dass ich bald in der Wohnhalle speisen würde, wandte ich mich ihm ein wenig zu. »Stimmt’s, Amadán?«
Stiefel und Fäuste – FitzAldelm – runzelte die Stirn und stieß mich an.
»Siehst du?« Mein Übermut nahm immer weiter zu.
»Isabelle!« Die Stimme schwoll an zum Kreischen eines alten Drachen.
Isabelle rollte mit den Augen. »Das ist meine Amme. Ich gehe wohl besser.« Sie raffte die Röcke auf, damit sie nicht durch den Schlamm schleiften, und eilte vor uns den Pfad hinauf. »Leb wohl, Rufus!«
»Leb wohl, Herrin!«, rief ich.
Zum ersten Mal hatte es mir nichts ausgemacht, dass jemand mich Rufus nannte. Aber meine Freude war von nur kurzer Dauer.
Stiefel und Fäuste versetzte mir mit aller Kraft einen Schlag in den Rücken. Fast wäre ich aufs Gesicht gestürzt. Ich rappelte mich auf, die Ohren voller Flüche, und machte mich an den Aufstieg. Isabelle durchschritt gerade das Tor in die Burg und bemerkte meine Misshandlung nicht.
Fast hätte ich ihr nachgerufen, aber völlig überzeugt, dass die Schindereien bald ein Ding der Vergangenheit wären, hielt ich den Mund. Wenn Aoife eine gerechte Frau ist, überlegte ich, wird Stiefel und Fäuste vielleicht sogar bestraft für das, was er mir angetan hat.
Als ich das Tor erreichte, das schon wieder geschlossen worden war, sah ich zum Rand der Burgmauer hoch. Drei Männerlängen hoch musste er aufragen. Dem Wächter, der von oben auf mich hinunterglotzte, konnte ich in die Augen sehen, aber er war hinreichend weit aus meiner Reichweite, dass ich erkannte, wie unsinnig ein Versuch wäre, diese Festung im Sturm zu nehmen.
»Ouvrez la porte!«, befahl Stiefel und Fäuste wütend.
Öffnet das Tor, dachte ich. Erinnere dich an diese Worte.
Ungeduldig trat Stiefel und Fäuste an mir vorbei und hämmerte mit der Faust gegen die Baumstämme. So fest es auch gebaut war, das Tor stellte die Schwachstelle in diesem Abschnitt der Wehranlagen dar. Im Fall eines Angriffs würden die Garnisonssoldaten jedoch Töpfe mit erhitztem Sand auf die Köpfe der Angreifer leeren, während von den Brustwehren die Pfeile flogen.
Knarrend öffnete sich das Tor, und ein Soldat in Gambeson und Ringpanzerhemd stand vor mir. Eindeutig ein Mann, der im Rang weit unter Stiefel und Fäuste stand, ertrug er FitzAldelms Beschimpfungen ohne Widerwort. Eine Frage wurde gestellt. Ich hörte den Namen »Eva«, das französische Wort für Aoife. Der Soldat maß mich mit einem neugierigen Blick und schüttelte den Kopf.
Ich hatte keine Zeit, über die Bedeutung dessen nachzudenken, was ich beobachtet hatte, denn Stiefel und Fäuste stieß mir ins Kreuz, seine Art, mir mitzuteilen, dass ich eintreten sollte.
Ich war schon in einem Burghof gewesen, wie die Engländer den Raum innerhalb der Wehranlagen nannten, aber noch nie in einem so großen. Er bildete ein unregelmäßiges Viereck, in der Mitte zum Himmel offen, und war auf einer Seite von dem zwei Stockwerke hohen Wehrturm mit angebauten Küchen- und Lagerhäusern begrenzt. Auf den anderen Seiten der Burgmauer standen Gebäude mit schrägen Dächern, die ich für Soldatenunterkünfte hielt, Ställe und dergleichen. Menschen wimmelten umher, aber kaum jemand achtete auf mich.
Ein Schmied mit Lederschürze beugte sich über den Huf eines Pferdes, den Hammer erhoben, um einen weiteren Nagel durch das Eisen zu treiben, das er dem Tier anlegte. Am Kopf des Rosses hielt ein Halbwüchsiger in zerlumptem Hemd und löchrigen Beinlingen den Zügel und bohrte sich zugleich mit der freien Hand in der Nase. Ein untersetzter Mann reichte pralle Säcke mit Gemüse von der Ladefläche eines Wagens zu einem zweiten hinab. Aus einem leeren Stall kam ein Rattenfänger, der seinen einrädrigen Stab vor sich herschob. Ihm folgten mehrere magere Katzen, deren Aufmerksamkeit ganz dem halben Dutzend Nagetiere galt, die an ihren Schwänzen von dem Stab hingen. Einige Soldaten lungerten am Holzbrunnen herum, ließen einen Weinschlauch kreisen und beäugten die junge Magd, die einen Eimer aus den Tiefen des Brunnenschachts heraufzog.
Gerüche hingen in der Luft: Pferdemist, Holzrauch und frisches Brot. Letzterer ließ meinen Magen knurren, und ich dachte voll Sehnsucht an Weizenbrot, frisch aus dem Ofen, das noch warm mit Butter und Honig bestrichen wurde. Gequält drängte ich das Bild beiseite, denn in letzter Zeit hatten Welten meine Kost von solchen Leckereien getrennt.
»Cette direction.« Stiefel und Fäuste deutete über meine Schulter auf eine Tür im Erdgeschoss des Wohnturms.
Ich bemerkte einen drängenden Unterton in seiner Stimme. Der heftige Stoß, der folgte, bestätigte, dass er es eilig hatte.
Eine Frauenstimme drang von oben herab. Sie klang verärgert und tadelnd. Mein Blick folgte der Treppe, die vom Hof hinauf zum reich verzierten Eingang in der Wand des Turms führte. Eine zierliche Gestalt – Isabelle, an ihrem grünen Mantel erkennbar – hatte die oberste Stufe erreicht, wo eine Frau mit üppiger Figur sie erwartete. Dem drohenden Finger und dem fortwährenden Geschimpfe nach handelte es sich um Isabelles Amme.
Ich wollte so gern, dass Isabelle sich umdrehte, mich sah und mich mit einer freundlichen Geste bedachte. Wieder hätte ich beinahe nach ihr gerufen, aber Stiefel und Fäuste kam mir mit einem scharfen Schlag zuvor, bei dem ich mir auf die Lippe biss. Nun sicher, dass etwas nicht stimmte, schaute ich mich nach jemandem von hoher Stellung auf dem Burghof um, dem Vogt oder einem Ritter, aber ich entdeckte niemanden. Ich ging schleppend, aber es machte keinen Unterschied. Bald hatten wir die unheilvoll aussehende Tür erreicht, und nachdem er sie mit einem schweren eisernen Schlüssel aufgeschlossen hatte, trieb er mich ich in den dunklen, feuchten Raum dahinter.
Ich schaute um mich, während sich meine Augen ans Halbdunkel gewöhnten. Holzpfeiler, dicker als ein Mann, standen ein Dutzend Schritte auseinander und stützten, was über mir war, vermutlich den Boden der Wohnhalle. Auf allen Seiten waren Türen in den Wänden. Ich hielt sie für Kornspeicher, Lagerräume und Kerkerzellen. Mein Verdacht, was Letzteres anging, wurde bestätigt, als Stiefel und Fäuste mich auf eine offene Tür zutrieb, die wie der Eingang eines Grabmals klaffte. Ich blieb stehen. Ich war kein Königskind wie Aoife, aber ich war auch kein Schwerverbrecher. Ich verdiente ein besseres Quartier als ein Verlies. Mit zum Widerspruch geöffnetem Mund wandte ich mich Stiefel und Fäuste zu.
Auf diese Gelegenheit hatte er nur gewartet. Seine rechte Faust schoss vor und traf mich unter dem Kinn. Dass sie mit einer schweren Eisenkette umwickelt war, sollte ich erst später erfahren. Wie ich am Boden aufprallte, merkte ich nicht.
KAPITEL II
Was soll ich über die schreckliche Zeit berichten, die darauf folgte? Ich vermochte nicht einmal zu sagen, wie lange ich in dem Höllenloch schmachtete. Damals erschien es mir wie eine Ewigkeit, später erfuhr ich, dass es etwas mehr als eine Woche gewesen war. Nur eine dünne wollene Decke trennte mich vom Boden aus gestampfter Erde, und ich fror ständig. Ich würde sogar wetten, dass die Kälte genauso schlimm war wie in dem windgepeitschten Kloster auf Lindisfarne, über das ich von Mönchen gehört hatte. Um mir die Knochen zu wärmen, stapfte ich in meiner Zelle, die sechs mal sechs Schritte maß, auf und ab. Von der Tür ging ich bis an die gegenüberliegende Wand, zuerst mit ausgestreckter Hand, damit ich nicht gegen die Steine prallte, dann, bei wachsendem Ortsgefühl, mit beiden Händen an der Decke, die ich mir um die Schultern gewickelt hatte.
Völlige Dunkelheit war meine Welt. Dass die Stunden verstrichen, bemerkte ich nur, weil immer wieder ein Soldat kam und mir Essen und Bier brachte. Ich hatte keine Vorstellung, wie oft diese Besuche erfolgten, aber mein knurrender Magen deutete darauf hin, dass er vielleicht einmal am Tag kam. Weit seltener erschien einer meiner Wärter, um meinen überquellenden Eimer auszuwechseln.
Während solcher kurzen Momente drang ein schwaches Licht von der Außentür in den Keller und dadurch auch in meine Zelle. Fast blind, aber darauf erpicht, herausgelassen zu werden, begrüßte ich die Wärter zuerst mit entrüsteten Protesten, dass ich nicht hier sein sollte, dass ich zwar eine Geisel, aber immer noch ein Edelmann sei. Ob sie meine furchtbare Mischung aus Irisch und Französisch verstanden, weiß ich nicht zu sagen. Entweder lachten sie darauf oder gaben gar keine Antwort. Ich lernte bald, den Mund zu halten, denn nach mehreren Versuchen stattete Stiefel und Fäuste mir einen Besuch ab.
Er setzte eine Fackel in einen Halter neben der Tür, postierte für den Fall, dass ich Widerstand leisten sollte, einen Soldaten mit gezücktem Schwert, dann trat er mich grün und blau. Obwohl ich darauf brannte, mich zu wehren, ließ ich es sein, denn gegen zwei bewaffnete Widersacher war jeder Versuch zum Scheitern verurteilt. Ich rollte mich zusammen und versicherte mir, dass es besser sei, wund und verhungernd zu überleben, als im Verlies an einem Stich in den Bauch langsam zu verrecken.
Er kam wieder, als ein Wächter mir das nächste Mal Essen brachte, und verprügelte mich erneut. Vermutlich von einem irischen Matrosen hatte er in der Zwischenzeit erfahren, dass das Wort Amadán so viel wie Schwachkopf bedeutete, und war vor Wut außer sich. Ein Tritt gegen den Schädel sandte mich wirbelnd in die Schwärze der Bewusstlosigkeit.
Ich kann nicht sagen, wie lange ich am Boden gelegen habe, aber als ich zu mir kam, litt ich Schmerzen, wie ich sie noch nie erlitten hatte. Jeder Atemzug stach in der Brust, ein Zeichen, dass ein paar Rippen angebrochen waren. Mein Gesicht war blutverkrustet. Ich hatte einen Schneidezahn verloren, und mein Bauch fühlte sich an, als hätte der Hufschmied vom Burghof ihn stundenlang mit seinem Hammer bearbeitet. Bei allen Heiligen, Stiefel und Fäuste wusste, wie man Schmerzen zufügte.
Ich lernte aus diesen Prügeln. Von diesem Zeitpunkt an zog ich mich an die hintere Wand meiner Zelle zurück, sobald ich hörte, dass sich Schritte näherten, und wartete auf das Knarren der Tür. Misstrauisch wie ein wildes Tier sah ich zu, wie Schüssel und Becher auf den Boden gestellt wurden. Erst wenn sich wieder völlige Schwärze eingestellt hatte, kroch ich auf allen vieren – richtig, wie ein hungriger Hund – zu meiner mageren Ration und schlang sie hinunter.
Im Dunkeln allein, halb totgeprügelt, durchgefroren bis aufs Mark und rasend vor Hunger, verlor ich beinahe den Verstand. Zuerst half mir das Gebet, aber als es Tag für Tag, Nacht für Nacht unbeantwortet blieb, verlor ich die Hoffnung. Mönche mögen mit Fasten und Einsamkeit vertraut sein, aber sie mussten nie in einem Verlies schmachten. Sie wurden nie so lange im Dunkeln gehalten, bis auch der schwächste Sonnenstrahl wie ein Blitzschlag in den Augen schmerzte, hatten nie die fachkundigen Aufmerksamkeiten von Stiefel und Fäuste erdulden müssen.
Ich gab das Beten auf, träumte von Irland, malte mir aus, wie es dort wäre.
Über die Heimat meiner Kindheit, über Cairlinn, habe ich noch nichts berichtet. Am nördlichsten Ausläufer von Leinster befindet es sich am Südufer eines langen schmalen Meeresarms, auf dessen anderer Seite Ulster liegt. Ein steiler Berg ragt hinter der Siedlung auf. Sliabh Feá nannten wir ihn – die Engländer würden es »Schlie-af Fay« aussprechen. Viele schöne Sommertage lag ich mit meinen Freunden auf dem Gipfel. Vom Wettlauf nach oben schwer atmend schauten wir über den schmalen Wasserstreifen, der Cairlinn von Ulster trennte. Als Männer, prahlten meine Freunde und ich, würden wir nach Norden ziehen und Vieh stehlen, ganz wie unsere Väter und Großväter es getan hatten. Die Clans von Ulster waren stets unsere Feinde gewesen, oder wenigstens hieß es so in den Geschichten.
Die Erinnerungen halfen mir eine Weile über meine Lage hinweg. Ich saß an die Zellenwand gelehnt, die Decke eng um mich gelegt, und stellte mir die großen Hände meines Vaters mit ihren Schwielen und gebrochenen Nägeln vor, die dennoch sanft waren und mir zeigten, wie man ein Schwert greift. Mutter, die Stirn vor Konzentration gerunzelt, brachte meiner jüngeren Schwester das Sticken bei. Der Ruf der Lerche schallte an einem warmen Sommertag über Sliabh Feá. Der verlockende Geruch von frisch in der Bucht gefangenen Makrelen, die nun in Butter brieten, oder von Brot frisch aus dem Ofen, drang mir in die Nase. Ich sah Frauen und Männer, die in der längsten Nacht des Jahres um die großen Feuer tanzten. Bealtaine nennen wir es. Die Engländer kennen es als Beltane. Winterabende, die man vor dem Feuer verbringt, während draußen der Sturm tobt, und der Barde webt Geschichten von Liebe und Verrat, Freundschaft und Feindschaft, Krieg und Tod. Mein Name Ferdia stammt aus der legendären Táin, einer Geschichte, die seit tausend Jahren und länger an den Feuern Irlands erzählt wird. »Teun« wäre eine Entsprechung des Wortes, die englische Zungen noch am ehesten bewältigen könnten.
Ich hatte damals noch nicht viel vom Leben gesehen. Nach nur kurzer Zeit ging mir der Vorrat an Erinnerungen aus. Ich versuchte sie erneut zu durchleben, aber das Elend meiner Lage wurde mir zu groß. Völlig niedergeschlagen vergoss ich bittere Tränen, und in meinem Kopf wütete ich gegen die Ungerechtigkeit, die mir zugefügt wurde. Ich betete zu Gott, aber der Herr gab keine Antwort. Zorn verdrängte meine Furcht, und ohne zu überlegen, wer es hören könnte, hämmerte ich gegen die Tür, bis meine Hände aufgeschürft waren und bluteten. Niemand reagierte, niemand kam. Ich würde hier sterben, schien es. Verzweiflung und Erschöpfung überfielen mich, und ich sackte am Boden zusammen. Nicht lange dauerte es, und ich war trotz der Kälte und meines Herzenskummers eingenickt.
Ich fuhr aus dem Schlaf hoch, weil ein Scharren mich weckte. Ich sprang auf, und als der Riegel ganz beiseitegeschoben war, schlurfte ich weg von der Tür. Mir drehte sich der Magen um. Es war kaum drei Stunden her, seit ich meine letzte Mahlzeit verschlungen hatte. Stiefel und Fäuste ist wieder da, sagte ich mir. Zu meiner Überraschung merkte ich, wie ich selbst die Hände zu Fäusten ballte. Bilder traten mir vor Augen. Sein hässliches Gesicht, von Furcht verzerrt. Meine Hiebe ließen seine Nase zerplatzen wie eine überreife Pflaume. Schreie, Flehen um Gnade füllte die Zelle – von ihm, nicht von mir.
Die Tür wurde geöffnet. Fackelschein fiel auf den Fußboden.
Ich atmete tief ein. Stiefel und Fäuste stand die Überraschung seines Lebens bevor. Wenn mein Angriff durch ein Wunder erfolgreich war, würde der Soldat, der meinen Peiniger stets begleitete, sie vermutlich mit seiner Klinge beenden. Scheiterte ich, würde ich Prügel bekommen, wie ich sie noch nie zuvor erhalten hatte. Im ersten Fall wäre ich tot, im zweiten verkrüppelt.
Mich kümmerte es nicht mehr.
»Willkommen, FitzAldelm«, krächzte ich. Ich stellte die Füße auseinander, wie mein Vater es mich gelehrt hatte, und hob die Fäuste.
»Ferdia Ó Catháin?«, fragte eine piepsige Stimme.
Verwirrung überfiel mich. In der Tür erkannte ich zwei kleine Gestalten, die eine etwas größer als die andere, und dahinter einen noch größeren Umriss. »Ja?«, antwortete ich.
»Siehst du, Gilbert? Ich habe es mir nicht ausgedacht!«, rief eine Stimme auf Irisch. Erstaunt erkannte ich Isabelle.
Die große Gestalt trat von einem Fuß auf den anderen und sagte etwas auf Französisch: ein Mann, und er klang nicht glücklich.
Isabelle gab eine scharfe Antwort. Der Mann verstummte. »Du bist grausam behandelt worden, Rufus«, sagte sie zu mir.
Gilbert unterbrach sie, wie kleine Kinder es tun. »Rufus? Ich dachte, du hättest gesagt, er heißt Ferdia.«
»Ich habe rote Haare«, erklärte ich. »Einige nennen mich Rufus. Das ist ein altes lateinisches Wort für ›der Rote‹.«
»Mir gefällt der Name«, sagte Gilbert.
»Leise«, befahl Isabelle. »Ich habe versucht, dich zu befreien, Rufus, aber der Wärter hört mir nicht zu. Wenn meine Mutter erfährt, was geschehen ist, wird sie sehr zornig sein.«
Aoife ist noch nicht wieder hier, dachte ich, und meine neu geweckte Hoffnung fiel in sich zusammen. »Wo ist sie?«
»Irgendwo an der Küste. Sie besucht eine der Burgen meines kleinen Bruders.«
»Ich habe fast zwanzig davon in Wales«, verkündete Gilbert mit kindischem Stolz. »Und in England und Irland noch mehr.«
»Das ist eine Menge.« Ich musste an die kleine Feste meines Vaters denken, die dank meiner älteren Brüder nie mir gehört hätte. Eigenartigerweise war Isabelle in einer ähnlichen Lage. Obwohl sie das ältere Kind war, würde sie die Ländereien der de Clares nicht erben, weil Söhne Vorrang gegenüber Töchtern hatten. Ich deutete eine Verneigung vor Gilbert an. »Dann bist du der Earl von Pembroke.«
»Das bin ich.«
»Es ist mir eine Ehre, dich kennenzulernen, Herr.«
Gilbert wandte sich Isabelle zu und wollte wissen: »Wer ist das noch mal?«
»Ich habe es dir doch gesagt. Ein irischer Edelmann, der als Geisel nach Striguil geschickt wurde. Er sollte nicht so eingesperrt sein.«
»Was ist denn eine Geisel?«
Sie sind noch so klein, dachte ich. Isabelle war vielleicht sechs und Gilbert nur drei oder vier. Dass es den beiden gelungen war, mich zu erreichen, war schon ein Wunder, aber mich zu befreien überstieg gewiss ihre Möglichkeiten.
»Still, Gilbert, lass mich nachdenken«, murmelte Isabelle.
»Wann wird eure Mutter zurückerwartet?«, fragte ich.
»In zwei oder drei Tagen.«
Das war keine Ewigkeit, aber mir graute vor dem Gedanken, wie Stiefel und Fäuste reagierte, wenn er von meinem Besuch erfuhr. »Weiß der Vogt, dass ich hier bin, oder ein Ritter des Haushalts?«
Der Mann, der bei den Kindern war, sagte wieder etwas zu Isabelle. Er klang weiterhin respektvoll, aber auch drängender.
Sie stampfte mit dem Fuß auf. »Ferdia, ich kann nicht bleiben. Und befreien kann ich dich auch nicht – es tut mir leid.« Sie klang gequält.
»Das ist nicht deine Schuld, Herrin.« Ich versuchte, unbekümmert zu klingen.
»Bist du hungrig?«
»Ausgehungert.«
»Du wirst Essen bekommen, und auch Wein.« Sie zog sich zurück, nahm Gilbert bei der Hand und gestattete dem Wächter, mich wieder einzuschließen.
»Und FitzAldelm, Herrin?«
Die Tür fiel zu. Der Riegel wurde vorgelegt.
Durch die Bohlen sagte Isabelle: »Er wird nicht wiederkommen, bevor meine Mutter zurückgekehrt ist. Das schwöre ich.«
In der Dunkelheit entschlüpfte mir ein langes Seufzen der Erleichterung.
Tatsächlich dauerte meine Einkerkerung noch einen Tag und eine Nacht an. Zu meiner Erleichterung gab es in dieser Zeit kein Zeichen von Stiefel und Fäuste. Am letzten Morgen erwachte ich aus unruhigem Schlaf und schritt die Zelle ab, um mich von der Kälte und meinem knurrenden Magen abzulenken. Isabelle hatte Wort gehalten, aber die dicke Lauchsuppe und das frische Brot, das ich erhielt, waren längst verspeist. Ich hatte die Holzschalen schon ausgeleckt und überlegte gerade, sie erneut zu untersuchen, als Geräusche vom Burghof meine Aufmerksamkeit erregten.
Männer brüllten, Pferdehufe klapperten. Sogar durch die dicken Wände spürte ich die Aufregung. Jemand Wichtiges war eingetroffen. Ich betete, wie ich seit Tagen nicht gebetet hatte: Lieber Gott, lass es Aoife sein, ich flehe dich an!
Seine Antwort erhielt ich rascher als erhofft.
Mehrere Soldaten kamen, öffneten meine Zellentür und führten mich auf den Burghof. Sie legten keine Hand an mich, als ich blinzelnd und misstrauisch ins grelle Sonnenlicht hinaustrat. Mit verfilzten Haaren, in schmutzigen Lumpen, zum Himmel stinkend, muss ich einem wilden Tier geglichen haben. Mehr als einer verzog das Gesicht, und ich warf mit hasserfüllten Blicken um mich. Hätte ich ein Schwert gehabt, hätte ich jeden Mann gefällt, der mir unter die Augen gekommen wäre. Ich überlegte, eine Klinge an mich zu bringen, aber allein hätte ich die Soldaten in ihren schweren Gambesons, den gepolsterten Waffenröcken, nur wenige Augenblicke beschäftigt. Wie mit einem Kacheldeckel, der ein Feuer über Nacht am Leben erhält, würde ich meinen Hass auf kleiner Flamme halten, um ihn an einem anderen Tag auflodern zu lassen.
»Sprecht Ihr Französisch?« Die gebieterische Stimme näselte.
Ich drehte den Kopf. Ein kleiner, beflissener Mann in einem ärmellosen, gegürteten langen Hemd aus feiner blauer Wolle war die Stufen zum Eingang der Wohnhalle herabgestiegen. Ich kannte ihn nicht, aber dem Schnitt seiner Kleidung und seinem arroganten Gebaren nach hielt ich ihn für den Vogt. »Ein wenig«, antwortete ich.
Seltsamerweise verstand er meine Worte so, als beherrschte ich die Sprache fließend, und plapperte auf Französisch los. Die wenigen Worte, die ich verstand, waren »Eva«, »schmutzig« und »Bad«. Er wies auf ein Gebäude neben der Schmiede, wo ich vor einem Lebensalter zugesehen hatte, wie ein Pferd beschlagen wurde. In der Annahme, er meine, dass ich in meinem Zustand unmöglich vor die Gräfin Aoife treten könne und vorher ein Bad nehmen müsse, hob ich einen Arm und tat, als würde ich mich erst darunter und dann unter dem anderen schrubben. Ein steifes Nicken war seine Antwort.
»Und danach?«, wagte ich auf Französisch zu fragen.
»Wartet.« Der Vogt sagte etwas zu den Soldaten, stieg die Treppe hoch und verschwand im Wohnturm.
Ein Befehl auf Französisch, und einer der Fußsoldaten stieß mich an. Ich tat wie geheißen und ging zu dem Gebäude, das sich als Dienerunterkunft erwies. Im ersten Raum fand ich eine hölzerne Badewanne, die zu zwei Dritteln mit warmem Wasser gefüllt war. Ich hätte weinen können. Selten habe ich meine Kleidung so schnell abgelegt wie damals, nicht einmal, wenn eine Frau im Spiel war.
Mit einem Seufzer des Behagens stieg ich ins Wasser, tauchte den Kopf unter und lächelte noch immer, als ich wieder hochkam. Da die Fußsoldaten draußen geblieben waren, war ein Diener der einzige Zeuge meines Entzückens. Mit unbewegtem Gesicht reichte er mir ein Stück Seife. Es war nicht die teure Sorte aus Kastilien, an die ich mich später gewöhnt habe, sondern die übliche weiche Masse, die man aus Hammelfett, Holzasche und Soda herstellt. In diesem Augenblick jedoch erschien mir die Seife kostbarer als ein Klumpen Gold.
Nachdem ich mich gesäubert und mir die Haare gewaschen hatte, stieg ich aus der Wanne und nahm das grobe Leinentuch, das der Diener mir reichte. Ich trocknete mich ab und dankte ihm auf Französisch. Ein wenig erstaunt, überhaupt beachtet zu werden, senkte er den Kopf. Einfache, aber gute Kleidung lag auf einer Holztruhe für mich bereit. Auf dem Boden standen neue, niedrige Stiefel. Ich zeigte auf meine Bruoch, mein Hemd und meine Beinlinge, die auf einem Haufen lagen. Das einzige Wort in der Antwort des Dieners, dem ich Sinn entnehmen konnte, war feu, Feuer. Dass ich gleich vor die Gräfin Aoife treten würde, beherrschte meine Gedanken. Mir war es egal, was aus den Lumpen wurde, und winkte gleichgültig ab.
Ich trat hinaus auf den Hof, wo der Vogt auf mich wartete. Er betrachtete mich von oben bis unten und schniefte. Dafür hätte ich ihn am liebsten geohrfeigt, ich erinnerte mich aber, wie es geendet hatte, dass ich mir Stiefel und Fäuste zum Feind machte, und überging sein Betragen. Zahm wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, nahm meine Hoffnung mit jedem Schritt zu, während ich ihm folgte. Zwei Soldaten stapften hinter uns her, muskulöse Arme, unrasierte Kinne und harte Blicke.
Die Treppe hinauf ging es in die Wohnhalle. Wir traten am einen Ende des riesigen Saals ein, und ich musste mein Erstaunen verbergen. Die Halle meines Vaters war im Vergleich zu der des Königs von Leinster, einem beeindruckenden Bauwerk, nicht groß gewesen, aber gegenüber dieser wirkten beide winzig. Mit Schnitzereien versehene Holzpfeiler, dick wie ein Mann, stützten auf ganzer Länge des Raums die hohe Decke. In den Rundbogenfenstern rechts und links zeigte sich blauer Himmel – heute wurden die Kerzen in den Wandhaltern nicht gebraucht. Unter den Fenstern hingen Wandteppiche, deren Farben sich satt vom stumpfen Cremeweiß des Putzes abhoben.
Neugierig schaute ich mich um. Vor der Rückwand standen von Tüchern bedeckte Tische und lange Bänke für die Mahlzeiten. Von einem Kammerherrn mit Adleraugen bewacht, polierten Diener silberne Kelche. Ein Junge kehrte schmutzige Binsen zusammen, ein zweiter streute frische auf den Holzboden, der das Dach meiner Zelle gewesen war. So nah und doch so fern, dachte ich. Beide Orte trennten Welten voneinander.
Eine Berührung am Ellbogen. Ich lächelte den Vogt entschuldigend an. Er erwiderte die Geste nicht, sondern bedeutete mir, ihm zu folgen. Ich gehorchte. Der schwere Schritt der Soldaten hinter mir ließ mich nicht vergessen, in welch unsicherer Lage ich mich nach wie vor befand.
Ich ging den Saal entlang, während Hausritter, Schreiber und Knechte an den Seiten zusahen und hinter vorgehaltener Hand tuschelten. Die meisten Blicke waren forschend oder gleichgültig, aber ich sah auch unfreundliches oder gar feindseliges Starren. Ich fragte mich, was man seit meiner Ankunft über mich erzählte und am Feuer weitertratschte. Stiefel und Fäuste hatte eine Lügengeschichte ersonnen, um über seine Taten hinwegzutäuschen, so viel stand für mich fest. Wenn er das Ohr der Gräfin Aoife hatte, geriet ich leicht vom Regen in die Traufe. Die Angst stieg wieder in mir auf. Isabelle mochte mich, aber die Meinung eines Kindes, und mochte es von noch so hohem Rang sein, wog selten schwer. Dank Stiefel und Fäuste hatte ihre Mutter vielleicht bereits entschieden, dass ich ein gefährlicher Wilder sei, der in den Käfig gehöre. Ich bemerkte den Blick von jemandem, und als ich den Kopf drehte, sah ich niemand anderen als Stiefel und Fäuste in einer Schar eines halben Dutzends Ritter. Er grinste höhnisch und sagte etwas zu seinen Gefährten, die daraufhin auflachten. Hart aussehende Männer waren sie alle, aber mein Blick blieb auf einem mit einem seltsamen Haarschnitt hängen, einer Frisur, die seinen Hinterkopf kahl ließ, während sich der Rand von dort zu seinen Ohren absenkte. Eine höckrige Narbe verunzierte sein Kinn.
Erzürnt über die Verachtung der Ritter, besorgt über die Zuversicht, die Stiefel und Fäuste an den Tag legte, aber nicht bereit, mir etwas anmerken zu lassen, tat ich, als hätte ich sie nicht gesehen. Mit trockenem Mund und pochendem Herzen folgte ich dem Vogt zu einem niedrigen Podest, auf dem zwei zierliche Stühle mit hohen Lehnen standen. Beide waren leer. Hinter ihnen schloss eine deckenhohe Trennwand die Halle ab. Dahinter befanden sich vermutlich die Privatgemächer der Gräfin.
Ich spitzte die Ohren, als ich Kinder auf der anderen Seite des Schirms hörte. Eine Frau sagte etwas. Eine Mädchenstimme – sie gehörte Isabelle – erhob sich protestierend. Die Frau entgegnete mit Schärfe. Stille folgte. Meine Befürchtungen steigerten sich. Ich stählte mich und sandte Gott ein Bittgebet. Alles werde gut, versicherte ich mir.
Mit einem warnenden Blick, zu bleiben, wo ich sei, trat der Vogt zu einer Tür, die in den Wandschirm eingelassen war, und klopfte. Eine Frau öffnete, er trat ein und schloss sie hinter sich. Bald kehrte er zurück, und der nunmehr vertraute abschätzige Blick von oben nach unten, mit dem er mich bedachte, verriet mir, dass die Gräfin ihm bald folgen würde.
Die Tür wurde abermals geöffnet. Ein Umriss erschien, gefolgt von drei Dienerinnen. Der Vogt kündigte Aoifes Erscheinen auf Französisch an. Schweigen senkte sich herab, und alles wandte sich dem Podest zu. Ich wusste, dass ich besser nicht starrte, aber ich konnte nicht anders.
Zu dieser Zeit hatte Aoife einunddreißig Sommer gesehen. Eigentlich war sie über ihre Blüte hinaus, aber die Frau, die sich vor mir auf den Stuhl setzte, raubte mir den jugendlichen Atem. Jeder Gedanke, sie könnte meine Feindin sein, verflüchtigte sich wie der Morgennebel. Ich trank ihren Anblick. Ein langes Kleid aus grüner Seide schimmerte bei jeder Bewegung und hob sich vom dunklen Rot ihrer Haare ab, die von einem zierlichen Netz aus juwelenbesetztem Gold zurückgehalten wurden. Ein Gürtel aus demselben Edelmetall umschloss ihre schmale Taille, und ein blutroter Rubin funkelte in einer Brosche an ihrer Brust.
Ein entrüstetes Psst, und ich riss meinen Blick von Aoife los. Mit wütenden Gebärden gab der Vogt mir zu verstehen, dass ich mich verbeugen sollte. Entsetzt verneigte ich mich aus der Hüfte und sagte auf Irisch: »Ich bitte tausendmal um Verzeihung, Herrin.«
»Bekommt man in Irland keine Manieren mehr beigebracht?« Aoife sprach ebenfalls Irisch. Ihr Tonfall war beiläufig, aber dahinter spürte ich Stahl.
Verlegen verbeugte ich mich erneut und betete, dass sie meine Lust nicht gesehen hatte. Hinter mir hörte ich Gekicher. »Chien«, sagte eine Stimme. »Irischer Hund«, eine andere. Mit nunmehr tiefroten Wangen antwortete ich: »Das bekommt man durchaus, Herrin, und ich habe sie ganz vergessen. Vergib mir, ich flehe dich an.«
Ihr Lächeln erreichte ihre Augen, die von einem betörenden Grün waren. »Dir sei verziehen. Falls das, was ich gehört habe, wahr ist, verwundert es nicht, wenn höfisches Benehmen die geringste deiner Sorgen ist.«
Unsicher, was ich am besten antworten sollte, sagte ich gar nichts darauf.
»Du bist Ferdia Ó Catháin aus Cairlinn in Leinster, in den Gewahrsam meines Sohnes gegeben, um für das Wohlverhalten deines Vaters zu garantieren.«
»Jawohl, Herrin.«
»Wird das Versprechen eingehalten?«
Erschrocken erinnerte ich mich der Mahnung meines Vaters, niemals vor den Engländern das Knie zu beugen. »Ich werde es auch nicht tun«, hatte er gesagt und geblinzelt. Als er meine Sorge bemerkte, hatte er hinzugefügt: »Fürchte nichts. Ich werde der Garnison schon Loyalität vorspielen – damit du unbeschadet bleibst –, aber es gibt Mittel und Wege, den Feind zu bekämpfen. Silber in der richtigen Hand kann viele Dinge erkaufen. Waffen, Rüstungen und Männer, die damit umgehen können.« Noch ein Blinzeln. »Ich werde nichts weiter sagen, nicht dass du dich noch verplapperst.«
»Nun?«, fragte Aoife.
»Verzeih, Herrin. Ich musste an meine Familie denken.« Erfreut zu sehen, wie ihre Miene milder wurde, fuhr ich fort: »Mein Vater ist ein Mann, der zu seinem Wort steht.«
»Und du?«
Überrascht von ihrer Direktheit und in meiner Ehre gekränkt, streckte ich das Kinn vor und sagte: »Das bin ich auch, Herrin. Ich habe in Irland geschworen, nicht zu fliehen. Ich wiederhole diesen Schwur nun vor dir, vor Gott und allen seinen Heiligen.«
Aoife schien zufrieden. »Wie ich höre, wurdest du während meiner Abwesenheit in einer Zelle unter uns eingesperrt.« Mit der Spitze ihres Pantoffels klopfte sie zur Betonung auf das Podest.
»Richtig, Herrin. Keine Stunde ist es her, dass ich befreit wurde.«
»Mir wurde berichtet, dass der Ritter Robert FitzAldelm dich schlecht behandelt hat. Er soll dich verprügelt haben.« Sie wiederholte ihre Worte auf Französisch und warf, während sich entsetztes Keuchen erhob, einen Blick durch die Halle auf Stiefel und Fäuste. Isabelle hatte mit ihrer Mutter gesprochen, so viel stand fest.
»Ist das wahr?« Sie richtete die grünen Augen auf mich. Mehr als einmal hat er das getan, wollte ich sagen, aber ich spürte, wie der Blick von Stiefel und Fäuste mir ein Loch in den Rücken brannte. Striguil wird mein Zuhause sein, dachte ich, und ich habe keine Freunde außer Isabelle. Ihre erhabene Stellung hätte zur Folge, dass sich unsere Wege nur selten kreuzten, und bei all ihrer Freundlichkeit war sie noch ein Kind. Stiefel und Fäuste hingegen würde ich täglich begegnen, ohne Zweifel hatte er zahlreiche Freunde und Verbündete. Sehr gut denkbar, dass er bereits plante, mir das Leben zur Hölle zu machen. Beschuldigte ich ihn öffentlich, riskierte ich, an einem dunklen Abend ein Messer zwischen die Rippen zu bekommen.
Ich traf meine Entscheidung. »Auf dem Schiff gab es Zank, als wir den Fluss hinauffuhren, Herrin. Ich war unhöflich zu FitzAldelm, und als er mich rügte, erhob ich die Hand gegen ihn.« Mir erschien es gut denkbar, dass Stiefel und Fäuste etwas Ähnliches behauptete. Ich hoffte darauf. »Darauf reagierte er, wie jeder Ritter es täte, und Frau Isabelle kam dazu und sah es.«
Aoife runzelte die Stirn, aber mit keiner Miene gab sie zu verstehen, dass sie meine Geschichte nicht glaubte. »Und danach – als du in der Zelle warst?« Sie starrte mich an, und obschon es unmöglich war, kam es mir vor, als blickte sie mir unter Hemd und Beinlinge auf die Schwielen, die meinen Körper bedeckten.
»Das Essen war erbärmlich, Herrin, aber sonst kann ich mich über nichts beschweren.« Ich schenkte ihr etwas, von dem ich hoffte, es sei ein gewinnendes Lächeln.
Ob sie meine Lüge durchschaute, vermochte ich nicht zu sagen, aber ihre vollen Lippen krümmten sich belustigt. »Es war falsch von FitzAldelm, dich in den Kerker zu werfen, aber unter den Umständen vielleicht verständlich.«
»Jawohl, Herrin«, log ich und dachte dabei: Herrgott, gewähre mir Rache. Ich werde Stiefel und Fäuste zeigen, was Prügel bedeuten.
»Du sollst von nun an in der Wohnhalle schlafen und auch hier essen. Ich rufe dich vielleicht von Zeit zu Zeit zu mir. Von meinen Kindern abgesehen habe ich kaum jemanden, mit dem ich Irisch sprechen kann.«
»Es wäre mir eine Ehre, Herrin«, antwortete ich entzückt.
»Du wirst außerdem Französisch lernen.«
»Jawohl, Herrin.« Ich verbeugte mich und hoffte, dass ich das Schlimmste hinter mir hatte.
KAPITEL III
Im Stall war die Luft warm und klebrig. Schweiß lief mir von der Stirn, während ich mit meiner Schaufel in der hintersten Ecke nach Dung suchte, der mir bisher entgangen war. Ich fand nur eine Ratte, die davonschoss, bevor ich sie zerhacken konnte. Ich pfiff nach Patch, aber der Terrier des Stallmeisters kam nicht. Ich verfluchte den elenden Köter, der nie zur Stelle war, wenn man ihn brauchte, und wandte mich wieder dem Boden aus gestampfter Erde zu. Ich entschied, dass er ausreichend sauber war, ergriff meinen Besen und fegte das Ergebnis meiner Arbeit, einen Haufen aus schmutzigem Stroh und Pferdemist, in Richtung Tür.
Seit meiner Ankunft in Striguil war ein halbes Jahr verstrichen. Der Hochsommer hatte Einzug gehalten, und mitgebracht hatte er drückend heißes Wetter. Nach meiner Audienz bei Aoife war ich zur Arbeit mit den Knappen eingeteilt worden, die den Hausrittern der Gräfin dienten. Da ich niemandem im Besonderen unterstand, musste ich für alle buckeln, eine ungerechte Last, an der ich wenig ändern konnte. Ein guter Teil der Knappen war durchaus anständig, und nachdem ich einige Zeit den Kopf unten gehalten und wenig geklagt hatte, hießen sie mich in ihrer Mitte willkommen. Die beiden, mit denen ich am meisten gemeinsam hatte, hießen Hugo und Walter. Hugo war schlank und zäh und hätte mit seiner hellen Haut und dem sommersprossigen Gesicht als Ire durchgehen können. Walter war sein genaues Gegenteil, hatte einen bräunlichen Teint und dunkle Haare. Schmal gebaut, aber drahtig wie ein Jagdhund, war er jedermanns Freund.
Um weder meine körperliche Form noch die Geschicktheit mit den Waffen einzubüßen, übte ich mit den beiden bei jeder Gelegenheit. In gepolsterten Gambesons oder in vollem Harnisch – der natürlich geliehen war – drosch ich auf sie ein, und sie taten das Gleiche mit mir. Wir rangen, wir kämpften mit den Fäusten, wir beschimpften uns gegenseitig, wie junge Männer es tun. Ich übte mit Schwert und Schild aus Holz und schliff meine Fertigkeit am Palus, einem mannshohen Pflock, der in den Boden getrieben war. Manchmal erhielten wir auch Gelegenheit, mit der Lanze gegen die Stechpuppe zu reiten. Zuerst hallte mir das spöttische Gelächter der Zuschauer in den Ohren, aber bald, als ich meine Kunst verbesserte, bekam ich auch ermutigende Rufe zu hören.
Von den übrigen Knappen kann ich sagen, dass die meisten mich nicht übermäßig plagten, aber einige gab es, die alles taten, um mich auszunutzen. An diesem Morgen hatte einer der übelsten Missetäter, ein hohlwangiger Tölpel namens Bogo, der sich bereits für einen Ritter hielt, mir befohlen, die Ställe auszumisten – eine Aufgabe, die zu diesem Zeitpunkt er hätte erledigen sollen.
Einwände zu erheben hätte Bogo und seinen Kumpanen genau den Vorwand geliefert, auf den sie warteten. Ich hatte mich verteidigt, als sie mich das erste Mal angriffen, und zwei sogar niedergeschlagen, bevor ich überwältigt wurde. Während ich nach der Konfrontation ein blaues Auge und eine aufgeplatzte Lippe pflegte, war ich zu der bitteren Erkenntnis gelangt, dass ich am besten fuhr, wenn ich Zank und Streit mied. Ich konnte mich nicht mit jedem Mann in Striguil prügeln. Genauso wenig konnte ich zu meinem Leidwesen Rache an Stiefel und Fäuste üben. Er war ein Ritter, und ein Ritter war für meinesgleichen unantastbar. Ich hatte mich daher entschieden, ihm aus dem Weg zu gehen, als hätte er die Pest, und mir meine anderen Fehden gut auszusuchen. »Kämpfe, wenn du gewinnen kannst«, hatte mein Vater oft zu mir gesagt. »Andernfalls räume das Feld. Nur ein Narr würde sich anders verhalten.« Und so ignorierte ich Bogos höhnisches Grinsen und das seiner Freunde. Die Lippe hatte ich mir genäht, und an diesem Morgen war ich wortlos dem Befehl gefolgt, Besen und Schaufel zu ergreifen. Ich hatte mich beeilt, um die Arbeit rasch hinter mich zu bringen, denn die Wärme des Tages machte die Schufterei im feuchten Stall zur reinen Folter. Meine Arbeit ginge nicht zu Ende, bevor ich sie erledigt hatte. Zwei Pferde mussten gestriegelt werden, Sättel und Zaumzeug gereinigt, und danach hatte ich eine Rüstung zu polieren. Wenn ich fertig war, erhielten die Ritter ihr Mittagessen. Erst nachdem ich bei Tisch aufgetragen hatte, durfte ich kommen und gehen, wie es mir beliebte.
Bei der Bullenhitze konnte man nicht viel anderes tun, als in den Untiefen des Wye zu planschen. Der Fluss bot nicht nur eine angenehme Zuflucht vor der Hitze, dort konnte ich mich auch behaupten. Dank einer Kindheit am Meer wusste ich mich im Wasser zu bewegen und konnte jeden anderen Knappen länger untertauchen, als es angenehm war. Während ich das Stroh aus dem Stall kehrte, dachte ich: Bogo soll sich nur in meine Nähe wagen, dann zeige ich es ihm.
Eine Stimme drang in meine Gedanken. »Was für ein Gestank!«
»Herrin Isabelle.« Ich sah lächelnd auf. Niemand außer ihr sprach mich auf Irisch an. »Ich nehme an, du willst mir nicht helfen?«
Sie runzelte die Stirn. »Das wäre unter meiner Stellung.«
Ich lachte und bot ihr den Besen an. »Es ist ehrliche Arbeit. Komm, versuch es.«
»Nein!« Sie büßte ein wenig von ihrer Würde ein, als sie ihre Puppe an sich drückte und einen Schritt zurückwich.
»Ich scherze, Herrin«, sagte ich, indem ich ins Französische wechselte. Bei den seltenen Gelegenheiten, zu denen wir miteinander reden konnten, machten wir es immer so. Für mich war es eine Möglichkeit, außerhalb der ermüdenden Lektionen, die ich von einem der Schreiber des Kaplans erhielt, die Sprache zu lernen. »Das würde sich nicht geziemen.«
Sie spitzte schmollend die Lippen. »Genau das sagt Mutter auch, wenn ich mit dem Bogen üben möchte wie Gilbert.«
»Jungen lernen das Bogenschießen, Mädchen nicht.« Und doch fällt der Apfel nicht weit vom Stamm, sagte ich mir. Ich war lange genug in Striguil, um zu wissen, dass Aoife willensstark und im Denken unabhängig war. Ihre Tochter geriet ganz nach ihr.
»Das ist ungerecht.«
Ungerecht ist auch, dass ich hier Geisel bin, dachte ich bitter und sagte laut: »Aber so ist der Lauf der Welt.« Als ich ihre Enttäuschung sah, fiel mir ein, dass sie oft zu den Stallungen ging. »Ihr könnt aber mit dem Falken jagen, wenn Ihr älter seid. Würde Euch das gefallen?«
Sie seufzte. »Der Falkner sagt, es wird noch Jahre dauern, bis ich die Kraft dazu habe.«
»Dann müsst Ihr geduldig sein, Herrin.« Am liebsten hätte ich hinzugefügt: so wie ich. Ganz wie sie musste ich abwarten. Am Ende würde ich Irland wiedersehen und mit Gottes Hilfe auch meine Familie.
»Ihr klingt wie meine Amme oder der Kaplan. Oder meine Mutter«, sagte sie finster.
Ich machte eine entschuldigende Gebärde. »Erwachsene klingen für Kinder oft alle gleich.«
»Isabelle!«, erscholl das vertraute Gekeife.
»Könnt Ihr es mir beibringen?«
Ich sah mich besorgt um und flüsterte: »Das Bogenschießen?«
»Ja.«
Ich stellte mir vor, was die Gräfin daraufhin täte – oder Stiefel und Fäuste. »Nichts täte ich lieber, Herrin, aber mein Leben ist es mir nicht wert.«
»Ich hielt Euch für meinen Freund!«
»Das bin ich auch, Herrin«, wandte ich ein, aber sie war schon davongerauscht.