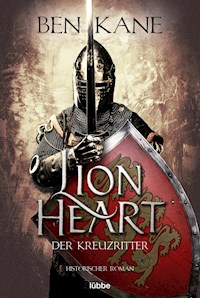9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Rom gehen Makedonien - Kampf der Imperien
Rom, 200 vor Christus. Gerade hat Rom Hannibal geschlagen und zum Friedensschluss von Kathargo gezwungen. Doch im Osten wartet bereits ein neuer Feind: Philipp V. von Makedonien, Herrscher über Griechenland. Als er seine Hand auch nach Pergamon und Rhodos ausstreckt, greift Rom ein. Ein neuer Krieg entbrennt und bringt die Römer bald an den Rand ihrer Möglichkeiten. Haben sie zu viel riskiert? Wird ihr Imperium untergehen? Oder kann der ehrgeizige Feldherr Flaminus das Blatt noch einmal wenden?
Der Bestsellererfolg aus England - endlich auf Deutsch!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über das Buch
Über den Autor
Titel
Impressum
Widmung
Zitat
PROLOG
TEIL I
1. KAPITEL
2. KAPITEL
3. KAPITEL
4. KAPITEL
5. KAPITEL
6. KAPITEL
7. KAPITEL
8. KAPITEL
TEIL II
9. KAPITEL
10. KAPITEL
11. KAPITEL
12. KAPITEL
13. KAPITEL
14. KAPITEL
15. KAPITEL
16. KAPITEL
17. KAPITEL
18. KAPITEL
19. KAPITEL
20. KAPITEL
21. KAPITEL
22. KAPITEL
23. KAPITEL
TEIL III
24. KAPITEL
25. KAPITEL
26. KAPITEL
27. KAPITEL
28. KAPITEL
29. KAPITEL
30. KAPITEL
31. KAPITEL
32. KAPITEL
33. KAPITEL
TEIL IV
34. KAPITEL
35. KAPITEL
36. KAPITEL
37. KAPITEL
38. KAPITEL
39. KAPITEL
40. KAPITEL
41. KAPITEL
42. KAPITEL
43. KAPITEL
44. KAPITEL
45. KAPITEL
46. KAPITEL
47. KAPITEL
48. KAPITEL
49. KAPITEL
EPILOG
NACHBEMERKUNG DES AUTORS
GLOSSAR
Über das Buch
Rom gehen Makedonien – Kampf der Imperien Rom, 200 vor Christus. Gerade hat Rom Hannibal geschlagen und zum Friedensschluss von Karthago gezwungen. Doch im Osten wartet bereits ein neuer Feind: Philipp V. von Makedonien, Herrscher über Griechenland. Als er seine Hand auch nach Pergamon und Rhodos ausstreckt, greift Rom ein. Ein neuer Krieg entbrennt und bringt die Römer bald an den Rand ihrer Möglichkeiten. Haben sie zu viel riskiert? Wird ihr Imperium untergehen? Oder kann der ehrgeizige Feldherr Flaminus das Blatt noch einmal wenden? Der Bestsellererfolg aus England – endlich auf Deutsch!
Über den Autor
Ben Kane wurde in Kenia geboren und wuchs in Irland auf, im Heimatland seiner Eltern. Bevor er sich ganz dem Schreiben widmete, arbeitete er als Tierarzt. Schon als Kind übte die Geschichte Roms eine große Faszination auf ihn aus, weshalb mit der Veröffentlichung seines Debüts »Die Vergessene Legion« ein lang gehegter Traum in Erfüllung ging. Mittlerweile ist Ben Kane Bestsellerautor und lebt mit seiner Familie in North Somerset, England.
BEN KANE
Kampf der Imperien
HISTORISCHER ROMAN
Aus dem Englischen von Dr. Dietmar Schmidt
Vollständige E-Book-Ausgabedes in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Für die Originalausgabe:Copyright © 2018 by Ben KaneTitel der englischen Originalausgabe: »Clash of Empires«Originalverlag: Orion Books, an imprint of The Orion Publishing Group Ltd
Für die deutschsprachige Ausgabe:Copyright © 2019 by Bastei Lübbe AG, KölnTextredaktion: Rainer Delfs, ScheeßelUmschlaggestaltung: Massimo Peter-BilleUnter Verwendung von Motiven von © Spear: kultofathena.com; Shield: ancientsculpturegallery.com & niximperial.com; Design/photography: blacksheep-uk.com; © bennymarty/DeposiphotosE-Book-Produktion: two-up, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-7798-9
www.luebbe.dewww.lesejury.de
Für Sam Wood und Dylan Reynolds – Fahrradfahrer, Gentlemenund seit dem Hannibal Trail 2016 gute Freunde
Am besten wäre, wenn die Griechen niemals untereinander Krieg führten, sondern immer mit einem Herzen und einer Stimme sprechen könnten, barbarische Invasoren gemeinsam zurückschlügen und sich zum Erhalt ihrer selbst und ihrer Städte einigten. Wenn solch ein Bund unerreichbar wäre, riete ich euch angesichts der Gewaltigkeit des Krieges im Westen, Vorkehrungen um eurer Sicherheit willen zu treffen. Fest steht: Gleich ob Rom oder Karthago jenen Krieg gewinnt, der Sieger wird sich nicht mit Italien und Sizilien begnügen. Er wird mit Sicherheit hierherkommen und seinen Ehrgeiz über die Grenzen dessen, was rechtens ist, hinaus ausweiten. Daher beschwöre ich euch alle, euch vor dieser Gefahr zu schützen, und richte mein Wort besonders an König Philipp.
Agelaos von Ätolien, Konferenz von Naupaktos, 217 v. Chr.
PROLOG
Vor der Südküste ItaliensFrühsommer 215 v. Chr.
Der Abend war wunderschön, lau und windstill, das Meer glich einem Blech aus gehämmerter Bronze. Von kreischenden Möwen verfolgt, befanden sich ein Dutzend kleiner Fischerboote auf dem Heimweg. Licht blitzte an den Helmen der Soldaten auf der Küstenstraße. Im Westen hoben sich die Berge Bruttiums als dunkle Schatten vor der langsam sinkenden goldenen Scheibe der Sonne ab. Nach Nordosten, im Hitzeflimmern verborgen, lag die große Stadt Tarentum. Weit draußen auf dem Wasser überquerte ein Geschwader römischer Triremen die große quadratische Bucht, die tief in Italiens Südküste einschneidet.
Die Schiffe fuhren in zwei Fünferlinien, und die Trireme in der Mitte der vorderen war das Flaggschiff des Admirals Publius Valerius Flaccus. Er hatte es nicht eilig – die dreitätige Patrouille nach Locri und zurück war ereignislos verlaufen –, und bei Sonnenuntergang erreichten sie ihren Heimathafen Tarentum. Flaccus hatte sich entschieden, dass sein Bericht und andere Pflichten bis zum nächsten Morgen warten konnten. An Land würde er ein Bad nehmen und die Kleidung wechseln, und danach freute er sich auf einen Abend in Gesellschaft seiner Geliebten, der Witwe eines Adligen, der bei Cannae gefallen war.
Flaccus war ein untersetzter, entschlossener Mensch. Die fleischigen Wangen und das zurückweichende Haar nahmen ihm nichts von seiner gebieterischen Erscheinung, die durch ein strahlend blaues Augenpaar betont wurde. Diese Augen, da war er sicher, hatten zusammen mit seinem hohen Rang und seinem städtischen Auftreten den Ausschlag gegeben, warum die Witwe seinen Annäherungsversuchen erlag. Tarentum war kein Provinznest, aber wer aus Rom kam, trat kultivierter auf, und Flaccus wusste seine unsichtbare Überlegenheit bis aufs Letzte auszuspielen. Bei seiner damals noch zukünftigen Geliebten hatte sie gleich bei ihrem ersten Zusammentreffen Wirkung gezeigt, auf dem Fest, mit dem er in Tarentum empfangen worden war. Seine Lippen zuckten. Das Fest lag gar nicht lange zurück, und er hatte sie noch in derselben Nacht ins Bett bekommen.
Sie war gerade so üppig, wie es ihm gefiel, und hatte weiche, parfümierte Haut und bemerkenswert kecke Brüste. Ihr Geschmack im Schlafgemach war vielfältig und unersättlich, eine ewige Quelle von Überraschung und Wonne.
Flaccus zügelte seine Fantasie.
Wie seine Offiziere trug er auf See nur eine kurze Tunika und nicht die umständliche Toga seines Ranges.
Er stand neben dem Steuermann und hatte Sicht auf die ganze Länge des Schiffes. Ein zentraler Steg verband den Bug mit dem Heck, und zu beiden Seiten saßen die Ruderer in drei Ebenen auf ihren Bänken und bewegten Körper und ausgestreckte Arme in beständigem Rhythmus vor und zurück. Vorn spielte der Taktgeber auf seiner Flöte, seine Melodie bestimmte den Schlag. Die Schlagmänner, fünfundzwanzig Schritte voneinander getrennt auf dem Steg, knallten ihre eisenbeschlagenen Stäbe im Takt des Flötenspiels auf die Planken. Im Moment war der Schlag gemächlich, und die Schiffe fuhren in gleichbleibendem Tempo, das die Ruderer stundenlang beibehalten konnten.
Flaccus gefiel der Gedanke, dass auf sein Wort das ganze Geschwader auf Rammgeschwindigkeit beschleunigen würde. Er hatte zur Übung den Befehl schon erteilt, und bei den Göttern, es ging ihm jedes Mal ins Blut. Wenn er zu einer feindlichen Flotte aufschloss, würde es sich anders anfühlen, erregend und erschreckend zugleich. Wie erschreckend, konnte Flaccus nicht sagen, aber schon bei der Vorstellung, wie sich die gezackte Bronzeschnauze eines Rammsporns durch den Rumpf seines Schiffes bohrte, verkrampfte sich sein Magen. Ins nasse Grab zu sinken, so wollte er sein Leben nicht beschließen – er wollte auch nicht vom Sog eines vorüberfahrenden Schiffes in die Tiefe gerissen oder im Meer schwimmend vom Feind aufgespießt werden. Mehr sagte ihm schon der Gedanke zu, ein karthagisches Schiff auf den Meeresgrund zu schicken. Genauso wie die Vorstellung, an der Seite einer feindlichen Trireme vorbeizufahren, ihr die Riemen abzuscheren und das Schiff manövrierunfähig zu machen, damit man es entern konnte, wenn man es wollte.
»Segel voraus!«
Der unerwartete Ruf des Ausgucks zog aller Aufmerksamkeit an sich, nicht zuletzt die von Flaccus. Fischerboote, zahlreich und ungefährlich, wie sie waren, wurden nicht gemeldet. Handelsschiffe schon, doch da der Abend nahte, lagen die meisten dickbäuchigen Kauffahrer längst im Hafen oder ankerten dicht an der Küste.
»Noch ein Segel!«, rief der Ausguck. »Drei, vier – ich sehe fünf, direkt voraus!«
Flaccus eilte zum Bug. Der Schiffskommandant folgte ihm auf dem Fuße. Ein Schlagmann glotzte zu ihm hin, und Flaccus fuhr ihn an: »Halt den Rhythmus, bis man dir etwas anderes sagt, Narr!«
Er schob sich an dem Kerl vorbei. Die Rufe der Ausgucke auf seinen anderen Schiffen vergrößerten sein Unbehagen.
Ihm kam es zweifelhaft vor, dass die fünf Schiffe karthagisch waren. Seit Roms großen Seesiegen während des letzten Krieges wichen die Guggas Begegnungen mit römischen Flotten aus, wann immer es möglich war. Die andere Möglichkeit – Kriegsschiffe der Makedonier – erschien genauso unwahrscheinlich. Gewiss, König Philipp hatte vor zwei Jahren die Insel Kephallenia angegriffen, und es gab Gerüchte über seine Pläne in Illyrien, aber er besäße niemals die Frechheit, Schiffe in italische Gewässer zu entsenden.
Flaccus schob den Gedanken beiseite.
Er erreichte den Ausguck, einen mageren jungen Burschen mit windzerzausten Haaren. »Wo?«
Der Ausguck salutierte nervös und wies ein paar Grad nach Steuerbord. »Dort, Admiral. Ungefähr zwei Meilen entfernt.«
Flaccus beschirmte die Augen mit der Hand. In der Ferne zeichneten sich drei weiße Quadrate gegen das dunkle Meer ab – Segel. Sein Herz schlug rascher. Er wartete, und im nächsten Moment entdeckte er zwei weitere. Die Schiffe liefen nach Südost zu der Landzunge, die Italiens Ferse bildete, und er war sich darüber im Klaren, dass jede Hoffnung auf erfolgreiche Verfolgung dahin wäre, sobald sie sie umfahren hatten.
»Sollen wir die Verfolgung aufnehmen, Admiral?« Der Schiffskommandant, ein krummbeiniger alter Seebär, den Flaccus mittlerweile gern mochte, hatte sich neben ihn gestellt.
»Ja. Römer sind es nicht, so viel steht fest. Es wäre gut, herauszufinden, was sie in diesen Gewässern suchen.«
»Wir haben die Sonne im Rücken, Admiral. Sie werden uns nicht kommen sehen, bevor wir dicht an ihnen dran sind.« Das Grinsen des Kommandanten offenbarte ein halbes Dutzend zapfenförmige braune Stümpfe. »Die Würfel könnten zu unseren Gunsten fallen.«
Flaccus nickte. »Einverstanden.«
Der Kommandant winkte dem Flötenspieler zu. »Schnelle Fahrt!«
Eine raschere Melodie begann, und die Schlagmänner nahmen den neuen Rhythmus auf. Die Ruderer beugten die Rücken und pullten, und nach zehn Herzschlägen hatte sich die Geschwindigkeit der Trireme verdoppelt. Der Rammsporn schnitt in die Wellen, als wittere er die neue Beute.
Die Jagd hatte begonnen.
Am Ende wurde es knapp. Flaccus’ Geschwader hatte sich auf eine Dreiviertelmeile genähert, bevor die anderen Schiffe es bemerkten. Was sie in jenem Moment verriet, blieb unklar – die Sonne stand so tief, dass jeder, der nach Westen schaute, geblendet werden musste. Trotzdem erhöhten die fünf Schiffe das Tempo, bis sie genauso schnell fuhren wie die römischen Triremen.
Die Landzunge war nahe, und dahinter lockte das offene Meer. Flaccus setzte alles auf eine Karte.
»Rammgeschwindigkeit!«, bellte Flaccus.
Für seine Ruderer bedeutete es eine herkulische Arbeit, bei solchem Abstand eine Verfolgung aufrechtzuerhalten, aber es gab nichts zu verlieren. Im schlimmsten Fall entkamen die fremden Schiffe, sagte sich Flaccus, und seinen Besatzungen stand eine lange Rückfahrt nach Tarentum unter dem Sternenhimmel bevor. Im besten Fall brachten sie das Wild auf, und er fand heraus, wieso es geflohen war wie ein erschrockenes Reh.
Die Jagd mit halsbrecherischer Geschwindigkeit dauerte nicht lange. Zwei verfolgte Schiffe entkamen, aber die Besatzungen an Bord der übrigen drei waren Flaccus’ Ruderern nicht gewachsen. Als ihnen die Not ihrer Kameraden auffiel, brachen auch die vordersten beiden Schiffe ihre Flucht ab. Obwohl es sich um schwerfällige Fahrzeuge handelte und sie gegenüber seinen Triremen in der Minderzahl waren, ging Flaccus kein Risiko ein. Er sandte vier Schiffe aus, um die vordersten beiden aufzubringen, und mit den fünf verbliebenen und seinem eigenen kesselte er die langsameren Frachter ein.
Auf Zuruf hin zogen die Kauffahrer die Riemen ein. Auf ihren Decks war kein Bewaffneter zu sehen, und Flaccus’ anfängliches Unbehagen wich selbstgefälliger Gelassenheit. Sein Plan war gut ausgeführt worden. Widerstand erschien unwahrscheinlich. Er hatte Zeit, die Absicht der Schiffe herauszufinden und sie entsprechend zu behandeln, sei es, indem er die Schiffer mit einer Geldstrafe belegte, sei es mit der Beschlagnahme ihrer Fahrzeuge. In jedem Fall konnte er Tarentum vor Mondaufgang erreichen. So war sein Abend mit seiner Geliebten nicht bedroht.
Zunehmend ungeduldig sah Flaccus zu, wie die Ruderer sein Schiff längsseits zum größten Handelsschiff brachten, einem rundbäuchigen Fahrzeug mit einem quadratischen Leinwandsegel. Die Backbordriemen ratterten und tropften, als sie eingezogen wurden. Die Schiffe glitten einander vorbei, Holz scharrte über Holz, Enterhaken schlugen dumpf aufs Deck und wurden festgezurrt. Die Seeleute an Bord des gekaperten Schiffs schlurften umher, die Gesichter starr vor Furcht. Nah am Mast stand eine kleine Gruppe vornehm gekleideter nervös wirkender Männer, die leise miteinander redeten.
»Schickt ein Enterkommando hinüber«, ordnete Flaccus an. »Findet heraus, wer den Befehl hat, und bringt ihn zu mir.«
Die Planke fiel mit einem Knall, und zwanzig Seesoldaten, von einem Optio geführt, überquerten sie mit lauten Schritten.
Vier kehrten bald mit einer stämmigen Gestalt zurück.
»Er sagt, er ist der Gebieter, Admiral«, erklärte der Optio. Ein nicht allzu freundlicher Stoß trieb den Gefangenen näher zu Flaccus. Er war mittleren Alters, trug einen gepflegten Bart und hatte kluge Augen. Ein besticktes Himation, goldene Ringe an den Fingern und seine selbstsichere Haltung ließen auf einen vermögenden Mann schließen. Er verbeugte sich vor Flaccus.
»Xenophanes von Athen, zu deinen Diensten, Herr.« Sein Latein sprach er mit Akzent, aber es war gut. »Darf ich deinen Namen erfahren?«
»Publius Valerius Flaccus, Admiral.« Er suchte in Xenophanes’ Gesicht nach Anzeichen von Verschlagenheit, aber er fand nichts. Doch das hatte nichts zu bedeuten. In Kriegszeiten, dachte Flaccus, darf man niemandem trauen, es sei denn jemandem, der sich des Vertrauens als würdig erwiesen hat. Ein guter Anfang war das Verhalten des Atheners nicht gewesen. »Du bist vor meinen Schiffen geflohen. Wieso?«
Xenophanes’ Finger zitterten. »Meine Entschuldigung, Admiral. Wir haben euch für Piraten gehalten. Wie ihr aus dem Westen kamt, die Sonne im Rücken – es schien, dass wir überfallen werden sollten. Unsere Fahrzeuge sind leicht bewaffnet, aber keine Kriegsschiffe. Flucht war meine einzige Möglichkeit.« Ein nervöses Lächeln. »Nicht, dass wir weit gekommen wären. Deinen Ruderern gebührt Lob.«
Flaccus ging über das Kompliment hinweg. »Was hast du in diesen Gewässern zu tun?«
Xenophanes zog ein Gesicht, als wolle er Flaccus ins Vertrauen ziehen. Er beugte sich näher, aber der argwöhnische Optio packte ihn an der Schulter.
Xenophanes hob die Hände. »Ich will dem Admiral nichts Böses.«
»Dann halte Abstand, Wilder«, knurrte der Optio.
Zorn zuckte durch Xenophanes’ Gesicht, aber er bedachte Flaccus mit einem verschwörerischen Lächeln. »Ich möchte mit dir im Vertrauen sprechen, ohne dass andere Ohren zuhören.«
»Sag, was du zu sagen hast.« Welches Spiel Xenophanes auch zu treiben versuchte, Flaccus war seiner bereits müde. In Tarentum erwartete ihn seine Geliebte.
Mit einem finsteren Blick auf den Optio brummte Xenophanes: »Ich bin Gesandter Philipps von Makedonien.« Als er Flaccus’ Erstaunen sah, fügte er rasch hinzu: »Dem König dünkte, dass es mir als Neutralem leichterfallen könnte, um ein Treffen mit euren Konsuln und dem Senat zu ersuchen. Meine Absicht war es, einen Freundschaftspakt mit Rom und seinem Volk zu schließen.«
Damit hatte Flaccus nicht gerechnet. »Das ist ein merkwürdiges Ansinnen. Philipp hat sich der Republik in den vergangenen Jahren feindlich entgegengestellt.«
»Ein Missverständnis, nichts weiter.« Xenophanes klang schroff.
Wie soll man die Invasion auf Kephallenia missverstehen, fragte sich Flaccus. »Ich habe nichts davon gehört, dass eine Gesandtschaft der Makedonier nach Rom unterwegs sein sollte.«
»Du hast nichts von meiner Aufgabe gehört, Admiral, weil wir uns außerstande sahen, Rom zu erreichen. Wir landeten am Junotempel in der Nähe von Kroton und reisten über Land auf Capua zu. Als wir römischen Truppen begegneten, lernten wir den Prätor Laevinus kennen. Er war ein großzügiger Gastgeber und stellte uns eine Eskorte, die uns auf den sichersten Wegen geleiten und vor Hannibals Heer schützen sollte.«
Flaccus verbarg seine Überraschung. Laevinus war in der Tat ein Prätor und operierte in Campania. Es schien zweifelhaft, ob Xenophanes von dem Mann gehört haben könnte, wenn er ihm nie begegnet war, aber das erklärte nicht, wieso er, Flaccus, von der makedonischen Gesandtschaft und seiner Mission nichts wusste. Neuigkeiten eines möglichen Bündnisses mit Philipp V. hätten sich – nach dem Verhängnis bei Cannae im vorhergehenden Jahr – rasch herumgesprochen. Und dennoch lag das, was Xenophanes berichtete, nicht vollständig außerhalb des Möglichen.
»Du bist also von den Karthagern angegriffen worden, nehme ich an. Ist deine Reise nach Rom deshalb gescheitert?«
Xenophanes wirkte angespannt. »Richtig. Numidische Reiter sind so tödlich, wie man es ihnen nachsagt. Mehrere unserer Begleiter fanden den Tod, und ihr Befehlshaber erachtete die Fortsetzung der Reise als zu unsicher. Bei unserer Rückkehr in Laevinus’ Feldlager flehte ich um mehr Hilfe, aber er wies mich ab. Er brauche alle seine Männer, um gegen den Feind zu kämpfen, sagte er. Ohne militärischen Schutz hatten wir keine Aussicht, Rom zu erreichen. Ich sah mich gezwungen, unsere Mission abzubrechen. Wir waren auf der Rückfahrt nach Makedonien.«
»Hast du Beweise für Philipps Absichten?«
»Natürlich. Die Dokumente liegen in einer Truhe in meiner Kabine. Gib den Befehl, und ich lasse sie zu dir an Bord bringen.«
Flaccus massierte sich das Kinn. Die bisherige Feindseligkeit zwischen Rom und Makedonien würde Philipp nicht davon abhalten, ein Bündnis anzustreben. In der Erkenntnis, dass die rasch heranziehende Nacht seine Rückkehr nach Tarentum – und in die willigen Arme seiner Gespielin – beträchtlich verzögern würde, traf Flaccus eine Entscheidung. Wenn Xenophanes’ Papiere echt erschienen und eine Durchsuchung seines Schiffes nichts Gegenteiliges ans Licht brachte, gab es wenig Grund, den Athener weiterhin festzuhalten.
»Lass mich einen Blick darauf werfen.«
Xenophanes nickte zufrieden. Er legte eine Hand an den Mund und rief dem ihm am nächsten stehenden seiner Seeleute einen Befehl zu.
Flaccus’ gute Laune kehrte zurück. »Wein?«, fragte er.
»Es wäre mir eine Ehre, Admiral.« Xenophanes verbeugte sich ein gutes Stück tiefer als zuvor.
Sie hatten einander zugeprostet und getrunken, als die Dokumente an Bord gebracht wurden. Flaccus warf einen kritischen Blick auf die beiden Pergamente, eines auf Latein, das andere auf Griechisch. Der Wortlaut des Ersteren schien Xenophanes’ Schilderung zu stützen, und er nahm an, dass das griechische ihm entsprach. Mit einem makedonischen Siegel versehen und mit dem kühnen Namenszug Philipps unterzeichnet, wirkten beide authentisch. Als Flaccus seine Entscheidung bestätigt sah, winkte er nach mehr Wein. Lächelnd ließ Xenophanes sich nachschenken.
»Wollen wir hoffen, dass deinem nächsten Versuch, Rom zu erreichen, Erfolg beschieden ist«, sagte Flaccus und grüßte Xenophanes mit seinem Kelch. »Auf die lang anhaltende Freundschaft zwischen der Republik und Makedonien.«
»Mögen die Götter sie uns schenken.« Xenophanes erwiderte die Geste. Flaccus trank seinen Kelch leer und blickte den Optio an. »Bring den Herrn wieder auf sein Schiff. Vergewissere dich, dass das Enterkommando nichts Wichtiges gefunden hat, und hol die Männer zurück.«
»Meinen Dank für deine Gastfreundschaft«, sagte Xenophanes.
»Neptun wache über deine Schiffe«, sagte Flaccus.
»Möge Poseidon dir das Gleiche erweisen.«
»Bereit zur Weiterfahrt«, befahl Flaccus dem Schiffskommandanten.
Xenophanes hatte gerade den Fuß auf die Planke zwischen den Schiffen gelegt, als ein Tumult auf seiner Trireme ausbrach. Erhobene Stimmen schallten aus dem Unterdeck herauf. Zwei Seesoldaten stiegen nach oben.
»Wir haben etwas gefunden, Optio!«, riefen sie ihrem Vorgesetzten zu.
»Eher jemanden«, ergänzte der größere Mann.
Flaccus war binnen eines Herzschlags an der Reling. »Was habt ihr?«
»Wir haben drei Männer ganz unten im Laderaum entdeckt, Admiral«, sagte der größere Seesoldat. »Gleich hinter einer Ladung von gestapelten Amphoren hockten sie. Wenn einer nicht geniest hätte, hätten wir sie nie gefunden.«
Flaccus’ Blick schoss zu Xenophanes. Der Grieche hatte die Planke halb überquert, und sein Schritt war sichtlich schneller geworden.
»Halt, Xenophanes!«, bellte Flaccus. »Hol ihn zurück aufs Schiff, Optio!« Er wandte sich den Seesoldaten zu. »Bringt sie herauf. Beeilt euch!«
Es dauerte nicht lange, und drei dunkelhäutige Männer standen blinzelnd vor Flaccus auf dem Deck. Mit einem Ausdruck grimmiger Genugtuung stieß der Optio Xenophanes zu ihnen.
Der Athener tat, als sehe er die Neuankömmlinge nicht, und Flaccus’ Verdacht wurde umso stärker. Mit ihrem dunklen Teint, den geölten Ringellocken und langen Gewändern ähnelten sie den Karthagern, denen er begegnet war. »Nun, Xenophanes?«
Sie starrten einander schweigend an.
»Sie sind zahlende Passagiere«, räumte Xenophanes ein. Farbflecken waren auf seine Wangen getreten. »Ich wusste, dass es nicht gut aussehen würde, welche von ihrer Art an Bord zu haben, wenn wir von römischen Schiffen aufgebracht werden.«
»Welche Art wäre das denn?«, fragte Flaccus höhnisch.
Schweigen.
»Nun?«
»Karthager.«
Als Xenophanes es zugab, begriff Flaccus, was gespielt wurde. »Durchsucht die Guggas.«
Binnen zwanzig Herzschlägen hielt er einen anderen Satz von Dokumenten in der Hand, die unter der Tunika des ranghöchsten Karthagers entdeckt worden waren, eines Mannes mit stolzem, falkenhaftem Gesicht. Der Gesandte verlor seine Haltung rasch unter dem Hagel von Schlägen, die der Optio und seine Seesoldaten auf ihn niederprasseln ließen. Xenophanes kreischte wie ein gezüchtigtes Kind, als auch er geprügelt wurde. Flaccus, der mit seinem Nicken die Hiebe ausgelöst hatte, schenkte ihm keine Beachtung. Die Spitze seiner Zunge sah zwischen seinen Lippen hervor, während er sorgfältig das griechische Dokument las. Stärker entsetzt, als er es für möglich gehalten hatte, las er den Brief noch dreimal, bevor er seine volle Bedeutung erfasste.
Flaccus suchte den Blick des Schiffskommandanten. »Ändere den Kurs. Wir fahren nach Rom.«
Der alte Seebär riss die Augen auf. »Nach Rom, Admiral?«
»Du hast mich gehört. Benachrichtige die anderen Schiffe. Drei werden uns begleiten. Die anderen bringen die Handelsschiffe nach Tarentum.«
»Jawohl, Admiral.« Der Kommandant brüllte den Rudermeister an, der eine Reihe von Befehlen herunterrasselte. Augenblicklich hoben die Ruderer auf der einen Schiffsseite die Riemen aus dem Wasser, während die auf der anderen Seite tief eintauchten und das Schiff drehten, bis der Bug nach Westen zeigte.
Flaccus sah ungeduldig zu. Am liebsten hätte er Rammgeschwindigkeit befohlen, aber es hatte keinen Sinn, die Ruderer auszulaugen. Trotz aller Dringlichkeit lag die Hauptstadt wenigstens zwei Reisetage entfernt.
»Wir fahren nach Rom, Admiral?« Der Optio war an seine Seite getreten.
»Ja.«
»Darf ich fragen, wieso, Admiral?«
Der Optio konnte auf dem Schiff mit niemandem von Bedeutung reden, und Flaccus nahm an, dass sich die Neuigkeit innerhalb ganz Italiens herumgesprochen hätte, ehe der Monat zu Ende ging. »Du wirst für dich behalten, was du hörst.«
»Bei meinem Leben, Admiral«, sagte der Optio.
»Philipp strebt ein Bündnis mit Hannibal an.«
Der Optio sah fassungslos drein.
»Hier ist der Beweis!« Flaccus hielt ihm den Brief hin.
Im Licht der sinkenden Sonne nahm die Schrift auf dem Pergament einen blutroten Farbton an.
Ein schlechteres Omen hätte Flaccus sich nicht vorstellen können.
TEIL I
1. KAPITEL
Dreizehn Jahre später …In der Nähe der Stadt Chalkedon, am Ufer der PropontisSpätsommer 202 v. Chr.
Demetrios verbarg sich nur ungern zwischen den Bäumen, aber bei den Zelten wäre er zu leicht entdeckt worden. Als Dieb lebte man gefährlich. Ein paarmal war er schon ertappt und übel verprügelt worden. Seitdem sah er sich das Gelände genau an, bevor er seine Haut riskierte. Zwischen den Immergrünsträuchern und Korkeichen am Rand von König Philipps Lager konnte er den richtigen Moment abwarten. Die einzigen Menschen, die vorbeikamen, waren Soldaten auf der Suche nach einem stillen Plätzchen, an dem sie sich erleichtern konnten, und Männer, die ihre Gedärme im Sinn hatten, achteten kaum auf einen jungen Burschen in einem zerlumpten Chiton. Sie würden ihn für einen Gelegenheitsarbeiter halten, die zu Hunderten der makedonischen Flotte an der Propontis entlang folgten.
Demetrios war kein Aasgeier, der sich nahm, was die plündernden Soldaten übrig ließen, sondern Ruderer auf einem von Philipps Schiffen. Nicht auf einer glorreichen Triere mit schimmerndem Schiffsschnabel und gemustertem Segel oder auf einem flinken Lembos, sondern auf einem dickbäuchigen, tief im Wasser liegenden Frachtschiff. Ausgesucht hatte er sich den Beruf nicht, bei den Göttern. Seit frühester Jugend hatte Demetrios ein Soldat werden wollen, der in der mächtigen Phalanx kämpfte. Jetzt erschien ihm dieses Ziel schwerer zu erreichen als der Gipfel des Olymps im tiefsten Winter. Es wäre vielleicht dazu gekommen, wenn sich die Götter sich nicht gegen ihn verschworen hätten.
Sein Vater war ein armer Schäfer gewesen, aber stolz hatte er in jungen Jahren als Schleuderer gedient. Er hatte Demetrios die Jagd beigebracht und ihn zu den Söhnen der reicheren Bauern geschickt, damit er Pankration, Ringen und Faustkampf, erlernte. Schlank und drahtig, aber stark von der harten Arbeit, hatte Demetrios rasch gelernt, was auch gut so war, denn die reicheren Jungen hatten sich bei jeder Gelegenheit über ihn lustig gemacht. Trotzig hatte er ausgeharrt und immer an die Worte seines Vaters gedacht: Wenn Demetrios erst älter wäre und er ihn den richtigen Leuten vorstelle, sei es möglich, ihn zum Phalangiten zu machen.
Wenn Vater nur noch lebte, dachte Demetrios, und die Trauer schnitt ein wie ein Messer. Doch Vater war tot. In einer Herbstnacht vor zwei Jahren hatten ihn Viehdiebe ermordet. Elternlos – Demetrios hatte seine Mutter mit fünf Jahren verloren – und durch den Raub der ganzen Herde mittellos, war von heute auf morgen aus dem Sohn eines Schäfers ein landloser Bettler geworden. Da der Winter nahte, konnten ihn selbst die freundlichsten Nachbarn nicht länger als einige Tage durchfüttern. Bald hatte er sich gezwungen gesehen, nach Pella zu gehen, der Hauptstadt Makedoniens, der nächsten großen Ortschaft. Allein und ohne Freunde war sein Leben auf den Straßen wenig erfreulich gewesen. Überlebt hatte er, indem er auf den Märkten und im Hafen jede Arbeit annahm.
Im gerade vergangenen Frühjahr hatte sich die Nachricht verbreitet, dass der König die Propontis mit Krieg überziehen wollte, und ein plötzlicher Bedarf an Besatzungsmitgliedern auf Handelsschiffen war entstanden. Auf ihrem Feldzug brauchten Philipps Soldaten gewaltige Mengen an Nahrung und Schiffe, die sie heranbrachten. Weil er es leid war, von der Hand in den Mund zu leben, und weil er in der Nähe des Heeres sein wollte, hatte Demetrios bei dem ersten Schiffsherrn angeheuert, der ihn nehmen wollte – und so fand er sich nun am Rand des makedonischen Lagers wieder, Tausende von Stadien von seinem Zuhause entfernt.
Sein Traum, Phalangit zu werden, war noch nicht ganz gestorben, aber sein alltäglicher Überlebenskampf sorgte dafür, dass er kaum daran dachte. Die körperliche Anstrengung des Ruderns war gewaltig, und allzu gern setzten die Schlagmänner Fäuste und Tritte ein. Von Tagesanbruch bis zur Abenddämmerung schufteten die Ruderer unter der brennend heißen Sonne. Wasser wurde regelmäßig verteilt, aber Ruhepausen waren selten. Wenn Demetrios abends sein Mahl heruntergeschlungen hatte, blieb ihm oft nur noch die Kraft, die Decke über sich zu ziehen. Schlafen konnte man nur schlecht, und das war denjenigen seiner Kameraden zu verdanken, die auf der Suche nach Fleischeslust über die Decks strichen. Nachdem er ihnen kurz nach seiner Ankunft an Bord knapp entkommen war, hatte er ein lockeres Bündnis mit zwei anderen jungen Ruderern geschlossen. Seine Freunde waren sie nicht – Demetrios wusste das genau, denn beide hatte ihm schon Essen gestohlen –, aber bei Anbruch der Nacht blieben die drei eng beisammen und hielten abwechselnd Wache. Die Vereinbarung bedeutete, dass er sich ein wenig mehr erholen konnte als früher, aber sein Schlaf blieb unruhig, und immer hielt er die Faust um seinen Dolch geschlossen.
Ein Aufstieg von der Ruderbank erschien unwahrscheinlich. Realistischer war seine Hoffnung, wieder Schäfer werden zu können, aber er würde mindestens ein Jahr brauchen, um die Münzen für ein paar Tiere zusammenzusparen. Demetrios konzentrierte sich daher darauf, einen Tag nach dem anderen zu überstehen und sich so oft wie möglich den Magen zu füllen. Als Achtzehnjähriger, noch im Wachsen, war er immer hungrig. Zumindest an Bord seines Schiffes waren die Rationen für Ruderer von schlechter Qualität und geizig bemessen. Nahrung zu stehlen war darum eine Pflicht, die täglich erledigt werden wollte. Am Morgen hatte es keinen Sinn – Demetrios hatte sich daran gewöhnen müssen, dass ihm beim Aufwachen der Magen knurrte –, aber wenn der Tag zu Ende ging und die Sonne sank, waren Soldaten und Seeleute müde, und es ließ sich leichter Beute machen. Er hatte gelernt, bei denjenigen Zelten zu stehlen, wo die meisten Männer abwesend waren und nur der Soldat zurückblieb, der mit dem Kochen an der Reihe war.
Solch ein Zelt lag keine fünfzig Schritte von seinem Versteck zwischen den Bäumen entfernt. An der Kette eines eisernen Dreibeins schaukelte ein Topf über einem kleinen Feuer. Beim Gedanken an die Suppe, die darin blubberte, lief ihm das Wasser im Mund zusammen. Trotz der Verlockung war das Risiko zu groß. Mit einem Topf voll kochend heißer Flüssigkeit davonzulaufen, konnte nur schlimm enden – es war ein fast unmögliches Unterfangen. Weniger schmackhaft, aber leichter zu stehlen waren die Brotfladen, die rings um das Feuer auf den Steinen gebacken wurden. Zwei oder drei davon würden Demetrios’ Hunger stillen. Vielleicht konnte er ein Brot sogar bei einem Schiffskameraden gegen ein Stück Fleisch oder ein paar Oliven tauschen.
Seine Hoffnung, dass der Soldat von einem Nachbarn abgelenkt wurde, hatte sich bislang nicht erfüllt, aber als der Mann seine Suppe ein letztes Mal umrührte und dann entschlossenen Schrittes auf die Bäume zuging, grinste Demetrios. Ihr Götter, macht, dass er scheißen muss und nicht nur pissen, betete er. Er wartete ab, bis der Mann, ein hart aussehender Peltast, näher gekommen war, bevor er selbst die Baumreihe verließ und betont seinen Chiton ordnete wie jemand, der soeben die Abtrittgrube besucht hat. Demetrios wich dem Blickkontakt aus und nahm eine Richtung, die ihn schräg von der Feuerstelle mit dem begehrten Brot wegführte. Als er fast die Zelte erreicht hatte, verriet ihm ein verstohlener Blick, dass der Peltast im Wäldchen verschwunden war.
Demetrios änderte die Richtung. Zwanzig Schritte, und er stand an dem Dreibein. Der köstliche Duft nach Schweinefleisch und Kräutern regte wieder seinen Speichelfluss an. Er ergriff die Rührkelle und nahm einen großen Mundvoll. Die Suppe schmeckte besser als alles, was er seit Tagen gegessen hatte. Sein Bauch schrie nach mehr, aber die Zeit stand nicht auf seiner Seite. Demetrios schnappte sich drei Brotfladen und dann, unfähig, sich zu zügeln, auch noch ein großes Stück Käse. Nachdem er alles in seinen Chiton, der am Hals weit war, gestopft hatte, hielt sein Gürtel sie an Ort und Stelle. Er sah zu den Bäumen und entdeckte zu seiner Erleichterung keine Spur von dem Peltasten. Wenn dem Mann der Diebstahl auffiel, sagte sich Demetrios, wäre er längst verschwunden.
Er pfiff das Lieblingslied seines Vaters, während er zwischen den Zelten davonschlenderte. Heute Nacht würde er mit vollem Bauch schlafen.
Niemand verfolgte ihn nach seinem gekonnt durchgeführten Diebstahl. Der Erfolg machte Demetrios übermütig. Statt in der relativen Sicherheit seines Schiffes zu essen, beging er den Fehler, ein Stadion vom Feuer des Peltasten entfernt haltzumachen. Nachdem er einen Brotfladen heruntergeschlungen hatte und noch immer hungrig war, entschied er sich als Nächstes für einen Bissen Käse.
»Wen haben wir denn da?«, fragte jemand gedehnt.
Sie mussten gesehen haben, wie er sein Essen unter der Kleidung hervorgeholt hatte. Demetrios entschied sich, dass Frechheit siegte. Schulterzuckend wandte er sich den jungen Schleuderern zu, die zwischen den Zelten links von ihm erschienen waren, und sagte: »Deine Kameraden zu beklauen ist kein Verbrechen. Sie beklauen uns, wir beklauen sie – ihr wisst, wie es ist. Morgen sind sie die Mistkerle, die durchs Lager streifen und schauen, wo sie den Gefallen erwidern können.«
Der junge Mann, der ihn angesprochen hatte, hatte eine breite Brust, und ein Lederriemen hielt seine schwarzen Haare zusammen. Der Schleuderer stieß ein unangenehmes Lachen hervor.
»Nur dass du hier keine Kameraden hast, du Kanalratte. Wir lagern jede Nacht gleich. Mit der Zeit lernt man seine Nachbarn kennen. Dich habe ich noch nie gesehen, also bist du ein Dieb, so einfach ist das.«
Seine Freunde brummten zustimmend.
Demetrios hob den Kopf. »Was geht es dich an?«
Der Schleuderer verzog höhnisch das Gesicht. »Habt ihr ihn gehört? Wenn das kein Geständnis ist, hab ich noch nie eins gehört.«
Demetrios war sich nicht sicher, wieso es den Schleuderer kümmerte, was er gestohlen hatte, wo der Diebstahl doch nicht an seinem eigenen Feuer geschehen war, aber eines stand fest: Sie würden ihn gleich verprügeln. Sein Ankläger hatte vier Gefährten, nicht alle groß, aber sie wirkten ausnahmslos kampferfahren. Sie kreisten ihn mit entschlossenen finsteren Mienen ein.
Schleuderer sind schnellen Fußes, dachte er. Selbst wenn er ihnen davonrannte und sein Schiff erreichte, bestand kaum die Hoffnung, dass seine Kameraden ihm halfen. In der Hackordnung der Ruderbänke stand Demetrios fast ganz unten. Er versuchte es auf andere Weise.
»Wollt ihr ein bisschen Käse? Brot habe ich auch.«
Hohngelächter war die Antwort.
»Das nehmen wir uns, nachdem wir dir die Scheiße aus dem Leib geprügelt haben«, sagte der Anführer.
Demetrios hatte überlegt, sich nicht zu wehren, aber die Überheblichkeit des Wortführers war unerträglich. »Fick dich und deine Mutter!«, rief er und stürzte sich auf den ganz links stehenden Schleuderer. Mit vier Schritten Abstand hatte sein Ziel gerade noch Zeit, ihn anzuglotzen, dann rammte Demetrios ihm die rechte Schulter in den Bauch. Außer Atem fiel der Schleuderer zu Boden. Demetrios fuhr herum und schmetterte dem nächsten Mann die Faust gegen das Kinn. Schmerz durchschoss seine Hand, aber die Knie des Schleuderers knickten ein. Demetrios floh, und in seinen Ohren gellten die wütenden Rufe: »Haltet den Dieb!«
Er rannte zwischen den Zelten hindurch, übersprang Spannleinen und einmal auch eine Feuerstelle. Er konnte seinen Vorsprung halten und fasste schon Hoffnung, die Sicherheit der ankernden Schiffe zu erreichen. Die Schleuderer würden es nicht wagen, ihm dorthin zu folgen – zwar gehörte die Flotte zu Philipps Heer, aber zwischen Seeleuten und Soldaten herrschte tiefe Feindschaft. Und sie wussten nicht, wie gering Demetrios angesehen war.
Den Fuß, der ihn zum Sturz brachte, sah er nicht. Gerade steuerte er die Lücke zwischen zwei Zelten an, da raste der Boden auf sein Gesicht zu. Mit ausgestreckten Händen fing er den Aufprall zum Teil ab, aber trotzdem entwich ihm pfeifend die Luft aus dem Leib. Er rollte herum, wollte sich aufrappeln, aber der Besitzer des Fußes versetzte ihm einen heftigen Tritt in den Bauch, der ihn wieder auf die Erde schickte. Demetrios würgte, und im nächsten Moment erbrach er das Brot, das er verschlungen hatte. Er versuchte, sich auf die Ellbogen hochzustemmen, aber ein Tritt in die Rippen warf ihn erneut zu Boden. Er sog rasselnd Luft ein und fragte sich, was beim Tartaros er jetzt unternehmen sollte.
Füße trommelten. Stimmen näherten sich.
»Ist der das, den ihr jagt?«, fragte jemand.
»Sieht so aus«, antwortete der Schleuderer, der Demetrios beschuldigt hatte.
»Ein Dieb ist er?«
»Ja. Unseren Dank, Kamerad.«
Die von Sandalen umschlossenen Füße des Schleuderers blieben vor Demetrios’ Gesicht stehen. Eine Sandale traf ihn hart.
»Hoch, du Hurensohn.«
Demetrios war der Gnade der Schleuderer ausgeliefert, aber längst nicht bereit, sich in sein Schicksal zu ergeben. Er warf sich nach vorn und versenkte seine Zähne ins Fußgelenk des Schleuderers. Ein Schmerzensschrei, und sein Opfer stolperte zurück. Irgendwie gelangte Demetrios wieder auf die Knie. Ein erschrocken dreinblickender Peltast – das muss der sein, der mir das Bein gestellt hat, dachte er – bewahrte den Schleuderer vor dem Sturz. Hinter den beiden sah er wütende Gesichter: die anderen Schleuderer. Er trat dem Peltasten zwischen die Beine, und als sich der Mann stöhnend zusammenkrümmte, stand Demetrios auf.
Die Übrigen brachten ihn vielleicht um, aber das war ihm egal. Sein ganzer Kummer, seine ganze Wut über den Tod seines Vaters, über das harte Leben, das ihm seither beschieden war, stieg an die Oberfläche. Wenn alles gegangen wäre wie geplant, wäre er jetzt schon ein Phalangit, der es nicht nötig hatte, Nahrung zu stehlen. Stattdessen würde er als einfacher Ruderer unter den Fäusten mordlustiger Schleuderer sterben.
Demetrios stellte sich mit dem Rücken an das Zelt, seinem einzigen Schutz, und ballte die Hände. »Wie viele müsst ihr sein, damit ihr euch traut, einen Mann zu schlagen?«
Die Beleidigung war zu viel. Die Schleuderer und der Peltast stürmten vor. Demetrios landete zwei Faustschläge und einen Kopfstoß, dann ging er unter einem Hagel von Hieben zu Boden. Sterne blitzten vor seinen Augen auf, Wellen aus Schmerz fuhren durch jeden Teil seines Körpers. Er krümmte sich, so gut es ging, zusammen. Wenn er seinen Kopf schützte, überlebte er vielleicht.
Kurz nachdem sie begonnen hatten, ihn zusammenzutreten, verlor er das Bewusstsein.
Wasser klatschte Demetrios ins Gesicht, und prustend kam er zu sich. Er lag auf der Seite und hatte Schmerzen am ganzen Leib. Blutklumpen füllten ihm den Mund. Er tastete mit der Zunge, fand einen losen Zahn und spie ihn unter Schwierigkeiten aus.
»Er lebt.« Die Stimme klang belustigt. »Ein Wunder in Anbetracht dessen, mit wie vielen ihr euch auf ihn gestürzt habt.«
Füße scharrten. Demetrios verstand nicht, wieso niemand antwortete. Kalte Furcht breitete sich in seinem Bauch aus. Ein Offizier hatte die Schlägerei unterbrochen. Erfuhr er die Gründe für den Angriff, wäre Demetrios’ Schicksal aufs Neue besiegelt. Resignation überflutete ihn. Die Moiren waren heute schlecht gestimmt.
»Kannst du dich rühren?«, fragte die Stimme.
Demetrios versuchte es und stellte fest, dass er es konnte. Er wischte rötlichen Sabber von seinen aufgeplatzten Lippen und richtete sich mühsam in eine Sitzhaltung auf. Ein stechender Schmerz in seiner rechten Brust deutete auf angebrochene Rippen hin. Er blinzelte zu dem Mann mit dem schmucklosen Umhang hoch, der gesprochen hatte. Schlank, mit hellen Augen und einem Bart, erinnerte er Demetrios an jemanden.
Er drehte den Kopf und bemerkte die nervösen Mienen der Schleuderer und des Peltasten. Hinter ihnen stand eine ehrfürchtig dreinblickende Menge von Soldaten. Die Erkenntnis traf ihn. Er hatte Gerüchte gehört, Philipp pflege in einfacher Kleidung das Lager zu durchstreifen und mit seinen Soldaten zu reden. Wie es schien, entsprachen die Geschichten der Wahrheit. Demetrios drehte sich der Magen um. Egal, welche Strafe er erhalten hätte, was nun kam, würde schlimmer sein: Der König würde an ihm ein Exempel statuieren.
Er erhob sich auf ein Knie und zuckte vor Schmerzen zusammen. »Mein König.«
»Diese Männer sagen, sie hätten dich ertappt, wie du Brot stahlst.« Mit dem Daumen wies Philipp auf die Schleuderer.
Demetrios zögerte. Die Anklage zu bestreiten würde aussehen, als lüge er, um seine Haut zu retten. Er blickte zu seinen Verfolgern, die offen ihre Schadenfreude zeigten, und ihn packte der Zorn. »So ist das nicht geschehen, mein König.«
Der Wortführer der Schleuderer lachte verächtlich auf.
»Also hast du nichts gestohlen?« Philipps Stimme klang hart und bedrohlich.
»Doch, mein König.« Demetrios zog einen verformten Klumpen Brot aus dem Chiton – beim Kampf war seine Beute zerdrückt worden. »Aber sie haben nicht gesehen, wie ich es nahm. Das hat niemand.«
Durch Philipps Gesicht zuckte etwas, das Belustigung sein mochte. »Wie kamen sie dann dazu, dich anzugreifen?«
»Ich war ausgehungert, mein König, daher blieb ich stehen, um etwas davon zu essen. Die Schleuderer sahen mich, und weil sie mich nicht kannten, nahmen sie an, dass ich das Brot gestohlen hätte.«
»Die Zelte der Schleuderer stehen ein gutes Stück entfernt«, sagte Philipp. »Als du wegliefst, verfolgten sie dich?«
»Ja, aber vorher schlug ich zwei von ihnen nieder, mein König.«
»Wie viele waren es?«
»Fünf, mein König.«
Philipp zog die Brauen hoch. »Fünf. Gegen dich.«
»Jawohl, mein König.«
»Bist du ein Soldat?«
»Ein Ruderer, mein König.«
»Auf einem meiner Kriegsschiffe?«
»Nein, mein König. Auf einem Handelsschiff.«
Der Wortführer der Schleuderer errötete vor Scham. Seine Gefährten wirkten peinlich berührt und wütend zugleich. Philipp andererseits schien beeindruckt zu sein.
»Wie haben sie dich gefangen?«, verlangte er zu erfahren.
»Der Peltast …«, Demetrios wies auf den Mann, »… hörte ihre Rufe, mein König, und stellte mir ein Bein.«
»Niemand mag Diebe«, sagte Philipp. »Und da haben sie dich bewusstlos geprügelt.«
»Jawohl, mein König!«, rief der Anführer der Schleuderer.
»Ich habe dir etwas gegeben, was dich an mich erinnert«, entgegnete Demetrios. »Dein Fußgelenk wird dich noch tagelang schmerzen. Und dem Peltasten habe ich in die Eier getreten.«
Jemand lachte leise auf. Demetrios brauchte einen Augenblick, bis er begriff, dass es der König war. Im Bewusstsein, dass das Lachen ihm einen grausamen Tod ankündigte, senkte er den Kopf.
»Meine Schleuderer gehören zu den besten auf der Welt, dessen rühmen sie sich wenigstens. Habe ich recht?«, fragte Philipp mit erhobener Stimme.
Der Wortführer fand die Stimme wieder. »Jawohl, mein König.«
»Dennoch werden fünf von euch zu dreien durch einen Ruderer. Einen Ruderer! Ihr habt den Bastard nur gefangen, weil jemand anderer sich einmischte. Selbst dann gelang es ihm, noch zwei weitere von euch zu verletzen, bevor ihr ihn überwinden konntet.«
Schweigen.
»Sprich, Narr!« Philipps Ton klang zornig.
»Da hast du recht, mein König«, murmelte der Wortführer der Schleuderer.
»Geht mir aus den Augen«, fuhr Philipp ihn an.
Ungläubig schaute Demetrios zu, wie die Schleuderer davonschlichen. Wenn sie Hunde wären, dachte er, hätten sie die Schwänze zwischen die Hinterbeine geklemmt. Sein Entzücken war nur von kurzer Dauer – der König würde auch ihn bestrafen. Diebstahl war Diebstahl. Demetrios hatte einmal mit angesehen, wie ein Mann für dieses Verbrechen hingerichtet wurde. Zumindest musste er damit rechnen, dass man ihm die rechte Hand abhackte. Panik stieg in ihm auf. Verstümmelt konnte er nicht rudern. Wenn die Flotte weiterzog, würde man ihn zurücklassen, und er würde des Hungertods sterben.
»Du.« Philipp sprach den Peltasten an.
»Mein König.« Der Blick des Mannes war zu Boden gerichtet.
»Du hast getan, was du für richtig hieltest – ich kann dir deswegen nichts vorwerfen. Aber dich von dem Jungen überrumpeln zu lassen …« Philipp schwieg, und der Peltast sah auf, blanke Furcht im Gesicht. Der König lachte. »Betrachte die Schmerzen in deinen Lenden als gerechte Strafe. Du darfst gehen.«
Seinen Dank stammelnd, verschwand der Peltast in sein Zelt.
Demetrios schloss die Augen. Jetzt kommt es, dachte er. Lass mich ein schnelles Ende finden, großer Zeus.
»Steh auf.«
»Mein König.«
Philipp würde ihn im Stehen hinrichten. Demetrios biss die Zähne zusammen und richtete sich unter Schmerzen auf.
»Du bist stolz. Du kämpfst wie ein Soldat.«
Verblüffung ergriff Demetrios. »Ich – mein König.«
»Du hast gestohlen, weil du ausgehungert warst?«
»Jawohl, mein König. Sie geben uns nie genug.«
Philipps Gesicht verdüsterte sich. »Handelsschiffer bekommen ausreichende Mittel, um jedem Mann ihrer Besatzung zweimal am Tag zu essen zu geben. Wie heißt dein Schiff?«
»Stern des Meeres, mein König.«
Philipp nickte ihm zu. »Geh deines Wegs.«
Demetrios riss den Mund auf. »Mein König?«
»Du bist frei.«
»Du tötest mich nicht, mein König?«
Philipp verzog amüsiert den Mund. »Nein.«
Demetrios verbeugte sich so tief vor Philipp, wie er nur konnte. Unfähig, sein Glück zu glauben, ging er die erforderlichen zehn Schritte rückwärts, dann drehte er sich um und hinkte zum Ufer.
Auf halbem Weg zu den Schiffen entwich ihm ein leises Kichern. Unter seinem Chiton hatte er noch immer einen Brotfladen und das Stück Käse.
2. KAPITEL
Das Forum Romanum in Rom
Titus Quinctius Flamininus war noch ein Stück vom Comitium entfernt, der Fläche für politische Versammlungen, als er seinen Liktoren ein Zeichen gab. Sofort begaben sie sich an ein ruhiges Plätzchen neben einem Tempel am Ostrand des Forums. Seiner Begleitung wegen konnte er nicht unsichtbar bleiben, aber auf der großen weiten Fläche des Forums herrschte immerhin solch ein Betrieb, dass er nicht augenblicklich entdeckt wurde. Seine Politikerkollegen sammelten sich vor der Curia, dem Senatshaus, und erwarteten die Ankunft Gesandter aus dem griechischen Ätolien. Wie jeder wusste, kamen sie, um Roms Hilfe gegen den kampfesfreudigen Philipp von Makedonien zu erbitten – einen König, gegen den die Republik vor einigen Jahren ohne Erfolg Krieg geführt hatte.
Flamininus beabsichtigte keineswegs, die wichtige Versammlung zu versäumen, aber bevor er sich der Menge anschloss, wollte er sehen, wer wem ins Ohr flüsterte und wer wen ignorierte. Er hatte Spione in Rom, aber vieles ließ sich auch durch Beobachtung ans Licht bringen. Wissen war Macht und für einen ehrgeizigen Mann wie Flamininus nur mit Gold aufzuwiegen. Die römische Politik wurde von Lagern beherrscht, und das Zünglein an der Waage der Macht pendelte zwischen vielleicht einem halben Dutzend Familien. Allzu beschäftigt, Hannibal von einem Besuch Roms abzuhalten, blieb Publius Cornelius Scipio der Liebling der Republik. Seine Partei war die größte mit einem bedeutenden Vorsprung gegenüber der zweitstärksten. Beide Gruppen erreichten jedoch nicht die Anzahl der Senatorenfamilien, deren Gefolgschaft hin und her schwankte und deren Unterstützung entscheidend war für jeden, der ein Amt anstrebte. Flamininus’ Familie gehörte dazu. In den zurückliegenden Jahren war seine Familie Scipio zugeneigt gewesen, aber das lag diesmal nicht in Flamininus’ Absicht. Für ihn war ein Bündnis wie ein Mantel, den man trug, solange man ihn brauchte, und gegen einen anderen austauschte, wann immer es zweckmäßig erschien.
Heute begleitete ihn sein älterer Bruder Lucius, ein athletischer Mann, dessen Gesicht ihn als nahen Verwandten verriet. Statt bei der Gruppe zu bleiben, war Lucius die Tempelstufen hochgestiegen, um einen besseren Blick auf das Forum zu haben. Flamininus wollte seinen Bruder schon zurückrufen, überlegte es sich aber anders. Lucius würde dort keine Schwierigkeiten machen, und da die Zeit drängte, wollte Flamininus so viel erspähen, wie er konnte.
Er war noch keine dreißig und klein, seine braunen Haare nach Soldatenmanier kurz geschnitten, sein Bart gestutzt. Ein Adonis war er nicht. Seine Augen standen leicht hervor, er hatte eine lange, spitze Nase und fleischige Lippen, aber er glich sein Aussehen mit unerschütterlichem Selbstvertrauen aus. Als er mit vier Jahren versucht hatte, das Pferd seines Vaters zu reiten, war es für ihn dagewesen, und genauso, als er zwei ganze Jahre vor seinem fünfzehnten Geburtstag verlangte, die Toga anlegen zu dürfen. Die Prügel, die er zu beiden Gelegenheiten erhalten hatte, hatten sein Selbstvertrauen nur gestärkt, und das wiederum half ihm dabei, sein Selbstvertrauen für eine Gottesgabe zu halten.
Flamininus’ Vater war der Spross einer an Einfluss verarmten Patrizierfamilie gewesen, verbittert über sein mangelndes Glück im Leben, ein strenger Zuchtmeister, leicht zu verstimmen und schwer zufriedenzustellen. In einer unglücklichen Ehe gefangen, war seine Mutter zu einer zänkischen Frau geworden. Von Kindesbeinen an hatte Flamininus sich danach gesehnt, das Haus seines Vaters zu verlassen. Innerhalb eines Jahres, nachdem er die Toga nahm, war es ihm gelungen, seinen Vater zu bewegen, ihn ins öffentliche Leben einzuführen. Noch jetzt spürte er die Freude, die ihn überkam, als er nach Rom davonritt. Seitdem war er seinem eigenen Weg gefolgt. Zuerst als Gehilfe eines Stadtrichters, dann eines bekannten Advokaten hatte Flamininus erste Erfahrungen darin gesammelt, wie man die Republik verwaltete und regierte. Trotz seiner Jugend bekannt und geschickt darin, sich Verbündete zu suchen, war es unausweichlich gewesen, dass Flamininus vor mehr als fünf Jahren die politische Laufbahn begonnen hatte.
Im Moment war er in Tarentum Quästor mit den Vollmachten eines Prätors. Ernannt hatte man ihn, kurz nachdem die Stadt im Süden Hannibal entrungen worden war; die Quästur war, gelinde gesagt, anspruchsvoll. Gerissen und nicht abgeneigt, sich bestechen zu lassen, hatte Flamininus während seiner Amtszeit diskret ein Vermögen angehäuft. Wenn es weiterging wie bisher, bestand eine gute Möglichkeit, dass ihm in zwei oder drei Jahren die Stellung eines Konsuls winkte. Wenn an diesem Nachmittag alles so ablief wie erhofft, konnte es sogar noch schneller gehen.
Er zügelte seine Aufregung. »Nur ein Narr spannt den Wagen vor das Maultier«, hatte sein alter Tutor zu Recht oft gesagt. Flamininus’ spontanes Vorgehen am heutigen Tag würde wohl kaum die gewünschte Wirkung zeitigen, aber das Risiko war es wert. Bevor das hohe Amt des Konsuls in seine Reichweite kam, brauchte er breite Unterstützung durch die Senatoren, und sie zu gewinnen erforderte Zeit. Alte Bindungen mussten gelockert, vielleicht sogar zerrissen, neue geknüpft werden. Bestechungen mussten gezahlt, Schwächen gefunden, Drohungen verhüllt werden. Gelegentlich mochte sogar brutale Gewalt angebracht sein. Flamininus war nicht so beliebt wie etwa Scipio, aber er war entschlossen und einfallsreich. Außerdem wuchs durch den großzügigen Einsatz seines Vermögens sein Spionagenetz mit jedem Monat weiter an.
»Gutes widerfährt dem Geduldigen«, murmelte Flamininus und ließ den Blick über die in Togen gehüllten Gestalten schweifen, die vor der Curia wimmelten und sich einem Mann zuwandten, dessen mittleres Alter zu Ende ging. Selbst aus der Entfernung war die hagere Erscheinung des Exkonsuls Galba unverkennbar. Wenn Flamininus genau lauschte, hörte er dessen melodische Stimme aus dem Raunen der Menge heraus. Dreißig oder mehr Senatoren hingen an Galbas Lippen, und während Flamininus zusah, traten weitere hinzu.
»Rom hat kein Bedürfnis, sich in griechische Angelegenheiten einzumischen«, sprach Galba seine oft geäußerte Ansicht aus. »Ist Hannibal nicht Feind genug für die Republik? Was nützte ihr ein neuer Krieg gegen Makedonien?«
Galbas Position war wenig überraschend. Die Republik hatte sechzehn Jahre fortgesetzten blutigen Konflikts mit Karthago hinter sich, zehntausende ihrer Söhne verloren und mehrmals erleben müssen, wie die Hälfte ihrer italischen Verbündeten dem unbesiegbaren Hannibal Gefolgschaft schworen. Zum ersten Mal war ein Ende des Krieges in Sicht, was jedermann freute, doch Galba hatte persönliche Gründe, den Konflikt mit Makedonien zu vereiteln. Flamininus’ Spionen zufolge hatte er ein Auge auf einen einträglichen Magistratsposten in Hispania geworfen. Noch mehr als Flamininus’ Quästur in Tarentum brachten Stellungen im Ausland die Gelegenheit mit sich, durch Geschäftsabschlüsse, Abzweigen von Steuern und dergleichen reicher zu werden als im schönsten Traum. Eindeutig konnte Galba nicht gleichzeitig als Prätor in Hispania dienen und einen Krieg gegen Philipp führen, aber wenn er Letzteren verhinderte, entgingen seinen zahlreichen Rivalen Gelegenheiten, in Makedonien Ruhm, Ehre und Reichtum zu erlangen.
Ob Galba es nun wusste oder nicht, Flamininus war einer dieser Rivalen. Bevor er jedoch Roms Legionen in Makedonien befehligen konnte, musste er den Senat überzeugen, Ätolien zu helfen. Danach müsste er die Wahl zum Konsul gewinnen. Beides waren große Hindernisse.
Zeit, dachte Flamininus. Hätte ich nur mehr Zeit.
Die Nachricht von der ätolischen Gesandtschaft hatte ihn vor sechs Tagen erreicht. Zwei Tage hatte er damit vergeuden müssen, seine Untergebenen in Tarentum zu instruieren, den Rest hatte die schwierige Reise die Westküste hinauf gekostet. An diesem Morgen hatte sein Schiff angelegt. Vor kaum einer Stunde war er in Rom eingetroffen. Ihn plagte nun die Sorge, dass er nur geplant hatte, jeden einzelnen Senator in Rom zu umwerben, während Galba und seine Unterstützer hingegen genau dies seit wenigstens einem halben Monat betrieben.
Flamininus machte es Mut, als Galba eine Gruppe von einem Dutzend Senatoren grüßte und der Anführer achtlos an ihm vorbeiging. Zwanzig Schritte von dem früheren Konsul entfernt gesellte sich das Dutzend zu einer größeren Gruppe. Noch ist nicht alles verloren, sagte sich Flamininus. Es wurde Zeit, mit der Partei von Galbas Feinden zu sprechen. Mit ein wenig Glück würden seine Worte auf fruchtbaren Boden fallen. Er verdrehte den Kopf und hielt Ausschau nach Lucius. Sein Bruder stand noch auf der obersten Tempelstufe. Flamininus folgte dem Blick und runzelte die Stirn. Lucius beäugte mehrere halb nackte Jünglinge, die in der Gasse neben dem Tempel miteinander rangen.
»Komm mit, Bruder!«, rief Flamininus.
»Schon gut, schon gut.« Mit einem letzten lustvollen Blick gehorchte Lucius.
»Konntest du nicht noch offensichtlicher sein?«, fragte Flamininus bissig.
»Ich wollte ja bemerkt werden.« Lucius zuckte nonchalant mit den Schultern. »Eine Schande, dass mich niemand gesehen hat. Ich hätte gern ein bisschen gefummelt, während du dich in der Menge herumdrückst.«
Flamininus gelangte ans Ende seiner Geduld. »Wir sind in ernsthafter Absicht hier.«
»Wir? Es geht doch immer nur um dich, kleiner Bruder.« Lucius verzog das Gesicht.
»Du bist doch gern Ädil, oder nicht?«, versetzte Flamininus. Er war es gewesen, der Lucius den Posten verschafft hatte.
Schweigen.
»Nun?«
»Das stimmt.« Lucius klang beleidigt.
»Wenn mein Stern aufsteigt, lieber Bruder, ergeht es dem deinen genauso. Wenn ich Konsul bin, wirst du vielleicht Proprätor sein oder sogar Prätor, und es gibt keinen Grund, weshalb du nach mir nicht ebenfalls Konsul werden könntest. Die Vorteile, die du jetzt genießt, verblassen neben den Möglichkeiten, die dir als Konsul in den Schoß fallen. Verstehst du?«
Lucius’ Schmollen verschwand. »Ja.«
Mehrere Stunden verstrichen, und die Ätolier trafen an der Graecostasis ein, wo griechische Gesandten auf die Einladung, die Curia zu betreten, zu warten pflegten. Drinnen standen die dreihundert Senatoren nach Parteien aufgestellt. Dank seines Ranges hatte Flamininus erstklassige Plätze gleich bei den Senatoren für sich, seinen Bruder und ihre Anhänger sichern können. Die diesjährigen Konsuln, Tiberius Claudius Nero und Marcus Servilius Pulex Geminus, waren beide anwesend, begleitet von ihren Liktoren.
Vielleicht achtzig Senatoren – vor allem Galbas und Scipios politische Feinde – hatten versprochen, wie Flamininus abzustimmen, aber sie reichten nicht aus, damit er den Sieg davontrug. Dennoch war es eine solide Grundlage. Wenn er innerhalb weniger Stunden so viel Unterstützung mobilisieren konnte, lachte ihm eine strahlende Zukunft.
Und noch hatte Flamininus nicht alle Hoffnung aufgegeben. Er war ein fähiger Redner, und die Senatoren waren Männer wie alle anderen. Stachelte man ihre Gefühle ausreichend an, ließen sie sich vielleicht bewegen, Ätolien zu Hilfe zu eilen. Im Senat hatte er so etwas schon geschehen sehen. Der befriedigende Gedanke veranlasste ihn, spöttisch eine Augenbraue vor Galba hochzuziehen, der so tat, als habe er es nicht bemerkt. Verärgert verzog Flamininus das Gesicht. Galbas Lippen zuckten zur Antwort, und Flamininus verwünschte sich innerlich, dass er sich so leicht reizen ließ.
Ulmenholzstäbe schlugen auf den Boden. Köpfe wurden gedreht, das Murmeln erstarb. Es gehörte sich nicht, auf den Streifen aus gefliestem Boden zu treten, der von den Bronzetüren zu den Sesseln der Konsuln lief und den Raum zweiteilte. Stattdessen lehnte sich Flamininus nach außen, nicht weit genug, um eifrig zu erscheinen – obschon er es war –, aber ausreichend, um am Eingang zwei wartende Gestalten zu erblicken.
»Euripidas und Neophron, Gesandte aus Aetolia in Griechenland, sind gekommen, um vor dem Senat zu sprechen!«, rief ein hochrangiger Liktor.
Ein erwartungsvolles Schweigen setzte ein. Leder knallte über den Boden. Flamininus spürte, wie sein Herz klopfte, während die Ätolier näher traten.
Beruhige dich, dachte er. Heute trägst du nicht den Sieg davon. Heute ist nur das erste Scharmützel eines Krieges.
Euripidas und Neophron gingen an ihm vorbei, den Blick auf die beiden Konsuln gerichtet. Die Gesandten waren beide mittleren Alters und in Himatien aus feiner Wolle gekleidet. Euripidas verlieh der graue Bart die Anmutung eines verdienten Staatsmannes, während die Fältchen in Neophrons Augenwinkeln verrieten, dass Humor ihm nicht fremd war.
Der Ernste und der Lustige, dachte Flamininus. Interessant.
Als die Ätolier die Konsuln erreichten, verbeugten sie sich.
»Ich heiße euch willkommen«, sagte Claudius, der ältere Konsul. »Die Republik und Ätolien sind seit Langem Freunde, auch wenn in den letzten Jahren diese alte Freundschaft auf eine ernste Probe gestellt wurde.«
Mehr als ein Senator kicherte, und Flamininus dachte: Da benötigen die Gesandten ihre ganze Selbstbeherrschung.
Als Karthago im langen Krieg gegen Rom die Oberhand errang, war Ätolien seinem Schicksal überlassen worden. Unfähig, allein gegen Philipp zu kämpfen, hatten die geschwächten Ätolier vor drei Jahren um Frieden gebeten. Rom hatte selbst die Situation herbeigeführt, doch die meisten Römer hätten das niemals zugegeben.
Neophron lächelte und tat, als sei ihm die bissige Beleidigung entgangen. »Unsere alte Freundschaft ist es, was uns aus unserer Heimat hierherreisen ließ, Konsul. Ätolien möchte seine Bindung zur Republik erneuern.«
Servilius ließ ihn nicht davonkommen. »Zuletzt hatte ich gehört, Ätolien habe einen Friedensvertrag mit Philipp von Makedonien geschlossen. Was braucht ihr Verbündete in Übersee, wenn ihr doch einen König zum Freund habt?«
Euripidas hustete betreten, doch Neophron lächelte noch breiter. »Der Friedensschluss ist drei Jahre alt, Konsul, und Philipp ist wankelmütig – das hast du vielleicht gehört. In den zurückliegenden Monaten hat er den Vertrag gebrochen, indem er an der Propontis Krieg führt, wo er unter anderem auch ätolische Städte belagert und eingenommen hat. Ihn schert es nicht, dass die Menschen, die er von seinen Soldaten morden und versklaven lässt, freigeborene Griechen sind.«
»Die Griechen fahren einander doch ständig an die Kehle. Stritten sie nicht auch am Vorabend von Marathon und der Schlacht von Salamis?«, fragte Claudius und deutete ein Lächeln an, während die Belustigung durch die Ratskammer zog.
»Du sprichst die Wahrheit, Konsul.« Euripidas nickte wehmütig. »Dennoch ist es selten, dass wir einander versklaven. Philipp geht zu weit. Briefe mit deutlichen Worten wurden nach Pella gesandt, doch es gab keine Antwort. Selbst wenn er sie empfangen hat, scheint es, als träfen unsere Proteste auf taube Ohren. Während ich hier spreche, führt er seine Soldaten gegen eine weitere ätolische Stadt an der Propontis, gegen Kios.«
»Aus diesem Grund entsandte die Volksversammlung uns nach Rom«, fuhr Neophron fort. »Um Rom zu bitten, nein, anzuflehen, uns Hilfe zu gewähren gegen diesen machthungrigen mörderischen Tyrannen. Für Kios mag es schon zu spät sein, aber auch andere Siedlungen sind in Gefahr.«
»Ätolien mag bestürzt sein über den Verlust einer Handvoll unbedeutender Städte in Kleinasien«, erklärte Servilius, »aber die Republik nicht.«
Zustimmende Rufe wurden bei Galbas Anhängern laut.
Neophron beantwortete die sarkastischen Kommentare, indem er eine höfliche Verbeugung andeutete. »So könnte man denken. Aber setzen sich Philipps Erfolge fort, beherrscht er bald die Propontis und damit den Kornhandel von den Ufern des Pontos Euxeinos.«
Claudius winkte ab. »Die Bürger Athens mögen diesen Ausgang beklagen, aber einmal mehr ist es ohne Belang für die Republik.«
»Philipp wird dort nicht haltmachen. Seit er an die Macht gelangte, hat er wenig anderes getan, als Krieg zu führen«, wandte Euripidas ein. »Fällt sein Auge wieder auf Ätolien, was unweigerlich der Fall sein wird, kann unser Heer die Flut für eine kurze Zeit aufhalten, doch er wird siegreich sein. Ätolien wird fallen.«
Claudius’ Gesicht blieb reglos. Servilius zuckte mit den Schultern.
Flamininus sah zu, wie Euripidas sich umblickte und nach einer mitfühlenden Reaktion Ausschau hielt. Ihm gegenüber flüsterte Galba seinem Nachbarn ins Ohr. Seine Anhänger gaben sich, als wären die Ätolier gar nicht zugegen. Rings um Flamininus murmelten allerdings auch einige Senatoren untereinander. Er lauschte.
»Philipp sollte nicht gestattet werden, jeden mit Füßen zu treten, bei dem er es wünscht.«
»Er könnte zum nächsten Hannibal werden.«
»Schlangen zertritt man am besten, bevor sie zu einem ins Bett kriechen.«
Die Stimmen waren jedoch gedämpft. Wenn jemand laut das Wort ergreifen sollte, erkannte Flamininus, müsste er es selbst tun.
»Warum sollte die Republik Ätolien zu Hilfe eilen?«, wollte Claudius wissen. »Das treulose Ätolien war es, das den Bund zwischen unseren Völkern gelöst hat, nicht Rom.«
Schweigen fiel über die Senatskammer. Jeder wusste, dass Roms Rückzug aus dem Konflikt Ätolien gezwungen hatte, in Verhandlungen mit Philipp einzutreten, aber die Schuld offen der Republik zuzuweisen hätte eine tiefe Kränkung bedeutet. Dennoch bedurfte es Neophrons verhaltender Hand, um Euripidas an einer Gegenrede zu hindern. Das Gesicht des graubärtigen Gesandten war dunkel angelaufen, und wütend musterte er Claudius.
Neophron brachte ein besänftigendes Lächeln zustande. »Wir Ätolier können uns nur entschuldigen. Unsere Lage war verzweifelt, aber es war ein Fehler, Frieden mit Philipp schließen zu wollen. Ein zukünftiges Bündnis zwischen unseren Völkern wäre unantastbar – mögen die Götter mich niederstrecken, sollte ich lügen.« Er sah Euripidas an, der mit einem heftigen Nicken seine Zustimmung bekundete.
»Einmal eidbrüchig, immer eidbrüchig. Nicht ein Senator hat bisher zu euren Gunsten gesprochen«, sagte Servilius schroff. Er sah Claudius an, der zustimmend nickte, ehe er mit dem Finger zur Tür schnippte. »Ich wünsche euch eine angenehme Rückreise in euer Heimatland.«
Wieder musste Neophron einen wütenden Euripidas an einer Antwort hindern. Sie verbeugten sich – steifer als zuvor – und wandten sich zum Gehen.
»Die Konsuln führen Rom in Zeiten des Krieges, aber sie treffen nicht jede einzelne Entscheidung.« Flamininus hob die Stimme, damit sie durch die Kammer trug. »Sollte über diese wichtige Frage nicht der Senat abstimmen?«
Die Blicke der Gesandten wandten sich Flamininus zu – zusammen mit denen aller anderen. Dieses Unterfangen mag von Anbeginn zum Untergang verurteilt sein, dachte er, aber es wird Zeit, ein Zeichen zu setzen, den Senatoren zu zeigen, dass sie mit mir zu rechnen haben.
»Quästor Flamininus, richtig?« Galbas Betonung des ersten Wortes machte seine Geringschätzung der Magistrate im untersten Rang deutlich.
Flamininus ignorierte es. »Ich wünsche, über diese Angelegenheit abzustimmen, wie auch gewiss eine Reihe meiner Kollegen.« Er wartete, bis die vielen lauten Ja-Rufe verstummt waren, bevor er fortfuhr. »Offenbar ist dir der vorhergegangene Krieg zwischen der Republik und Philipp entfallen. Er mag ergebnislos verlaufen sein, doch das bedeutet noch lange nicht, dass Philipp ein vernachlässigbarer Gegner ist. Vergiss nicht, dass er sich vor einigen Jahren mit Hannibal verbünden wollte. Meiner Ansicht nach sollten die, die sich ihm entgegenstellen, unterstützt werden, nicht verhöhnt.« Er schenkte den Ätoliern ein freundliches Nicken, das beide erwiderten.
»Niemals soll es heißen, ich stünde der Republik im Weg.« Servilius’ Ton war ungerührt, aber sein Blick – auf Flamininus fixiert – wirkte genauso mörderisch wie der Galbas. Nach einem kurzen Austausch mit Claudius erklärte er: »Lasst uns sehen, was der Senat wünscht. Wer dafür ist, Ätolien Unterstützung anzubieten, hebe die rechte Hand.«
Flamininus reckte den Arm in die Höhe, und seine Anhänger taten es ihm gleich. Einige Senatoren auf der anderen Seite bekundeten ihre Unterstützung ebenfalls, aber es waren nicht viele. Rings um Galba hob nicht ein Mann die Hand.
Flamininus begegnete zum ersten Mal dem Blick seines Rivalen. Nun war es an Galba, eine Braue hochzuziehen. Ist das alles, was du zuwege bringst?