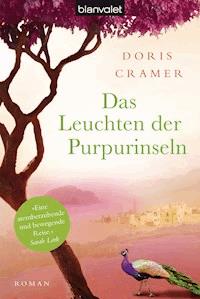
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Marokko-Saga
- Sprache: Deutsch
Abenteuer und Liebe in fernen exotischen Welten
Antwerpen, 1520. Da ihr Vater im Sterben liegt, müssen sich Mirijam und Lucia Van de Meulen auf eine gefahrvolle Reise nach Andalusien begeben, wo sie bei Verwandten ein neues Leben beginnen sollen. Doch auf hoher See geraten sie in Gefangenschaft und werden nach Afrika gebracht. Dort wird Lucia in einem Harem eingesperrt, während Mirijam als Sklavin derart gefoltert wird, dass sie die Sprache einbüßt. Sie überlebt allein dank der Hilfe eines maurischen Heilers. Gemeinsam machen sie sich auf den Weg nach Mogador, der Stadt der Purpurschnecken. Dort lernt Mirijam nicht nur die Kunst des Färbens und des Heilens, sondern auch die Liebe kennen …
- Eine Frau kämpft um ihre Zukunft und ihre Freiheit – und um die Liebe.
- Für die Leserinnen von Sarah Lark, Carla Federico und Patricia Mennen.
- Rot ist die Liebe, Blau ist das Glück, doch Purpur ist die Freiheit!
- Eine exotische Familiensaga vor der Kulisse Nordafrikas.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 803
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Doris Cramer
Das Leuchten
der Purpurinseln
Roman
Buch
Mirijam und ihre schöne Schwester Lucia werden jäh aus ihrer unbeschwerten Kindheit als Töchter eines reichen Antwerpener Kaufmanns herausgerissen: Nicht nur ihr Vater stirbt unerwartet, auf ihrer Reise zu spanischen Verwandten wird ihr Schiff von Korsaren überfallen, und die beiden jungen Mädchen geraten in maurische Gefangenschaft und Sklaverei. Wurden die reichen Erbinnen Opfer eines grausamen Verräters? Es gibt nur einen, der von ihrem Tod profitiert, der aber gehört zur Familie …
Eine farbenprächtige Familiensaga: In die Welt der Berber Marokkos und durch alle Höhen und Tiefen menschlichen Schicksals führt Mirijams atemberaubende Reise vor den grandiosen Panoramen des Mittelmeers und der Sahara.
Autorin
Doris Cramer ist gelernte Buchhändlerin und leitete zuletzt siebenundzwanzig Jahre lang als Bibliothekarin eine Gemeindebibliothek. Sie ist ein Bücherwurm durch und durch. Allein oder zu zweit unternimmt sie seit 1984 regelmäßige und ausgedehnte Reisen in Nordafrika und darüber hinaus, von Marokko bis nach Syrien, davon allein siebzehn Touren im äußersten Süden Marokkos. Landschaft, die Berberkultur und das alltägliche Leben in den Wüstenregionen Südmarokkos haben ihr ein spannendes Gegenkonzept zum Leben im übererschlossenen und-regulierten Deutschland gezeigt. DasLeuchten der Purpurinseln ist der erste Teil einer Marokko-Saga.
Weitere Romane der Autorin sind bereits bei Blanvalet in Planung.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © by Blanvalet Verlag, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück, Garbsen.
Umschlaggestaltung: bürosüd°, München
Redaktion: Andrea Stumpf
ED · Herstellung: sam
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-07537-8V004
www.blanvalet.de
Für meinen lieben Richard.
Und für Dörte und Sabine
und den ganzen geliebten Anhang.
Prolog
MOGADOR 1525
Alî el-Mansour war in die nahtlosen, weißen Tücher eines Mekka-Pilgers gehüllt, aller Körperhaare ledig und barhäuptig. Er saß auf einem Hocker in der Mitte des Raums, umgeben von großen Öllampen. Sie waren allerdings noch nicht entzündet, denn durch das Fenster fielen jetzt, am Spätnachmittag, die Strahlen der untergehenden Sonne in breiten Bahnen und tauchten den Raum in goldenes Licht.
Für gewöhnlich schmückten dieses Zimmer farbige Wandbehänge und dichte Teppiche, die Tische waren unter Stößen von Büchern begraben, und vor Tür und Fenstern hingen gewebte Vorhänge aus Kamelhaar, die Wind und Zugluft abhielten. Heute jedoch war er leer, kahl und weiß, kalkweiß.
»Salâm u aleikum*, meine Tochter«, sagte der Alte. »Friede sei mit dir. Wir müssen reden.«
* Für Erläuterungen zu den einzelnen Fremdwörtern und Redewendungen siehe Glossar am Ende des Romans
»Aleikum as salâm«, antwortete Azîza und ließ ihre Augen umherwandern, »auch mit dir sei Friede.« Sie war beunruhigt. Warum hatte er den Raum ausräumen lassen? Was ging hier vor? Dann aber küsste sie ehrerbietig seine Hände, legte sie an Stirn und Herz und setzte sich vor dem alten Arzt auf den Boden. Geduld und das Gefühl für den richtigen Moment waren wichtige Tugenden, hatte der Hakim ihr beigebracht.
»Jeden Tag danke ich Allah für seine große Güte«, begann der Alte, und sein freundliches Gesicht erstrahlte. »Für die Güte, die er mir erwies, indem er mir dich als Tochter schenkte. Mit Freude unterrichtete und schützte ich dich und sorgte all die Jahre für dein Wohlergehen. Heute jedoch bedarf ich deiner Hilfe.« Mit beiden Händen umfasste er Azîzas Gesicht und küsste sie auf die Stirn. »Ich erbitte von dir eine Hilfe, die nur du allein mir erweisen kannst.« Seine Stimme zitterte.
Dann wandte er sein Gesicht den schrägen Strahlen der Sonne zu und forderte: »Schau in meine Augen. Schau genau hin, damit du mir sagen kannst, was du siehst.«
Azîza tat, wie ihr geheißen, und obwohl sie um die Schwere seiner Augenerkrankung wusste, erkannte sie erst bei der genauen Betrachtung im hellen Sonnenlicht, wie weit seine Erblindung fortgeschritten war. »Oh Abu, Vater!«, stöhnte sie.
»Nur ruhig, du bist eine Heilerin!«, mahnte der alte Hakim. »Was siehst du? Beschreibe es mir genau, so wie ich es dich gelehrt habe.«
Die junge Frau jedoch wandte das Gesicht ab.
»Azîza, ich bitte dich! Sieh hin!«
Und Azîza sah hin. »Dieses Auge…« Sie stockte und wandte erneut den Blick ab. Dann aber zwang sie sich zur Ruhe. Behutsam legte sie ihren Finger unter das linke Auge des Mannes und untersuchte es sorgfältig. »Es sieht aus, als sei es mit Milch gefüllt, mit geronnener Milch«, meinte sie, um Sachlichkeit bemüht. »Das andere ebenfalls. Doch nein, das rechte ist nicht ganz gefüllt, nur ein Teil scheint milchig zu sein.«
»Gut«, nickte der Alte zufrieden. »Nun sag mir, wie nennen wir diese Krankheit, und welche Therapie kennst du bei einem derartigen Befund?«
»Es ist die Cataracta, der Schleier, mein Vater. Und es gibt nur einen Weg, diesen Schleier zu beseitigen und den starren Blick zu verhindern. Das ist die Operation, welche wir ›den Star stechen‹ nennen.«
»Sehr gut! So ist es.« Die nüchterne Art des Hakim half Azîza, ihre Fassung wiederzugewinnen. Dennoch zitterte sie, als er ihre Hand ergriff. »Und nun beantworte mir folgende Frage: Wie oft hast du mir schon bei dieser Operation zugesehen, und wie oft hast du mir dabei geholfen?«
»Oft, Vater, sehr oft sogar.«
Azîza erriet, was kommen würde, und sie versteifte sich. »Nein, verlange das nicht von mir, das kann ich nicht tun!« Sie umklammerte die Knie des Alten. »Ich flehe dich an, bitte mich nicht darum!«, beschwor sie ihn unter Tränen.
Der Vater ließ sie weinen. Seine Hand ruhte leicht auf ihrem Kopf, die Finger streichelten den weichen Flaum am Ansatz ihrer Locken und strichen sanft über ihren verspannten Nacken. Er wartete geduldig.
»Du weißt, wir haben keine Zeit zu verlieren«, sagte er leise, als sie sich endlich gefangen hatte. »Außerdem habe ich die Sterne befragt. Sie stehen zurzeit günstig, und das sollten wir nutzen. Nun ruh dich einen Moment aus, mein Kind, bevor wir mit der Operation beginnen.«
Er entnahm einer Silberschale zwei der von ihm selbst gefertigten Betäubungspillen und schluckte sie hinunter. Wie Alî el-Mansour kannte auch seine Tochter die Zusammensetzung dieser Pillen auswendig, zu der man Tropfen aus Mohnkapseln, Weihrauch und Wolfskraut mit Kräutern aus der Wüste und gemahlener Muskatnuss aufkochen musste. Danach zog alles vierzig Tage in Wein, bevor man die Flüssigkeit in die Sonne stellte, bis sie verflogen und nur noch eine breiige Masse übrig war, aus der man kleine Kugeln drehen konnte. Sie besaßen immer einen ausreichenden Vorrat dieser Arznei, die in getrocknetem Zustand lange wirksam blieb.
Es half ihr, sich die Rezeptur in Erinnerung zu rufen und damit die Gewissheit, dass sie keineswegs unfähig war. Im Gegenteil, im Laufe der Jahre hatte ihr Abu sie gründlich unterrichtet und so viel seines Wissens an sie weitergegeben, dass sie selbst eine gute Heilerin geworden war. Sie verdankte ihm viel, genau genommen alles. Wo wäre sie, wenn er sie nicht auf dem Sklavenmarkt entdeckt und zu sich genommen hätte? Man hätte sie misshandelt, getreten und geschlagen und am Schluss irgendwo im Sand der Wüste verscharrt.
Von draußen ertönten plötzlich Trommelschläge, dumpfe, dunkle, rhythmisch pulsierende Schläge, die Azîza erzittern ließen.
Der Alte nickte zufrieden. »Sîdi Bilals gnaoua-Musiker werden uns begleiten und helfen, die bösen Dschinn zu vertreiben. Alles wird gut, mit Allahs Hilfe.«
Er hatte eine lila bestellt? Für diese Zeremonie also wurden in der Küche Milch und Datteln, die heiligen Speisen, sowie einige Hühnchen vorbereitet. Den schwarzen Musikern, die in der Tradition des verehrten Mystikers Sîdi Bilal ihre Musik zur Heilung von Kranken einsetzten, wurden magische Kräfte nachgesagt. Familien, die sich um eine kranke oder verwirrte Person sorgten, baten sie in ihr Haus, um sich betend in eine heilende Trance zu tanzen. Schon setzte die Laute ein, dann ertönten Kastagnetten und Tamburine.
Der Hakim zog seine Arztkiste zu sich heran. »Bismillah, im Namen Gottes«, murmelte er, als er aus einem weißen Baumwolltuch ein schmales, frisch geschliffenes spitzes Instrument wickelte und in Azîzas Hände legte. »Dieses Messer wurde im Feuer gehärtet und gereinigt, es ist ein gutes Werkzeug. Rufe nun unsere Helfer herein. Und fürchte dich nicht, mein liebes Kind.« Er streichelte ihr über die Finger. »Ich werde dich leiten, du aber wirst meine Hand sein.«
Ruhig gab der alte Heiler den beiden Helfern, die sich ein wenig bang im Raum umsahen, seine Anweisungen. »Halte meinen Kopf gut fest«, trug er dem schwarzen Hünen auf, der gemeinsam mit der Dienerin näher trat. »Die Operation dauert lediglich wenige Minuten. Es wird nicht wehtun, aber ich darf meinen Kopf keinesfalls bewegen.«
Der Diener blickte ängstlich in die Runde. Ihm war keine Arbeit zu schwer, aber was nun von ihm verlangt wurde, beunruhigte ihn. Umständlich wischte er sich die Hände an seiner weiten, hemdartigen gandourah ab, bevor er nickte.
»Stell dich hinter mich, leg deine Hand an meine Stirn, und press meinen Hinterkopf fest an deine Brust. Genau so, das machst du gut. Und du«, fuhr Abu Alî an die Frau gewandt fort, »wirst für das Licht verantwortlich sein, es soll direkt auf die Augen fallen. Entzünde gleich jetzt die Lampen. Von Zeit zu Zeit musst du außerdem Tränen fortwischen. Nimm dazu jenes saubere Tuch dort.« Er hatte alles genau vorbereitet. Nun schwieg er und schaute Azîza an.
Äußerlich hatte die junge Frau ihre Ruhe inzwischen wiedergefunden. Sie holte ein Tischchen herbei und legte reine Tücher und den glänzenden Starstecher bereit. Auf einem zweiten Tisch warteten frische Weidenrinde und schmale Streifen von Kürbisschalen neben dem Verbandmaterial.
Im Garten begann die tabal zu dröhnen, erst langsam, dann immer drängender, bis die große Trommel in einen steten Rhythmus fiel. Die dunklen Schläge vibrierten in Azîzas Körpermitte. Andere, hellere Trommeln setzten ein, Tamburine kamen hinzu und nahmen den Takt auf, ebenso die klatschenden Hände der Menschen im Garten. Die Musik wurde drängender. In die anschwellenden und wieder abflauenden Trommelwirbel mischten sich Flötentöne und Gesänge mit halblaut gemurmelten Beschwörungen und Gebeten. Azîzas Gedanken ordneten sich, ihr Atem wurde ruhig, und die Monotonie der Musik verlangsamte ihren Herzschlag. Sie hob den Kopf. Sie war bereit.
Alî el-Mansour sprach die erste Sure des Korans: »Bismillah, Lob sei Allah, dem Weltenherrn, dem Erbarmer, dem Barmherzigen, dem König am Tag des Gerichts: Dir dienen wir, und zu Dir rufen wir um Hilfe. Leite uns den rechten Pfad, den Pfad derer, denen Du gnädig bist.«
»Ich beginne. Halt ihn gut fest«, sagte die junge Frau zu dem Schwarzen, der den Hinterkopf des Hakim an seine Brust presste.
Mit der linken Hand hielt sie das Auge geöffnet, mit der rechten fasste sie das schlanke Starstichmesser. Sie atmete tief aus und fixierte das Auge. Behutsam senkte sie die Nadel in die getrübte Linse. Sie musste auf den Boden des Augapfels gedrückt und dort eine Weile gehalten werden, um zu verhindern, dass sie wieder aufstieg. Wenn das geschah, wäre alles umsonst gewesen.
Eine blutige Träne quoll aus dem Auge und rann über Abu Alîs Wange. »Mehr Licht auf das Auge!«, befahl Azîza. »Und die Tränen abwischen.«
Vorsichtig tupfte die Dienerin über das Gesicht des Alten.
Dann zog Azîza behutsam die Nadel zurück. Es blieb bei dem einen Blutstropfen, und auch die Linse verharrte an ihrem Platz. Geschafft!
»Baraka Allah u fiq! Gott segne dich.« Alî el-Mansour seufzte erleichtert. »Du hast getan, was ich von dir verlangte. Sei ganz ruhig, alles wird gut.«
»Schließe die Augen, Vater, und leg den Kopf in den Nacken. Ich will dich verbinden.«
Die Tochter tupfte über sein Gesicht, dann legte sie frische Weidenrinde zusammen mit feinen Kürbisschalen über das Auge und wickelte aus reinen, weißen Baumwolltüchern einen Verband.
»Deine Hände haben nicht gezögert«, sagte der Alte, und man hörte den Stolz in seiner Stimme, »sie blieben ruhig. In einigen Wochen, wenn dieses Auge geheilt sein wird, werden wir, so Gott will, das rechte ebenfalls von seinem Schleier befreien, Insha’allah.«
Erst später, als alles längst vorüber war und Abu Alî auf seinem Lager zwischen angewärmten Decken lag und sein gleichmäßiger Atem sie eigentlich hätte beruhigen müssen, begann Azîza zu zittern. Tränen liefen ihr über die Wangen. Sie schlug die Hände vors Gesicht und kauerte sich in den Schatten, wo niemand sie sehen konnte.
In diesem Moment musste sie an die Qualen und den langen, mühevollen Weg denken, den die kleine Mirijam aus Antwerpen hinter sich gebracht hatte, bis Lâlla Azîza dem Vater durch ihre Heilkunst endlich so etwas wie einen Gegendienst erweisen konnte. Dabei war ihr klar, sie würde niemals ihre Dankesschuld abtragen können, nicht einmal dadurch, dass sie ihm das Augenlicht erhielt.
1. TEIL
SCHRECKENSREISE 1520
1
ANTWERPEN
Am Tag vor seinem Tod tat Andrees van de Meulen endlich alles Nötige, um die Zukunft seiner Töchter Lucia und Mirijam zu sichern. Allzu lange hatte er die Augen vor dem Kommenden verschlossen, jetzt eilte es.
»Keine Widerrede, Lucia, es ist mein Wille«, verkündete er mit gewohnter Autorität. »Du reist zu deinem Oheim nach Granada und heiratest seinen jüngsten Sohn Fernando. Das Schiff sticht noch heute Abend in See. Mirijam begleitet dich. Sie wird bei dir bleiben, bis Juan, dein Oheim, auch für sie einen guten Ehemann gefunden hat. Nun packt eure Sachen, danach kommt wieder zu mir, damit ich euch meinen Segen geben kann.« Der Kaufmann winkte den Mädchen, sich zu entfernen.
Lucia lief schluchzend und mit fliegenden Röcken in ihre Kammer, während Mirijam auf den Treppenabsatz sank. Was sie am Bett des Vaters gespürt hatte, ließ sie frösteln. Etwas Fremdes war um den armen kranken Vater gewesen. Außerdem hatte sie die fahle Blässe im Gesicht des Vaters gesehen und die dunklen Schatten um seine Augen, und sie ahnte, was das bedeutete. Offensichtlich wusste auch er selbst, wie es um ihn stand. Aber er durfte nicht sterben und sie verlassen! Tief in ihrem Inneren spürte sie jedoch, niemand konnte sich dem Tod in den Weg stellen, weder Arzt noch Priester. Er würde sterben. Deshalb schickte er sie zu fremden Leuten. Aber ausgerechnet nach Andalusien?
Mirijam lehnte sich an das Geländer. Blicklos starrte sie auf ihre verkrampften Hände. Wenn, dann war jetzt wohl der richtige Zeitpunkt, um zu beten, dachte sie. Muhme Gesa behauptete, bis auf den einen oder anderen Unterschied seien der jüdische und der christliche Gott im Grunde gleich. Sie sagte auch, ein Gebet zur rechten Zeit sei immer nützlich.
Als Kind einer jüdischen Mutter kannte Mirijam keine christlichen Gebete, dennoch faltete sie jetzt die Hände. Sie kniete auf dem Dielenboden, verschränkte die Finger so fest ineinander, dass die Knöchel weiß hervortraten, und flehte inbrünstig: »Allmächtiger Gott, Herr und Gebieter über alle Stämme Abrahams und Israels, Vater des Herrn Jesus, ich bitte dich, mach, dass unser Vater bei uns bleiben kann. Ich flehe dich an, lass uns unseren Vater! Du hast doch bereits unsere Mütter zu dir geholt. Wir können nicht allein in Antwerpen bleiben.« Sie überlegte, bevor sie entschlossen fortfuhr: »Als Dank werde ich mich taufen lassen und in deine Kirche eintreten, sogar gegen Vaters Rat. Das gelobe ich. In Ewigkeit, Amen.« Mehr fiel ihr nicht ein.
Ein Wort aber drängte sich in ihrem Kopf mehr und mehr in den Vordergrund: Allein! Nach Vaters Tod würden sie ganz allein sein, Lucia und sie. Wenn sie doch bloß ein Junge wäre! Dann könnte sie auch ohne Vater hierbleiben. Bei einem der Kaufherren würde sie Vaters Geschäft erlernen und gar nicht lange, dann könnte sie allein… Mirijams Gedanken kamen ins Stocken. Allein nicht, überlegte sie, aber vielleicht mit Hilfe von Advocat Cohn? Der würde doch sicher auch ihr helfen, wie er jetzt dem Vater zur Seite stand?
Im Scherz, in dem auch ein bisschen Ernst steckte, hatten Lucia und sie diese Erbteilung längst beschlossen. Lucia interessierte sich nicht für den Handel, sie hingegen schon. Sie hätte sogar Talent dafür, ein gutes Gespür, hatte der Vater kürzlich erst gesagt, als sie eine fehlerhafte Abrechnung gefunden und berichtigt hatte.
Das Licht fiel durch eine der bunten Fensterscheiben und malte farbige Flecken auf den hellen Boden. Sie konnte kaum den Blick von den verschwimmenden Farben abwenden, während sie mit den Tränen kämpfte. Sie liebte die bunten Fenster hier oben, ebenso die schimmernde Holzvertäfelung und die geschnitzten Türen. Auch den feinen Duft nach Bienenwachs liebte sie, mit dem Muhme Gesa die Treppe einreiben ließ, und den sanften Glanz, wenn danach die Stufen mit einem weichen Tuch poliert worden waren. »Ich will nicht fort«, murmelte sie halblaut. »Hier bin ich doch zu Hause!«
Spanien war furchtbar weit entfernt von allem, was ihr Leben bisher ausgemacht hatte. Dort lebten die de Molinas, entfernte Verwandte, die keiner von ihnen von Angesicht kannte. Wenn sie nur daran dachte, bekam sie Bauchweh. Lucia sollte mit dem Sohn verheiratet werden, und auch für sie wurde ein Ehemann gesucht. Eines Tages würde sie heiraten, natürlich, vielleicht sogar Cornelisz. Sie spürte, wie ihr die Röte ins Gesicht schoss, und sprang schnell zum nächsten Gedanken. Jedenfalls würde sie irgendwann in der Zukunft gemeinsam mit ihrem Gemahl das Handelshaus van de Meulen führen und nicht irgendwo in Spanien leben. So klar hatte bis heute ihre Zukunft ausgesehen. Und nun Spanien?
Wusste Vater denn nicht, dass sie als Jüdin dort nicht in Sicherheit würde leben können? Andererseits, in welchem Land der Erde konnte sie schon Sicherheit für sich erhoffen? Überall wurden Juden höchstens geduldet. Mutter war noch ein Kind gewesen, als ihre Familie Granada verlassen musste. Ihre Flucht vor der Inquisition war eine Geschichte, über die im Haus nicht gesprochen wurde. Nicht aus Gleichgültigkeit, eher weil Mutters Jüdischsein etwas ganz Normales zu sein schien. Vielleicht vergaß Mirijam es ja deshalb oft selbst? Dabei würde sie liebend gern ebenfalls irgendwo dazugehören, sogar zu einer jüdischen Gemeinde, wo doch Vater und Lucia Christen waren! Schon immer hatte sie es als Ungerechtigkeit empfunden, nicht mit zu den festlichen Messen zu Ostern oder Weihnachten in die Kathedrale gehen zu dürfen. Auch aus diesem Grund hatte sie schon ein paar Mal daran gedacht, sich taufen zu lassen. Sie hatte mit Vater darüber gesprochen, der jedoch gar nichts davon hielt.
»Die Menschen behaupten zwar, dass die Taufe das Wichtigste am Christentum sei, aber leider leben sie nicht danach«, hatte er gesagt. »Konvertierte Juden werden keinen Deut höher geachtet oder besser behandelt als bekennende Juden, vielleicht sogar weniger, jedenfalls ist das hier in Antwerpen so. Du tätest dir keinen Gefallen, mein Kind. Es ist besser, du bleibst bei der Religion deiner Mutter und ihrer Vorfahren. Zu gegebener Zeit werde ich dich zum Rabbi bringen, damit du die herrschenden Regeln und Gebote erlernst.«
Dazu war es allerdings bis heute nicht gekommen. Wäre sie ein Junge, hätte sich Vater sicher anders verhalten. Einen Sohn würde er nicht wie einen Tuchballen behandeln, den man nach Belieben überallhin verfrachten konnte, selbst über das Meer nach Spanien. Nein, rief sie sich gleich darauf zur Ordnung, das war nicht gerecht. Vater meinte es gut, und er hatte kaum eine andere Wahl. Schließlich hatten sie außer dieser merkwürdigen spanischen Verwandtschaft keine Angehörigen mehr.
Mirijam schlug die Hände vors Gesicht. Sie konnte weiterhin versuchen, sich mit allen möglichen Überlegungen abzulenken, der eigentliche Schrecken würde dadurch jedoch nicht vergehen. Der Tod stand vor der Tür! Was immer für sie und Lucia auch vorgesehen war, wo immer man sie beide auch hinschickte, bei aller Ungewissheit war doch eines sicher: Sie lebten und sahen einer Zukunft entgegen. Der arme Vater indessen…
Kaum hatten die Mädchen den Raum verlassen, ballte van de Meulen die Fäuste, er hustete und keuchte und krümmte sich vor Schmerzen. Der vergangene nasskalte Sommer hatte ihm schwer zugesetzt, mehr als manch ein Winter, und er hatte immer wieder den Arzt rufen lassen müssen. Seit Wochen kam dieser nun täglich und untersuchte die Beschaffenheit von Urin und Blut. Er verbrachte viel Zeit am Bett des Kranken, hielt auch Rat mit seinen Kollegen und fertigte die verschiedensten Arzneien für ihn an. Doch weder warme Umschläge mit Kampfer, Kräutern oder zerstoßenen Samen noch Tinkturen, Tees oder Salben hatten bis jetzt geholfen. Ebenso wenig hatten Aderlasse gefruchtet oder die Messen, die van de Meulen lesen ließ. Seine Pein wurde von Tag zu Tag eher größer. Seit einigen Tagen nun hustete er Blut. Er wusste, dass keine Heilung mehr zu erwarten war und sein Ende nahte. In der vergangenen Nacht hatte er viele Stunden gebetet, und jetzt fügte er sich in sein Schicksal, wie es einem guten Christenmenschen anstand. Allerdings gab es noch wichtige Dinge zu regeln, vor allem, was mit seinen Töchtern geschehen sollte.
Wohl zum hundertsten Male ging der Kaufmann im Geiste die bisher gefassten Entschlüsse durch. Er war der Letzte seines Hauses, und da die Mädchen nach seinem Tod hierzulande keine Verwandtschaft mehr hatten, musste er sie entweder in ein Kloster einkaufen, in das Haus von Freunden geben oder aber nach Andalusien senden.
In ein Kloster könnte allerdings nur Lucia allein eintreten, denn Mirijam hatte er niemals taufen lassen. Einerseits hatte ihn der tiefe Respekt vor ihrer früh verstorbenen Mutter und deren altehrwürdiger Religion daran gehindert. Andererseits aber wusste er nur zu gut um die unsichere gesellschaftliche Stellung von Konvertiten, die auch in Antwerpen niemals als wahre Christen angesehen wurden.
Dann waren da die Freunde. Bei ehrlicher Betrachtung musste er sich jedoch fragen: Hatte er überhaupt Freunde, echte Freunde? Natürlich war er viel herumgekommen im Leben, und natürlich kannte er eine Menge Kaufherren, Kommissionäre und Bankiers, nicht nur hier in der Antwerpener Kaufmannscompanie. Aber befand sich unter ihnen einer, der geeignet wäre, sich seiner Töchter anzunehmen? War unter ihnen auch nur einer, der nicht hauptsächlich nach dem verlockenden Erbe der Mädchen schielen würde? Nein, dachte er zum wiederholten Male, letztlich würde dieses Erbe wohl bei jedem den Ausschlag geben.
Mirijam und Lucia konnten aber keinesfalls allein bleiben, sie mussten zu den Verwandten nach Spanien, es blieb kein anderer Ausweg. Dabei war es nicht einmal gesichert, dass sein Vetter einer Hochzeit zwischen Lucia und seinem Sohn zustimmen würde. Die Verhandlungen liefen zwar seit einiger Zeit, und es waren mehrere Briefe gewechselt worden, allerdings war man noch zu keinem befriedigenden Ergebnis gekommen. Natürlich spielten dabei Erbteil und Höhe der Mitgift eine zentrale Rolle. Auch die geschäftliche Beziehung ihrer beider Kontore war von Bedeutung, Vetter Juan wünschte schon länger eine Zusammenlegung beider Häuser.
Wie dem auch sei, dachte er müde, und welche Maßnahmen oder Konstellationen man sich sonst noch hätte ausdenken können, um den Fortbestand des Handelshauses zu sichern, ihm blieb keine Zeit mehr. Er konnte nichts weiter tun, als auf Juan de Molinas Ehre, auf sein Pflichtgefühl und den Familienzusammenhalt zu vertrauen.
Die schweren Vorhänge seines Lagers im Alkoven waren weit geöffnet, damit er leichter Luft bekam. Helle Bienenwachskerzen brannten im Raum, da ihm die billigeren Talglichter Übelkeit bereiteten. Sie beleuchteten die geschnitzte Holzvertäfelung, einige Truhen, lederbespannte Sessel und den schweren Arbeitstisch, auf dem seine aufgeschlagene Bibel lag. Er ließ seinen Blick über Regale voll ziselierter Silberkannen, venezianischer Gläser und italienischer Majolika-Teller wandern. Die bleigefassten Gläser der Fenster leuchteten fröhlich und fast so bunt wie die der Kathedrale! Nicht mehr lange und er würde diese Schönheit nicht mehr genießen können. Wehmut und Trauer beschwerten sein Herz, und er seufzte tief auf.
Doch schnell fasste er sich wieder. Sein Leben war wahrhaft gut gewesen, und er hatte viel erreicht, am Lauf der Dinge aber konnte niemand etwas ändern. Zu oft schon war ihm der Tod begegnet, er gehörte zum Leben wie die Geburt und der Atem, der ihn nun allmählich verließ. Und wäre da nicht seine bohrende Sorge um die Zukunft der Mädchen gewesen, er wäre gern in Gottes Frieden heimgegangen.
Damit er dazu aber wirklich bereit war, mussten sie unbedingt noch heute lossegeln. Erst dann würde er Ruhe finden. Es war nicht nur der letzte Konvoi vor den gefährlichen Herbststürmen, es waren vor allem die letzten Schiffe, die in seinem Auftrag segelten. Erneut seufzte er.
Einen Großteil seines Kodizills hatte er glücklicherweise bereits damals schriftlich niedergelegt, als er mit dem wachsenden Erfolg seiner Unternehmungen nach und nach mehrere Grundstücke in der Stadt gekauft hatte. »Da nichts gewisser ist als der Tod, nichts hingegen ungewisser als die Stunde desselben…«, hatte er jenen Teil seiner letztwilligen Verfügung überschrieben, in dem er die Grundstücke Lucia und Mirijam als gemeinschaftliches Erbe übertrug.
»Der Tod soll nicht ohne Verordnungen eintreten«, so hieß es seit alters her unter den Antwerpener Kaufleuten. Eine kluge Regel, die er befolgen würde, denn allzu oft schon hatte man unrühmliche Streitigkeiten zwischen Familien und Geschäftspartnern miterleben müssen. Das sollte es in seinem Hause nicht geben. Er war immer ein besonnener und nach Möglichkeit ehrlicher Kaufmann gewesen, der über das Tagesgeschäft hinaus zu denken pflegte. Wohl auch deshalb hatte Gottes Segen auf seiner Arbeit gelegen.
Er horchte auf Geräusche von draußen, doch alles, was er vernahm, waren das leise Knacken eines der großen Holzbalken und der rasche Tritt der guten Muhme Gesa auf der Treppe. Diesem Haus am Koornmarkt gehörte seine ganze Liebe. Es war vier Stockwerke hoch und lag fast im Zentrum von Antwerpen, so dass die Lagerhäuser gut erreichbar waren. Sein Vater, der als junger Mann aus Granada an die Schelde gekommen war, hatte es einst erbaut. Er war ein gewitzter Kaufmann gewesen und ahnte wohl schon frühzeitig, wie sich die Stadt entwickeln würde.
Mit kundiger Hand und zunehmendem Erfolg hatte der Vater einen Strom von Schätzen aus aller Welt durch sein Haus gelenkt, Gewürze und Edelsteine waren ebenso darunter gewesen wie Getreide und Tuche. Im Laufe der Zeit hatte er allerdings den Handel mit Gewürzen anderen überlassen und sich auf edle Metalle und Stoffe spezialisiert. Brüsseler Spitzen, flämisches Leinen, Tuche aus Florenz und schwere Wollstoffe aus England gingen nach Süden, Seide, Baumwolle und meisterhafte Schmiedewaren nach Norden– zwei Flüsse, die im selben Bett, aber in verschiedene Richtungen flossen. Und bei aller Bescheidenheit, er selbst war ein würdiger Nachfolger seines Vaters gewesen, hatte er doch das Vermögen nicht nur klug verwaltet, sondern auch üppig vermehrt.
Und nun? Gott, der Herr, hatte ihm männliche Nachkommen verwehrt, obwohl er oft und lange auf den Knien gelegen und um einen Sohn gebetet hatte. Jetzt blieb ihm nichts als die Hoffnung auf Lucias Söhne. Söhne, die sie mit Fernando de Molina haben und die er in dieser Welt niemals zu Gesicht bekommen würde, die aber einmal für den Erhalt seines Handelshauses sorgen könnten.
Lucia war noch etwas kindlich im Wesen, mit ihren bald siebzehn Jahren jedoch längst im heiratsfähigen Alter. In Spanien, so wusste er, wurden die Töchter im Übrigen viel früher als hier im Norden verheiratet. Und Mirijam? Über sie und ihre Zukunft oder gar ihre Bedeutung für sein Handelshaus hatte er sich bisher noch nie Gedanken gemacht, fiel ihm jetzt auf. Sie war ja auch noch ein halbes Kind, nicht einmal vierzehn Jahre alt, ein schwieriges und eigensinniges Kind dazu. Sie war freiheitsliebend wie ein Knabe, ganz und gar loyal und mit einem eigenen Kopf versehen. Hatte sie sich jemandem zum Freund erwählt, so hielt sie ihm zuverlässig die Treue. Zudem war sie wissensdurstig und klug, dabei nachdenklich und zurückhaltend. Wie ihre Mutter konnte auch sie nicht um eines Vorteils willen taktieren. Wer konnte vorhersagen, wie sie sich entwickeln würde? Was hätte er also für sie planen und vorbereiten können? Für eine angemessene Mitgift war jedenfalls gesorgt, darüber hinaus musste er ihr Schicksal in Gottes Hände legen und auf seinen Vetter im fernen Spanien vertrauen. Wenigstens würde sie in das Land ihrer Mutter und Vorväter zurückkehren. Über diesen Gedanken schlief er ermattet ein.
Ein Knarren weckte ihn nach kurzem Schlummer. Sein Notar und Ratgeber öffnete leise die Tür. Andrees schlug die Augen auf und winkte ihn mit müder Hand zu sich.
»Jakob, komm nur herein. Ach, wärest du wie ich ein Vater, so wüsstest du, welch schwere Last auf meinem Herzen liegt! Wie sehr sorge ich mich um die Mädchen, Jakob. Ich muss sie der Hand des gnädigen Gottes anvertrauen, denn ich fühle, meine Stunde naht. Zünde mehr Kerzen an, ich sehe dich nicht gut, und es gibt noch viel zu regeln.«
2
Jakob Cohn entstammte der vornehmen, aber völlig verarmten jüdischen Familie der verstorbenen zweiten Frau van de Meulens, und schon aus diesem Grunde genoss er bei dem Kaufmann höchstes Ansehen. Daneben hatte er es in den letzten beiden Jahren verstanden, sich als Rechtsberater und Notar des Kaufherrn unentbehrlich zu machen.
Jakob Cohn, so hatte er seinerzeit Andrees van de Meulen erzählt, hatte sich vor nunmehr bald dreißig Jahren nicht wie so viele andere seines Volkes der trügerischen Hoffnung hingegeben, die allerchristlichsten kastilischen Könige Ferdinand und Isabella würden Wort halten und ihren Schutz tatsächlich auch auf die konvertierten Juden ausdehnen. Klugerweise, so musste man aus heutiger Sicht wohl sagen. Denn nicht nur die Mauren, sondern vielleicht noch mehr die Juden, besonders aber die konvertierten neofiti hatten unter den grausamen Verfolgungen Schreckliches zu erleiden gehabt.
Cohn jedenfalls hatte sich damals einer Gruppe sephardischer Kaufleute angeschlossen, war mit ihnen den katholischen Truppen und den Scheiterhaufen der Inquisition über die Berge nach Norden entkommen und hatte schließlich Zuflucht in den Handelszentren Englands, Brabants und der Hanse gefunden.
In London, so hatte er weiter berichtet, habe er zunächst ein Studium der Rechte absolviert und später dann für verschiedene namhafte Häuser von Bergen bis Krakau und von London bis Brügge gewirkt. Und zwar erfolgreich und durchaus gewinnbringend, wie es schien.
Vor zwei Jahren stand Cohn plötzlich vor der Tür, um bei seiner Verwandten, Andrees’ Ehefrau Lea, vorzusprechen. Leider weilte sie damals schon nicht mehr unter den Lebenden. Andrees van de Meulen aber war gleich überzeugt, dass er die Kenntnisse im Vertragswesen und die kaufmännische Erfahrung des Mannes gut für sich nutzen konnte. Noch dazu gehörte er praktisch zur Familie, war also sozusagen von Natur aus loyal.
Der Notar räusperte sich mahnend.
»Du hast recht, mein Freund«, unterbrach van de Meulen seine Erinnerungen, »machen wir uns an die Arbeit. Die Zeit drängt.«
Doch seine Gedanken wollten ihm heute nicht recht gehorchen und schweiften erneut in die Vergangenheit. Jakob Cohn beaufsichtigte mittlerweile das Kontor, arbeitete Verträge aus, führte sogar Verhandlungen und fungierte ganz allgemein als Ratgeber. Darüber hinaus unterrichtete er Lucia und Mirijam in Philosophie, Spanisch und Latein, was der älteren Kaufmannstochter allerdings nicht eben leichtfiel. Dabei war Lucia nicht dumm, sie hatte nur keine Lust, sich anzustrengen.
Der Vater seufzte. Besuche, Möbel, Schmuck und schöne Stoffe sowie die neuesten Gerüchte, die in der Stadt die Runde machten, all das fesselte die ältere Tochter. Außerdem liebte sie jede Art von Plauderei und fröhliche Spiele mit ihren Gefährtinnen. Seit Neuestem interessierte sie sich sogar für deren ältere Brüder, und von Gesprächen über das merkwürdige Verhalten junger Männer konnte sie nie genug bekommen. Nun, sie war noch jung und sorglos, manchmal fast ein wenig oberflächlich, im Grunde jedoch ein liebes Kind. Aber es wurde Zeit, sie zu verheiraten.
Mirijam hingegen sog im Unterricht alles mit geradezu spielerischer Leichtigkeit auf, wie ihm der Advocat berichtete. Sie fragte nach, wenn sie etwas nicht gleich verstanden hatte, las, was ihr unter die Augen kam, und wollte am liebsten alles auf einmal wissen. Besonders Zahlen faszinierten sie. Allein durch Beobachtung im Kontor hatte sie gelernt, mit ihnen zu spielen und zu jonglieren wie ein Jahrmarktsgaukler, und manches Mal war sie entzückt, wenn sich ihre langen Zahlenkolonnen zu sinnvollen Ergebnissen formiert hatten. Auch sie würde nun schnell heranreifen müssen.
Andrees van de Meulen seufzte, bevor er sich erneut seinem Notar zuwandte. »Sind die Schiffsanteile bereits überschrieben? Vorzüglich, sehr gut. Und wird Kaufmann Lange, wie besprochen, an van de Beurse zahlen?«
Advocat Cohn hob den Blick von seinen Papieren und nickte. »Er wird sich hüten, nicht zu zahlen.«
Van de Meulen entspannte sich ein wenig. Der befreundete Kaufmann Lange war zwar bekannt für mancherlei waghalsige Geschäfte, doch trotz seines Gespürs für gute Gelegenheiten, wie er es nannte, blieb er ein Ehrenmann und handelte auch so. Ein guter Name war Gold wert, war pures Kapital. Der vereinbarte Kaufpreis würde also dem eigenen conto beim seriösen Brügger Bankier zugerechnet und von jenem zu treuen Händen für Lucias und Mirijams Erbe verwaltet werden.
Seine Augen irrten erneut zum Fenster. Die Sonne hatte bereits ihren Zenit überschritten. Bald schon würde die Dämmerung einsetzen, und damit käme die Stunde des Abschieds. Erst nach dem Auslaufen der Schiffe sollte Pater Lucas kommen und ihm die heiligen Sterbesakramente spenden, so hatte er es um der Mädchen willen gewünscht.
»Der Schreiber wartet bereits, Ihr müsst nur noch festlegen, wie Ihr mit dem Haus sowie mit einigen Legaten zu verfahren wünscht. Ich würde vorschlagen, Muhme Gesa und die anderen langjährigen Diener mit festen Leibrenten zu bedenken, die zu Ostern und Pfingsten, dem Sankt-Martins-Fest und zu Weihnachten ausgezahlt werden. So ist es Sitte in Antwerpen. Muhme Gesa wolltet Ihr darüber hinaus Wohnrecht auf Lebenszeit in diesem Hause einräumen.« Der Advocat schaute fragend von seinen Papieren auf.
Van de Meulen nickte. »Und nicht zu vergessen, die Stiftungen«, erinnerte er Cohn.
»Richtig, die Verfügungen zu ›Gottes Ehr und guten Sachen‹, wie Ihr gesagt hattet. Ich habe bereits alles nach Eurem Wunsch vorbereitet. Hier habe ich übrigens die Inventare der Waren in den Lagern und Magazinen. Wollt Ihr einen Blick darauf werfen?«
Van de Meulen winkte ab. »Sage mir nur, ob du alles für rechtens befunden hast.«
»Durchaus«, bestätigte der Advocat. »Ihr habt wahrlich treue Diener: Die Listen sind allesamt vollständig und stimmen mit den Büchern überein.« Er legte den einen Stapel Papier zur Seite und griff nach einem neuen. »Ich werde jetzt verlesen, was Ihr bereits niedergelegt habt. Danach rufe ich den Schreiber und die Zeugen, damit Ihr unterzeichnen könnt und Euer letzter Wille in Kraft tritt. Schließlich soll alles seine Ordnung haben.«
Damit zog er einen der Kerzenleuchter näher zu sich heran und begann vom obersten Blatt an zu lesen: »Also, wir begannen mit ›Im Namen der Heiligen Dreifaltigkeit: Ich, Andrees van de Meulen, verwitwet und Bürger der Stadt Antwerpen, gottlob noch aller meiner Sinne und Gedanken mächtig, verfüge hiermit im Jahre des Herrn 1520 im Folgenden über all mein festes und bewegliches Hab und Gut, als da ist…‹«
3
»Wir müssen ihm gehorchen«, schluchzte Lucia. »Doch wie kann er uns einfach fortschicken? Sollen wir den eigenen Vater zurücklassen, krank und allein?« Lucia lag auf dem Bett, tränenüberströmt und mit wirren Haaren, und klagte laut.
So ist es immer, dachte Mirijam und betrachtete die Schwester. Kaum geschah etwas Unerwartetes oder Besonderes, egal wie schön oder unangenehm es auch sein mochte, gab sich Lucia hemmungslos ihren Gefühlen hin. Sie selbst konnte das nicht. Je elender sie sich fühlte, desto tiefer zog sie sich in ihr Schneckenhaus zurück. Wie es sich wohl anfühlen mochte, wie Lucia zu weinen, zu stöhnen und allen Kummer in die Welt hinauszujammern? Wurden die Dinge dadurch wirklich leichter?
Das Kohlebecken richtete kaum etwas aus gegen die Kälte in der Kammer, in ihrem Inneren jedoch, so kam es ihr wenigstens vor, in ihrem Herzen war es noch um einiges kälter als im Zimmer. Das machte die Angst um den Vater und die Sorge um die eigene Lage. Dennoch ließ sie sich nicht gehen, vielmehr nahm sie die Hände der Schwester und rieb sie kräftig zwischen ihren eigenen. Das beruhigte und wärmte und nicht nur Lucias Hände. »Was können wir schon anderes tun?«, murmelte sie halblaut vor sich hin. »Sollen wir denn in den Wald?«
Lucias Gejammer zerrte an ihren Nerven. Die Schwester mochte ihr zwar an Jahren überlegen sein, aber heute benahm sie sich wieder launischer als ein kleines Kind. Muhme Gesa erklärte Lucias schwankende Stimmungen gern mit einer schweren, fiebrigen Erkrankung in ihren frühesten Jahren, die zu schwachen Nerven und einer gesteigerten Empfindsamkeit geführt hätte. Insgeheim war Mirijam jedoch davon überzeugt, dass Lucia diese Erklärung hervorragend in den Kram passte. Oder stimmte es etwa nicht, dass sie furchtbar gern im Mittelpunkt stand und es liebte, andere nach ihrer Pfeife tanzen zu lassen? Selbst Cornelisz hatte Lucia längst durchschaut. »Unsere Prinzessin«, so nannte er Lucia, manchmal auch »Ihre Hoheit«. Irgendwann würde sie es ihr ins Gesicht sagen, dass sie sich dieses Getue sparen konnte, sie jedenfalls ließ sich nicht davon beeindrucken.
Andererseits liebte sie Lucia natürlich, wie sollte sie auch nicht? Oft genug hatte die Schwester sie in die Arme genommen, mit ihr gespielt, getanzt, gelacht. Und immer wieder hatte sie zu ihr gestanden und ihr geholfen. Als Mirijam zum Beispiel einen der kostbaren chinesischen Teller zerschlagen hatte oder als sie abends zu spät ins Haus gekommen war, weil sie unbedingt im Stall hatte bleiben wollen, bis die helle Stute ihr Fohlen auf die Welt gebracht hatte. Oder damals, als ihr in der Vorratskammer der Topf mit dem frischen Pflaumenmus heruntergefallen war und sie diese tiefe Schnittwunde davon getragen hatte… Mirijam atmete tief ein. In ihrer Brust drückte etwas, so dass sie nur schlecht Luft bekam. Es tat scheußlich weh, und sie musste Acht geben. Auch sie hatte heute nah am Wasser gebaut, wie man so sagt. Doch sie riss sich zusammen.
»Ich mache mich jetzt jedenfalls ans Packen.« Energisch öffnete sie den Schrank und begann, ihre Sachen in die ledernen Reisetruhen mit dem gewölbten Deckel zu legen. Neben einigen Erinnerungsstücken, die von ihrer Mutter stammten und ganz nach unten in die Truhe kamen, besaß sie nicht viel. Schuhe und etwas Wäsche, darunter ein zweites Mieder, das ihr noch etwas zu groß war, legte sie ebenfalls nach unten.
Seit ein paar Monaten bestand Muhme Gesa darauf, dass sie sich anständig kleidete, oder was sie sich darunter vorstellte, und seitdem musste sie täglich das lästige Ding tragen. Jetzt konnte sie nicht einmal mehr ohne Hilfe aufs Pferd steigen! Und auf einen Baum klettern? Kein Gedanke daran, wenn sie nicht vorher das Mieder auszog. Ein Mädchen hatte es schwer, als Junge wäre sie eindeutig besser dran, dachte sie wieder einmal.
Ihre wenigen Schmuckstücke, einige Bücher sowie ihre Kleider und Umhänge waren schnell gepackt. Sie war der Antwerpener Gesellschaft noch nicht offiziell vorgestellt worden, deshalb bestand ihre Garderobe aus schlichten Stoffen und bescheidenen Gewändern. Ihr war das nur recht, im Gegensatz zur Schwester, die ihre schönen Kleider über alles liebte.
Endlich sprang auch Lucia wieder auf die Füße. Sie stemmte die Arme in die Seiten. »Also gut, da es nun einmal sein Wille ist.« Ungeduldig riss sie Unterröcke, Hemden und andere Weißwäsche aus dem geschnitzten Schrank und stopfte die Sachen wahllos in ihre beiden Reisetruhen. »Ich bin also jetzt verlobt und reise zu meinem zukünftigen Ehemann. Wer hätte das gedacht?« Sie lachte ein wenig gekünstelt.
»Hörst du, Gesa?«, rief sie der Muhme entgegen, die soeben die Kammer betrat. »Ich werde heiraten. Und in der Sonne leben, wie herrlich! Endlich Sonne, das ganze Jahr über, und nicht wie hier andauernd Regen, Nebel und Sturm. Bald werde ich unter Granatapfelbäumen spazieren gehen, Pomeranzen und frische Zitronen von meinen eigenen Bäumen pflücken und jeden Tag üppige Sträuße duftender Rosen schneiden! Also weine ich nicht länger, sondern freue mich lieber.«
Lucia war groß, größer als Mirijam oder Muhme Gesa, und hatte bereits die Figur einer Frau, ihr Verhalten aber war immer noch das eines Mädchens, das daran gewöhnt war, jeden Wunsch erfüllt zu bekommen. »Hole mir sogleich Mutters Perlenkappe, Gesa. Und auch die anderen Sachen: ihre Granatkette, den seidengefütterten Umhang, die Haarbürsten sowie die silbernen Haarnadeln und natürlich ihren venezianischen Handspiegel. Du hättest das alles schon längst in meine Brauttruhe legen können!«
Die alte Gesa ertrug Lucias herrisches Gehabe kommentarlos, dabei litt sie sichtlich unter der bevorstehenden Trennung. Sie war blass vor Kummer, und die Falten in ihrem Gesicht hatten sich noch ein wenig tiefer eingegraben.
Sie sorgte sich sehr um Lucia, deren Amme sie wurde, als Lucias Mutter, Andrees’ erste Frau, im Kindbett starb. Seit damals kümmerte sie sich um das Mädchen und stand zugleich dem Hauswesen vor. Man hatte den Kindern, kaum dass sie verständig genug waren, erklärt, sie sei ihre Muhme, und irgendwann nannten alle sie so, obwohl sie keine Blutsverwandte war. Mirijams Mutter Lea wiederum, Andrees van de Meulens zweite Frau, starb an den Pocken, als Mirijam knapp zwei Jahre alt war. Damals hatte sich Gesa ebenfalls vorbildlich und liebevoll um das zweite Töchterchen des Witwers gekümmert. Niemand, nicht einmal eine leibliche Mutter, hätte besser für die kleinen Mädchen sorgen können, das sagten alle in der Stadt. Lange war Lucia ihr erklärter Liebling gewesen, doch mit den Jahren hatte sich auch die eigensinnige Mirijam tief in ihrem Herzen eingenistet.
Die Schwestern hätten nicht unterschiedlicher sein können. War an Lucia alles weich und hell und rund, so war dasselbe bei Mirijam dunkel, dünn und eckig. Lucia plauderte und lachte gern, während Mirijam lieber zuhörte, beobachtete und sich ihre Gedanken machte. Lucias Haut schimmerte wie Sahne, ihre blonden Flechten leuchteten, und ihre Augen hatten die sanfte Farbe des Himmels über der Schelde. Mirijams bernsteinfarbene Augen hingegen konnten brennen und Blitze versenden, wenn sie sich ärgerte oder ungerecht behandelt fühlte. Sie konnten sich sogar verdunkeln und vor Angst oder Aufregung weiten wie die einer Katze. Ihre wilden Locken mussten in feste Zöpfe gezwungen werden, dennoch stahlen sich immer wieder einige widerspenstige, tiefschwarze Strähnen hervor. Zu ihrem Leidwesen hatte Mirijam nicht nur die Haare, sondern auch die Haut ihrer mütterlichen Vorfahren geerbt, die rasch bräunte wie die eines Bauernmädchens. Bei einem Jungen hätte das vielleicht ganz gut ausgesehen, dachte sie manchmal, Lucias vornehme Blässe gefiel ihr jedoch besser.
Die alte Gesa schob eine von Mirijams vorwitzigen Locken wieder unter die weiße Kappe, ein Handgriff, den sie sicher schon tausendmal oder öfter getan hatte. Dann nahm sie das nächste Kleidungsstück zur Hand, faltete es und legte es sorgfältig in Lucias Truhe.
»Ach, wenn doch wenigstens du mit uns reisen könntest, gute alte Gesa!«, rief Lucia in diesem Moment und sprach damit aus, was alle drei dachten.
Wortlos nahm Gesa beide Mädchen in ihre Arme und drückte sie einen Moment fest an sich. Ihr Atem ging schwer, und als sie einen Kuss auf Lucias Haar drückte, schnaufte sie hörbar. Sie würde hierbleiben. Mirijam drängte sich näher an Gesa und sog ihren Duft ein.
Alle würden hierbleiben, nicht nur Muhme Gesa. Auch die Diener und Lagerarbeiter, die Kontoristen, alle Vertrauten und Freunde blieben, selbst Cornelisz. Cornelisz, ihr Freund seit Kindesbeinen, der demnächst bei Vater Andrees das Handwerk des Kaufmanns lernen sollte, obwohl er sich viel lieber mit Farben und Malerei beschäftigt hätte. Cornelisz, der nachdenkliche Grübler mit seinem Goldhaar und seinem Grübchen am Kinn, Cornelisz, ihr Prinz…
»Schon fertig mit Packen?«, fragte Lucia und riss sie aus ihren Gedanken.
»Ich will nicht! Ich will nicht weg!«, murmelte Mirijam. Nur mit größter Mühe hielt sie die Tränen zurück. Stattdessen ballte sie die Fäuste, dass die Nägel sich ins Fleisch bohrten.
Plötzlich kam ihr ein Gedanke. Rasch setzte sie sich an den Tisch, öffnete das Tintenfass und griff nach einem Blatt Papier. Diese vertrauten Handgriffe milderten ein wenig den Druck, der auf ihrer Brust lastete und das Atmen beinahe unmöglich machte.
»Es ist ja nicht für immer. Irgendwann, vermutlich schon bald, werdet ihr mit euren Ehemännern wiederkommen und mir eure eigenen Kinder vorstellen«, tröstete Muhme Gesa. »Mit Gottes Hilfe dauert es nicht lange.«
Doch Mirijam hörte nur mit halbem Ohr zu, denn beim Stichwort Ehemänner war ihr siedend heiß eingefallen, dass Cornelisz keine Ahnung von ihrer Abreise hatte. Wo hatte sie nur ihren Kopf? Sie musste ihn dringend von dem bevorstehenden Aufbruch verständigen! Die Zeit, bis die Schiffe ausliefen, war knapp, aber ohne Abschied konnte sie nicht von ihm fort. Hastig warf sie ein paar Zeilen hin, beschrieb mit wenigen Worten die Lage, setzte ihren Namen darunter und faltete das Papier. Dann rannte sie die Treppe hinunter, um sofort einen Boten mit dem Brief loszuschicken.
Als sie in die Kammer zurückkam, hielt Gesa ein schmales Päckchen in den Händen. Es war sorgfältig in mehrere Lagen feines Kalbsleder eingeschlagen und mit einer festen Seidenkordel umwickelt. »Dies ist das Vermächtnis deiner Mutter, Mirijam«, sagte Gesa leise und ein bisschen feierlich. »Sie wollte eigentlich, dass du diese Briefe an deinem Hochzeitstag bekommst, doch nun händige ich sie dir schon heute aus. Sie schickt sie dir mit ihrem Segen.«
Gesa wandte sich ab und stopfte das schmale Päckchen zuunterst in Mirijams Truhe. Dann ließ sie sich auf den Bettrand fallen und presste kurz die Hände gegen ihre Schläfen. Sie sammelte sich. All das ging ihr sichtlich nahe.
»In den Wochen vor deiner Geburt fühlte sie sich nicht wohl, sie lag viel und ruhte sich aus. Damals hat sie die, wie sie sie nannte, Briefe an ihr Kind geschrieben. Sie haben etwas mit ihrer Familie zu tun, mit ihrer Mutter und ihrer Heimatstadt Granada, glaube ich. Genau weiß ich es leider nicht. Als sie mir später das Bündel anvertraute, konnte sie im Fieber schon nicht mehr klar sprechen«, erklärte sie und streichelte Mirijams Hand. »Wenn ich sie damals recht verstanden habe, darfst du sie erst als Braut öffnen oder falls du schwer erkrankst oder sonstwie in Not geraten solltest. ›Sag meiner geliebten Mirijam, sie muss sie hüten. Sie sind mir sehr wichtig.‹ Das waren ihre Worte.«
Gesa erhob sich, beugte sich erneut über die Truhe und legte einen weiteren Umhang hinein, dann schloss sie den Deckel. Als sie sich wieder aufrichtete und Mirijam anschaute, glitzerten Tränen in ihren Augen.
Jetzt konnte auch Mirijam nicht länger an sich halten. Schluchzend umklammerte sie die Haushälterin. »Ach, Gesa, Vater soll nicht sterben! Ich will, dass alles so bleibt, wie es ist!«
Die alte Gesa hielt das Mädchen in den Armen und streichelte seine zuckenden Schultern. »Ich weiß, mein Kind, und mir ergeht es nicht anders. Aber es ist nun einmal, wie es ist auf der Welt: Der Mensch denkt, und Gott lenkt. Wir müssen uns fügen.«
Lucia saß auf ihrem Lager und starrte auf die gepackten Reisetruhen. Sie knetete ihre Finger. Schwer lastete das Schweigen auf den dreien.
»Denkt immer daran, was euer Vater und ich euch gelehrt haben, dann habt ihr eine Richtschnur im Leben«, mahnte Gesa. »Und jetzt wollen wir uns freuen, dass ihr in das schöne Spanien reisen dürft. Ihr werdet sehen, erst einmal in Granada angekommen, wird es euch gefallen. Wie Lucia vorhin ganz richtig sagte, die Sonne und die vielen schönen Blumen, all das werdet ihr von Herzen genießen und schon bald nicht mehr missen wollen. Und eines Tages werdet ihr wiederkommen und mir erzählen, wie es euch ergangen ist…« Die Tränen in ihren Augen straften ihre Worte Lügen, und sie musste sich abwenden.
Lucias Blick verlor sich in unbestimmter Ferne, und Mirijam nickte tapfer, als glaube sie jedes von Gesas Worten.
Dann öffnete Mirijam einen Fensterflügel und starrte auf den Hafen hinunter. Einige der Masten da draußen gehörten zu den drei Schiffen, die noch heute Abend Richtung Spanien aufbrechen würden: die Palomina, die Sacré Cœur und die Santa Katarina. Plötzlich wirkte das Wasser fremd und bedrohlich und die Masten der Schiffe wie gen Himmel gerichtete Lanzen.
4
Mirijam zitterte unter ihrem warmen Umhang, als sie durch die frühe Dämmerung zum Hafen gingen. Lucia stolperte mit tränenblinden Augen neben ihr, gestützt von Muhme Gesa, die ihre Tränen ebenfalls kaum zurückhalten konnte. Begleitet wurden sie von Advocat Cohn sowie einigen Hausbediensteten und Lagerarbeitern, die den Weg mit Fackeln beleuchteten. Einige trugen die Reisetruhen, andere den Weidenkorb, in dem sich der Reiseproviant aus Gesas Vorratskammer befand. Außerdem folgte ihnen eine Menge neugieriger Jungen und alter Tunichtgute, wie bei jedem Auslaufen eines Schiffes. In Mirijams Ohr klangen die Worte des Vaters nach. Als er ihnen zum Abschied seinen Segen gab, hatte seine Stimme brüchig geklungen. »Seid stark, meine lieben Kinder. Steht zusammen, wie ihr es in eurem Vaterhaus gelernt habt, und helft einander. Darin werdet ihr stets Kraft finden.« Lucia und Mirijam knieten an seinem Lager und küssten seine Hände. Weinend umklammerte Lucia die Hand des Vater, und auch Mirijam kämpfte mit den Tränen, doch sie wollte seine Sorge nicht noch vergrößern, indem sie die Fassung verlor. Furcht, Beklemmung und die Anstrengung schnürten ihr allerdings die Kehle zu, so dass sie kaum atmen konnte. »Du bist wie deine Mutter, mein Kind«, sagte der Vater zu ihr. »Du hast den gleichen starken Willen wie sie, der wird dir helfen. Geht nun mit meiner Liebe und mit meinem Segen. Gott der Herr möge seine Hand allezeit schützend über euch halten.« Noch niemals zuvor hatte er etwas so Zärtliches zu ihr gesagt.
Kalter Nieselregen fiel aus tiefhängenden Wolken, als sie den Hafen erreichten und sich durch das Geschiebe und Gedränge von Menschen, Karren und Warenballen ihren Weg zur Kaimauer bahnten.
Die Sacré Cœur und die Santa Katarina, zwei Handelsschiffe der Van-de-Meulen-Companie, legten bereits vom Kai ab, schwer mit Waren für Granada beladen. Ihre Ruder hoben und senkten sich ins Wasser, und zum Schlag der Trommeln nahmen die beiden Galeeren allmählich Fahrt auf. Einige Leute verließen den Kai, während die Schiffe hinter der Biegung des Flusses verschwanden. Andere standen mit eingezogenem Kopf im Regen und stampften hin und wieder fest mit ihren Holzschuhen auf, um die Füße zu wärmen, und warteten. Von Cornelisz keine Spur. Hatte er ihren Brief etwa nicht erhalten?
Lucia hing an Gesas Hals und weinte bitterlich, während Mirijam mit hängenden Armen danebenstand. Sie sah und hörte zwar alles, gleichzeitig aber war ihr, als träume sie oder schliefe mit offenen Augen.
Advocat Cohn sorgte dafür, dass ihr Gepäck über die breite Bohle an Bord der Palomina gebracht und verstaut wurde. »Nun ist es wohl an der Zeit«, befand er sodann, umfasste Lucias Arm, und gemeinsam mit Gesa geleitete er die Mädchen über die Laufplanke an Deck.
Kapitän Nieuwer, ein schmallippiger Mann mit grauen Locken, der ein rotes Wams und elegante Schuhe aus feinstem Leder trug, verneigte sich zur Begrüßung. Dann nahm er Advocat Cohn am Arm und zog ihn eilig beiseite.
»Wo bleibt Ihr denn? Ich ließ doch ausrichten, dass ich Euch dringend sprechen muss! Immerhin ist es die letzte Gelegenheit, und es steht einiges auf dem Spiel, deswegen frage ich Euch noch einmal: Seid Ihr Euch sicher? Ihr habt Euch nicht umentschieden?« Seine Blicke gingen unruhig umher, und er sprach mit gesenkter Stimme. Dennoch konnte Mirijam jedes seiner Worte verstehen. »Bedenkt das Risiko, und vor allem die Konsequenzen. Bei einem Fehlschlag… Ihr wisst schon…« Der Kapitän wirkte höchst besorgt.
Der Notar trat unauffällig einen Schritt zurück, wohl um dem Weindunst, der den Kapitän umgab, auszuweichen. Er musterte ihn scharf. »Was soll das? Natürlich bleibt es dabei.«
Dem Kapitän schien das jedoch nicht zu genügen. Er packte erneut den Ärmel des Notars und flüsterte: »Aber das Gerede!« Schnell wanderte sein Blick zu den beiden Mädchen, und er lächelte gequält, als er Mirijams Augen auf sich ruhen sah.
»Nun, Kapitän, Ihr werdet doch wohl nicht vergessen haben, in wessen Händen sich gewisse Unterlagen befinden? Und auch an den Schuldturm denken?« Diese Worte des Advocaten trafen den Kapitän wie ein Schlag, obwohl sie leise und ganz beiläufig gesprochen waren. Kurz darauf stand er am langen Ruder der Palominaund sprach mit dem Steuermann.
Eine seltsame Unterhaltung, überlegte Mirijam, doch weiter kam sie nicht, denn plötzlich entstand Unruhe am Kai. Ein sehr junger Mann mit blondem Schopf bahnte sich seinen Weg durch die Menge und rief schon von weitem: »Mirijam! Mirijam, wo bist du? Hörst du mich?«
Mirijam trat an die Reling. »Cornelisz? Hier, ich bin hier!«
»Ich habe deinen Brief soeben erst erhalten! Ich konnte nicht schneller…Wirst du mir schreiben aus Granada?«
»Gleich nach unserer Ankunft«, rief sie, »ich versprech’s. Die Palomina wird bereits bei ihrer Rückkehr einen Brief an Bord haben!«
»Hört, hört!«, lachte einer der Umstehenden auf der Kaimauer. »Und was ist mit mir? Bekomme ich etwa keinen Brief?« Andere fielen in das Gelächter ein, sie grölten und riefen durcheinander und verlangten ebenfalls nach einem Brief.
Mirijam schoss die Röte ins Gesicht. Sie stand an der Reling und klammerte sich am obersten Holm der Bordwand fest. Das zuckende Licht der Fackeln spielte auf den Locken des Jungen, der gefährlich nah am Rand des Hafenbeckens stand. Cornelisz keuchte noch vom schnellen Laufen, und auch seine Wangen waren gerötet.
»Du wirst mir fehlen, Cornelisz«, flüsterte Mirijam. Dann hob sie rasch die Hand zum Gruß und wandte sich ab. Dies war zwar nicht der Abschied, den sie sich gewünscht hatte, aber Cornelisz würde sie schon verstehen, wie er sie immer verstand.
Kapitän Nieuwer trat hinzu. »Es wird Zeit«, mahnte er an Advocat Cohn und die alte Gesa gewandt. »Ihr solltet das Schiff nun verlassen.«
Gesas vertrautes Gesicht war von Kummerfalten durchzogen, und die Haube saß ihr schief auf dem Kopf. Sie segnete beide Mädchen mit dem Kreuzzeichen. »Gott sei mit euch«, flüsterte die alte Frau, bevor sie sich umdrehte und mit geschürzten Röcken die Planke hinunterhastete.
»Gehabt Euch wohl«, sagte Advocat Cohn. »Der Zahlmeister und Kapitän Nieuwer werden sich um alles Weitere kümmern.« Er zog seinen Hut und verneigte sich vor Mirijam und Lucia. Dann verließ auch er das Schiff und gesellte sich zu den Wartenden am Kai.
Kaum war die Bohle eingezogen und das umlaufende Schiffsgeländer geschlossen, erteilte der Kapitän seine Befehle. Sogleich wurden Kommandos über das Deck gebrüllt, vermischt mit derben Flüchen und den ersten Trommelschlägen aus dem Ruderdeck. Die Ruderblätter hoben sich, als wollten sie der Stadt salutieren, dann senkten sie sich ins Wasser. Das Schiff drehte, und mit langsamer Schlagzahl schob sich die Galeere aus dem Hafenbecken.
5
Mirijam und Lucia standen noch an der Reling, als die Männer bereits über das Deck rannten, um Laternen an Bug und Achterdeck zu entzünden und die Luken zu schließen. Einige Matrosen verstauten steinerne Kugeln und Pulver im vorderen Kielraum, andere schlugen die Segel an den Rahen an. Sie bereiteten die Takelage zum Segelsetzen vor, indem sie dicke Seile zu großen Bündeln, Garndocken gleich, zusammenfassten und am Mast befestigten. Wieder andere begaben sich in den Laderaum hinunter, um in der Proviantkammer die Fässer mit Wein, Mehl, Wasser und gepökeltem Fleisch sicher zu deponieren und zu vertäuen.
»Aus dem Weg, Mädchen! Ich sag’s ja, Frauen und Schiffe, das passt einfach nicht zusammen!« Beinahe hätte sie einer der Männer mit einem rollenden Fass umgerannt. Hastig brachten sie sich am Mast in Sicherheit.
Aus dem höheren Wellengang und dem veränderten Klang des Windes schloss Mirijam einige Zeit später darauf, dass sie das offene Meer erreicht hatten. Vor ihnen lag das Unbekannte, ein fremdes Land, eine unklare Zukunft, und hinter ihnen lag alles, was ihr Leben bisher ausgemacht hatte. Sie zitterte, nicht nur wegen der Kälte und Nässe.
Starke Arme legten sich um ihre und um Lucias Schultern, und unwillkürlich überließ sich Mirijam für einen Moment ihrer Schwäche.
»Guten Abend, jonge dames, und herzlich willkommen an Bord der Palomina«, sagte ein älterer, sonnenverbrannter Mann. Er betrachtete die beiden Mädchen, als wolle er sich ein möglichst genaues Bild von ihnen machen, und deutete eine Verbeugung an. »Mein Name ist Vancleef, Joost Vancleef, zu Euren Diensten. Ich bin der argousin, der Zahlmeister, Lademeister und Schutzmann. Oder auch Mädchen für alles auf unserer schönen Palomina.« Er lächelte, dass sich ein Kranz tiefer Falten um seine Augen bildete, und zwinkerte freundlich. »Möchtet Ihr Euer Quartier sehen? Ich denke, heute wollt Ihr in Eurer Kajüte speisen. Der Koch wird Euch in ungefähr einer Stunde einen Eintopf servieren, seine Spezialität.«
Während der leutselige Mann die beiden Mädchen über eine enge Treppe hinunter in den Bauch des Schiffes führte, erklärte er ihnen, wo sich der Abtritt befand und überlegte laut, was es voraussichtlich während der Reise zu essen geben würde. Weiter behauptete er, dass der Koch ihnen jederzeit Tee zubereiten könnte, bedauerte, dass es keinen medicus an Bord gab, wohl aber einen Schiffsprediger, der sich auch auf Aderlässe, das Schneiden von Furunkeln und Amputationen verstünde, und dergleichen mehr. Er öffnete die Tür zu einer niedrigen Kajüte.
»Mijnheer Vancleef«, unterbrach Lucia, »bitte sagt mir, wann werden wir in Spanien ankommen?«
»Das ist nicht so leicht zu beantworten, Mejuffrouw«, erklärte der argousin und blickte sich suchend in der Kajüte um. »Ah, hier ist sie ja«, murmelte er, nahm eine Zunderbüchse von einem schmalen Regal und entzündete die Öllaterne an der Decke. »So, nun sieht es doch gleich freundlicher aus, nicht wahr? Also, meistens wird nachts in Küstennähe nicht gefahren, nur in Ausnahmefällen, zum Beispiel wenn man die Flut ausnutzen muss, so wie wir heute.«
»Und das heißt…?«
»Am Tage jedoch«, fuhr der Mann fort, »am Tage und natürlich bei günstigen Winden werden die Segel gesetzt. Dazwischen muss gerudert werden. Nun, und davon hängt es schließlich ab, nicht wahr? Vom Wind, meine ich, dem Wetter allgemein, sowie von der Route und von den sonstigen Umständen. Wir kommen unterschiedlich schnell voran, will ich damit sagen. Versteht Ihr? Habt Ihr Euch schon für eine Koje entschieden?««
Der enge Raum war mit schlichtem Holz getäfelt und verfügte über zwei Kojen, einen schmalen Tisch und eine kleine, hochliegende Luke. Die Laterne schwankte an ihrer Aufhängung, und ihr Lichtkegel erfasste mal diese, mal die gegenüberliegende Wand der Kajüte.
Mirijam fiel auf, dass Lucia plötzlich außergewöhnlich blass aussah, die Kante des kleinen Tisches in der Mitte der Kajüte umklammerte und immer wieder für kurze Momente die Augen schloss.
»Man kann wohl davon ausgehen«, sagte der argousin und trat einen Schritt näher zu Lucia, »dass eine normale Reise ohne Störungen annähernd zwei Wochen dauert. Einstweilen solltet Ihr, mein Fräulein, Euch schnellstens niederlegen. Die See bekommt Euch offenbar schlecht.«
Kaum hatte er das gesagt, versagten Lucias Beine. Er konnte sie gerade noch auffangen und auf eines der Betten legen.
»Lucia, was ist?«, fuhr Mirijam erschreckt auf.
»Macht Euch keine Sorgen«, beruhigte sie der Zahlmeister, »nur die Aufregung und ein bisschen Seekrankheit. Hier, das bringt sie wieder zu sich.« Damit reichte er Mirijam eine kleine Porzellandose. Als Mirijam den Deckel anhob, fuhr sie entsetzt zurück. »Was für ein Gestank!«
Vancleef lachte dröhnend. »Das weckt Tote auf, stimmt’s? Ein besonders wirksames Mittel gegen Übelkeit und Ohnmacht.« Er hielt Lucia die geöffnete Dose unter die Nase. Sogleich schlug sie die Augen auf, aber nur, um sie sofort wieder zu schließen. Sie stöhnte leise.
»Ihr seid ein wenig seekrank, junge Dame, doch das vergeht. Bleibt ruhig liegen, ich besorge Euch gleich etwas Tee.«
Lucia lag unter ihrer wollenen Decke und seufzte bei jedem Heben und Senken des Schiffes. Ihre Augenlider zuckten. Mirijam zog der Schwester Schuhe und Umhang aus, lockerte ihr Mieder und stopfte die Decke rundherum fest.
Vancleef brachte einen Becher Tee. »Vorsicht, heiß!«, mahnte er. »Ich muss jetzt wieder nach oben. Kommt Ihr zurecht bis morgen früh?«
Mirijam nickte und reichte den Becher an Lucia weiter.
»Dann wünsche ich gute Träume. Und keine Sorge, Ihr seid hier in Sicherheit.«
»Jetzt geht es also wirklich los«, flüsterte Lucia und blies in den Becher. Sie sah blass und müde aus, aber vielleicht lag das auch am Licht der schwankenden Laterne.
Während Lucia bereits nach einigen Schlucken heißen Tees in einen unruhigen Schlaf sank, konnte sich Mirijam nur schwer beruhigen. Lucias Ohnmacht hatte sie zutiefst erschreckt. Von einem auf den anderen Moment fühlte sie sich plötzlich von allem Vertrauten verlassen und abgeschnitten. Das war ein scheußliches Gefühl, als sei sie plötzlich ausgesetzt. Hoffentlich ging es Lucia bald besser. Die Reise war lang und ohne die große Schwester… Mirijam hob den Kopf. Zum Glück atmete Lucia jetzt gleichmäßig, ein beruhigendes Geräusch in der kleinen Kajüte.
Bei gutem Wind, aber begleitet von viel Regen und zumeist hohem Wellengang, segelten sie zunächst die französische, danach die westspanische und noch später die portugiesische Küste entlang. Sie steuerten auf die Meerenge zwischen Afrika und Spanien zu, auf jenen schmalen Durchlass, der den Weg ins milde Klima des Südens darstellte. Das Meer dort sei wütend und voller Gefahren, hatte Vancleef gesagt. Hätten sie die gefürchteten Strömungen und widrigen Winde an dieser Stelle aber erst einmal hinter sich gebracht, so lägen die prachtvollen Städte Andalusiens zum Greifen nahe.





























