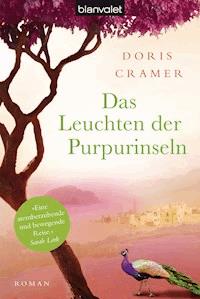3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Freiheit verweht wie Sand, doch die tausend Farben der Wüste bleiben ...
Deutschland, 1942. Eine junge Frau träumt von einer Zukunft mit ihrer großen Liebe, doch nach einer unvergesslichen Nacht wird er nach Nordafrika versetzt, bevor sie heiraten können.
1988: Im Nachlass ihrer gerade verstorbenen Mutter entdeckt die dreiundzwanzigjährige Doro Zeichnungen der marokkanischen Wüste und ein Amulett. Daraufhin reist sie nach Marokko, um mehr über ihre Mutter zu erfahren, die immer sehr verschlossen war. In Agadir trifft sie Ingrid, ihre ehemalige Dozentin und Leiterin einer Hilfsorganisation, die das Amulett sofort erkennt: Es ist ein seltenes Exemplar der Fatima-Hand, eines bei Muslimen verehrten Schutzsymbols. Einige Tage später wird Doro Zeugin einer brutalen Verhaftung. Kurz darauf begegnet sie dem Gefangenen erneut – er heißt Amir und trägt das gleiche Amulett ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 445
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Buch
Deutschland, 1942. Eine junge Frau träumt von einer Zukunft mit ihrer großen Liebe, doch nach einer unvergesslichen Nacht wird er nach Nordafrika versetzt, bevor sie heiraten können.
1988: Im Nachlass ihrer gerade verstorbenen Mutter entdeckt die dreiundzwanzigjährige Doro Zeichnungen der marokkanischen Wüste und ein Amulett. Daraufhin reist sie nach Marokko, um mehr über ihre Mutter zu erfahren, die immer sehr verschlossen war. In Agadir trifft sie Ingrid, ihre ehemalige Dozentin und Leiterin einer Hilfsorganisation, die das Amulett sofort erkennt: Es ist ein seltenes Exemplar der Fatima-Hand, eines bei Muslimen verehrten Schutzsymbols. Einige Tage später wird Doro Zeugin einer brutalen Verhaftung. Kurz darauf begegnet sie dem Gefangenen erneut – er heißt Amir und trägt das gleiche Amulett …
Autorin
Doris Cramer ist gelernte Buchhändlerin und leitete jahrelang eine Gemeindebibliothek, bevor sie zum Schreiben fand. Sie ist ein Bücherwurm durch und durch. Allein oder zu zweit unternimmt sie seit 1984 regelmäßige und ausgedehnte Reisen in Nordafrika und darüber hinaus, von Marokko bis nach Syrien, davon allein siebzehn Touren im äußersten Süden Marokkos. Die Landschaft, die Berberkultur und das alltägliche Leben in den Wüstenregionen Südmarokkos haben ihr ein spannendes Gegenkonzept zum Leben im übererschlossenen und -regulierten Deutschland gezeigt.
Von Doris Cramer bereits erschienen
Das Leuchten der Purpurinseln; Das Lied der Dünen; Die Perlen der Wüste
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag
Doris Cramer
DIE
WOLKEN
FRAUEN
Roman
Für Aminatou Haidar,
die an die Selbstbestimmung ihres sahraouischen Volkes glaubt
Prolog
SEPTEMBER 1942
Er wartete hinter der Mühle auf sie, hatte Fahrräder ausgeliehen, wollte mit ihr zum oberen Mühlteich. Früher, als Kinder, hatten sie dort endlose Sommer verbracht … Inzwischen war nichts mehr wie früher.
Vor dem Garderobenspiegel kämmte sie ihr Haar, dunkel und störrisch, und nahm die Schürze ab. Aus dem Speisezimmer verkündete der Volksempfänger den Vormarsch der heldenhaften deutschen Armee. Von Generalfeldmarschall Paulus war die Rede, von Stalingrad und dass man den Großteil der Stadt bereits erobert habe.
Russland war unvorstellbar weit entfernt, auch deshalb war sie froh, dass Gernots Kompanie nicht dort zum Einsatz kam. Das stand fest. Doch wohin es als Nächstes ging, wusste niemand. Dabei konnte sein neuer Marschbefehl jeden Moment eintreffen. Bald begann es also wieder, dieses Warten, bis der erste Feldpostbrief eintraf.
Sie brachte die Decken am Küchenfenster an, damit die Gnädige später zum Verdunkeln nicht auf die Leiter klettern musste. Frau Koch war nicht mehr die Jüngste, und Herr Koch kam meist erst spätabends aus der Fabrik. Offiziell war sie ihm zugeteilt und arbeitete nur nebenbei hier im Haus, in Wahrheit sah es umgekehrt aus.
Alles erledigt. Laut rief sie in den Flur: »Ich gehe«, schloss die Tür und lief die Hintertreppe hinunter. Personal und Lieferanten hatten diesen Weg zu nehmen, das prachtvolle Treppenhaus der Villa war den Herrschaften und Gästen vorbehalten.
Sie überquerte den Fabrikhof. Wegen der Fliegerangriffe hatte man die Fahnen abgenommen, die Hallen mit feldgrauen Planen getarnt und die Lastwagen unter strohgedeckten Pergolen geparkt. So war die kriegswichtige Koch’sche Metallfabrik aus der Luft nicht zu erkennen. Nachts lag die Stadt dunkel da, am nahen Bahnhof löschte man sogar die Notbeleuchtung, sobald Alarm gegeben wurde.
Immer öfter hörte man jetzt die englischen Bomber, die gegen die nahe Großstadt flogen, und sah den Widerschein der Brände am Himmel. Rotglühende Wolken, eigentlich ein schönes Bild. Die Leute aber, die hier durchkamen – Alte und Mütter mit verstörten Kindern –, berichteten von Feuerwalzen, von eingestürzten Häusern, verschütteten Menschen und Straßen voller Trümmer.
Sie passierte das Tor. Auf den ersten Blick sahen die Wohnhäuser in Fabriknähe aus, als trügen sie Wollsocken. Dabei hatte man die Fenster zu den Kellern, in denen sich die Bewohner bei Alarm in Sicherheit brachten, mit Sandsäcken abgedeckt. Tagelang hatten sie dafür schaufeln müssen, Ortsgruppenleitung und NS-Frauenschaft hatten diesen »Freiwilligen Arbeitsdienst der Heimatfront« angeordnet. Dabei gab es im Torfwerk am Ende der Stadt und auch hier in der Metallfabrik genügend Arbeitskräfte, Juden, Polen und Franzosen, die man zu derart schwerer Arbeit hätte heranziehen können. Aber nein, um die Verantwortung der Bevölkerung hervorzuheben, hatte man Frauen und junge Mädchen dazu eingeteilt. Noch jetzt spürte sie die Schwielen an den Händen.
Endlich außer Sicht lief sie los: An der Mauer entlang, die Garten, Villa, Fuhrpark und Fabrikhallen umschloss, den Karrenweg runter zur Bahntrasse, den Bahndamm hoch und über die Gleise. Sie nahm den Trampelpfad nahe der Flugabwehrstellung, dann bog sie auf den Mühlweg ein. Inzwischen rannte sie, flog geradezu. Gernot hatte überraschend Heimaturlaub bekommen, er wartete auf sie, und sie hatte frei bis morgen Abend!
Natürlich hatte die Gnädige geseufzt, schließlich aber doch ihre Einwilligung gegeben. »Ihr jungen Leute habt nichts als Vergnügen im Sinn! Sie sollten lieber an Ihre Zukunft denken.«
Sie lächelte. Ihre Zukunft? Sie trug einen Namen: Gernot! Und an ihn dachte sie unentwegt.
Die Uniform stand ihm hervorragend. Er trug sie mit Stolz, erst recht, seitdem auf Kragenspiegel und Schulterklappen silberne Leutnantsabzeichen glänzten.
Sie fuhren durch die seidenweiche Septemberluft, während sich auf den abgeernteten Feldern Schwärme von Zugvögeln zum Abflug bereit machten. Manchmal drehte er sich zu ihr um und lachte, wenn ihr der Fahrtwind den Rock über die Knie hochschlug. Es war dieses unbeschwerte Lachen, in das sie sich verliebt hatte, dieses Aufstrahlen, das sein normalerweise nachdenkliches Gesicht wie von innen erhellte. Das und seine strohfarbenen Locken und tiefblauen Augen.
Ewig hätte sie so mit ihm von Hecken gesäumte Wege entlangfahren können, bis ans Ende der Welt.
1. Teil
März 1988
Kapitel 1
Doro spannte den Bogen in die Schreibmaschine und tippte Absender, Adresse, Datum und Anrede. Der Anfang war gemacht. Wie weiter? Jedes Wort hatte sie im Kopf vorformuliert, und doch zögerte sie jetzt.
In Mutters Arbeitszimmer war es still, nicht einmal die Standuhr gab ein Geräusch von sich. Vor Monaten, noch vor der Beerdigung, hatte sie das Pendel angehalten. Zeit verging auch ohne Uhr.
Sie stand auf, wanderte vom Schreibtisch zum Sofa zu den überquellenden Bücherregalen. Hier die Makramee-Eule, die sie vor Jahren für ihre Mutter geknüpft hatte, dort an der Wand Van Goghs Sonnenblumen, ein Fotokalender und der grünseidene Teppich. Die Welt ihrer Mutter, ihr Zimmer, das Arbeitszimmer einer Lehrerin, und demnächst ihr eigenes. Sie trat auf den Balkon. Schneereste auf dem Rasen und kahle Sträucher, der Frühling war noch weit. Sie fröstelte.
Mutters Tod war erst nach und nach, wie in Zeitlupe zu ihr durchgedrungen, obwohl sie in ihrem Arm eingeschlafen war. Sie fehlte ihr, und zugleich war sie wütend auf sie. Wie konnte sie sie allein lassen? Wie konnten Ärzte diesen Tod zulassen, wie konnte heutzutage ein Mensch mit fünfundvierzig sterben? Hieß es nicht, die medizinische Forschung mache riesige Fortschritte, und ausgerechnet bei Brustkrebs sollte das nicht gelten? Vielleicht hatte sich Mutter aber auch selbst aufgegeben. Zuerst verausgabt, dann resigniert, schließlich kapituliert. Das war es, was sie ihr nachtrug, diese fixe Idee! Und dass sie sich niemandem anvertraut hatte. Als es gegen den Krebs gehen sollte, waren ihre Kraftreserven erschöpft.
Irgendwie waren Beerdigung und Prüfungen, waren Sommer und Herbst vergangen. An Weihnachten bei ihrem Vater und seiner neuen Familie war sie erstmals wieder zu sich gekommen, und nun begann bereits der Frühling.
Unter der Hecke kamen die Schneeglöckchen heraus. Sie wusste es, ohne nachzusehen. Unnötig, wenn man jeden Quadratzentimeter von Haus und Garten kannte. Nach den Amtspapieren gehörte alles nun ihr, das Reihenhaus, die Möbel und Haushaltssachen, die Sparverträge, das alte Auto. Alles. Ihr Erbe. Und Mutters Suche nach ihrer Identität – war auch das Teil des Erbes?
Sie schloss die Balkontür, drehte die Heizung auf. Das Knacken, Gluckern, Fließen in den Rohren unterstrich die Stille. Sie trat an den Schreibtisch, malte Das-Haus-vom-Nikolaus in den Staub der Tischplatte, zwischen Telefon und Urlaubsfoto.
Mutter und sie am Strand. Mutter lächelte, obwohl sie zu jener Zeit bereits von der Krankheit gewusst haben musste. Eigentlich unvorstellbar, ihre Verschwiegenheit, andererseits hatte sie jahrelange Übung darin. Hatte Mutter denn nie bemerkt, wie unerreichbar sie hinter diesem Schweigen war? Und wie die Unsicherheit der Tochter wuchs?
Nur zu gut erinnerte sie sich an Mutters innere Abwesenheit, die sie gelegentlich mit übertriebener Zuwendung auszugleichen versucht hatte, an ihre Stimmungsschwankungen, und sie hatte noch ihr Mantra im Ohr: »Vertrau mir, wenigstens du sollst unbeschwert aufwachsen.«
Vertrauen? Bis fast zum letzten Augenblick hatte Mutter ihr Geheimnis gewahrt. Erst als sie immer weniger wurde, hatte sie sich in einem langen, ungeordneten Monolog geöffnet. So viel zum Thema Vertrauen.
Ein Jahr lag das nun zurück.
Doro sah sich auf Mutters Bettkante sitzen, sah das veränderte Gesicht der Mutter, die wimpernlosen Augen, die transparente Haut, durch die ein Netz zarter Adern schimmerte. Sie hielten sich an den Händen. Keine sprach es aus, doch beide wussten, ein Später gab es nicht.
Wie getrieben bekannte Mutter, dass sie sich zeitlebens »falsch« gefühlt und erst am Tag ihrer Verlobung den Grund erfahren hatte: Sie war ein adoptiertes Kind.
Oma und Opa Wagner hatten ihr den Namen Christa gegeben, sie großgezogen, ihr Anstand und Benimm beigebracht und das Studium ermöglicht. »Opa Wagner sagte immer, als Lehrerin hast du Zeit, dich um Mann und Kinder zu kümmern, und außerdem: Beamtin!« Mutter küsste ihre Fingerspitzen, eine vertraute Geste. Sie lachten beide. Es tat gut, Mutter lachen zu sehen.
Danach gab es kein Halten mehr. Mehrmals wiederholte Mutter Opa Wagners Worte: »›Wir als solide, urdeutsche Familie haben dich an Kindes statt zu uns genommen.‹ Geahnt habe ich schon immer etwas, doch plötzlich gab es eine Erklärung für dieses Gefühl der Fremdheit«, sagte sie. »Niemand sah mich an und sagte ›Die Nase hat sie vom Vater‹ oder ›Genau wie Großtante Ilse‹. Ich war ein falsches Kind. Zuerst dachte ich, ich werde verrückt. Und bis heute frage ich mich, was für ein Mensch ich wohl geworden wäre, wäre ich ein richtiges Kind gewesen.« Mutter zog sich in ihre Erinnerungen zurück.
»Dennoch haben Klaus und ich ein Jahr später geheiratet. Damals war es üblich zu heiraten, außerdem strahlte er diese Zuversicht aus … Wir kriegen das hin, hat er gesagt.« Sie drehte den Kopf.
»Nichts haben wir hingekriegt. Selbst als du zur Welt kamst, mein kleines Gottesgeschenk, und wir eine richtige Familie waren, fühlte ich mich immer noch nicht ›richtig‹. Die Frage blieb: Was an mir war falsch, dass mich meine leiblichen Eltern nicht bei sich haben wollten? Waren sie Nazis gewesen oder Juden, wurden sie verfolgt, waren sie an Kriegsverbrechen beteiligt?«
Hustenanfall, Schweißausbrüche, piepsende Monitore, eine neue Infusion, Erschöpfung. Der Tod – kam er jetzt? Doro wäre am liebsten geflohen. Doch sie nahm Mutters Hand und blieb. Mutter hielt sich fest an ihr. Spürte sie die Zerrissenheit der Tochter, ihre Fluchtbereitschaft?
»Verzeih mir, aber einmal muss ich es loswerden. Anfang der siebziger Jahre, du warst in der zweiten Klasse, drehte sich alles nur noch darum. Ich hatte einen Nervenzusammenbruch, kam in ein Sanatorium, und danach, ich weiß noch, es ging auf Weihnachten zu, fühlte ich mich eine Weile besser.«
An diese Zeit wollte sich Doro nicht erinnern. Sie wollte vergessen, wie hektisch Mutter Plätzchen gebacken und jeden Winkel des Hauses mit Zweigen, Engeln und Weihnachtskugeln geschmückt hatte, als seien Zimt und rote Kugeln eine Gewähr für Glück.
Zur gleichen Zeit begannen die Streitereien. Doro sah sich auf dem Bett kauern, ein Buch auf den Knien und die Finger in den Ohren. Streit, Tränen, laute Stimmen. In ihrem Beisein sprachen die Eltern kaum miteinander. Niemand erklärte, worum es ging, und zu fragen traute sie sich nicht. Sicher war ohnehin alles ihre Schuld. Sie konzentrierte sich nicht in der Schule, räumte ihr Zimmer nicht auf, trödelte, hatte Widerworte …
Sie wusste noch, wie es im Haus kälter und kälter geworden war, bis Klaus, wie sie ihren Vater seit Neuestem zu nennen hatte, auszog. Ausgerechnet Mutters Sehnsucht nach Wurzeln hatte die ihrer Ehe gekappt.
Was hatte die Trennung, die Scheidung damals mit ihr gemacht? Genau wusste sie es nicht mehr, nur, dass sie lange Zeit Schuldgefühle gehabt hatte und dass sie sich seither zweimal überlegte, wem sie vertraute.
Mutter erzählte in Wendungen, kam aber immer wieder darauf zurück, dass eines Tages eine juristische Frist verstrichen war und sie begonnen hatte, in Archiven und Registern zu forschen.
Vage erinnerte sich Doro an Umschläge mit amtlichen Stempeln auf dem Schreibtisch. Gesprochen wurde darüber nicht. Nicht über die Umschläge, nicht über Oma und Opa Wagner und schon gar nicht über Mutters Kummer. Er war spürbar, immer, Doro kannte es nicht anders, doch sie stellte keine Fragen. Fragen brachten Traurigkeit in Mutters Augen.
Irgendwann, erzählte Mutter, habe sie nach langwieriger Suche im Archiv einer Lungenheilanstalt den entscheidenden Eintrag gefunden. »Unter meinem Geburtsdatum war eine einzige Geburt verzeichnet. Kind: Weiblich, Gewicht: 2.900 Gramm, Länge: 50 cm, Mutter: Elisabeth Müller, geboren 1922, Vater: unbekannt. Verstehst du? Elisabeth Müller, geboren 1922, war die Frau, die mich geboren hat.« Sie weinte ohne Kraft.
Später fuhr sie fort: »Ich fand heraus, dass Elisabeth Müller nicht nur den Krieg überlebt hatte, ich erfuhr sogar ihren Ehenamen und ihren Wohnort. Mir war sofort klar: Ich musste zu ihr, musste mich mit eigenen Augen von der Existenz dieser Frau überzeugen. Nur ihr konnte ich meine Fragen stellen.«
Doro starrte auf Mutters Hände, diese dünnen, bläulich geäderten, von zahllosen Spritzen zerstochenen Hände, und sah, wie ihre Finger an der Bettdecke rieben und zupften, am Stoff drehten und zwirbelten, bis genug beisammen war, um die Faust darum schließen und sich festhalten zu können.
»Es dauerte, bis ich ausreichend Mut gesammelt hatte, doch dann tat ich es. Ich fuhr in ihre Stadt und beobachtete einen ganzen Tag lang eine energische, ältere Frau, die Fahrrad fuhr und in einem gepflegten Haus inmitten eines Gartens voller Apfelbäume lebte, allein. Meine Mutter. Meine Mutter? Ich spürte nichts, keine Verbundenheit, kein Erkennen, nichts. Nach einer Nacht im Bahnhofshotel, in der ich keine Ruhe fand, ging ich zu ihrem Haus und klingelte.«
Von der Begegnung unter der Haustür hatte Mutter kaum eine Erinnerung, nur, dass sie wie ein Staubsaugervertreter abgewimmelt worden war. »Mir fehlten die Worte. Sie schloss die Tür, ich legte meine Karte auf den Fußabstreifer und fuhr nach Hause. Ja, so war das.«
Doro trocknete ihr die Tränen.
Auf dem Foto lächelten sie. Mutter und Tochter in Ferienlaune, beide mit welligem Haar, die eine blond, die andere dunkel, und beide mit leuchtend blauen Augen. Sie waren einander wirklich ähnlich. Hatte sie deshalb ebenfalls Lehramt studiert? Sie könnte in Mutters Lebenshülle schlüpfen, es wäre die einfachste Sache von der Welt.
Sie entstamme einer Dynastie von Schulmeistern, hatte man schon in der Abizeitung gespottet. Zu Recht. Mutter: Lehrerin an der Realschule, Vater: Studiendirektor am Gymnasium, wie auch schon sein Vater zuvor. Also hatte sie Englisch und Französisch auf Lehramt studiert.
Bisher hatte sie den Schuldienst in beruhigender Ferne gesehen, doch nun lag das Angebot auf dem Tisch. Das Ministerium schrieb, nach den Sommerferien könne sie sich an Vaters Schule auf das zweite Staatsexamen vorbereiten, bis zum kommenden Dienstag solle sie sich geäußert haben. Mit kollegialen Grüßen … Hatte ihr Vater seine Beziehungen spielen lassen?
Doro starrte die Schreibmaschine an. Sie musste nur noch den Termin bestätigen, einen Dank formulieren und den Brief abschicken.
Lehrerin, Schule – das hieß Übersichtlichkeit und Sicherheit, vom kommenden Herbst bis zum Tag ihrer Pensionierung, Tag für Tag. Wollte sie das, sozusagen die Fortsetzung dessen, was sie in- und auswendig kannte, eine Wiederholung, ein Parallelleben? Aber was konnte sie denn anderes? Wer war sie überhaupt, besser, was war sie? Kopie oder Original? Andauernd hieß es, man müsse Verantwortung für sich selbst und seine Entscheidungen übernehmen. Einerseits selbstverständlich, andererseits aber doch nur Gerede. Konkreter waren die Stimmen, die forderten, man müsse Neues wagen, sich von Fesseln befreien und Herausforderungen suchen. Lernte man sich und seine Fähigkeiten dadurch wirklich besser kennen?
Sie presste die Handballen auf die Augen, bis hinter den geschlossenen Lidern Sterne tanzten. Wo konnte sie Rat finden? Ihre Freunde waren längst in alle Winde verstreut. Vater? Er kannte nichts als Schule und Lehrersein. Erschwerend kam hinzu, dass sie schlecht war im Fragenstellen. Wer fragte, machte sich angreifbar.
Sie drehte eine weitere Runde durch Mutters Arbeitszimmer. Regale, Sofa, Sessel. Ihre Fingerspitzen fuhren über den marokkanischen Wandteppich, folgten seinen Dreiecken, Rauten und Wellenlinien. Geheimnisvolle Symbole. Im Licht schimmerte er, wie man sich einen fliegenden Teppich vorstellte, auf der Rückseite aber erkannte man die feste Knüpfung. Ingrid, ihre frühere Seminarleiterin, hatte ihr diesen Teppich geschenkt. Seit der Pensionierung lebte sie in Marokko, wo sie sich eine neue Aufgabe gesucht hatte. Selbst im Alter schaffte Ingrid noch alles, was sie sich vornahm.
Doro sah sich um. Alte Unterrichtsmaterialien, Ordner, jede Menge Papierkram und unter dem Schreibtisch die verschrammte Munitionskiste aus dem Zweiten Weltkrieg, die Mutter jahrelang als Fußstütze gedient hatte. Hier musste dringend aufgeräumt werden. »Ordnung im Haus schafft Ordnung im Kopf« war einer von Mutters Lieblingssprüchen gewesen.
Doro zog die Kiste hervor. Graues Holz, angerostete Klappverschlüsse und eine eingebrannte Nummer auf der Oberseite. Entweder Anschauungsmaterial für den Geschichtsunterricht oder ein Flohmarktfund. Irgendwann hatte sie gemeinsam mit Mutter den Inhalt der Kiste untersucht, fiel ihr ein, bewahrte sie nicht Zeichnungen darin auf? Die Verschlüsse schnappten auf.
Der Duft von altem Papier wehte Doro an. Eine Mappe kam zum Vorschein, darunter lagen ein Bildband über Wüsten und ein in Seidenpapier eingeschlagenes Schmuckstück. Die Mappe enthielt Aquarelle und Skizzen, einige düster, andere recht hübsch. Merkwürdige Motive. Auf den Rückseiten der Blätter standen Bezeichnungen wie »RAM RAM« und »Ouazazarte«, und eines nannte sich »Bou Saalam«. Waren das die Titel? Unverständlich, aber gut lesbar, genau wie die Signatur: »G. Schlüter 1944«.
Als echten Künstler konnte man diesen G. Schlüter kaum bezeichnen. Erinnerungen eines Fremden hatte Mutter damals gemeint. Warum hatte sie den Kram dann aufgehoben? Und was bedeuteten die Angaben? Ouazazarte kam ihr bekannt vor. Hatte nicht Ingrid eine marokkanische Stadt mit diesem Namen erwähnt? Wenn sie nicht von abgelegenen Dörfern sprach und die mangelhafte Ausstattung dortiger Schulen beklagte, erzählte sie von den Bergen des Hohen Atlas, von Lehmburgen und Oasen, von Teppichkunst und Minaretten. Sie kannte sich aus in Marokko.
Doro schaltete die Stehlampe ein. Im Licht wurden Farben und Konturen der Aquarelle intensiver. Ein Blatt zeigte eine Oase, ein anderes die geschwungene Linie einer Sanddüne, das nächste halb im Sand versunkene Palmen, wieder andere Stachelkakteen oder steinige Bergpfade. Auch die Bleistiftskizzen von Baracken hinter Drahtzäunen gewannen im Licht, dennoch wirkte alles irgendwie unbelebt. Landschaften aus Marokko hatte dieser Mensch im Jahr 1944 gemalt, aber weder Tiere noch Menschen. Nur das Blatt mit dem Titel »Bou Saalam« zeigte ein Kind. Offenbar kämpfte es gegen Wasserfluten. Das Buch mit Bildtafeln in Schwarzweiß befasste sich ebenfalls mit der Wüste und mit Marokko. Über dieses Land wusste sie lediglich, was Ingrid erzählt hatte.
Ingrid. Seit Mutters Tod klebte ihre Karte unter einem der Kühlschrankmagneten. »Leg dein Examen ab, das muss sein. Dann aber pack zusammen, komm her und bleib, solange es dir gefällt.« Den ganzen Winter hindurch war Doros Blick immer wieder an diesen Worten hängen geblieben.
Ingrid lebte in Agadir, nur ein- oder zweimal pro Jahr kam sie nach Deutschland, um Leute zu besuchen und Spenden zu sammeln. Der eingefleischten Lehrerin war die Alphabetisierung von jungen Marokkanerinnen ein Herzensanliegen. Daher hatte sie ein Hilfsprojekt ins Leben gerufen, mit dem sie den Schulbesuch von Mädchen auf dem Land förderte. Pausenlos schrieb sie Bettelbriefe, organisierte Berge von Sachspenden französischer und deutscher Firmen und verdonnerte Freunde und Bekannte zu Transportdiensten. Auch ehemalige Seminarteilnehmer, die lediglich Urlaub an Marokkos Stränden machen wollten, wagten nicht, mit leeren Händen anzureisen.
Doro wickelte das Schmuckstück aus dem Papier. Der silberne Anhänger in Form einer Tulpe war über und über mit Gravuren bedeckt. Sie wirkten wie arabische Kalligraphie. In der Mitte trug der Anhänger einen dunklen Stein mit Einschlüssen, der seltsam belebt wirkte, auch, weil seine Form an ein Auge erinnerte.
Doro bewegte das Stück unter dem Licht, folgte den eingeschnittenen Schwüngen. Fremd und schön, wie der seidene Wandteppich.
Ingrid. Bei ihr konnte sie sich Rat holen.
Bevor sie ihren Entschluss noch einmal überdenken konnte, durchsuchte Doro das Telefonbuch nach der Nummer eines Reisebüros, holte den Kalender aus der Küche, ein Notizblatt, einen Stift, und wählte. Warten, warten, warten. Das Knacken und Piepsen in der Leitung erinnerten sie an die Geräusche der Überwachungsgeräte in Mutters Sterbezimmer.
Endlich meldete sich jemand.
Innehalten, nur einen Moment, dachte Doro zwei Wochen später. Sie stand im Flur, lauschte. Das Haus blieb still.
Draußen wartete das Taxi.
Aufbrechen, Neues wagen …
Sie tastete nach dem Geldgürtel, dem Brustbeutel für Pass und Bargeld, nach Ingrids Adresse in Agadir. Hatte sie an alles gedacht?
Ihr Blick fiel auf den vergilbten Spruch über der Haustür. Mutter hatte ihn einst dort angebracht. »Jenseits dieser Grenze werden Drachen sein.« So hatten frühe Kartographen über das spekuliert, was außerhalb der ihnen bekannten Welt lag.
Das Taxi hupte.
»Wo geht’s denn hin?« Der Fahrer warf einen Blick auf ihr Gepäck.
»Nach Marokko«, antwortete sie, »in die Wüste.«
Kapitel 2
MAROKKO
Doro war es, als sei ihr dieses Flirren aus Licht, Wärme und Farben, aus fremden Gestalten und Gerüchen bereits seit Langem vertraut. Nie hatte sie Ähnliches gesehen, und doch schien sie es zu kennen. Absurd, dachte sie, Einbildung. Sie hob ihr Gesicht der Sonne entgegen und ließ sich vom Strom der Urlauber aus dem Flugzeug über das hitzeflirrende Vorfeld in den Schatten der Ankunftshalle treiben.
Jenseits der Absperrung wartete Ingrid mit ausgebreiteten Armen. Sie wehrte heranstürmende Träger und Taxifahrer ab und lotste Doro zu ihrem kleinen japanischen Geländewagen. »Du siehst blass aus, meine Liebe, aber das gibt sich, sobald dich die Sonne küsst. Schön, dass du da bist!« Ihre Freude war echt.
»Hier geht’s ja drunter und drüber!« Doro deutete auf die Straße.
Taxis mit qualmenden Auspuffen hupten sich den Weg frei, Fahrer gestikulierten aus offenen Autofenstern, Männer in langen Kapuzengewändern und verhüllte Frauen überquerten die Straße, dazu Palmen im Wind, Staub, von der Sonne vergoldet, und Reiter auf bunt gezäumten Pferden. Eine Betonbrücke spannte sich über einen Fluss ohne Wasser, im Sand neben der Schnellstraße hüteten Kinder Ziegen, und Uniformierte bewachten ein Anwesen, über dessen Mauern sich Kaskaden von Bougainvillea und Jasmin ergossen. Auf der Straße Eselskarren, turmhoch beladene japanische Pick-ups, Mopedfahrer und rostfleckige Taxis, die jede Ampel ignorierten. Und bei all dem Trubel schienen alle guter Dinge zu sein. Was für ein Kontrast zu Deutschland!
Ingrid lachte und redete und erklärte. Die Reiter seien unterwegs zu einem Auftritt vor Touristen, Agadirs Taxifahrer wahre Virtuosen im Straßenverkehr und jeder achte auf jeden. Ihre Erklärungen glitten an Doro vorbei.
»Wie kommst du bloß damit zurecht?«
»Es ist, wie es ist.« Typisch Ingrid.
Zur Linken blitzte das Meer zwischen Hotelklötzen, entlang der Straße blühten Hibiskus und Oleander, und irgendwie schien hier alles aus dem Inneren heraus zu leuchten.
»Ich muss für ein, zwei Stündchen ins Büro, danach bring ich dich nach Hause, und wir richten uns gemütlich miteinander ein«, sagte Ingrid. Sie erläuterte ihre Arbeit, aber Doro hörte nicht wirklich hin.
Dieses merkwürdig vertraute Gefühl des ersten Augenblicks hielt an. Das konnte nur an Ingrid liegen. Von Anfang an hatte sie sie als Vorbild empfunden. Sie war einfühlsam, aber bestimmt, und stets objektiv, was ihr den Respekt von Schülern einbrachte. Wenn ihre Studenten fragten, wie sie das mache, antwortete sie: »Es gibt keinen Trick. Man muss auf sich selbst vertrauen. Das ist alles: Sich an den eigenen Rat halten.« Ingrids Maxime.
Sich an den eigenen Rat halten – wenn das so einfach wäre! Doro beobachtete Ingrid. Obwohl sie sich über ein Jahr nicht gesehen hatten, war es, als hätten sie sich erst gestern getrennt. Ungeachtet ihres Alters war Ingrid wahrscheinlich der lebendigste Mensch, den sie kannte.
»Schicke Frisur.« Doro deutete auf Ingrids kurze graue Haare.
Ingrid lachte. Sie erzählte von Mohammed, ihrem Friseur, den sie immer dann aufsuchte, wenn ihr nach Klatsch und Tratsch bei einem starken Mokka zumute war. Er kannte jedes Mitglied der kleinen deutschen Gemeinde in Agadir. Sie bestand aus Managern und Kaufleuten mit ihren Familien, aus deutsch-marokkanischen Paaren, Rentnern und Künstlern, und wenn möglich, hielt sich Ingrid von ihren Clubabenden und Partys fern. »Oktoberfest in Marokko? Darauf kann ich gut verzichten.« Dennoch hielt sie zumindest losen Kontakt, und sei es über ihren Friseur.
Furchtlos kurvte sie durch den Verkehr, hupte und gestikulierte wie die anderen Autofahrer und erzählte dabei vom Ringen mit der Zollbehörde und von ihrem Hilfsprojekt. In Doros Wahrnehmung vermengten sich ihre Worte mit den Straßenszenen, mit dem Licht und den Gerüchen zu einem aufregenden Kaleidoskop. Sie war heilfroh, hergekommen zu sein.
Aus einem ummauerten Gebäudekomplex, über dem die marokkanische Flagge wehte, fluteten Scharen von Kindern mit Schultaschen. Andere Kinder trieben ihnen entgegen.
»Schichtunterricht.« Ingrid deutete auf die Ströme. »Sonst kriegen sie nicht alle Kinder unter. Auf dem Land sieht es anders aus, dort werden die Mädchen als Arbeitskräfte gebraucht. Jungen sind selten besser dran, doch wenn es sich eine Familie irgend leisten kann, ermöglicht man ihnen wenigstens für ein paar Jahre regelmäßigen Schulbesuch. Bei Mädchen hingegen empfindet man Schule als Verschwendung, schließlich heiraten sie ja irgendwann.« Ingrid schnaubte.
Das alte Reizthema. Schon immer hatte sich Ingrid für die Förderung von Frauen, ihre Karriere und eine gleiche Bezahlung starkgemacht. Ihre Studentinnen konnten die Parolen rauf- und runterbeten. Doro schmunzelte.
»Lach nicht! Natürlich ist meine Arbeit nur der sprichwörtliche Tropfen auf den heißen Stein, aber solche Verhältnisse akzeptieren? Ganz gewiss nicht.«
»Ich weiß gar nicht, worüber ich lache, jedenfalls nicht über dich. Das alles hier ist so chaotisch, so widersprüchlich, und dabei wunderbar.«
Ingrid bog auf einen Platz ein, dessen Boden von abgefallenen blauen Blüten bedeckt war, während sich im Blätterdach darüber gleichzeitig unzählige frische Blüten öffneten. Eine blaue Wolke, unter der Autos parkten.
»Wer Chaos und Widersprüche mag, ist in Marokko goldrichtig. Nimm zum Beispiel diese Jacarandabäume. Sie sind Schattenspender, schon klar, aber sind sie nicht zugleich eine Augenweide? Sicher hat man sie auch deswegen angepflanzt. Die Blüten halten nicht lange, verdrecken die Autos, faulen irgendwann … Ja und? Hauptsache, sie erfreuen Auge und Herz. Voilà, mein Hauptquartier: Büro, Lager und überhaupt Lebensmittelpunkt.« Sie deutete auf die schmalen Läden, die den Platz umrahmten. Über einer der Türen prangte der Name »Alphabétisation des Femmes«.
»Etwas theatralisch, dieser Name, nicht wahr? Aber für meine Spenderfirmen genau richtig. Und ein paar Straßen weiter liegt mein Appartement. Nur eine kleine Wohnung, doch ich hoffe, es wird dir bei mir gefallen.«
Doro kletterte aus dem Wagen. Rundum Asphalt, Beton und Autoblech, dazwischen Bäume und dunkelrote Erde, bedeckt von welkender Blütenpracht. Es stank aus den Gullys, und doch lagen zugleich die Frische des nahen Meeres und süßer Blumenduft in der Luft.
Neben Ingrids Büro saßen Händler zwischen Taschen und Wasserpfeifen vor ihren überquellenden Geschäften. Sie schlürften Tee aus kleinen Gläsern, warfen Ingrid Scherzworte zu und winkten freundlich. »Das sind meine Nachbarn Salamah, Abdu und Omar. Du wirst sie noch kennenlernen.«
Gegenüber schöpfte ein Junge mit beiden Händen Wasser aus einem Eimer und spritzte es über das Pflaster. Die Wassertropfen glitzerten in der Sonne wie flüssiges Silber. Doro hatte den Eindruck, einer archaischen Kulthandlung beizuwohnen. Ingrid war ihrem Blick gefolgt. »Gegen den Staub. Außerdem kühlt es die Luft.« Wie prosaisch.
Quietschend ruckten die Rollläden an Tür und Schaufenster von Ingrids Büro nach oben. Ingrid lachte. »Ibrahim! Woher weiß er, dass wir gerade angekommen sind? Er muss den sechsten Sinn haben.«
Groß und dünn, gekleidet in ein knöchellanges Hemdgewand, stand ein älterer, dunkelhäutiger Mann zum Empfang bereit.
»Ich bin Ibrahim, Lâlla1 Ingrids Helfer«, strahlte er und bot Doro auf einem Tablett Datteln und Milch an. »Willkommen in Marokko, bienvenue, Mademoiselle Dorothea. Le bäs, wie geht es dir? Tritt ein und bringe baraka ins Haus.« Er sprach eine wilde Mischung aus Französisch und etwas, das in Doros Ohren arabisch klang.
»Vielen Dank, ich bin aber keine Mademoiselle, ich bin einfach Dorothea«, sagte sie, »oder Doro, das ist noch besser.«
»Doro, wie Gold? Swuina, ein schöner Name. Er passt zu deinem Haar.«
»Wer zum ersten Mal ein masirisches Haus betritt, wird traditionell mit Orangenmilch und Datteln begrüßt«, erklärte Ingrid, »und mit dem Spruch ›Mein Haus ist dein Haus‹. So gehört es sich. Marokkaner sind nicht nur freundlich und hilfsbereit, sie legen auch Wert auf würdiges Verhalten.«
Doro trank von der Milch und aß eine Dattel, erst dann gab Ibrahim die Schwelle frei.
Im Inneren roch es nach Staub. Der Schreibtisch mit Telefon, Ordnern und Ablagen dicht an der Schaufensterscheibe bildete das Zentrum, im hinteren Bereich gab es einen Abstelltisch mit Kochplatte, Tellern und Gläsern, und an der Wand hingen Plakate und ein Porträt des marokkanischen Königs. Ingrids Reich.
»Nicht besonders komfortabel.« Ingrid öffnete die Tür zu einem fensterlosen Nebenraum. Im Licht der nackten Glühbirne erkannte Doro raumhohe Regale, darauf Kisten und Kartons, und in der Ecke ein Waschbecken und eine Matratze am Boden. »Wie gesagt, nichts Tolles, doch für meine Zwecke ausreichend. Und jetzt die entscheidende Frage: Hast du etwas mitgebracht?«
Doro deutete auf ihre prall gefüllte Reisetasche.
»Gutes Kind! Wir können jeden Kuli gebrauchen.«
Im Handumdrehen leerte sich die Tasche. Tuschkästen, Kugelschreiber und Blöcke wurden in Listen eingetragen, Hefte und Stifte sortiert. Ein Stück nach dem anderen wanderte ins Regal, während Ibrahim mit Wasserkocher und Teekanne hantierte und zugleich Doro unauffällig musterte.
Ingrid erzählte von ihren Fahrten über Land, von der Mühsal, behördliche Genehmigungen zu erhalten, von der Gastfreundschaft der Marokkaner, von der Armut auf dem Lande, der Freude der beschenkten Mädchen, der Scheu der zumeist blutjungen Lehrer, als liefe ihr das Herz über.
Jetzt nahm sie das silberne Schmuckstück aus der Tasche. Am Boden blieb nur die Mappe mit den Aquarellen zurück. »Eine Hand der Fatima«, erklärte Ingrid, die den Anhänger ausgewickelt hatte, »ein Amulett. Fünf Finger, siehst du? Der Zahl Fünf werden magische Kräfte zugeschrieben. Sehr schön, diese Gravuren. Sieh nur, Ibrahim.«
Ibrahim nahm den Anhänger behutsam, als sei er zerbrechlich, betrachtete ihn von allen Seiten, schließlich räusperte er sich. »Ein gutes gris gris«, sagte er. »Und du hast es wirklich aus Deutschland mitgebracht?«
Doro nickte.
Ingrid nahm die Mappe zur Hand und öffnete sie. »Und das hier? Was hat es mit den Bildern auf sich?«
»Später. Es ist eine etwas komplizierte Geschichte.« Doro legte die Mappe zurück und schloss die Tasche. Irgendwann würde sie Ingrid zu den Bildern befragen, aber nicht jetzt.
Sie wandte sich an Ibrahim. »Also ein Amulett? Und wofür hilft es?«
Der hagere Mann schien mit seinen Gedanken woanders zu sein. Er starrte Doro und Ingrid an. Dann besann er sich und hob seine Hand, Daumen und kleinen Finger leicht abgespreizt. »Al khamsa, die Fünf, hilft gegen den bösen Blick. Aber eigentlich ist es für alles gut.«
Ingrid lachte. »Ausgezeichnet, Schutz und Hilfe können wir schließlich alle gebrauchen. Ibrahim, besorg bitte ein Lederband bei den Nachbarn, dann hängen wir es Doro gleich um.«
Sie klang munter, aber nicht wirklich fröhlich. Etwas schien Ingrid auf der Seele zu liegen. Doro spürte es, schreckte jedoch vor Nachfragen zurück. Probleme und ihre Lösungen waren Ingrids Spezialgebiet, nicht ihres.
1 Siehe Glossar am Ende des Romans
Kapitel 3
Die dürren Äste der Akazie spendeten kaum Schatten. Wind kam auf, trieb Sand vor sich her, wirbelte ihn umher und legte ihn schließlich an einem Grasbüschel ab. Der junge Mann erhob sich aus seiner Kauerstellung und suchte den Horizont ab. Nichts. Sie waren jetzt seit fast zwanzig Stunden überfällig. Er schwang sich auf die unteren Äste der Akazie. Auch aus dieser erhöhten Position: Nichts. Hamada, leere Steinwüste und ewiger Wind.
Nach Osten wurde die Ebene begrenzt durch die Sanddünen des Erg, im Westen von den Steilküsten und Schwemmsanden des Atlantiks und im Norden, in seinem Rücken, von den Bergen des Atlas al Khalfiyah. Sie stemmten sich gegen den Sand aus den Tiefen der Sahara, der alles unter sich begrub, auch die Palmwedel, die den Weg zur Küste markieren sollten.
Solche Orientierungshilfen benötigte er nicht. Immer noch kannte er alle Pisten dieses Gebiets in- und auswendig, auch die, die parallel zur algerischen Grenze und weiter bis zum Atlantik verlief.
In London hatte er beeindruckende Satellitenfotos gesehen, die die Spur eines unter dem Sand verschwundenen Flusses nachzeichneten, der schon seit Jahren seine Mündung am Ozean nicht mehr erreicht hatte. Ihm folgte diese Piste. Eine andere Route, weiter südwestlich, führte in sechs, sieben Tagesetappen in die einstige Heimat der Sahraouis. Auch sie kannte er. Und versperrte nicht El Berm, die marokkanische Mauer der Schande, diesen Weg, er fände noch heute blind und im Dunkeln dorthin zurück!
Die Schatten wurden länger. Er rollte einen Kieselstein im Mund, um den Speichelfluss anzuregen. Seine Flasche war leer. Erst wenn die anderen eintrafen, konnte er mit Wasser rechnen.
Der Esel döste vor sich hin, nur gelegentlich schlug er mit dem Schwanz. War das abgemagerte Tier überhaupt kräftig genug für die schweren Lasten? Warum nur hatte er diesen Auftrag übernommen? Weil Mahmud ihn herausgefordert hatte? Wollte er ihm oder sich selbst etwas beweisen? Waffen über die streng bewachte algerische Grenze zu schmuggeln war riskant. Im Grunde aber machte ihm nicht so sehr die Gefahr zu schaffen. Er war im Begriff, gegen die Stimme seines Gewissens zu handeln, und das trieb ihn um.
Die Augen des jungen Mannes starrten in die Ferne, als versuchten sie, die hinter dem Horizont liegenden Landschaften zu erreichen. Was, wenn sie auch heute nicht kamen? Es gab keine Wasserstelle in erreichbarer Nähe. Er müsste mit leeren Händen umkehren. Mahmud würde falsch lächeln und erklären, er laste das Scheitern dieser Schmuggelaktion keinesfalls seinem alten Freund Sheïk Amir Tahar an. Garantiert aber würde er sich nicht verkneifen können, das leichte Leben in London hervorzuheben und zu behaupten, dort verlören offenbar selbst die Edlen der Sahraouis ihre ererbten Fähigkeiten. Dabei wäre Mahmud damals nur zu gern selbst nach London gegangen. Als man jedoch ihn, den nach Mahmuds Ansicht ohnehin privilegierten Sheïk-Sohn, dafür auswählte, begann sich sein latentes Minderwertigkeitsgefühl zu unversöhnlichem Groll zu wandeln.
Schon seit Kindertagen lebte Mahmud in Konkurrenz zu ihm, wegen jeder Nichtigkeit fühlte er sich gekränkt. Möglicherweise aber wurde es jetzt, da er in den Kreis der Polisario-Kommandeure aufgerückt war, endlich leichter für ihn.
Da, eine Bewegung. Amir kniff die Augen zusammen. Inmitten eines Sandnebels tauchten in der Ferne Schemen auf. Nachdem sein Blick sie einmal gefunden hatte, hielt er sie fest. Sie kamen näher, wurden zu menschlichen Gestalten, obwohl sie sich scheinbar ohne Bodenkontakt bewegten. Sie gingen gebeugt unter den geschulterten Lasten. Trotzdem bewegten sie sich gleichmäßig, nichts störte ihren Rhythmus. So gingen nur die Menschen der Wüste.
In ihren dunklen Gesichtern regte sich kein Muskel, als sie ihn endlich erreichten, die Verschnürungen ihrer Lasten lösten, die Kisten absetzten und sich neben Amir unter der Akazie niederließen.
Seit Mademoiselle Doros Ankunft beobachtete Ibrahim, wie Lâlla Ingrid aufblühte. Das gefiel ihm. In letzter Zeit war Lâlla Ingrid häufig geistesabwesend gewesen. War sie nicht gesund? Vermisste sie Deutschland? Jeder Mensch brauchte eine Heimat, wer wüsste das besser als er.
War Mademoiselle Doro gekommen, um Lâlla Ingrid nach Hause zu holen? Keine Lâlla Ingrid, keine Alphabétisation des Femmes … Was würde aus ihm werden, falls Lâlla Ingrid in ihre Heimat zurückkehrte? Schließlich hatte er hier eine Aufgabe, und eine bessere Tarnung als ihre Hilfsorganisation konnte man sich nicht wünschen. Davon abgesehen hatte er Lâlla Ingrid in sein Herz geschlossen, er würde sie schmerzlich vermissen. Manchmal wünschte er, er könnte sie ins Vertrauen ziehen, aber er hatte gelernt zu schweigen. Sollte er seine Befürchtungen Mahmud mitteilen? Noch nicht, vorläufig genügte es, wachsam zu bleiben. Und den Mund zu halten.
Alle schwiegen sie, Presse, Rundfunk, Fernsehen mussten mit der Zensur leben. Selbst französische Tageszeitungen mit unliebsamen Meldungen wurden schon an den Flughäfen abgefangen und vernichtet. Den Geheimdiensten des Königs entging nichts. Ihre Spitzel lauerten in der Moschee, im Café, auf der Straße – überall, sogar im Freundeskreis wog man seine Worte ab.
Er wusste, dass seine Lâlla Ingrid von der politischen Realität im Lande keine Ahnung hatte. Ebenso nicht von dem UN-Referendum oder den verminten Grenzen oder den Völkerrechtsverletzungen in der Westsahara. Westsahara? Ibrahim biss die Zähne zusammen, dass es schmerzte. Offiziell musste man seine Heimat seit 1975 »südliche Provinzen« nennen!
Jedenfalls schien Lâlla Ingrids Kummer zurzeit gelindert. Mademoiselle Doro munterte sie sichtlich auf mit ihrer Begeisterung, mit ihrem Staunen und ihren Fragen. Die junge Frau war harmlos. Mahmud hatte gemeint, diese Unbedarftheit sei ein Geschenk und es sei dumm, das nicht zu nutzen.
Ibrahim sah den beiden Frauen nach, die Arm in Arm über den Platz schlenderten. Und diese Hand der Fatima, die die junge Deutsche mitgebracht hatte und nun am Hals trug? Wie kam sie in ihren Besitz?
Nazar sherifa, das Auge der Edlen – er hatte es sofort erkannt. Wie auch nicht? Es sah genauso aus wie in der Überlieferung beschrieben, von den Gravuren bis zu dem Stein in der Mitte. Mit seinen Einschlüssen erinnere er an ein Auge, erzählte man.
Wie alle Kinder seines Stamms hatte auch er einst an den Lippen der Großmutter gehangen. Geschichtenerzählen war eine Kunst. Abend für Abend, wenn sie genügend trockene Kamelköttel für das Feuer gesammelt hatten, wenn im Zelt Ruhe eingekehrt war und alle sich um die Feuerstelle versammelt hatten, erzählte Großmutter.
Eine dieser Geschichten handelte von Nazar sherifa und dem Silberschmied aus Dakhla, der es einst aus Silber erschaffen hatte. Er hatte heilige Verse eingraviert und es mit einem kostbaren rauchblauen Augenstein verziert. Dieses gris gris sei eines Heiligen oder eines Königs würdig, so hieß es.
Die eigentliche Legende hatte er vergessen, er wusste nur noch, dass es von einem Sheïk zum anderen weitergereicht worden war, bevor es verschwand. Vor zwanzig Jahren dann, unmittelbar nach dem Massaker von Zemla, waren plötzlich die ersten Nachbildungen aufgetaucht.
Zemla. Ibrahim hob die Hände in Gebetshaltung und gedachte der Opfer dieses Blutbads. Er sah sie erneut vor sich, die Demonstranten in dem Vorort von El Aiyoun, sah, wie ihre Fahnen gegen den Himmel leuchteten, bevor sie in den Dreck sanken, sah, wie sich die Fahnenträger unter den Knüppeln der Legionäre krümmten, und hörte ihre Schreie.
Lange her, 1970 war er noch ein junger Mann gewesen. Doch wie damals roch er Sand und Pulver und Blut, und die Ohnmacht jenes Tages legte sich bleiern auf sein Gemüt.
Seine Onkel, den Großvater, alte Frauen und andere, deren Kräfte nachließen, hatte er am Ende des Protestzugs auf der Ladefläche seines Lastwagens eingesammelt. Von dort hatten sie mitangesehen, wie Hunderte Soldaten aus den Seitengassen vorrückten, wie sie die sahraouischen Demonstranten einkesselten, niederprügelten und zusammenschossen. Er hatte ihr Blut gesehen und das versteinerte Gesicht seines Großvaters, hatte gesehen, wie Freunde um ihr Leben rannten, und sich wie gelähmt gefühlt. Erst spät hatte er den Lastwagen wenden und die Alten in der Wüste in Sicherheit bringen können.
Ibrahim dachte an frühere Zeiten, an die Zelte der Familie, die Boote am Strand von Dakhla und die vollen Netze der Fischer. Er sah die lange Dünung des Meeres vor sich, roch den Rauch der Schmiede und hörte ihr metallisches Hämmern, das Zischen, wenn glühende Klingen, Haken und Ankerketten in Öl oder Wasser abgekühlt wurden. Schon immer lagen ihre Werkstätten abseits der Dörfer. Man nahm sich in Acht vor der Magie der Männer, die das Feuer beherrschten und Metalle verwandelten.
Bald nach dem Massaker von Zemla hatten sie begonnen, einfache Kopien von Nazar sherifaherzustellen. Seit damals diente es den shabiha als Erkennungszeichen – jenen gespensterhaften Männern, die wie aus dem Nichts erschienen und unerkannt ihre Anschläge durchführten. Er aber hatte das Original in der Hand gehalten. Warum tauchte esjetzt plötzlich auf, noch dazu in der Hand einer offensichtlich ahnungslosen Fremden? Allahs Wege waren unergründlich.
Das Telefon riss ihn aus seinen Gedanken. Hassan? Er rief selten an. Meistens schickte er einen Kurier. Ibrahim schloss die Ladentür und zog sich in den hinteren Teil des Raums zurück. »Ça va, Hassan, ist etwas passiert?«
»Man wird unruhig. Zwei Lieferungen sind überfällig. Ist bei dir auch wirklich alles gut?«
Hassan, der zu Mahmuds engsten Vertrauten gehörte, erkundigte sich nach den ausstehenden Lieferungen? Soweit Ibrahim wusste, kümmerte er sich normalerweise um den Ausbau des Flugfelds bei Gleibat El Foula. Ibrahim beruhigte ihn. »Kein Grund zur Sorge, mein Freund. Ich musste lediglich umplanen, um unsere neue, äh, Mitarbeiterin einzuarbeiten.«
Schweigen. Ibrahim hörte Hassans Atem, dann die vorsichtige Frage: »Eine Frau?«
»Al hamdullillah, ich verspreche mir viel von ihr.«
Tat er das wirklich? Schnell redete er weiter. »Eine junge Deutsche, unerfahren, aber nützlich. Du wirst sehen, bald gibt es für mich nichts mehr zu tun, und ich werde wie ein Urlauber am Strand faulenzen.« Ibrahim lachte.
Hassan lachte nicht mit. »Vertraust du ihr?«
Vertrauen, einer Fremden? »Verlass dich auf mich, mein Freund.« Ibrahim räusperte sich. »Abgesehen von dieser kleinen Verzögerung bleibt alles wie besprochen. Heute Nacht werden die Ladungen vervollständigt, ein Teil geht morgen auf die Reise, den anderen schicke ich einen Tag später los. Sind weitere Lieferungen zu erwarten?«
»Wie du selbst sagst, alles bleibt wie besprochen. Der Plan steht.«
»Allah schütze euch.« Ibrahim legte den Hörer auf.
Der Plan! Er sah Attacken entlang des Berm vor.
Während die Polisario dort an den Grenzanlagen Ablenkungsmanöver ausführte, konnten Hassans Pioniere unbemerkt das neue Flugfeld in den Dünen fertigstellen und das Kerosinlager anlegen. Hassans Männer benötigten noch etwa eine Woche, um die einzelnen Segmente der Landebahn vor Ort zu gießen. Eine Woche, und zwar jetzt, bevor es in der Wüste für Betonarbeiten zu heiß wurde.
Es eilte, der Start- und Landeplatz für die Kleinflugzeuge von den Kanaren musste endlich Wirklichkeit werden. Unbemerkt Waffen ins Land zu bringen wurde immer riskanter und teurer, selbst als Beiladung von Fischkuttern. Kapitäne und Hafenarbeiter ließen sich ihr Schweigen vergolden.
Ibrahim sah, dass Lâlla Ingrid und Mademoiselle Doro zurückkehrten. Sie hatten sich untergehakt und kicherten wie junge Mädchen. Er öffnete ihnen die Tür.
Beinahe hätte Amir den unauffälligen Kutter, der zu später Stunde einlief, übersehen. Jetzt aber ließ er die Estrella del Marnicht mehr aus den Augen. Reglos hockte er hinter Stapeln von Fischkisten, kaute an einem Stück miswak und wartete. Die Kauerhaltung entspannte ihn, und Geduld war jedem Sahraoui vertraut.
Die Tore des Hafens waren längst geschlossen, die Arme der Kräne erstarrt und das nachtdunkle Gelände menschenleer. Wasser gluckste, Seile knarrten, und hin und wieder hörte man einen Nachtvogel rufen, sonst gab es kein Geräusch.
Plötzlich ein Blinkzeichen. Ein Mann huschte durch die Dunkelheit. Das Entladen begann. Auf dem Schiff stemmten zwei Männer flache Kisten über die Bordkante, der andere hievte sie auf die Kaimauer.
Hinter einem der Schuppen wartete schon seit Anbruch der Nacht ein alter Lieferwagen. Jetzt erschien dort ein Mann und öffnete die Hecktüren des Autos. Ibrahim, der seit Jahren in Agadir als Agent der Polisario wirkte.
Bisher kannte er Ibrahim nicht persönlich, wusste aber um seinen guten Ruf und dass Mahmud diesem Mann dennoch plötzlich Verrat unterstellte. Seit zwei Tagen überwachte er ihn nun, ohne triftigen Grund, wie er fand, und vor allem ohne Beweise für Mahmuds Verdacht zu entdecken. Für morgen Abend war ein Treffen mit ihm vereinbart.
Aus den Schatten näherte sich der Oberaufseher des Fischereihafens, der seit Langem seine Hand aufhielt und doch bei Allah schwor, ein treuer Diener des marokkanischen Königs zu sein.
Laut Ibrahim entwickelte sich dieser Mann mit seinen Forderungen nach mehr Geld zu einem unkalkulierbaren Problem. Bei zwei Transporten pro Woche anstatt wie bisher einer Lieferung sehe er sich gezwungen, seinen Preis zu verdoppeln. Er könne die erhöhten Kosten plus das zusätzliche Risiko nicht allein tragen, müsse andere ins Vertrauen ziehen und mit ihnen teilen, hatte er ausrichten lassen. Ibrahim vermutete für die Zukunft weiter steigende Ansprüche, sogar Erpressungsversuche seien vorstellbar, hatte er gewarnt.
Für Amir klang das nachvollziehbar, nicht so jedoch für Mahmud. Er argwöhnte Betrug.
Bereits die zweite Nacht in Folge musste Amir in Mahmuds Auftrag die Vorgänge im Hafen beobachten, dabei hasste er jede Form von Bespitzelung. Und wer wusste das besser als Mahmud?
Doch sein Aufstieg in die Führungsriege der Frente Polisario war Mahmud zu Kopf gestiegen, so kam es Amir jedenfalls vor. In anderer Hinsicht allerdings – etwa bei der Organisation der Waffentransporte oder der Ausbildung junger Kämpfer – machte er seine Sache gut. Deshalb und auch um unnötige Debatten zu vermeiden, hatte Amir dieser nächtlichen Schnüffelei zugestimmt. Kämpften sie denn nicht gemeinsam für die eine große Sache? Unabhängigkeit der Westsahara, darum ging es doch. Und um politische Anerkennung ihrer Regierung, um Freiheit für das Volk der Wolken und um Rückkehr aus dem Exil. Diese Ziele würde er niemals aus den Augen verlieren, mochte der Weg dorthin noch so lang und dornig sein.
Amir reckte den Hals. Ibrahim und der Vorarbeiter redeten. Geduckt schlich er näher. Verstehen konnte er nichts, doch die angekündigten zehn Kisten auf der Ladefläche des Autos konnte er erkennen. Eine Spende des großen libyschen Bruders zur Unterstützung ihres heroischen Freiheitskampfes, hatte Mahmud getönt. Heute zehn Kisten plus jene, die er neulich über die Grenzpiste geleitet hatte, das ergab insgesamt zweihundert Kalaschnikows mit Munition.
Jetzt hob Ibrahim die Hände gen Himmel, als riefe er Allah als Zeuge an, der Vorarbeiter streckte seine Hand aus, Ibrahim legte ein Bündel Geldscheine hinein, und schon gingen sie auseinander. Amir begab sich zurück in sein Versteck.
Auch wenn er diesmal eher indirekt beteiligt war, so hatte er sich doch bereits zum zweiten Mal in die Beschaffung von Gewehren hineinziehen lassen. Heiligte der Zweck wirklich jedes Mittel? Sollte die Zukunft seines Volkes, der A hel es Sahel, mit Waffen gestaltet werden oder ausschließlich durch Verträge? In dieser Frage konnte er zu keiner eindeutigen Haltung finden.
Mahmud und seine FrentePolisario behaupteten, erst mit der marokkanischen Invasion vor dreizehn Jahren hätten die Sahraouis begonnen, als Volk zusammenzufinden, der bewaffnete Kampf befördere und stärke also das nationale Bewusstsein.
Einiges sprach für diese Argumentation. Seit Menschengedenken waren die sahraouischen Nomaden unabhängig gewesen, und jeder Mann hatte Sitz und Stimme bei den Beratungen. Sie lebten sozusagen eine natürlich gewachsene Demokratie, aber hatten sie sich deshalb als Nation gefühlt?
Es hätte sich gelohnt, darüber nachzudenken, zumal sich die Zeiten gerade grundlegend änderten, doch für theoretische Überlegungen war jetzt nicht der ideale Moment. Zumindest das Ziel war klar, und wie Tausende war auch Amir bereit, dafür seine Kraft einzusetzen.
Für ihn hieß das überwiegend Öffentlichkeitsarbeit. Er nahm an Konferenzen teil und verfasste Berichte für internationale Bündnispartner, außerdem schrieb er Abhandlungen für ausländische Magazine, sammelte und veröffentlichte Fakten, stellte richtig, klagte an. Niemand sollte das Unrecht vergessen können, das Marokko über das sahraouische Volk gebracht hatte.
Seit Kurzem wurde die Idee einer Wirtschaftsgemeinschaft des Maghreb neu belebt, einer Union du Maghreb Arabe. Derzeit liefen bereits die Vorgespräche zur Gründungskonferenz in Marrakesch, und er, Sheïk Amir, sollte im Auftrag der sahraouischen Regierung daran teilnehmen. Neben Delegierten aus Algerien und Tunesien würden auch mauretanische und libysche Abgesandte anwesend sein. Sie verhielten sich diplomatisch, um die Marokkaner nicht unnötig zu verärgern, plädierten aber doch mehr oder weniger offen dafür, nicht nur das Post- und Fernmeldewesen mit der Demokratischen Arabischen Republik Sahara, der DARS, vertraglich zu regeln, sondern auch weitergehende Wirtschaftsfragen zu diskutieren. Natürlich galten ihre Hauptinteressen – neben den unerschöpflichen Fischgründen – den Phosphatlagern von Bou Craa, das war jedem klar, und natürlich konnte man über die Ausbeutung dieser Bodenschätze verhandeln. Sollten solche Verhandlungen jedoch überhaupt eine Chance haben, müsste zuvor die neue Wirtschaftsunion die DARS als souveränen Staat anerkennen.
Auf diesem Ohr aber hörten Männer wie Mahmud schlecht.
Amir sah den einstigen Freund vor sich, breitbeinig, das Kinn vorgereckt, wie er seine Zuhörer fixierte. »Auf Konferenzen setzen, auf Beschlüsse der UNO? Nichts anderes tun wir doch seit November 1975!«, hatte er gerufen. »Hat sich in dieser Zeit etwas verändert? Seit damals, seit dem gottverdammten Grünen Marsch, verschwinden unsere Männer im Gefängnis, während König Hassan im großen Stil marokkanische Bauern auf unserem Land ansiedelt. Schon bald werden in unserer Heimat mehr Marokkaner leben als Sahraouis! So wird jede Volksabstimmung zur Farce!«
Er spuckte aus. »Haben wir nicht längst unseren eigenen Staat gegründet? Und erkennen ihn nicht bereits viele Länder der Welt an?« Er hob die Hände in Predigermanier. »Zu diesem Referendum wird es niemals kommen. Denn worum geht es wirklich? Der marokkanische König giert nach Bodenschätzen. Und nach Land, nicht nur nach unserem, auch nach algerischen, malischen und mauretanischen Gebieten. Er träumt von einem ›Grand-Maroc‹, einem Riesenreich vom Mittelmeer bis zum Senegalfluss. Er brennt nach Macht und danach, seinen persönlichen Reichtum zu mehren. Dazu ist ihm jedes Mittel recht.«
Besser als andere wusste Amir, wie recht Mahmud hatte. Erst kürzlich hatte ihm ein amerikanischer Reporter ein Videoband zugespielt. Darin antwortete König Hassan auf die Frage des Journalisten, ob sich Marokko Verhandlungen mit der Polisario vorstellen könne: »Verhandeln? Wir werden sie verschlingen!«
Immerhin, der gemäßigte Flügel um den Präsidenten der Sahraouischen Republik hatte es trotzdem geschafft, dass über eine endgültige Waffenruhe verhandelt wurde. Etliche westliche Zeitungen und Fernsehkanäle hatten Korrespondenten nach El Aiyoun entsandt, die über diese Verhandlungen berichteten. Dank seiner, Amirs, guten Kontakte erlangte die Konferenz inzwischen internationales Interesse.
Hassan II., dem marokkanischen König, war nicht zu trauen, doch in diesem Fall hatte sein Renommeeauf dem Spiel gestanden. Er war nicht umhingekommen, ebenfalls Unterhändler nach El Aiyoun zu entsenden. Erstmals saßen nun Marokkaner, Algerier, Mauretanier, sahraouische Abgeordnete und natürlich die UNO an einem Tisch!
Gleichzeitig aber, und das machte Amir besonders zu schaffen, landeten am Verhandlungsort marokkanische Flugzeuge im Stundentakt. Tonnenweise schafften sie Nachschub für die Besatzungsarmee herbei, kaum getarnt und unbehelligt.
Warum berichteten die internationalen Beobachter vor Ort nicht darüber, warum dokumentierten die Kameras der Weltpresse keine dieser Lieferungen? Durchschaute denn niemand das Doppelspiel des marokkanischen Königs?
Freie Presse?, hatte Mahmud gehöhnt. Amerikaner und Europäer seien genauso korrupt wie der Rest der Welt, und wer das nicht wahrhaben wolle, sei ein Träumer.
Amir hatte die bittere Wahrheit hinter Mahmuds Worten gespürt. Natürlich sah er sich selbst nicht als Träumer, eher als Idealist, dennoch hatte er Mahmuds Auftrag akzeptiert. Er würde diese Waffen bis ans Ziel begleiten. Danach aber stand er für die Polisario nicht mehr zur Verfügung.
Auf der Estrella del Marwurden die Luken geschlossen. Hinter dem Schuppen startete Ibrahim den Wagen und rollte ohne Licht aus dem Fischereihafen.
Die Nacht war lang. Erst mit dem einsetzenden morgendlichen Verkehr überkletterte Amir den Zaun des Hafenareals, sprang auf die andere Seite der Straße und nahm durch Gestrüpp und Steine den Weg bergauf zur alten Kasbah von Agadir. Wer sich auskannte, war in ihren Ruinen und eingestürzten Kellern sicher.
Kapitel 4
Nach zwei Wochen hatte Doro alle Sehenswürdigkeiten der Stadt erkundet, hatte an Ingrids Seite die Trümmer der alten Kasbah besichtigt, war durch Hafen, Markthallen und den souq gestreift. Sie war im Meer geschwommen, hatte Postkarten verschickt, und sie hatte gelernt, mit den Fingern zu essen. Wie unkompliziert hier alles war, wie friedlich die Leute und wie wunderbar die Sonne, die Farben und Düfte.
Deutschland, das vergangene Jahr, die bedrückenden Zukunftsfragen – jeden Tag entfernte sie sich ein Stück weiter davon. Manchmal streiften sie Gedanken, was ihre Mutter wohl zu diesem Farbenrausch gesagt hätte, zu diesem Menschengewimmel und dem Sprachengewirr. Hätte sie es genossen oder sich geängstigt? In solchen Momenten, meistens kurz vor dem Einschlafen, war ihr das Herz schwer. Doch mit dem Licht des Morgens schwanden Wehmut und Trauer.
Nur zu gern überließ sie sich dem Sog dieses Landes. Sie freute sich auf jeden neuen Tag, und sie lachte viel. Hatte sie in den vergangenen Monaten überhaupt jemals gelacht? Zu Hause wirkten ihre Probleme bedrückend, hier hatten sie kaum Bedeutung. Diese Leichtigkeit wollte sie sich erhalten, auch deshalb schob sie das Gespräch mit Ingrid vor sich her.
Heute ging es endlich los. Nach einem Fahrtraining unter Ibrahims strengen Augen und versehen mit Ingrids Erklärungen und Ibrahims Ermahnungen durfte sie erstmals allein zu einer der kleinen Dorfschulen fahren. Es handelte sich um eine Tagestour und, wie Ibrahim sagte, um die Vorbereitung auf größere Aufgaben. Was er damit andeuten wollte? Ibrahim winkte ab.
Doro ließ die protzigen Villen am Stadtrand hinter sich, die hinter hohen Mauern liegenden weiten Areale von Golfplatz und Königspalast und bog auf die Überlandstraße Richtung Süden ein. Hier begann es mit der Armut, der Ödnis, mit dem Staub, mit den winzigen Dörfern hinter Kaktushecken und den barfüßigen mageren Kindern. Drei Mal hatte sie Ibrahim bereits zu abgelegenen Dorfschulen begleitet, ihr war klar, was sie erwartete. Das schroffe Nebeneinander von knalligem Grün und staubigen Feldern, von ausgedörrten Flusstälern neben üppigen Oasengärten war beunruhigend, gleichzeitig konnte sie nicht anders, als die wilde Schönheit der Landschaft zu bewundern.
Die Sonne brannte, auf den winzigen Feldern verdorrte das Viehfutter bereits auf dem Halm zu Heu. Das Dorf bestand aus einer Ansammlung von Häusern aus Feldsteinen und Lehm, dazwischen enge, steile Wege. Der letzte Sturzregen hatte Brücken und Stege zerstört, so dass sie Mühe hatte, das winzige Schulgebäude zu erreichen. Es war das einzige im Umkreis vieler Kilometer und leuchtete im typischen Himbeerrosa aller Dorfschulen. Im Handumdrehen war sie umringt von Kindern, die wie junge Zicklein umhersprangen.