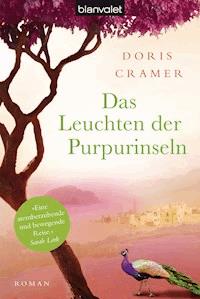8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Marokko-Saga
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Sonnendurchflutete Wüste, stahlblaues Meer und eine junge Frau, die dem Lied ihres Herzens folgt ...
Margalis und M’Bareks Liebe darf nicht sein. Man hält sie nicht nur für Geschwister, M‘Barek ist außerdem einer anderen versprochen. Um seine Zukunft nicht zu gefährden, trifft Margali eine folgenschwere Entscheidung: Als Mann verkleidet flieht sie an Bord eines Schiffes nach Tunis. Dort will sie von vorn beginnen und bei einer berühmten Musikmeisterin ihren Traum, die arabische Laute perfekt spielen zu können, verwirklichen. Doch dies ist ein gefährlicher Weg – und das Geheimnis um Margalis Geburt muss um jeden Preis gewahrt bleiben, denn die Wahrheit würde Schande über ihre Mutter Sarah und den ganzen Berberclan bringen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 674
Ähnliche
DORIS CRAMER
Das Lied der Dünen
Roman
1. Auflage
Deutsche Originalausgabe Juli 2015 bei Blanvalet,
einem Unternehmen der Verlagsgruppe Random House GmbH, München.
Copyright © 2015 by Blanvalet Verlag,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH, München
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur
Thomas Schlück, Garbsen.
Umschlaggestaltung: © www.buerosued.de, München
Redaktion: Andrea Stumpf
ED · Herstellung: sam
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN: 978-3-641-15786-9
www.blanvalet.de
Jede Kultur ist anders, aber niemals falsch.
(Autor unbekannt)
Gewidmet meinen Lesern, besonders jenen, die mit offenem Herzen reisen. Und meinem lieben Richard.
1. TEIL
SOMMER 1565, NORDAFRIKA
1
Gewaltige Mauern umgaben die Stadt, über deren Dächern die spanische Festung mit mächtigen Wachtürmen und Zinnen, mit Toren und Schießscharten thronte. Getreue des marokkanischen Sultans* und Bauern aus dem Hinterland behaupteten, sie erdrücke Bewohner und Hafen, andere hingegen verließen sich nur zu gern auf den Schutz der Spanier und ihrer Truppen. Viel zu schützen oder zu bewachen gab es derzeit allerdings nicht, trotz der beunruhigenden Kriegsnachrichten dümpelten außer einer spanischen Galeere lediglich zwei alte Segler und einige Fischerboote im Hafen. Schon im Morgengrauen hatten die Fischer ihren Fang angelandet und auf den Märkten verkauft. Inzwischen brannte die Sonne von ihrem höchsten Punkt auf Gassen und Mauern, und wer konnte, suchte Schatten. Die Zeit der mittäglichen Ruhe war gekommen.
Nicht so im Haus von Sheïk Saïd Aït el-Amin. Zwar brannte auch hier die Sonne, sodass sich die Katze in den Schatten des Aprikosenbäumchens zurückgezogen hatte, doch der Küchenbereich bebte vor Geschäftigkeit, und der Lehmofen glühte. Die Köchinnen bereiteten ein Festmahl vor. Sie klapperten mit Tellern und Küchengerätschaften, kneteten und rührten, und sie lachten bei der Arbeit. Düfte von mariniertem Lamm, von Salzzitronen, Mandelcreme und Honigbällchen zogen durch das Haus. In allen Räumen wurden Teppiche geklopft, Kissen und Polster aufgeschüttelt und sämtliche Ecken und Winkel von Staub befreit.
Margali saß in der Tür ihres Zimmers, die honigfarbene Oud im Arm. Sie konnte das Wiedersehen mit ihrem großen Bruder kaum erwarten und übte, tief über das Griffbrett gebeugt, ihr Willkommenslied. Zunächst rankte sich die Musik wie gewünscht aufwärts und dehnte sich dabei weit nach allen Seiten aus, gleich darauf allerdings verlor das Spiel seine Feinheit. Etwas klang falsch. Dieses Lied sollte in den Höhen strahlen, luftig und leicht wirken. Sie kontrollierte die Stellung ihrer Finger, dann schlug sie die Saiten erneut an und folgte den Tönen. Woran lag es, dass sie sich ausgerechnet im oberen Bereich schwer und beinahe stumpf anhörten? An den mitschwingenden tiefen Saiten oder doch eher an ihrem angespannten Handgelenk, den Fingern, denen es an Geschmeidigkeit fehlte? Dabei dehnte und kräftigte sie bei jeder Gelegenheit ihre linke Hand. Immerhin galt es, Doppelsaiten zu greifen, und das gelang allein mit starken und zugleich biegsamen Fingern.
Ein gutes Instrument, feinfühlige, kräftige Hände und empfindsame Ohren – daraus bestand das Vermögen eines Musikers. Und natürlich aus der Vorstellung, wie etwas klingen sollte. Daran mangelte es ihr nicht. Oft war ihr, als bestünde die Welt aus Klängen, häufig drängten sich Melodien sogar in ihren Schlaf. Sie hörte sie und konnte sie nach dem Erwachen summen, auf der Oud jedoch brachte sie nichts zustande, das Ähnlichkeit mit dem hatte, was sie in ihrem Inneren vernahm. Dennoch versuchte sie sich wieder und wieder daran. Man müsse sich einfach vorstellen, dass man es schafft, hatte M’Barek sie früher ermuntert. Daran hielt sich Margali bis heute.
Für sie ging es nicht nur um dieses eine maqam, diese Liedfolge, zu der sie eine fröhliche Begleitung auf der Oud erdacht hatte. Ihr ging es um mehr: um ihren heimlichen Traum, eine anerkannte Musikerin, eine gute Sängerin und gefühlvolle Oudspielerin zu werden. Je gründlicher sie sich mit der Oud und allgemein mit Musik beschäftigte, desto größer wurde ihr Verlangen nach wahrer Kunstfertigkeit. Mit jeder gelungenen Passage oder Variation wuchs dieser Wunsch, wurde mächtiger, sodass sie manchmal an nichts anderes mehr denken konnte.
Leider gab es in ganz Melilla niemanden, der sie die Feinheiten des Oudspiels hätte lehren können, außerdem missfiel es ihrer Mutter, wenn sie sich stundenlang mit dem Instrument beschäftigte. Ihr bedeutete Musik nichts, und von Musikern hatte sie eine schlechte Meinung. Ginge es nach Umm Sarah, müsste Margali mehr Zeit mit ihren Freundinnen verbringen oder, noch besser, sich praktischen Dingen widmen. Wie sollte sie ausgerechnet ihr diese Sehnsucht verständlich machen? Die Magie von Musik – darüber konnte sie mit niemandem sprechen, am wenigsten mit ihrer Mutter.
Auch ihre Großmutter, Melala Mirijam, hielt sich zurück bei diesem Thema. Doch falls sie wirklich Umm Sarahs Ansichten über Musik teilte, warum hatte sie Margali dann überhaupt von dem bevorstehenden Auftritt spanischer Musiker im Palast des Gouverneurs erzählt? Aus irgendeinem offiziellen Anlass sollten dort demnächst spanische Lautenmusik und Weisen auf der arabischen Oud erklingen. Margali hatte Abu Saïd lange in den Ohren gelegen, bis er schließlich versprach, ihr und Melala Mirijam Zutritt zu der Aufführung zu verschaffen. Seither füllte die Hoffnung auf neue Erkenntnisse und auf Wissen Margalis Herz. Der Gobernador hatte sicher besonders versierte Musikanten eingeladen, sie durfte also schönste Musik erwarten, ergreifend und in Vollendung … Man sollte nicht nach den Sternen greifen, hatte sie gelernt, und doch konnte sie nicht anders.
Wenn nur M’Barek endlich käme! Ihm könnte sie von ihrem Traum erzählen, ihm anvertrauen, was sie bewegte und was sie den Eltern vorenthielt. Seitdem sie denken konnte, verließ sie sich auf ihn, zählte sie auf sein Verständnis, mehr noch, existierte diese besondere Verbindung zwischen ihnen. Sicher half und riet er ihr auch diesmal. Ermutigt griff sie erneut nach ihrer Oud.
Mit geschlossenen Augen betastete sie ihr Instrument. Sie strich über den abgeknickten Hals und die Wirbel und fuhr über den gewölbten, aus schmalen Spänen zusammengefügten Körper und die feinen Intarsien rund um die Schalllöcher. Abu Saïd hatte ein wunderschönes Instrument für sie anfertigen lassen. Rund und leicht lag es in ihren Armen, und wenn sie die Saiten anschlug, vibrierte es, als sei es lebendig.
Noch einmal begann sie zu spielen. Die Töne jedoch, die sie hervorbrachte, klangen dumpf und trugen nicht weit.
*
Seitdem Saïd ihrer Tochter dieses Instrument zum Geschenk gemacht hatte, gab es für das Mädchen nichts anderes, dachte Sarah, auch jetzt drangen einzelne Töne bis zu ihr herauf. Doch nicht daran wollte sie denken.
Sie wollte ausruhen, sich auf der Dachterrasse den Düften und Farben der vielen Blumen hingeben und dem Anblick der Wolken. Sie segelten über den klaren Himmel, doch landeinwärts würden sie in der aufsteigenden Hitze vergehen. Dieser Sommer war sehr trocken gewesen, nun hatte er seinen Höhepunkt bereits überschritten. Nicht mehr lange und der Aufbruch nach Sijilmassa stand bevor.
Wie immer verbrachte die Familie den Sommer hier an der See und die Wintermonate in der Wüste, und nach den langen Wochen im geschäftigen Melilla freute sie sich bereits auf die Stille, auf die Weite der Dünen, das satte Grün der Oase und auf die trutzige Kasbah, die Familienburg oberhalb der Stadt. Sie liebte beides, ihr Leben in Melilla wie das in Sijilmassa, und war sich wohl bewusst, wie begünstigt sie war. Warum also diese Melancholie? Vielleicht weil die Wochen von Jahr zu Jahr schneller vergingen? Zumindest kam es ihr so vor. Unter ihre Vorfreude auf M’Bareks Heimkehr mischte sich leise Wehmut. Sie seufzte.
Heute galt es, das Willkommensfest für M’Barek vorzubereiten, nach vier langen Jahren kehrte er zurück, hatte der Junge durch Boten angekündigt. Sarah freute sich aufrichtig, ihren Ziehsohn endlich wieder in die Arme schließen zu können. Ob er ihre mütterliche Umarmung jedoch noch duldete? Er musste erwachsen geworden sein, zu einem Mann gereift. Wie schnell die Zeit vergangen war!
Margali zum Beispiel war mit ihren inzwischen beinahe siebzehn Jahren zu einem schönen jungen Mädchen herangewachsen. Sie war ein liebes Kind, allerdings für sie als Mutter mit viel zu viel Einfühlungsvermögen und einer überbordenden Phantasie ausgestattet. Ob diese Empfindsamkeit nicht doch etwas mit ihren Augen zu tun hatte?
Sarahs Gedanken schweiften ab. Vor Jahren hatte Margali einmal einen weisen Mann zu ihren verschiedenen Augenfarben befragt. Immer wieder hatte sie von ihren »Teufelsaugen« sprechen gehört und erlebt, dass sich Menschen bei ihrem Anblick schützten, so als habe sie den bösen Blick. »Was ist falsch an mir?«, hatte sie unter Tränen gefragt.
»Nichts. Richtig und falsch liegen so weit auseinander wie Auge und Ohr«, hatte der alte amusnaw geantwortet. »Oder wie deine Augen, die dir die Welt in unterschiedlichen Färbungen zeigen, je nachdem, durch welches Auge du siehst. Doch bedenke, Bilder können lügen, wie trügerische Fata Morganas beweisen. Das Ohr aber erkennt die Wahrheit.«
Margali kamen seine Worte entgegen, da sie sich ohnehin von Tönen angezogen fühlte. Von klein auf hörte sie rundherum Klänge, im Rauschen der Palmen, im Plätschern der Bewässerungsgräben und auch sonst überall, und die Trommeln, Flöten, Zimbeln und dreisaitigen guembris bei den Festen versetzten sie in einen Rausch. Suchte man Margali, fand man sie dort, inmitten der Musiker, Tonerzeuger und Geräuschmacher.
Sarah stand dem kritisch gegenüber. Musik, was war das schon? Man schlug die Trommeln, klapperte mit Schellen, bis es in den Ohren schmerzte, und zupfte an irgendwelchen getrockneten Tierdärmen – kein Wunder, dass Menschen, die das taten, nicht gerade in hohem Ansehen standen.
Zudem sah Sarah mit Sorge, dass Margalis Eigenschaften ausnahmslos in ein und dieselbe Richtung wiesen: auf das Herz, den Sitz der Gefühle. Und nun kamen auch noch ihre Oud und die Musik hinzu? Manchmal erzählte Margali etwas von Schwingungen und davon, dass ihre Oud »sprach« … So etwas konnte sie nicht gutheißen, ihre Erfahrungen hatten sie gelehrt, dass man mit Nüchternheit allemal weiterkam. Karim, ganz der Sohn seines Vaters, konnte Verstand und Herz wunderbar miteinander verbinden, und auch die kleine Dalila ließ bereits Einsicht und Vernunft erkennen, Margali dagegen war sogar ihr, der Mutter, ein Rätsel.
Ihre eigenen Erfahrungen entstammten dem Zusammenleben innerhalb einer sehr kleinen Familie, schließlich war sie das einzige Kind ihrer Eltern. Was für ein Gegensatz zu den großen masirischen Clans und zur Familie der Aït el-Amins. Ein festes Band schlang sich um ihre Mitglieder. Diese Gemeinschaft und der Zusammenhalt selbst mit den entferntesten Verwandten, so hatte es ihr Saïd vor Jahren erklärt, bildeten ein Bollwerk gegen Gewalt und Not und sicherten seit Urzeiten das Überleben. Mit Saïds Hilfe hatte auch sie gelernt, wie man rücksichtsvoll und achtsam in einem größeren Familienverband miteinander umging. Man unterstützte sich gegenseitig, übte Höflichkeit und Diskretion und bewahrte und stärkte so das Zusammengehörigkeitsgefühl. Längst empfand sie sich als Teil dieses masirischenFamiliensystems.
Neben Saïd gehörten die vier Kinder seines verstorbenen Bruders, Cherif und M’Barek, Amina und Safia, zu ihrem Lebensmittelpunkt. Außerdem natürlich Margali, die sie mit in die Ehe gebracht hatte, sowie ihre beiden Kleinen, Karim und Dalila. Klein?, dachte sie wehmütig lächelnd. Karim lebte mit seinen dreizehn Jahren längst überwiegend an der Seite seines Vaters, und Dalila war auch schon neun Jahre alt.
M’Barek, das jüngste von Saïds Bruderkindern, stand ihrem Herzen besonders nahe. Wie sich damals seine Hand in die ihre geschoben hatte, und wie der elternlose kleine Junge mit zaghaftem Lächeln zu ihr aufgesehen hatte – ihr war, als sei das erst gestern gewesen. Mit ernster Miene hatte er um Erlaubnis gebeten, zu Saïd Abu, Vater, sagen und sie mit Umm Sarah, Mutter, ansprechen zu dürfen.
So hatte sie seinerzeit mit der kleinen Margali auf dem Arm und mit M’Barek an der Hand die ersten Schritte in ihr neues Leben an Saïds Seite getan. Ohne Saïds Geduld und Vertrauen, vor allem aber ohne ihrer beider wachsender Liebe hätte sie die Herausforderungen bestimmt nicht bewältigt. Auch M’Barek war ihr dabei eine Hilfe gewesen. Damals hatte er die kleine Margali kurzerhand huckepack genommen und, so kam es ihr heute vor, für Jahre nicht mehr heruntergelassen. Unvorstellbar, wie lange das zurücklag.
Unten im Hof nahm der Lärm zu, Fatima rief etwas, ein Kessel schepperte, die Köchin lachte, und sie hörte ihre Mutter sprechen. Sarah erhob sich, die Mittagsruhe war vorbei. Die Tafel musste hergerichtet, Honigkringel gebacken und Säfte gekühlt werden. M’Barek kehrte heim!
*
Er kam über die Berge, passierte Dörfer und Schluchten und rastete bei Köhlern, bei Hirten oder einem der Bauern. Es waren verschlossene Menschen, einfache Masiren voll stolzer Zurückhaltung. In ihrer Bergwelt war Vorsicht, sogar Misstrauen durchaus angebracht, das Gastrecht aber stand über allem. So gaben sie ihm zu trinken und zu essen und boten ihm Schutz in der Nacht, seine Fragen zu ihren Mühlen jedoch, zu ihren Brunnen und Hebeanlangen oder zur Bewässerung ihrer Felder beantworteten sie eher zurückhaltend.
Er nahm ihre teils seit Generationen bewährten Methoden mit Staunen zur Kenntnis. Gerade in schroffem Gelände mit tiefen Schluchten hatten sie Lösungen für die Bewässerung ihrer Äcker und Gärten entwickelt, archaisch und häufig nicht von langer Dauer, deren Leistung der zeitgemäßen Technik dennoch kaum nachstand. Längst pumpte man andernorts das Wasser bergauf, zumindest etappenweise über jeweils geringe Höhenunterschiede, hier behalf man sich jedoch nach wie vor mit Schöpfrädern, Eimerketten und schlecht abgedichteten Holzrinnen. Und obwohl seine Liebe den neuesten technischen Errungenschaften gehörte, nötigten ihm die Fähigkeiten der Alten Respekt ab. Wie schon häufig fand er sich auch hier inmitten des Gegensatzes zwischen traditionellem Denken und neuen Erkenntnissen.
Sein Blick wandte sich ab von den vor Hitze wabernden Hängen. Der Kopf seines Pferdes nickte in immer gleichem Takt, Steine schlugen aneinander, und die Verschnürungen der Packtaschen knarrten. Diese Geräusche sowie der allgegenwärtige Zikadenlärm wirkten einschläfernd, doch Wachsamkeit gehörte zum Überleben. Das war ihm von klein auf vertraut. Man musste umsichtig sein und entschlossen handeln, wollte man in der Wüste überleben. Wie alle wesentlichen Regeln hatte ihm auch diese Abu Saïd beigebracht, sein Onkel.
Umm Sarah und Abu Saïd, die ihn und die Geschwister nach dem Tod von Vater und Mutter zu sich genommen hatten, waren zu seinen Eltern geworden. Sie hatten ihn gefördert und getröstet, ermutigt und unterstützt. Abu Saïd hatte ihn gelehrt, ein aufrechter Masir zu werden, ein Mann, der Verantwortung übernahm und das Richtige tat. Inzwischen sprachen nicht einmal mehr die Alten in Sijilmassa von seinen leiblichen Eltern, Allah schenke ihnen die ewige Ruhe, in ihren Augen und vor denen der Welt war er Abu Saïds Sohn. Dieser Status brachte Vorteile, aber auch hohe Erwartungen mit sich, wie die Treuepflicht, die ein Mann unter allen Umständen zu erfüllen hatte.
M’Barek starrte in die Ferne. Er war der Älteste, und er wusste, Abu Saïd hatte ihn, M’Barek, für den Fall seines Todes als neuen amghar von Sijilmassa bestimmt, verantwortlich für das Tafilalt, sowie als Oberhaupt der Familie. So verfuhr man seit alters her.
Er aber fühlte sich zu anderem berufen. Folgenschwere Gespräche lagen vor ihm, sogar Auseinandersetzungen, und sie würde nicht leicht werden. Sein Gesicht verhärtete sich. Seit seinem Reiseantritt legte er sich die richtigen Worte zurecht und prüfte Argumente, mit denen er Abu Saïd überzeugen konnte. Er wollte ihn nicht kränken, nichts lag ihm ferner! Gleichwohl musste er seiner Bestimmung folgen.
Durch sein Studium in Féz hatte sich ihm eine neue Welt mit aufregenden Erkenntnissen eröffnet. Tag für Tag hatte es unendlich viel zu lernen, zu lesen und zu experimentieren gegeben. Nicht nur über die Eignung verschiedener Baumaterialien hatte er geforscht, auch verblüffende Mechaniken hatte er erprobt und entwickelt und viel Nützliches und Spannendes kennengelernt, sowohl auf Reisen wie in der ehrwürdigen Gelehrtenstadt. Die Jahre des Lernens waren rasch vergangen.
Und jetzt hatte sein Lehrer Sîdi Larbi die Tür zu einer strahlenden Zukunft für ihn aufgestoßen, wollte ihm einen Platz an der Seite der angesehensten Männer des Wissens verschaffen. Gemeinsam mit ihnen zu arbeiten, zu forschen und zu leben, hochgeschätzt und bewundert wie sie – was für eine Aussicht!
Zunächst müsse er jedoch mit seiner Familie ins Reine kommen, hatte Sîdi Larbi gefordert. Mechanik, Technik im Allgemeinen, die Wissenschaften an sich seien das eine. Das andere seien Traditionen, auch sie hätten ihre Berechtigung, hatte er gemeint, und mit den Erwartungen eines Vaters dürfe man nicht fahrlässig umgehen. »Bleibe einige Zeit bei deinem Vater«, hatte sein alter Lehrer gemeint. »Der Prophet, Allah sei seiner Seele gnädig, sagt: ›Wir haben dem Menschen aufgetragen, seine Eltern gut zu behandeln.‹ Ich gebe dir also ein Jahr, um deinen Pflichten als Sohn zu genügen.«
M’Barek hatte sich jedoch längst entschlossen. Er kannte seinen Platz, auch wenn das bedeutete, seinen geliebten Abu Saïd enttäuschen zu müssen. Möge Allah ihm die Kraft geben, das zu ertragen.
Inzwischen lagen die Ebenen der Küstenregion vor ihm, Wind kam auf, und ein Hauch von Salzluft mischte sich mit dem Staub und den würzigen Düften der Berge. Und als die Sonne im Westen stand, tauchten die Mauern und Türme von Melilla auf.
Die Torwächter unterbrachen ihr Würfelspiel nur kurz, nach einem prüfenden Blick winkten sie ihn durch. In den dunklen Gassen hinter dem Tor trieb sich Bettelvolk herum, Unrat sammelte sich in Ecken, und vor Tavernen lungerten Spieler und Säufer. Einem Vergleich mit Fèz konnte Melilla nicht standhalten.
M’Barek ritt weiter zum Haus der Familie und betätigte den Türklopfer. Eine Klappe im massiven Doppeltor zu Abu Saïds Haus öffnete sich, und heraus sah der alte Hamid, schwarz und riesig wie eh und je. Inzwischen hatte er keine Zähne mehr, aber er lachte breit, als er M’Barek erkannte.
»Al hamdullillah, der junge Sîdi ist zurück!«, rief er, und unter Hamids Willkommensrufen und den schrillen zghirts, den Freudentrillern der Frauen, ritt M’Barek in den Hof ein.
Er hatte fast vergessen, wie liebevoll Umm Sarah und Abu Saïd diesen Wohnsitz in der Stadt am Meer gestaltet hatten. In der Mitte des arkadengesäumten Innenhofes befand sich ein kleiner Brunnen, dessen Wasser sacht in ein sternförmiges Bassin rann. Rosen und Minze gediehen in Kübeln und kleinen Beeten und erfüllten den Hof mit kühlem Duft. Wohin man sah, gab es gehämmertes Messing, poliertes Holz, üppige Teppiche und farbenfrohe Kissen. Den Boden zierten grünweiße Fliesen, an den Wänden leuchteten Mosaikornamente, und grazile Holzsäulen mit rotgrüner Bemalung trugen den umlaufenden Balkon, auf den weitere Räume mündeten. Über denen wiederum lag eine Terrasse mit schattiger Laube und weitem Blick auf das Meer. Viele kühle Abende und Nächte hatte er dort einst verbracht.
Was Margali wohl zu den beiden bespannten Lampions sagen würde? Eigenhändig hatte er sie aus leichten Hölzern und dünnen Papieren gebaut, eigentlich sogar erfunden, jedenfalls was die Schalen für das brennende Öl anging. An einem windstillen Abend wollte er sie gemeinsam mit Margali von dort oben in den Nachthimmel aufsteigen lassen. So wie er die Kleine kannte, würde sie davon entzückt sein.
* Für Erläuterungen zu den einzelnen Fremdwörtern und Redewendungen siehe Glossar am Ende des Romans
2
Lautes Lachen, Rufe, Freudentriller unterbrachen Margalis Summen. M’Barek war eingetroffen! Sie spähte in den Hof hinunter und zuckte zurück, als hätte sie einen Stoß erhalten. Das sollte M’Barek sein, dieser hochgewachsene, breitschultrige Mann, der dort unten im Hof zur Begrüßung Abu Saïds Hand küsste? Er bewegte sich gemessen und doch kraftvoll und wirkte, als könne ihn nichts erschüttern. Margali spürte, dass ihr die Röte über den Hals bis unter die Haarwurzeln kroch. Rasch duckte sie sich hinter die Terrassenbrüstung.
Sie hatte mit seinem Kommen gerechnet, hatte seine Ankunft sogar herbeigesehnt, voller Zuversicht, dass er ihr wie früher zur Seite stand. Nun aber zitterten ihr die Knie. Von hier oben gesehen hatte der selbstsichere junge Mann im Hof keine Ähnlichkeit mit ihrem verständnisvollen und geduldigen großen Bruder. Jener dort war ein beeindruckender Mann, ein Fremder.
Konnten vier Jahre einen Menschen derart verändern? In diesen Jahren hatte M’Barek studiert, hatte ferne Städte und Länder bereist und sich mit wichtigeren Dingen als ausgerechnet Musik beschäftigt. Wenn er nun ihre Nöte als die albernen Probleme eines Mädchens vom Land ansah? Plötzlich kamen sie ihr selbst nichtig vor. Am liebsten wäre sie ungesehen in ihr Zimmer gehuscht, um nachzudenken – und um ein frisches Gewand anzuziehen.
Sie hatte den Pflanzen, die auf der Terrasse in großen Töpfen wuchsen, frische Erde und Wasser gegeben, was man sowohl ihrem Kleid wie ihren Händen ansah. Margali rieb an den Fingern, sauber aber wurden sie davon nicht. Sollte sie etwa so die Oud spielen? In diesem Aufzug konnte sie einen Mann wie M’Barek schwerlich beeindrucken, nicht einmal, wenn ihr Spiel erstklassig wäre. Sie würde nicht spielen, entschloss sie sich.
Sie lauschte. Seine warme Stimme – wie gut sie sich daran erinnerte. M’Barek erzählte, Abu Saïd fragte, es wurde gelacht. Ihr Herz schlug unregelmäßig, doch nun, da sie ihn nicht sehen, lediglich hören konnte, beruhigte es sich allmählich. Er war kein Fremder.
Eine Weile kauerte sie noch im Verborgenen und horchte auf den Klang der Worte und auf M’Bareks Lachen. Schließlich richtete sie ihr Gewand und strich die Haare aus dem Gesicht. Hoch aufgerichtet, mit klopfendem Herzen, schritt sie die Treppe zum Hof hinunter.
M’Barek entlud sein Gepäck. »Meine Lehrer gaben mir den Rat …« Mit den Lampions in den Händen drehte er sich um und verstummte. Eigentlich hatte er fortfahren wollen: »… die Festigkeit verschiedener Steine zu untersuchen«, doch mitten im Satz verschlug es ihm die Sprache.
Was für eine Grazie, was für eine Haltung, war sein erster Gedanke angesichts der anmutigen jungen Frau auf der Treppe. Dieser leicht geneigte Kopf, dieses Lächeln … Selbstsicher nahm sie die letzten Stufen und kam direkt auf ihn zu. Er starrte sie an wie eine Erscheinung. Erst, als sie die Augen hob und ihn anlächelte, erkannte er Margali. »Oh! Du?«
»Willkommen, lieber Bruder. Wie geht es dir? Hattest du eine gute Reise?«
»Wie? Al hamdullillah, alles ging gut.« Er stotterte, und hatte er eben wirklich nach Luft geschnappt? Er blickte seinen Onkel an.
Abu Saïd legte den Arm um Margalis Schultern. »Du staunst, wie erwachsen deine kleine Schwester ist? Ich gestehe, manchmal wundere ich mich selbst darüber.«
»Ouacha, erwachsen, du hast recht.« Mehrmals öffnete er den Mund, doch er brachte keinen vernünftigen Satz zustande. Außerdem konnte er seinen Blick nicht von Margali lösen, von ihren Haaren, ihrem lebhaften Gesicht, der schlanken Gestalt. Seit ihrer letzten Begegnung war Margali nicht nur gewachsen und weiblicher geworden, vor allen Dingen hatte sie eine Ausstrahlung bekommen, wie er sie noch bei keiner Frau gesehen hatte. Bei Allah, was für befremdliche Gedanken!
Ihm war, als erwache er. Erst jetzt stellte er fest, dass er nach wie vor die beiden Lampions in Händen hielt. Er streckte sie Margali entgegen. »Vielleicht gefällt dir so etwas ja überhaupt nicht mehr? Eigentlich hoffte ich, wir könnten sie in einer ruhigen Nacht gemeinsam aufsteigen lassen?«
»Natürlich gefallen sie mir«, sagte Margali, »warum auch nicht, sie sind wunderschön.«
Und jetzt endlich, in dieser leicht trotzigen Antwort, erkannte er die kleine Schwester wieder.
Um M’Bareks Augen bildeten sich kleine Fältchen. »Dann bin ich zufrieden. Ich vermute allerdings, sie werden noch besser zur Geltung kommen, wenn du erst die Verpackung entfernt hast.«
Sie schaute auf die eingewickelten Lampions, sah den Bruder an, erkannte seinen milden Spott und lachte. Doch der merkwürdige Druck in ihrer Brust blieb bestehen.
Und auch M’Barek empfand diese Spannung.
Niemand bemerkte Abu Saïds steigende Aufmerksamkeit, und keiner sah seine nachdenklichen Blicke, die zwischen M’Barek und Margali hin und her wanderten.
*
Der weiche Akkord hing noch einen Augenblick in der Luft. Er weckte Bilder in ihr wie sonst die Geschichten von Märchenerzählern. Zunächst hatten die beiden spanischen Musiker einen Zyklus aus temperamentvollen, dann wieder ruhigen Passagen auf spanischen Lauten gespielt. Jetzt aber nahmen sie die arabischen Ouds zur Hand und trugen schwermütige und getragene Weisen vor. Ihre Finger eilten auf den Griffbrettern hin und her, die Melodien kletterten hinauf, perlten wieder herab, und die Hände flogen über die Saiten, dass die Töne tanzten. Margali saß auf der vordersten Stuhlkante, mit glänzenden Augen folgte sie jeder Bewegung der Musiker. Im Gegensatz zur spanischen Lautenmusik bestanden diese Stücke auf den Ouds aus ihr vertrauten Tonfolgen und Rhythmen. Sie klangen herzbewegend sanft, weich, schmelzend und klagend.
Die letzten Klänge verwehten, und unten im Saal, wo neben uniformierten Herren dunkel gekleidete Kaufleute und masirische Händler in weiten Gewändern saßen, brandete Applaus auf.
Sowohl hier auf der Galerie als auch im Saal glänzten die vergoldeten Arabesken der Spiegel und Fensterumrahmungen und der stuckverzierten Säulen. Margali konnte Abu Saïd ausmachen, der als Botschafter des Sultans in der Nähe des spanischen Gouverneurs saß.
Sie fühlte den Blick ihrer Großmutter auf sich und nahm eine manierliche Haltung an. Melala Mirijam legte Wert auf richtiges Verhalten. Obwohl ihr Musikdarbietungen nichts bedeuteten, begleitete sie Margali. »Hat es dir gefallen?«, fragte sie nun und musterte ihre Enkelin.
Margalis Wangen glühten. »Oh ja, sogar sehr. Mit Worten kann ich es gar nicht ausdrücken, aber hier habe ich es gespürt.« Sie legte die flache Hand auf ihre Brust. »Sie erzählen Geschichten, malen mit Tönen – einmal so ergreifend spielen können! Wie machen sie das?« Sie seufzte.
Die Großmutter drückte Margalis Hände. »Du fragst die Falsche. Wir werden die Herren zu uns bitten.« Und bevor Margali sie davon abhalten konnte, hatte sie schon einem der Diener den Auftrag erteilt.
»Euer Interesse ehrt uns.« Während Juán Tirádo, der jüngere der beiden Virtuosen, sich ungeniert umsah und die anwesenden Damen musterte, neigte Señor Pablo Ruíz Fernandéz, der Meister, vor Melala Mirijam den Kopf.
Ihre schmucklosen dunklen Gewänder wirkten abgetragen, so als hätten die beiden Musiker schon bessere Tage gesehen, dennoch traten sie selbstbewusst auf. Der Jüngere verzog keine Miene, während der Ältere bereitwillig lächelte. Seine Hände flatterten, als führten sie ein Eigenleben. Margali hielt sich nahe hinter ihrer Großmutter, um sich keine Silbe des Gesprächs entgehen zu lassen.
»Señores, Eure Musik erinnert an farbenprächtige Gemälde, jedenfalls nach Ansicht meiner Enkelin.« Margali errötete.
»Muchas gracias, die junge Dame hat ein feines Ohr.« Señor Pablo deutete Verbeugungen vor beiden Damen an. Er war ein kleiner, fülliger, nicht mehr junger Mann mit beinahe plumpen Fingern, und wäre Margali ihm in anderer Umgebung begegnet, hätte sie ihn niemals für einen Musiker gehalten. Und doch hatte er eben komplizierte Läufe auf der Laute vollführt, und die Töne seiner Oud hatten sich arabeskengleich durch den hohen Raum gerankt. Er strahlte, schien von seiner Musik erfüllt zu sein, und es ging etwas Beschwingtes von ihm aus, als wollte er am liebsten tanzen. Das hatte etwas Entwaffnendes.
Anders als er sonnte sich der Jüngere nicht im Lob der Zuhörer, sondern in den verstohlenen Blicken der spanischen Damen hier auf der Empore. Während des Konzerts hatte nicht er im Vordergrund gestanden, sein Part war mehr der eines Begleiters gewesen.
»Ich will Euch freimütig gestehen, ich fühle mich hin- und hergerissen«, fuhr der ältere Musiker fort. »Nichts vermag Sehnsucht, Hoffnung oder Leid besser zum Ausdruck zu bringen als die hiesige arabische Musik, gespielt auf einer volltönenden Oud. Es gibt nichts Bewegenderes.« Über Señor Pablo Gesicht huschte ein Lächeln, als lausche er just in diesem Augenblick solch gefühlvoller Musik.
Margali hing an seinen Lippen. Bewegender Ausdruck der Oud – das lag an der »hiesigen« Musik? Was meinte er damit?
»In Al-Andalus jedoch«, fuhr der Musiker eilig fort, und seine Miene wurde beinahe traurig, »fühle ich mich ihr vollkommen entfremdet. Es ist mir ein Rätsel, un misterio, aber in meiner Heimat benötige ich neben den gewohnten musikalischen Modi und eindeutigen rhythmischen Verläufen etwas, das ich hierzulande noch niemals vermisste: eine Komposition!«
Wenn sie ihn doch nur näher befragen könnte. Musik in Worte zu fassen erschien ihr beinahe unmöglich, er aber tat es. Vermutlich war er ein wunderbarer Lehrer. Ob sie ihn bitten sollte, ihr Unterricht zu erteilen?
Nun wandte ihnen auch der junge Señor Juán seine Aufmerksamkeit zu. »Mein Onkel übertreibt. Immerhin entstammen zahlreiche in Al-Andalus entstandene Kompositionen direkt der arabischen Tradition.«
Señor Pablo winkte ihm zu schweigen. Er war die Autorität in musikalischen Fragen, daran ließ er keinen Zweifel.
Mit vertraulich gesenkter Stimme erklärte er: »Die spanische und die arabische Musiktradition verhalten sich in der Tat wie Geschwister zueinander, doch nicht darum geht es. Euch will ich es gestehen, Señoraund Señorita: In Al-Andalus werde ich verrückt, wenn ich mir die Töne auf der Oudzusammensuchen soll. Keine Abbindungen, dafür aber doppelte Besaitung, und keinerlei Eindeutigkeit der Töne! Alles schwingt miteinander, steht in Verbindung, und dann noch dieser enorme Tonumfang! Ich sage Euch: Das, was ich hierzulande liebe, beleidigt dort mein Gehör!« Seine Hände zeigten an, wie weit voneinander entfernt für ihn die eine von der anderen Musik war.
Während sein Neffe unauffällig die Augen verdrehte, verzog sich Señor Pablos Miene zu einem Bild übertriebenen Jammers, so komisch, dass Margali hellauf lachen musste.
Melala Mirijam zog überrascht die Brauen in die Höhe. Margali errötete und deutete rasch zum Ende der Galerie. In Begleitung von Abu Saïd und einigen anderen Herren eilte soeben der Gouverneur heran.
Melala Mirijam schloss ihren Fächer. »Señor Pablo und Señor Juán, Eure Erläuterungen werfen weitere Fragen auf, vor allem bei meiner Enkelin. Sie ist die Musikerin in unserem Haus. Es wäre uns daher eine Freude, in Ruhe mit Euch sprechen zu können. Dürfen wir Euch zum Essen im Familienkreis begrüßen?«
*
Die Tage vergingen in heiterer Stimmung. Freunde und Nachbarn kamen zu Besuch, und Abu Saïd lud würdige Männer ein, damit sie M’Bareks Bekanntschaft machten oder erneuerten. Unentwegt wurde gekocht und gebacken, wurden Gäste bewirtet, es wurde gelacht und gescherzt, kurz: Das Leben war ein Fest.
M’Barek drückte sein Gewissen von Tag zu Tag mehr. Er hätte längst das Gespräch mit Abu Saïd suchen müssen, am besten gleich nach seiner Ankunft, doch in der allgemeinen Wiedersehensfreude hatte er es nicht fertiggebracht. Und nun wurde seine Lage mit jedem neuen Gast und jedem Gespräch misslicher. Nicht nur Abu Saïd und die Leute von Sijilmassa und des Tafilalts, auch die Männer von Melilla sahen in ihm ganz selbstverständlich Abu Saïds natürlichen Nachfolger, den zukünftigen amghar.
Noch vor Kurzem hatte auch er seine Aufgabe innerhalb der Familie und in Sijilmassa gesehen, aber nun? Sîdi Larbi hatte Größeres mit ihm vor. Er, der verehrte Baumeister von Fèz, hatte ihm, dem Mann aus der Wüste, Partnerschaft und Nachfolge angetragen! Sein Lehrer erschuf Häuser und Paläste, während er selbst sich besonders für Wasserkraft und Wasserversorgung interessierte, ein ideales Zusammentreffen, behauptete zumindest Sîdi Larbi. Im Kreise großartiger Gelehrter zu leben und zu arbeiten, an der Seite seines Lehrers und als dessen künftiger Erbe – was für eine Aussicht.
M’Barek seufzte. Beide, sowohl Abu Saïd wie auch Sîdi Larbi, zählten auf ihn. In masirischen Familien folgte der Sohn auf den Vater, so war es Brauch seit Generationen, und davon ging auch Abu Saïd aus. Der Plan seines alten Lehrers aber sah vor, dass er nicht nur sein Erbe antrat, sondern auch Aisha, Sîdi Larbis Tochter, zur Frau nahm und in Fèz lebte.
Sîdi Larbi baute auf ihn und vertraute ihm. Hätte er ihm anderenfalls die Hand seiner Tochter angetragen oder ihm die kostbare Abschrift aus Ibn Al-Jazaris Buch des Wissens von sinnreichen mechanischen Vorrichtungen vermacht? »Aisha und ich erwarten dich«, hatte er ihm beim Abschied nachgerufen. Schwiegersohn und Erbe dieses Mannes zu werden war eine hohe Ehre, die ihn mit Stolz erfüllte.
Auf der anderen Seite wartete das Dasein eines Provinzfürsten, eine Fortsetzung des Lebens Abu Saïds und seiner Vorgänger. Für sie mochte es richtig gewesen sein, doch für ihn? Inzwischen konnte er sich kaum noch vorstellen, sich mit den immer gleichen Streitigkeiten, Nöten und Problemen von Viehzüchtern, Oasenbauern und Karawanenhändlern abzugeben.
M’Barek hasste sich schon jetzt dafür, dass er Unfrieden und Enttäuschung ins Haus bringen würde. Genauso aber verabscheute er Unklarheit. Je eher er also das Gespräch mit Abu Saïd und Umm Sarah suchte, desto besser. Dennoch sollte er zuvor noch einmal alle Aspekte durchdenken, immerhin kannten seine Eltern weder Sîdi Larbi noch Aisha. Am besten wäre es, ihnen zu schildern, wie klug und einfallsreich der Lehrer arbeitete und wie findig seine Tochter ihn dabei unterstützte, zum Beispiel mit ihren Modellen.
Sîdi Larbi benutzte zum Heben besonders schwerer Lasten wie Marmorblöcke Kräne mit Laufrädern. Durch Versuche und gründliche Planungen hatte er herausgefunden, wie man mehrere dieser Räder hintereinander anordnen musste, um mit geringer Kraft auch schwerste Lasten heben zu können. Nach diesen Berechnungen war unter den geschickten Fingern seiner Tochter Aisha das Modell eines solchen Kranes entstanden, anhand dessen man die Möglichkeiten fortschrittlicher Kraftübertragung in allen Einzelheiten studieren konnte.
Immer wieder stellte Lâlla Aisha derartige lehrreiche Miniaturen her, als Sîdi Larbis einziges Kind hatte sie sich zudem schon früh mit Fragen der Architektur und des Bauwesens beschäftigt. So übertrug sie seine Berechnungen und Planskizzen ins Reine und war gleichzeitig seit dem frühen Tod ihrer Mutter auch zuständig für den Haushalt ihres gelehrten Vaters.
Sie war eine vielseitige und kluge Frau, die ihm zur Seite stehen und mit der er über all die Dinge reden konnte, die ihn fesselten. Sie mochte ein bisschen füllig sein, zudem war sie ein Jahr älter als er, aber was bedeutete das schon? Er jedenfalls konnte sich wahrhaftig glücklich schätzen, dass LâllaAisha und ihr Vater ihn erwählt hatten. Mit Allahs Hilfe fand er Abu Saïd gegenüber die richtigen Worte.
3
Blut tropfte aus seinem Ohr auf die Schulter. Den nächsten Schlag sah Leonardo jedoch rechtzeitig kommen und duckte sich. Die Knute des Korsaren streifte ihn an der Seite. Es brannte wie Feuer, und unwillkürlich schrie er auf, gleichzeitig jedoch war er erleichtert. Nicht die Hände, dachte er zum wiederholten Mal, Gott sei Dank nicht die Hände. Schultern und Rücken schmerzten, einer der Schläge hatte ihn seitlich am Kopf erwischt, sodass er nichts hören konnte, aber er konnte alles überstehen, solange seine Hände heil blieben.
Al Dschesaïr lag vor ihnen. Sämtliche Gefangenen standen an Deck und wurden mit Seewasser übergossen, um den schlimmsten Dreck abzuwaschen. Danach wurden sie paarweise mit Fußketten aneinandergefesselt.
Zwischen den Inseln vor Sizilien hatten ihnen die verdammten Korsaren aufgelauert! Ihren kleinen Konvoi hatte der Wind schon vorher zerstreut, sodass der venezianische Kauffahrer, mit dem er in das unter spanischer Hoheit befindliche Tunes zu gelangen gehofft hatte, ihnen hilflos ausgeliefert war. Aber auch mit zwei weiteren Schiffen aus Genua hatten die Korsaren leichtes Spiel gehabt. Drei Schiffe – gekapert innerhalb weniger Tage. Eine der genuesischen Galeeren war in Brand geschossen worden und mitsamt Mannschaft und Ladung gesunken, und auch der venezianische Kapitän seines Schiffes hatte das Gemetzel nicht überlebt. Wie viele Ruderer und Soldaten den Überfall überlebt hatten, konnte Leonardo nicht sagen, aber insgesamt pferchten die Korsaren mehr als hundert Männer im Laderaum zusammen. Was für eine Enge, und was für ein Gestank, schlimmer als auf der Gerberinsel in der Lagune von Venedig. Jetzt brüllten die bärtigen Schläger, nur wer ihren Befehlen gehorche, sei es wert, den Boden von Al Dschesaïr, ihrer geliebten Heimat, zu betreten, jedem anderen drohe der Tod in den Wellen.
Der geschützte Hafen und das strahlende Weiß des Häusermeers von Al Dschesaïr kamen in Sicht. Was erwartete ihn in dieser Stadt? Sie stand unter dem Schutz des osmanischen Sultans, und in Venedig wusste jedes Kind, dass die Seeräuber ihre erbeuteten Schätze zu ihm nach Konstantinopel schickten.
Das Korsarenunwesen hatte beängstigende Ausmaße angenommen. Inseln und küstennahe Siedlungen wurden geplündert und ihre Bewohner in die Sklaverei verschleppt, und Händler und Kauffahrer benötigten auf ihren Reisen bewaffneten Begleitschutz. Obwohl die Kaufleute von Venedig und Genua in seltener Eintracht König Felipe ein ums andere Mal um Abhilfe baten und obwohl sogar der Papst dessen Eingreifen als dringend geboten anmahnte, war bisher nichts geschehen. Im Gegenteil, es hieß, die Osmanen rüsteten massiv auf.
Sultan Süleyman ließ zahllose Schiffe bauen, eine furchterregende Kriegsflotte, mit der er seine militärische, aber auch wirtschaftliche Vormachtstellung ausweiten wollte. Man sagte außerdem, er strebe vom östlichen Mittelmeer immer weiter nach Westen, riskiere sogar den Krieg gegen Papst und König, nicht um den Islam zu verbreiten, sondern um sämtliche Handelsrouten zu kontrollieren. Angeblich schindeten sich auf den Ruderbänken seiner Kriegsgaleeren überwiegend christliche Sklaven. Stand nun auch ihm ein solches Schicksal bevor?
Boote ruderten heran, Segens- und Grußworte wurden gerufen und erste Preisangebote abgegeben. Stolz über ihren Fang prügelten die Korsaren die Gefangenen von Bord und trieben sie über einen langen, wackeligen Holzsteg an Land. Dabei lachten sie wohlgelaunt, brüllten Scherze und knüppelten eher beiläufig. Leonardo stolperte, konnte sich aber fangen. Er füllte seine Lunge, sog so viel frische Luft wie möglich ein. Balsam nach dem Gestank unter Deck, dachte er.
Der Junge, mit dem man ihn am Fußgelenk zusammengekettet hatte, warf ihm einen abschätzenden Blick zu. Er hieß Cesare und stammte aus Genua, das wusste Leonardo, ebenso, dass sein Schiff wenige Tage zuvor ebenfalls gekapert worden war. Cesare bewegte die Lippen, er schien ihn etwas zu fragen, Leonardo aber konnte nichts verstehen. Von dem Schlag gegen das Ohr dröhnte es noch in seinem Kopf. »Was?«
Cesare verdrehte die Augen. Er sah sich rasch um, dann trat er einen Schritt zur Seite und ließ sich ins Wasser fallen. Der Schwung riss Leonardo von den Füßen, und ehe er sich’s versah, platschte auch er ins Meer. Es war zwar eine seichte Stelle, dennoch schlug das Wasser über ihm zusammen und drang in seinen zum Schrei geöffneten Mund. Cesare zog ihn hoch und weiter unter den Holzsteg und kugelte ihm dabei beinahe den Arm aus. Leonardo hustete und spuckte. Cesare hielt sich an einem Holzpfosten fest, er selbst wurde von den Wellen hin und her gestoßen.
Endlich erwischte Leonardo ebenfalls einen Balken. »Merda, stupido, bist du dem Tollhaus entlaufen oder was?« Hinter ihnen lag das Schiff der Korsaren, vor ihnen der Berg mit der fremden Stadt und ihren Kerkern, und über ihren Köpfen trampelten die anderen Gefangenen.
Leonardo machte sich möglichst klein, das Gesicht knapp über den Wellen. Er keuchte und spuckte, Salzwasser brannte in den offenen Wunden am Rücken, doch der Schreck klang allmählich ab. Dieser Cesare, was für ein Teufelskerl! Ob der Fluchtversuch gelang, war mehr als zweifelhaft, aber ihn überhaupt zu versuchen, nötigte ihm widerwillig Achtung ab. Er hätte niemals den Mut dazu aufgebracht, nicht einmal auf eine solche Idee wäre er gekommen.
Cesare antwortete, doch noch immer konnte Leonardo kein Wort verstehen. Der Junge grinste breit. Er war muskulös, ein Arbeitstier, wie der Reis, der osmanische Kaperkapitän, händereibend befunden hatte, dabei noch ein Knabe von gut fünfzehn Jahren. Er sei auf Werften und Schiffen zu Hause, hatte er erzählt. Das sah man ihm auch an, ebenso, dass er von klein auf gewohnt war zuzupacken. Dabei stammte er aus gutem Hause, wenn man dem Gerede über seinen adeligen Großvater glauben durfte.
Bei genuesischen Familien kannte sich Leonardo nicht aus, er lebte zusammen mit seinem Vater in Venedig. Vater baute Lauten, besonders schöne und begehrte Instrumente, und hatte ein gutes Auskommen. Zurzeit aber konnte er nicht das richtige Holz bekommen, für volltönende Lauten benötigte er Eibenholz. Doch die Handelswege nach Füssen, in die Berge der alten Heimat, wo beste Eiben wuchsen, waren durch Aufstände und Kriege unpassierbar. Daher hatte der Vater ihn losgeschickt, Proben von Zedernholz zu besorgen. Zedern, sagte man, seien den Eiben ähnlich. Sie wuchsen in den Gebirgen Nordafrikas, den Atlasbergen.
Cesare zog ihn ein Stück weiter, er lugte durch die Spalten zwischen den Bohlen. Immer noch stampften Füße, klirrten Ketten und trotteten die Gefangenen über ihre Köpfe hinweg, dem Festland der Barbareskenküste entgegen. Dort sollten sie auf Sklavenmärkten verkauft werden.
Cesare hatte behauptet, schon bald werde es mit den Raubzügen der Korsaren vorbei sein. Mehrfach hatte er einen Pakt zwischen gewissen Großmächten angedeutet, sogar auf die Möglichkeit einer Seeschlacht hingewiesen, die das Mittelmeer ein für alle Mal von Osmanen befreien sollte. Woher wollte ausgerechnet er das wissen, dieser genuesische Wichtigtuer?
Leonardo sah, dass Cesare mit geweiteten Augen hinter ihn starrte. Er drehte den Kopf. Zwei Ruderboote, besetzt mit bärtigen Männern, rauschten heran. Noch wenige Ruderschläge, dann waren sie bei ihnen. Cesare deutete auf die entgegengesetzte Seite des Steges und holte bereits Luft zum Tauchen, doch Leonardo schüttelte den Kopf. Der Junge konnte es nicht sehen, doch auch auf dieser Seite näherten sich zwei offene Korsarenboote. Ihr kurzer Ausflug in die Freiheit war beendet.
Die Ruderer tauchten ihre Köpfe mehrmals unter Wasser, bevor sie kurzerhand ihre Hände fesselten, sie ans Heck eines der Ruderboote banden und an den Strand zogen. Als sie um Luft ringend an Land krochen, hagelte es Prügel. Nicht auf die Hände, hoffte Leonardo, ansonsten wäre es vorbei mit dem Instrumentenbau. Die Männer stießen Leonardo und Cesare zurück in die Reihe ihrer zerlumpten Leidensgenossen, und gemeinsam mit ihnen wurden sie durch die Tore der Stadt in ein Verlies getrieben.
*
Eine schnelle kleine Schebecke, nicht mehr neu, aber ziemlich gut in Schuss, dazu mit sechs Bronzekanonen ausgestattet – was wollte er mehr? Auf der Werft im Hafen von Genua schritt Kapitän Marino Capello an dem Schiff entlang und versuchte, seine Zufriedenheit mit gerunzelten Brauen und knurrigen Kommentaren zu kaschieren.
Seit dem Tod des greisen Admiral Doria vor vier Jahren waren dessen Nachfolger zwar dem Namen nach Seefahrer, in Wahrheit aber nichts als Schaumschläger, in puncto Seekriegsführung jedenfalls konnten sie dem großen Andrea Doria nicht das Wasser reichen. Hinzu kam: Ganz gleich, was auf dem Spiel stand und zu welchem Zweck der derzeitige Flottenverband gebildet wurde – sie knauserten. Ob es sich nun um Proviant oder um Waffen handelte, um Kanoniere, Seeleute oder Soldaten oder um das Wichtigste von allem: die Schiffe – sie schacherten und sparten.
Vielleicht aber schätzten die Flottenkommandanten das Zögern des spanischen Königs auch lediglich richtig ein? Man munkelte, nach dem Debakel von Ğarba beim letzten Feldzug seines Vaters lasse König Felipe II. zwar Schiffe bauen, scheue sich jedoch, sie in einer Schlacht aufs Spiel zu setzen. Vielleicht hatte er deshalb mit Don Garçia de Toledo einen zwar außerordentlich erfahrenen Admiral benannt, den er aber als Vizekönig von Sizilien zugleich an der kurzen Leine halten konnte. Don Garçias Ansehen unter allen Beteiligten der vereinigten Flotte – immerhin war neben Spanien, Neapel und Sizilien nun auch Genua mit von der Partie – stand außer Frage, dennoch kam es Capello vor, als dauere alles viel zu lange.
Bereits seit Wochen schleppten sich die kriegerischen Auseinandersetzungen um Malta hin, rannte die türkische Flotte ungehindert gegen die kleine Insel an. In Genua hingegen konnte bisher von Kampfeswillen kaum die Rede sein. Dabei mangelte es nicht an großartigen Zielen: Rettung von Malta, Rückgewinnung der Hoheit über die Handelswege, von denen auch Genuas Reichtum abhing, und Ausrottung der Korsaren, tönte es allenthalben. Auch das eigentliche Ziel erklang im lauten, patriotischen Getöse: die Zerschlagung der osmanischen Flotte. Man höre und staune!
Trotz des drohenden Verlustes von Malta und obwohl sogar der spanische König dem Bündnis beigetreten war, um den Überfällen der Türken in diesem Teil des Mittelmeeres endgültig ein Ende zu bereiten, hatten sich die Herren der Republik Genua zurückgehalten. Immerhin lag Don Garçia mit einem Großteil der spanischen Flotte inzwischen im Hafen von Messina, sozusagen sprungbereit, um den Rittern auf Malta zu Hilfe eilen zu können. Der Befehl dazu aus Madrid ließ allerdings immer noch auf sich warten. Und nun endlich hatten sich auch die Genueser bequemt, sich der vereinten Flotte anzuschließen.
Kapitän Capello ließ seinen Blick über die Schebecke wandern. Sie trug den harmlosen Namen Colombella, Täubchen, ungewöhnlich für ein bewaffnetes Schiff. Alles an ihr war klein und nichts neu, obwohl man immerhin die Masten verstärkt hatte, ebenso das Bugspriet und Teile des Achterkastells. Selbst die Kanonen an Deck stammten von älteren, ausgemusterten Schiffen, machten auf ihren stabilen Gestellen aber einen leidlich zuverlässigen Eindruck. Nicht schlecht, dachte er, durchaus passabel, und es dürfte ein Leichtes sein, ein Schiff dieser Größe und Ausstattung zu segeln. In welchem Zustand sich die Colombella allerdings unterhalb der Wasserlinie befand, blieb abzuwarten. Zweifel waren angebracht angesichts der Krämerseelen der Genuesen. Capello schnaubte mit gerunzelten Brauen. Die wie stets in einem schwarzen Handschuh verborgene gekrümmte Rechte auf dem Rücken schritt er das Schiff ab.
An den öffentlich geäußerten Absichten des Hohen Rates war nicht das Geringste auszusetzen, wohl aber an deren Umsetzung. Sogar sein hochnäsiger Schwiegervater Antonio Spinola gab inzwischen zu, dass die meisten genuesischen Schiffe eher mangelhaft für einen Kampf gegen Süleymans Kriegsflotte gerüstet waren.
Dabei verachtete Spinola ihn, nannte ihn einen Schlammspringer aus der Lagune und hatte über seine Tochter geflucht, weil sie seinerzeit auf ihn, einen windigen Venezianer hereingefallen war. Selten verzichtete er darauf, die familiären Beziehungen der Spinola zum Dogenamt in Genua zu erwähnen oder dass vor zweihundert Jahren einer seiner Vorfahren die Stadt Lucca gekauft hatte.
Der Kapitän spuckte ins Wasser. Er war selbst kein Chorknabe, bei Gott, aber seine Liebe zu Karten und Würfeln war harmlos im Vergleich zu dem, wie dieser Mann mit seiner Tochter umgesprungen war. Zweimal hatte er sie gegen ihren Willen mit mächtigen, ihm nützlichen Männern verheiratet, die jedoch beide früh verstarben. Der eine angeblich bei einem Jagdunfall, der andere an Geschlechtskrankheiten und übermäßiger Völlerei. Dass Capello sie zur heimlichen Heirat überredet und damit den väterlichen Fängen entrissen hatte, verzieh dieser weder ihm noch seiner Tochter. Leider war sie bald nach der Geburt ihres Sohnes verstorben. Tragisch, zumal Capello in der Folge nicht mehr an ihre Geldtöpfe herankam. Die Verwaltung ihres Vermögens oblag – zumindest derzeit – Antonio Spinola, ihrem Vater.
Der Adjutant des Admirals, dem die Inspektion zu lange dauerte, räusperte sich. »Was sagt Ihr, Commandante? Seid Ihr zufrieden?«
»Auf den ersten Blick nicht schlecht«, gab der Kapitän zu. »Noch besser wäre es, wenn König Felipe endlich das Signal zum Losschlagen geben würde. Man muss den Türken die Peitsche geben!«
Vor Wochen war die osmanische Flotte mit mehr als zweihundert Schiffen ausgelaufen, Ziel Malta, und inzwischen kontrollierte sie die Seewege zwischen der afrikanischen Küste, Sizilien und Malta. Er hatte es angezweifelt, doch glaubwürdige Kuriere berichteten, eine der Festungen auf Malta liege unter massivem Beschuss. Noch befand sich dieser winzige Steinhaufen zwar in den Händen der kämpferischen Ritter, aber wie lange konnten die Ordensleute ohne Unterstützung der Spanier und Genuesen standhalten?
Capello rieb seine Hand im Handschuh. Manchmal juckte die Haut der versteiften Finger, manchmal fühlte sie sich eiskalt an. Vor vielen Jahren hatte er einmal auf die falsche Karte gesetzt. Der Gegner sei nichts als ein eifersüchtiger Wüstensohn, leicht zu beeindrucken, hatte er gedacht. Ein Fehler. Seither lebte er mit zerschnittenen Sehnen und steifen Fingern. Gewöhnt hatte er sich bis heute nicht daran.
»Welche Nachrichten habt Ihr von Euren Spähern?«, erkundigte er sich bei dem Adjutanten. »Es sind doch etliche Schnellsegler unterwegs.«
Der Adjutant schüttelte den Kopf.
»Wie denn, gar nichts? Hattet Ihr nicht mindestens drei Schiffe losgeschickt?«
»Sì, Commandante, und alles flinke Segler, ideal für verdeckte Erkundungsfahrten. Doch leider – bisher keine Nachrichten. Ist nicht auch Euer Sohn dabei?«
Der Kapitän knurrte Unverständliches in seinen graumelierten Bart. Als jüngster Offizier befand sich Cesare tatsächlich an Bord eines der Schiffe, er hatte sich sogar freiwillig gemeldet, wohl, um seinem Großvater zu imponieren. Der Junge nannte sich Spinola, dem Alten zu Gefallen. Ein Affront gegen ihn, seinen Vater, gewiss, aber welche Handhabe hatte er schon dagegen?
Kapitän Capello ging in die Hocke, bückte sich so tief hinab, wie es seine Knochen zuließen, und prüfte die Schiffswand bis hinunter zur Wasserlinie.
Merda! Ächzend kam er wieder hoch. »Wie viel hat man Euch gezahlt?« Seine Stimme klirrte vor Kälte.
»Scusa? Was meint Ihr?
»Hier, schaut Euch die Beplankung an. Dort, die Ritzen unterhalb der Wasserlinie, wo es darauf ankommt. Was meint Ihr, womit hat man die abgedichtet? Mit Werg, das im Wasser aufquillt, und mit heißem kafr, Asphalt, der alles dicht verschließt?«
Der Adjutant bückte sich ebenfalls, besah die nachgearbeiteten Fugen und zuckte die Schultern. »Was habt Ihr auszusetzen? Das sieht doch gut aus.«
»Gut?«, polterte der Kapitän. »Gut? Vielleicht für Ziegen! Das ist Stroh, uomo, billiges Stroh, das sich im Wasser auflösen wird, und kein Werg, Mann!«
*
Sheïk Hassans fleischige Lippen über dem Kinnbart lächelten. Dennoch versteinerten die Sklaven, sobald sie ihn erblickten, die Diener duckten sich, und auch seine Frauen und Kinder nahmen sich vor ihm in Acht. Und das aus gutem Grund. In seinem Haus wusste jeder, das Lächeln verdankte er nicht seinem gutmütigen Wesen, sondern einer Laune der Natur. Bereits seit seiner Geburt lächelte Sheïk Hassan el Alaoui, selbst wenn er Schmerzen verspürte, oder Ärger, Wut und Zorn. Es sei ein Geschenk Allahs, hatte ihm sein Vater in Kindertagen versichert, man könne daran nichts ändern, es lediglich klug einsetzen. Und das tat er. Er trug sein Lächeln wie eine Maske. Hinter ihr ließen sich Machtgier und sein berechnendes Wesen vorzüglich verbergen.
Dieses Anwesen war der ideale Ort für ihn, und die grünen Gärten waren das reinste Paradies, sein ğanna. In dem noblen, weitläufigen Haus mit Terrassen und hohen Gemächern, mit Treppen und schattigen Innenhöfen lebte es sich komfortabel und ungestört. Es lag einsam an der kargen Südküste des Landes, in einem Unruhegebiet, über das jederzeit räuberische Wüstenkrieger oder feindliche Nachbarn herfallen konnten. Von hier aus spann er sein Netz. Im Laufe der Zeit hatte er es zu engen Maschen verknüpft. Einflussreiche Männer des Hofes gehörten ebenso dazu wie einfache Dorfvorsteher und Zuträger. Weitab vom Hof in Tunes konnte er Gleichgesinnte um sich sammeln, nach Belieben Boten aussenden und empfangen, vertrauliche Gespräche führen und Vorbereitungen treffen. Niemand sah oder hörte oder verriet etwas von seinen Maßnahmen, jedenfalls niemand, der an seinem Leben hing.
Nicht einmal die Soldaten, die er unauffällig um sich scharte, lösten lästige Nachfragen bei der Armeeführung in Tunes aus. Der WesirMulay Youssef hatte Sultan Ahmad, dem Herrscher in Tunes, und seinem Hof erklärt, Sheïk Hassans Truppe sei als Schutz zu verstehen, wegen der nahen Grenze zu Tripolis, dem Machtbereich der Osmanen. Der Süden müsse sich ihrer erwehren können und ebenso der räuberischen Nomaden, die aus der Wüste herandonnerten und über Tuzer und Nafta und andere reiche Oasenstädte herfielen. Man sei dem treuen Sheïk zu Dank verpflichtet. Seither hielt sich der Argwohn in Grenzen. Nicht in allen Fragen, aber zumindest in dieser konnte er sich auf Mulay Youssef verlassen, Allah sei Dank. Sheïk Hassan lächelte. Seine Stunde nahte, insha’allah.
Noch allerdings verfügte er lediglich über gut einhundert Mann. Nicht genug, dachte er, bei weitem nicht. Doch sein Sklavenaufkäufer schaffte gerade weitere Männer heran, seinen Nachrichten zufolge hatte er gute Ware erstehen können. Rechnete er die eigenen Sklaven hinzu, die er ebenfalls zu Kämpfern auszubilden gedachte, kam ein beeindruckender Haufen zusammen, der sich nicht vor den hochmütigen Spaniern zu verstecken brauchte. Hier im Süden hatten die verhassten nasrani, die spanischen Nazarener, ohnehin nur wenige Männer stationiert, erst weiter nördlich gab es größere christliche Kontingente. Um die würde sich Mulay Youssef kümmern, so war es abgesprochen.
Nun fehlte nur noch das Abkommen mit Turgut Reis Pa˛sa. Zweimal hatte er sich bereits mit dem alten Korsarenkapitän beraten, hatte ihn großzügig bewirtet und beschenkt und nach allen Regeln hofiert, zu einem Ergebnis waren sie dennoch nicht gekommen. Stellte er ihm nun seine Männer, allesamt kampferprobte Korsaren, zur Verfügung oder nicht? Der Alte war ein schlauer Fuchs, für ihn musste sich eine Sache immer auch persönlich lohnen. »Alquiler«, Leihgebühr, hatte er es genannt und sich dabei vor Vergnügen auf die Schenkel geklopft.
Derzeit kämpfte Turgut Reis Pa˛sa vor Malta, wurde jedoch demnächst zurück auf Ğarba erwartet. Wenigstens hatten die umliegenden Landbesitzer ihre Börsen bereits geöffnet, Turgut Reis’ »Leihgebühr« konnte also als gesichert gelten.
Sheïk Hassan lehnte sich zurück und lächelte zufrieden, diesmal tatsächlich, aus Genugtuung. Nicht nur er, auch Mulay Youssef und die Großgrundbesitzer des Südens arbeiteten an einem großen gemeinsamen Ziel.
Mit Unterzeichnung des spanischen Vertrages hatte sich Sultan Ahmad, der Schwächling aus dem Hause der Hafsiden, sein eigenes Grab geschaufelt, seine Tage auf dem Thron waren gezählt. Nicht genug, dass er das Abkommen unterzeichnet hatte, er hatte auch spanischen Forderungen nach neuen Schiffen zugestimmt. Seither machte sich hier im Süden deutlicher Unwille breit. Bei Allah, was glaubte der Sultan denn, wer diese Schiffe bezahlen würde? Außerdem sollten sie in Malta gegen Glaubensbrüder eingesetzt werden. Muslime gegen Muslime? Unerträglich, dieser Gedanke.
Warum war Sultan Ahmad vor den Spaniern eingeknickt, warum ließ er Schiffe für sie bauen und stellte ihnen auch noch Soldaten? Sogar Bauernsöhne ließ er von den Feldern holen, nur um die Spanier zufriedenzustellen. Wusste er nicht mehr, auf welche Seite er gehörte? Mit solchen und ähnlichen Mahnrufen beförderten der Wesir und er, Sheïk Hassan, den Widerstand im Lande.
Nach allem, was man hörte, war Felipe II. von Spanien ein König, der sich hinter Palastmauern verbarg, von wo aus er mit Dekreten und Erlassen regierte. Hunderte von Briefen verfasste er, anstatt wie ein Mann von Angesicht zu Angesicht zu verhandeln. Und der jetzige Sultan aus dem Geschlecht der Hafsiden, Sultan Ahmad? Er liebte das gute Leben und die Künste, und anstatt die Spanier zu bekämpfen, leckte er ihnen die Stiefel.
Niemals wieder durfte ein Sultan dem Haus der Hafsiden entstammen! Für dieses Amt standen in Zukunft andere Männer bereit, starke Männer wie Wesir Mulay Youssef oder wie er selbst, Sheïk Hassan. Ihre gemeinsame Parole lautete: Nieder mit Spanien und nieder mit den Hafsiden! Er ballte seine Faust. Bald, insha’allah, mit Gottes Hilfe!
Noch aber nahm er sich ein Beispiel an Turgut Reis Pa˛sa, dem gerissenen Korsaren, und hielt sich im Hintergrund. Sie beide duldeten sogar eine Werft der Spanier auf Ğarba in Sichtweite der Korsarenfestung. Dort sollten die neuen Schiffe für die spanische Flotte entstehen, mehrere hatte man auf Kiel gelegt, und einige bereits so gut wie fertiggestellt. Noch aber hatte keines die Werft verlassen, dafür sorgten entweder er oder der alte Korsarenkapitän. Kurz vor Fertigstellung verzögerte sich der Nachschub, dann wieder zerbrachen Kräne und Werkzeuge, ein anderes Mal fanden sich wurmige Hölzer oder Männer erkrankten. Es gab immer eine Möglichkeit, die Wasserung eines Schiffes zu verzögern. Sheïk Hassan strich sich über den Bart.
Auf diese Schiffe konnten die Spanier lange warten! Schon bald würden sie seinen eigenen Zwecken dienen und denen der Osmanen. Sobald Turgut Reis das Zeichen gab, würden sie nicht für, sondern gegen die maltesischen Rittermönche eingesetzt werden!
Seit Wochen dauerten die Kämpfe nun schon an. Die Christenhunde verteidigten ihre Insel mit dem Mut von Löwen, doch irgendwann musste sie die Kraft verlassen. Waffen, frische Soldaten oder anderer Nachschub kam nicht durch zu ihnen, dafür wurde unauffällig, aber wirksam gesorgt. Fern konnte der Sieg also nicht mehr sein. Alles lag in Allahs Hand, doch seine Stunde kam, insha’allah. Sheïk Hassan lächelte.
4
»Liebend gern begleitete ich Señorita Margali auf ihrem Weg in die Welt der Musik. Ach ja, noch einmal ganz von vorn beginnen zu können – ein verführerischer Gedanke.« Señor Pablo deutete eine Verbeugung in Margalis Richtung an. »Doch leider wird es dazu nicht kommen, wir müssen schon bald nach Tunes aufbrechen. Sehr bedauerlich.«
Das erwartungsvolle Leuchten auf Margalis Gesicht erlosch.
Farbige Lichter wischten über Margali, über Melala Mirijam und die beiden spanischen Musiker, über Abu Saïd und M’Barek und all die anderen. Windlichter und Fackeln, besonders aber die großen Laternen mit ihren bunten Glasscheiben erleuchteten den Innenhof. Sie schwangen im Abendwind und tauchten für Augenblicke die Treppe, die Menschen und jeden Winkel in rotes und grünes, dann wieder blaues Licht. Zahlreiche Gäste hatten sich zu diesem Abendessen eingefunden, neben der Familie und den Spaniern vor allem Freunde von M’Barek, sodass man den Hof mit Teppichen ausgelegt hatte, damit alle Platz fanden.
Diener schleppten mit spitzen Hauben abgedeckte Tabletts herbei und setzten sie auf dem Boden ab, wo man sich um sie scharte. Karaffen mit Wasser und gekühlten Fruchtsäften wurden bereitgestellt, die Kinder des Hauses übernahmen den Dienst des Händewaschens. Mit silbernen Schalen, Wasserkannen und weißen Tüchern gingen sie von einem Gast zum nächsten. Die Hauben wurden entfernt, und Berge von duftendem Kuskus, gekrönt von Gemüse und Fleisch, tauchten darunter auf. Mit einem gemurmelten bismillah eröffnete Abu Saïd das Mahl.
Auf Margalis Drängen nahmen auch Juán und sein Onkel an diesem Abendessen teil. Schon seit ihrem Eintreffen konnte Juán kaum die Augen von der Tochter des Hauses abwenden. Sie trug ein grünes Gewand mit silbernen Litzen, dazu Silberschmuck, und beides wirkte kostbar. Sie sah etwas atemlos aus, so als sei sie gerannt, als sie sich ihm gegenüber setzte, zwischen tío Pablo und ihre Großmutter Mirijam. Ihr Bruder M’Barek saß im Kreis von Freunden, hatte seinen Platz aber so gewählt, dass er Margalis Runde im Blick hatte. Kontrollierte er seine Schwester? Juán war sich seiner Aufmerksamkeit jedenfalls überaus bewusst. Jetzt schob Margali über den duftenden Berg von Kuskus ein saftiges Fleischstückchen in seine Richtung und nickte ihm auffordernd zu. Das Fleisch schmeckte nach den fremden Gewürzen. Rasch schluckte Juán den Bissen hinunter.
»Mein verehrter Onkel meint«, brach er sodann das Schweigen, »dass wir als fahrende Sänger, wie man so schön sagt, einem Schüler keine dauerhafte Aufmerksamkeit schenken könnten. Ich allerdings sehe das als ein eher geringes Problem an.«
Tunes war ein Ziel, zu dem es allein den Onkel zog. Er dagegen, der sich noch nie in einem vergleichbaren Haus wie diesem aufgehalten hatte, konnte sich gut vorstellen, hierzubleiben und das junge Mädchen zu unterrichten.
Von außen wirkte das Haus unscheinbar, im Inneren aber erlebte man geschnitzte Treppen und schwere Teppiche, kunstvolle Mosaike und goldene Schriftbänder über den Türen, fein gehämmerte Messingtabletts in beinahe absurder Größe und kostbare Gläser für jeden Gast. Auch das reichhaltige Essen, das ohne Unterlass aus der Küche herangeschafft wurde und so großzügig bemessen war, dass man ein halbes Dorf davon hätte sättigen können, sprach von Reichtum. Wie überaus wohlhabend diese Familie sein musste!
Leider wurde kein Wein serviert, zudem hockte man auf dem Boden, was ihm trotz der weichen Teppiche unbequem war. Noch dazu gab es nicht einmal Löffel, sodass alle gezwungen waren, mit den Fingern zu essen, auch er. Dennoch, sein Onkel musste blind sein, wenn er eine Gelegenheit wie diese nicht als Glücksfall erkannte und wahrnahm. Was war ein Sultanshof in der Fremde schon gegen diesen mit Händen zu greifenden Wohlstand? Und sah die Tochter des Hauses nicht reizend aus? Außerdem, unterrichten gegen Entgelt – ein bequemeres Leben gab es nicht für einen Musiker.
»Ach ja, die Jugend, stets unbedacht.« Onkel Pablos Lachen klang gekünstelt. »Doch leider irrt mein lieber Neffe. Schon in wenigen Tagen werden wir abreisen, um mit Gottes Hilfe erst im kommenden Frühjahr auf dem Rückweg nach Al-Andalus wieder eine Rast in Melilla einzulegen.« Er funkelte Juán an. Dazu lächelte er zwar, sein Tonfall aber duldete keinen Widerspruch.
Der junge Spanier jedoch zwinkerte Margali verschwörerisch zu, als gebe er ihr insgeheim ein Versprechen.
Margali errötete. Sie mochte Juáns unbekümmerte Art, außerdem machte er keinen Hehl daraus, dass sie ihm gefiel. Verstohlene Blicke kannte sie, freimütige Bewunderung aber war etwas Neues.
M’Barek entging weder sein Zwinkern noch ihr Erröten. Er fing zwar lediglich Bruchstücke des Gesprächs auf, bei dem es offenbar um Reisepläne ging, dieser Blickkontakt aber gefiel ihm nicht. Weder mochte er das Aussehen dieses Mannes noch sein unverfrorenes Auftreten. Ein Spanier eben. Bei der Begrüßung hatte er einige höfliche Worte mit ihm gewechselt und sofort eine unterschwellige Abneigung gegen den jungen Musiker verspürt.
»Sind alle Mitglieder Eurer Familie Musiker?«, fragte Margali Señor Pablo. Sie mochte ihn.
»Juán ist der jüngste Sohn meiner Schwester, Señorita, und bedauerlicherweise außer mir der Einzige in der Familie mit einer gewissen musikalischen Begabung. Ich bildete ihn selbst aus, und inzwischen glaube ich sagen zu können, dass meine Bemühungen nicht vergeblich waren.« Sein Unmut über den vorlauten Einwand des Neffen schien vergessen.
»Befürchtet Ihr nicht, unterwegs in Kämpfe verwickelt zu werden?«, mischte sich jetzt M’Barek ins Gespräch. »Malta und Tunes sind nicht allzu weit voneinander entfernt.«
Abu Saïd und die anderen horchten auf.
»Ach das.« Señor Pablo machte eine wegwerfende Geste. »Unser Kapitän Villafranca gilt als erfahren, außerdem kennt er den neuesten Stand auf Malta. Zudem erklärte er, sein Schiff habe geringen Tiefgang und könne daher im Schutz der Küste segeln. Wir sehen also einer entspannten Seereise entgegen, heißt es doch, der August sei die geeignetste Reisezeit in diesem Teil des Mittelmeers. Und sind wir erst in Tunes, am Hof des Sultans, erwarten uns allerbeste Bedingungen.«
Er wandte sich Melala Mirijam zu. »Schon vor Jahren drang der Ruf des Hofes bis nach Al-Andalus, wo Lauten- und Oudspieler in harter Konkurrenz zueinander stehen«, erklärte der alte Spanier.
Sie nickte höflich. Margali beugte sich vor, um keines seiner Worte zu verpassen, während Juán gelangweilt schaute. Señor Pablos Gesicht rötete sich.
»Am Hof von Tunes werden Musiker hochgeschätzt, dort zählen nicht Herkunft oder Beziehungen, sondern allein künstlerisches Können.« Er reckte das Kinn vor: So sollten Künstler behandelt werden.
Melala Mirijam lächelte weiterhin höflich, Margali aber hing an seinen Lippen.
Señor Pablo bemerkte es, und es gefiel ihm. Stolz fuhr er fort: »Ihr müsst wissen, Señorita, der Sultan erwartet uns. Zudem residieren in der Umgebung von Tunes und entlang der gesamten ifriqyschen Küste zahlreiche wohlhabende Familien auf herrlichen Landsitzen, die unserer Musik ebenfalls mit Vergnügen lauschen werden. In nicht wenigen Frauengemächern wird musiziert, teilweise sogar mit beachtlicher Fertigkeit.« Er neigte sich ihr zu, als wolle er Margali ein Geheimnis verraten.