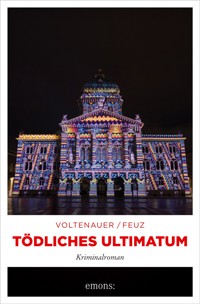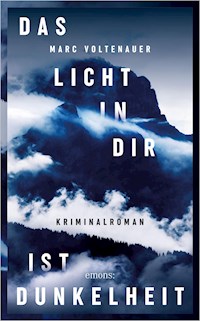
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Andreas Auer
- Sprache: Deutsch
Eine meisterhaft erzählte Geschichte von göttlicher Rache und teuflischem Zorn. Ein abgeschiedenes Bergdorf in den Alpen. Die beschauliche Welt gerät aus den Fugen, als in der Kirche ein Toter gefunden wird, grausam zugerichtet und drapiert wie Jesus am Kreuz. Kommissar Andreas Auer von der Kriminalpolizei Lausanne ahnt, dass dies erst der Auftakt zu einer blutigen Serie ist. Und er soll recht behalten. In der Enge der Dorfgemeinschaft geschieht ein weiterer verstörender Mord. Es beginnt ein atemloser Wettlauf gegen die Zeit – und gegen einen kaltblütigen Täter, der sich als Instrument Gottes betrachtet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 650
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Sammlungen
Ähnliche
Diese Geschichte ist frei erfunden, daher sind auch jedwede Ähnlichkeiten zwischen den Romanfiguren und real existierenden Personen rein zufällig. Die verschiedenen Orte in und um Gryon herum sind hingegen real, auch wenn sich der Autor hier und da kleine künstlerische Freiheiten erlaubt hat.
Für die Übersetzung der evangelischen Bibelzitate wurde die Zürcher Bibel (2007, Theologischer Verlag Zürich), für die katholischen Bibelzitate eine Bibel aus dem Verlag Herder (Freiburg im Breisgau, 1965) verwendet.
Die Originalausgabe erschien 2015 unter dem Titel »Le Dragon du Muveran« bei Les Éditions Plaisir de Lire, Lausanne.
©Marc Voltenauer
©2016 Slatkine& Cie
©der deutschsprachigen Ausgabe: 2021 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: shutterstock.com/David Marti
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer
eBook-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-96041-747-7
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Und ich werde Wunderzeichen wirken
am Himmel und auf der Erde:
Blut und Feuer und Rauchsäulen.
Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln
und der Mond in Blut,
bevor der Tag desHERRNkommt,
der große und furchtbare.
Prophetenbücher, Joel
PROLOG
Freitag, 7.September
Der Mann, der kein Mörder war, stand auf der Terrasse seiner Alphütte in Gryon. Allein. Ringsherum war niemand zu sehen. Die Wanderer, die den sonnigen Nachmittag genutzt hatten, waren bereits in ihre Städte zurückgekehrt. Lediglich einige grasende Kühe auf den Weiden, die mit ihrem Glockengeläut die Stille des Augenblicks störten. Die Sonne war kurz davor, hinter den Gipfeln zu verschwinden. Er beobachtete, wie sich die Bergflanke Miroir d’Argentine rosa färbte, während sich der Himmel langsam verdunkelte. Zu seiner Linken lag das zerklüftete Bergmassiv der Diablerets. Beeindruckende Berglandschaften hatte er viele gesehen, doch diese hier hatte er nie vergessen.
Er entkorkte eine Flasche Rotwein, schenkte sich ein Glas ein und ließ seinen Blick auf den Alpweiden der Tour d’Anzeindaz ruhen. Wie viele Wochenenden hatte er dort mit der Familie verbracht? Glückliche, unschuldige Zeiten. Er drückte die Play-Taste seines Handys und schob den Lautstärkeregler hoch.
Während er mit Zunge und Gaumen die Aromen des Weins erforschte, versank er in Mozarts Requiem. »Lacrimosa«. Seine Musik, die ihn inspirierte und seine Trauer in Zuversicht verwandelte. Die ihn all die Jahre am Leben gehalten hatte. Mit deren Hilfe er seiner Verzweiflung ein wenig Hoffnung entgegenzusetzen vermocht hatte.
Tag der Tränen, Tag der Wehen,
Da vom Grabe wird erstehen
Zum Gericht der Mensch voll Sünden;
Lass ihn, Gott, Erbarmen finden.
Milder Jesus, Herrscher Du,
Schenk den Toten ew’ge Ruh.
Sein Blick schweifte über den Horizont und blieb am Grand Muveran hängen. Er schloss die Augen. Vierzig Jahre… Er wurde von Emotionen übermannt. Tränen stiegen in ihm auf und wollten nicht fließen. Er wollte schreien, brachte aber keinen Ton heraus. Seine Seele war vertrocknet.
Erinnerungen drangen an die Oberfläche. Eine Silhouette erschien vage vor seinem inneren Auge und nahm langsam Gestalt an. Ein Funken Wärme traf sein kaltes, erstarrtes Herz. Seine Großmutter.
Sie war eine einfache, zurückhaltende Frau gewesen, die sich nie vor etwas gedrückt hatte. Stets voller Pflichtgefühl allem gegenüber. Ihrem Mann, der Molkerei, den Kindern. Ihrer Arbeit in der Gemeinde. Ihr wohlwollender Blick ließ ihren inneren Frieden und die ihr innewohnende Stärke erkennen. Sie trug einen Dutt und eine kleine Nickelbrille. Trotz tiefer Falten, die die Zeit und ihr Leben im Dienst der anderen in ihr sanftes Gesicht gegraben hatten, strahlte sie Harmonie aus. Meist trug sie eine fliederfarbene Bluse mit weißen Blumen, einen grauen Rock und darüber eine violette Schürze, die sie niemals ablegte. Ihre Gegenwart und ihr Duft nach dem Alpchalet und nach Kaminfeuer hatten ihn als Kind getröstet. Sie war die Einzige gewesen, die ihn verstand. Damals war er zehn Jahre alt gewesen und gerade mit seinen Eltern nach Gryon gezogen.
In einer Vollmondnacht wie der, die gerade hereinbrach, hatte sie ihm auf dieser Terrasse eine Legende erzählt, die sich Wort für Wort in sein Gedächtnis eingegraben hatte. Seine Großmutter und er hatten hier nebeneinandergestanden und sich an das Geländer gelehnt. Sie hatte ihm den Arm um die Schulter gelegt und folgende Geschichte erzählt.
»Siehst du dahinten den Grand Muveran?«, hatte sie mit gedämpfter Stimme gefragt und dabei mit dem Finger in die Ferne gezeigt. »Erkennst du diese Farben, Orange und Rot? Nun, hinter diesem Berg lebt ein Drache. Bevor eine Vollmondnacht anbricht, während die Sonne untergeht, fliegt er los und speit Feuer in den Himmel. Riesige Flammen, die das Gebirge umzüngeln. Im Frühjahr lässt er den Schnee und das Eis der zugefrorenen Seen schmelzen. Manchmal fliegt der Drache sogar über das Dorf Gryon hinweg.«
1
Sonntag, 9.September
Andreas Auer war mit dem ersten Licht des Tages aufgestanden. Wie jeden Morgen bereitete er sich an der Küchentheke einen Milchkaffee zu. Zwei Löffel lösliches Kaffeepulver, zwei Drittel heißes Wasser und ein Drittel Milch in seiner mit einem Elch verzierten Lieblingstasse. Durch das Fenster betrachtete er den Miroir d’Argentine, und er fühlte sich gut.
Vor sechs Monaten hatten Mikaël und er sich in Gryon niedergelassen. Ein Traum war Wirklichkeit geworden. Sie hatten sich sofort in dieses alte Chalet verliebt, das zwar ein wenig renovierungsbedürftig war, aber viel Charme besaß und völlig abgeschieden auf einer Lichtung stand. Ein kleines Paradies. Nach Jahren, die sie in einer Wohnung in Lausanne verbracht hatten, waren sie des Stadtlebens überdrüssig. Dieser Ort war es, an dem sie leben wollten.
Als Erstes hatten sie das Holzschild mit der Aufschrift »Chalet Edelweiß« über der Eingangstür abgehängt. Auch wenn das Gebäude den Namen seit seiner Erbauung mit Stolz getragen hatte und Mikaël die in den Schweizer Alpen immer seltener zu findende Wildblume sehr mochte, hatte er befunden, dass der Name zu sehr nach einer Touristenfalle klänge. Egal ob in Los Angeles, im Val-d’Isère, in Genf, in Lissabon oder sogar in New Glarus, einem gottverlassenen Kaff in Wisconsin– bei einem »Chalet Edelweiß« handelte es sich in aller Regel um ein typisch schweizerisches Restaurant mit übertrieben folkloristischer Ausstattung. Oder hinter dem Namen verbarg sich eines dieser großen, unästhetischen Gebäude für Jugendfreizeiten. Und ihr neues Zuhause sollte weder mit dem einen noch dem anderen in Verbindung gebracht werden. Da sie jedoch die Identität ihres Chalets nicht hatten verfälschen wollen, hatten sie es in »L’Étoile d’argent« umgetauft, den französischen Namen der mythischen Pflanze.
Im kommenden Jahr würde Andreas seinen vierzigsten Geburtstag feiern. Sein braunes Haar war schon vor Jahren ergraut, und Mikaël nahm ihn deswegen häufig auf den Arm. Andreas erinnerte sich an einen Wortwechsel des Vorabends: »Das macht doch meinen Charme aus, oder?«– »Wenn dich das beruhigt…«– »Schau dir Sean Connery an, je älter er wird, desto sexyer wirkt er!«
Brauchte er eine Beruhigung? Andreas hatte das Gefühl, dass er mit zunehmendem Alter immer mehr mit sich im Reinen war. Als hätte er einen Zustand der Reife erreicht, in dem er von seinen Errungenschaften und seiner Erfahrung profitieren konnte. Nur eine Sache plagte ihn. Vor seinem inneren Auge tauchte die Lebenskurve auf. Kindheit, Reife und Verfall. Der Gedanke, demnächst den Höhepunkt überschritten und damit den Anfang vom Ende erreicht zu haben, ließ ihn nicht los. Sein Verstand sagte ihm, dass noch viele schöne Jahre vor ihm lägen, aber auf einer emotionalen Ebene war er sich dessen nicht so sicher. Bis vor Kurzem war ihm nie in den Sinn gekommen, dass ihm einmal etwas zustoßen könnte. Er hatte sich unverwundbar gefühlt. Doch dann war ein Kollege bei der Polizei mit zweiundvierzig Jahren plötzlich an einem Herzinfarkt gestorben. Einer seiner Jugendfreunde hatte erfahren, dass er Krebs im Endstadium hatte. Langsam hatte es Andreas gedämmert, dass er nicht unsterblich war. Für sein überdurchschnittlich großes Ego war dies ein harter Schlag gewesen, den er noch nicht verdaut hatte.
Andreas war derart in Gedanken versunken, dass er nicht gehört hatte, wie Mikaël und ihr imposanter Bernhardiner die Küche betreten hatten. Sie hatten Minus letztes Jahr aus dem Tierheim geholt, nachdem er dreijährig seine endgültige Größe und ein Gewicht von fünfundsechzig Kilo erreicht hatte und daraufhin ausgesetzt worden war. Hatte man ihn davongejagt, weil er mehr als ein Kilo Fleisch pro Tag fraß? Mikaël und Andreas waren der charmanten Tollpatschigkeit und dem Schlafzimmerblick des großen Hundes jedenfalls sofort erlegen.
»Woran denkst du?«
»An das Glück, dich zu haben… na ja, euch zu haben«, fügte Andreas hinzu, weil Minus kurz und so passend gebellt hatte.
»Begleitest du uns auf einen Spaziergang?«
»Du weißt, dass ich mitten in einer wichtigen Ermittlung stecke. Und dass uns der Staatsanwalt im Nacken sitzt.«
Mikaël nahm keinerlei Anstoß an seinem leicht schroffen und unwirschen Tonfall. Seit ein paar Wochen war Andreas nervöser als gewöhnlich. Seine Arbeit hatte schon immer einen wichtigen Platz eingenommen und beschäftigte ihn manchmal bis zur Besessenheit.
»Wann, meinst du, bist du zurück? Ich könnte dir für heute Abend etwas Leckeres kochen«, sagte Mikaël. »Wir könnten einen Film gucken. Was hältst du davon, wenn wir uns mal wieder ›Breakfast at Tiffany’s‹ anschauen? Du weißt, der Film mit Audrey Hepburn.«
»Willst du nicht lieber einen alten Krimi gucken?«
Andreas umarmte Mikaël und beugte sich dann hinunter, um sich von Minus zu verabschieden, indem er ihm eine Hand auf den Nacken legte. Der Hund fuhr ihm mit der Zunge durchs Gesicht, als sei er eine Windschutzscheibe, die gerade mit einem Reinigungsprodukt behandelt wurde, nur dass das Fenstertuch in diesem Fall eine große, raue Zunge voller Sabber war.
Wir hätten einen Malteser oder einen Chihuahua nehmen sollen, dachte Andreas zärtlich.
Mikaël Achard hatte vor wenigen Wochen seine Festanstellung als Journalist bei der Tageszeitung »24Heures« gekündigt, um mit fünfunddreißig Jahren seine Zukunft selbst in die Hand zu nehmen. Als Freiberufler konnte er jetzt in aller Ruhe von zu Hause aus arbeiten, sich um den Hund kümmern, um den Garten und zu Andreas’ großer Freude auch um die Küche. Immer wieder überraschte er seinen Freund mit neuen Gerichten, deren Geheimnis er allein kannte.
Sie waren gerade von ihrem morgendlichen Spaziergang zurückgekehrt, und Mikaël trocknete die Pfoten des Hundes, der es sich mal wieder nicht hatte nehmen lassen, in die Fluten des nahe gelegenen Wildbachs Avançon zu springen. Lässig schlenderte Minus zu seinem Lieblingsplatz– ein grauweißes Schafsfell, das sie letzten Sommer aus Gotland mitgebracht hatten und das nun vor dem Kamin lag– und ließ sich dort flach auf dem Bauch nieder, den Kopf zwischen den Vorderpfoten, die er mit Ohren und Lefzen bedeckte. Man hätte meinen können, die Schwerkraft habe ihn am Boden festgenagelt oder dass all die Sorgen dieser Welt auf seinen Schultern ruhten. Minus seufzte und schloss die Augen.
Mikaël stieg die knarzende Holztreppe zu seinem Arbeitsplatz hinauf, den er sich auf der oberen Etage eingerichtet hatte. Er schaltete seinen Computer ein.
Den Mittelpunkt des Zimmers bildeten zwei alte sich gegenüberstehende Schreibtische, die er auf dem Flohmarkt erstanden hatte. Ein Teil der weiß verputzten Wand wurde von einem vollbestückten Bücherregal verdeckt. Daneben hingen einige in Öl gemalte Landschaften, die sie bei einem Ferienaufenthalt in Bordeaux in einer Ausstellung entdeckt hatten. Sie hatten sich von den Emotionen, die diese Gemälde ausstrahlten, sofort angesprochen gefühlt und am Ende sogar mehr Bilder als Wein gekauft. Das größte Gemälde zeigte einen Strand, der durch die im Vordergrund stehenden Pinien nur zum Teil sichtbar war, auf dem zweiten Bild waren Weinberge und ein Bauernhaus auf einem Hügel zu sehen und auf dem dritten eine hübsche Kirche, umgeben von einer Steinmauer und Bäumen. Das letzte Gemälde war ein Stillleben: ein Obstkorb, ein Tonkrug und einige Äpfel und Trauben auf einem Holztisch. Die mit Spachteln aufgetragenen Farben sorgten für Bewegung und vermittelten den Eindruck eines Reliefs. Durch die unterschiedlich dicken Schichten lebhafter und frischer Farben wohnte den Bildern ein subtiles Lichtspiel inne.
Mikaël liebte die antiquierte, authentische Atmosphäre des Arbeitszimmers, die von dem alten Holzparkett, seinen Möbeln und seinen Bildern herrührte, allerdings durch seine Macs, die durchaus eines Jüngers von Steve Jobs würdig waren, einen modernen Anstrich bekam. Und dann dieser unglaubliche Blick ins Grüne, den er durch die Glastür, die zum Balkon führte, genießen konnte.
Mikaël hatte an der Universität von Neuenburg seinen Master in Journalismus gemacht und sich anschließend auf die Ressorts Wirtschaft und Politik spezialisiert. Als fest angestellter Redakteur war er jedoch das Gefühl nicht losgeworden, die Quellen zu bestimmten Themen nicht frei wählen zu dürfen. Nur selten hatte man ihm wirklich Spielraum bei seiner Herangehensweise an ein Thema gelassen. Seine Vorgesetzten hatten ihm vorgeworfen, zu kritisch und zu vorlaut zu sein, doch sein Gewissen hatte sich nicht von den Erwartungen einer konformistischen Gesellschaft beschränken lassen. Er brauchte mehr Freiheit, um an die öffentliche Meinung appellieren zu können und sie bei Grundsatzfragen, die ihm am Herzen lagen, aufhorchen zu lassen.
Gerade war er von einer Reise nach Angola zurückgekehrt, wo er eine Reportage über eine brandneue, von Chinesen errichtete Stadt in der Nähe der Hauptstadt Luanda geschrieben hatte. Siebenhundertfünfzig Hochhäuser auf fünftausend Hektar Land. Wohnmöglichkeiten für mehr als fünfhunderttausend Menschen. Als er durch diese Betonwüste gelaufen war, deren Gebäude sich nur durch die Nummern über dem Eingang unterschieden, hatte er sich über die dort herrschende Stille gewundert. Kaum Autos und noch weniger Menschen. Ein apokalyptisches Gefühl. Hatte er eine Fata Morgana gesehen? Waren die Menschen geflohen? Nein. Eine Geisterstadt, die schon tot war, bevor sie überhaupt erblühen konnte. In einem Jahr waren lediglich zweihundertzwanzig Apartments verkauft worden, und die Erklärung dafür lag auf der Hand. Die Reichen konnten es sich leisten, nicht in einer tristen Satellitenstadt leben zu müssen, und die Armen konnten es sich nicht leisten, dort zu leben. Hundertzwanzigtausend Dollar für die günstigste Wohnung, obwohl ein Großteil der Bevölkerung mit zwei Dollar pro Tag auskommen musste. Die Chinesen hatten über drei Milliarden investiert und im Gegenzug dafür einen bevorzugten Zugriff auf die Bodenschätze des Landes erhalten, darunter natürlich vor allem Rohöl. In der vergangenen Woche hatte Mikaël seinem Artikel den letzten Schliff gegeben und Fotos hinzugefügt.
Während er auf Antworten der Zeitungen wartete, denen er den Text angeboten hatte, wollte er sich ein bisschen in die Geschichte Gryons vertiefen, insbesondere was die Herkunft der Bürger des Dorfes und seiner eigenen Vorfahren betraf. Die Familie seiner Mutter ließ sich bis ins 15.Jahrhundert zurückverfolgen. Väterlicherseits fanden sich Wurzeln bei den Waadtländern des Piemont, die Ende des 17.Jahrhunderts unter dem Druck König Ludwig XIV
2
Erica Ferraud, die Pfarrerin von Gryon, saß im Arbeitszimmer des Pfarrhauses und bearbeitete die letzten Zeilen ihrer Predigt, die sie im Zehn-Uhr-Gottesdienst halten würde. Sie hatte die berühmte Bibelstelle zum Jüngsten Gericht aus dem Matthäusevangelium gewählt. Einer der Bibelverse enthielt eine besondere Aufforderung.
Geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer,
das bereitet ist für den Teufel und seine Engel.
Wie ließ es sich heutzutage noch rechtfertigen, dass einigen das Reich Gottes offenstand, während andere zu ewiger Verdammnis verurteilt waren? Verzieh Gott etwa nicht allen Menschen?
Als sie gestern über diese Frage nachgedacht hatte, war ihr ein schmerzhaftes Erlebnis aus ihrer Kindheit hier in Gryon in den Sinn gekommen, das ihr damals viele Nächte lang den Schlaf geraubt hatte. Verdiente dieser Mensch es, zur Hölle zu fahren? Eine Frage, die sich nicht so leicht beantworten ließ. Hatte sie damals alles in ihrer Macht Stehende getan, um zu verhindern, was sich zugetragen hatte? Obwohl sie damals erst zwölf Jahre alt gewesen war, hatte sie sich selbst nie vergeben können.
Aufgrund der damaligen Erlebnisse hatte sie beschlossen, Pfarrerin zu werden. Gutes zu tun war für sie die einzige Antwort auf all die existenziellen Fragen, die sie quälten. Der theologische Diskurs war nicht gerade ihre Stärke, was jedoch durch ihr offenes Ohr und den Zuspruch, den sie anderen gab, mehr als wettgemacht wurde. Sie war von mittlerer Statur, und die paar Kilo zu viel, die sich in den letzten Jahren auf ihren Hüften angesammelt hatten, rührten eher von den zahlreichen Einladungen nach den Gottesdiensten her als von der Küche ihres Mannes. Mit ihrem aschblonden Haar, ihrem rundlichen rosigen Gesicht und ihrem Lächeln strahlte sie Sanftmut und Güte aus.
Ericas Liebe zu den Menschen war aufrichtig und zärtlich. Stets bemühte sie sich, ihren Mitmenschen Trost zu spenden und ihnen zu helfen, den Sinn ihres Daseins zu erkennen. Sie in wichtigen Momenten ihres Lebens zu begleiten, egal, ob sie glücklicher oder schmerzlicher Natur waren. Ihre Empathie und ihr wohlwollender Blick hatten ihr stets große Anerkennung eingebracht. Ihr wohnte eine Melancholie inne, die sie in gewisser Weise schätzte und daher gern kultivierte. Oft stellte sie ihre eigenen Bedürfnisse und Vorlieben zugunsten der Gemeinde hintenan und konnte es so vermeiden, sich den Schatten ihrer Existenz zu stellen.
Als im vergangenen Jahr die Pfarrstelle in Gryon neu besetzt werden musste, war es ihr gelungen, ihren Ehemann, der gerade in den Vorruhestand gegangen war, zu überreden, sich mit ihr hier niederzulassen. Sie war froh gewesen, in ihre alte Heimat zurückzukehren. Nachdem ihre beiden Kinder das Elternhaus verlassen hatten, konnte sie sich nun mit Herz und Seele ihrem geistlichen Amt widmen.
Sie musste noch die letzten Vorbereitungen für den Gottesdienst treffen. Brot und Wein für das Abendmahl bereitstellen und den Tisch decken. Die Gesangbücher herausholen. Wie viele Menschen wohl kommen würden? Seit ihrer Ankunft war die Besucherzahl der sonntäglichen Gottesdienste deutlich gestiegen, was sie sehr freute, ohne sie hochmütig werden zu lassen.
Erica verließ den Schreibtisch und ging in die Küche, aus der ihr ein angenehmer Duft von frisch gebackenem Brot entgegenwehte. Für ein Abendmahl backte sie es stets selbst, nach dem Rezept einer alten Freundin, die im vergangenen Jahr im Alter von dreiundneunzig Jahren gestorben war. Auf Wunsch der Verstorbenen hatte Erica, ein paar Monate bevor sie die Pfarrstelle übernommen hatte, den Trauergottesdienst gehalten. Die Freundin hatte dieses Brot viele Jahre für die Gottesdienste gebacken, denn es war ihre Art gewesen, Gott zu dienen. Ein ganz einfaches Rezept: Mehl, Hefe, lauwarmes Wasser und eine Prise Salz. Erica hatte diese Aufgabe nun übernommen, um die Erinnerung an ihre Freundin wachzuhalten und ihr auf diese Weise weiterhin einen Platz in den Gottesdiensten zu schenken, die in ihrem Leben eine so große Rolle gespielt hatten. Dieses Brot würde gleich während des Abendmahls gebrochen und geteilt werden. Das Brot des Lebens. Sie wiederholte im Geiste die Worte, die sie dabei sprechen würde.
Als es Abend wurde, begab Jesus sich mit den zwölf Jüngern zu Tisch. Während des Mahls nahm er das Brot und sprach den Lobpreis, dann brach er das Brot, reichte es den Jüngern und sprach: Nehmt und esst, das ist mein Leib.
Erica nahm das Brot und eine Flasche Rotwein und verließ das Pfarrhaus. Es war ein strahlender Morgen, und sie hätte sich nicht besser fühlen können. Die Stunden vor dem Gottesdienst erfüllten sie stets mit großer Freude. Sie konnte es kaum erwarten, die Gemeindemitglieder auf der Kirchenschwelle zu begrüßen, als seien sie ihre Gäste, die sie zu einem selbst zubereiteten Festmahl eingeladen hatte. Begleitet von den Geräuschen ihrer Schritte auf dem knirschenden Kies und dem Klopfen eines geschäftigen Buntspechts im Kastanienbaum, durchquerte sie den Hof.
Nicht einmal in ihren schlimmsten Alpträumen hätte sie sich ausmalen können, was sie hinter der Tür im Inneren der Kirche erwartete.
3
Gryon, 1960
An jenem sonnigen Sonntag im September nahm Albert seinen Sohn in den Arm und verspürte ein unbeschreibliches Gefühl des Stolzes. Der kleine Nachzügler. In der dreiunddreißigsten Woche als Frühchen zur Welt gekommen, wog er mittlerweile zweieinhalb Kilo. Er hatte ihn vom ersten Augenblick an geliebt. Das kleine Näschen und die niedlichen rosa Pausbäckchen. Der winzige herzförmige Mund. Die glänzenden blaugrauen Augen. Die leicht abstehenden Ohren und der weiche Haarflaum auf dem Schädel. Ein ganz normaler Säugling, aber sein Kind. Er vernahm ein leichtes Aufstoßen, und kurz darauf lief etwas Milch aus dem Mundwinkel, die er mit einem Lätzchen behutsam abtupfte. Zärtlich betrachtete er seinen Sohn.
Albert war fünfundzwanzig, und dies war sein drittes Kind. Sechs Jahre zuvor hatte er Louise geheiratet, die er auf einem vom Jugendring in Bex organisierten Festabend kennengelernt hatte. Sofort war er ihrem Charme erlegen. Drei Monate später war sie schwanger gewesen. Die Eltern hatten darauf bestanden, dass sie so schnell wie möglich heirateten, was sie auch taten. Schon bald hatte er unter ihrer Fuchtel gestanden und den Eindruck gewonnen, dass der Charme seines Schneewittchens vergänglich war und sie sich unter dem Deckmantel der Bauersfrau in die böse Königin verwandelt hatte. Dennoch hatten sie eine fünfjährige Tochter, einen vierjährigen Sohn und hatten nun den kleinen Nachzügler bekommen.
Albert stammte aus Gryon, war aber in das Bauernhaus seiner Schwiegereltern nach Bex gezogen. Er war sogar erleichtert gewesen, Gryon und damit dem Regiment seines strengen und anspruchsvollen Vaters zu entkommen. Niemals hätte er es gewagt, ihm zu widersprechen.
Sein Schwiegervater ließ ihn an der Leitung des landwirtschaftlichen Betriebes teilhaben, in der Hoffnung, in ihm seinen Nachfolger zu finden. Sie hatten gut zwanzig Kühe, einige Ziegen, zwei Schweine und Hühner. Albert hegte das Gefühl, sich nützlich machen zu können, wohl wissend, dass er immer der kleine Junge bleiben würde, der niemals eine eigene Meinung haben oder diese gar kundtun durfte und nie unabhängig sein würde. Er meinte, zwischen seinem Schwiegervater und seiner Frau in der Falle zu sitzen. In ihrer Ehe war sie es, die entschied. Mehrfach hatte er versucht, sich gegen sie durchzusetzen. Ein echter Mann zu sein! Doch gegen ihren gestählten Willen kam er nicht an, sodass er sich längst kampflos ergeben hatte.
Wie jeden Sonntag waren er und seine Familie auch heute nach dem Melken nach Gryon hochgewandert, um den Tag mit seinen Eltern zu verbringen. Vor allem im Frühjahr und im Herbst war dieses Familientreffen auf der Alphütte zur Tradition geworden, nur im Sommer hatte die Heuernte Vorrang.
Trotz der Gegenwart seines Vaters Edmond, der keine Gelegenheit ausließ, ihn zu erniedrigen oder seine Art, die Kinder zu erziehen, zu tadeln, genoss Albert diese Momente. Vor allem die Gesellschaft seiner Mutter Odile, die sich stets bemühte, ihn vor den Wutanfällen seines Vaters zu schützen. Als er klein gewesen war, hatte sie ihm vor dem Einschlafen oft eine Geschichte erzählt, um ihn zu trösten. Auch als Erwachsener beglückten Albert diese seltenen intimen Augenblicke mit seiner Mutter. Eine Blase der Unbeschwertheit, in der er sich wohlfühlte und in die die Außenwelt nicht einzudringen vermochte.
Während Odile und Louise in der Küche das Essen vorbereiteten und Edmond mit den beiden größeren Kindern bastelte, bewunderte Albert auf der Terrasse des Chalets das Bergpanorama. Er liebte diesen Ort.
4
Sonntag, 9.September
In seinem alten silbernen BMW635 CSi fuhr Andreas durch den Dorfkern von Gryon. Obwohl sein Auto unzählige Kilometer auf dem Buckel hatte, konnte er sich nicht entschließen, es gegen ein neues einzutauschen. Er liebte den besonderen Charakter alter Autos, während er bei neuen Fahrzeugen häufig ein gewisses Temperament vermisste. Ihm gefielen das sportliche Aussehen des Wagens mit der haiförmigen Schnauze, das sanfte Schaukeln und das Schnurren des Sechszylinder-Reihenmotors auf seinen täglichen Fahrten.
Andreas war dem Charme Gryons bereits erlegen, als Mikaël ihn vor ein paar Jahren zum ersten Mal dorthin mitgenommen hatte. Mikaël hatte in dem Dorf seine ersten zehn Lebensjahre verbracht, bevor sein Vater in Leysin eine Arbeit gefunden hatte und mit der Familie umgezogen war. Für den jungen Mikaël war es ein traumatisches Erlebnis gewesen, den Ort seiner Kindheit und seine Freunde verlassen zu müssen. Das kleine, immer noch ursprüngliche Gryon mit seinen pittoresken Gässchen lag an einer Bergflanke und ragte weit in die von den Wassern des Avançon gegrabene Schlucht hinein. Der Dorfkern bestand aus dunklen Holzchalets auf Steinsockeln, die zum Teil bereits im 17.Jahrhundert errichtet worden waren, und man hatte das Gefühl, dass jeder dieser Steine eine Geschichte erzählen konnte.
Gerade als Andreas das Dorf in Richtung Les Posses verließ, kamen ihm zwei Polizeifahrzeuge mit blinkendem Blaulicht entgegen. Sein Handy spielte dazu die Titelmelodie von »Indiana Jones«, die er seiner abenteuerlustigen und mutigen Kollegin Karine Joubert zugewiesen hatte. Seit fast fünf Jahren bildeten sie ein perfekt eingespieltes Ermittlerteam der Kriminalpolizei von Lausanne.
»Hallo, meine Liebe! Vermisst du mich?«
»Na ja, das hält sich in Grenzen. Hör auf mit dem Geplänkel. Wo bist du gerade? Wir haben einen Anruf von der Polizeidienststelle in Bex erhalten. In Gryon wurde eine Leiche entdeckt. Wir sind auf dem Weg.«
»In Gryon? Wo?«
»In der Kirche.«
Andreas’ Herz schlug schneller. Er wendete sofort.
Ein paar Minuten später erreichte er Fond de Ville, die Dorfmitte Gryons, die sich in großem Aufruhr befand. Mindestens zwanzig Menschen hatten sich auf der Straße versammelt, offenbar hauptsächlich Kirchgänger und ein paar Schaulustige. Einige kannte er vom Sehen. Weitere Personen blickten von ihren Balkonen herunter.
Andreas parkte sein Auto mitten auf der Straße direkt am Dorfbrunnen, stieg aus und schlug die Wagentür zu. Alle Blicke richteten sich auf ihn.
Obwohl er erst vor Kurzem nach Gryon gezogen war, hatte die Nachricht, dass sich ein Kriminalbeamter in der Gegend niedergelassen hatte, sofort die Runde gemacht. Mit seinem Äußeren fiel er in dem kleinen Bergdorf ja auch etwas aus dem Rahmen und blieb nirgends unbemerkt. Ihm war bewusst, dass er ein gewisses Charisma besaß, das ihm häufig, auch in dringenden Fällen, weiterhalf. Sein Gang und seine Haltung strahlten Selbstsicherheit aus. Die grauen, sehr kurzen Haare und die Sommerbräune seiner Haut betonten seine stahlblauen Augen, die an Gletschereis oder an die Augen eines Huskys erinnerten. Der graue Dreitagebart verlieh ihm markante, aber zugleich auch harmonische Gesichtszüge, die Fältchen um die Augenwinkel wirkten geradezu charmant. Wie immer trug er eine verwaschene und leicht abgewetzte Jeans und Cowboystiefel, die mit ihren eckigen Spitzen und verzierten Metallbeschlägen aus einem Sechziger-Jahre-Western zu stammen schienen. Um den Stil des Bad Boy zu vervollständigen, den er sorgfältig kultivierte, trug er dazu ein weißes T-Shirt ohne Aufdruck, eine goldene Halskette und eine Lammfelljacke.
Er genoss es, im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen, und war vermessen genug, sich manchmal sogar über die Menge erhaben zu fühlen. Dabei war er sich seines Hangs zur Egozentrik und seines Narzissmus durchaus bewusst, der ihm in der Vergangenheit oft angekreidet worden war und seine Beziehungen zu Freunden und Partnern nicht selten aufgemischt hatte. Dank einer Psychoanalyse, die drei Jahre gedauert und ihn eine ganze Stange Geld gekostet hatte, konnte er sich selbst und andere besser verstehen und war vor allem inzwischen in der Lage, die Welt nicht nur von seinem eigenen Standpunkt aus zu betrachten. Dass er und Mikaël vor zehn Jahren ein Paar geworden waren, verdankte er sicherlich auch dieser Therapie.
Zwei Polizisten hatten den Eingang zur Kirche, einem der ältesten Gebäude des Dorfes, mit Plastikbändern abgeriegelt, die die Aufschrift »Polizei– Zutritt verboten« trugen. Unter dem Vorbau des Portals sprach ein Polizist mit einer Frau, die Andreas sofort als die Pfarrerin Erica Ferraud erkannte.
Die Glocken begannen zu läuten. Die Zeiger der Kirchturmuhr zeigten zehn Uhr an. Andreas hielt dem auf dem oberen Treppenabsatz stehenden Beamten seine Dienstmarke hin.
»Kein schöner Anblick.«
Der Polizist bewahrte Ruhe, doch Andreas konnte seinem Blick entnehmen, wie sehr ihn das Gesehene bewegte. »Wer hat den Leichnam entdeckt?«, fragte er ihn.
»Die Pfarrerin.«
»Ist noch jemand drinnen?«
»Nein. Wir haben den Tatort abgesichert.«
»Gut. Ich schaue es mir an. Bitten Sie die Pfarrerin zu warten. Ich werde gleich mit ihr sprechen. Und lassen Sie niemand sonst rein.« Während Andreas eilig auf die Kirchentür zuschritt, drehte er sich noch einmal um. »Und nutzen Sie die Zeit, die Namen aller Umstehenden zu erfassen.«
Andreas stieß die massive Holztür auf, die dies mit einem Knarzen quittierte, und betrat die kleine Vorhalle, die als Schleuse zwischen dem Draußen und Drinnen, dem Vorher und Nachher diente. Es herrschte Totenstille. Bevor er die zweite Tür öffnete, die ihn direkt ins Kirchenschiff führen würde, hielt er kurz inne. Er wollte allein sein. Er wusste aus Erfahrung, wie wichtig der erste Eindruck für die anschließende Ermittlung sein würde. Ein Tatort glich einem aufgeschlagenen Buch. Er musste es betrachten, es lesen, es studieren und den Worten lauschen. Er musste versuchen, eins mit der Umgebung zu werden, um sie vollständig zu erfassen.
Kaum hatte er die Schwelle überschritten, umgab ihn ein Gefühl der Ruhe und der Wärme. Der Raum war schlicht, ohne Schnörkel oder irgendwelche prunkvollen oder morbiden Darstellungen. Die einfachen Holzbänke legten Zeugnis ab von Gemeindemitgliedern vieler Generationen. Das runde Gewölbe aus Tannenholz, das nach einem Brand im Jahr 1719, der auch große Teile des Dorfes zerstört hatte, wiederaufgebaut worden war, trug zu der Ruhe bei, die dieser Raum ausstrahlte. Hinten rechts befand sich die Kanzel. Wie viele weise oder unsinnige Predigten waren in den letzten achthundert Jahren von dort oben wohl zu hören gewesen?
Während Andreas den Gang weiter entlangschritt, wurde sein Blick von einem bunten Kirchenfenster im Gemäuer des Chores angezogen. Es stellte Jesus mit einem Heiligenschein dar, dessen Gesicht von zusätzlichen Lichtstrahlen erhellt wurde. Kein Licht ohne Schatten, dachte er. Auf dem sehr viel kleineren Fenster darüber erkannte er die Darstellung einer Friedenstaube. Hatte der Mörder oder die Mörderin inneren Frieden gefunden? Hatte der Mord mit einer unbändigen Wut auf Gott zu tun?
Andreas war noch ein paar Schritte weitergegangen. Die nackte Leiche lag ausgestreckt auf dem Altar. Mit den waagerecht ausgebreiteten Armen und den mit einem Seil zusammengebundenen Beinen erinnerte der Tote an den gekreuzigten Jesus. Ein Mann. Vermutlich um die fünfzig. In seinem Herzen steckte ein langes Messer. Um die Wunde herum hatte sich das inzwischen getrocknete Blut wie ein Netz aus kleinen Rinnsalen von der Brust bis zu seinem Geschlechtsteil ausgebreitet. Man hatte ihm die Augen entfernt. Die Augenhöhlen sahen aus wie zwei schwarze Löcher. Am Messergriff hing ein mit einer kleinen Kordel befestigtes Stück Papier.
Andreas streifte sich seine Latexhandschuhe über, nahm den Zettel ab und las die folgenden Zeilen:
Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist,
5
Nachdem Andreas sich viel Zeit in der Kirche gelassen hatte, trat er wieder nach draußen. Zu der Gruppe auf dem Platz waren inzwischen neue Gesichter hinzugekommen.
Die dort herrschende Unruhe, die er im Kircheninneren nicht hatte wahrnehmen können, vermittelte ihm kurz das Gefühl, aus einem Traum zu erwachen. Die Leiche auf dem Altar. Die Schaulustigen auf dem Kirchplatz. War das real? Die schwere Tür fiel laut ins Schloss. Alle drehten sich zu ihm um, und eine bedrückende Stille breitete sich auf dem Platz aus. Alle Blicke waren auf Andreas gerichtet, die Leute erwarteten eine Bestätigung. Doch sein Gesichtsausdruck sagte schon alles.
Es stimmte also.
Hier war ein Mord geschehen.
Andreas schaute die Straße hinunter, aber sein Team war noch nicht in Sicht. Er kannte Karine gut genug, um zu wissen, dass sie bereits den Gerichtsmediziner kontaktiert und einen Leichenwagen bestellt hatte. Er musste nur warten, bis sie eintrafen.
Er beschloss, mit der offensichtlich sehr aufgewühlten Pfarrerin zu sprechen. Sie saß etwas abseits der Menschenmenge auf einer an die Kirchenmauer gelehnten Holzbank. Ihr Ehemann Gérard Ferraud hielt sie in den Armen. Ein sehr zurückhaltender und unauffälliger Mann in beigefarbener Hose und grün kariertem Hemd. Eine lange Haarsträhne bedeckte die beginnende Glatze. Auf der Nasenspitze saß eine kleine Brille mit rechteckigen Gläsern. Er wirkte älter als seine Frau.
Andreas bot ihnen an, ins Haus zu gehen, um mehr Ruhe zu haben, und folgte ihnen dann in das Pfarrhaus hinter der Kirche. Es war ein altes Gebäude mit rot-weiß gestrichenen Fensterläden und einem Türrahmen aus Stein, neben dem sich eine ebenfalls alte Scheune befand.
Kaum hatte Andreas die Diele betreten, wurde sein Blick auf das Zimmer zu seiner Rechten gelenkt. Dort brannte eine Kerze auf einem riesigen Schreibtisch aus massiver Eiche. Offenbar das Arbeitszimmer der Pfarrerin. Unter einer Bibel lag ein Stoß Blätter. Vermutlich die heutige Predigt. Worüber hatte sie reden wollen? Rechts davon ein imposantes Bücherregal mit zahlreichen theologischen Werken.
An der Wand ein Bild des gekreuzigten Jesus, das einen starken Gegensatz zu dem darstellte, was er gerade in der Kirche erlebt hatte. Andreas erkannte das Bild als eine Kopie eines Gemäldes des spanischen Malers Velázquez. Er hatte es im Prado gesehen, als er und Mikaël im Frühling ein Wochenende in Madrid verbracht hatten. Die dunkle Leinwand rückte das Leiden Jesu in den Vordergrund. Von den Füßen und Händen tropfte Blut. Der Kopf war leicht nach vorn geneigt. Die Haare verdeckten die Hälfte des Gesichts. Dieser Mensch schien resigniert zu haben. Im Geiste hörte Andreas jene Worte, die Jesus am Kreuz gesprochen hatte: »Mein Gott, warum hast du mich verlassen?« Hatte Gott auch Erica Ferraud verlassen? Die Vorstellung beunruhigte ihn.
»Hier entlang, Monsieur le Commissaire.«
Andreas wandte sich um und folgte Gérard Ferraud bis zur Küche am Ende des Flurs. Dort bot man ihm einen Platz an dem Holztisch an, der mitten im Raum stand. Er setzte sich Erica Ferraud gegenüber. Sie wirkte abwesend. Tränen liefen ihr über die Wangen. Gérard Ferraud schaltete die Kaffeemaschine ein und setzte sich mit an den Tisch.
Andreas schaute sich aufmerksam um, bevor er das Wort ergriff. Zwischen den beiden Fenstern, die zum Garten hinausgingen, befand sich eine antike Anrichte, auf der Zinnkannen und Postkarten mit alten Schwarz-Weiß-Motiven von Gryon standen. Eine der Karten zeigte das Dorf mit dem Bergmassiv der Dents du Midi im Hintergrund. Auf einer anderen Karte waren die Kirche und der Grand Muveran zu sehen, und auf einer dritten saßen zwei alte Männer auf einer Bank vor einem historischen, mit zahlreichen Holzschnitzereien verzierten Chalet und unterhielten sich vielleicht über vergangene Zeiten.
Andreas ließ seinen Blick weiter durch die Küche schweifen. Neben dem Herd stand ein antiker Holzofen, auf dem »Le Rêve« zu lesen war. Seine Großmutter hatte ebenfalls einen Herd dieser Schweizer Traditionsmarke besessen, den er ein paar Jahre lang in seiner ersten Schweizer Wohnung aufgestellt hatte. Der Herd hatte trotz seiner mehr als sechzig Jahre treu seine Dienste getan. Obwohl Andreas die sentimentale Angewohnheit hatte, solche Dinge aufzubewahren, hatte er sich widerstrebend davon getrennt, als er mit Mikaël zusammengezogen war.
Auf dem Kühlschrank klebten alle möglichen Magneten. Offenbar Urlaubssouvenirs. Ein Londoner Doppeldeckerbus. Der Eiffelturm. Das Kolosseum. Ein gelbes Taxi aus New York. Nicht besonders originell, dachte Andreas. Einige Magneten fixierten Postkarten, die jüngeren Datums zu sein schienen, da es sich um Farbfotografien handelte. Auf dreien waren typische New Yorker Ansichten zu sehen: die Freiheitsstatue, das Empire State Building und der Central Park.
Als Andreas das Geräusch eines Streichholzes hörte, das entzündet wurde, richtete er den Blick nach vorn auf die unbehandelte alte Holzplatte des Tisches, auf der man die Maserung und all die Risse erkennen konnte, die die Zeit hinterlassen hatte. In der Mitte stand eine dicke runde Kerze, die Gérard Ferraud gerade entflammt hatte.
»Kennen Sie das Opfer?«
Erica Ferraud schien Andreas nicht gehört zu haben, doch nach einem kurzen Moment löste sie sich aus ihrer Starre, wandte den Kopf, stieß einen tiefen Seufzer aus und beantwortete die Frage, die er ihr etwas abrupt gestellt hatte.
»Ja. Ich kannte ihn. Es ist schrecklich. Alain Gautier, der Leiter der Immobilienagentur im Dorfzentrum, direkt neben dem Café Pomme, wenn Ihnen das etwas sagt. Unvorstellbar. In der Kirche!«
Wieder rannen ihr Tränen über die Wangen. Sie nahm das Taschentuch, das ihr Ehemann ihr reichte.
»Ich weiß, wie schwer das für Sie ist. Sind Sie damit einverstanden, mir jetzt ein paar Fragen zu beantworten? Wenn nicht, hat das auch Zeit bis später.«
»Nein, nein. Ich bitte Sie, Monsieur le Commissaire.«
»Könnten Sie mir berichten, wann und wie Sie die Leiche gefunden haben?«
»Mein Mann und ich haben wie immer gegen sieben Uhr dreißig gefrühstückt. Gegen acht Uhr habe ich mich in mein Arbeitszimmer zurückgezogen, um meine Predigt fertig zu schreiben. Und so gegen neun Uhr bin ich dann rüber zur Kirche.«
»Ist Ihnen beim Betreten der Kirche etwas Ungewöhnliches aufgefallen?«
»Nein, nichts… bis zu dem Moment, als…«
Erica Ferraud brach erneut in Tränen aus. Sie trocknete ihre geröteten Augen und ihre Wangen, bevor sie den Kopf hob. Ihre Mascara war verlaufen.
»Sie trinken doch einen Kaffee, Monsieur le Commissaire?« Ohne Andreas’ Antwort abzuwarten, wandte sich Gérard Ferraud zur Kaffeemaschine, deren Kontrollleuchte auf Grün umgesprungen war.
»Gestern Abend oder heute Nacht, haben Sie da etwas Ungewöhnliches gehört oder gesehen?«
»Nein, ich glaube nicht… Nein, nichts.«
»Was haben Sie gestern Abend gemacht? Sind Sie noch mal rüber zur Kirche gegangen?«
»Ja, in der Tat. So gegen zwanzig Uhr, unmittelbar vor dem Abendessen. Ich habe mich in eine Kirchenbank gesetzt und einen Moment meditiert und gebetet. Und ich habe schon mal die Nummern der Kirchenlieder angeschlagen. Nach dem Essen bin ich noch mal ins Arbeitszimmer gegangen, um den Gottesdienst vorzubereiten. Gérard hat Fernsehen geschaut. Er ist so gegen zweiundzwanzig Uhr ins Bett. Nicht wahr, Liebling?«, fragte sie ihren Mann, der inzwischen die dritte Tasse Espresso eingeschenkt hatte.
Gérard Ferraud setzte sich wieder zu ihnen. Auf dem Tablett, das er auf den Tisch gestellt hatte, standen neben den drei Kaffeetassen eine Flasche Aprikosenschnaps und zwei kleine Gläser. Er schob eines der Gläser in Andreas’ Richtung, der es jedoch mit einer Handbewegung ablehnte. Danach füllte er sein eigenes Glas bis zum Rand. Andreas bemerkte die Schweißflecken unter seinen Achseln und die Tropfen auf seiner Stirn. »Nehmen Sie Milch oder Zucker?«
»Nein danke, ich trinke ihn schwarz.« Obwohl Andreas seinen Kaffee meist mit Milch aus einer großen Tasse trank, freute er sich ab und zu über einen echten Espresso.
»So gegen zweiundzwanzig Uhr fünfzehn. Nach dem Ende der Fernsehsendung, die ich geschaut habe. Ich habe dir noch eine gute Nacht gewünscht«, fügte er hinzu, wobei er auf einen bestätigenden Blick seiner Frau wartete. »Danach bin ich zu Bett gegangen.«
Er nahm das Schnapsglas und leerte es in einem Zug. Danach schenkte er sich ein zweites Glas ein, was Andreas erstaunt beobachtete, während Erica offensichtlich mit den Gedanken woanders war.
»Ich selbst habe mich gegen halb eins schlafen gelegt«, sagte sie.
»Das stimmt. Ich bin nämlich noch mal aufgewacht. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke… habe ich kurz darauf das Geräusch eines Autos gehört, das nicht weit von hier abgestellt wurde. Ich habe dabei sogar noch auf meine Uhr geschaut. Genau um zehn vor eins.«
Andreas wollte sein Notizheft aus der Innentasche seiner Jacke ziehen, um die Angaben aufzuschreiben, doch er hatte es in der Eile im Auto liegen lassen.
»Gehörte Alain Gautier zu Ihren Gemeindemitgliedern?«
»Nein. Er ist nur einmal auf einer Beerdigung gewesen, wenn ich mich recht entsinne«, sagte Erica. »Er gehörte nicht zu den regelmäßigen Besuchern der Kirche. Außerdem war er katholisch.«
»Kannten Sie ihn gut?«
»Er war mein Jahrgang. Wir sind zusammen zur Schule gegangen. Hier in Gryon. Aber danach haben wir uns aus den Augen verloren. Ab und zu habe ich ihn im Dorf getroffen, und dabei haben wir dann ein paar Worte gewechselt. Mehr nicht. Schon als Kinder hatten wir nicht viel miteinander zu tun.«
Für einen kurzen Moment hatte Andreas ein bestimmtes Bild vor Augen, das aber sofort wieder verschwand. Er versuchte, ihm nachzuspüren. Was hatte er da gerade zwischen Erica Ferrauds Worten vernommen? Hatte sie Gautier besser gekannt, als sie zugeben wollte? Oder lag es am Verhalten ihres Ehemanns?
Irgendetwas entging ihm hier.
Er beschloss, es vorerst dabei zu belassen. Erica Ferraud war ganz offensichtlich mit den Nerven am Ende, auch wenn sie seine Fragen ruhig und sachlich beantwortet hatte.
»Ich danke Ihnen. Ich möchte Sie allerdings bitten, niemandem zu erzählen, was Sie wissen. Für die Ermittlungen ist es wichtig, dass diese Informationen den Raum hier nicht verlassen. Falls Ihnen noch etwas einfällt, mag es Ihnen auch noch so unbedeutend erscheinen, dann zögern Sie nicht, mich anzurufen. Hier ist meine Karte.«
6
Auf dem Platz mit dem Brunnen oberhalb der Kirche traf Andreas auf seine Kollegin Karine und auf Christophe von der Spurensicherung, dicht gefolgt vom Gerichtsmediziner, der ebenfalls gerade eingetroffen war.
Der Dorfkern war mit den unterschiedlichsten Wagentypen zugeparkt. Immer mehr Schaulustige waren hinzugekommen und ergänzten den ungewöhnlichen Anblick. Der blaue Schein der Warnleuchten spiegelte sich in den Fensterscheiben der umstehenden Chalets.
Nachdem Andreas ein neues Notizheft aus dem Handschuhfach seines Autos geholt hatte, winkte er seinen Kollegen zu und gab ihnen ein Zeichen, ihm ins Innere der Kirche zu folgen.
Sie bildeten einen Halbkreis um den Altar und betrachteten die Szene, die sich ihnen dort bot.
»Oh mein Gott!«, rief Karin entsetzt.
»Du weißt gar nicht, wie recht du damit hast«, erwiderte Andreas.
Christophe hatte die Augen aufgerissen. Der Gerichtsmediziner schaute ihn fragend an und kratzte sich dabei mit der rechten Hand am Kopf.
Andreas brachte sie kurz auf den neuesten Stand.
Ohne Zeit zu verlieren, zückte Christophe seinen Fotoapparat und begann, den Tatort aus allen Blickwinkeln zu fotografieren. Der Gerichtsmediziner wartete sichtlich ungeduldig darauf, dass er damit fertig wurde, damit er selbst die Leiche näher untersuchen konnte.
»Das ist ja wie im ›Da Vinci Code‹«, sagte Karine, die spürte, wie ihr Puls schneller schlug.
Karine war sechsunddreißig Jahre alt. Ihr Vater, ebenfalls ein Polizist, hatte sie, da er keinen Sohn hatte, von klein auf Kampfsportarten trainieren lassen, daher besaß sie den höchsten Gürtelgrad, den roten Gürtel, im Jiu-Jitsu. Ihr nicht ganz ebenmäßiges Gesicht war ausdrucksstark und ihr Blick durchdringend. Mit ihrer Präsenz und ihrer entschlossenen Haltung beeindruckte sie selbst mutige Männer. Ihre größte Freude bestand darin, den Gegner zu beherrschen. In Situationen, die Körpereinsatz erforderten, war sie stets die Schnellste, was Andreas durchaus recht war, denn trotz seiner Machoallüren vermied er nach Möglichkeit den Nahkampf.
»Der Mörder hat eine regelrechte Inszenierung gewählt. Wie im Theater oder wie auf einem Gemälde. Ja, wie ein Gemälde«, wiederholte Andreas.
War das Kunst? War der Mörder ein Künstler? Der ganze Tatort wirkte, als sollte alles einen bestimmten Sinn, eine Symbolik haben. Nichts schien dem Zufall überlassen worden zu sein. Hier hatte jemand eine Botschaft hinterlassen.
Andreas holte Notizheft und Stift hervor und schrieb auf die erste Seite »Gryon, Mord in der Kirche« und das Datum. Er blätterte um und machte mitten auf der nächsten Seite eine Anmerkung, die er zweimal energisch unterstrich. »Eine Botschaft für wen?«
Für uns?
Für die Pfarrerin?
Für die Gesellschaft?
Für Gott?
Andreas hatte die Angewohnheit, bestimmte Ideen sofort niederzuschreiben, damit sie sich nicht im Wirrwarr seiner Gedankengänge verflüchtigten. Dinge, die ihm wichtig erschienen. Entscheidende Fragen, die er beantworten musste, um weiterzukommen. All das schrieb er auf und benutzte daher auch für jeden Fall ein neues Notizheft.
Andreas unterbrach den sehr konzentriert wirkenden Gerichtsmediziner bei der Arbeit. »Was meinst du, wann war der Todeszeitpunkt, Doc?«
Doc war ein merkwürdiger, sehr interessanter Mensch. Merkwürdig, weil er mit seinen struppigen, ungekämmten Haaren und seinen dicken Brillengläsern wie ein verrückter Wissenschaftler wirkte, der fernab der Gesellschaft in seiner ganz eigenen Welt zu leben schien. Und genau das machte ihn auch so interessant. Er stürzte sich mit der Gier einer ausgehungerten Hyäne auf jeden neuen Fall, als sei dies sein einziger Lebensinhalt.
Über die Leiche gebeugt, hob er den Kopf, griff sich mit der linken Hand ans Kinn, legte den Zeigefinger auf den Mund und murmelte eine Antwort. »Mmh, die ganze Leiche ist steif wie eine Statue. Die Kiefer sind fest aufeinandergepresst. Kopf und Hals sind nach hinten überstreckt. Die rechte Hand wirkt verkrampft. Die Beine sind gestreckt. Der Rigor mortis ist also voll ausgeprägt. Daher muss der Tod vor mindestens zwölf Stunden eingetreten sein.«
Doc verwandte gern wissenschaftliche Begriffe, um sich wichtigzumachen, und er hatte Spaß daran, in die betretenen Gesichter der Polizeibeamten zu gucken, die vorgaben, seine Fachausdrücke zu verstehen. Bei Andreas und Karine war das jedoch etwas anderes, denn sie arbeiteten schon seit ein paar Jahren mit ihm zusammen. Es war zu einer Art Spiel zwischen ihnen geworden.
»Die Livores… ähm, die Totenflecken, für all diejenigen von euch, denen die lateinische Sprache für immer ein Mysterium bleiben wird«, präzisierte er mit verschmitztem Lächeln, »lassen sich noch wegdrücken. Hier, die violetten Flecken, die man an verschiedenen Körperstellen sehen kann. Ich konnte mit meinem Daumen das Blut in den Adern noch bewegen, sodass die Haut an dieser Stelle wieder hell geworden ist. Nach etwa fünfzehn bis achtzehn Stunden ist das Blut bereits so eingedickt, dass die Flecken unter dem Druck meines Fingers nicht mehr verblassen.«
Der Arzt hatte einen diebischen Spaß daran, jedes Mal aufs Neue die Grundlagen der forensischen Medizin zu erklären und genau zu erläutern, auf welchen Anzeichen seine Schlussfolgerungen basierten. Das gehörte einfach zu seiner Arbeitsmethode.
Er blickte auf die Anzeige eines Thermometers, mit dem er gerade die Temperatur des Leichnams gemessen hatte.
»Siebenundzwanzig Grad. Die Algor mortis…«
»Die Leichenkälte«, übersetzte Karine, um zu zeigen, dass sie bei seinen Ausführungen aufgepasst hatte.
»…ist eine Angleichung der Körpertemperatur an die Umgebung. Wenn man davon ausgeht, dass die Temperatur ab zwei Stunden nach Eintritt des Todes in den ersten zehn Stunden stündlich um ein Grad und danach um ein halbes Grad sinkt… dann würde ich sagen, dass der Todeszeitpunkt mindestens zehn bis zwölf Stunden zurückliegt. Also ist der Mann vermutlich gestern Abend gestorben.«
»Könntest du dich da etwas präziser festlegen?«
»Nicht wirklich. Die Totenkälte hängt von verschiedenen Faktoren ab, unter anderem von der Umgebungstemperatur. Und hier in der Kirche ist es verhältnismäßig kühl. Achtzehn Grad etwa. Je niedriger die Außentemperatur, desto schneller kühlt die Leiche aus. Zumal diese hier auch noch vollkommen nackt ist. Allerdings wurde sie erst nach dem Tod hier abgelegt. Das erschwert die Berechnung, denn wir wissen nicht, wo sie getötet wurde und was für Bedingungen geherrscht haben, bevor sie hergebracht wurde.«
»Woher weißt du, dass der Mann nicht hier getötet wurde?«
Doc richtete sich auf, hob den Kopf und faltete die Hände über dem Bauch, als wolle er eine öffentliche Rede halten. »Die Todesursache ist zweifelsfrei der Messerstich ins Herz gewesen. Angesichts der geringen Menge Blut auf dem Leichnam ist es jedoch offensichtlich, dass der Mord woanders stattgefunden haben muss. Außerdem sind nirgends Blutspuren zu finden, weder auf dem Altar noch auf dem Boden. Und auch die Totenflecken beweisen eindeutig, dass die Leiche umgelagert wurde. Ich würde sogar behaupten, dass sie sechs bis zwölf Stunden nach Eintritt des Todes transportiert wurde.«
»Erklär das genauer.«
»Mit dem Eintritt des Todes hört das Blut auf zu fließen. Ein Herzstillstand verursacht einen sofortigen Durchblutungsstopp. Die Kapillaren werden durchlässig für die roten Blutkörperchen, die sich im Gewebe unter der Haut ablagern. Durch die Schwerkraft bilden sich Totenflecken an den am tiefsten liegenden Teilen der Leiche. Dort, wo sich das Blut ansammelt, wird es unter der hellen, durchscheinenden Haut sichtbar. Hier hinten haben wir einen dorsalen Dekubitus, der uns zeigt, dass die Leiche auf dem Rücken liegend gelagert wurde. In diesem Fall bilden sich auch im Nacken, am Gesäß und auf der Unterseite der Schenkel Totenflecken, und genau das können wir hier erkennen. Allerdings sehen wir auch Totenflecken auf dem Bauch, auf den Schenkelvorderseiten und im Gesicht.«
»Dann würde man von einem ventralen Dekubitus sprechen«, kam Andreas Doc zuvor.
»Ganz genau. Die Leiche hat also zunächst einige Zeit auf dem Bauch gelegen, bevor sie auf den Rücken gedreht wurde. Wird jedoch eine Leiche mehr als zwölf Stunden nach Eintritt des Todes umgelagert, bilden sich keine neuen Totenflecken mehr aus. In diesem Fall würde man also eine auf dem Rücken liegende Leiche mit Totenflecken auf dem Bauch oder eine auf dem Bauch liegende Leiche mit Totenflecken auf dem Rücken finden. Wird eine Leiche jedoch innerhalb der ersten sechs Stunden nach ihrem Tod transportiert, verändern sich die Totenflecken entsprechend der neuen Lage.«
»Und in diesem Fall würde man also die Totenflecken der letzten Stellung der Leiche sehen, und man könnte nicht mehr sagen, ob sie vorher transportiert wurde.«
»Ganz genau. In der nächsten Phase, im Zeitraum von sechs bis zwölf Stunden nach dem Tod, bleiben die Totenflecken allerdings bestehen, und neue können hinzukommen. Also genau wie in unserem Fall hier. Auf dem Rücken und auf dem Bauch.«
»Wenn wir also davon ausgehen, dass der Todeszeitpunkt mindestens zwölf Stunden, also gegen zweiundzwanzig Uhr gestern Abend, und höchstens fünfzehn Stunden zurückliegt, also gegen neunzehn Uhr, dann glaubst du, dass die Leiche zwischen ein und vier Uhr morgens hierhertransportiert worden sein könnte.«
»Stimmt.«
»Und was kannst du uns zu diesem Zeitpunkt noch erzählen?«
»An den Handgelenken konnte ich leichte Verbrennungsmale auf der Haut feststellen. Womöglich wurde der Mann an den Händen gefesselt. Genaueres kann ich euch aber erst nach der Autopsie sagen.«
»Und was ist mit seinen Augen?«
»Da möchte ich mich noch nicht genau festlegen, aber nach meinen ersten Erkenntnissen könnten ihm die Augen bei lebendigem Leibe entfernt worden sein.«
»Wie furchtbar«, rief Christophe.
»Um sicher zu sein, sind weitere Untersuchungen erforderlich. Hämorrhagische Verletzungen können nur bei Lebenden entstehen. Nach dem Stillstand des Blutes können bei einem Toten keine inneren Blutungen mehr ausgelöst werden. Aber…«
»Bei dir gibt es immer ein Aber…«
»Das stimmt, das Aber ist in diesem Fall die Supravitalität.«
»Die Supra-was?«, hakte Karine nach.
7
Andreas stand schon auf der Schwelle der Tür, als er sich noch einmal umdrehte. Irgendetwas meinte er im Inneren der Kirche noch bemerkt zu haben, aber das Bild in seinem Kopf blieb verschwommen. Irgendetwas hatte er übersehen. Es war, als würde ihm eine innere Stimme zuflüstern: »Andreas, du hast hier noch nicht alles gesehen und noch nicht alles verstanden!« Es war nur so ein diffuses Gefühl. Er würde zurückkommen.
Draußen überreichte ihm einer der Polizisten eine Liste mit den Kontaktdaten all derer, die sich vor der Kirche aufhielten.
»Monsieur le Commissaire, hätten Sie eine Minute Zeit für mich?« Aus der Menschenmenge trat ein Mann hervor.
Der schon wieder! Dieser sensationslüsterne Aasgeier, dachte Andreas. Fabien Berset verfolgte sämtliche Kriminalfälle der Region und hatte die unangenehme Angewohnheit, immer als einer der Ersten zur Stelle zu sein. Andreas hegte den Verdacht, dass er den Polizeifunk mithörte oder eine Freundin in der Telefonzentrale hatte. Auch wenn ihm dieser Kerl nicht gerade das Leben erleichterte, bewunderte Andreas dennoch seinen Kampfgeist.
»In der Kirche wurde eine Leiche gefunden. Mehr kann ich Ihnen in diesem Stadium der Ermittlungen noch nicht sagen.«
»Kommissar! Bei dem Toten handelt es sich doch um Alain Gautier, oder? Wie ist er denn gestorben?«
Andreas antwortete nicht und bahnte sich einen Weg durch die Menge. Berset folgte ihm.
»Angeblich wurde bei der Leiche eine Botschaft gefunden?«
Andreas blieb unvermittelt stehen, drehte sich um und musterte den Journalisten feindselig.
»Handelt es sich um eine satanische Tat?«, fügte Berset sensationslüstern hinzu.
Andreas packte ihn, zog ihn dicht zu sich heran und flüsterte ihm gereizt ins Ohr: »Hören Sie, Monsieur Berset. Ich weiß nicht, woher oder von wem Sie das haben, aber wenn ich morgen irgendetwas davon in Ihrem Schmierblatt lese…«
Karine legte Andreas eine Hand auf die Schulter, um ihm zu bedeuten, nicht zu weit zu gehen. Sie war es nicht gewohnt, dass er so heftig reagierte. Hatte er das Gefühl, unter Druck zu stehen? Ein Verbrechen hier in Gryon, in dem Dorf, in dem er wohnte…
»Soll das eine Drohung sein, Monsieur le Commissaire?«
»Nein, nur eine Warnung«, antwortete Andreas und ließ ihn los.
Fabien Berset sah Andreas auf dem Weg zu seinem Auto hinterher und grinste zufrieden. Dass der Mann der Pfarrerin bereitwillig mit ihm geredet hatte, war sein Glück gewesen.
Als Andreas am Wagen angelangt war, erwartete ihn bereits ein etwa fünfzig Jahre alter Mann.
»Guten Tag, Monsieur le Commissaire, mein Name ist Maurice Fournier. Ich bin der Gemeinderat von Gryon.«
»Ja, ich weiß, wer Sie sind. Wir sind uns hier im Dorf schon ein paarmal über den Weg gelaufen«, sagte Andreas kurz angebunden.
»Ich wollte den Gottesdienst besuchen. Erica, die Pfarrerin, hat mir erzählt, dass Alain getötet worden ist. Das ist schrecklich. Falls ich Sie in irgendeiner Form unterstützen kann…«
»Monsieur Fournier, danke für Ihr Angebot. Zu diesem Zeitpunkt können Sie allerdings nichts tun. Ich melde mich, sollten wir Ihre Hilfe benötigen.«
Karine und Andreas setzten sich ins Auto. Dann wählte Andreas Mikaëls Nummer.
»Ich bin’s. Ich wollte dir nur sagen, dass man in der Kirche eine Leiche entdeckt hat.«
»In der Kirche? In welcher Kirche?«
»Hier in Gryon. Den Leiter der Immobilienagentur.«
»Alain? Unmöglich.«
Über seine Agentur hatten sie ihr Haus in Les Pars gekauft.
»Ich erzähle dir später, was passiert ist. Könntest du mir erst mal einen Gefallen tun?«
»Ja, klar.«
»Wir haben eine vom Mörder verfasste Botschaft gefunden. Hast du etwas zu schreiben?«
»Ja, einen Moment.«
Andreas öffnete sein Notizheft und las vor.
8
Mikaël nahm die Einkaufstasche und verließ das Haus. Er schloss die Tür ab und versteckte den Schlüssel wie immer unter einem Stein auf der Fensterbank. Dann fuhr er mit dem Auto die Straße von Les Pars nach Rabou entlang, wo der historische Dorfkern Gryons begann und der Weg sich zwischen den Häusern hindurchschlängelte. Er hielt vor der Käserei. Der Immobilienmakler, der gegenüber sein Büro hatte, war ermordet worden. Hier, in Gryon. Völlig sinnlos… Die Neuigkeit vom Mord an Alain Gautier ließ ihn nicht kalt. Vom Tod eines Menschen zu erfahren, den man kannte, brachte einen an sich schon durcheinander, aber hier handelte es sich noch dazu um ein Verbrechen!
Er parkte gegenüber dem Lebensmittelgeschäft des Dorfes, genau unter dem Schaukasten mit den öffentlichen Bekanntmachungen, der von der Gemeindeverwaltung angebracht worden war. Darin wurden die Todesanzeigen der Einwohner von Gryon angeschlagen, meistens ältere Leute. Hier würde auch die Anzeige von Gautier hängen. Zweifellos würde dieses Verbrechen die Gemüter beschäftigen und in der nächsten Zeit das zentrale Gesprächsthema sein.
Das Bibelzitat ging ihm durch den Kopf. Als Andreas ihm die Worte am Telefon vorgelesen hatte, hatte er sofort gewusst, dass es sich dabei um einen Vers aus der Bergpredigt, einer der wichtigsten Lehren Jesu, handelte. Alte Erinnerungen kamen in ihm hoch…
Vor seiner Ausbildung zum Journalisten hatte er ein paar Semester Theologie studiert. Er war in einem von Religion und strengen Moralvorschriften geprägten familiären Umfeld aufgewachsen und hatte als junger Erwachsener zunächst nicht gewusst, was er mit seinem Leben anfangen sollte. Das Einzige, dessen er sich sicher gewesen war, war, dass er aus Leysin fortgehen wollte. So weit weg wie möglich. Er hatte das Gefühl gehabt, in diesem Bergdorf zu ersticken, wo jeder jeden kannte und wo er sich nicht wohlfühlte. Auslöser für seine Entscheidung war der Pfarrer der Region gewesen, den Mikaël wegen seiner Empathie sehr schätzte. Als er eines Abends bei ihm zum Essen eingeladen gewesen war, hatte dessen Mutter mitten im Gespräch ausgerufen, dass er doch Theologie studieren und Pfarrer werden solle. Der Pfarrer hatte die Gelegenheit beim Schopf ergriffen und enthusiastisch von seinem Studium und seinem Beruf erzählt. Warum sollte er es nicht probieren? Mikaël hatte darin die Verwirklichung seines Traumes gesehen, das Elternhaus zu verlassen und gleichzeitig noch den Segen seiner Mutter zu bekommen.
In Lausanne angekommen, konnte er endlich sein Leben leben. Seine Mutter hatte darauf bestanden, dass er jedes Wochenende nach Hause kam, und im ersten Jahr hatte er das bis auf wenige Ausnahmen auch brav getan. Doch am Ende der Sommerferien traf er eine Entscheidung. Bevor er nach Lausanne zurückfuhr, hatten sie sich alle zum sonntäglichen Mittagessen um den Tisch versammelt, und seine Mutter bat ihn, das Tischgebet zu sprechen. Das sei eine gute Übung für einen zukünftigen Pfarrer, hatte sie gesagt. Daraufhin hatte er die Chance genutzt, seinen Eltern zwei Neuigkeiten zu verkünden: dass er schwul sei und dass er nicht mehr so oft nach Hause käme. Die zweite Neuigkeit war aufgrund der ersten Mitteilung anstandslos durchgegangen. Sein Vater verließ den Tisch, ohne seinen Teller anzurühren, und seine Mutter sagte kein Wort mehr. Er selbst genoss das köstliche Essen.
Obwohl sich Mikaël mit großem Interesse auf die Theologie gestürzt hatte, musste er sich irgendwann eingestehen, die falsche Wahl getroffen zu haben. Seine Berufung war der Journalismus.
Und nun war er mit fünfunddreißig Jahren zurück in Gryon, dem Dorf, das er als Heranwachsender verlassen und das ihm so gefehlt hatte. Zusammen mit Andreas. Der Kreis hatte sich geschlossen.
Mikaël stieg die Stufen zur Gemeindeverwaltung hoch, denn er hatte vom Bürgermeister die Erlaubnis erhalten, das Gemeindearchiv für seine Recherchen zu nutzen.
Einige Zeit später kam er mit einem eindrucksvollen Stapel Fotokopien unter dem Arm wieder heraus: Ahnentafeln, Gerichtsprotokolle und andere Dokumente, die wichtige Ereignisse des Gemeindelebens bezeugten. Außerdem Informationen, die er zu den Ursprüngen seiner Familie zusammengetragen hatte, denn er hoffte, dahinter Geschichten zu entdecken, die ihm als Grundlage für einen Roman dienen konnten. Schon seit einiger Zeit verspürte er Lust, sich auf das Abenteuer des Romanschreibens einzulassen. Er besaß eine gewisse Begabung, Fakten miteinander zu verknüpfen und Themen weiterzuentwickeln, aber war er kreativ genug, Intrigen zu ersinnen und entsprechende Figuren zu konstruieren? Einen Kriminalroman zu schreiben? Aber genau das reizte ihn. Gryon war die perfekte Umgebung für einen etwas bärbeißigen Kommissar und einen eiskalten Mörder: die einzigartige Atmosphäre des kleinen pittoresken Dorfes. Die besondere Lebensart der Bergbewohner. Die gemütliche Atmosphäre der Chalets vor der eindrucksvollen Bergkulisse. Die harten Winter. Doch die Realität schien gerade die Fiktion eingeholt zu haben.
Nachdem er die zwei mit Dokumenten gefüllten Taschen ins Auto gestellt hatte, betrat er die Metzgerei gegenüber der Gemeindeverwaltung. Er kaufte hier regelmäßig ein, denn das Fleisch war exzellent und nicht zu vergleichen mit den eingeschweißten Produkten der Discounter. Der Metzger kaufte bei den Landwirten der Umgebung ein und hatte erst kürzlich beschlossen, seinen Laden auch sonntagvormittags zu öffnen, denn die Zahl der Touristen und der Ferienhausbesitzer war merklich gestiegen. Die Türklingel holte ihn nun aus seinem Hinterzimmer hervor.
»Hallo, Mikaël. Was darf es denn heute sein?«
»Einen dicken Streifen Speck bitte, René.«
René nahm ein großes Stück durchwachsenen Speck mit einer ordentlichen Fettschicht aus der Auslage. Genau von der Art, wie ihn Mikaël besonders liebte. Er nahm sein großes Messer, führte die Klinge am Wetzstein entlang und hielt sie dann ans Fleisch.
»Ist es so recht?«
»Perfekt.«
Während er den Speck schnitt, hob René den Kopf. »Schrecklich, diese Geschichte!«
Die Neuigkeit war ganz offensichtlich schon bis zu ihm vorgedrungen. Bevor Mikaël antworten konnte, erklang die Türklingel erneut, und zwei weitere Kunden betraten den Laden. Mikaël zahlte und ging.
Draußen stand er plötzlich Fabien Berset gegenüber, der gerade aus dem Lebensmittelgeschäft nebenan kam.
»Das hätte ich mir denken können. Immer als Erster am Ball, wie ich sehe«, sagte Mikaël zur Begrüßung.
»Ich hab meine Verbindungen…«
Bevor Berset zum »Le Matin« gewechselt war, waren sie Kollegen gewesen. Ein ehrgeiziger Mensch, der nicht gezögert hatte, seine Ellbogen einzusetzen, ganz im Gegenteil zu dem stets wohlwollenden Mikaël, der sich in der Zeitungswelt mit Kompetenz und Berufsethos einen Namen gemacht hatte. Trotz ihrer unterschiedlichen Persönlichkeiten verkehrten sie gern miteinander und respektierten sich gegenseitig.
»Ich nehme an, dass du ein Weilchen hierbleiben wirst.«
»Gut möglich, in der Tat. Vielleicht können wir abends mal einen trinken gehen.«
»Ja, gern. Und ich bringe dich dann auf den neuesten Stand der Ermittlungen…« Mikaël grinste.
»Aber nein, Mikaël, darum geht es nicht. Einfach mal wieder über die guten alten Zeiten schwätzen. Ein, zwei Gläser trinken. Und wenn du mir dann ein paar Auskünfte geben willst, ist das deine Sache.«
»Vergiss es, mein Lieber. Andreas erzählt mir eh nichts, und ich frage auch nicht nach. Da macht jeder sein Ding.«
»Und das soll ich dir glauben?«
»Auf jeden Fall erfährst du von mir nichts. Da musst du dich schon direkt an Andreas wenden.«
»Das habe ich ja versucht…«
Fabien Berset berichtete ihm von dem Streit, den er am Morgen mit Andreas gehabt hatte. »Er muss mich ja nicht gleich als seinen Feind betrachten. Ich mache einfach meinen Job, das ist alles. Und du kannst ihm ausrichten, dass ich bereit wäre, mit ihm zusammenzuarbeiten. Schließlich könnte ein Informationsaustausch für uns beide nützlich sein.«
»Ich werde mich nicht in eure Geschichten einmischen. Das musst du ihm schon selbst sagen.«
Sie gaben sich zum Abschied die Hand, und jeder ging seines Weges.