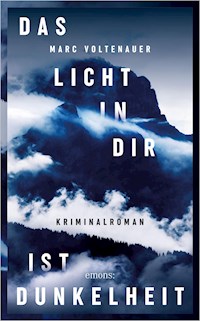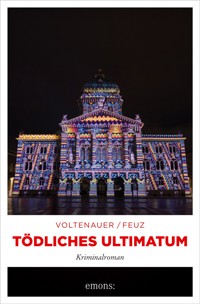Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: The AOS
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Lebensnah gezeichnete Charaktere mit psychologischer Tiefe treffen auf einen glänzend konstruierten Plot, der bis zum Schluss in Atem hält. Das beschauliche Bergdorf Gryon wird von einer Serie verstörender Ereignisse erschüttert. Ein Auftragskiller, der kurz zuvor einen Mord an einem Politiker begangen hat, zieht in ein Luxus-Chalet in der Nachbarschaft. Die Kuh eines Dorfbauern wird regelrecht hingerichtet. Eine Frau aus der Region verschwindet, kurz darauf wird eine weitere tot aufgefunden. Und mittendrin Kommissar Andreas Auer, der versucht, die Fäden zu entwirren – und dabei riskiert, alles zu verlieren.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
Die Originalausgabe erschien 2017 unter dem Titel »Qui a tué Heidi?« bei Slatkine & Cie.
© Marc Voltenauer
© 2017 Slatkine & Cie
© der deutschsprachigen Ausgabe: Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: LAURA/stock.adobe.com, Pexels/Pixabay.com
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer
E-Book-Produktion: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-96041-943-3
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Für meinen Lebensgefährten Benjamin,der mir stets zur Seite steht
Wo der Fußweg anfängt, beginnt baldHeideland mit dem kurzen Gras und den kräftigenBergkräutern dem Kommenden entgegenzuduften, denn derFußweg geht steil und direkt zu den Alpen hinauf.
Heidi, Johanna Spyri
PROLOG
Freitag, 5. April
Am Steuer seines alten BMW jagte Andreas die kurvenreiche Strecke von Gryon nach Bex entlang und reizte dabei das Tempolimit aus, das ihm die Bergstraße auferlegte. Am Ende einer scharfen Kurve kam er mit dem Hinterrad seines Wagens beinahe von der Straße ab, an deren Rand sich der Abgrund der Schlucht auftat. Es war ihm vollkommen egal, dass er geblitzt werden könnte, aber ein Unfall würde die Lage jetzt nicht verbessern. Er beschloss, langsamer zu fahren. Aus dem Autoradio ertönte ein Lied von Mylène Farmer, »À quoi je sers«. Der quälend traurige Refrain hallte wie ein Echo seines Seelenzustands in ihm wider.
Aber mein Gott, warum scheine ich
zu nichts gut zu sein?
Und wer vermag in dieser Hölle zu sagen,
was von uns erwartet wird?
Ich gestehe, nicht mehr zu wissen, wozu ich tauge,
zweifellos bin ich zu überhaupt nichts gut.
Zu überhaupt nichts gut. Ganz offensichtlich taugte Andreas zu überhaupt nichts. Gerade hatte ihn das Krankenhaus angerufen. Aus Furcht vor dem Gespräch hatte er es ein paarmal klingeln lassen. Er befürchtete das Schlimmste. Am Telefon hatte man ihm jedoch keine Auskunft geben wollen. Er sollte unverzüglich kommen.
Mein Gott, warum scheine ich …
… solch ein Idiot zu sein? Ein Idiot, der weder hatte das Drama voraussehen noch es aufhalten können. Und schon gar nicht die Kette von Ereignissen, die ihn jetzt diese Straße hinabrasen und jede Kurve schneiden ließ, ohne sich um den Gegenverkehr zu scheren.
Und wer vermag in dieser Hölle zu sagen,was von uns erwartet wird?
Die Hölle, die Ereignisse der vergangenen Tage, die vertrackte Ermittlung, die vielen Fallstricke, die er zu spät gelöst hatte, die sinnlosen Morde – und seine eigene Verantwortung bei alldem.
Was geschehen war, ließ sich nicht rückgängig machen. Unmöglich, die Zeit zurückzudrehen. Das alles würde ihn bis in alle Ewigkeit verfolgen. Doch jetzt musste er sich auf das Fahren konzentrieren. Diese unglückselige Musik ausschalten, unversehrt im Krankenhaus ankommen. Und sich der Realität stellen, egal, wie diese aussehen mochte.
Dabei hatte alles mit einem wunderbaren Tag begonnen …
1
Samstag, 23. Februar
Andreas war bei Sonnenaufgang aufgestanden, hatte Minus, den Bernhardiner, hinaus in den Garten gelassen und sich danach sein morgendliches Getränk aus zwei Dritteln Milch und einem Drittel Kaffee in seiner mit einem Elch verzierten Lieblingstasse zubereitet, die er aus Schweden mitgebracht hatte. Die Tasse erinnerte ihn an seine Wurzeln, an das Land, mit dem er sich zutiefst verbunden fühlte.
Ein Anflug von Melancholie überkam ihn, ein ambivalentes Gefühl. Er hasste es, sich von den verpassten Chancen der Vergangenheit und der Unzufriedenheit der Gegenwart runterziehen zu lassen, dennoch blätterte er im Geiste seine Erinnerungen durch, um in diesen sanften Schmerzen zu schwelgen.
Andreas trat hinaus auf die Terrasse seines Chalets und ließ sich auf dem Sofa nieder. Ein frischer Wind fuhr ihm unter die Kleidung, gleichzeitig wärmten die ersten schüchternen Sonnenstrahlen sein Gesicht. Der Schnee glitzerte und kitzelte ihm in der Nase. Er roch Tannenduft. Spürte die Feuchtigkeit der Luft, die gerade eine Temperatur um den Gefrierpunkt erreicht hatte.
Minus bahnte sich einen Weg durch den frischen Schnee, der in der Nacht gefallen war. Er hatte im Vogelhäuschen in der Eberesche zwei Kohlmeisen gesichtet, die dort nach Körnern suchten. Als eine Alpendohle auf einem Ast landete und dabei frischen Schnee auf Minus herunterrieseln ließ, bis dieser sich schüttelte, flogen sie auf. Die Dohle hüpfte mit ausgebreiteten Flügeln auf das Vogelhäuschen. Die Spannweite ihrer Flügel machte einen solchen Eindruck auf die beiden Meisen, dass diese sich auf einem anderen Baum niederließen und von dort misstrauisch das metallisch schwarze Gefieder und den schwefelgelben Schnabel beäugten, der sie ihrer Kost beraubte.
Trotz dieses idyllischen Spektakels, von dem eine gewisse Ruhe ausging, wuchs sich Andreas’ melancholische Stimmung in ein regelrechtes Unwohlsein aus. Warum weckte der pechschwarze Vogel ein solch ungutes Gefühl in ihm?
In seinen düsteren Gedanken verloren, hörte Andreas nicht, dass sich Mikaël von hinten näherte und sich über ihn beugte. Die Umarmung ließ ihn die Gründe für seine Irritation vergessen.
2
Der deutsche Zöllner hob den Kopf und betrachtete den vor ihm stehenden Mann, dessen Haltung rein gar nichts Sympathisches oder Entspanntes ausstrahlte. Laut seines Reisepasses war er ein Meter fünfundsiebzig groß. Er war schmal, doch sein schwarzer perfekt sitzender Anzug ließ eine kompakte, stählerne Muskelmasse erahnen, die er zweifellos einem intensiven sportlichen Training verdankte. Er hatte kurz geschorene blonde Haare, eiskalte blaue Augen und ein so ausdrucksloses Gesicht, dass ihn nur das Beben seiner Nasenflügel beim Einatmen als Lebewesen verriet.
Dreißig Jahre hatte der Zollbeamte hinter dem Schalter auf dem Flughafen Berlin-Schönefeld Reisende kontrolliert, nun würde er in den Ruhestand gehen. Wie viele Personen hatte er vorbeiziehen sehen? Unzählige. Um die Monotonie seines Arbeitsalltags zu durchbrechen, hatte er sich Ratespiele ausgedacht. Manchmal hatte er Spaß daran, die Nationalität der Reisenden zu erraten, ihr Gewicht zu schätzen oder ihre Größe. Diese Woche hatte er es sich mit seinem ausgeklügelten System zur Aufgabe gemacht, ihr Alter zu raten. Bevor er den Pass aufklappte, musste er das Alter seines Gegenübers schätzen. Lag er richtig, machte er zwei Haken in einer Kladde, die neben seiner Tastatur lag. Verschätzte er sich um ein bis drei Jahre, machte er nur einen Haken. Alles, was darüber hinausging, erhielt ein Kreuzchen, was allerdings fast nie vorkam. Am Ende des Tages zählte er seine Punkte zusammen. Er war mit der Zeit immer besser geworden, aber der Mann, der vor ihm stand, blieb ihm ein Rätsel. Erneut schaute er in den Pass und rechnete im Kopf nach: sechsundfünfzig Jahre. Er hatte ihn zehn Jahre jünger geschätzt. Er malte ein Kreuzchen.
»What is the purpose of your visit, Mister Artomonov?«, fragte er auf Englisch mit einem leichten deutschen Akzent.
»Business«, erwiderte der Mann mit einem deutlich russischen Akzent.
Der Mann nahm seinen Pass und ging zum Gepäckband Nummer vier, dessen Anzeigetafel auf die Ankunft eines Fluges aus Moskau hinwies. Während er auf seinen Koffer wartete, holte er sein Smartphone hervor und schaltete es ein. Ein Klingelton signalisierte ihm, dass er eine Nachricht empfangen hatte. Er öffnete sie und las die Adresse des Ortes, an den er sich begeben musste.
Der Mann verließ den Flughafen, zog seinen Rollkoffer hinter sich her, auf den er seinen Aktenkoffer gestellt hatte, und begab sich zum Taxistand. Dort wartete bereits ein knappes Dutzend Leute, aber er hatte es nicht eilig. Das Flugzeug war pünktlich gelandet. Er schaute auf seine Uhr: fünfzehn Uhr dreißig. Ein Fahrer kam ihm entgegen, nahm seinen Koffer und verstaute ihn im Kofferraum seines Wagens, einem beigen Mercedes, dem üblichen Taximodell in Deutschland. Der Mann nahm auf der Rückbank Platz und drückte den Aktenkoffer an sich.
»Guten Tag, Mister, welcome to Berlin. Where …«
»Hotel Adlon Kempinski«, unterbrach ihn der Mann und nahm dem Taxifahrer damit jede Möglichkeit, etwas Freundlichkeit an den Tag zu legen.
Die Stille, die sich daraufhin im Wagen ausbreitete, bereitete dem Fahrer Unbehagen. Er hatte zwar schon viele schweigsame Kunden kennengelernt, aber dieser hier wirkte geradezu frostig. Verstohlen schaute er in den Rückspiegel. Sein Fahrgast zeigte keinerlei Regung.
»Sind Sie das erste Mal in Berlin?«
»Nein«, sagte der Mann. Niemals auch nur ein Wort zu viel sagen. Sich eine Aura des Geheimnisvollen zu geben und eine perfekte Selbstbeherrschung waren seine Markenzeichen. Sie hatten ihm beim russischen Auslandsnachrichtendienst SWR, der 1991 aus der Auflösung des KGB hervorgegangen war, seinen Spitznamen Litso Ice eingebracht. »Gesicht aus Eis« – eine Mischung aus einem russischen und einem englischen Wort. Litso Ice war einer jener hoch spezialisierten Agenten gewesen, die der Staat für geheime Spionageeinsätze im Ausland nutzte. Vor zehn Jahren hatte er dort seinen offiziellen Posten an den Nagel gehängt, um privat eine weitaus lukrativere Karriere zu starten.
Das Taxi bog nach links ab. In der Ferne sah Litso Ice die Siegessäule, jene monumentale Säule, die zu Ehren der Preußischen Armee errichtet worden war. Am Kreisverkehr angelangt, erkannte er die riesige vergoldete Statue darauf – Viktoria, das römische Äquivalent der griechischen Siegesgöttin Nike, die durch eine bekannte Sportschuhmarke auf dem Altar des Kapitalismus geopfert worden war. Das Taxi nahm die erste Ausfahrt und fädelte sich in die Straße des 17. Juni ein, die am Großen Tiergarten vorbeiführte. Sofort erblickte Litso Ice zu seiner Linken das Sowjetische Ehrenmal, das zu Ehren der Soldaten der Roten Armee errichtet worden war, die in der Schlacht um Berlin im Jahr 1945 gefallen waren. Nostalgische Rückblicke erschienen ihm als vertane Zeit, ein überflüssiges Gefühl, dennoch erinnerte ihn der riesige helle Betonbogen an seine Anfänge in der Armee. Mitten im Kalten Krieg war er zur Bewachung dieses Denkmals für zwei Jahre in den Sowjetischen Sektor nach Berlin abgesandt worden.
Vor ihnen erhob sich das Brandenburger Tor. Der dichte Verkehr zwang das Taxi zum Anhalten. Litso Ice sah, dass das Taxameter etwas mehr als dreißig Euro anzeigte. Er holte zwei Zwanzigerscheine aus seiner Brieftasche, warf sie auf den Beifahrersitz, öffnete die Wagentür und verließ unter dem verdutzten Blick des Fahrers wortlos das Taxi. Er holte seinen Koffer aus dem Kofferraum, überquerte die Straße bis zum Platz des 18. März, schritt unter dem Brandenburger Tor hindurch, um zu seinem in der berühmten Prachtstraße Unter den Linden gelegenen Hotel zu gelangen.
Litso Ice betrat die Lobby, ging auf die Rezeption zu und hielt inne. In der Mitte des Atriums befand sich ein mit Elefanten geschmückter Brunnen. Ein Pianist spielte Mozart. Er erkannte den dritten Satz der Sonate Nr. 11, Alla Turca.
Er hatte schon häufiger in luxuriösen Hotels gewohnt, doch die Atmosphäre im Adlon übertraf alles, was er bisher kennengelernt hatte. Es war wie eine zugleich klassische und zeitgenössische Musik, ein historisches Denkmal mit modernstem Komfort. Der Boden und die Säulen waren aus Marmor. Die Wände cremefarben und die Decken mit goldenem Stuck verziert. Und in der Mitte über dem Brunnen ein Lichtschacht und eine Glaskuppel mit blau-goldenen Mosaikarbeiten.
Litso Ice atmete ein, um dies alles in sich aufzusaugen. Irgendwo hatte er gelesen, dass Greta Garbo hier regelmäßig abgestiegen war und sogar eine eigene Suite gehabt hatte. Auch Chaplin, Einstein, Roosevelt hatten hier gewohnt. Und hier wandelte nun er, Litso Ice, auf den Spuren dieser illustren Persönlichkeiten. Allerdings wusste er, dass sich niemals jemand an Litso Ice erinnern würde, und das war auch gut so.
Nachdem er in seinem Zimmer im obersten Stockwerk eingecheckt und in einem Sessel neben dem Fenster, Berlin zu seinen Füßen, Platz genommen hatte, überlegte er, ob sich sein Auftraggeber nicht etwa über ihn lustig machte. Er öffnete den Briefumschlag, den man ihm übergeben hatte. Er enthielt eine Eintrittskarte für eine Aufführung der Oper »Die Walküre« an diesem Abend um zwanzig Uhr.
Litso Ice legte seinen Koffer auf das Bett, öffnete das Schloss und klappte ihn auf. Er holte einen Anzug heraus, strich ihn glatt und hängte ihn in den Schrank. Anschließend räumte er den Rest aus. Kleidung, einen Kulturbeutel, einen Rasierer, Schuhe und weitere Accessoires, die er für seine Mission vorgesehen hatte. Dem Kulturbeutel entnahm er eine elektrische Zahnbürste, in der er den Lauf seiner Waffe versteckt hatte. Den Griff mit dem sowjetischen Stern holte er unter seinen Socken hervor. Er löste den Stoff, mit dem der Schalenkoffer ausgeschlagen war, ließ eines der biegsamen Kunststoffrohre herausgleiten, die der Verstärkung dienten, und zog aus ihm die Schlagfeder und den Schalldämpfer heraus. Nachdem er sämtliche Akten beiseitegelegt hatte, löste er in seinem Aktenkoffer eine Platte, die als doppelter Boden diente, unter dem sich in Schaumstoff eingebettet das Gehäuse einer halb automatischen Pistole und ein mit Munition gefülltes Magazin befanden.
Ein paar Minuten später lagen sämtliche Bauteile einer Makarow auf dem Tisch. Trotz der immer strengeren Kontrollen hatte er nie auch nur das geringste Problem gehabt, seine Waffe mit über die Grenze zu nehmen. Die Sicherheitsbeamten achteten auf Plastikteile und Flüssigkeiten, die verdächtig nach Sprengstoff aussahen, aber nie waren sein Koffer und sein Aktenkoffer einer gesonderten Kontrolle unterzogen worden. Mit einem Freund, der auf dem internationalen Flughafen Scheremetjewo in Moskau arbeitete, hatte er alles getestet. Sämtliche Bauteile waren so platziert, dass sie für den Scanner nicht erkennbar waren.
Die Makarow, eine in Russland produzierte halb automatische Pistole, war während seiner Spionagetätigkeit fürs Vaterland seine Dienstwaffe gewesen, und für nichts in der Welt hätte er sie gegen eine andere Pistole getauscht. Diese Waffe besaß viele Vorteile: geringe Größe, wenig mobile Bauteile – zumindest weniger als andere Waffen dieser Kategorie –, einfach zu zerlegen und wieder zusammenzubauen. Ihre einzigen Makel waren ihre geringe Präzision und Reichweite. Litso Ice hatte dies zu seinem Vorteil umgemünzt: Er liebte es, im Moment des Abdrückens ganz nahe an seine Opfer heranzukommen.
Die Zeiger seiner schlichten, eleganten Schweizer Uhr, einer schiefergrauen Royal Oak Offshore, die er bei seinem letzten Auftrag als Prämie bekommen hatte, zeigten sechzehn Uhr dreißig an. Noch mehr als drei Stunden bis zur Aufführung. Litso Ice war noch nie in der Staatsoper gewesen und freute sich schon darauf, Wagners »Walküre« in einem der ältesten Opernhäuser Deutschlands zu hören, das von den Stalinorgeln zerstört und 1952 vollständig wieder aufgebaut worden war.
Er liebte die Oper und hatte sich sogar ein Abonnement für das Bolschoi-Theater gegönnt. Diese Vorliebe kam aus der Zeit, in der er im Sicherheitsdienst für Boris Jelzin gearbeitet hatte. Damals hatte er den russischen Präsidenten zu Aufführungen begleitet und in der Loge mit perfektem Blick auf die Bühne direkt hinter ihm gestanden. Als das Orchester die ersten Töne der berühmten Arie »E lucevan le stelle« aus Puccinis Oper Tosca angestimmt hatte, hatte Litso Ice eine gewaltige Leere in seinem Innern verspürt, einen Riss, so als würde die Musik die in seiner Seele versteckten Gefühle aus dunkelster Tiefe an die Oberfläche holen.
An jenem Abend hatte er den Eindruck gehabt, als würde etwas in ihm aufreißen. Sein ganzes Leben und seine gesamte berufliche Karriere über hatte nur eine einzige Sache gezählt: die Beherrschung. Seine Gefühle und sein Handeln zu beherrschen war zum Credo seines Alltags geworden. Zu einer tödlichen Waffe, die sich durch nichts aufhalten ließ. Brachte er jemanden um, verspürte er nichts, außer vielleicht etwas Erleichterung, eine Aufgabe erledigt zu haben. Bei einer Frau verspürte er allerhöchstens Lust. Liebe war für ihn nur ein Wort. Sein brutaler, alkoholabhängiger Vater und seine psychisch kranke Mutter, die unfähig gewesen war, ihren Kindern Zuneigung zu schenken, hatten ganze Arbeit geleistet. Doch an jenem Abend in der Oper hatte er sich zum ersten Mal lebendig gefühlt. Ein merkwürdiges Gefühl, eine Mischung aus Freude und Angst: eine unkontrollierbare Freude zu existieren vermischt mit der irrationalen Angst, schwach zu werden. Noch heute, auch wenn er es sich eigentlich nicht eingestehen wollte, konnte er die sanfte Wärme der Tränen spüren, die ihm damals den Blick verschwimmen lassen hatten.
Litso Ice entschied sich, ein Bad zu nehmen. Das Badezimmer aus weißem Marmor mit dem ovalen Whirlpool für mindestens zwei Personen stand in krassem Gegensatz zu der Realität seiner Kindheit. Er drehte den Wasserhahn auf und leerte den Inhalt des großen Flakons mit dem Badezusatz ins Wasser. Dann kehrte er in den Salon zurück, hob sein Mobiltelefon vom Couchtisch auf und betrachtete das Foto, das ihm zugeschickt worden war. Es handelte sich um einen Plan des Opernhauses. Ein Kreuz markierte den Ort, wo er während der Aufführung sitzen würde, ein Kreis die Loge, in der sich sein Opfer befinden würde. Ein Viereck zeigte den Notausgang an, den er zu Beginn des dritten Aktes benutzen musste. Der einzige Wermutstropfen: Er würde den Schlussakt verpassen.
Er legte ein Kleidungsstück nach dem anderen ab, strich sie einzeln glatt und verstaute sie im Kleiderschrank. Kurz betrachtete er seinen nackten athletischen Körper im Spiegel, ließ sich dann ins Badewasser gleiten und verschwand unter einer dicken Schaumschicht.
3
Der Mann, der sich an dem Parfüm seiner Mutter betörte, hatte eine Stunde Zeit. Sein Vater war beschäftigt und würde ihn nicht stören. Er ging in die Küche, nahm den Zinnkrug von der Anrichte und fischte einen Schlüssel heraus. Dann begab er sich in den ersten Stock. In seinem Zimmer holte er einen Rucksack aus dem Schrank, danach zog er sich aus und ging unter die Dusche. Für sein Vorhaben musste er sauber sein, sich von jeglicher Schande reinwaschen. Drei Minuten, mit der Uhr in der Hand.
Nachdem er sich abgetrocknet hatte, nahm er den Schlüssel, den er auf dem Klodeckel abgelegt hatte, und lief nackt, mit dem Rucksack über der Schulter, über den Flur bis zu der Tür am anderen Ende des Ganges. Er steckte den Schlüssel ins Schloss, drehte ihn herum, hielt kurz inne. Er schloss die Augen. Quälende Gedanken marterten ihn. Er hatte das Gefühl, etwas Verbotenes zu tun, ein Tabu zu verletzen. In dieses Zimmer einzudringen bedeutete, eine Grenze zu überschreiten. Tief in seinem Innern wusste er, dass es böse war. Doch immer wieder siegte das Begehren über den Verstand. Er drückte die Klinke hinunter, öffnete langsam die Tür und trat ein.
Auf der anderen Seite des Zimmers befand sich rechts der Frisiertisch. Das weiße Möbel mit dem von einem Lichtkranz gerahmten ovalen Spiegel zog seinen Blick an wie ein Magnet. Es war die Art von Möbel, von der sich seine Mutter vorgestellt hatte, dass sie in den fünfziger Jahren in den Umkleiden der Hollywoodsternchen gestanden hatte. Sie hatte den Tisch extra aus Amerika kommen lassen. Direkt unter dem Fenster stand eine Kommode. Er konnte seinen nackten Körper in der Fensterscheibe sehen. Ohne zu zögern, öffnete er eine Schublade, holte einen rosafarbenen Seidenslip mit Spitzen hervor und zog ihn vorsichtig an. Dann griff er nach einem schwarzen Strumpfhalter und legte ihn um seine Taille. Er streifte Seidenstrümpfe über, rollte sie nach oben und befestigte sie an den Strapsen.
Er ging zum Schrank und begutachtete die Kleidersammlung seiner Mutter. Die meisten Kleider stammten aus den 1950er Jahren. Seine Mutter liebte diese Art Vintagegarderobe, wie sie Grace Kelly, Audrey Hepburn und Joanne Woodward einst getragen hatten. Sie hätte gern dieser Generation von Frauen angehört und so ausgesehen wie sie. Sie war einfach zur falschen Zeit geboren worden.
Selten hatte seine Mutter diese Kleider außerhalb der eigenen vier Wände getragen, außer an den wenigen Abenden, an denen sie tanzen gegangen war. Überwiegend schienen sie für die Intimität ihres Zimmers bestimmt gewesen zu sein. Sie verriegelte ihre Tür stets doppelt. Er beobachtete sie durch das Schlüsselloch, während sie in eines dieser Kleider schlüpfte und sich vor ihrem Spiegel schminkte.
Schließlich wählte er ein mit Frühlingsblumen bedrucktes Kleid. Aus einem Regal nahm er die Schuhe mit den schwarzen Absätzen und zwängte seine Füße hinein. Er betrachtete sich im Standspiegel in der Ecke. Das Wichtigste fehlte noch.
Er setzte sich auf den Stuhl vor dem Frisiertisch und musterte sich im Spiegel. Was er sah, gefiel ihm nicht.
Ein junger Mann.
Das Gesicht eines Engels.
Androgyne Gesichtszüge.
Weniger weiblich als seine Mutter, auch wenn er ihre Kleider trug.
Weniger männlich als sein Vater in seiner Alltagskleidung.
Halb Mann, halb Frau. Weder Mann noch Frau.
Aus der Schublade des Frisiertisches holte er einen Lippenstift, Make-up und Mascara hervor und schminkte sich sorgfältig. Er hatte diese Handgriffe so oft wiederholt, dass er sich ein gewisses Geschick angeeignet hatte. Er öffnete eine Schmuckschatulle und nahm ein Paar Ohrringe heraus. Um sein Profil im Spiegel zu sehen, wandte er leicht den Kopf. Er zog den einen Ohrring an. Dann den zweiten. Danach legte er sich eine Perlenkette um. Zum Schluss setzte er sich eine Perücke mit hellbraunem Haar auf, die er seinem Rucksack entnommen hatte.
Vor ihm stand der Glasflakon mit dem dunkelblauen Verschluss, der die goldene Farbe der kostbaren Flüssigkeit besonders gut zur Geltung brachte. Er bewunderte ihn wie einen Schatz. Auf dem Kristallglas stand in Goldbuchstaben Shalimar.
Solange er sich erinnern konnte, hatte seine Mutter stets dieses Parfüm benutzt. Als Kind hatte er sich einmal damit besprüht. Als er hinunter in die Küche gekommen war, hatte sie es sofort bemerkt: Er stank. Sie hatte ihn heftig geohrfeigt. Er erinnerte sich sehr gut daran, wie sie geschrien hatte: »Verdammter Rotzbengel, was hast du dir dabei gedacht! Vermutlich nichts, bei deinem Spatzenhirn! Weißt du, wie teuer das ist? Bei besonderen Gelegenheiten verwende ich ein, zwei Tropfen, und du, du verschwendest es einfach so aus Spaß?«
Wenn sie ihn mit Beschimpfungen überschüttete, ging sie oft sehr weit und setzte meist noch einen drauf: »Und auch noch den Duft einer Frau … Du bist ein Mann, oder nicht? Du wirst doch hoffentlich nicht schwul sein?« Sie hatte ihn an den Ohren in sein Zimmer gezogen, abgeschlossen und wieder und wieder geschrien: »Dein Vater würde das nicht ertragen. Und ich … und ich … verdammte Scheiße!« Beim Weggehen hatte sie gebrüllt: »Bis morgen bleibst du hier und bekommst nichts zu essen!«
Sein Vater hatte weiter am Küchentisch gesessen und keinen Ton dazu gesagt.
Der Mann, der sich am Parfüm seiner Mutter betörte, nahm den Flakon in die leicht zitternde Hand. Die Angst. Allgegenwärtig. Auch wenn er nichts mehr zu fürchten hatte, war die Wirkung seiner Mutter immer noch sehr präsent.
Er öffnete vorsichtig den Verschluss und gab ein paar Tropfen der wertvollen Flüssigkeit auf sein Handgelenk. Anschließend strich er sich damit erst über die rechte und dann über die linke Halsseite. Der sanfte, frische Bergamottduft erinnerte ihn an seine Mutter. Eine tröstliche und gleichzeitig unerträgliche Erinnerung. Unerträglich, da sie einen tief sitzenden Hass in ihm nährte. Tröstlich, da ihn dieser exotische Geruch an Sonnenschein und Blumen denken ließ. Er schloss die Augen und stellte sich vor, er befinde sich in einem dieser luxuriösen Gärten mit sprudelnden Springbrunnen und duftenden Blumen. Rosen, Iris, Jasmin. Und dann, ganz hinten, der samtige Duft der Vanille, der mehrere Tage anhielt. Er stellte sich vor, wie er sich inmitten dieses verlorenen Paradieses mit einer reinen, perfekten Frau aufhielt. Einer Mutter. Die, die er begehrte. Der er mit bitterer Inbrunst hinterherjagte. In seinen Träumen ebenso wie in der Realität. Es gelang ihm nicht, die Erinnerung an diese lieblose, monströse Mutter mit der Subtilität und der Sinnlichkeit des Parfüms in Einklang zu bringen. Im Sanskrit bedeutete »Shalimar« »Tempel der Liebe«. Das hatte er im Internet gelesen. Er war im Tempel des Hasses groß geworden.
Er bewunderte die Frauen. Er verehrte sie. In Wirklichkeit war jedoch alles viel komplizierter. Er hatte es versucht. Hatte versucht, sie mit seinem Engelsgesicht zu verführen. Doch das hatte immer böse geendet. Er war unfähig, ein Mann zu sein, ein richtiger, wenn es darauf ankam. Er trieb auf der Welle der Enttäuschung bis hin zur Desillusion. Er hasste die Frauen. Ein innerer Kampf ohne Ausweg.
Der Mann, der sich am Parfüm seiner Mutter betörte, hätte sich niemals vorstellen können, wie nah Liebe und Hass beieinanderliegen konnten.
Wie untrennbar sie miteinander verbunden waren.
Wie Licht und Schatten.
Die zwei Seiten einer Medaille.
Er war bereit, sich im Spiegel zu betrachten. Lange und aufmerksam. Ohne zu zwinkern. Sein Spiegelbild zeigte ihm ein maskenhaftes Gesicht. Doch irgendetwas stimmte nicht. Seine Mutter hatte blaue Augen gehabt, die seinen waren dunkelbraun. Sein Blick gefiel ihm nicht, er fand ihn ausdruckslos. Der seiner Mutter war durchdringend gewesen, distanziert und eisig. Der Blick einer Göttin und gleichzeitig so eisig, dass er sich davon wie mit einer Klinge durchbohrt fühlte. Er dachte häufig darüber nach und hatte schließlich sogar blaue Kontaktlinsen im Internet bestellt. Er wollte ihr ähnlich sehen. Perfekt sein.
Als er das Päckchen aufgemacht hatte, war er enttäuscht gewesen. Die Linsen hatten überhaupt nicht den gewünschten Farbton. Das Foto auf der Internetseite hatte etwas anderes versprochen. Er hatte keine Ahnung, wie er die richtigen Kontaktlinsen auftreiben konnte. Linsen, die ihm den Blick seiner Mutter in Erinnerung rufen würden, wenn er sich im Spiegel betrachtete.
Zwischenfälle wie diese irritierten ihn. Er spürte, wie seine Atmung schneller wurde. Wie sein Puls raste. Seine Zeit war begrenzt. Er hatte nur eine Stunde. Die wollte er nutzen. Die Schlagader an seinem Hals pochte. Zunächst musste er wieder ruhig werden. Ja, wieder ruhig werden.
Erneut konzentrierte er sich auf den Spiegel, öffnete den Shalimar-Flakon und hielt ihn sich unter die Nase. Er schloss die Augen. Er inhalierte den Duft. Seine Atmung verlangsamte sich, und sein Puls schlug weniger heftig. Seine Seele schwebte mit den Molekülen des Parfüms durch die Luft. Plötzlich konnte er sich selbst von außen sehen. Hatte seine Mutter diesen Trick benutzt, um ihrer düsteren Realität zu entfliehen? Dessen war er sich sicher.
Er fokussierte sich wieder, als er hörte, wie sich ein Auto näherte. Er horchte, verharrte reglos und hielt die Luft an. Der Wagen hatte angehalten. Er lauschte dem laufenden Motor. Hörte das Klappern des Briefkastens. Die Briefträgerin! Er schaute auf die Uhr. Sie war früher als gewöhnlich vorbeigekommen. Er hörte, wie das Auto losfuhr und sich wieder entfernte. Er stieß einen tiefen Seufzer aus.
Er hatte das Zeitgefühl verloren. Zum ersten Mal. Er blickte zur Wanduhr. Es blieben ihm noch zehn Minuten, bevor er kam. Er zog die Perücke aus und verstaute sie im Rucksack. Dann beeilte er sich, den Schmuck abzulegen und ihn wieder in der Schatulle zu deponieren. Er legte die Schminkutensilien nebeneinander in die oberste Schublade des Frisiertisches. Danach zog er sich aus und hängte die Kleidungsstücke zurück in den Schrank. Wieder war er splitternackt. Er blickte sich um. Alles war an seinem gewohnten Platz. Er verließ mit dem Rucksack über der Schulter das Zimmer und verschloss die Tür. Er würde eine Dusche nehmen und anschließend seine Arbeitskleidung anziehen.
Nachdem er sich wieder angezogen hatte, ging er die Treppe hinunter, um das Haus zu verlassen. Dann besann er sich und kehrte in die Küche zurück, um den Schlüssel wieder in die Zinnkanne zu legen. Anschließend trat er zur Haustür hinaus. Die Nachbarin beobachtete ihn von ihrem Fenster aus, schaute zu, wie er ins Auto stieg und mit quietschenden Reifen davonfuhr.
4
Der Wintertag begann unter besten Vorzeichen. Andreas und Mikaël waren von Cergnement aus zu einer Schneeschuhwanderung nach Solalex aufgebrochen, einer umringt von gewaltigen Felswänden gelegenen Alp. Minus war mit von der Partie und sprang fröhlich im pulvrigen Schnee herum. Dieser sonnige Tag versöhnte Andreas mit dem Winter, der ihn für gewöhnlich eher trübsinnig werden ließ. Jeden Morgen spürte er seine Last, wenn er sich durch die nebelverhangene Rhôneebene auf den Weg zur Arbeit nach Lausanne machte.
Die fehlende Sonne schlug Andreas aufs Gemüt. Zumindest behauptete er das, auch wenn ihm Mikaël kein Wort glaubte. Seit dem Ende der Ermittlungen im Fall eines kaltblütigen Serienmörders im vergangenen Herbst hatte Andreas Mühe, sich wieder im Arbeitsalltag zurechtzufinden. Vor allem, da sich seitdem nichts Aufregendes mehr zugetragen hatte. Nichts als Banalitäten. Es hatte ein einziges Tötungsdelikt gegeben, das sich innerhalb von wenigen Stunden hatte aufklären lassen. Ein Mann hatte seine Frau und seine beiden Kinder umgebracht, bevor er sich selbst das Leben genommen hatte. Ein schreckliches Drama, aber eine Ermittlung, die ihn unterfordert hatte. Nichts, was seine Kompetenz verlangt hätte. Auf Adrenalin war Langeweile gefolgt.
Mikaël hatte dem Leiden seines Freundes einen Namen gegeben: der Crime-Blues. Er hatte versucht, mit Andreas darüber zu reden, der ihm jedoch systematisch ausgewichen war: »Mach dir keine Sorgen. Das wird besser, sobald der Winter vorbei ist.«
Mikaël hatte das Gefühl, dass sich Andreas beinah einen Mord herbeisehnte, um wieder besserer Laune zu sein. Andreas wiederum fiel es schwer, seine eigenen Schwächen in Worte zu fassen, und verzichtete bereitwillig darauf, sich zu ihnen zu bekennen. In Wirklichkeit fühlte er sich wie ein verwundeter Sportler auf der Ersatzbank. Wie ein Pokerspieler mit Casinoverbot. Wie ein Drogenabhängiger während einer Entgiftungskur. Er war auf Entzug.
Während sie mit ihren Schneeschuhen bergauf wanderten, hatte die Sonne die Luft erwärmt, und auch Andreas’ Stimmungsbarometer hellte sich wieder auf. In Solalex angekommen, setzten sich Andreas und Mikaël auf die Terrasse des kleinen Restaurants am Fuße der Diablerets und des Miroir d’Argentine, dieser glatten, bei Alpinisten sehr beliebten Felswand, deren Anblick man nie müde wurde. Der Kellner brachte ihnen zwei Cafés Solalex, die Gourmetvariante eines Espresso mit unanständig viel Sahne und einem großzügigen Schuss Pflaumenschnaps. Zwei Stücke hausgemachte Pflaumentarte machten den kleinen Imbiss perfekt. Ohne dass sie danach fragen mussten, stellte der Kellner einen Wassernapf auf den Boden, denn auch Minus galt hier als Stammgast.
Als Andreas’ Telefon vibrierte, wusste Mikaël, dass der Tag gelaufen war. Doch nachdem Andreas die SMS gelesen hatte, zeigte er ihm lächelnd die Nachricht auf dem Display: Yodi hat das Fruchtwasser verloren. Es geht gleich los. Antoine.
Andreas hatte schon immer mal beim Kalben dabei sein wollen. Als er den Bauern Antoine aus Gryon auf einem Fest des Fremdenverkehrsamts anlässlich des letzten Alpauftriebs kennengelernt hatte, hatte er mit ihm darüber gesprochen.
Sie bezahlten und zogen die Schneeschuhe wieder an.
5
Der Bauernhof, vor dem Andreas und Mikaël parkten, lag mitten in Gryon. Um ihn herum waren immer mehr Chalets gebaut worden, bei denen es sich zum größten Teil um leer stehende Zweitwohnsitze handelte. Die Zahl der noch aktiven Landwirte der Gemeinde ließ sich an einer Hand abzählen, doch Antoine war einer von ihnen. Er hatte den Hof von seinem Vater geerbt und würde ihn demnächst an seinen Sohn Vincent weitergeben. Letzterer begnügte sich bislang damit, ihm ab und zu zur Hand zu gehen und seinen Lebensunterhalt mit Gelegenheitsjobs in der Region zu verdienen. Im Winter arbeitete er am Skilift, überwachte dort die Funktion der Anlagen oder fuhr nachts mit der Schneeraupe über die Pisten. Je nach Bedarf wurde er auch von der Gemeinde Gryon engagiert.
Andreas und Mikaël betraten den Stall. Zur Linken standen zehn Kühe in einer Reihe, hinten rechts vier Modzons. Antoine hatte ihnen erklärt, dass dies im waadtländischen Dialekt die Bezeichnung für junge Färsen war. In einem Pferch käuten zwei Kälber wieder.
Antoine drehte sich zu ihnen um, kam auf sie zu und schüttelte ihnen die Hand.
»Yodi hat noch nicht gekalbt. Ihr seid noch rechtzeitig gekommen.«
Ein Geräusch entweichender Luft ließ sie aufschauen. Vincent hatte gerade eine der Kühe gemolken und auf einen Knopf gedrückt, damit sich die Zitzenbecher vom Euter lösten. Er begrüßte die Besucher.
»Welche von den Kühen ist Yodi?«, fragte Andreas.
»Die da drüben.« Antoine zeigte auf die fünfte Kuh in der linken Reihe. »Wir nennen sie Yodi, aber eigentlich heißt sie Yodeleuse.«
Er ging zu ihr hinüber, legte eine Hand auf ihren Rücken und streichelte sie.
»Sie ist die sanfteste meiner Kühe.«
Yodeleuse besaß ein champagnerfarbenes Fell mit vereinzelten weißen Flecken. Zwei helle Ringe um die Augen ließen sie freundlich und intelligent aussehen. Sie hatte einen hübschen Kopf, musste Andreas zugeben.
»Wie lange dauert es denn noch, bis sie kalbt?«, fragte Mikaël.
»Ich glaube, es geht gleich los. Sie wird schon etwas unruhig. Und die Wehen haben bereits eingesetzt.«
Sie nahmen an einem Tisch in einer Ecke des Raumes Platz, der wie ein Carnotzet, ein Waadtländer Weinstübchen, eingerichtet war. Antoine öffnete eine Flasche Weißwein und füllte vier kleine Gläser.
»Prost«, rief Antoine.
»Prost«, antworteten die anderen drei einstimmig.
»Wie nennt man die Rasse dieser Kühe?«, fragte Andreas, dessen Wissen über Rinder sich auf die morgendliche Milch in seinem Kaffee und auf das Steak tatare, das er gelegentlich zubereitete, beschränkte.
»Das sind Simmis«, erklärte Vincent.
»Das sind was?«
»Simmentaler Fleckvieh«, präzisierte Antoine.
»Sie stammen ursprünglich aus dem Berner Oberland und sind eine Zweinutzungsrasse«, fügte Vincent hinzu.
»Zweinutzung?«, fragte Mikaël erstaunt.
»Ja, sie sind gute Milchkühe und außerdem exzellente Fleischlieferanten.«
»Hauptsächlich findet man sie auf den Alpwiesen.«
»Und sie sind viel hübscher als die Holsteiner!«
Vincent und Antoine überboten sich gegenseitig in ihrem leidenschaftlichen Stolz.
Antoine fuhr voller Elan fort: »Unten in der Rhôneebene haben die Bauern fast nur noch Holsteiner. Das sind zwar bessere Milchkühe, aber sie sind auch mager und knochig. Außerdem sind sie dort meist enthornt, aber für mich ist eine Kuh ohne Hörner keine Kuh mehr. Obendrein sind die Simmentaler viel muskulöser. Das sind Kühe mit Charakter. Und ihre Milch ist perfekt für die Herstellung von Bergkäse.«
»Produziert ihr auch Käse?«, fragte Mikaël.
»Nein, meine Eltern haben noch Käse gemacht. Ich liefere meine Milch bei der Molkerei ab. Aber ich hoffe, dass Vincent entsprechende Schulungen besucht, und ermutige ihn, diese Tradition wiederaufleben zu lassen.«
Yodeleuse ließ ein lang gezogenes Muhen vernehmen. Antoine ging zu ihr hinüber. Sie hatte sich gerade hingelegt. Er beugte sich zu ihr hinunter und streichelte ihren Kopf. Die anderen kamen näher.
»Alles gut, Yodeleuse? Wirst du uns einen kleinen Bullen oder ein Mädchen schenken?«
Ihr Blick war nach innen gekehrt. Sie atmete heftig, die Stärke der Wehen schien zuzunehmen. Nach einigen erfolglosen Versuchen kam plötzlich ein Beinchen des Kalbes zum Vorschein.
»Ah, da ist es ja.«
Antoine schob das Bein vorsichtig zurück, um nach dem anderen zu tasten und das Kalb an beiden Beinen herausziehen zu können. Dabei sprach er beruhigend auf seine Kuh ein. Doch das Kälbchen kam noch nicht zum Vorschein. Yodeleuse legte ihren Kopf ins Stroh, als wolle sie zeigen, dass sie die Kraft verließ.
»Komm schon, meine Große. Du musst jetzt noch mal kräftig drücken.«
Antoine wischte sich den Schweiß von der Stirn, zog etwas kräftiger und ließ nicht mehr locker. Die Schnauze kam zum Vorschein, gefolgt vom ganzen Kopf. Nach weiteren erfolglosen Wehen atmete Yodeleuse tief ein und drückte, bis das ganze Kälbchen auf einen Schlag hinausglitt.
»Ein Mädchen«, sagte Antoine lächelnd.
Vincent und sein Vater ergriffen jeder ein Bein und zogen das Kälbchen auf ein vorbereitetes Strohlager. Vincent kniete sich hin und begann das Fell mit einem Strohbündel abzureiben.
»Antoine!«, rief Andreas, tief bewegt von dem, was er sah. »Komm her! Da kommt noch ein Zweites.«
Antoine, der in den Nachbarstall gegangen war, kam wie der Blitz angelaufen.
»Na so was! Du bescherst uns ja eine schöne Überraschung, Yodi.«
»Ich hab dir doch gesagt, dass sie auffällig dick war«, meinte Vincent.
»Andreas, hilfst du mir mal?«
Andreas und Antoine zogen das zweite Kalb auf das Strohlager nebenan. Andreas nahm etwas Stroh und machte sich daran, das Kälbchen trocken zu reiben, so, wie er es bei Vincent gesehen hatte. Er fühlte sich nützlich. Ein Gefühl, das er beinah vergessen hatte.
Ein paar Minuten später stand Yodeleuse bereits wieder und fraß ihr Heu.
6
Touristen flanierten über den Pariser Platz. In Berlin hatte es angefangen zu schneien, und einzelne Schneeflocken blieben auf dem Pflaster liegen. Das Brandenburger Tor, Denkmal der Wiedervereinigung und Mahnmal der Trennung, war erleuchtet. Litso Ice betrat den Mittelstreifen der Prachtstraße Unter den Linden, um den einen Kilometer bis zur Oper zu Fuß zu gehen.
Er erkannte die im Stil eines korinthischen Tempels gestaltete Fassade des Gebäudes sofort und eilte die Treppenstufen der Staatsoper empor. Die riesige Eingangshalle war schwarz vor Menschen, und ein eindringliches Klingeln ertönte: In sieben Minuten würde die Vorstellung beginnen. Ein Platzanweiser wies ihm den Weg zum ersten Rang und zu seinem Sitz in der ersten Reihe direkt hinter dem Geländer. Litso Ice setzte sich und legte sich seinen gefalteten Mantel über die Knie. Ihm gegenüber saß ein etwa fünfzigjähriges Paar in einer Loge, die eigens für die Ehrengäste hergerichtet worden war. Er holte sein Smartphone hervor und überprüfte, ob die Zielperson mit dem Foto übereinstimmte, das er erhalten hatte.
Der Dirigent betrat die Bühne, das Gemurmel verstummte, und das Licht wurde gedimmt. Der Vorhang öffnete sich und gab den Blick frei auf einen majestätischen Baum, der inmitten einer Behausung stand. Hinten konnte man eine Eingangstür sehen, rechts einen Wohnraum mit einem großen Kamin und in der Mitte, vor dem Baum, einen Tisch, an dem Sieglinde saß. Ihr Ehegatte Hunding schlief friedlich. Draußen tobte ein Unwetter. Die Streichinstrumente intonierten mit einem ungezügelten, abgehackten Rhythmus den Regen. Die Holzbläser unterstrichen den Tumult, der Rhythmus nahm Fahrt auf, Posaunen, Tuba, Becken, Pauken. Schon anhand dieser ersten Takte ließ sich das dramatische Schicksal der Helden erahnen. Dann stimmten die Fagotte, Klarinetten, Hörner und Trompeten in das Geschrei ein, und der Rhythmus steigerte sich weiter. Die Holzinstrumente hielten inne und überließen den Posaunen, Tuben, Becken und Pauken das Spiel, die alles hinwegzufegen schienen.
Litso Ice wurde heiß unter der Silikonmaske, die er trug, um nicht wiedererkannt werden zu können. Trotz dieser Unannehmlichkeit in die Musik versunken, schloss er die Augen. Er dachte an den Mann und an dessen Frau in der Loge. In der Oper zu sterben und von den Walküren nach Walhall gebracht zu werden, das Drama bis zu seinem Höhepunkt zu leben – ein schönes Ende. Die Musik wurde langsamer. Das Gewitter hatte sich gelegt. Er öffnete die Augen.
Siegmund war es gelungen, seinen Feinden zu entkommen. Gerade betrat er erschöpft die Behausung, in der er Unterschlupf gefunden hatte. Er blickte sich um und ließ sich dann auf dem Bärenfell vor dem Kamin nieder.
Am Vorabend hatte Litso Ice das ganze Libretto der Oper noch einmal gelesen. Er kannte jede Szene, jede Anspielung und konzentrierte sich ganz auf seinen Genuss. Am Ende des zweiten Aktes würde er selbst einen Auftritt haben und den dritten Akt verpassen. Das war schade, aber die Arbeit kam eben vor dem Vergnügen.
Während der nächsten zwei Stunden stellte sich Litso Ice vor, er sei in die Haut des unglücklichen Helden Siegmund geschlüpft: Er machte sich auf die Suche nach dem verzauberten Ring, der von einem furchteinflößenden Drachen bewacht wurde, durchlebte die glühende Liebe zu Sieglinde, bekam die Wut Frickas zu spüren, forderte Hunding, den eifersüchtigen Ehemann, heraus, bevor ihn Wotans Zorn niederstreckte und der Göttervater Blitz und Donner heraufbeschwor, um zu verschwinden.
Die Musik verklang.
Der Vorhang fiel.
Das Licht ging an.
Pause.
Um zweiundzwanzig Uhr vierzig begab sich Litso Ice zu dem auf seinem Plan markierten Notausgang, drückte die Klinke hinunter, um sicherzustellen, dass die Tür unverriegelt war, und suchte anschließend die Toiletten auf. Er schloss sich in einer der Kabinen ein, holte die Pistole aus der Tasche, versicherte sich, dass sie geladen war, schraubte den Schalldämpfer auf und versteckte sie in einer der Außentaschen seines Mantels. Mittlerweile schwitzte er stark unter der Silikonmaske und hatte es eilig, sich ihrer zu entledigen. Er betrachtete sich im Spiegel. Alles war in Ordnung. Er ging auf den Flur zurück, hörte das Klingeln, das das Ende der Pause ankündigte, und sah, dass die Zuschauer wieder ihre Plätze einnahmen.
Litso Ice hatte sehr wenig Zeit und durfte sich absolut keinen Fehler erlauben. Er wusste, dass die Zielperson immer von zwei Leibwächtern begleitet wurde, hatte sie jedoch im Saal noch nicht gesehen. Er stieg die Treppen hinauf und bemerkte zwei Männer in dunklen Anzügen, die vor der Tür zur Loge standen. Er ging auf sie zu.
Das Orchester spielte wieder, der dritte Akt hatte gerade begonnen. Als Litso Ice die ersten Takte hörte, erkannte er den berühmten »Ritt der Walküren«, den man in »Apocalypse Now« für die Szene aufgegriffen hatte, in der mit Helikoptern Jagd auf die feindlichen Vietnamesen gemacht wurde. Und gleichzeitig musste er an die Filmmusik zu »Der Krieg der Sterne« denken. Die Ähnlichkeit war frappierend. Wäre Wagner noch am Leben, hätte er den Prozess um einen Plagiatsvorwurf mit Sicherheit gewonnen. Litso Ice fühlte sich wie Luke Skywalker, der auf zwei Soldaten der Imperialen Armee zuschritt. Mangels Laserschwerts umfasste er den Griff seiner Waffe in der Manteltasche. Als er auf ihrer Höhe war, wandten ihm beide Leibwächter die Köpfe zu, sodass sich ihre Blicke trafen.
»Entschuldigung, wo sind die Toiletten?«
Als einer der Handlanger daraufhin den Arm hob, um ihm die Richtung zu weisen, richtete Litso Ice die Pistole, die er immer noch in seiner Manteltasche versteckt hielt, auf den anderen Mann, der etwas weiter hinten stand.
Er betätigte den Abzug. Außer dem Klicken des Hammers auf den Schlagbolzen und der Bewegung des Verschlusses, gefolgt von einem kurzen dumpfen Ton, war nichts zu hören. Die Kugel hatte diesen Zerberus mitten ins Herz getroffen. Auf seinem schwarzen Anzug zeichneten sich ein paar rote Spritzer ab, bevor er zusammenbrach. Dem vorderen Leibwächter blieb keine Zeit zum Nachdenken. Litso Ice hatte bereits seinen Schusswinkel angepasst und ein zweites Mal mit gleicher Präzision den Abzug betätigt.
Beide Männer lagen auf dem Boden. Die Musik brandete auf.
Litso Ice öffnete sacht die Tür. Das Paar saß mit dem Rücken zu ihm. Gerade als Gerhildes durchdringende Rufe zu hören waren, die als eine der acht Walküren die Leichen der Gefallenen nach Walhall brachte, drückte er das erste Mal den Abzug. Die Frau wurde im Nacken getroffen und sank auf ihrem Sessel zusammen. Der Mann wandte sich um und sprang auf. Ihm blieb gerade noch genug Zeit, seinen Angreifer verblüfft anzuschauen, bevor ihn die Kugel mitten in die Stirn traf. Er kippte über das Geländer. Sein lebloser Körper stürzte hinab in den Orchestergraben.
Die Musik verstummte. Schreie, die nicht aus den Mündern der Walküren kamen, ertönten.
Litso Ice würde zwar nicht das Ende des dritten Aktes verfolgen können, aber er kannte den Epilog: Wotan beraubt seine Tochter Brünnhilde ihres göttlichen Status und versetzt sie in einen tiefen Schlaf … Heute Abend würde es keinen dritten Akt mehr geben. Der Tod seiner Zielperson hatte die Vorstellung beendet.
Litso Ice steckte die Waffe wieder in seine Tasche und verließ die Loge. Der Fluchtweg war nur ein paar Meter entfernt. Da er ahnte, dass das Publikum von Panik ergriffen völlig aufgescheucht umherlaufen würde, wählte er die Treppe nach unten und trat durch den Notausgang hinaus auf die Straße, um in der Berliner Nacht zu verschwinden.
7
Nachdem Vincent den ganzen Tag oben auf den Pisten die Ankunft der Sessellifte überwacht hatte, war er seinem Vater noch wie immer beim Melken zur Hand gegangen. Nach einer gründlichen Dusche hatte er sich auf das traditionelle Treffen am Samstagabend vorbereitet. Bevor er sich auf den Weg zu seinen Freunden machte, betrachtete er sich im Spiegel und zupfte an ein paar rebellischen Haarsträhnen. Der Anblick seines Spiegelbilds ließ ihn erstarren. Er war kein Jugendlicher mehr, kam sich aber auch noch nicht richtig wie ein Mann vor. Lag das an seinen jungenhaften Gesichtszügen?
Bis jetzt hatte er bei den Frauen trotz seines wohlproportionierten Körpers und den von der Arbeit auf dem Hof geformten Muskeln keinen wirklichen Erfolg gehabt. Sein Körper war ihm zu einer regelrechten Obsession geworden. Auf der Suche nach Inspiration klickte er sich regelmäßig durchs Internet und verwendete einige sündhaft teure Cremes und Pflegeprodukte, die er vor den Blicken seines Vaters in seinem Zimmer versteckte, denn dieser hätte dafür kein Verständnis gehabt. Dennoch fühlte er sich immer noch wie ein kleiner Junge im Körper eines Mannes.
Vincent betrat das Harambee Café am Platz der Barboleuse in Gryon, ein Treffpunkt der Jungen und weniger Jungen, zu denen er sich nichtsdestotrotz zählte. Seine Kumpel waren alle genau wie er zwischen fünfundzwanzig und dreißig. Sie hatten ein paar schöne Jahre zusammen im Jugendring der Gemeinde verbracht, hatten im vergangenen Jahr allerdings beschlossen, ihren Platz dort nun den Jüngeren zu überlassen. Dennoch hatten sie ein paar für Junggesellen typische Angewohnheiten beibehalten, da sie auch tatsächlich alle unverheiratet waren.
Vincent hatte Gryon immer sehr gemocht, aber in letzter Zeit belastete ihn sein Umfeld. Die Erwartungen seines Vaters wurden immer fordernder. Er hatte das Gefühl, immer die gleichen Rituale auszuführen und dieselben Leute an den immer gleichen Orten zu treffen. All das deprimierte ihn. Er konnte sich einfach nicht vorstellen, sein ganzes Leben in dieser Enge zu verbringen, die keinerlei Überraschungen zuließ. Er hatte Pläne, die er auf jeden Fall umsetzen wollte.
Der Abend war in vollem Gange. Vincent erblickte seine drei Kumpel an der Bar, gesellte sich zu ihnen und klopfte Jérôme auf die Schulter.
»Hallo, wie geht’s?«
»Gut. Ich hatte heute frei und hab das ausgenutzt. Ein höllischer Pulverschnee.«
»Ich hab mich heute den ganzen Tag nicht aus dem Lifthäuschen wegbewegt … aber dich habe ich da nicht gesehen.«
Jérôme gab dem Kellner ein Zeichen und bestellte eine Runde Bier.
»Ich war mit meinen Tourenskiern in Anzeindaz. Am Wochenende ist mir auf den Pisten zu viel los, dazu das lästige Anstehen und die dämlichen Horden von Städtern.«
»Und ich«, fiel ihm Cédric ins Wort, »hab den ganzen Tag auf dem Parkplatz verbracht, um für diese idiotischen Touristen den Verkehr zu regeln.«
Romain hob sein Bierglas – Vincent war sich ziemlich sicher, dass es nicht sein erstes war –, prostete seinen Freunden zu und stimmte den gemeinsamen Schlachtruf an. Keiner der anderen Anwesenden konnte dieses Freudengeschrei überhören, das den Lärmpegel, den die ohrenbetäubend laute Musik verursachte, noch um einiges erhöhte.
Vincent nahm nicht am Gespräch teil und fragte sich, was er dort überhaupt machte. Immer die gleiche Leier, die gleichen öden Unterhaltungen. War es überhaupt ein Zufall, dass sie alle vier Junggesellen waren? Romain hatte letztes Jahr geheiratet, aber die Verbindung hatte nicht mal ein Jahr gehalten. Seine Frau hatte ihm vorgeworfen, ein zurückgebliebener Teenie zu sein, unfähig, sich der Verantwortung eines Erwachsenenlebens zu stellen. Vincent kannte die genauen Umstände ihrer Ehekrise nicht, war sich jedoch sicher, dass Romains exzessiver Alkoholkonsum das Ende ihres kurzen Glücks, das mit einer Scheidung endete, eingeläutet hatte.
Cédric, der schüchtern und zurückhaltend war, erzählte wenig von seinen Eroberungen. Wenn er von der Arbeit kam, musste er sich um seinen behinderten Vater kümmern, was ihm wenig Zeit für amouröse Bekanntschaften ließ. Seine freie Zeit verbrachte er mit seinen Freunden. Außerdem half er Vincent und Antoine auf dem Hof, wann immer es ihm möglich war. Cédric war sein bester Freund, doch mit der Zeit hatte Vincent einsehen müssen, dass sie nicht mehr die gleichen Interessen teilten. Dennoch schätzte er seine Gegenwart und seine Hilfe. Allerdings bedankte er sich viel zu selten dafür bei ihm. Er würde versuchen, öfter daran zu denken. Momentan hatte er jedoch andere Sorgen.
Jérôme hingegen war ganz klar auf der Suche nach einer Frau. Er schämte sich nicht, offen zuzugeben, dass er sich auf den entsprechenden Internetseiten angemeldet hatte, im Gegensatz zu Vincent, der sich nicht zu seiner eigenen Suche im Netz bekannte. Er sollte bald den Hof übernehmen, und das vertrug sich nicht unbedingt mit seiner Sehnsucht, eine Frau zu finden. Zumindest würde es schwierig werden, eine zu finden, von der er träumte. Ein paar kleinere Abenteuer hatte er für sich verbuchen können, aber nie war etwas Ernstes daraus geworden. Vor allem hatte er das Gefühl, dass der Beruf des Landwirtes die Damenwelt eher abstieß. Sobald er davon erzählte, sahen sie sich schon Ställe misten und heuchelten Entschuldigungen, um das nächste Rendezvous zu umgehen.
Vincent hatte daher schließlich einen Account bei einer Dating-App angelegt. Beim Erstellen seines Profils hatte er etwas gemogelt. Eine Lüge, die vielleicht zur Wahrheit würde, aber er konnte es sich nicht erlauben, darüber zu sprechen. Noch nicht.
8
Sonntag, 24. Februar
Das Glockengeläut hallte im historischen Dorfkern Gryons wider. Entgegen ihren üblichen Gewohnheiten hatten Andreas und Mikaël bis in die Puppen geschlafen und sich dann hastig fertig machen müssen. Sie waren von der Pfarrerin Erica Ferraud und ihrem Mann Gérard zum Mittagessen eingeladen worden. Obwohl sie keine regelmäßigen Kirchgänger waren, erschien es ihnen unhöflich, vor dem Essen nicht am Gottesdienst teilzunehmen.
Die Gemeinde saß bereits, als sie die Kirche betraten. Die Orgel spielte, hörte aber genau in dem Moment auf, als die beiden Nachzügler erschienen. Erica stand vor dem Altar und wollte gerade die Gemeinde begrüßen, als sie sie sah und die Hand hob, um sie von Weitem heranzuwinken.
»Herzlich willkommen, hier vorne ist noch Platz. Kommt und setzt euch.«
Alle drehten sich zu ihnen um. Sie hatten keine andere Wahl, als den Mittelgang entlangzugehen und sich in die erste Bank direkt unter der Kanzel zu setzen. Diskretion sah anders aus.
Erinnerungen, begleitet von starken Gefühlen, stiegen in Andreas auf. Er hatte die Kirche seit dem 21. September nicht mehr betreten. Damals hatte er auf just dieser Bank gesessen und alles verstanden. Die Schuldige war Erica Ferraud – die Frau, die gerade vor den versammelten Gläubigen Gott anrief. Er hatte mit seiner Seele und seinem Gewissen vereinbart zu schweigen. Niemandem etwas davon zu erzählen. Noch nicht einmal Mikaël. Ein Berufsvergehen, aber er hatte geglaubt, damit zurechtzukommen. Was das Gewissen Ericas betraf, so war dies nicht sein Problem. Sie musste diese Sache von Angesicht zu Angesicht mit Gott ausmachen.
»Lasset uns beten.« Erica verstummte für einen kurzen Moment, um sich vor dem Gebet zu sammeln. »Herr, inmitten unserer Not, unserer Irrwege und all der Dunkelheit, die uns umgibt, schenke Du uns neuen Atem. Gib uns Mut, wenn wir versucht sind, die Arme hängen zu lassen, und Erlösung, wenn uns die Fehler der Vergangenheit zu erdrücken drohen. Herr, wir gestehen dir unsere Angst vor dem Bösen und bitten dich um Vergebung und um Erlösung von all unseren Sünden. Bedenke uns mit deiner Güte und der Versicherung deiner Liebe.«
Ericas Worte hallten in Andreas’ Kopf nach: »Wenn uns die Fehler der Vergangenheit zu erdrücken drohen …« Waren diese Worte für die Gemeinde oder in erster Linie für Erica selbst bestimmt? Fühlte sie sich schuldig, einen Menschen getötet zu haben? Wie schaffte sie es, vor der Gemeinde zu stehen und Gott zu repräsentieren, wenn sie ihren eigenen Dämonen erlegen war? Auch als Pfarrerin war sie eben doch menschlich und fehlbar.
Auf die Bitte der Pfarrerin hin erhoben sich die Gläubigen und stimmten ein Kirchenlied an. Nach einigen von der Orgel begleiteten Strophen ergriff Erica wieder das Wort.
»Hören wir nun das Wort Gottes. Ich möchte Sie einladen, Ihre Jacken anzuziehen und mir auf den Platz vor der Kirche zu folgen.«
Die Gemeindemitglieder tauschten verwunderte Blicke aus, doch als Erica den Mittelgang in Richtung Ausgang entlangschritt, folgten ihr alle.
Während Andreas ihr hinterherging, dachte er über ihre Entscheidung nach, ihr Amt weiter auszuüben, und musste sich eingestehen, dass er sich damit ein wenig schwertat. Er konnte nachvollziehen, warum sie so gehandelt hatte, und hatte sich eingeredet, dass es Ericas Opfer nicht anders verdient hatte. Doch tief in seinem Inneren wusste er, dass er sie hätte festnehmen müssen. Sie war schuldig. Schließlich durfte niemand, und schon gar keine Pfarrerin, die Justiz oder gar Gott ersetzen.
Die Sonne strahlte von einem makellos blauen Himmel herab. Als sich alle vor der Kirche versammelt hatten, erhob Erica wieder die Stimme. »Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen«, begann sie und betrachtete dabei ehrfürchtig den Grand Muveran.
Alle folgten ihrem Blick und bewunderten das Bergpanorama, außer Andreas, der Mikaël aus dem Augenwinkel musterte und dabei in dessen tiefgründigen dunklen Augen versank. Selbst nach zehn gemeinsamen Jahren machte es ihm immer wieder Freude, seinen Partner anzuschauen. Sein dichtes, wuscheliges braunes Haar, sein Bartansatz, seine buschigen Augenbrauen, seine Stupsnase und sein Muttermal auf der linken Wange hatten auf ihn immer noch die gleiche Wirkung wie früher. Er war seinem Charme verfallen, aber vor allem liebte er seine Persönlichkeit. Er verspürte plötzlich große Lust, Mikaëls Körper an seinem zu fühlen, das irrationale Bedürfnis nach einer leidenschaftlichen Umarmung.
Erica fuhr mit der Lesung des Psalms 121 fort, und Andreas wurde rot. Das hier war weder der Ort noch der richtige Zeitpunkt, sich sexuellen Phantasien hinzugeben. Er versuchte, sich auf die Worte der Pfarrerin zu konzentrieren.
Als alle wieder in den Kirchenbänken Platz genommen hatten, stieg Erica auf die Kanzel. Ihr Blick schweifte über die Anwesenden, bevor er sich an Andreas in der ersten Reihe heftete. Sie wurde von seinen blauen Augen aus dem Konzept gebracht. Es war, als könnte sie durch sie in ihn hineinschauen und seine Gedanken lesen. Ein Gefühl, das Erica bei jedem ihrer Treffen überkommen hatte, seit sie sich im Zuge der Ereignisse des letzten Herbsts kennengelernt hatten.
Sie fragte sich, warum sie ihn und seinen Freund eingeladen hatte? Verspürte sie gegen ihren eigenen Willen das Bedürfnis, ihr Geheimnis zu teilen? Und obwohl Andreas Polizist war, war er der Einzige, bei dem sie sich vorstellen konnte, mit ihm darüber zu sprechen, denn zwischen ihnen war eine ganz besondere Beziehung entstanden, eine Verbindung an der Grenze zwischen Licht und Finsternis.
Während sie mit ihrer Predigt begann, behielt sie Andreas aufmerksam im Blick. Er stach aus der Gruppe der Gemeindemitglieder heraus. Seine silbergrauen sehr kurz geschnittenen Haare, sein Dreitagebart und seine markanten Gesichtszüge betonten seinen intensiven Blick. Sorgfältig kultivierte er den Look eines »bad boys«: abgewetzte Jeans, Cowboystiefel und ein weißes T-Shirt unter einer Lederjacke, dennoch spürte sie hinter diesem äußeren Erscheinungsbild einen hohen Grad an Empfindsamkeit. Seine Anziehungskraft auf sie hatte keinerlei sexuelle Komponente. Sie wollte herausfinden, wer er wirklich war, und ihn verstehen. Vor allem aber hoffte sie, dass er ihrem Dilemma ein Ende setzen würde. Ja, aus diesem Grund hatte sie ihn eingeladen: ein erster intimerer Kontakt mit Andreas, um sicherzustellen, dass er es wusste. Um sich ihm zu nähern. Einschätzen zu können, ob er ihr Vertrauter sein konnte. Oder ihr Beichtvater? Welche Ironie für eine Protestantin. Doch genau darum ging es eben auch. Sie hatte das Bedürfnis zu beichten. Bis jetzt hatte sie niemandem ihre Tat gestanden. Noch nicht einmal ihrem Ehemann. Dabei lastete dieses Geheimnis schwer auf ihrem Gewissen.
»In der Bibel ist ein Berg der Ort, an dem Gott sich zeigt. Er ist eine Verbindung zwischen Himmel und Erde. Ein Ort, an dem sich Gott und die Menschen begegnen. In dem Moment, da der Verfasser des Psalms seinen Blick zu den Bergen hebt, streckt er ihnen seine Seele entgegen, um sich Gott zu öffnen. Denn dort findet er Hilfe.« Erica sah zur Decke hinauf und ließ ihren Blick auf dem Gewölbe aus Tannenholz ruhen. »Wer hat sich noch nie die Frage gestellt, warum Gott unsere Gebete mit offensichtlichem Schweigen beantwortet? Ob Gott schläft, statt zu handeln, während sich das Schicksal gegen uns verschworen hat? ›Woher wird mir Hilfe kommen?‹, fragt sich der Autor des Psalms. Und die Antwort lässt nicht auf sich warten: ›Meine Hilfe kommt vom Herrn!‹ Denn selbst wenn wir meinen, unserem Unglück allein gegenüberzustehen, ist Gott gegenwärtig. Er ist da, um uns zu beschützen und uns auf unserem Lebensweg zu begleiten. Um uns aufzurichten, uns voranzubringen und um uns die Last zu nehmen, die uns in die Tiefe zieht. Lasset uns beten und um Vergebung bitten. Um Vergebung zu bitten ist nicht immer einfach. Selbst zu vergeben ist häufig noch viel schwieriger. Und um das Gefühl zu haben, dass mir vergeben wird, muss ich mich von allem befreien, was mich innerlich zerstört. Von der Schuld und dem Hass, die mich daran hindern, nach vorne zu schauen. Doch wo fängt man an?«
Erica ließ die Frage unbeantwortet, damit jeder für sich darüber nachdenken konnte. Nach einer kurzen Pause ergriff sie wieder das Wort.
»Im Markusevangelium finden wir eine erste Antwort darauf: ›Und wenn ihr dasteht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen vergibt.‹ Ich muss demjenigen vergeben, der mir Böses getan hat, und ich muss akzeptieren, mir selbst zu vergeben. Indem ich mich selbst von diesem Gewicht befreie, kann mir die Vergebung Gottes zuteilwerden, damit ich meinen Blick heben und nach vorne schauen kann. Amen.«
Andreas hatte das Gefühl, dass Erica die Predigt für ihn geschrieben hatte. Dass sie von sich selbst sprach und die Botschaft an ihn richtete. Er war sich sicher: Die Schuld zerfraß sie, und sie wurde den Hass nicht los, der in ihr wohnte. Doch von welchem Hass genau sprach sie? Dem Hass gegen jene, die den Freund ihrer Kindheit zu dem gemacht hatten, was er geworden war? Gegen diesen Freund, der sie zweimal im Stich gelassen hatte? Gegen sich selbst? Oder gar gegen Gott, der all dies zugelassen hatte?
Vor der Kirche warteten Andreas und Mikaël auf Erica und Gérard. Sie begrüßten sich und tauschten die üblichen Höflichkeiten aus, wenngleich Erica dabei Andreas’ Blick mied.
Während des Essens drehten sich die Gespräche um relativ neutrale Themen. Die zwei Gläser Aprikosenschnaps als Digestif lösten allerdings Gérards Zunge.
»Hatte deine Predigt etwas mit all diesen Morden und deinem Jugendfreund zu tun?«, fragte er plötzlich.
Erica hatte nicht mit einem derartigen Einwurf ihres Ehemanns gerechnet. Ihr fehlten die Worte. Andreas’ Blick und ihrer kreuzten sich, und plötzlich war sie sich sicher, dass er wusste, was sich in Wahrheit an jenem Tag zugetragen hatte.
»Nein, nein«, antwortete sie dann. »Es war eher allgemein gemeint. Na ja, doch, es hatte natürlich schon auch damit zu tun.« Sie schwieg einen Moment, um eine angemessene Antwort zu formulieren. »Diese Geschichte hat jeden hier in Gryon berührt. Vor allem unsere Gemeindemitglieder. Und selbst wenn wir nie vergessen werden, was geschehen ist, müssen wir nach vorne schauen.«
Doch Gérard fuhr fort: »Warum dann die Erwähnung, dass man vergeben müsse, damit einem selbst vergeben werde? Man hätte meinen können, dass es sich um eine persönliche Botschaft deinerseits handelt …«
»Entschuldige, aber ich denke nicht, dass das der richtige Moment ist, uns hier die Stimmung zu verderben!«
»Aber du musst doch zugeben, dass es dir seit dieser Geschichte nicht gut geht. Und du willst nie darüber sprechen. Das beschäftigt mich. Ich mache mir Sorgen um dich, Erica.«
»Das reicht, Gérard«, stieß Erica aus, weil sie spürte, dass ihre Augen feucht wurden.
Andreas und Mikaël hatten dieser Szene regungslos beigewohnt. Die Pfarrerin hatte Schiffbruch auf einer einsamen Insel erlitten, und jemand musste ihr zu Hilfe kommen. Andreas erkannte, dass er damit gemeint war. Ericas Hilferuf war nicht an Gott auf dem Berg gerichtet gewesen, sondern an ihn.
Erica verweilte auf der Türschwelle und sah den Gästen nach, nachdem sich diese verabschiedet hatten. Ihr Mann hatte recht. Es ging ihr nicht gut. Sie hatte ihren Blick zum Himmel erhoben und um Hilfe gerufen, aber offenbar weigerte sich Gott, ihren Schrei der Verzweiflung zu erhören.
9
Am Abend zuvor war Litso Ice über eine Parallelstraße, die etwas weniger frequentiert und diskreter als Unter den Linden war, in sein Berliner Hotel zurückgekehrt. Zehn Minuten nachdem er seinen Auftrag in der Staatsoper ausgeführt hatte, war er wieder auf seinem Zimmer gewesen. Im Badezimmer hatte er aus seinem Kulturbeutel ein Tuch und einen Flakon gefischt, um die Fingerabdrücke von seiner Waffe abzuwischen und den Kolben mit Reinigungsmittel zu säubern. Anschließend hatte er geduscht, sich umgezogen und war am Flussufer entlangspaziert. Als er sicher war, dass er von niemandem beobachtet wurde, hatte er die Waffe in die dunklen Wasser der Spree geworfen. Danach war er ins Hotel zurückgekehrt und hatte sich vor dem Zubettgehen noch ein Glas Champagner eingeschenkt und den Blick auf das erleuchtete Brandenburger Tor genossen.
Alles war nach Plan gelaufen. Er war zufrieden. Zurück in Moskau, würde er einen Umschlag mit der zweiten Hälfte der Gage erhalten. Ein Auftrag brachte ihm zwischen dreißig- und fünfzigtausend Dollar ein. Dieser hier war komplexer und daher deutlich besser bezahlt. Eine Zielperson samt Ehefrau, zwei Bodyguards. Sein guter Ruf erlaubte es Litso Ice, seine Tarife im Allgemeinen selbst festzulegen. Die Konkurrenz war in den letzten Jahren stark geworden, und einige seiner Nebenbuhler zögerten nicht, die Tarife kaputt zu machen, doch er hatte nichts zu fürchten, denn seine Auftraggeber verfügten über genügend Mittel und wollten den Besten haben: ihn. Er hatte ein hübsches Sümmchen angehäuft und es auf einem Konto in einem Steuerparadies geparkt. Noch ein oder zwei Aufträge und er konnte seinen Traum in die Tat umsetzen: die Stadt verlassen und sich auf dem Land ein Gestüt aufbauen.
Litso Ice packte rasch seinen Koffer, fuhr hinab in die Empfangshalle, gab seinen Schlüssel ab und bezahlte, was er der Minibar entnommen hatte. Die Dame an der Rezeption fragte ihn, ob er sich am gestrigen Abend nicht durch den Krach der Krankenwagen und Polizeifahrzeuge gestört gefühlt habe. Ohne seine Antwort abzuwarten, fügte sie in vertraulichem Tonfall hinzu, dass ein russischer Politiker und seine Frau mitten in einer Opernaufführung ermordet worden seien. Er ging nicht darauf ein und bestellte ein Taxi zum Flughafen.
Auf der Fahrt dachte er darüber nach, was er eben gehört hatte. Er hatte den Auftrag angenommen, ohne die Identität seiner Zielperson zu kennen, was ihn nicht weiter störte, denn häufig war es besser so. Es verhinderte, dass er sich das Opfer als eine bestimmte Person vorstellte. Es war lediglich ein bewegliches Objekt, das es zu eliminieren galt. So einfach, wie den Müll hinunterzutragen. Ein russischer Politiker? Als ihm wenige Minuten vor der Opernaufführung das Foto auf sein Smartphone geschickt worden war, war ihm das Gesicht bekannt vorgekommen, doch letztlich hatte er es nicht wiedererkannt. Noch nicht einmal, als er mit seiner Waffe genau auf die Stirn gezielt hatte.