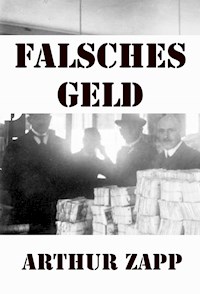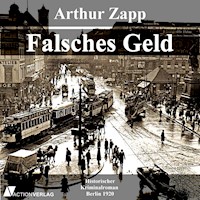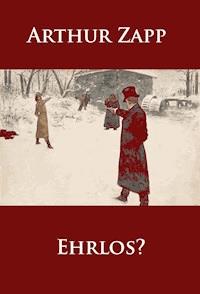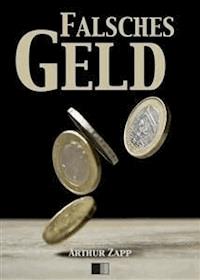Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Erotische Bibliothek Band 16: Das Liebesleben eines deutschen Jünglings von Arthur Zapp Sammlung klassischer erotischer Werke der Weltliteratur "Das Liebesleben eines deutschen Jünglings" ist ein Roman, dessen Manuskript Arthur Zapp von dem imaginären, von Zapp erfundenen Soldaten Albert Zell zugespielt wurde und das er vorgeblich in dessen Namen nach dem Dahinscheiden des Kameraden herausgab, und zeichnet die erotischen Erweckungserlebnisse eines jugendlichen Knaben Anfang des 20. Jahrhunderts nach.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 332
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Liebesleben eines deutschen Jünglings
Nach hinterlassenen Papieren eines Toten
Arthur Zapp
Erotische Bibliothek
Band 16
Arthur Zapp
Das Liebesleben eines deutschen Jünglings
Erstmals erschienen 1920
© Lunata Berlin 2019
Inhalt
Vorbemerkung des Herausgebers
Vorwort des Verfassers
Das Liebesleben eines deutschen Jünglings
Über den Autor
Die erotische Bibliothek
Vorbemerkung des Herausgebers
Ich lernte Albert Zell, der in den nachfolgenden Blättern die erotischen Erlebnisse seiner Jugendzeit erzählt, während des Feldzuges 1870/71 kennen, den wir als blutjunge Pennäler in demselben Regiment mitmachten. Gleiche Neigungen und Interessen schlangen bald das Freundesband um uns, das erst durch seinen Tod zerrissen wurde. Wenn wir auch jahrelang örtlich getrennt waren, geistig standen wir immer in Verbindung. Zell besaß alle Eigenschaften, die das weibliche Geschlecht anziehen und fesseln. Mit einem sehr ansprechenden Äußern verband sich ein lebhaftes, heißblütiges Temperament, viel Phantasie und warmes Gefühl. Wie er die Frauen, so zog auch ihn die Weiblichkeit unwiderstehlich an. Dabei war er durchaus keine leichte, oberflächlich angelegte Natur; er war keineswegs ein allzeit lustiger, fröhlicher Gesell, der das Leben von der heiteren Seite nahm. Im Gegenteil, die Grundzüge seines Charakters waren Ernst und Schweigsamkeit, ja, er neigte schon in jungen Jahren zur Melancholie. Eben diese Mischung seines Wesens war es wohl, die so sehr auf die Mädchen und Frauen wirkte, mit denen ihn seine etwas außergewöhnlichen Schicksale in Verbindung brachten. Einige seiner Beziehungen zu dem weiblichen Geschlecht sah ich entstehen und sich weiter entwickeln. Die meisten seiner erotischen Erlebnisse habe ich jedoch erst durch seine hier verzeichneten Bekenntnisse kennen gelernt. Wenn er wiederholt in den nachfolgenden Blättern das Typische seines Liebeslebens betont, so wird mancher Leser zweifelnd den Kopf schütteln. Man möge aber bedenken, daß sich diese erotischen Abenteuer, die hier in der Erzählung gewissermaßen Schlag auf Schlag folgen, in der Wirklichkeit sich auf viele Jahre verteilten. Wer das Leben kennt, wird wissen, daß ein so ungebundenes Liebesleben bei unserer Jugend die Regel bildet, bei der heutigen vielleicht noch mehr, als bei der, der mein Freund und ich angehörten. Welche Motive ihn bei seinen sehr offenherzigen Aufzeichnungen leiteten, wird der Leser aus seinen eigenen Erklärungen ersehen. Sie waren sicherlich keine unedlen, und wer vorurteilslos liest und die Schlußfolgerungen prüft, die er aus alledem zieht, wird zugeben, daß diesen sehr menschlichen Dokumenten ein kulturgeschichtlicher Wert nicht fehlt und daß die Absichten des Verfassers durchaus sittliche, kulturfördernde waren.
Mein Freund starb im Jahre 1917, nachdem er noch einen zweiten Band, der von seinem Eheleben berichtet und der den Titel: »In der Ehe, Bekenntnisse eines Ehemannes« führt, niedergeschrieben hatte. Er starb keines natürlichen Todes. Der große Weltkrieg hat auch ihn zu Fall gebracht, nachdem er ihm seine beiden Söhne und seine aufs innigste geliebte Frau, die den Tod ihrer Lieblinge nicht verwinden konnte, geraubt hatte. In seinem Testament hat er mir diese seine beiden letzten Manuskripte vermacht und mich beauftragt, sie zu sichten, eventuell zu überarbeiten und herauszugeben. Er selbst mochte bei der Durchsicht empfunden haben, daß er zuweilen doch allzu rückhaltlos verfahren, und daß manches nicht so der Öffentlichkeit übergeben werden konnte, als er es in seinem rücksichtslosen Wahrheitsdrang, der immer einer der Hauptzüge seiner Natur gewesen, kritiklos auf das Papier geworfen hatte.
Arthur Zapp
Vorwort des Verfassers
Wenn ich heute als Mann von 65 Jahren die Geschichte meines wilden jugendlichen Liebeslebens niederschreibe, so tue ich es wahrlich nicht aus Freude an der Erinnerung, denn neben manchem Schönen habe ich noch mehr Unschönes, Beschämendes zu berichten. Noch weniger schreibe ich aus Sensationslust, denn ich bin heute ein müder Greis, dem nur noch eine kurze Spanne Lebenszeit zugemessen ist und der resigniert, wunschlos, mit überlegenem Lächeln auf die Eitelkeiten des Lebens blickt. Ich veröffentliche die Erlebnisse meiner Jugendzeit aus demselben Grunde, der mich veranlaßt hat, in früheren Romanen die unnatürlichen, kulturwidrigen, durch und durch verrotteten Zustände in unserem Liebes- und Eheleben zu schildern und an den Pranger zu stellen. Ich will an dem mir zunächst liegenden Beispiel zeigen, wie sich das Liebesleben des deutschen Jünglings abzuspielen pflegt. Es handelt sich ja nicht um die Darstellung der Sitten eines Einzelindividuums, die wenig Wert haben würde, sondern um die des typischen Treibens unserer männlichen Jugend. So wie ich und meine damaligen Altersgenossen vor vierzig Jahren unter der Herrschaft der zweierlei Moral das schönste, höchste und stärkste Gefühl des Menschen geschändet, in den Schmutz gezogen haben, ohne uns dessen bewußt zu sein, weil wir die anderen so leben sahen, weil wir wußten, daß unsere Väter es nicht anders getrieben hatten, ebenso verzetteln auch noch heute die jungen Leute ihre Kraft zu lieben. Wer hat schuld an dieser beschämenden Tatsache, die unser ganzes Leben vergiftet und die Ursache von schweren moralischen und physischen Gebrechen und Leiden ist? Der einzelne nicht, sondern die Gesellschaft hat schuld, d.h. die tonangebenden Kreise, die die staatlichen Gesetze, die gesellschaftlichen Sitten und Gebräuche und Anschauungen geschaffen haben. Unsere sozialen Einrichtungen lassen nicht zu, daß die Männer der gebildeten, führenden Klassen vor dem 35. Lebensjahr heiraten. Das ist der Urquell alles Übels, der Prostitution und der illegitimen Verhältnisse, des wüsten Liebeslebens der unverheirateten Männer. Solange wir diese unsinnigen grellen Mißverhältnisse haben, solange wird und kann es nicht anders sein. Ich frage: Was sollen denn unsere jungen Männer tun, die noch ein halbes Dutzend Examina und lange Probe- und Diätarjahre vor sich haben, bevor sie eine Anstellung erlangen, die ihnen gestattet, eine Familie zu gründen? Will man den normalen, gesunden jungen Männern etwa zumuten, den stärksten natürlichen Trieb zu unterdrücken, sich körperlich selbst zu mißhandeln? Wenn sie es auch wollten, sie könnten es nicht, denn die gemißhandelte Natur würde sich doch elementar Bahn brechen. Ein gesunder, normaler junger Mann kann bis in die dreißiger Jahre hinein ohne geschlechtlichen Verkehr nicht leben. Er würde körperlich und seelisch ein Krüppel werden, wollte er es versuchen; Lebensfreude und Arbeitslust würden dahinsiechen, und er würde zur Liebe und Ehe und zur Erzeugung von Kindern nicht mehr tauglich sein. Die Natur läßt sich nicht spotten. Unsere unkulturellen sozialen Verhältnisse zwingen den normalen jungen Mann zur Prostitution mit allen ihren häßlichen, gefahrbringenden Begleiterscheinungen oder zur Verführung ehrbarer Mädchen oder zu widernatürlichen, ungesunden Manipulationen. Deshalb ist es Heuchelei oder Unverstand, will man die jungen Leute verdammen, die so leben, wie – ich gelebt habe. Die ganze geschlechtliche Frage ist nur ein Teil der großen sozialen Frage. Schafft Zustände, daß jeder junge Mann, gleichviel welchen Berufes, zwischen dem 20. und 22. Lebensjahr das Mädchen seiner Liebe heimführen kann, und daß er es nicht nötig hat, sich an ein reiches Mädchen, das ihm vielleicht Widerwillen einflößt, zu verkaufen und heimlich das Lasterleben seiner Jugend auch als Ehemann fortzuführen, um den in der Ehe unbefriedigten natürlichen Trieben zu genügen. In den meisten Kulturstaaten sind heute allein die Handarbeiter in der glücklichen Lage, mit zwanzig Jahren Liebesehen einzugehen und ihre natürlichen Begierden in legaler Weise zu befriedigen. In den unteren Ständen ist die Frühehe die Regel, in den oberen die Spätehe. Deshalb leben auch die jungen Leute der gesellschaftlich höheren Kreise geschlechtlich viel ungebundener, sittenloser und deshalb ist es auch Tatsache, daß Geschlechtskrankheiten in den oberen und mittleren Bevölkerungsschichten häufiger sind als in den Handarbeiterkreisen. Die jungen Arbeiter pflegen sehr häufig das von ihnen geschwängerte junge Mädchen zu heiraten, die »besseren« jungen Männer fast nie.
Schon in der Jugend müßte die Grundlage einer schöneren, reineren Auffassung von dem Verhältnis der beiden Geschlechter zueinander und ihrer gegenseitigen Pflichten gelegt werden. An Stelle einiger für die bei weitem größere Mehrzahl der Schüler wirklich recht entbehrlichen Disziplinen (z.B. Griechisch, höhere Mathematik, das Auswendiglernen starrer, veralteter Dogmen usw., wobei weder Geist noch Gemüt profitieren) müßte das wichtigste aus der Biologie, von der Natur des Menschen und auch Moralunterricht gegeben werden. Hierbei müßte die Jugend auch über das Wesen der geschlechtlichen Dinge in der ihr angemessenen Weise aufgeklärt und die heranwachsenden Jünglinge zur Achtung des Weibes, zur richtigen Würdigung des Liebeslebens und zur geschlechtlichen Selbstachtung erzogen werden...
Wenn ich meine Scheu, meine Bedenken, das erotische Leben meiner Jugendjahre der Öffentlichkeit preiszugeben, überwunden habe, so tat ich es, um durch ein aus dem Leben gegriffenes, ohne irgendwelche erdichteten romanhaften Zutaten und ohne alle Beschönigungen dargestelltes drastisches, eindruckfähiges Beispiel die öffentliche Aufmerksamkeit auf diese unhaltbaren Zustände zu lenken und zum Nachdenken darüber anzuregen. Ich tat es in dem Bewußtsein, daß ja alle, die von meinen Offenherzigkeiten Kenntnis nehmen, dieselben Jugendsünden hinter sich haben, die einen mehr, die anderen weniger, und von dem Wunsche beseelt, die Erkenntnis der Reformbedürftigkeit unserer sozialen und damit verbundenen und davon abhängigen übrigen kulturwidrigen Zustände auf allen Gebieten des Lebens immer weiteren Kreisen zu erschließen und die Bestrebungen einer bisher noch so kleinen Gruppe von vorurteilslosen Kulturfreunden fördern zu helfen, unser Liebesleben und unsere Eheinstitution sittlicher, menschenwürdiger zu gestalten.
Albert Zell
Das Liebesleben eines deutschen Jünglings
Ich war noch nicht ganz fünf Jahre alt, als ich das erste erotische Erlebnis hatte. Die aktive Rolle, die dem Manne nach Sitte und Herkommen in erotischen Dingen gebührt, spielte ich jedoch nicht dabei, sondern meine ältere Schwester Marion und ihre Freundin waren es, die mich und meinen kleinen Freund Viktor von Lichtenstein veranlaßten, mit ihnen auf den Heuboden auf dem Hofe unseres elterlichen Grundstücks zu klettern, um hier Vater, Mutter und Kind zu spielen. Oben mußte ich mich zu der Spielgefährtin legen, und meine Schwester, die alles das angab, wies den kleinen Viktor an, sie zu umhalsen. Meine kleine Frau und ich ahmten diese Prozedur folgsam nach, und nach einem Weilchen zogen die beiden kleinen Mädchen ihre Puppen, die sie unter ihren Kleidern verborgen gehalten, hervor und erklärten: Die Kinder seien nun geboren. Man sieht, wie geschäftig die Phantasie der kleinen Mädchen ist, sich schon in frühester Kindheit in recht naiver Weise in die Hauptrolle ihres künftigen Lebens als Gattin und Mutter hineinzuträumen.
Mein Spielgefährte und ich waren aber nicht recht bei der Sache; uns langweilte das Spiel, und unwirsch verließen wir den Schauplatz unserer ersten kindlich harmlosen erotischen Betätigung.
Dabei war ich durchaus kein phantasieloser Stockfisch; im Gegenteil, die Phantasie spielte in meinem späteren Liebesleben eine große, zuweilen stark stimulierende Rolle, aber sie schlummerte damals noch gänzlich. Im übrigen war ich schon in meiner frühen Kindheit ein Träumer. So habe ich in späteren Jahren meine Mutter erzählen hören, daß man mich einmal um die Mittagszeit vergebens im ganzen Hause und auf dem Hofe gesucht habe. Endlich fand man mich im Garten, im dichten Gebüsch; mit offenen Augen stand ich und starrte träumend vor mich hin. Ich selbst erinnere mich, daß ich als Kind die Gewohnheit hatte, mich in eine Märchenwelt hineinzudenken, mit der ich die Gestalten meiner Lektüre bevölkerte. Die böse Stiefmutter im Märchen von dem armen Geschwisterpaar Hänsel und Gretel verkörperte sich mir in der Gestalt einer bei uns Kindern gefürchteten häßlichen, keifenden, alten Nachbarin, und in einem biederen, wegen seiner jovialen Freundlichkeit bei uns Kindern beliebten alten Werkmeister einer Tuchfabrik sah ich den lieben Gott, von dem ich gelesen hatte, daß er zuweilen in Gestalt eines Mannes auf Erden wandele, um die Menschen, Gute und Böse, auf die Probe zu stellen.
Als ich elf Jahre alt war, machte ich meine ersten dichterischen Versuche. Damals war ein Mädchen, etwa in der Mitte der zwanzig, als Wirtschafterin in mein Elternhaus gekommen. Eveline Schrader war sentimental angehaucht, spielte die Gefühlvolle und erwies sich besonders mir gegenüber sehr liebenswürdig, und so machte ich sie zur Vertrauten meiner heimlichen lyrischen Bestrebungen. Sie lobte meine Gedichte, wohl mehr, um sich bei mir einzuschmeicheln, als aus wirklich objektivem künstlerischen Interesse; mehr denn als Dichter gefiel ich ihr offenbar als hübscher Bengel. Sie lehnte sich an mich, streichelte mir die Backen und mit schmelzender Stimme flüsterte sie mir ins Ohr: »Albert! Albertchen! Mein schöner lieber Junge!« Ihre heiße Wange schmiegte sich an meine.
Ich kann nicht sagen, daß mir diese Zärtlichkeitsanwandlung der etwa vierzehn Jahre Älteren Vergnügen bereitet und entsprechende erotische Regungen in mir erweckt hätte, im Gegenteil, die Verliebtheit der Wirtschafterin rief in mir, wie auch später ähnliche Situationen mit sinnlich begehrenden und meist älteren Mädchen und Frauen, nur eine peinlich beklommene Stimmung hervor. Aber die in dem liebeglühenden Alter des reifen Mädchens Stehende ließ nicht locker. Sie schwärmte mir von einem ihrer früheren Verehrer vor, wie lieb er sie gehabt, wie er ihre Schönheit gepriesen. Und eines Tages raffte sie ihr Kleid bis fast zum Knie: »Habe ich nicht ein schönes Bein, Albertchen?«
Natürlich wandte ich mich betreten ab und vermied von da ab, mit der Versucherin allein zu sein.
Ich war nahezu dreizehn Jahre alt, als ich endlich die Liebe kennen lernte, die in meinem ganzen späteren Dasein, wie im Leben jedes phantasiebegabten temperamentvollen Mannes, eine große Rolle spielen sollte. Der Blick der schwärmerischen blauen Augen, das freundliche Lächeln der blonden, anderthalb Jahre jüngeren Elise Grabert, einer Schulfreundin meiner gleichaltrigen jüngeren Schwester Gertrud, war es, was mich bezauberte und die ersten erotischen Triebe in mir wachrief. Nur ein halbes Jahr lang ungefähr währte diese Liebe, aber es war bereits eine Liebe mit allen obligaten Begleiterscheinungen: Schwärmerei, die sich in glühende Gedichte ergoß, süß empfundene Küsse und zuletzt brennende Eifersucht mit leidenschaftlichen heftigen Ausbrüchen.
Ich weiß es noch heute, wie eine schöne, selige Stimmung beim ersten Kuß über mich kam: Zart und keusch war mein Empfinden und doch voll inniger Zärtlichkeit. Das erste Erwachen der wunderbaren Zauberin Liebe, die natürliche Zuneigung der beiden Geschlechter, die mit unwiderstehlicher Gewalt den Knaben zum Mädchen drängt und die jungen Herzen mit hochklopfender Seligkeit erfüllt.
Mein Vater war damals häufig fern von Haus und Stadt, und so konnten wir Kinder, die wir jedesmal aufatmeten, wenn unser in seinen Erziehungsgrundsätzen übertrieben strenger Erzeuger abwesend war, uns freier bewegen. Mein Vater war – es war in der Konfliktszeit 1865 – Mitglied des preußischen Abgeordnetenhauses. Unsere Vaterstadt hatte, allen Bemühungen meines fortschrittlich gesinnten Vaters zum Trotz, noch keine Eisenbahn, und so war die Verbindung mit Berlin, die nur die Post und daneben ein noch langsamerer, großmächtiger, vorsintflutlicher Omnibus vermittelte, sehr beschwerlich und zeitraubend. Wir sahen also unsern Vater wochenlang gar nicht, und unsere gute Mutter, die überdies ein mildes Regiment führte, war von unserem großen Haushalt und den kleinen Geschwistern – wir waren unser sieben – viel in Anspruch genommen. So kam es, daß wir Älteren uns in dieser Zeit vielfach selbst überlassen waren. Im übrigen war mein Vater ein liberal denkender, gastfreier Mann, und er hatte nichts dagegen, daß des Sonntags nachmittags meine und meines älteren Bruders Freunde und die Freundinnen unserer beiden Schwestern sich zum Besuch bei uns einstellten. Es wurden Gesellschaftsspiele gespielt und getanzt, und zwischen uns Jungens und den Mädchen stand ein kindlich harmloser Flirt in voller Blüte.
Da packte mich Zwölfjährigen eines Tages zum erstenmal eine plötzliche, unerklärliche sinnliche Aufwallung. Ich befand mich mit meiner jüngeren Schwester und einer in ihrem Alter stehenden Schulgefährtin aus einer Nachbarsfamilie in unserem Wohnzimmer. Wir saßen an einem viereckigen Tisch, meine Schwester mir gegenüber, die etwa elfjährige Agnes Wahl zwischen uns. Und nun ereignete sich etwas Merkwürdiges, das mir noch heute fast unerklärlich ist. Es waren wohl die ersten Pubertätsregungen in mir und vielleicht auch die Wirkung der Mitteilungen eines neuen Freundes, der mir gerade damals von einer häßlichen Sache, die er heimlich betrieb, erzählt hatte. Meine Schwester war in ein vor ihr liegendes Buch vertieft, und auch Agnes Wahl hatte ihr Köpfchen über ein Buch gesenkt. Ich betrachtete sie schweigend; eine Locke ihres Blondhaars lag auf ihrer Stirn, auf ihren Wangen flammte eine Röte, vielleicht unter dem Einfluß der Lektüre, vielleicht auch war es meine unmittelbare Nähe, der Druck meines Schenkels, der sich gegen ihren preßte. Möglich, daß sie zu den frühreifen Kindern gehörte, bei denen sich schon in zarter Kindheit sinnliche Wallungen einstellen. Ihre Lippen waren leicht geöffnet, ihr Atem ging heftig.
Da kam es über mich. Nie hatte ich ähnliches empfunden. Wie im Traum, wie in einer Hypnose, wie unter dem Zwange einer unwiderstehlichen höheren Gewalt ließ ich meine Hand unter den Tisch gleiten und drückte ihre Knie, und dann glitt sie begehrlich weiter, keck, dreist. Agnes Wahl saß mäuschenstill, rührte sich nicht und wehrte die unerhörte Annäherung nicht ab. Nur ihr Atem wurde lauter, die Glut in ihrem Antlitz brennender. Wahrscheinlich stand sie unter demselben unbewußten, dunklen Trieb wie ich, den ein niegekanntes, bezwingendes, atemraubendes Gefühl durchrieselte. Kein Entschluß war vorausgegangen, kein Willensakt war es, eine unwillkürliche, jäh erwachte, unbewußte, rein triebhafte Regung hielt mich und die kleine Spielgefährtin eine Weile im Bann, bis ich aufstand und mich wortlos entfernte. Das Wunderbare war, daß die kleine Agnes gar nicht hübsch war, weder körperlich noch seelisch Anziehendes besaß und mir nie ein Gefühl der Sympathie eingeflößt hatte, etwa wie vorher Elise Grabert. Und auch in den Knabenjahren nachher hat mich keine ähnliche Regung zu ähnlicher Tat getrieben, was war es? Ein rätselhaftes Spiel der Natur? Wahlverwandtschaft? Lag etwas Verwandtes in unseren Naturen, das aufeinander wirkte und den gleichen sinnlichen Drang in uns auslöste? Es mußte wohl so sein, und auch in späterer Zeit habe ich die Erfahrung gemacht und auch von Frauen und Männern bestätigen hören, daß Menschen auf uns körperlich in dieser Weise wirken, die uns seelisch nichts sind und weder durch äußerliche noch innerliche Eigenschaften unser Interesse erwecken. Merkwürdig, daß es gröber veranlagte, geistig und moralisch unter uns stehende Menschen zu sein pflegen, die uns in dieser rein sinnlichen Weise anziehen.
Neben diesen erotischen Wallungen hatte ich schon als Knabe ernste Bestrebungen. Stundenlang saß ich an meinem kleinen Schreibpult, einem Weihnachtsgeschenk, und verfaßte schon als elfjähriger Knabe nach einer historischen Erzählung ein großes fünfaktiges Drama und schrieb auch, neben einigen kleinen Gedichten, eine romantische Novelle, die als Fortsetzung des Schillerschen Fragments »Der Geisterseher« gedacht war.
Im Jahre 1866 verlegten meine Eltern ihren Wohnsitz nach einer größeren Stadt. In nahezu zwanzig Jahren hatte mein Vater seine Fabrik zu großer Blüte gebracht, aber das hatte seiner Unternehmungslust, seinem Tatendrang und seiner Arbeitslust nicht genügt. Nicht nur, daß er sich in verschiedenen Ehrenstellungen betätigte, als Stadtverordnetenvorsteher, Meister vom Stuhl der Loge, als Politiker, er hatte auch eine Vorschußkasse begründet nach dem System von Schulze-Delitzsch, zu dem er auch persönliche Beziehungen angeknüpft hatte. Dieses Institut hatte er weiter ausgebaut und in mehreren kleineren Städten des Regierungsbezirks Filialen angelegt. Nachdem er seine Fabrik verpachtet hatte, verlegte er nun den Hauptsitz der Kreditgesellschaft von Zell & Co., wie das zur Aktengesellschaft ausgestaltete Unternehmen jetzt volltönender hieß, nach der Regierungshauptstadt.
Es dauerte gar nicht lange – ich hatte noch nicht ganz mein sechzehntes Lebensjahr erreicht – als ich mich sterblich in eine neue Schulfreundin meiner jüngeren Schwester verliebte. Es war eine Jüdin zwischen vierzehn und fünfzehn, klein, mit gelblichem Teint, schwarzem Haar, keine Schönheit, aber ihre großen, schwarzen, seelenvollen Augen mit dem melancholischen Ausdruck, den man oft in den Augen der Jüdinnen findet, und vor allem ihr Wesen war es, was mich unwiderstehlich anzog und mich zu einer anbetenden Schwärmerei Jahre hindurch hinriß. Sie war lebhaft, klug, schlagfertig, zurückhaltend und doch seltsam anziehend. Sie flößte mir ebensoviel warme Sympathie wie Achtung ein. Wunderbar, rätselhaft ist das Menschenherz. Ich, der ich mich Agnes Wahl gegenüber vom dunklen Trieb zu einer meinen dreizehn Jahren gar nicht angemessenen, frechen Handlung hatte hinreißen lassen, war jetzt der schüchternste, keuscheste, zarteste Anbeter. Klara Bohm kam oft in unser Haus – die Eltern kannten sich nicht und nie kam außer meiner Schwester einer von uns in ihre Familie – aber stets begegnete ich ihr mit der größten Zurückhaltung, und doch war ich über die Maßen verliebt in sie, mit tiefem, innigem, verehrendem Gefühl. Nur mit dem reinsten, ich möchte sagen frommsten Gefühl dachte ich ihrer, und nie schlich sich ein unlauterer, begehrlicher Wunsch in meine Empfindungen.
Meine Liebe verstieg sich nie höher als zu einem stummen, leisen, schüchternen Händedruck, zu einem bewundernden Blick und zu allerlei zarten Aufmerksamkeiten. Daß ich ihr auf der Eisbahn die Schlittschuhe anschnallte und während des Laufes nicht von ihrer Seite wich, jedes Winkes gewärtig, zu jedem Dienst bereit, war selbstverständlich, sowie daß ich bei Gesellschaftsspielen in unserem Hause und auch sonst ihren Kavalier machte. Ob sie mein stummes, aber doch beredtes Werben mit entsprechenden Empfindungen erwiderte, weiß ich bis zum heutigen Tage nicht. Einmal wagte ich, ihr durch meine Schwester eine Bonbonniere zu schicken. Sie hatte das Präsent erst, wie mir Gertrud berichtete, nach längerem Sträuben angenommen und nur unter der Bedingung, daß die Freundin den Inhalt mit ihr teilte, was meine Schwester natürlich nicht ausschlug. Der Überbringerin hatte sie einen schlichten Dank an mich aufgetragen, mir gegenüber aber nie des Geschenkes Erwähnung getan.
Nur ein einziges Mal war ich nahe daran, meiner innigen leidenschaftlichen Liebe einen Ausbruch zu gestatten. Klara Bohm war wieder einmal bei uns zu Gast, wir Kinder belustigten uns, während die Eltern in einem anderen Zimmer weilten, mit allerlei kindlichen Spielen. Jetzt war das Handwerkspiel an der Reihe. Zwei der Mitspieler verabredeten sich zu der pantomimischen Darstellung irgendeiner handwerkmäßigen Tätigkeit, und die anderen mußten es erraten. Ich stand mit Klara Bohm im dunklen Nachbarzimmer, um mit ihr zu beraten. Ich sehe die Situation heute noch so deutlich vor mir, als wäre es erst gestern gewesen, wir lehnten beide am Ofen, dicht nebeneinander. Unsere Ellenbogen berührten sich, tiefes Schweigen herrschte zwischen uns. Auf mir lag etwas Beklemmendes; ein heißer, erregender Kampf spielte sich in mir ab. Mit keinem Gedanken war ich bei dem Spiel; nur die unmittelbare Nähe des angebeteten Mädchens erfüllte mich ganz. Ich verspürte sie in allen meinen Nerven, jede Fiber in mir war gespannt. Trotz aller Dunkelheit sah ich ihr mir so liebes Antlitz mit dem bezaubernden Blick in den berückenden dunklen Augen. Ein heißer Wunsch stieg in mir auf: »Nur einmal möchtest du sie küssen, nur einen einzigen Kuß auf ihre roten, schon geschwungenen Lippen pressen!«
Ach, ich fand nicht den Mut, und doch hatte ich die Empfindung, daß sie sich in ähnlicher Stimmung befand wie ich, daß sie meinen Kuß erwartete. Ich nahm all' meinen Mut zusammen: »Jetzt – ja jetzt tust du es!«
Schon wollte ich mich zu ihr hinüberneigen. Da erklang ihre lebhafte, ein wenig lispelnde und doch so liebliche Stimme, die ich so gern hörte: »Warum sprechen Sie nicht, Albert? Woran denken Sie?«
»Ich?« verlegen stotterte ich es, beschämt. Ihre Stimme klang ärgerlich, erregt. Ahnte sie, was in mir vorging? »Natürlich doch – an unser Spiel –« beeilte ich mich zu versichern, »was – was wählen wir denn nur? Schlagen Sie doch etwas vor ..!«
»Ich weiß nichts«, versetzte sie, und ich meinte, daß etwas beklommenes, Bedrücktes in ihrem Ton lag.
Wieder trat Schweigen ein, wieder kämpfte ich verzweifelt mit mir. Es war wie Feuer in meinem Arm, der den ihrigen fühlte; ich hörte ihre Atemzüge, jetzt streifte ihr Haar meine Wange. Ich biß die Zähne aufeinander. Jetzt!
Da löste sich ein ganz leiser Seufzer von ihrer Brust. Ich vernahm es deutlich. Und im nächsten Moment trat sie von dem Ofen hinweg, der Tür entgegen.
»Kommen Sie! Wir spielen Drechsler!«
Sie legte ihre Hand auf die Klinke und öffnete.
Es war verpaßt. Noch heute konnte ich mich ohrfeigen über meine dumme Schüchternheit. Nie wieder bot sich eine so günstige Gelegenheit. Und es wäre doch so herrlich gewesen, das angebetete, heiß geliebte Mädchen einmal in meinen Armen zu halten, einmal die Küsse zu tauschen, die doch schon auf unseren Lippen brannten.
Jahrelang habe ich sie noch im stillen geliebt, und auch später noch, wenn ich in den Ferien in das Elternhaus zurückkehrte, ihr meine stumme Huldigung entgegengebracht.
Noch heute wird es mir warm, und eine sanft melancholische, innige Empfindung beschleicht mein Herz, wenn ich an die so keusch und innig Geliebte meiner frühesten Jünglingsjahre zurückdenke.
In der Schule war ich damals ebensowenig wie früher und später ein guter Schüler. Mit vierzehn Jahren war ich erst nach Tertia gekommen, und da ich nicht rechtzeitig nach »Ober« aufgerückt war, hatte mich mein Vater aus dem Gymnasium genommen, um mich von einem strafweise entlassenen, aber im Lehrfach sehr tüchtigen, erfolgreichen Pädagogen, der sich durch Privatunterricht ernährte, für Sekunda vorbereiten zu lassen. So wenig fleißig ich als Schüler war, so eifrig war ich bei meinen privaten dichterischen Arbeiten. Für Lyrik habe ich nie Begabung und Neigung besessen. Dem Drama und der epischen Dichtung gehörte meine Liebe, höchst charakteristisch war es für die Art meiner literarischen Betätigung, daß ich schon als fünfzehnjähriger Knabe eine ganz realistische Novelle verfaßt habe: »Des jungen Gottlieb Knieriems Leiden.« Es war die paradostische Liebesgeschichte eines Schustergesellen, der sich in seine Meisterin verliebt hatte. Die Lektüre von »Werthers jungen Leiden« hatte mich dazu angeregt. Schon ein Jahr vorher hatte ich eine satirisch angehauchte Dichtung verfaßt; merkwürdigerweise war es ein Operettentext in Knittelversen: »Die Jungfrau von Katzenei«, als Parodie auf die Jungfrau von Orleans gedacht. Der Krieg in Schleswig-Holstein im Jahre 1864 hatte den äußeren Rahmen dazu gegeben.
Das Jahr 1868 brachte einen Wendepunkt in meinem Leben. Zum erstenmal verließ ich auf längere Zeit das Elternhaus. Ich wurde nach der Festungsstadt Küstrin in Pension gegeben; hier leitete ein von meiner Vaterstadt her meinem Elternhause befreundeter Direktor das Gymnasium, der mich nach kurzer, von ihm selbst erledigter Prüfung für die Sekunda aufnahm.
Mein Vater hatte dem im Geruch eines entschieden freisinnigen Mannes stehenden Pädagogen seinerzeit die Direktorstelle in unserem Heimatstädtchen verschafft.
Direktor Thiel war ein Original, ein begeisterter Jahn-Verehrer; er selbst betätigte sich als Vorturner in der ersten Riege seiner Gymnasiasten.
Ich wohnte nun in der Familie eines alten Rechnungsrates, der zwei Töchter besaß, von denen die eine etwa vierzehn, die andere zwanzig Lenze hinter sich hatte. Die jüngere, ein kleines, körperlich etwas zurückgebliebenes Mädchen, flößte mir keinerlei Interesse ein. Besser gefiel mir eine Freundin von ihr, die einen Kopf größer war als sie und immer sehr nett angekleidet ging. Eine prächtig proportionierte Gestalt besaß die Vierzehnjährige und ein bereits recht kokettes Wesen. Wie sie das mit langen Locken geschmückte, im übrigen aber nicht gerade hübsche Köpfchen trotzig in den Nacken warf und bald mit den blaugrünen Augen und dem etwas großen Mund lächelte, war gar verführerisch. Auch hatte ich damals schon mein Wohlgefallen an den straffen, schön geformten Waden, die, es war im Sommer, stets in leichten weißen Strümpfen steckten. Wenn sie auf der Straße Ball spielte und lebhaft hin- und hersprang, konnte ich mich eine ganze Stunde lang an dem Anblick der hübsch gebauten Mädchengestalt, vor allem aber an den hin- und herspringenden Beinen ergötzen, über denen auch bei den lebhaften Bewegungen sich ab und zu ein Streifen der weißen Höschen zeigte.
Meine erwachenden Sinne erhielten auch sonst Anregung. Das Dienstmädchen in der Familie meines Pensionsvaters, das auch mein Zimmer aufräumte, das ich mit einem Mitschüler teilte, erzählte uns, daß die ältere Tochter des Hauses sie angelegentlich auszuforschen pflege: was wir mit ihr sprächen und ob wir, wenn sie uns am Sonntagmorgen den Kaffee ins Zimmer brächte, noch im Bett lägen, wie wir dann aussähen usw. Und sie solle uns doch einmal mit Wasser bespritzen, um zu sehen, was wir dann wohl beginnen, ob wir aus dem Bett springen und sie für den Schabernack bestrafen würden.
Unsere Wirtstochter mochte wohl eine stark sinnlich beanlagte junge Dame sein. Das zeigte sich mir eines Tages in mich recht überraschender Weise. Es war am Abend; ich hatte mich zum gemeinsamen Abendbrot verspätet. An der Wand gegenüber von der Flurtür, durch die ich eintrat, stand ein Sofa, auf dem, am runden Tisch, die Pensionsmutter und ihre beiden Töchter saßen. Ich nahm an einem kleinen, unweit der Tür stehenden Tische Platz, auf dem schon mein Abendbrot stand. Tiefes Schweigen herrschte; die drei weiblichen Wesen waren mit Lektüre beschäftigt. Da plötzlich sah ich, wie die ältere Tochter ihre Hand unter den Tisch sinken ließ und verstohlen ihren Rock langsam hinaufzog, fast bis zum Knie. Mir war's ein berauschender Anblick. Ein bildschönes, geradezu ideal geformtes Bein (sie mochte sich dieses Vorzugs wohl bewußt sein) enthüllte sich im hellen Strumpf meinen still bewundernden Blicken.
Ein, zwei Minuten dauerte meine geheime Lust. Dann fiel der Rock wieder hinab, aber der Eindruck, den dieses kleine Erlebnis auf mich gemacht hatte, hielt noch lange vor. Auf einsamen Spaziergängen zauberte die Erinnerung mir das Bild immer wieder vor die Seele; meine aufgeregte Phantasie malte mir ähnliche Erlebnisse; wie im Traum ging ich umher und sah auf Feldern und Wiesen kurzgeschürzte Landmädchen bei der Arbeit.
Dieser sinnliche Rausch, den meine Umgebung wie die natürliche Stimmung der Pubertätszeit immer wieder nährte, erfuhr eine Unterbrechung durch neue Eindrücke. Die Hundstagferien waren gekommen und es war von meinen Eltern bestimmt worden, daß ich die Ferienzeit, wie schon so oft, bei unseren Verwandten in Pommern zusammen mit meinen Geschwistern verleben sollte. Unweit von Stargard besaß der älteste Bruder meiner Mutter ein Rittergut, das er von seinem Vater ererbt hatte, hier haben wir Kinder schöne Tage voll Freiheit, in reiner ländlicher Luft, in starker körperlicher Bewegung verlebt. Wie ein Beruhigungs- und Heilmittel wirkte das gesunde Landleben auf meine erhitzten Sinne. Onkel und Tante empfingen uns, wie immer, mit liebenswürdigster Gastfreundlichkeit. Hier herrschte ein anderer Ton als im elterlichen Hause, wo die Gegenwart des ernsten, strengen Vaters jede laute, geräuschvolle Fröhlichkeit dämpfte und oft erstickte. In dem mehrere Morgen großen Garten und park, draußen auf den Feldern, auf Wiesen und im Wald konnten wir uns nach Herzenslust austoben. Die Hauptcharakterzüge des behäbigen, gemütlichen Onkels August waren eine herzliche, unversiegliche Gutmütigkeit und ein schlichter natürlicher Sinn. Unter meines Vaters Erziehungsgrundsätzen stand an erster Stelle die Pflicht unbedingten Gehorsams und eines tiefen heiligen Respekts vor der Autorität der Eltern, vornehmlich aber des Vaters. In unserer Familie gab es nur einen Willen, den des Vaters, dem sich alle, auch die Mutter, ohne jeden Versuch eines Widerstandes zu fügen hatten. Nie habe ich erlebt, daß meine Mutter auch nur den leisesten Widerspruch gegen eine vom Vater getroffene Bestimmung gewagt hätte. Nie fand vor uns Kindern auch nur der geringste Wortwechsel zwischen den Eltern statt. Und uns Kindern wäre es auch nicht einmal im Traum eingefallen, dem Vater zu widersprechen. Ja, wir wagten kaum in seiner Gegenwart den Mund zu öffnen, wenn wir nicht gefragt waren. Gewissermaßen wie eine göttliche Macht und Vorsehung thronte er über uns; sein Wille war uns unverletzliches, heiliges Gebot. Auf der anderen Seite aber sorgte er für unser körperliches Wohlbefinden ebenso liberal und gewissenhaft wie für unser geistiges Vorwärtskommen. Nie war ihm in dieser Hinsicht eine Ausgabe zu groß, und wenn wir in der Schule einigermaßen gut bestanden, so erwies er sich auch gegen unsere Wünsche willfähig und freigebig.
Mit vollen Sinnen genoß ich in Gesellschaft meiner Geschwister und meiner beiden Vettern (Töchter besaßen meine Verwandten nicht) das frische, freie Landleben. Den ganzen Tag waren wir draußen im Hof, Garten, Feld und Wald. Tagtäglich wurde gebadet, Reitversuche wurden unternommen und neue Freundschaften mit den Kindern und Besuchern auf den Nachbargütern geschlossen. Es herrschte unter den Gutsbesitzern und Pächtern eine ebenso schlichte wie herzliche Gastfreundschaft. Des Sonntags fuhr man stets irgendwohin. Es machte auf uns Stadtkinder immer einen halb komischen, halb rührenden Eindruck, wenn wir, die wir an die steifen Verkehrsformen des städtischen Lebens gewöhnt waren, sahen, daß die alten Gutsherren einander bei solchen Besuchen zur Begrüßung herzlich umarmten und küßten. Der alte Pastor Gerloff von einem der Nachbardörfer, der mit Frau, Tochter und Sohn unter den regelmäßigen Besuchern war, ging auch an uns fremden Kindern nicht vorüber, ohne jeden von uns mit einem Kuß zu begrüßen.
Während die älteren Herren sich in einem weiter abgelegenen Zimmer zum Boston oder L'hombre niederließen, suchten wir junges Volk zunächst stets den Garten auf, um uns hier an ländlichen Spielen zu vergnügen.
Auf dem nächsten Gute, der königlichen Domäne Luisenfließ, war es, wo ich von neuem mein Herz verlor und ich mich sterblich in die liebliche blonde Tochter des Oberamtmanns Schmitz verliebte. Ich sehe das fünfzehnjährige große schlanke Mädchen noch vor mir, mit den lieben freundlichen Blauaugen, mit dem so liebenswerten, ungemein sympathischen, natürlicher Herzenswärme entquellenden Wesen. Ich hatte sogleich bei der ersten Begegnung den Eindruck, daß ich ihr ebenso gefiel wie sie mir. Mit hochklopfendem, beseligten Herzen empfanden wir, wie sich zarte Fäden zwischen uns anspannen. Abgefallen war alles Sinnliche, Unreine von mir, was während der ersten Monate in Küstrin so bezwingend, betäubend von mir Besitz genommen. Ich war wieder ganz der ideale Schwärmer; die irdischen, allzu irdischen Regungen waren ganz der frommen Anbetung, dem wunschlosen, heiligen Gefühl selbstloser, innigster Herzensneigung gewichen. So oft ich dem geliebten Mädchen in diesen vier Wochen begegnete, gesellten wir uns sofort zueinander, und wenn wir auch wenig miteinander sprachen, es war uns beiden schon köstlichste Seligkeit, uns einander nahe zu fühlen, uns verstohlen die Hand zu drücken und glückberauscht zärtliche Blicke zu täuschen.
Die größte Rolle bei diesen ländlichen Besuchen spielte natürlich der Tanz am Abend. Wie haben wir doch geschwelgt, Johanna Schmitz und ich im Polka, im Walzer und im Galopp. Zart den Arm um das geliebte Mädchen geschlungen, während ihr Atem meine Wangen fächelte, ihr Blondhaar meine Stirn streifte, fühlte ich mich so unbeschreiblich glücklich, daß mir fast das ganze Herz zerspringen wollte.
Heilige Gelübde durchschauerten meine Seele: Immer, immer würde ich Johanna lieben, ihr teures Bild würde mich überallhin begleiten und alles häßliche aus meiner Nähe scheuchen, und jeden Augenblick würde ich bereit sein, ihr zuliebe alles, auch das schwerste und höchste, zu vollbringen.
Ach, wie bald bist du verflogen, schöner, reiner Jugendenthusiasmus! Andere weibliche Gestalten traten in mein Leben und entzündeten heißere, wildere Gluten in mir. Damals ahnte ich noch nicht, wie nahe ich dem verhängnisvollen Moment war, wo sich mir das Wesen der Geschlechtlichkeit enthüllte. Die irdische erstickte auf lange Zeit die himmlische Liebe.
Nach dem beglückenden, herrlichen, poesievollen Liebestraum empfand ich das tägliche Leben mit seiner verdrießlichen Prosa, die öde, jeden seelischen Schwung lähmende Schulfuchserei mit verdoppelter Unlust. Unter den pedantischen Schulmeistern war nur ein einziger, der es verstand, dem Unterricht belebende Geistigkeit, die Phantasie anregende, begeisternde Wirkung zu verleihen. Dies war unser Geschichtslehrer, ein freundlicher Mann von urbanem Wesen, mit prächtiger Rednergabe, wenn er uns einen Vortrag hielt, in schöner Sprache, mit hinreißendem Temperament und innerer Anteilnahme die geschichtlichen Vorgänge und Charaktere schildernd, hingen wir alle voll Aufmerksamkeit und tiefem Interesse an seinem Munde. Ich erinnere mich, daß ich mich besonders für Catilina begeisterte. Während mich Ciceros philiströse Reden langweilten und mit ihrem leeren Pathos nur Widerwillen in mir erzeugten, begeisterte ich mich an Sallusts Beschreibung der berühmten Verschwörung. Und meine Anteilnahme ging bei mir, dem trägen Schüler, der seine Arbeiten oft erst in den Pausen zwischen den Unterrichtsstunden anfertigte, so weit, daß ich zu Hause voll Eifer über Sallust saß und sogar eigene Anmerkungen zum Text machte. Überhaupt, die lateinische Sprache war mir sympathisch, während mir die griechische viele Schwierigkeiten bereitete und nur wenig Interesse einflößte. Schon als Quartaner hatte ich seinerzeit begonnen, eine Geschichte des römischen Reiches in lateinischer Sprache zu schreiben. Freilich, über die Anfangskapitel bin ich nicht hinausgekommen, von der griechischen Literatur interessierte mich nur Homer, dagegen war mir Sophokles ein Greuel. In Obersekunda verstieg ich mich sogar dazu, einige Stellen aus Homers Odyssee in deutsche Verse zu bringen, die ich in der Klasse mit Genehmigung des Lehrers vorlas.
Jetzt freilich, nach den Hundstagen, während mein Herz noch ganz erfüllt war von dem lieblichen Bild Johanna Schmitz', war ich nur lyrisch gestimmt, und mein heißes Sehnen ergoß sich in die weltschmerzlichen schlichten Verse:
Mein Schatz, laß dieses Lied dir sagen,
wie ich unsäglich lieb dich hab'!
Ach, will dein Herz für mich nicht schlagen,
bleibt mir nur noch der Weg zum Grab.
Wo du nicht bist, ist mir die Sonne
verhüllt in einen Nebelflor,
doch schau ich dich, zieht mich die Wonne
des Augenblicks zu Gott empor.
Ich habe in meinem ganzen Leben höchstens zwei Dutzend Gedichte geschmiedet; nur in frühester Jugend und bei sehr bewegtem Herzen wurde ein bißchen lyrisches Empfinden in mir wach.
Ein Erlebnis, das ich bald darauf hatte, lenkte meine Augen, freilich nur diese und nur für ganz kurze Zeit, auf ein anderes weibliches Wesen. Schon ein paarmal auf der Straße war mir ein junges Mädchen aufgefallen, das mit ihrem schon voll entwickelten Busen und mit ihrer kecken, bestimmten Art einen älteren Eindruck machte, als ihren sechzehn Jahren entsprach. Jedesmal sah sie mich mit ihren dunklen Feueraugen in so herausfordernder Weise an, daß mir das Blut ins Gesicht schoß. Eines Nachmittags sah ich aus dem Fenster der im ersten Stock gelegenen Wohnung meines Pensionsvaters. Da kam meine schöne Unbekannte die Straße herauf. Sie schaute mit einem Glutblick zu mir hinauf, während sie vorüberging.
Am Ende der kurzen Straße kehrte sie um und kam zurück. Diesmal hatte ihr Blick etwas so deutlich lockendes, daß unwillkürlich die Frage in mir aufstieg: »Was will sie von dir?« Nach ein paar weiteren Schritten drehte sie sich um und machte mit dem rechten Ellenbogen eine heftige, fast herrisch auffordernde Bewegung. Instinktiv gehorchte ich; es war kein Zweifel, sie wollte, daß ich zu ihr hinabkommen sollte. Also nahm ich meinen Hut und eilte auf die Straße. Sie ging langsam, von Zeit zu Zeit sich umblickend, ob ich ihr auch folgte, die Straße hinunter, dem Festungstor zu. Es war in der siebenten Abendstunde, im Dämmerlicht. Draußen bog sie in einen menschenleeren, vom Bäumen besäumten Weg ein. Jetzt verlangsamte sie ihre Schritte; mir hämmerte das Herz in der Brust. Noch nie in meinem Leben hatte ich ein mir unbekanntes Mädchen angesprochen, und allerlei beklemmende, lähmende Bedenken regten sich in mir. Bildete ich mir nicht am Ende etwas ein, das keinerlei realen Hintergrund hatte? Hatte ich ihrer Armbewegung nicht vielleicht eine falsche Bedeutung untergelegt? Würde sie mich nicht gehörig abblitzen lassen, wenn ich sie jetzt anredete? Und überhaupt, was sollte ich ihr eigentlich sagen?
Sie schritt so zögernd, daß ich es nicht vermeiden konnte, an ihr vorüberzugehen. Das Gesicht mit der Verlegenheitsglut auf die Brust gesenkt, schlich ich an ihr vorbei. In meiner hilflosen Befangenheit wußte ich nichts Besseres zu tun, als meine Schritte zu beflügeln. Da hielt mich ihre Stimme zurück.
»Haben Sie's denn so eilig, Herr Zell?«
Ich blieb stehen und starrte sie überrascht an.
»Sie kennen mich?«
»Freilich. Sie sind mir aufgefallen, und da habe ich mich erkundigt, wie Sie heißen und wo Sie wohnen.«
»Warum ... warum denn?«, stotterte ich tölpelhaft.
Sie lächelte und sah mich wieder mit ihren Glutaugen an, vor denen mir angst und bange wurde.
»Weil Sie mir gefallen und ich Ihre Bekanntschaft zu machen wünsche«, versetzte sie ohne Scheu.
Ich fühlte mich geschmeichelt. Nun war kein Zweifel mehr.
»Gefalle ich Ihnen denn nicht?«, fragte sie schelmisch, während wir unseren Weg wieder aufnahmen.
»Doch, doch!«, versicherte ich stammelnd, dabei den Blick vor ihren niederschlagend.
Aber meine Unbeholfenheit schien ihr Selbstgefühl, ihre Sicherheit noch zu erhöhen.
»Ein so hübscher Mensch wie Sie braucht doch nicht so schüchtern zu sein!«, ermunterte sie resolut.
Natürlich wurde ich dunkelrot; so geradeheraus hatte mir das doch noch keine gesagt, seit ich zum Jüngling gereift war. Es war eine eigentümliche Situation, die mich in grenzenlose Verwirrung brachte. Die Rollen waren vertauscht; das Weib, noch dazu ein so junges Geschöpf, war der aktive Teil, der Mann der passive.
Trotz der Schmeichelei war meine Stimmung keinesweges eine gehobene. Ich lächelte verlegen.
»Sie haben wohl noch niemals geküßt?«, fuhr sie fort.
»Doch – doch!«, gab ich zurück und dachte an Elise Grabert. Es war das einzige Mal gewesen, wo ich weibliche Lippen auf meinen gefühlt. Zugleich ärgerte ich mich über mich selber. Wenn ich damals so unternehmend gewesen war, warum benahm ich mich heute wie ein Stockfisch.
Sie wurde immer deutlicher. Sich ein wenig vorneigend und mich aus nächster Nähe mit ihren begehrlichen Blicken anblitzend, sagte sie schmeichlerisch:
»Sie haben einen so schönen Mund; ich glaube, Sie müssen sehr nett küssen können.« Trotz ihrer für ihre Jahre erstaunlichen Raffiniertheit kannte sie wohl das Menschenherz noch wenig. Gerade ihre dreiste, schamlose Art stieß mich ab und nahm ihr in meinen Augen allen Reiz. Ich weiß nicht mehr, welche Antwort ich ihr gab; ich erinnere mich nur, daß unsere Unterhaltung und unser Spaziergang bald ein Ende nahmen, wir verabschiedeten uns ziemlich kühl voneinander und verabredeten nicht einmal ein Wiedersehen.
Am nächsten Tage erkundigte ich mich über das Mädchen – sie hatte mir, noch ehe wir uns trennten, ihren Namen genannt. Was ich über sie erfuhr, steigerte die Antipathie, die mir ihr draufgängerisches Wesen eingeflößt, zum grenzenlosen Abscheu. Sie war eine Waise und lebte mit ihrem erwachsenen Bruder, der ein Geschäftsmann war, zusammen. Man erzählte sich von den Beiden kaum glaubliches, furchtbares.