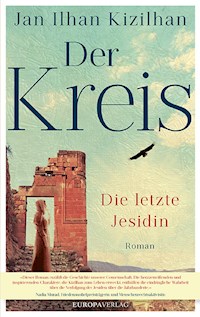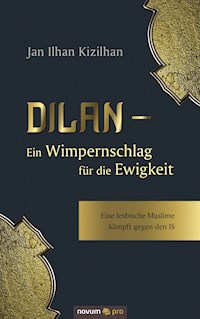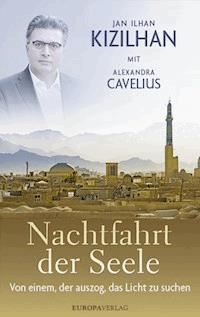Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Europa Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der dreizehnjährige Rodi ist gerade einmal ein Jahr alt, als seine yezidische Familie aus seiner Heimat in den kurdischen Bergen fliehen muss. Da Rodis Vater seither verschollen ist, finden er und seine Mutter Unterschlupf bei Rodis tyrannischem Onkel, der in einem yezidisch kurdischen Dorf in der Türkei lebt. Dort lernt der Junge nicht nur die strikten Regeln seiner Religion in all ihrer Widersprüchlichkeit kennen, sondern erlebt auch hautnah die grausame Unterdrückung der Yeziden in mitten der islamischen Welt. In seinem fesselnden Roman entführt Jan Ilhan Kizilhan den Leser auf eine faszinierende Reise in die yezidische Kultur und gibt tiefe Einblicke in das Schicksal einer religiösen Gemeinschaft, die nicht erst seit dem Vormarsch des IS unter massiver Verfolgung, Diskriminierung und Ausgrenzung zu leiden hat. Der dreizehnjährige Rodi lebt mit seiner Mutter in einem kleinen kurdischen Dorf in der Türkei. Tagtäglich machen ihm die strikten Moralvorstellungen seines herrschsüchtigen Onkels zu schaffen, ein orthodoxer Yezide, der seinen Neffen mit harter Hand zu erziehen versucht. Aber auch die allgegenwärtige Unterdrückung der Yeziden durch den türkischen Offizier Ihsan Bey lastet schwer auf Rodis jungen Schultern. Doch die Freundschaft zu der alten yezidischen Erzählerin Hazal gibt Rodi Halt und lässt ihn immer wieder gegen die strengen Regeln der Ältesten aufbegehren. Als das Dorf von einer langen Dürre bedroht wird, taucht wie aus dem Nichts ein geheimnisvoller alter Mann auf.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 426
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
1. eBook-Ausgabe 2017
© 2016 Europa Verlag GmbH & Co. KG, München Umschlaggestaltung: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich, unter Verwendung eines Fotos von © plainpicture/Kniel Synnatzschke Redaktion: Caroline Draeger, Langenhagen Layout und Satz: BuchHaus Robert Gigler, München
Konvertierung: Brockhaus/Commission ePub-ISBN: 978-3-95890-129-2 ePDF-ISBN: 978-3-95890-130-8
Das eBook einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Alle Rechte vorbehalten.
www.europa-verlag.com
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von §44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Ansprechpartner für ProduktsicherheitEuropa Verlage GmbHMonika RoleffJohannisplatz 1581667 Mü[email protected]+49 89 18 94 [email protected]
DER AGHA saß auf dem Balkon seines Hauses, blickte hinaus auf die weiten Felder, die schier endlos erscheinende Ebene und die weiten Berge auf der anderen Seite. Er rauchte seinen Tabak und trank seinen Raki; mit etwas Wasser vermischt, hatte dieser eine milchige Farbe. Die Sonne strahlte, und nur der Schatten des Daches schützte in dieser Mittagshitze vor der sengenden Sonne. Der Agha schwitzte. Auf seinem dicken, schwer herabhängenden Schnurrbart, den er frisch geschwärzt hatte, glänzten Tropfen. Vom Raki noch mehr erhitzt, schwitzte er am ganzen Körper. Ein Krug, gefüllt mit kaltem Wasser, stand neben ihm, und er versuchte, sich mit einem Schluck zu erfrischen. Rechts von ihm harrte ich aus, sein gedungener Khulam, sein Knecht und Diener. Und zu seiner linken Seite saß mit gekreuzten Beinen auf einem Samtkissen Gule, ein hübsches Mädchen, welches nicht älter war als fünfzehn, das ihm seinen Tabak immer wieder neu zu Zigaretten drehte, sie anzündete und ihm seinen Raki oder Wasser nachfüllte.
Der Agha senkte schläfrig die Augenlider und erfreute sich an dieser Welt. Für den Agha hatte Allah alles wohl geordnet. Was für eine herrliche Schöpfung war diese Welt, nichts fehlte in ihr. War man hungrig, gab es Fleisch und Brot, Eintopf und Reis. War man durstig, gab es dieses erlesene Wasser, das sich Raki nannte. War man schläfrig, genoss man den Schlaf, hatte Allah doch den Schlaf geschaffen, der besonders nach dem Mittagessen in der Hitze herrlich war und dem man sich rückhaltlos hingeben durfte. War man zornig, verfügte man über die Peitsche und den Rücken seiner Khulams oder seiner Dorfbewohner. War man melancholisch gestimmt, wurden Sänger einbestellt, die eigens für ihn Lieder dichteten und für ihn sangen.
Der Agha riss mich aus den Gedanken: »Ruf die Sänger. Sie sollen singen.« Noch bevor ich mich umdrehte, hörte ich den Agha erneut: »Rodi, dieses Dorf gefällt mir wirklich«, dabei schaute er in Richtung des Dorfes nicht weit von seinem riesigen Anwesen. »Es sind alles brave und arbeitsame Menschen. Es ist ein wohlhabendes Dorf, und ich glaube, ich bin auch nicht so schlecht zu ihnen.« Dabei schaute er mich an, als erwartete er, dass ich zustimmte. »Ich will nur meine Ruhe«, fuhr der Agha fort, »meinen Raki, meine Frauen und keinen Ärger mit dem Offizier Ihsan Bey.« Er blickte nach links, wo Gule saß.
Gule war gerade zwei Jahre älter als ich, und was musste sie alles für diesen Agha tun, dachte ich. Doch der Raki tat seine Wirkung, und der Agha war gesprächig geworden und vergaß, dass ich ein dreizehnjähriger Junge war, von seinem Onkel dazu verdammt, einen Monat lang für den Agha zu arbeiten.
Aber dieser Agha ließ mir keine Zeit, meine Gedanken zu ordnen. Er sagte: »Es sind wirklich nette Menschen. Sie haben auch dieses Jahr meine Räume wieder mit Geschenken zum Ramadan und zum Opferfest gefüllt: Käse, Fleisch, Eier, Getreide und Obst. Und sie schicken wie dein Onkel, Rodi, jeden Monat fünf bis zehn junge Leute, die mir dienen – und noch mehr. Nun geh und hol die Sänger. Sie sollen mir von den Kämpfen und Siegen meiner Vorfahren singen.«
Ich lief ins Haus zu Ali, der dort für alles zuständig war, und sagte Bescheid.
Ali aber hatte dem Gespräch zugehört und schon nach den Sängern gerufen, die in Windeseile eintrafen und nach einer kurzen Begrüßung begannen, mit Liedern den Agha und seine Vorfahren zu preisen. Sie lobten ihn in den Himmel: Der Agha und sein ganzer Stamm waren Helden.
Mal wechselten sich die Sänger ab oder sie sangen gemeinsam. Doch ich war damit beschäftigt, neuen Raki herbeizuschaffen, sodass ich nie ein Lied zu Ende hören konnte.
Endlich rief mich Ali und sagte: »Geh jetzt nach Hause. Wir brauchen dich nicht mehr, und außerdem ist dein Monat um. Morgen kommen andere.«
Also verließ ich das große Anwesen und lief die Straße entlang bis ins Dorf.
»Der Agha ist guter Laune«, murmelte Kazim, der ein kleines Teehaus im Dorfzentrum hatte. »Du bist früher als sonst hier«, sagte er, während er seine Gäste bediente. »Das haben wir wahrscheinlich dem Raki zu verdanken.«
»Das haben wir gewiss Gule zu verdanken«, sagte Gavan mit einem bitteren Lächeln.
»Es ist ein glücklicher Zufall, der ihn gerade hier zum Agha gemacht hat«, murmelte Cemil, der Bruder des Pirs, unseres Priesters. Cemil gedachte der Ahnen und seufzte. Dann redete er sich warm: »Einmal haben die Yeziden das ganze Land regiert. Die Kurden, die jetzt Moslems sind, waren früher alle Yeziden. Doch die Yeziden wurden mit Feuer und Schwert zum Islam bekehrt. Nur wir und einige wenige sind übrig geblieben. Was für eine Ungerechtigkeit. Auch die Ahnen des heutigen Agha waren einmal Yeziden, aber jetzt ist er ein strenggläubiger Moslem und hasst uns, weil wir Yeziden geblieben sind. Das Rad der Geschichte dreht sich. Kazim, komm und gib dem Jungen einen Tee!«
Das Wetter war so heiß, dass man unweigerlich schwitzte, und der Tee war gut gegen meinen Durst. Vor dem Teehaus waren kleine Holzstühle mit dicker Plastikbespannung aufgestellt, und die Leute unterhielten sich über die Ungerechtigkeit der Moslems, die uns Yeziden gezwungen hatten, aus den kurdischen Bergen mit ihren Weiden und ihrem fruchtbaren Boden hierher umzuziehen. Sie beklagten ihr Schicksal, auf einer dürren und trockenen Ebene zu leben. Die Schuldigen waren schon lange ausgemacht: der Agha, der ihr Land für sich nutzte und moslemische Kurden überall angesiedelt hatte. Und die türkischen Soldaten, die keine rebellischen Kurden in den Bergen duldeten. Warum das so war, wusste ich nicht, aber nach Gründen zu fragen war aussichtslos. Die Antwort war immer die gleiche: Es ist so, weil Khoda, weil Gott, der Allmächtige, es so will.
Selim, der als einer der ältesten Bewohner des Dorfes zu den Gemeindeältesten zählte, näherte sich dem Teehaus. Er war, trotz seines Alters, ein kräftiger Mann, der etliche Jahre von einem Ort zum anderen geflohen war, bis er in unser Dorf kam. Früher war er einmal Schmuggler und Kämpfer für die Kurden im Irak gegen die Araber gewesen, aber als Yezide fand er nur unter seinesgleichen Frieden. So glaubte er jedenfalls. Er hatte lange dünne Haarsträhnen, die in unserer Gegend unüblich waren, aber er hatte sie von den Yeziden in Lalisch übernommen, und dort befindet sich schließlich das Heiligtum der Yeziden. Nun war er alt geworden, und auch sein Glaube war alt. Viel hatte er mit seinen Augen gesehen, und viel hatte er erlebt; er hatte genug davon, mehr als genug, und hatte alles satt, aber er schämte sich, es einzugestehen. Als er das Teehaus betrat, erhoben sich einige Bauern und baten ihn, sich zu ihnen zu setzen.
Kazim fragte ihn wie jedes Jahr: »Onkel Selim, jeder feiert den Neujahrsbeginn nach dem christlichen Kalender am ersten Januar, sogar die Moslems tun es. Warum wir nicht?«
Selim drehte sich um, ließ den Blick über die sitzende Menge wandern und begann sofort, sie zu beschimpfen: »Ihr habt es nicht verdient, zu einer so alten Religion zu gehören. Nur, weil ein anderer etwas tut, müssen wir es nicht nachmachen. Außerdem ist unsere Religion älter als die der anderen. Wir respektieren sie, müssen aber nicht so werden wie sie.«
Kazim fragte weiter: »Was hat es mit dem Carsema Sor, dem Roten Mittwoch auf sich?«
»Im Jenseits wird Gott dir als Erstes einen neuen Kopf geben müssen, denn dieser arbeitet nicht«, antwortete Selim trocken.
Einige lachten, doch Kazim gefiel es offensichtlich, wie der alte Selim ihn beschimpfte.
Selim fuhr fort: »Das Neujahr wird bei uns am ersten Mittwoch im April gefeiert, so wie Newroz am einundzwanzigsten März, das Neujahrsfest der Kurden. Ihr wisst, dass der Mittwoch unser Ruhetag ist, und es ist uns verboten, uns am Mittwoch zu waschen oder bei einer Frau zu sein.«
Kazim gefiel dieser Gedanke nicht, und er warf ein: »Hey lo, wer soll sich daran halten.«
Das reichte. Prompt ließ Selim wieder neue Verwünschungen auf Kazim herabprasseln. Aber Kazim hatte weiterhin Freude daran.
Selim erklärte schließlich: »Am Festtag muss in jedem Haus Fleisch sein, wobei das Vieh bereits am Vortag geschlachtet und das Fleisch in der Nacht zubereitet werden soll. Merkt euch das! Denn am Mittwochmorgen muss es von den Priestern gesegnet werden. Auch der Toten wird gedacht. Dann begeben sich am Nachmittag die Frauen auf den Friedhof und legen Essen auf die Gräber. Das Fest wird zu Ehren von Tausi Melek gefeiert, unserem obersten Engel, gesegnet sei sein Name. Denn an einem Mittwoch im April hat sich vor Tausenden von Jahren Tausi Melek auf die Erde begeben. Er hat eine Ratsversammlung abgehalten, in der er das alte Jahr bedacht und bewertet und das kommende Jahr geplant hat. Deswegen, und ich hoffe, ihr wisst es, dürfen wir Yeziden niemals im April Hochzeiten abhalten. Merkt euch das, und handelt danach. Yezide zu sein ist nicht einfach, aber es ist eine gute und reine Religion.«
Die Leute im Teehaus bedankten sich für seine Worte, und Kazim trat auf Selim zu und küsste ihm die Hand.
Selim sagte zu ihm: »Gott beschütze dich und deine Familie. Aber ich weiß, du bist der Sohn eines Esels und machst nur deine Witze über alles, aber du bist ein guter Yezide. Das rettet dich vor meinen Flüchen.« Und an die Leute im Teehaus gewandt, fügte er hinzu: »Gott beschütze euch, aber ich habe keine Zeit mehr. Bald ist unser heiliger Feiertag, und ich bin auf dem Wege zum Pir, wo wir, die Ältesten, eine Zusammenkunft haben. Wir haben viel zu tun.« Dann schwieg er einen Augenblick, drehte sich um und ließ den Stock bedeutungsvoll auf einen großen Stein herabsausen, der vor dem Eingang des Teehauses lag.
Mit Blick auf das Haus des Priesters stöhnte er und fluchte leise vor sich hin – doch so, dass wir alle es hören konnten: »Das ist mal ein Priester, der weder an Gott glaubt noch an Tausi Melek, unseren obersten Engel, den Engel Pfau. Er hat sich sein Haus am allerhöchsten Punkt im ganzen Dorf gebaut. Welcher Yezide hat hier schon ein Koshk, ein zweistöckiges Haus, und dazu noch aus Beton? Wir anderen sind froh, wenn unsere Dächer aus Stroh und Lehm nicht eines Tages über uns zusammenbrechen und uns lebendig begraben.« Dann drehte er sich um und trat den Rückweg an. Er ging bergauf zur Ratsversammlung.
Ich folgte Selim, weil er den Eindruck machte, als könne er sogleich aus Schwäche stürzen. Ich nahm ihn beim Arm und stützte ihn vorsichtig. So kam er schneller und leichter voran.
Er sagte zu mir: »Ich danke dir, Rodi. Gott beschütze deinen Vater, wo immer er sich jetzt auch befindet.« In Gedanken aber war er noch beim Priester, und so fuhr er fort: »Nur Gott weiß, was dieser Priester im Schilde führt. Es ist jedenfalls immer nur in seinem eigenen Interesse, was er tut, und die Religion dreht er so herum, wie er will.«
Beim Priester hatten sich schon einige Gemeindeälteste zusammengefunden. Sie saßen schweigend mit gekreuzten Beinen auf weichen Kissen und tranken ihren Tee. Der Priester aber war in die Küche gegangen und braute für sie einen türkischen Kaffee, eine Kostbarkeit im Dorf. Seine einzige Tochter Mira war gerade dabei, noch mehr Tee, das frische Wasser und die Früchte zurechtzustellen.
In der Ecke rechts saß der alte Ebu, der roheste und unangenehmste Mensch des ganzen Dorfes. Er arbeitete eng mit dem Agha zusammen und verriet ihm alles, was sich im und um das Dorf herum ereignete. Er war ein magerer, unsauberer Mann mit einem kleinen Kopf, flinken Augen und verschwitzten Händen.
Auch mein Onkel Teto gehörte zu den Gemeindeältesten. Er war sogar der Älteste von ihnen, und die Leute hörten auf ihn – zumindest wenn er aus unserem Buch zitierte.
Kaum hatte ich den Raum betreten, hoben sich schon fast von selbst ihre Hände und boten sich mir zum Gruß, zumindest kam es mir so vor, denn ich musste allen die Hand küssen. Einige Hände waren voller Schweiß, und die Berührung war mir unangenehm, aber es gab keinen Ausweg. Ich musste jedem Einzelnen die Hand küssen. Ich hasste diese Tradition, aber wenn man es nicht tat, wurde man beschimpft.
Jedenfalls war Ebu schon fünfzig Jahre alt. Zumindest behauptete er das. Aber mir schien er älter. In Wirklichkeit wusste keiner von den Ältesten sein genaues Alter, weil es nirgends aufgeschrieben und festgehalten worden war. Ebu aber hatte sein ganzes Leben gegraben, gesät und geerntet, Weizen, Roggen, Wein und Oliven gepflanzt, die Erde gequält und ihr Blut getrunken. Man sagte, dass er seit seiner Kinderzeit die Erde nie aus seinen Klauen gelassen habe, unersättlich und mit unstillbarem Hunger habe er sich über sie geworfen, ihr wenig gegeben und Tausendfaches von ihr zurückverlangt. Niemals habe er »Gott sei es gedankt für seine Gaben« gesagt, stets habe er mürrisch gebrummt und sei unzufrieden gewesen. Nachdem der Agha und die Soldaten uns gezwungen hatten, unser Dorf in den Bergen zu verlassen und hier in der dürren Ebene zu leben, hatte er wohl am meisten gelitten, denn hier wächst nichts. Die Erde war schon vor unserem Kommen tot, und selbst Ebu konnte nichts mehr aus ihr herausholen. Deshalb sah er es wohl als vernünftig an, mit dem Agha und den Soldaten von der nahen Militärstation zusammenzuarbeiten. Er verlieh Geld und forderte hohe Zinsen, und wenn die Leute nicht zahlen konnten, nahm er ihnen ihre Tiere und Lebensmittel und verkaufte sie an das moslemische Dorf, das eine Stunde von uns entfernt liegt. Darüber hinaus trieb er Geld für den Agha ein und leitete alle Neuigkeiten und Informationen an den Agha und den Offizier Ihsan Bey weiter.
Ich wusste noch ganz genau, wie seine Tochter vor einem Jahr krank geworden war und dringend einen Arzt gebraucht hätte. Er sagte damals: »Das sind allzu große Ausgaben. Die Städte sind zu weit entfernt, um einen Doktor zu holen, und was wissen die denn schon? Außerdem sind sie Moslems und werden uns Yeziden nur schaden. Wir haben den Priester und die alte Hazal, die verstehen sich auf die traditionelle Hausmedizin. Ihnen werde ich Geld geben, um die bösen Geister zu vertreiben. Der Priester kann sie heilen, und das wird zudem viel billiger.«
Aber weder der Pir noch die alte Hazal konnten ihr helfen, und das Mädchen starb. Es war zehn Jahre alt und hatte nun Ruhe vor ihrem Vater, doch er hatte auch seinen Vorteil, er blieb von den großen Ausgaben verschont.
Mira, die Tochter des Priesters, kam mit dem Tablett herein. Sie grüßte die Gemeindeältesten und blieb kurz mit niedergeschlagenen Augen stehen. Sie hatte große Augen mit langen Wimpern, wie ich wohl wusste. Sie war blass; zwei dicke kastanienbraune Zöpfe waren über ihrem Kopf zum Kranz gewunden. Ein Kopftuch trugen die Frauen in unserem Dorf selten. Nur wenn sie in die Stadt gingen, taten sie es wegen ihrer moslemischen Brüder. Es war bei ihnen so üblich, und man wollte nicht auffallen oder schlecht behandelt werden. Sie hatten die Macht.
Die Tochter des Pirs durfte nur mit einem Angehörigen einer bestimmten Kaste von Pirs verheiratet werden, was sich für den Priester als ein Problem darstellte. Schließlich wollte er sie mit dem Sohn eines reichen und wohlhabenden Pirs verheiraten. Doch das war schwierig. Die anderen Angehörigen dieser Kaste im Dorf und in der Umgebung kamen für ihn nicht infrage. Sie hatten kein Geld, kein Land und gehörten keinem starken Stamm an, hatten keine Macht und keinen Einfluss. So suchte der Priester bisher vergebens und hatte Botschafter ausgeschickt, um einen Yeziden zu finden, der ein Priester aus dieser bestimmten Kaste und zudem aus einer wohlhabenden Familie war. Doch die Suche dauerte nun schon zwei Jahre. Daher dachten wir Dorfbewohner: Die arme Mira wird wohl unverheiratet bleiben. Die Sitten und Gebräuche sind oft hart. Ein Yezide darf nur einen Yeziden heiraten, und dann gibt es da noch die Kasten, die nur untereinander heiraten. Zudem kann niemand Yezide werden. Man ist es allein durch seine Geburt. Es ist schon ein schweres Schicksal, als Kurde auf die Welt zu kommen, noch schwerer aber ist es, zusätzlich als Yezide nirgends hinzugehören.
Die Gemeindeältesten fingen mit ihren Beratungen an, und Mira und ich verließen den Raum. Der Priester verriegelte von innen die Tür. Wir sollten draußen warten und niemanden hereinlassen. Wir setzten und vor das Fenster des Wohnraums auf eine kleine Bank. Dieser Platz wurde Berrojik genannt, es war der Ort, an dem man sich sonnte und unterhielt. Das Fenster stand offen, und so konnten wir von draußen alles sehen und hören, was drinnen vor sich ging.
Der Priester legte sein braun gebranntes Gesicht in würdevolle Falten; seine Augen glänzten unter den dichten Augenbrauen. Er aß und trank gut, der Priester, er lärmte und fluchte, wenn er in Stimmung war, er schlug um sich, wenn er böse war, und noch in seinem hohen Alter geriet sein Blut in Wallung, wenn er die Frauen im Dorf sah. Er war voll menschlicher Leidenschaft, obwohl es ihm nicht erlaubt war.
Doch wenn der Priester über seine Religion sprach, wenn er die Hand zum Segen oder Fluch erhob, dann war es, als streiche der Wind der Wüste aus Ruha über ihn hinweg, und der Priester und die anderen Gemeindeältesten wurden zu Propheten.
»Meine Herren und Brüder«, sagte er nun mit tiefer Stimme, »heute ist ein feierlicher Tag. Khoda sieht uns, er hört uns, alles, was wir in diesem Raum sagen, verzeichnet er, vergesst es nicht. Er hat Tausi Melek zu uns geschickt, und dieser hat die Welt aus Dirr, der Kugel des Universums, entstehen lassen. Unsere Religion ist die älteste und reinste aller Religionen.«
Alle Personen im Raum sagten gemeinsam »Amin« und strichen sich den Bart als Zeichen der Ehrerbietung. Der Priester wusste, wie er die Zuhörer fesseln und ihre Gedanken in die richtige, in seine Richtung lenken konnte.
Das Fest zum Gedenken an Tausi Melek, unser »Roter Mittwoch«, sollte vorbereitet werden. Und da der Priester unumstritten an vorderster Stelle kam und danach die Wohlhabenden und dann erst die Bauern, nahm das Gespräch den gewohnten und vorhersehbaren Lauf, und ich ließ Mira alleine und ging den Fluss entlang, da ich meine Freunde Siyabend und Kerim treffen wollte.
Inzwischen war es Nachmittag und wir entschlossen uns, ein wenig außerhalb des Dorfes zu wandern, in der Gegend herumzustreunen. Es war selten genug, dass wir mal frei hatten. Nun, eigentlich ging es uns darum, allein zu sein und zu plaudern. Wir suchten die Einsamkeit und wollten unter uns und ohne andere Zeugen miteinander reden. Es gab schließlich so viele Geheimnisse und Fragen für uns – und wenig Antworten. Wenn wir die Ältesten fragten, wieso die Yeziden so oder so waren oder warum dieses und jenes verboten war, wurden wir aus dem Haus gejagt, beschimpft, oder es wurde gesagt, es sei Sünde, solche Fragen zu stellen.
Es hatte schon lange nicht mehr geregnet, und in der fernen Ebene glänzten die Steine in der Hitze und die Luft schwirrte, sodass sie vor unseren Augen manchmal merkwürdige Gestalten annahmen. Der trockene Duft der roten Erde machte das Atmen schwer. Das Schrillen der Insekten in den Feigen- und Olivenbäumen spielte wie ein Orchester das Lied der endlosen Trockenheit.
Eine Weile gingen wir stumm unseres Weges und dachten über unser Neujahrsfest nach. Die Menschen werden in dieser Zeit sehr fromm und tun Gutes. Das Wenige, was sie haben, teilen sie mit Bekannten und Nachbarn. Es scheint mir, als höben sie alles Gute und Herzliche für diese Tage auf.
Für den Rest des Jahres standen Intrigen, Lästereien, Klatsch, Gerüchte und Boshaftigkeit im Vordergrund. Doch in diesem Jahr trübte die Hitze der Trockenzeit die Stimmung im Dorf. Jeder hoffte, dass mit dem Anbruch des Feiertages auch der Regen einsetzen würde, um den Boden und uns vor dem Verdursten zu retten. Es schien, als sollte Tausi Melek für uns an diesem Tag erneut auferstehen. Aber noch war er nicht auferstanden, und es wehte ein lauer Märzwind von den Bergen herab, der die Natur und die Menschen sanft und kühl liebkoste.
Siyabend machte als Erster den Mund auf. »Der Priester hat wieder einmal so über unsere Religion gesprochen, als könnten wir der Welt helfen, ihren religiösen Frieden zu finden«, sagte er langsam.
»Möge Gott uns helfen, mit unserer Situation fertigzuwerden«, sagte Kerim. »Wenn es nicht bald regnet, dann können wir nicht mehr lange hierbleiben. Die Stimmung ist gereizt. Gut, dass wir jetzt diesen Feiertag haben. Alle sind damit beschäftigt und sehen die verbrannte Erde nicht.«
So redeten wir lange Zeit, bis wir auf einer Anhöhe angekommen waren, von wo aus wir die ganze Ebene überblicken konnten. Wir schauten in die Ferne, als sollte von da unser Heil kommen, aus der Unendlichkeit des Horizonts.
Plötzlich aber sahen wir in der Ferne eine immer größer werdende Staubwolke, die sich in unsere Richtung bewegte. Schon bald hörten wir Schritte und Stimmen. Aus dem fernen Staub löste sich eine Menschenmenge, die langsam und müde auf das Dorf zukam.
»Seht doch, seht«, sagte Kerim laut. »Was ist das für ein Ameisenhaufen, der sich dort auf dem Feld bewegt? Das sieht aus wie ein Marsch zum Heiligtum, wie ein Prozession. Aber es sind noch einige Tage bis dahin.«
Wir rissen alle die Augen auf. Es war wirklich eine Menge von Männern, Frauen und Kindern, die sich über das Feld auf unser Dorf zubewegte.
Schon bald konnten wir sie hören. Sie sangen alte yezidische Lieder. Es klang, als ob sie weinten.
»Es sind Brüder von uns! Yeziden!«, rief Kerim aus. »Kommt, beeilen wir uns, sie zu begrüßen.«
Wir liefen, so schnell es ging, vorbei an den alten und trockenen Weinhängen entlang auf die Felder. Der Anfang des Zuges war nun bei den ersten Lehmhäusern des Dorfes angelangt; die Hunde rasten auf den breiten Weg und bellten wie von Sinnen, die Türen öffneten sich, die Frauen kamen heraus, Männer bewegten sich im Schatten der Häuser und der vertrockneten Bäume auf den Meydan zu, den Dorfplatz. Sie hatten die Lieder, das Weinen und Schluchzen, das Geräusch der vielen Schritte gehört und waren sofort losgegangen. Auch wir waren jetzt bis an die Menschenmenge herangekommen.
Die Abenddämmerung senkte sich über uns, als verschwände die Sonne im selben Moment, in dem die Menschen im Dorf ankamen. An ihrer Spitze schritt ein sonnengebräunter, hagerer Priester mit großen schwarzen Augen und einem langen wirren Bart. Aus seinen Augen sprühte förmlich das Feuer. Er hielt eine kleine goldene Statue des Engels Pfau in der Hand und segnete die Menschen in seiner Nähe. Rechts von ihm standen die Älteren, dahinter waren Männer, Frauen und Kinder, und alle schrien und weinten: Männer mit Bündeln, Handwerkszeug, Sensen, Hacken und Spaten; Frauen mit Wiegen, Töpfen und Wannen.
»Was seid ihr für Landsleute? Woher kommt ihr, und wohin führt euch der Weg?«, fragte Cemil und blieb vor dem fremden Pir stehen.
»Wo ist euer Priester oder wo sind die Ältesten hier im Dorf? Wir wollen zu ihnen«, sagte der Neuankömmling, der sich als Priester Ilyas vorstellte. Und er fuhr fort: »Wir sind Yeziden, fürchtet euch nicht, Brüder, wir sind Kurden, Flüchtlinge und Verfolgte. Über uns ist der Ferman, ist großes Unheil gekommen. Ruft die Ältesten des Dorfes, ich will mit ihnen reden!«
Ermattet ließen sich die Frauen auf den Boden sinken, die Männer legten ihre Lasten ab, wischten sich den Schweiß von der Stirn und blickten stumm auf ihren Priester, als sei er ihre einzige Hoffnung.
»Woher kommt ihr?«, fragte Siyabend einen Greis, den die Jahre weiß wie Baumwolle hatten werden lassen und der trotzdem eine schwere Last auf dem Rücken trug.
»Beruhige dich, mein Junge«, antwortete der Alte. »Beruhige dich, der Priester Ilyas wird alles erzählen.«
Der Priester stand aufrecht und gerade und hielt immer noch die Statue in den Händen. Die letzten Strahlen der Sonne ließen das Gold der Statue glänzen. Die Menschen erkannten, was sie darstellte. Sie war heilig, und viele wollten sie küssen. Doch Priester Ilyas wehrte alle ab und sagte: »Ihr alle werdet sie noch küssen können, doch lasst uns erst mit dem Priester und den Ältesten des Dorfes sprechen. Unser Schicksal und unser Leben liegt in euren Händen.«
Der Agha hatte von der Ankunft der Menschenmenge gehört und beobachtete die in weiter Entfernung von seinem Anwesen versammelte Menge durch sein Fernglas. Er war betrunken und machte sich Sorgen, was die Menschen wollten.
»Komm her, mein armer Freund«, sagte er und drehte sich um. »Komm her und erkläre mir dieses Mysterium. Was ist das für ein Haufen da auf dem Meydan? Was ist das für ein Geschrei?«
Der Mohtar, der Dorfvorsteher, tauchte auf dem Balkon auf. Sein Kopf war mit einem nassen Tuch umwickelt. Er kühlte sich ab – von dem Raki und von der Hitze. Hin und wieder nahm er das nasse Tuch, tauchte es in einen Wassereimer und wand es sich frisch um den Kopf.
Der Mohtar beugte sich vor, riss die Augen auf und blickte in die Ferne. Waren dort unten auf dem Meydan wirklich Männer, Frauen und Kinder? Aber sie waren zu weit weg, als dass er sie mit bloßen Augen hätte erkennen können.
»Was ist das?«, fragte der Agha wieder. »Begreifst du, was da unten los ist?«
»Leute!«, antwortete der Mohtar. »Es sieht wie Leute aus, oder was siehst du, mein Agha?«
»Ich glaube auch, dass es Leute sind … Woher sind die gekommen? Was wollen sie bei uns? Soll ich sie aus dem Dorf jagen? Soll ich sie in Ruhe lassen? Soll ich mit der Peitsche hinuntergehen? Was meinst du?«
»Nimm es mit Ruhe, Agha! Du brauchst jetzt nicht zu drohen oder mit der Peitsche hinunterzugehen und dir die gute Laune verderben! Lass sie, wo sie sind … Komm, nehmen wir noch ein Glas Raki!«
»Scherefe«, rief der Agha und trank Raki mit dem Mohtar. Er befahl Gule zu sich und verlangte neue Gläser. »Gule, komm her, Licht meiner Augen, komm her mit dem Kissen, den Gläsern, dem Raki und dem Essen. Schau dir das an … Das sind Yeziden, die werden sich wohl bald schon mit den Yeziden hier im Dorf in die Wolle kriegen. Wenn nicht, dann sorge ich dafür. Ach, wie so oft. Das ist ja so einfach, sie gegeneinander zu hetzen. Gegen ihre Feinde wollen sie sich nicht erheben, aber gegen ihre eigenen Glaubensbrüder, ihre Nachbarn und Freunde kämpfen sie bis zum letzten Blutstropfen … Ach, das versteht niemand, aber so sind sie nun einmal.«
»Wo ist der Priester? Wo sind die Ältesten aus diesem Dorf?«, rief Priester Ilyas. »Gibt es hier nicht einen yezidischen Menschen der an den wahren Gott und Tausi Melek glaubt, der sie holen könnte?«
»Ich werde gehen«, sagte Siyabend, »beruhige dich, Alter.« Er wandte sich zu mir und Kerim. Wir liefen zu den Ältesten und trafen sie und den Priester schneller, als wir geglaubt hätten. Sie waren schon auf dem Weg zum Meydan gewesen, da sie die Unruhe, das Rufen der Männer und das Weinen der Frauen gehört hatten.
Als die Gemeindeältesten mit dem Priester eintrafen, sprangen die Männer auf, die Frauen reckten den Hals und seufzten. Die Statue Tausi Meleks hielt jetzt ein junger Mann wie einen Schatz in seinen Händen. Er stand neben Priester Ilyas.
Unser Pir küsste die Statue, und die Gemeindeältesten taten es ihm nach.
»Herzlich willkommen, Brüder!«, murmelte der Pir nicht sehr freundlich und wartete unbewegt.
Ausgemergelt und regelrecht grün vor Hunger stieß eine junge Frau einen gellenden Schrei aus und ließ den Kopf auf die Brust fallen. Seit drei Tagen hatte sie nichts gegessen. Es war ein feines und vornehmes Mädchen; sie hielt es nicht mehr aus und fiel in Ohnmacht.
Nachdem die Ältesten am Meydan ankamen, lief ich zum Agha und sagte zu ihm: »Lass dich nicht aus deiner Stimmung reißen, Agha, du bist im Paradies, bleibe dort. Wir Yeziden haben nicht so ein Glück.«
Der Agha lachte. »Haben die Menschen, die hergekommen sind, auch einen Priester?«, fragte er.
»Ja«, antwortet der Mohtar und füllte sein Glas von Neuem.
»Dann wird es lustig werden, wirst schon sehen. Die beiden Priester werden aneinandergeraten. Die Priester sind wie die Weiber, bei meiner Seele; wenn sie aneinandergeraten, gehen sie sich zuerst an die Haare. Zwei Priester in einem Dorf, da gibt es immer Streit. Es geht um die Macht, und niemand will teilen.« Sie lachten und tranken noch mehr, als verstärke sich ihr Durst angesichts der leidenden Menschen.
Ich war unruhig, angespannt und neugierig, sodass ich es nicht mehr länger beim Agha aushielt. Wie ein Jagdhund lief ich den Hügel hinunter und schaute mir an, was bei der Menge auf dem Meydan vor sich ging.
Eine alte Frau keifte: »Habt ihr denn kein Herz im Leib? Seht ihr es nicht, es sind eure Brüder und Schwestern, es sind Yeziden, die sich in Not befinden! Habt ihr kein Mitleid mit ihnen allen hier, die Hunger leiden? Ihr seid noch schlimmer als die Moslems und die türkischen Soldaten, die uns unterdrücken!«
»Soll ich dich in Stücke schlagen, Tochter einer Hure«, schrie ihr Mann. »Was hast du hier unter so vielen Männern zu suchen? Scher dich sofort nach Hause, weg von hier! Ich komme nach. Es ist die Sache unseres Priesters und der Großen des Dorfes.«
Sie schwieg einen Augenblick und wandte ihm den Rücken zu. Doch dann konnte sie sich nicht mehr beherrschen, sie wäre sonst an ihren Worten erstickt, und so drehte sie sich um und schrie: »Bêdin, Ungläubige, Heiden!«, und dann lief sie aus seiner Reichweite und mischte sich unter die Flüchtlinge.
Der Pir warf einen scharfen Raubvogelblick auf die zerlumpten, verhungerten und todmüden Menschen; es gefiel ihm nicht, was er sah, und so erhob er die Stimme: »Was seid ihr für Leute?«, fragte er. »Warum habt ihr eure Heimat verlassen? Was wollt ihr hier?«
Die Frauen duckten sich unwillkürlich, als sie seine Stimme vernahmen; die Kinder liefen zu ihren Müttern und fassten sie bei den Röcken; die Hunde begannen zu bellen. Der Agha hatte seine Spitzel unter den Menschen in der Menge, und alle fünf Minuten konnte man sehen, wie sie zu dem Anwesen des Aghas liefen und zurückkehrten. Ebu, der Geldeintreiber, war der Eifrigste von allen.
»Ich bin Priester Ilyas«, antworte der Priester ruhig und bestimmt. »Ich komme aus einem Dorf weit in der Ferne, mein Bruder. Und das hier sind die Seelen, die Gott mir anvertraut hat. Die Türken haben das Dorf niedergebrannt, uns von unserem Grund und Boden verjagt und so viele getötet, wie sie nur konnten. Wir sind entkommen. Unsere moslemischen kurdischen Brüder aus den Nachbardörfern hatten ebenfalls Angst und halfen uns nicht. Wir sind von Dorf zu Dorf gezogen, doch sie haben ihren Kopf gesenkt und geschwiegen. Nun hat uns aber Khoda nicht allein gelassen. Er hat uns den Weg in ein yezidisches Dorf gezeigt. Wir suchen neues Land, wo wir uns niederlassen können!«
Er schwieg einen Augenblick, die Kehle war ihm zu trocken, und die Worte kamen nur stockend heraus.
Der alte Selim konnte die Lage nur zu gut nachempfinden, denn ihn hatte im Irak durch die irakischen Soldaten ebenfalls ein solches Schicksal getroffen. Er hatte sein Dorf verlassen müssen, seine Familie war verschwunden, und erst nach Jahren hatte er unser Dorf in den Bergen gefunden und eine neue Familie gegründet. Er wollte sich gerade als Beispiel den Versammelten vorstellen und sich für die vertriebenen Yeziden einsetzen, doch der Pir unseres Dorfes ließ es nicht zu. Er trat einen Schritt vor, legte dem alten Selim die Hand auf die Schulter, und Selim verstand, dass er sich unterzuordnen hatte.
»Wir sind Yeziden, auch wir«, fuhr er in gemäßigterem Ton fort. »Wir sind Kurden, wir alle sind eine große Familie, wir dürfen nicht zugrunde gehen.«
Die Kuriere des Agha berichteten ihm jedes Detail. Der Mohtar war erneut auf den Balkon getreten und versuchte zu erkennen, was weit weg auf dem Meydan vor sich ging.
»Verdammt, was sind wir nur für ein Volk!«, sagte er. »Welch eine Ausdauer, welchen Mut haben wir! Sie schlagen uns und wollen uns vernichten, doch als hätten wir die Urkraft des Gilgamesh, stehen wir von Neuem wieder auf.«
Er hatte sich in Hitze geredet, also nahm er das Tuch vom Kopf, tauchte es in den Wassereimer neben sich, wand es wieder um den Kopf und fühlte sich erfrischt.
Der Agha sagte, als sei er von einem anderen Stern: »Ja, ihr Kurden seid stark, aber nicht vereint, und das ist eure Schwäche seit jeher. Ich weiß, dass diese Priester sich schon hassen, obwohl sie sich gerade zum ersten Mal gesehen haben«, dabei war er selbst Kurde, aber davon wollte er zumindest an diesem Tag nichts wissen.
Priester Ilyas erhob seine Stimme, damit alle es hören konnten: »Wir werden nicht vergehen! Tausende von Jahren haben wir gelebt, wir werden noch Tausende von Jahren leben … Wir sind froh, dass wir hergekommen sind.«
Sofort bewunderte ich diesen Priester. Er war ein richtiger Anführer. Welche Beharrlichkeit, welch einen Mut er hatte! Dennoch fiel es mir schwer, ihm zu glauben. Wir Yeziden sollten unsterblich sein? Man reißt uns mit den Wurzeln aus, man brennt uns nieder, schlachtet uns, doch wir gehen nicht zugrunde? Warum seid ihr dann vor den Türken geflohen? Es fiel mir schwer, dem Priester zu glauben. Aber dennoch gefiel mir seine Courage.
Die Frauen schrien, sie dachten wahrscheinlich an ihr Heim, und die Kinder dachten an das Brot und weinten.
Plötzlich aber versiegte der Lärm, denn unser Pir hob die Hand, legte sie dann auf seinen wohlgenährten Bauch und begann zu sprechen. »Was geschieht, ist Gottes Wille«, sagte er mit lauter Stimme. »Gott blickt auf die Erde und gibt jedem, was er verdient. Er lässt die einen in Wohlstand leben und stürzt euer Dorf in Trauer und Sorge. Nur Gott kennt eure Sünden.«
Er schwieg einen Augenblick, damit jeder in der Menge verstand, wie ernst es ihm war. Dann hob er wieder die Hand und rief in vorwurfsvollem Ton: »Die Wahrheit! Die Wahrheit! Berichtet, was ihr getan habt und wie euch ein solches Unglück hat treffen können.«
»Auch ich bin ein Diener meines Khodas und Tausi Meleks«, gab Priester Ilyas zurück, der sichtlich versuchte, seinen Zorn zu zügeln, der in ihm hochkochte. »Auch ich kenne die Gebete und Regeln unseres Glaubens. In meiner Hand halte ich eine der sieben Statuen des Engels Pfau, die es auf der Welt nur gibt. Ob du willst oder nicht, wir beide sind vom gleichen Glauben. Du bist vielleicht reich, und ich arm; du hast vielleicht viel Land, ich habe – wie du siehst – nichts. Vor Gott und dem Engel Pfau sind wir jedoch gleich. Vielleicht stehe ich Gott näher als du, weil ich Hunger leide. So mildere deinen Ton, guter Priester, wenn du willst, dass ich dir antworte.«
Unser Pir wurde rot im Gesicht und zornig. Ein irritierendes Gefühl stieg in ihm auf, doch er beherrschte sich. Er sah ein, dass er im Unrecht war; er merkte, dass alle Dorfbewohner zugegen waren als Zeugen und dem ungeschliffenen fremden Priester in ihrem Herzen recht gaben.
»Dann sprich!«, sagte der Dorfpriester, so weich und sanft es ihm möglich war. »Sprich! Gott hört uns, die Leute hören uns, auch wir sind Yeziden, verstehst du, und Kurden dazu.«
Als Bote des Agha zurück im Dorf, hatte ich mich zu Siyabend und Kerim gestellt. Jetzt griffen die beiden mich am Arm und zerrten mich näher heran an den fremden Priester, damit wir auch ja alles hörten.
Doch was Priester Ilyas erzählte, bedrückte mich: Tod, Vertreibung, Zerstörung ihrer Häuser. Der Schrecken wollte kein Ende nehmen. Die Frauen weinten, und die Männer seufzten aus tiefstem Herzen. Noch nie hatte ich ein derartiges Gefühl der Ohnmacht, der Schwäche in unserem Dorf gesehen. Es regnete nicht, und wir alle litten Hunger, aber das war nichts im Vergleich zum Schicksal der Menschen auf dem Meydan. Die Neuankömmlinge riefen immer wieder: »Gott helfe uns«, aber das kam nicht von Herzen: Sie waren nicht davon überzeugt, dass sich etwas an ihrer Lage ändern würde.
Der Agha war eingeschlafen und zuckte zusammen, als die anderen Kuriere und ich vom Meydan kamen, um zu berichten. Er sagte: »Höre, Mohtar, mir will das hier nicht ganz gefallen. Wann fangen sie an aufeinander loszugehen?«
Der Mohtar zuckte die Achseln und sagte: »Reg dich nicht auf, mein Agha, schlaf! Schlaf nur, ich habe Augen und Ohren für zwei.«
»Ich bin müde und schläfrig, ewiger Mohtar dieses Dorfes und mein yezidischer Bruder. Doch wenn du hörst, dass die Priester einander beschimpfen und aufeinander losgehen, dann weck mich sofort, damit ich mit der Peitsche hinuntergehen kann, um Ordnung zu schaffen.« Er lachte und wandte sich Gule zu. »Komm, Gule, massiere mir die Schläfen und knete meine Schultern, damit ich wieder in den Schlaf zurückfinde.«
Hier geschah nichts, also machte ich mich wieder auf den Weg ins Dorf.
Auf dem Meydan lauschten noch immer alle, was Priester Ilyas erzählte; die Menschen waren wie gelähmt und hörten gespannt zu, viele weinten. Auch ich konnte nicht an mich halten und weinte wie ein kleines Kind und schaute mir die beiden Priester an. Nur die beiden waren nicht zu Tränen gerührt. Der eine weinte wohl nicht, weil er all dieses Elend erlebt hatte und über dieses Stadium hinaus war, und der andere, weil er mit wachsender Unruhe darüber nachdachte, was er anstellen sollte, um den ausgehungerten Haufen und seinen ungepflegten Sprecher, der die Gefühle des Volkes ansprach, loszuwerden.
Ich konnte sehen, wie unser Pir die Stirn runzelte und sich sein Gesicht verzog. Ihm gefiel es nicht, dass Priester Ilyas die Menschenmenge in seinen Bann gezogen hatte. Er überlegte, wie er sie aus dem Dorf, ja aus der Gegend bekommen könne.
Ich war so betroffen, dass ich mich nicht beherrschen konnte. So trat ich vor und sagte: »Es sind doch Yeziden, wir müssen ihnen helfen. Wer es nicht tut, ist kein Yezide.« Ich wollte weiterreden, doch da wandte sich der Pir mir zu und sagte: »Schweig!«
Am liebsten hätte ich ihn beschimpft, doch dann sah ich die fürchterlichen Blicke meines Onkels und meiner Mutter und schwieg. Siyabend und Kerim aber kamen zu mir, als wollten sie sagen: »Wir denken genauso.«
Die Menschenmenge schwieg, und jeder wartete auf den Pir. Doch dieser sagte ebenfalls kein Wort, als denke er über eine Kriegsstrategie gegen den Feind nach. Was wollte er tun? Den Agha rufen? Murat Bekci, den Oberaufseher, und die Soldaten antreten lassen? Auch dieser Gedanke kam ihm, doch würde er die Yeziden durch Moslems und den türkischen Oberaufseher Murat Bekci und die Soldaten vertreiben lassen, würde man ihm das übel nehmen. Es waren Yeziden; wie sollte er es den Dorfbewohner erklären?
Priester Ilyas hielt es nicht mehr aus und fragte: »Hörst du nicht Gott und seinen Sklaven? Warum antwortest du nicht?«
»Ja, ich zögere«, antwortete der Pir wütend, »denn ich habe auch Seelen, für die ich Gott Rechenschaft schuldig bin.«
»Alle Seelen der Welt sollten jedem Menschen am Herzen liegen!«, erwiderte Priester Ilyas. »Mach keinen Unterschied zwischen den Menschen und vor allem nicht zwischen deinen und meinen.«
Ich glaube, wenn die beiden Priester alleine gewesen wären, dann hätte sich unser Pir in diesem Moment auf Priester Ilyas geworfen und ihn erwürgt. Doch er wusste nicht, was er tun sollte.
Noch bevor unser Dorfpriester Atem holen konnte, um etwas zu sagen, schrie jemand in der Menge auf. Ein junger Mann fiel zu Boden. Alle versuchten eifrig, ihn wieder auf die Beine zu bringen, doch als sie sein Gesicht sahen, wichen sie erschreckt vor ihm zurück. Er war grüngelb im Gesicht, die Lippen blau. Seine Füße waren geschwollen und bluteten.
Da trat der Dorfpriester vor und sprach: »Meine Kinder, Kinder Gottes«, sein Gesicht war voller Ernst, aber auch bewegt von einer inneren Freude, die er nicht verbergen konnte. »Seht ihr! Gott hat uns ein Zeichen gegeben. Seht ihr nicht den jungen Mann? Er hat die Cholera! Fasst ihn nicht an, sonst wird auch unser Dorf vernichtet.«
Die Menschen redeten wild durcheinander, und schnell bildeten sich zwei Gruppen: die Dorfbewohner und die Geflüchteten. Eben waren sie noch Brüder, und jetzt bereuten die Dorfbewohner schon dieses Gefühl.
Priester Ilyas versuchte, die Menschen zu beruhigen, und erklärte laut, es sei nur ein Zeichen von Erschöpfung, Hunger und Durst. Doch es war zu spät. Unser Pir hatte die Dorfbewohner auf seiner Seite.
Die Nachricht war schon beim Agha eingetroffen, als ich bei ihm ankam. Schon rief er nach Gule und noch mehr Raki und sagte: »Siehst du, Mohtar«, und er grinste breit, »ich kenne dein Volk. Nicht einmal ein paar Stunden halten sie zusammen. Der Dorfpriester ist die Ausgeburt der Hölle. Neben sich akzeptiert er keinen anderen Priester. Er geht über Leichen. Sind wir Moslems oder Türken eure Feinde, oder ihr selbst?«
Der Mohtar krümmte sich und verbarg seinen Zorn. Er trank noch schneller als zuvor und erwiderte: »Mein Agha, Religions-, Nations-, Stammeszugehörigkeit ist etwas für die Bauern. Der Wohlhabende hat keines davon. Er braucht sie auch nicht.«
»Wohl wahr, mein Freund. Scherefe! Zum Wohle! Lass uns noch einen Raki trinken.«
Angewidert wandte ich mich ab und rannte wieselflink zurück ins Dorf, wo unser Pir die Oberhand gewonnen hatte. Gerade als ich ankam, sagte er: »Mein Freund, du hast von euren Leiden berichtet. Sie schneiden uns ins Herz. Du siehst, dass wir alle Tränen in den Augen haben. Wir haben unsere Arme geöffnet, um euch aufzunehmen, doch in diesem Augenblick hat Gott sich unser erbarmt und uns ein Zeichen gesandt. Ihr führt die Pest mit euch, Brüder. Setzt eure Reise fort, und Gott sei mit euch, aber zerstört nicht unser Dorf!«
Überall hörten wir Klagerufe, und diesmal weinten Männer und Frauen zusammen. Ich hasste den Dorfpriester in diesem Moment und alles, was er über Religion, über Werte und Brüderlichkeit daherredete.
Andere Dorfbewohner begannen, die Flüchtlinge zu beschimpfen, und forderten sie auf, zu gehen, sonst würden sie mit Gewalt nachhelfen.
Priester Ilyas flehte sie an, sprach von Yezidentum, Religion, Gott und all den anderen Engeln. Er stieß auf taube Ohren. Als er merkte, dass alles vergebens war, sagte er: »Ja, wir werden uns auf den Weg machen. Verliert nicht den Mut, meine Kinder. Sie wollen uns hier nicht, dann wollen wir sie auch nicht. Die Erde ist groß, und Gott ist mit uns. Wir werden weitergehen.«
Und an unser Dorf gewandt fuhr er fort: »Aber lasst euch noch eines gesagt sein. Gott ist gerecht und wird euer Handeln schwer bestrafen. Dieses Dorf wird es nicht mehr lange geben. Es wird von der Trockenheit vernichtet und von dem Zorne Gottes zunichtegemacht werden. Nur Menschen reinen Herzens und vielleicht dieses Kind«, dabei schaute er mich direkt an, »werden euch retten.«
Doch niemand hörte mehr zu. Einige Dorfbewohner hatten schon drohend ihre Hacken, Messer und Stöcke geholt. Und so verließen die Flüchtlinge das Dorf.
Siyabend, Kerim und ich liefen noch lange mit ihnen und holten ihnen einige Schläuche voll vom wenigen Wasser und stahlen Brot aus den Häusern. Ungefähr an der Stelle, wo wir sie erstmals gesehen hatten, verabschiedeten wir uns von Priester Ilyas.
Er schaute mir tief in die Augen und sagte: »Eines Tages wird ein Fremder kommen und …«, dann unterbrach er sich, als sei er selbst erstaunt, dass er so geredet hatte, und drehte sich um. Mit dem Rücken zu uns gewandt, fügte er leise hinzu: »Nur er kann euer Dorf retten.«
Die Nacht war still, nicht ein Blatt regte sich. Über dem Himmel lag ein starker heller Schein. Von Weitem waren die Umrisse der Berge zu sehen. Wir folgten der Menge, wie sie Richtung Horizont weiterzog, bis sie nach einer Weile im Dunkel verschwunden war.
An Tagen wie diesen versammelten sich die Dorfbewohner auf dem Dach der alten Hazal. Sie war Heilerin, Wächterin des Glaubens und eine Erzählerin, die über ein wundersames Gedächtnis verfügte und Geschichten aus alten Zeiten vortragen konnte, wie ich sie noch nie gehört hatte. Sogar Leute aus anderen Dörfern und der Stadt kamen und fragten sie nach ihren Geschichten. Sie schrieben alles auf und waren so erfreut, als hätten sie einen riesigen Schatz gefunden. Die Familie von Hazal gehört zu den Micewir, die die Aufgabe haben, die Tempel der Yeziden zu schützen und zu pflegen. Sie sind handwerklich begabt, wie es auch der Mann von Hazal gewesen war. Nun war er wohl schon vierzig Jahre tot, und seither hat Hazal seine Aufgabe übernommen. Sie wurde besonders von den Armen geliebt. Der Agha, der Mohtar und sogar der Pir zollten ihr Respekt und baten sie immer wieder, sich zu den Männern zu setzen. Ich glaube, sie fürchteten sich vor ihrem Wissen und der Macht ihrer Flüche.
Die Haare von Hazal waren so weiß wie Schnee, ihr Gesicht aber glatt wie das einer jungen Frau, und ihr Lächeln schenkte Hoffnung und Zuversicht.
Auf dem flachen Dach des Hauses hatten sich Kinder, Frauen und Männer versammelt, und über ihnen strahlten die Sterne mit ihrem Licht; es war eine mystische Atmosphäre.
Diesmal aber war das Gesicht der alten Hazal ernst, als sie anhob zu sprechen: »Ich werde heute eine neue Geschichte beginnen, die zu erzählen einige Wochen, ja Monate dauern wird, und werde sie nicht wiederholen und vielleicht nie wieder in meinem Leben erzählen.« Die Spannung stieg, und jeder wollte, dass sie endlich anfinge. Doch sie erklärte weiter: »Nur diejenigen, die mir versprechen, bei jeder Sitzung am Abend oder wenn ich sie einberufe, dabei zu sein, können bleiben. Allen anderen wünsche ich einen guten Abend.« Sie stand auf und ging hinunter ins Haus, damit die Leute sich nicht zu schämen brauchten, wenn sie gingen. Ich wollte auch schon aufbrechen, aber ich war zu neugierig, denn ich wollte wissen, was dies für eine lange Geschichte sein könnte.
Als die alte Hazal wieder aufs Dach trat, saß nur noch ich dort.
»Gut, es lohnt sich, Rodi. Diese Geschichte erzählt von der Zeit vor der Flut, in der es viele Götter gab. Versprich mir, sie auswendig zu lernen, damit sie nicht verloren geht. Viele Gelehrte aus der Stadt waren schon mit kurdischen Übersetzern bei mir und haben mir Geld angeboten, damit ich ihnen die Geschichte erzähle, aber ich habe sie bis heute wie einen Schatz bewahrt. Es ist die Geschichte des Gilgamesh.«
Diesen Namen hatte ich öfter von den alten Männern gehört, doch wusste ich nichts Genaues darüber. Ich glaube, die Alten wussten es auch nicht.
Dann begann die alte Hazal zu erzählen:
»Ich möchte der Welt von den Taten des Gilgamesh künden. Denn er war der Mann, der alles kannte; er war der König. Er war weise und wusste von geheimen Dingen. Begab er sich auf eine Reise, wurde er weder müde noch erschöpft von der Arbeit. Alle seine Taten schrieb er auf Stein. Die sieben Tafeln aber sind uns von fremden Mächten genommen worden. Das ist unser Schicksal.« Dann schaute Hazal mir tief in die Augen, als wolle sie sich mit mir auf eine lange Reise begeben. Ich war aufgeregt und neugierig. Ich hing an ihren Lippen, als sie endlich weitererzählte: »Mein Junge, Rodi, du wirst viele Fragen haben, aber höre erst die Geschichte. Später, viel später, werden wir über alles reden.«
Ich verstand das nicht, aber das war mir in diesem Augenblick auch nicht so wichtig. Ich brannte darauf, mehr zu erfahren über diesen Gilgamesh, so sagte ich: »Ich werde zuhören und versuchen, mir alles zu merken. Doch erzähl endlich weiter.«
Sie versuchte ernst zu bleiben, aber ein kleines Lächeln glaubte ich gesehen zu haben. Endlich begann sie wirklich zu erzählen:
»Als die Götter Gilgamesh schufen, gaben sie ihm einen unvergleichlichen Körper. Shems, die herrliche Sonne, schenkte ihm Schönheit, Adad, der Gott des Sturmes, schenkte ihm Mut, die großen Götter machten seine Schönheit unübertrefflich. Stark war er wie ein wilder Bulle. Zu zwei Dritteln war er ein Mann, zu einem Drittel aber war er ein Gott.
In Uruk, seiner Stadt, baute er Mauern, einen großen Schutzwall, und den heiligen Feuertempel.«
Hazal drehte sich zu mir und sagte: »Schließ die Augen und sieh es dir selbst an.«
Ich schloss die Augen und dann lauschte ich weiter: »Sieh es dir selbst an: Die äußere Wand, wo das Gesims verläuft, leuchtet glänzend wie von Kupfer, und die Wand im Innern hat nicht ihresgleichen. Überschreite die antike Schwelle, nähere dich dem Feuertempel, den ihm kein lebender Mensch gleichmachen kann. Steige auf die Mauern von Uruk. Gehe an ihnen entlang, sage ich.« Dann forderte sie mich auf, die Augen zu öffnen und sagte: »Wenn du heute noch nichts gesehen hast, dann wirst du es in deinen Träumen tun. Verinnerliche diese Geschichte, und du wirst verstehen.«
Sie nahm ihre Gebetskette in die Hand, wie sie sonst nur Männer haben, und sie bewegte Kugel für Kugel, die auf einem roten Faden aufgereiht waren, als hielte sie die Zeit in der Hand, die sie nach Belieben vor- und zurückschob.
Dann machte sie eine feierliche Pause.
»Ich will dir von Gilgamesh und seinem Leben erzählen«, und voller Energie fuhr sie fort: »Gilgamesh zog in die Welt hinaus, aber niemand konnte sich mit ihm messen. So kannte seine Arroganz keine Grenzen. Kein Sohn blieb bei seinem Vater, sie alle folgten Gilgamesh. Doch er war König, und ein König sollte für sein Volk wie ein Hirte sein. Seine Begierde aber ließ keine Jungfrau bei ihrem Liebsten, weder die Tochter des Kriegers noch die Frau des Edelmannes.
So hörten die Götter viele Klagen über Gilgamesh, rastlos sei er und kein guter Hirte für die Stadt.
Die Menschen riefen Khoda, den Allmächtigen, an: Du hast ihn erschaffen, o Ahura Mazda, nun erschaffe sein Ebenbild, sein zweites Ich. Lass sie ihre Kraft aneinander austoben, damit Uruk in Ruhe gelassen wird.
Khoda machte einen Entwurf, und er griff das Material der Götter aus dem Firmament. Khoda tauchte seine Hände in Wasser und löste Lehm heraus, er ließ ihn durch Wind formen und durch Feuer härten. Er ließ ihn fallen in der Wildnis. Und so ward Enkidu. Es war Tugend in ihm. Sein Körper war hart, er hatte langes Haar wie eine Frau. Sein Körper war bedeckt mit verfilztem Haar wie der von Samuqan, dem Gott des Viehs. Er war voller Unschuld und lebte weit fort von den Menschen.
Enkidu aß in den Bergen Gras mit der Gazelle und lauerte mit wilden Tieren an den Wasserstellen. Er lebte mit ihnen, als einer von ihnen.
Aber es gab einen Fallensteller, der ihn eines Tages, Auge in Auge, an der Wasserstelle traf. Mit Angst im Herzen erzählte er seinem Vater: Vater, es gibt einen Mann, der aus den Bergen kommt, er ist anders als jeder andere. Er ist der Stärkste der Welt, er ist wie ein Unsterblicher vom Himmel. Mein Sohn, antwortete der Vater, in Uruk lebt Gilgamesh. Niemand hat ihn je besiegt, er ist so stark wie ein Stern vom Himmel. Geh und finde Gilgamesh, rühme vor ihm die Stärke dieses wilden Mannes. Bitte ihn um eine Huri, eine Schönheit vom Tempel der Liebe, und kehre mit ihr zurück. Wenn er das nächste Mal kommt, um an der Wasserstelle zu trinken, wird sie dort sein, vollkommen nackt. Und wenn er sie sieht, wird er sie umarmen, und dann werden die wilden Tiere ihn zurückweisen.