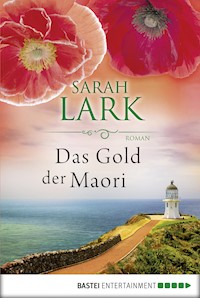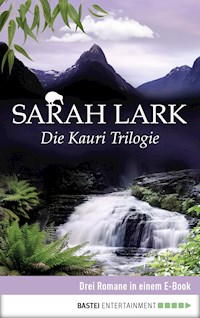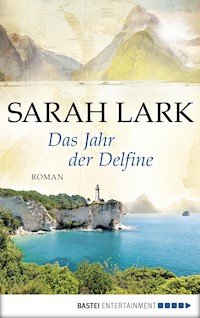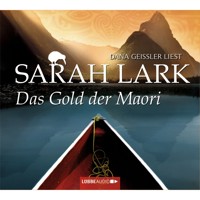9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Weiße-Wolke-Saga
- Sprache: Deutsch
Neuseeland, 1893: William Martyn ist gebildeter und kultivierter als die übliche Klientel, die es auf der Suche nach Gold nach Queenstown verschlägt. Kein Wunder, denn Will ist der Sohn irischer Landadeliger. Als sich die temperamentvolle Elaine in ihn verliebt, ist er zunächst nicht abgeneigt. Doch als Kura-maro-tini, Elaines Cousine und Halb-Maori, zu Besuch kommt, erliegt er deren Schönheit und Ausstrahlung sofort ...
Der zweite Teil der farbenprächtigen Generationen-Saga nach IM LAND DER WEISSEN WOLKE
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1038
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über die Autorin
Titel
Impressum
Karten
DIE ERBIN
1
2
3
4
5
6
7
8
DES MENSCHEN WILLE …
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
FLUCHT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
HEILUNG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
DIE STIMMEN DER GEISTER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
NACHWORT
Über die Autorin
Sarah Lark, geboren 1958, arbeitete lange Jahre als Reiseleiterin. Ihre Liebe für Neuseeland entdeckte sie schon früh. Seine atemberaubenden Landschaften haben sie seit jeher magisch angezogen.
Sarah Lark ist das Pseudonym einer erfolgreichen deutschen Schriftstellerin. Sie lebt in Spanien und arbeitet zurzeit an ihrem nächsten Roman. Unter dem Autorennamen Ricarda Jordan entführt sie ihre Leserinnen auch ins farbenprächtige Mittelalter (Die Pestärztin).
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Originalausgabe
© 2008 by Bastei Lübbe AG, Köln
DiesesWerk wurde vermittelt durch
die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH,
30827 Garbsen
Lektorat:Wolfgang Neuhaus
Titelillustration: Jochen Schlenker/Masterfile und
Oxford Scientific/Mauitius images
Umschlaggestaltung: Bettina Reubelt
Datenkonvertierung E-Book:
Urban SatzKonzept, Düsseldorf
ISBN 978-3-8387-0124-0
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
DIE ERBIN
Queenstown, Canterbury Plains1893
1
»Sie sind Mrs. O’Keefe?«
William Martyn schaute verdutzt auf das rothaarige, zierliche Mädchen, das ihn an der Rezeption des Gästehauses willkommen hieß. Die Männer im Goldgräberlager hatten ihm Helen O’Keefe als ältere Dame geschildert, ja als eine Art weiblichen Drachen von der Sorte, die mit zunehmendem Alter Feuer spie. In Miss Helens Hotel herrschten strenge Sitten, hieß es. Das Rauchen sei verboten, ebenso Alkohol, erst recht das Mitbringen von Gästen anderen Geschlechts, sofern keine Heiratsurkunde vorlag. Die Erzählungen der Goldgräber hatten eher ein Gefängnis als ein Gasthaus erwarten lassen. Immerhin gäbe es keine Flöhe und Wanzen in Miss Helens Etablissement, dafür aber ein Badehaus.
Letzteres hatte William endgültig davon überzeugt, alle Warnungen seiner Bekannten in den Wind zu schlagen. Nach drei Tagen auf dem Gelände der alten Schaffarm, die sich die Goldgräber als Unterschlupf gesichert hatten, war er zu allem bereit gewesen, um dem Ungeziefer dort zu entrinnen. Sogar den »Drachen« Helen O’Keefe wollte er über sich ergehen lassen.
Nun aber begrüßte ihn hier keineswegs ein Drache, sondern dieses ausnehmend hübsche, grünäugige Geschöpf, dessen Gesicht von einer unbezähmbaren rotgoldenen Lockenpracht eingerahmt war. Alles in allem der erfreulichste Anblick, seit William in Dunedin, Neuseeland, das Schiff verlassen hatte. Seine Laune, seit Wochen auf dem Tiefpunkt, hob sich beträchtlich.
Das Mädchen lachte.
»Nein, ich bin Elaine O’Keefe. Helen ist meine Großmutter.«
William lächelte. Er wusste, dass er damit Eindruck machte. In Irland hatte sich stets ein aufmerksamer Ausdruck auf die Gesichter der Mädchen geschlichen, wenn sie den Schalk in seinen blauen Augen aufblitzen sahen.
»Das tut mir ja fast leid. Sonst hätte ich nämlich glatt eine Geschäftsidee gehabt: ›Wasser aus Queenstown – entdecken Sie den Jungbrunnen!‹«
Elaine kicherte. Sie hatte ein schmales Gesicht und eine kleine, vielleicht ein bisschen zu spitze Nase mit unzähligen Sommersprossen.
»Sie sollten sich mit meinem Vater zusammentun. Der macht ständig solche Sprüche: ›Spaten gut, alles gut. Goldgräber, kauft eure Ausrüstung im O’Kay Warehouse!‹«
»Ich werde es beherzigen«, versprach William und merkte sich den Namen tatsächlich. »Wie ist es jetzt? Bekomme ich ein Zimmer?«
Das Mädchen zögerte. »Sie sind Goldgräber? Dann … na ja, es gibt schon noch freie Zimmer, aber die sind ziemlich teuer. Die meisten Goldgräber können sich die Unterkunft hier nicht leisten …«
»Sehe ich so aus?«, fragte William mit gespielter Strenge. Dabei runzelte er die Stirn unter seinem blonden, üppigen Haarschopf.
Elaine musterte ihn jetzt ungeniert. Auf den ersten Blick unterschied er sich nicht allzu sehr von den anderen Goldgräbern, die sie in Queenstown täglich zu sehen bekam. Er wirkte ein wenig schmutzig und abgerissen, trug einen Wachsmantel, blaue Denimhosen und feste Stiefel. Auf den zweiten Blick jedoch erkannte Elaine – als Tochter eines Kaufmanns – die Qualität seiner Ausstattung: Unter dem offenen Mantel war eine teure Lederjacke zu sehen; an den Beinen trug er lederne Chaps; die Stiefel waren aus hochwertigem Material, und das Hutband um seinen breitkrempigen Stetson war aus Pferdehaar geflochten. Das kostete ein kleines Vermögen. Auch seine Satteltaschen – er hatte sie zunächst lässig über seine rechte Schulter gehängt, jetzt aber zwischen seinen Beinen auf dem Boden deponiert – schienen eine solide und teure Arbeit zu sein.
Das alles war keineswegs typisch für die Glücksritter, die nach Queenstown kamen, um in den Flüssen und Bergen nach Gold zu suchen, denn nur die wenigsten wurden reich. Die große Mehrheit verließ die Stadt früher oder später so arm und abgerissen, wie sie gekommen war. Das lag auch daran, dass die Männer die Erträge ihrer Minen in der Regel nicht sparten, sondern gleich in Queenstown wieder verprassten. Wirklich zu Geld gekommen waren nur die Zuwanderer, die sich hier angesiedelt und ein Geschäft gegründet hatten. Zu ihnen gehörten Elaines Eltern, Miss Helen mit ihrer Pension, Stuart Peters’ Schmiede und Mietstall, Ethans Post- und Telegrafenamt – und vor allem natürlich der verrufene, aber allgemein beliebte Pub in der Main Street und das darüberliegende Freudenhaus namens Daphne’s Hotel.
William erwiderte Elaines abschätzenden Blick geduldig mit leicht spöttischem Lächeln. Elaine schaute in ein jungenhaftes Gesicht, in dessen Wangen Grübchen erschienen, wenn er den Mund verzog. Und er war frisch rasiert! Auch das war ungewöhnlich. Die meisten Goldgräber griffen höchstens am Wochenende zum Rasiermesser, wenn bei Daphne Tanz war.
Elaine beschloss, den Neuankömmling ein bisschen zu necken und damit vielleicht aus der Reserve zu locken. »Sie riechen zumindest nicht so streng wie die meisten.«
William lächelte. »Bislang bietet der See ja auch kostenlose Bademöglichkeit. Aber nicht mehr lange, hat man mir gesagt, und es wird kalt. Außerdem scheint das Gold Körpergeruch zu mögen. Wer am seltensten badet, holt die meisten Nuggets aus dem Fluss.«
Elaine musste lachen. »Daran sollten Sie sich aber kein Beispiel nehmen, sonst gibt’s Ärger mit Grandma. Hier, wenn Sie das ausfüllen würden …« Sie schob ihm ein Anmeldeformular zu und versuchte, nicht allzu neugierig über den Tresen zu linsen. Möglichst unauffällig las sie mit, während William schwungvoll seine Eintragungen machte. Auch das war ungewöhnlich; die wenigsten Goldgräber schrieben so flüssig.
William Martyn … Elaines Herz schlug höher, als sie seinen Namen las. Ein schöner Name.
»Was soll ich denn hier eintragen?«, fragte William und wies auf das Feld, das nach seiner Heimatadresse fragte. »Ich bin gerade erst angekommen. Das ist meine erste Adresse in Neuseeland.«
Elaine konnte ihr Interesse jetzt nicht mehr verbergen. »Wirklich? Wo kommen Sie denn her? Nein, lassen Sie mich raten. Das tut meine Mutter bei neuen Kunden auch immer. Man hört es am Akzent, woher jemand kommt …«
Bei den meisten Einwanderern war es einfach. Natürlich irrte man sich hin und wieder. Für Elaine beispielsweise klangen Schweden, Niederländer und Deutsche fast gleich. Aber Iren und Schotten konnte sie meist ohne Schwierigkeiten auseinanderhalten, und Leute aus London waren besonders leicht zu erkennen. Experten konnten sogar den Stadtteil benennen, aus dem jemand kam. William allerdings war schwer einzuschätzen. Er klang wie ein Engländer, doch irgendwie sprach er weicher, dehnte die Vokale ein bisschen mehr.
»Sie sind aus Wales«, riet Elaine auf gut Glück. Ihre Großmutter mütterlicherseits, Gwyneira McKenzie-Warden, war Waliserin, und Williams Aussprache erinnerte ein bisschen an sie. Allerdings sprach Gwyneira keinen ausgeprägten Dialekt. Sie war die Tochter eines Landadeligen, und ihre Erzieherinnen hatten stets Wert auf akzentfreies Englisch gelegt.
William schüttelte den Kopf, doch ohne dabei zu lächeln, wie Elaine gehofft hatte. »Wie kommen Sie denn darauf?«, meinte er. »Ich bin Ire aus dem County Connemara.«
Elaine wurde rot. Darauf wäre sie nie gekommen, obwohl es viele Iren auf den Goldfeldern gab. Die aber sprachen meist einen ziemlich plumpen Dialekt, während William sich eher gewählt ausdrückte.
Wie um seine Herkunft zu unterstreichen, setzte er jetzt seine letzte Adresse mit großen Buchstaben in das Kästchen: Martyn’s Manor, Connemara.
Das klang nicht nach dem Hof eines Kleinbauern, das klang nach einem Landgut …
»Dann zeige ich Ihnen jetzt Ihr Zimmer«, sagte Elaine. Eigentlich sollte sie die Gäste nicht selbst hinaufbegleiten, erst recht keine männlichen. Grandma Helen hatte ihr eingeschärft, für diese Aufgabe stets den Hausdiener oder eins der Mädchen zu rufen. Aber bei diesem Mann machte Elaine gern eine Ausnahme. Sie kam hinter der Rezeption hervor und hielt sich dabei so gerade, wie ihre Großmutter es ihr als »damenhaft«, beigebracht hatte: den Kopf mit natürlicher Anmut erhoben, die Schultern zurück. Und bloß nicht in den aufreizenden, wiegenden Gang verfallen, den Daphnes Mädchen so gern zur Schau trugen!
Elaine hoffte, dass ihr gerade erst halbwegs zur Reife gelangter Busen und ihre seit neuestem geschnürte, sehr schmale Taille zur Geltung kamen. Eigentlich hasste sie es, sich zu schnüren. Aber wenn dieser Mann dadurch auf sie aufmerksam wurde …
William folgte ihr und war froh, dass sie ihn dabei nicht im Blick hatte. Konnte er sich doch kaum bezähmen, ihre zierliche, an den richtigen Stellen aber schon sanft gerundete Figur lüstern anzustarren. Die Zeit im Gefängnis, dann acht Wochen Überfahrt und jetzt der Ritt von Dunedin zu den Goldfeldern bei Queenstown … insgesamt war er seit fast vier Monaten keiner Frau mehr auch nur nahegekommen.
Eigentlich undenkbar lange. Es wurde Zeit, hier Abhilfe zu schaffen! Die Jungs im Goldgräberlager hatten natürlich von den Mädchen bei Daphne geschwärmt; angeblich waren sie ziemlich hübsch und die Zimmer sauber. Doch die Vorstellung, dieser süßen kleinen Rothaarigen den Hof zu machen, gefiel William erheblich besser als der Gedanke an eine schnelle Befriedigung in den Armen einer Prostituierten.
Auch das Zimmer gefiel ihm, das Elaine jetzt für ihn aufschloss. Es war ordentlich und mit Möbeln aus hellem Holz schlicht, aber liebevoll möbliert. Es gab Bilder an den Wänden, ein Krug mit Wasser zum Waschen stand bereit.
»Sie können auch das Badehaus benutzen«, erklärte Elaine und wurde dabei ein bisschen rot. »Aber da müssen Sie sich vorher anmelden. Fragen Sie Grandma, Mary oder Laurie.«
Mit diesen Worten wollte sie sich abwenden, doch William hielt sie sanft zurück.
»Und Sie? Sie kann ich nicht fragen?«, erkundigte er sich mit weicher Stimme und blickte sie aufmerksam an.
Elaine lächelte geschmeichelt. »Nein, ich bin meist nicht hier. Nur heute vertrete ich Grandma. Aber ich … also, normalerweise helfe ich im O’Kay Warehouse. Das Geschäft gehört meinem Vater.«
William nickte. Also war sie nicht nur hübsch, sondern auch aus gutem Hause. Das Mädchen gefiel ihm immer besser. Und diverse Utensilien zum Goldgraben brauchte er sowieso. »Ich schau bald mal vorbei«, sagte William.
Elaine schwebte förmlich die Treppe hinunter. Es war ein Gefühl, als hätte ihr Herz sich in einen Heißluftballon verwandelt, der sie nun in lebhaftem Aufwind über alle Erdenschwere hinweghob. Ihre Füße berührten kaum den Boden, und ihr Haar schien im Wind zu wehen, obwohl sich im Haus natürlich kein Lüftchen regte. Elaine strahlte; sie hatte das Gefühl, am Beginn eines Abenteuers zu stehen und dabei so schön und unbesiegbar zu sein wie die Heldinnen in den Romanheften, die sie heimlich in Ethans Kramladen las.
Mit diesem Ausdruck im Gesicht tanzte sie in den Garten des großen Stadthauses, das Helen O’Keefes Pension beherbergte. Elaine kannte es gut; sie war in diesem Haus geboren. Ihre Eltern hatten es für ihre wachsende Familie errichten lassen, als das Geschäft erste Gewinne machte. Dann aber war es ihnen mitten in Queenstown zu laut und zu städtisch geworden. Vor allem Elaines Mutter, Fleurette, die von einer der großen Schaffarmen in den Canterbury Plains stammte, vermisste das freie Land. Deshalb hatten Elaines Eltern auf einem traumhaften Grundstück am Fluss neu gebaut, dem eigentlich nur eines fehlte: Goldvorkommen. Elaines Vater hatte es ursprünglich als Claim abgesteckt, doch gleich wie viele Talente Ruben O’Keefe auch besaß – als Goldsucher war er ein hoffnungsloser Fall. Zum Glück hatte Fleurette das schnell erkannt und ihre Mitgift deshalb nicht in das aussichtslose Unternehmen »Goldmine« investiert, sondern in Warenlieferungen. Hauptsächlich Spaten und Goldpfannen, die sich die Goldgräber aus den Händen rissen. Später war daraus das O’Kay Warehouse entstanden.
Das neue Haus am Fluss nannte Fleurette scherzhaft »Goldnugget Manor«, doch irgendwann hatte der Name sich eingebürgert. Elaine und ihre Brüder waren dort glücklich aufgewachsen. Es gab Pferde und Hunde, sogar ein paar Schafe, ganz wie in Fleurettes Heimat. Ruben fluchte, wenn er die Tiere alljährlich scheren musste, und auch seine Söhne Stephen und George fanden wenig Gefallen an der Farmarbeit. Ganz im Gegensatz zu Elaine. Für sie kam das kleine Landhaus nie an Kiward Station heran, die große Schaffarm, die ihre Großmutter Gwyneira in den Canterbury Plains leitete. Zu gern hätte sie auch auf so einer Farm gelebt und gearbeitet, und so war sie ein bisschen neidisch auf ihre Cousine, die den Hof später erben sollte.
Elaine war allerdings kein Mädchen, das lange grübelte. Sie fand es fast genauso interessant, im Laden zu helfen oder ihre Großmutter in der Pension zu vertreten. Dagegen hatte sie wenig Lust, aufs College zu gehen wie ihr älterer Bruder Stephen, der nun in Dunedin Jura studierte und damit den Traum seines Vaters erfüllte, der sich als junger Mann selbst gewünscht hatte, Anwalt zu werden. Ruben O’Keefe war seit fast zwanzig Jahren Friedensrichter in Queenstown, und für ihn gab es nichts Schöneres, als mit Stephen über juristische Themen zu fachsimpeln. Elaines jüngerer Bruder, George, ging noch zur Schule, schien aber der Kaufmann in der Familie zu sein. Schon jetzt half er mit Feuereifer im Laden und hatte tausend Verbesserungsideen.
Helen O’Keefe, die von der Hochstimmung ihrer Enkelin und deren Ursprung, dem Neuankömmling William Martyn, vorerst nichts ahnte, füllte mit eleganten Bewegungen Tee in die Tasse ihrer Besucherin Daphne O’Rourke.
Diese Teeparty in aller Öffentlichkeit bereitete beiden Damen ein diebisches Vergnügen. Sie wussten, dass halb Queenstown über die seltsame Beziehung zwischen den beiden »Hotel«-Besitzerinnen tuschelte. Helen hatte jedoch keine Berührungsängste. Ungefähr vierzig Jahre zuvor war die damals erst dreizehnjährige Daphne unter ihrer Aufsicht nach Neuseeland geschickt worden. Ein Londoner Waisenhaus wollte sich einiger Zöglinge entledigen, und in Neuseeland wurden Hausmädchen gesucht. Auch Helen reiste damals in eine ungewisse Zukunft mit einem ihr noch unbekannten Mann. Die Church of England bezahlte ihr die Überfahrt als Aufsichtsperson der Mädchen.
Helen, bislang Gouvernante in London, nutzte die dreimonatige Reise, um den Kindern ein wenig gesellschaftlichen Schliff beizubringen, wovon Daphne heute noch zehrte. Ihre Anstellung als Dienstmädchen war dann allerdings zu einem Fiasko geworden – genau wie langfristig Helens Ehe. Beide Frauen fanden sich in unerträglichen Verhältnissen wieder, aber beide hatten das Beste daraus gemacht.
Nun sahen sie auf, als sie Elaines Schritte auf der hinteren Terrasse hörten. Helen hob ihr schmales, von tiefen Falten durchzogenes Gesicht, dessen spitze Nase die Verwandtschaft mit Elaine verriet. Ihr Haar, ursprünglich dunkelbraun mit kastanienfarbenem Schimmer, war inzwischen von grauen Strähnen durchzogen, aber immer noch lang und kräftig. Helen steckte es meist zu einem großen Knoten im Nacken auf. Ihre grauen Augen leuchteten lebensklug und immer noch neugierig – vor allem jetzt, da sie den strahlenden Ausdruck auf Elaines Gesicht bemerkte.
»Nanu, Kind! Du sieht aus, als hättest du eben ein Weihnachtsgeschenk bekommen. Gibt’s was Neues?«
Daphne, deren katzenartige Züge selbst dann ein wenig hart wirkten, wenn sie lächelte, schätzte Elaines Ausdruck weniger unschuldig ein. Sie hatte ihn auf den Gesichtern Dutzender leichter Mädchen gesehen, die meinten, unter ihren Freiern den Märchenprinzen gefunden zu haben. Und dann hatte Daphne jedes Mal lange Stunden damit verbracht, die Mädchen zu trösten, wenn der Traumprinz sich schließlich doch als Frosch oder gar als widerwärtige Kröte erwies. In Daphnes Gesicht spiegelte sich deshalb Wachsamkeit, als Elaine jetzt so vergnügt auf sie zukam.
»Wir haben einen neuen Gast!«, erklärte sie eifrig. »Einen Goldsucher aus Irland.«
Helen runzelte die Stirn. Daphne lachte, und ihre leuchtend grünen Augen blitzten spöttisch.
»Hat der sich nicht verlaufen, Lainie? Irische Goldsucher landen sonst eher bei meinen Mädchen.«
Elaine schüttelte heftig den Kopf. »Es ist nicht so einer … Verzeihung, Miss Daphne, ich meine …« Sie verhaspelte sich. »Er ist ein Gentleman … glaube ich.«
Die Falten auf Helens Stirn wurde noch tiefer. Mit Gentlemen hatte sie so ihre Erfahrungen.
»Schätzchen«, sagte Daphne lachend, »irische Gentlemen gibt es nicht. Alles, was da von Adel ist, kommt ursprünglich aus England, denn die Insel ist seit Urzeiten in englischem Besitz – ein Umstand, über den die Iren immer noch heulen wie Wölfe, wenn sie ein paar Gläser getrunken haben. Die meisten irischen Clanvorsteher wurden abgesetzt und von englischen Adligen verdrängt. Und die tun seitdem nichts anderes, als sich an den Iren zu bereichern. Zuletzt ließen sie ihre Pächter zu Tausenden verhungern. Echte Gentlemen! Aber dazu dürfte dein Goldsucher kaum gehören. Die hängen an ihrer Scholle.«
»Woher wissen Sie denn so viel über Irland?«, erkundigte Elaine sich neugierig. Die Besitzerin des Freudenhauses faszinierte sie, aber leider hatte sie nur selten Gelegenheit, ausführlich mit ihr zu sprechen.
Daphne lächelte. »Süße, ich bin Irin. Zumindest auf dem Papier. Und wenn die Einwanderer bei mir ihren Moralischen kriegen, tröstet sie das ungemein. Ich hab sogar den Akzent geübt …« Daphne verfiel in breites Irisch, und jetzt lachte auch Helen. Tatsächlich war Daphne irgendwo im Londoner Hafenviertel geboren. Sie lebte allerdings unter dem Namen einer irischen Einwanderin. Bridie O’Rourke hatte die Überfahrt nicht überlebt, ihr Pass jedoch war über einen englischen Matrosen in die Hände der jungen Daphne geraten.
»Komm, Paddy, darfst mich Bridie nennen.«
Elaine kicherte.
»So redet er aber nicht … William, der neue Gast.«
»William?«, fragte Helen indigniert. »Der junge Mann hat sich mit dem Vornamen vorgestellt?«
Elaine schüttelte rasch den Kopf, um ja keine Ressentiments gegen den neuen Mieter aufkommen zu lassen.
»Natürlich nicht. Ich hab’s auf dem Meldezettel gesehen. Er heißt Martyn. William Martyn.«
»Nicht gerade ein irischer Name«, bemerkte Daphne. »Kein irischer Name, kein Akzent … Wenn das mal alles mit rechten Dingen zugeht. Wenn ich Sie wäre, würde ich dem Knaben erst mal gründlich auf den Zahn fühlen, Miss Helen!«
Elaine warf ihr einen feindseligen Blick zu. »Er ist ein feiner Mann, das weiß ich! Er wird sogar sein Goldgräberwerkzeug bei uns im Laden kaufen …«
Der Gedanke tröstete sie. Wenn William in den Laden kam, würde sie ihn wiedersehen, egal, wie Grandma über ihn dachte.
»Das macht ihn natürlich zu einem Ehrenmann!«, spottete Daphne. »Aber kommen Sie, Miss Helen, lassen Sie uns über etwas anderes sprechen. Ich habe gehört, Sie bekommen Besuch aus Kiward Station. Ist es Miss Gwyn?«
Elaine hörte dem Gespräch noch ein Weilchen zu, zog sich dann aber zurück. Über den Besuch ihrer anderen Großmutter und ihrer Cousine war in den letzten Tagen schließlich schon ausgiebig geredet worden. Wobei Gwyneiras Stippvisite keine Sensation war. Sie besuchte ihre Kinder und Enkel öfter und war vor allem mit Helen O’Keefe eng befreundet. Wenn sie in ihrer Pension logierte, plauderten die Frauen oft nächtelang. Außergewöhnlich war eher, dass Gwyn diesmal von Elaines Cousine Kura begleitet werden sollte. Das war bisher noch nie vorgekommen, und es schien ein bisschen … ja, skandalumwittert! Elaines Mutter und Großmutter senkten meist die Stimmen, wenn es um dieses Thema ging, und sie hatten die Kinder auch Gwyneiras Brief nicht lesen lassen. Kura schien sich sonst nämlich nicht viel aus Reisen zu machen, zumindest nicht zu ihrer Verwandtschaft nach Queenstown.
Elaine kannte Kura kaum, obwohl die beiden im gleichen Alter waren. Kura war gerade ein gutes Jahr jünger als Elaine. Trotzdem hatten die Mädchen sich bei Elaines seltenen Besuchen auf Kiward Station nie viel zu sagen gehabt. Die Unterschiede im Wesen der beiden waren einfach zu groß. So hatte Elaine nichts anderes im Kopf als Reiten und Schafe zu treiben, sobald sie Kiward Station erreichte. Die Weite des endlosen Graslandes und die Aberhunderte von Wolllieferanten, die darauf grasten, faszinierten sie. Hinzu kam, dass ihre Mutter Fleurette auf der Farm richtiggehend aufblühte. Es war aufregend für sie, mit Elaine um die Wette zu reiten, in Richtung der schneebedeckten Gipfel der Alpen, die trotz des verwegenen Galopps keinen Zoll näher zu rücken schienen.
Kura dagegen saß am liebsten im Haus oder im Garten und hatte nur Augen für das neue Klavier, das mit einem Warentransport für die O’Keefes von England nach Christchurch gekommen war. Elaine hatte sie deshalb für ein reichlich dummes Ding gehalten; aber natürlich war sie damals erst zwölf Jahre alt gewesen. Und sicher spielte auch der Neid eine Rolle. Kura war die Erbin von Kiward Station. Ihr würden einmal all die Pferde, Schafe und Hunde gehören – und sie wusste es kein bisschen zu schätzen!
Nun, inzwischen war Elaine sechzehn und Kura fünfzehn. Bestimmt gab es mittlerweile mehr Gemeinsamkeiten zwischen den Mädchen, und diesmal würde Elaine der Cousine ihre Welt zeigen können! Sicher gefiel ihr die quirlige kleine Stadt Queenstown am Lake Wakatipu, die den Bergen so viel näher war als die Canterbury Plains und die sehr viel aufregender war, mit den vielen Goldsuchern aus aller Herren Länder und einem Pioniergeist, der sich nicht auf pures Überleben beschränkte. Queenstown hatte eine florierende Laientheatergruppe unter Leitung des Pfarrers, es gab Squaredance-Gruppen, und ein paar Iren hatten sich zu einer Band zusammengeschlossen und spielten im Pub oder im Gemeindezentrum Irish Folk.
Elaine überlegte, dass sie das auch William unbedingt einmal erzählen musste – vielleicht hatte er ja Lust, mit ihr zum Tanz zu gehen! Jetzt, da sie die skeptischen Damen im Garten verlassen hatte, kehrte das verklärte Leuchten in Elaines Gesicht zurück. Hoffnungsvoll begab sie sich erneut an die Rezeption. Vielleicht kam William ja noch einmal vorbei …
Zunächst allerdings erschien Grandma Helen. Sie dankte Elaine freundlich für die Vertretung und gab ihr damit zu verstehen, dass ihre Anwesenheit nicht länger vonnöten war. Inzwischen wurde es fast schon dunkel – sicher ein Grund, weshalb Helen und Daphne ihr Treffen nicht weiter ausdehnten. Gegen Abend öffnete der Pub, und Daphne musste dort nach dem Rechten sehen. Helen drängte es, einen Blick auf die Anmeldung des neuen Gastes zu werfen, der einen so nachhaltigen Eindruck auf ihre Enkelin gemacht hatte.
Daphne, bereits im Aufbruch, schaute ihr dabei über die Schulter.
»Er kommt von Martyn’s Manor … hört sich nobel an«, meinte sie. »Also doch ein Gentleman?«,
»Das werde ich sehr schnell herausfinden«, erklärte Helen resolut.
Daphne nickte und lächelte in sich hinein. Dem jungen Mann standen inquisitorische Befragungen bevor. Für emotionale Beziehungen hatte Helen wenig Gespür.
»Und passen Sie auf die Kleine auf!«, bemerkte Daphne deshalb noch im Hinausgehen. »Die ist diesem irischen Wunderknaben nämlich schon verfallen, und das kann Folgen haben. Gerade bei Gentlemen.«
Zu Helens Verwunderung fiel die Begutachtung ihres neuen Gastes aber gar nicht so negativ aus. Im Gegenteil – als der junge Mann sich ihr erstmals zeigte, war er sauber gewaschen, rasiert und ordentlich gekleidet – auch Helen erkannte, dass sein Anzug aus bestem Tuch gefertigt war. Höflich erkundigte er sich, wo man hier zu Abend essen könne, und Helen bot ihm den Beköstigungsservice an, den sie für ihre Pensionsgäste bereithielt. Eigentlich musste man sich dazu anmelden, doch ihre eifrigen Köchinnen, Mary und Laurie, würden schon ein zusätzliches Essen zaubern. William fand sich also in einem geschmackvoll gestalteten Esszimmer an einem fein gedeckten Tisch wieder, gemeinsam mit einer etwas steifen jungen Dame, die als Lehrerin an der neu eröffneten Schule tätig war, sowie zwei Bankangestellten. Die Bedienungen irritierten ihn zunächst: Mary und Laurie, zwei fröhliche dralle Blondinen, entpuppten sich als Zwillinge, die William auch bei genauestem Hinsehen nicht auseinanderhalten konnte. Die anderen Gäste versicherten ihm jedoch lachend, das sei ganz normal. Lediglich Helen O’Keefe könnte Mary und Laurie auf einen Blick unterscheiden. Helen lächelte dabei. Sie wusste, dass Daphne es ebenfalls konnte.
Das gemeinsame Essen bot natürlich den idealen Rahmen, William Martyn auszuhorchen. Helen brauchte ihn nicht einmal selbst zu befragen, das besorgten schon die neugierigen anderen Gäste.
Ja, doch, er sei wirklich Ire, bestätigte William mehrmals und ein bisschen unwirsch, nachdem ihn auch die beiden Banker auf seinen fehlenden Akzent angesprochen hatten. Sein Vater habe eine Schafzucht in der Grafschaft Connemara. Diese Auskunft bestätigte die Annahme, die Helen gleich hegte, seit sie William das erste Mal hatte sprechen hören: Er war ein bestens erzogener junger Mann, dem man breites Irisch niemals hätte durchgehen lassen.
»Aber Sie sind englischstämmig, nicht wahr?«, erkundigte sich einer der Banker. Er stammte aus London und schien sich mit der irischen Frage ein wenig auszukennen.
»Die Familie meines Vaters kam vor zweihundert Jahren aus England!«, erklärte William gereizt. »Wenn Sie da noch von Einwanderern reden wollen …«
Der Banker hob beschwichtigend die Hände. »Schon gut, mein Freund! Wie ich sehe, sind Sie Patriot. Was hat Sie denn von der grünen Insel fortgetrieben? Ärger über die Sache mit der Home Rule Bill? Es war zu erwarten, dass die Lords das abschmettern. Aber wenn Sie doch selbst …«
»Ich bin kein Großgrundbesitzer«, bemerkte William eisig. »Geschweige denn ein Earl. Es mag sein, dass mein Vater in gewisser Hinsicht mit dem House of Lords sympathisiert, aber …« Er biss sich auf die Lippen. »Verzeihen Sie, das gehört nicht hierher.«
Helen beschloss, das Thema zu wechseln, bevor dieser Heißsporn noch heftiger reagierte. Was sein Temperament anging, war er zweifellos Ire. Obendrein hatte er sich mit seinem Vater überworfen. Gut möglich, dass dies ein Grund für das Auswandern war.
»Und nun wollen Sie Gold suchen, Mr. Martyn?«, erkundigte sie sich beiläufig. »Haben Sie schon einen Claim abgesteckt?«
William zuckte die Schultern. Er wirkte mit einem Mal sehr unsicher.
»Nicht direkt«, erwiderte er verhalten. »Mir wurden ein paar Stellen avisiert, die vielversprechend sind, aber ich kann mich nicht entscheiden …«
»Sie sollten sich einen Partner suchen«, riet der ältere der beiden Banker. »Am besten einen erfahrenen Mann. Es sind doch genug Veteranen auf den Goldfeldern, die schon beim Goldrausch in Australien dabei gewesen sind.«
William schürzte die Lippen. »Was soll ich mit einem Partner, der seit zehn Jahre schürft und immer noch nichts gefunden hat? Diese Erfahrung kann ich mir sparen.« Seine hellblauen Augen blitzten verächtlich.
Die Banker lachten. Helen dagegen fand Williams herrische Attitüde eher unpassend.
»Ganz Unrecht haben Sie nicht«, meinte der ältere Banker schließlich. »Aber hier macht kaum einer ein Vermögen. Wenn Sie einen ernsthaften Rat wollen, junger Mann: Vergessen Sie die Goldsucherei. Unternehmen Sie lieber etwas, von dem Sie was verstehen. Neuseeland ist ein Paradies für Gründer. Praktisch jeder normale Beruf verspricht mehr Einkommen als die Goldgräberei.«
Fragt sich nur, ob dieser Jüngling einen vernünftigen Beruf erlernt hat, dachte Helen. Ihr erschien er bisher als zwar ordentlich erzogener, aber ziemlich verwöhnter Spross aus reichem Hause. Man würde ja sehen, wie er reagierte, wenn er sich bei der Goldsuche die ersten Blasen an den Fingern holte.
2
»Was macht ihr denn hier?«
James McKenzies ohnehin gereizte Stimmung entlud sich über seinem Sohn Jack und dessen zwei Freunde Hone und Maaka. Die drei hatten einen Korb an einem der Cabbage Trees befestigt, die der Auffahrt zum Herrenhaus von Kiward Station ein exotisches Flair verliehen, und übten sich im zielsicheren Bällewerfen. Jedenfalls bis Jacks Vater erschien, dessen verärgerte Miene die Jungen innehalten ließ.
Sie verstanden gar nicht, warum er sie so heftig anging. Gut, der Gärtner wäre vielleicht nicht begeistert von der Umgestaltung der Auffahrt zum Spielplatz. Schließlich machte es große Mühe, den hellen Kies gleichmäßig zu harken und die Blumenrabatten zu pflegen. Auch Jacks Mutter legte Wert auf eine repräsentative Gestaltung der Front von Kiward Station, und sie mochte unwillig reagieren, wenn sie hier einen Basketballkorb und zertretenes Gras sah. Doch Jacks Vater waren solche Äußerlichkeiten im Grunde ziemlich gleichgültig. Die Jungs hätten eher erwartet, dass er den Ball auffing, der eben vor seinen Füßen gelandet war, und ebenfalls einen Korbwurf versuchte.
»Solltet ihr um diese Zeit nicht in der Schule sein?«
Ah, daher wehte der Wind! Erleichtert strahlte Jack seinen Vater an.
»Eigentlich schon, aber Miss Witherspoon hat uns frei gegeben. Sie muss noch packen und so … für die Reise. Dabei wusste ich gar nicht, dass sie mitfährt.«
Den Gesichtern der Jungen – sowohl Jacks sommersprossigen Zügen als auch den breiten braunen Gesichtern der Maori-Jungs – war die Freude anzusehen, dass ihnen damit offensichtlich weitere freie Tage vergönnt sein würden. James dagegen stand kurz vor der Explosion. Heather Witherspoon, die junge Erzieherin, bot ein weitaus gefälligeres Ziel für seinen Zorn als die drei Basketballspieler.
»Das ist mir allerdings auch neu!«, grollte McKenzie. »Ihr solltet euch keine voreiligen Hoffnungen machen. Der Dame werde ich die Reisepläne sehr schnell austreiben!«
Er hob den Ball jetzt wirklich auf, warf ihn zum Korb und landete zu seiner eigenen Verblüffung einen Volltreffer.
Monday, seine Hündin, die ihm überall auf dem Fuße folgte, sprang aufgeregt nach dem Ball. Jack hatte Mühe, ihr zuvorzukommen. Nicht auszudenken, wenn sie den echten Basketball zerbiss, dem er wochenlang entgegengefiebert hatte, bis er endlich aus Amerika geliefert worden war. Christchurch, von Kiward Station aus gesehen die nächste größere Ansiedlung, mauserte sich zwar langsam zu einer richtigen Stadt, doch eine Basketballmannschaft gab es noch nicht.
James grinste seinen Sohn an, während Monday dem Ball mit einem ebenso beleidigten wie begehrlichen Blick in ihrem hübschen, dreifarbigen Collie-Gesicht nachsah.
Jack rief die Hündin zu sich, streichelte sie und erwiderte James’ Lächeln erleichtert. Offensichtlich war alles wieder in Ordnung. Vater und Sohn hatten selten Streit; sie waren einander nicht nur wie aus dem Gesicht geschnitten – lediglich den Rotstich seines Haares und die Neigung zu Sommersprossen hatte Gwyneira ihrem Sohn vererbt –, sondern auch charakterlich ähnlich. Schon als ganz kleiner Junge folgte Jack seinem Vater wie die Welpen seiner Hütehunde durch die Ställe und Scherschuppen, saß vor ihm im Sattel, wobei es ihm gar nicht schnell genug gehen konnte, und balgte sich mit den Hunden im Stroh. Inzwischen war der Dreizehnjährige durchaus schon eine Hilfe auf der Farm. Beim letzten Abtrieb der Schafe von den Sommerweiden hatte er erstmals mitreiten dürfen und war unbändig stolz darauf, hier »seinen Mann« zu stehen. James und Gwyneira McKenzie ging es ebenso. Beide waren jeden Tag aufs Neue glücklich über das Wunder dieses spät geborenen Kindes. Hatte doch keiner von ihnen mehr an Kinder gedacht, als sie sich nach endlosen Jahren der unglücklichen Liebe, der Trennungen, Missverständnisse und widrigen Umstände endlich das Jawort gaben. Gwyneira hatte ihr vierzigstes Lebensjahr damals bereits überschritten, und kein Mensch rechnete noch mit einer weiteren Schwangerschaft. Der kleine Jack hatte sich allerdings nicht darum gekümmert, sondern es fast etwas zu eilig gehabt: Sieben Monate nach der Hochzeit erblickte er das Licht der Welt, nach einer völlig unproblematischen Schwangerschaft und verhältnismäßig leichten Geburt.
Trotz seiner gereizten Stimmung, die ihn die Auffahrt zum Haus jetzt in langen Schritten erklimmen ließ, lächelte James zärtlich beim Gedanken an Jack. Alles, was mit diesem Kind zu tun hatte, war einfach: Jack war unkompliziert, aufgeweckt, schlug bei der Farmarbeit hervorragend ein und wäre wohl auch ein sehr guter Schüler gewesen, wenn diese Miss Witherspoon sich nur ein kleines bisschen angestrengt hätte!
James runzelte die Stirn. Schon der Gedanke an die junge Lehrerin, die Gwyneira zwei Jahre zuvor vor allem für ihre Enkelin Kura ins Haus geholt hatte, ließ seine Wut wieder aufflammen. Wobei er seiner Frau keinen Vorwurf machte: Kura-maro-tini, die Tochter ihres Sohnes aus erster Ehe und dessen Maori-Frau Marama, benötigte dringend eine Erzieherin von außerhalb. Gwyneira – erst recht ihrer Mutter Marama – war das Mädchen längst über den Kopf gewachsen. Dazu war zumindest Gwyn nicht gerade die begnadetste Pädagogin. So viel Geduld sie mit Pferden und Hunden aufbrachte, so schnell verlor sie die Nerven, wenn sie jemanden beim ungelenken Zeichnen von Buchstaben beaufsichtigen sollte. Marama war da gelassener, doch sie hatte zwei Jahre zuvor wieder geheiratet und daher andere Interessen. Außerdem hatte sie selbst nur Helens improvisierte Schule im »Busch« besucht – und für die Erbin von Kiward Station wünschte Gwyneira sich denn doch eine umfassendere Bildung.
Heather Witherspoon schien die ideale Wahl gewesen zu sein – auch wenn James argwöhnte, dass Gwyn sich vor allem deshalb für diese Gouvernante entschieden hatte, weil ihr Vorname »Heather« ein bisschen wie »Helen« klang. James hätte Gwyneira jederzeit zugetraut, die komplette Mannschaft für eine Schererkolonne zusammenzustellen. Aber was die Beurteilung der Qualifikation von Lehrpersonal anging, fehlten ihr die Kenntnisse und das Interesse. Die Entscheidung war denn auch schnell und flüchtig gefallen – und nun hatten sie diese Heather am Hals, die zwar sicher hochgebildet war, aber im Grunde selbst noch ein halbes Kind, nicht minder verwöhnt als ihr Zögling Kura. James hätte sich längst wieder von ihr getrennt; heute war es nicht mehr so, dass eine Passage nach Neuseeland eine Reise fürs Leben sein musste. Seit es Dampfschiffe gab, war die Überfahrt kürzer und sicherer. Binnen acht Wochen hätte Miss Witherspoon ihre Talente wieder in England entfalten können. Damit hätte man jedoch gegen den ausdrücklichen Willen Kura-maro-tinis gehandelt, die sich gleich mit ihrer neuen Gouvernante angefreundet hatte. Und einen Wutanfall dieses Kindes hätten weder Gwyneira noch Marama riskiert!
James knirschte vor Zorn mit den Zähnen, während er seinen Mantel im Eingangsbereich des Hauses ablegte. Ursprünglich war es die Diele eines noblen Empfangszimmers gewesen, mit einer Silberschale auf einem kleinen Beistelltisch zum Ablegen von Visitenkarten. Inzwischen hatte Gwyneira das Schälchen längst entfernt. Sowohl sie als auch die Maori-Hausmädchen empfanden es als überflüssig, ständig das Silber zu putzen. Stattdessen stand dort nun eine Blumenvase mit Zweigen des einheimischen Rata-Strauches und machte den Raum heimelig.
James konnte der Anblick an diesem Tag allerdings nicht besänftigen; nach wie vor hegte er Groll auf die junge Lehrerin. Seit nun schon zwei Jahren schauten die McKenzies zu, wie Miss Witherspoon ihre Pflichten gegenüber Jack und den anderen Kindern sträflich vernachlässigte! Dabei sah ihr Vertrag ausdrücklich vor, dass sie neben den Privatstunden für Kura auch für die grundlegende Bildung der Kinder im Maori-Dorf zu sorgen hatte. Sie sollte dort täglich Unterricht halten. Jack hätte es nichts ausgemacht und Kura ganz sicher nichts geschadet, an den Stunden teilzunehmen. Doch Heather Witherspoon drückte sich darum, so oft sie nur konnte. Die erwachsenen Eingeborenen, sagte sie, machten ihr Angst und deren Kinder könne sie nicht leiden. Wenn sie sich trotzdem dazu herabließ, Unterricht zu erteilen, richtete sie die Unterrichtsinhalte ganz auf das Mädchen Kura aus – was die meisten Kinder im Dorf überforderte und somit langweilte. Heather Witherspoon las zum Beispiel ausschließlich reine Mädchenbücher, vorzugsweise solche, in denen kleine Prinzessinnen geduldig das Schicksal eines Aschenputtels durchlitten, bis sie endlich für all ihre guten Taten belohnt wurden. Den Maori-Mädchen sagte das gar nichts. Es war ihrer Wirklichkeit völlig fremd, und Heather unternahm keine Anstrengungen, es ihnen näherzubringen. Die Maori-Jungen trieb es schier zum Wahnsinn: Duldsame Prinzessinnen interessierten sie nicht. Sie wollten Geschichten über Piraten, Ritter und Abenteurer hören.
James warf einen raschen Blick in das einstige Empfangszimmer, das Gwyneira nun als Büro diente. Seine Frau war nicht anwesend, deshalb durchquerte er den mit teuren englischen Möbeln eingerichteten Salon, noch immer vor sich hin grummelnd. Konnte diese Miss Witherspoon nicht einmal die »Schatzinsel« vorlesen oder die Geschichten über Robin Hood oder Ritter Lancelot, die Fleurette und Ruben in ihrer Kindheit so entzückt hatten?
Aus dem früheren Herrenzimmer – nunmehr in eine Art Schul- und Musikzimmer umgewandelt – drang Klaviermusik in den Salon. James schaute auch hier kurz hinein, denn theoretisch war es ja möglich, dass sein Opfer Kura gerade eine Stunde erteilte. Doch das Mädchen saß allein vor ihrem vergötterten Klimperkasten und spielte selbstvergessen Beethoven. Im Grunde hatte James nichts anderes erwartet. Es war typisch für Kura, ihrer Großmutter und ihrer Gouvernante sämtliche Reisevorbereitungen zu überlassen, während sie selbst ihren Vergnügungen nachging. Später beschwerte sie sich dann darüber, dass man nicht die richtigen Kleider eingepackt hatte.
James ließ die Tür wieder zufallen, ohne das schlanke, schwarzhaarige Mädchen anzusprechen. Er hatte keinen Blick für Kuras auffallende Schönheit, die sonst eigentlich jeder rühmte, der dieses exotisch anmutende Geschöpf zum ersten Mal sah. Besonders seit Kura zur Frau heranreifte, stockte den Betrachtern oft der Atem. James McKenzie sah nach wie vor nur das Kind in ihr – ein verzogenes Kind, dessen Launen seine Familie und die Hausangestellten von Kiward Station oft zur Verzweiflung trieben.
James stieg die breite Treppe hinauf, die das Obergeschoss mit den Gesellschafts- und Wirtschaftsräumen im unteren Trakt verband, als er aus Kuras Zimmern zornige Stimmen hörte. Gwyneira und Miss Witherspoon. James grinste. Anscheinend war seine Frau ihm zuvorgekommen.
»Nein, Miss Heather, Kura braucht Sie keineswegs. Sie wird durchaus ein paar Wochen ohne Gesangsstunden auskommen – zumal ich mich ohnehin nicht erinnern kann, Sie als Gesangslehrerin angestellt zu haben. Sie jammern doch sowieso dauernd, dass Sie Kura hier kaum noch etwas beibringen können! Und was die Klavierstunden und die sonstige Bildung angeht … wenn Kura wirklich ohne das alles, wie Sie sagen, vertrocknet wie eine Blüte in der Wüste, wird meine Freundin Helen einspringen. Helen hat in ihrem Leben mehr Kindern das ABC beigebracht, als Sie sich vorstellen können, und sie spielt seit Jahren in der Kirche die Orgel.«
James lächelte in sich hinein. Gwyneira verstand sich fabelhaft darauf, Leute abzukanzeln. Er hatte das oft am eigenen Leib erfahren müssen – und war immer hin und her gerissen zwischen Zorn und Bewunderung. Allein schon, wie Gwyn sich bei einer Schimpftirade vor ihm aufzubauen pflegte! Sie war eher klein und sehr schlank, aber ungemein energisch. Wenn sie wütend war, schien sich ihr rotes Haar elektrisch aufzuladen, und ihre aufregend azurblauen Augen sprühten Funken. Nach wie vor sah man ihr auch ihr Alter nicht an. Zwar versuchte sie neuerdings, ihre Locken in einem Knoten zu bändigen, statt sie wie früher einfach im Nacken zusammenzubinden, aber ein paar Strähnen schafften es immer, sich zu befreien. Natürlich hatten die Jahre ein paar Fältchen in ihr Gesicht gegraben. Gwyn hatte nie viel von Sonnenschirmen gehalten, ebenso wenig von Regenschutz – sie setzte ihre Haut seit jeher ungeschützt der Natur der Canterbury Plains aus. Doch James hätte nicht eins ihrer Lachfältchen missen wollen oder die steile Falte, die sich zwischen ihren Augen bildete, wenn sie verärgert war, so wie jetzt.
»Nichts aber!«
Heather Witherspoon musste etwas erwidert haben, das James entgangen war.
»Der Platz, an dem Sie wirklich gebraucht werden, Miss Heather, ist hier! Einige Maori-Kinder können noch immer nicht lesen und schreiben. Und mein Sohn könnte eine altersgemäßere Förderung brauchen. Also packen Sie das Zeug wieder aus, und begeben Sie sich an Ihre eigentliche Arbeit. Die Kinder sollten jetzt Schule haben. Stattdessen spielen sie draußen Ball!«
Das war Gwyn also auch nicht entgangen. James applaudierte ihr, als sie jetzt aus dem Zimmer rauschte.
Gwyneira erschrak über ihren Zusammenstoß; dann lachte sie ihn an.
»Was machst du denn hier? Warst du auch auf dem Kriegspfad? Die Eigenmächtigkeiten unserer Miss Heather sind wirklich die Höhe!«
James nickte. Wie stets besserte sich seine Laune, wenn Gwyneira bei ihm war. Inzwischen waren sie seit sechzehn Jahren kaum einen Tag getrennt gewesen, aber ihr Anblick machte ihn immer noch glücklich. Umso schlimmer, dass er sie jetzt, möglicherweise für Wochen, nicht um sich haben würde.
Gwyneira merkte ihm die Verstimmung sofort an.
»Was ist los mit dir? Du rennst schon den ganzen Tag mit einer Miene herum wie drei Tage Regenwetter! Passt es dir nicht, dass wir wegfahren?«
Gwyneira wollte ihrem Mann zunächst die Treppe herab folgen, hörte dann aber Kuras Klavierspiel. Beide bogen wie auf ein unsichtbares Kommando in Richtung ihrer Privaträume ab. Im Salon mochten die Wände Ohren haben.
»Ob es mir ›passt‹, ist wohl kaum von Belang«, meinte James mürrisch. »Ich weiß einfach nicht, ob diese Reise das Richtige ist …«
»Um Kura in den Griff zu kriegen?«, fragte Gwyn. »Leugne es nicht. Ich hab gehört, wie du im Stall mit Andy McAran darüber gesprochen hast. Nicht gerade diskret, wenn du mich fragst …«
Gwyneira nahm ein paar Sachen aus ihrem Schrank und packte sie in einen Koffer. Ihre Reise, so signalisierte sie damit, war beschlossene Sache. James’ Unbehagen wuchs zu echtem Zorn aus.
»Es war Andys Ausdruck. Wenn du’s genau wissen willst, sagte er: ›Ihr müsst sehen, dass ihr die Kleine in den Griff kriegt, sonst verkuppelt Tonga sie mit dem nächsten Maori-Bengel, der ihm hörig ist.‹ Wie hätte ich da deiner Ansicht nach reagieren sollen? Andy McAran entlassen? Wo er nichts anderes sagt als die Wahrheit?«
Andy McAran gehörte zu den ältesten Arbeitern auf Kiward Station. Ebenso wie James war Andy schon hier gewesen, bevor Gwyneira als Braut des Hoferben, Lucas Warden, nach Neuseeland geschickt worden war. Zwischen Andy, James und Gwyn gab es eigentlich keine Geheimnisse.
Gwyneira behielt ihren provozierenden Tonfall somit auch nicht bei. Stattdessen ließ sie sich mutlos auf der Kante ihres Bettes nieder. Monday schmiegte sich sofort an ihre Beine, um gekrault zu werden.
»Was sollen wir denn sonst tun?«, fragte sie, die Hündin streichelnd. »›In den Griff kriegen‹ hört sich einfach an, aber Kura ist kein Hund oder ein Pferd. Ich kann ihr nicht einfach befehlen …«
»Gwyn, deine Hunde und Pferde haben dir immer gern gehorcht, auch ohne Gewalt. Weil du sie von Anfang an richtig erzogen hast. Liebevoll, aber konsequent. Nur Kura lässt du alles durchgehen! Und Marama war da auch nie eine Hilfe.« James hätte seine Frau gern in die Arme genommen, um seinen Worten die Schärfe zu nehmen, überlegte es sich dann aber anders. Es wurde Zeit, dass die Sache ernsthaft zur Sprache kam.
Gwyneira biss sich auf die Lippen. Sie konnte es nicht leugnen. Niemand hatte Kura-maro-tini, der Erbin von Kiward Station und Hoffnungsträgerin sowohl des örtlichen Maori-Stammes als auch der weißen Gründer der Farm, jemals wirklich Grenzen gesetzt. Weder von den Maoris, die ihre Kinder ohnehin nicht streng erzogen, sondern ihre Disziplinierung getrost dem Land überließen, in dem sie überleben mussten, noch von Gwyneira, die es eigentlich besser hätte wissen müssen. Schließlich hatte sie schon bei ihrem Sohn Paul, Kuras Vater, allzu sehr die Zügel schleifen lassen. Aber das war etwas anderes gewesen. Paul entstammte einer Vergewaltigung; Gwyneira hatte ihn nie wirklich lieben können. Das Ergebnis waren erst ein schwieriges Kind und dann ein zorniger, streitsüchtiger junger Mann gewesen, dessen Fehde mit dem Maori-Häuptling Tonga ihm schließlich den Tod gebracht hatte. Tonga, intelligent und gebildet, triumphierte letztendlich mit einem Beschluss des Gouverneurs: Der Ankauf des Landes für Kiward Station war nicht rechtens gewesen. Wollte Gwyneira die Farm behalten, müsste sie die Ureinwohner entschädigen. Doch Tongas Forderungen waren unannehmbar gewesen. Erst Marama hatte schließlich den Friedensschluss erwirkt. Ihr Kind, von pakeha- und Maori-Blut, sollte Kiward Station erben, und das Land würde somit allen gehören. Niemand machte den Maoris das Recht streitig, hier zu lagern, andererseits würde Tonga keinen Anspruch auf das Kernland der Farm erheben.
Gwyneira und die meisten Mitglieder des Maori-Stammes waren mit dieser Regelung mehr als zufrieden – nur in dem jungen Häuptling schwelte immer noch der Zorn auf die pakeha, die verhassten weißen Siedler. Paul Warden war zeitlebens sein Rivale gewesen, nicht nur um den Landbesitz, sondern auch um das Mädchen Marama. Nach Pauls Tod hatte Tonga sicher gehofft, die schöne junge Frau würde sich ihm nach einer angemessenen Trauerzeit doch noch zuwenden. Aber zunächst suchte Marama gar keinen neuen Partner, sondern zog ihr Kind im Herrenhaus auf. Und dann entschied sie sich nicht für Tonga oder einen anderen Mann aus seinem Stamm, sondern verliebte sich Hals über Kopf in einen Schafscherer, der im Frühjahr mit seiner Kolonne nach Kiward Station kam. Dem jungen Mann ging es mit ihr nicht anders, und die beiden wurden sich schnell einig. Rihari war ebenfalls Maori, gehörte aber einem anderen Stamm an. Trotzdem entschloss er sich zu bleiben. Er war umgänglich und freundlich und erkannte Maramas außergewöhnliche Situation sofort: Weder konnte man ihre Tochter Kura von Kiward Station fortholen, noch würde sie ihm allein zu seinem Stamm nach Otago folgen. So bat er um Aufnahme bei ihren Leuten, was Tonga zähneknirschend gewährte. Das Paar lebte nun im Maori-Dorf; Kura war auf eigenen Wunsch im Herrenhaus geblieben.
Doch in letzter Zeit führte ihr Weg sie immer häufiger zu der Siedlung am See, wobei der Besuch bei ihrer Mutter nur vorgeschoben war. Kura hatte die Liebe entdeckt. Der junge Tiare machte ihr den Hof – und das leider nicht so unschuldig, wie es unter pakeha-Kindern im gleichen Alter üblich war.
Gwyneira, die einstmals die Verliebtheit ihrer Tochter Fleur und Ruben O’Keefe gelassen geduldet hatte, war jetzt alarmiert. Schließlich wusste sie um die lockere Sexualmoral der Maoris. Mann und Frau durften hier beliebig miteinander verkehren. Eine Ehe galt erst als geschlossen, wenn zwei im Gemeinschaftshaus des Stammes das Lager teilten. Was vorher geschah, war dem Stamm egal, und Kinder waren stets willkommen. Kura schien sich an diesen Sitten orientieren zu wollen – und Marama machte keine Anstalten einzuschreiten.
Gwyneira, James und alle anderen denkenden Menschen auf Kiward Station befürchteten allerdings Tongas Einflussnahme. Natürlich hoffte Gwyneira auf eine Eheschließung Kuras mit einem Weißen ihrer Gesellschaftsschicht – eine Sache, von der Kura vorerst nichts hören wollte. Die Fünfzehnjährige hatte sich in den Kopf gesetzt, Sängerin zu werden, und ihre außergewöhnlich schöne Stimme und ausgeprägte Musikalität boten sicher das Potenzial dafür. Doch eine Opernkarriere in diesem jungen Land, das obendrein puritanisch geprägt war? In Christchurch baute man erst mal eine Kathedrale, im restlichen Land Eisenbahnen … kein Mensch dachte an ein Theater für Kura Warden! Heather Witherspoon hatte Kura natürlich die Idee von Konservatorien in Europa in den Kopf gesetzt, von Opernhäusern in London, Paris und Mailand, die nur auf eine Sängerin ihres Kalibers warteten. Aber selbst wenn Gwyneira – und Tonga – dies befürwortet hätten: Kura war zur Hälfte Maori, eine exotische Schönheit, die jeder bewunderte, aber würde man sie ernst nehmen? Würde man sie als Sängerin sehen, nicht als Kuriosum? Wo würde das verwöhnte Kind landen, wenn Gwyneira es tatsächlich nach Europa schickte?
Tonga schien das Problem jetzt auf seine Weise lösen zu wollen. Nicht nur Andy McAran vermutete seine Fäden ziehende Hand hinter Kuras junger Liebe. Tiare war Tongas Cousin; eine Verbindung mit ihm hätte die Stellung der Maoris auf Kiward Station erheblich gestärkt. Und der Junge war erst sechzehn, dazu nach Gwyneiras Dafürhalten nicht der Klügste. Tiare als Herr auf Kiward Station, neben einer an allen Belangen der Farm desinteressierten, nur auf dem Klavier klimpernden Kura – für Tonga wäre das zweifellos der Höhepunkt seines Lebens, aber undenkbar für Gwyn.
»Es wird nichts helfen, Kura jetzt ein paar Wochen nach Queenstown zu schaffen«, meinte James. »Im Gegenteil. Da werden nur Dutzende von Goldsuchern vor ihr auf den Knien liegen. Sie wird in Komplimenten baden, jeder wird sie hinreißend finden – und am Ende hat sie noch mehr Oberwasser. Und wenn sie zurückkommt, ist Tiare immer noch da. Und falls du daran denkst, ihn hier irgendwie wegzuloben – Tonga findet einen anderen. So bringt das nichts, Gwyn.«
»Sie wird immerhin älter und verständiger«, wandte Gwyneira ein.
James verdrehte die Augen. »Gibt es dafür irgendwelche Anzeichen? Bis jetzt wird sie nur immer verrückter! Und diese Heather Witherspoon macht es auch nicht besser. Die würde ich als Erstes nach England zurückschicken, ob es der kleinen Prinzessin passt oder nicht.«
»Aber wenn Kura sich sturstellt, ist auch nichts gewonnen. Damit treiben wir sie den Maoris in die Arme …«
James hatte sich zu Gwyn aufs Bett gesetzt, und sie schmiegte sich trostsuchend an ihn.
»Dass das aber auch alles so schwer sein muss«, seufzte sie schließlich. »Ich wünschte, Jack wäre der Erbe, dann müssten wir uns keine Gedanken mehr machen.«
James zuckte die Achseln. »Die bräuchten wir uns auch nicht zu machen, wenn Fleurette die Erbin wäre. Aber nein, dieser Gerald Warden musste ja unbedingt noch einen männlichen Nachkommen zeugen, und sei es mit Gewalt. Es bereitet mir immerhin eine gewisse Genugtuung, dass er sich jetzt zweifellos im Grabe herumdreht! Sein Kiward Station nicht nur in der Hand eines halben Maori, sondern obendrein eines Mädchens!«
Gwyneira musste lächeln. Was Erbschaftsangelegenheiten anging, waren die Maoris jedenfalls entschieden vernünftiger. Hier hatte es keine Probleme gegeben, als Marama ein Mädchen zur Welt brachte; Männer und Frauen waren in der Erbfolge gleichberechtigt. Schade nur, dass Kura so völlig aus der Art schlug und von der tatkräftigen und weniger musisch als praktisch orientierten Gwyneira nicht mehr geerbt hatte als die azurblauen Augen.
»Jetzt nehme ich sie erst mal mit nach Queenstown«, sagte Gwyn schließlich entschieden. »Vielleicht kann Helen ihr ja den Kopf zurechtsetzen. Manchmal findet ein Außenstehender eher Zugang. Helen spielt immerhin Klavier. Die wird Kura ernst nehmen.«
»Und ich muss ohne dich zurechtkommen«, schmollte James. »Der Viehtrieb …«
Gwyneira lachte und legte ihm die Arme um den Hals. »Der Viehtrieb sollte dich ausgiebig beschäftigt halten. Jack freut sich schon darauf. Und du könntest Miss Heather mitnehmen – auf dem Küchenwagen. Vielleicht geht sie hinterher freiwillig!«
Es war März, und vor dem kommenden Winter mussten die halbwild lebenden Schafe im Bergland zusammengesucht und zurück zur Farm getrieben werden. Jedes Jahr eine mehrtägige Beschäftigung, die alle Arbeiter einer Farm in Anspruch nahm.
»Sei vorsichtig mit deinen Ratschlägen!« James streichelte ihr übers Haar und küsste sie zärtlich. Ihre Umarmung hatte ihn erregt. Und was war auch gegen ein bisschen Liebe am Vormittag einzuwenden? »Ich habe mich schon mal in eine Frau verliebt, die auf dem Küchenwagen mitfuhr!«
Gwyneira lachte. Auch ihr Atem ging jetzt schneller. Geduldig hielt sie still, während James die Haken und Ösen an ihrem leichten Sommerkleid löste.
»Aber nicht in eine Köchin«, erklärte sie. »Ich erinnere mich noch gut, wie du mich gleich am ersten Tag herausgeschickt hast, um versprengte Schafe einzutreiben.«
James küsste ihre Schulter, dann ihre immer noch recht festen Brüste.
»Das diente der Lebensrettung der Truppe«, bemerkte er lächelnd. »Nachdem wir deinen Kaffee probiert hatten, musste ich dich aus dem Weg schaffen …«
Während Gwyneira und James die ruhige Stunde genossen, begab sich Heather Witherspoon zu ihrem Zögling Kura. Sie traf das Mädchen am Klavier an – und würde ihr jetzt vom Beschluss ihrer Großmutter berichten müssen, die Lehrerin nicht mit nach Queenstown zu nehmen. Kura nahm es erstaunlich gelassen auf.
»Ach, sehr lange werden wir sowieso nicht bleiben«, bemerkte sie. »Was sollen wir bei diesen Hinterwäldlern? Wenn es noch Dunedin wäre. Aber dieses Goldgräberkaff? Und mit den Leuten da bin ich kaum verwandt. Fleurette ist so etwas wie meine Halbtante und Stephen, Elaine und George sozusagen meine Viertelcousins, oder? Was hab ich mit denen zu tun?«
Kura wandte ihr hübsches Gesicht wieder den Noten zu. Glücklicherweise stand auch in Queenstown ein Klavier, dessen hatte sie sich versichert. Und vielleicht verstand diese Miss Helen ja wirklich etwas von Musik, womöglich mehr als Miss Heather. Tiare würde sie sowieso nicht vermissen. Natürlich war es nett, sich von ihm bewundern, küssen und streicheln zu lassen, aber sie würde doch niemals riskieren, schwanger zu werden! Vielleicht hielt Grandma Gwyn sie ja für dumm, und Miss Heather lief sowieso immer gleich rot an, wenn es irgendwie um »Geschlechtliches« ging. Aber Kuras Mutter war nicht so prüde; das Mädchen wusste durchaus, wie Kinder entstanden. Und in einem war sie sich sicher: Von Tiare wollte sie keins. Im Grunde hielt sie nur deshalb an der Beziehung zu ihm fest, um Grandma Gwyn ein bisschen zu ärgern.
Wenn sie es recht bedachte, wollte Kura überhaupt keine Kinder. Das Erbe von Kiward Station war ihr herzlich egal. Sie war bereit, jeden und alles hinter sich zu lassen, wenn sie damit ihrem eigentlichen Ziel näherkam. Kura wollte Musik machen, sie wollte singen. Und egal, wie oft Grandma Gwyn das Wort »unmöglich« sagte – Kura-maro-tini würde an ihren Wünschen festhalten!
3
William Martyn hatte Goldwaschen bisher stets für eine ruhige, ja kontemplative Tätigkeit gehalten. Man hielt ein Sieb in einen Bach, schüttelte es ein wenig – und dann blieben Goldnuggets darin hängen. Vielleicht nicht gleich und jedes Mal, aber doch genug, um auf die Dauer Millionär zu werden. In Queenstowns Realität gestaltete sich die Sache jedoch ganz anders. Genau genommen hatte William überhaupt kein Gold gefunden, bis er sich mit Joey Teaser zusammengetan hatte. Und das, obwohl er sich für die hochwertigsten Gerätschaften aus dem O’Kay Warehouse entschieden und dabei erneut das Vergnügen genossen hatte, mit Elaine O’Keefe zu plaudern. Die Kleine hatte sich dabei vor Begeisterung kaum halten können, ihn wiederzusehen, und je länger dieser erste Tag des Goldschürfens mit Joey voranschritt, desto intensiver überlegte William, ob in der Bekanntschaft mit diesem Mädchen nicht vielleicht die wahre Goldader schlummerte. Sofern er überhaupt zum Überlegen kam. Joey, ein erfahrener Goldsucher von fünfundvierzig Jahren, der aber wie sechzig aussah und sein Glück vorher schon in Australien und an der Westküste versucht hatte, begutachtete Williams frisch abgesteckten Claim nur kurz, erklärte ihn für durchaus aussichtsreich und fing sofort an, Holz für den Bau einer Waschrinne zu schlagen. William hatte dabei ein wenig verwirrt dreingeschaut, worauf Joey ihm eine Säge in die Hand drückte und den Befehl erteilte, die Stämme zu Brettern zu schneiden.
»Kann man … kann man die Bretter nicht kaufen?«, erkundigte William sich unglücklich, nachdem der erste Versuch kläglich gescheitert war. Wenn sie tatsächlich eine zwanzig Meter lange Rinne selbst bauen wollten, wie Joey vorzuhaben schien, würden sie mindestens zwei Wochen brauchen, bevor das erste Gold darin hängen blieb.
Joey verdrehte die Augen. »Man kann alles kaufen, Junge, wenn man Geld hat. Aber haben wir welches? Ich zumindest nicht. Und du solltest deins auch zusammenhalten. Lebst sowieso auf ganz schön großem Fuß, mit deiner Pension und dem ganzen Kram, den du da gekauft hast …«
Neben den wichtigsten Gerätschaften zum Goldschürfen hatte William auch in eine ordentliche Campingausrüstung und ein paar Jagdwaffen investiert. Konnte schließlich sein, dass man hier auf dem Claim mal die Nacht verbringen musste – spätestens dann, wenn es Gold zu bewachen galt. Und dann wollte William sein Lager auf keinen Fall unter freiem Himmel aufschlagen.
»Hier jedenfalls haben wir Bäume, eine Axt und eine Säge. Da bauen wir die Waschrinne doch am besten selbst. Greif dir jetzt die Axt. Beim Umhauen von Bäumen kannst du nichts falsch machen. Ich nehme die Säge und mach die Feinarbeit!«
Seitdem fällte William Bäume, wenn auch nicht sonderlich schnell; er hatte gerade mal zwei mittelgroße Südbuchen geschafft. Aber die Arbeit war schweißtreibend. Während die Männer morgens noch beim Paddeln zu ihrem Claim gefröstelt hatten, schufteten sie jetzt, gegen zehn Uhr, schon mit bloßem Oberkörper. Und William konnte kaum glauben, dass nicht einmal der halbe Tag zu Ende war.
»Versuchen Sie es lieber mit einer Arbeit, die Ihnen wirklich liegt.« Die Bemerkung des Bankers ging William im Kopf herum. Zunächst hatte er das als Phrasendrescherei eines risikoscheuen Bürohengstes abgetan, aber jetzt erschien ihm das Leben eines Goldsuchers gar nicht mehr so abenteuerlich. Natürlich war man an der frischen Luft – und die Landschaft hier um Queenstown war fantastisch. Nachdem William seine erste Missstimmung überwunden hatte, kam er nicht umhin, das festzustellen. Allein die majestätischen Berge rund um den Lake Wakatipu, die das Land zu umarmen schienen, und das Farbenspiel, das die üppige Vegetation vor allem jetzt im Herbst in einem Kaleidoskop von Rot-, Lila-und Brauntönen aufgehen ließ. Die Pflanzen schienen teils exotisch wie der palmähnliche Cabbage Tree, teils seltsam verfremdet wie die violetten Lupinen, die der Gegend um Queenstown besonders um diese Jahreszeit ihre besondere Note gaben. Die Luft war klar wie Kristall, desgleichen die Bäche. Aber wenn William noch ein paar Tage mit Joey arbeiten sollte, würde er zweifellos bald anfangen, zumindest die Bäume und Wasserläufe zu hassen.
Joey entpuppte sich im Laufe des Tages als wahrer Sklaventreiber. Mal war William ihm zu langsam, mal machte er zu oft Pausen, und dann rief er ihn selbst von seiner Holzfällertätigkeit weg, weil er Hilfe beim Sägen brauchte. Und dazu fluchte er auf die unflätigste Weise, wenn etwas schiefging – was leider vor allem dann passierte, wenn William zur Säge griff.
»Aber das lernst du noch, Junge!«, meinte der Alte letztlich ermunternd, sobald er sich wieder beruhigt hatte. »Zu Hause haste wohl nicht so viel mit den Händen geschafft.«
William wollte ihm zunächst wütend widersprechen, aber dann überlegte er, dass der Alte damit nicht ganz Unrecht hatte. Gut, er hatte auf den Feldern gearbeitet. Zusammen mit den Pächtern, gerade in den letzten Jahren, nachdem ihm die schreiende Ungerechtigkeit aufgegangen war, die auf den Ländereien seines Vaters herrschte. Frederic Martyn verlangte viel und gab wenig – der Pachtzins war für die Bauern kaum aufzutreiben, und nicht nur, dass ihnen in guten Jahren wenig zum Leben blieb, sie hatten auch keinerlei Hilfe zu erwarten, wenn die Ernte schlecht ausfiel. Bis jetzt hatten die Familien sich kaum von der großen Hungersnot in den Sechzigerjahren erholt. Praktisch jede hatte Opfer zu beklagen. Dazu fehlte hier fast eine ganze Generation – kaum ein Bauernkind in Williams’ Alter hatte die Jahre der Kartoffelfäule überlebt. Heute lag die Arbeit auf den Feldern also hauptsächlich in den Händen der ganz Jungen und ganz Alten; praktisch jeder war überfordert, und eine Verbesserung schien nicht in Sicht.
Frederic Martyn berührte das in keiner Weise – und auch Williams Mutter, obwohl Irin, machte keine Anstalten, sich für die Leute einzusetzen. William hatte dann erst in stummem Protest begonnen, den Pächtern bei der Landarbeit zu helfen. Später engagierte er sich in der Irischen Landliga, die ihnen zu fairen Zinsen verhelfen wollte.
Frederic Martyn schien die soziale Attitüde seines jüngeren Sohnes zunächst eher unterhaltsam als besorgniserregend zu finden. William würde auf seinen Ländereien ohnehin nie viel zu sagen haben, und sein älterer Sohn, Frederic junior, zeigte keine menschenfreundlichen Anwandlungen. Doch als die Landliga erste Erfolge verbuchen konnte, wurden seine Spöttereien und Frotzeleien über Williams Engagement immer bösartiger und trieben den jungen Mann noch tiefer in die Opposition.
Als er schließlich einen Aufstand unter den Pächtern unterstützte – wenn nicht gar anzettelte –, kannte der Alte kein Pardon. William wurde nach Dublin geschickt. Sollte er ein bisschen studieren, wenn es sein musste Jura, um seinen geliebten Pächtern später mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Was das anging, war Martyn großzügig. Hauptsache, der Junge wiegelte ihm nicht mehr die Leute auf!
Zunächst hatte William sich begeistert in die Arbeit gestürzt, aber schon bald erschien es ihm zu langwierig, sich mit den Feinheiten des englischen Rechts auseinanderzusetzen, wo doch ohnehin bald eine Irische Verfassung zu entwerfen war. Aufgeregt verfolgte er die Debatten um die Home Rule Bill, die den Iren erheblich mehr Mitspracherechte bieten sollte, wenn es um die Belange ihrer Insel ging. Und als das Oberhaus sie dann wieder ablehnte …
Aber darüber wollte William nicht weiter nachgrübeln. Die Sache war zu peinlich gewesen und die Folgen fatal. Aber immerhin hätte es für ihn viel schlimmer enden können als hier in der lieblichen Umgebung des friedlichen Queenstown.
»Was haste überhaupt gemacht, drüben in Irland?«, fragte Joey jetzt. Die beiden hatten ihr Tagewerk endlich beendet und paddelten müde heimwärts. Auf William wartete das Badehaus und ein gepflegtes Nachtmahl in Miss Helens Pension – auf Joey ein whiskygeschwängerter Abend am Lagerfeuer der Goldgräberkolonie Skippers.
William zuckte die Achseln. »Auf einer Schaffarm gearbeitet.«
Im Wesentlichen entsprach das der Wahrheit. Das Land der Martyns war weitläufig und bot erstklassige Weidegründe. Deshalb hatte Frederic Martyn auch kaum Einbußen durch die Kartoffelfäule erlitten. Die betraf nur seine Pächter und Landarbeiter, die sich auf kleinen Anbauflächen selbst ernährten.
»Wolltste dann nich’ lieber in die Canterbury Plains?«, erkundigte Joey sich gemütlich. »Da gibt’s Millionen Schafe.«
Das hatte William auch gehört. Aber seine Anteile an der Farmarbeit hatten eigentlich eher Verwaltertätigkeiten beinhaltet als tatsächliches Zugreifen. Er wusste zwar theoretisch, wie man ein Schaf schor, aber tatsächlich hatte er es noch nie getan und erst recht nicht in Rekordzeit wie die Männer der Schererkolonnen in den Canterbury Plains. Die besten sollten achthundert Schafe am Tag von ihrer Wolle befreien! Das waren kaum weniger Tiere, als die Farm der Martyns insgesamt beherbergte! Andererseits hätte vielleicht mancher Farmer im Osten einen fähigen Verwalter oder Aufseher gebraucht – ein Job, den William sich durchaus zutraute. Nur reich werden konnte man dabei wohl kaum. Und bei allem sozialen Engagement: Auf die Dauer hatte William nicht vor, bei der Lebensqualität Abstriche zu machen!
»Vielleicht kauf ich mir ’ne Farm, wenn wir hier genug Gold gefunden haben«, meinte William. »So in ein, zwei Jahren …«
Joey lachte. »Sportsgeist haste jedenfalls! So, hier kannste aussteigen …« Er lenkte das Boot ans Ufer. Der Fluss schlängelte sich im Osten an Queenstown vorbei und mündete dann im Süden der Stadt, unterhalb des Goldgräberlagers, in den See. »Ich hol dich morgen wieder hier ab, sechs Uhr früh, frisch und munter!«