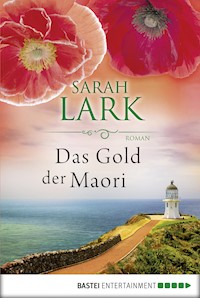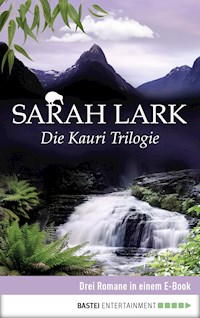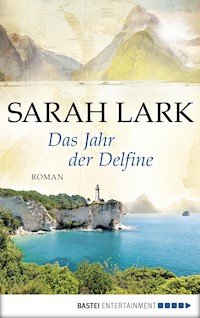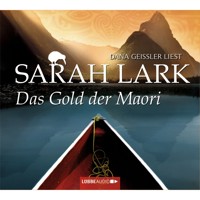Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Lübbe Audio
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Kauri-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Neuseeland, 1899: Lizzie und Michael verabschieden ihren Sohn nach Südafrika. Kevin, junger Mediziner und verwegener Reiter, zieht als Stabsarzt in den Burenkrieg. Für Roberta bricht damit eine Welt zusammen; sie ist entschlossen, für ihr gemeinsames Glück zu kämpfen - und ihr Wagemut ist dabei grenzenlos. Auch Matarikis Tochter Atamarie stellt sich einer großen Herausforderung: Sie schreibt sich als einziges Mädchen an der Universität für Ingenieurswissenschaften ein. Seit ihrer Kindheit faszinieren sie die Lenkdrachen der Maori. Das bringt sie mit dem Flugpionier Richard Pearce zusammen - und verlangt von ihr eine folgenschwere Entscheidung ...
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Zeit:7 Std. 54 min
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Danksagung
Stammbäume
Prolog
Geschenke der Götter
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Starke Frauen
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Um der Liebe willen
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Der Segen der Geister
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Der Zauberer von Oz
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Erwachen
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Die Rückkehr der Sterne
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Nachwort
Leseprobe – Die Insel der tausend Quellen
SARAH LARK
DIE TRÄNENDERMAORI-GÖTTIN
Roman
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Dieser Titel ist auch als Hörbuch erschienen
Originalausgabe
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen.
Copyright © 2012 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat: Melanie Blank-Schröder
Landkarten: Reinhard Borner
Umschlaggestaltung und Umschlagmotiv: Johannes Wiebel, punchdesign, München
E-Book-Produktion: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN 978-3-8387-1522-3
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
DANKSAGUNG
Wie immer haben an der Entstehung dieses Buches viele Menschen mitgewirkt, von meinem wunderbaren Agenten Bastian Schlück über meine nicht minder großartige Lektorin Melanie Blank-Schröder zu meiner hervorragenden Textredakteurin Margit von Cossart. Ohne sie würde ich mich im Zeitdickicht meiner Bücher hoffnungslos verstricken und auch schon mal verlaufen. Jahreszahlen und Himmelsrichtungen sind nicht mein Ding.
Vielen Dank auch meinen Testlesern und diesmal auch meinen Eltern und Freunden in Mojácar, die wochenlang mit einer gewissen geistigen Abwesenheit meinerseits leben mussten. Besonderen Dank meinem Hausmeisterehepaar Joan und Anna Puzcas – die neuerdings meine Bücher lesen können, da sie jetzt ja auch auf Spanisch erscheinen. Ohne euch ginge gar nichts, weder Lesereisen noch monatelanges Versinken in fremden Kulturen!
Und natürlich vielen, vielen Dank an alle Menschen, die helfen, dieses Buch an die Leser zu bringen, von der Marketingabteilung und dem Vertrieb bei Bastei Lübbe bis zu den Buchhändlern. Und den allergrößten Anteil am Erfolg von Sarah Lark haben natürlich die Leser selbst! In der letzten Zeit durfte ich viele von Ihnen kennenlernen und mich über persönlichen Kontakt freuen.
Sarah Lark
PROLOG
Neuseeland Parihaka
1894
Langsam senkte sich die Dämmerung über die Berge und die See. Die Sonne, die jetzt, im Winter, ohnehin nicht hoch am Himmel gestanden hatte, ließ sich gelassen ins Meer gleiten, während ihre letzten Strahlen den majestätischen Mount Taranaki in rotgoldenes Licht tauchten.
Die Spitze des Berges war schneebedeckt und bildete eine beeindruckende Kulisse für das Dorf Parihaka.
Wie ein Wächter, pflegte Atamaries Mutter zu sagen, wir freuen uns an seiner Schönheit und fühlen uns sicher in seinem Schatten.
Atamarie fand das manchmal ein bisschen befremdlich – schließlich lernte sie in der Schule, dass der Mount Taranaki ein Vulkan war und keineswegs ein friedlicher! Vor hundertfünfzig Jahren war er das letzte Mal ausgebrochen, und theoretisch konnte das jederzeit wieder passieren. Ihre Mutter winkte jedoch ab, wenn Atamarie ihr das vorhielt. Aber nein, Atamarie, die Götter werden jetzt Frieden halten, die Zeit der Kriege ist vorbei, sagte sie. Und dann erzählte sie Atamarie und den anderen Kindern die Legende rund um den Gott des Mount Taranaki, der sich mit einem anderen Berggott um die Liebe einer Waldgöttin stritt. Die Göttin Pihanga entschied sich schließlich für seinen Rivalen, und Taranaki zog sich nach dem Kampf mit den anderen Berggöttern verärgert an die Küste zurück. Damit kam der Krieg in ihre Welt und auch in die der Menschen. Aber es gab Hoffnung. Irgendwann würde Taranaki einlenken, und wenn die Götter sich dann wieder vertrugen, konnten auch die Menschen mit dauerhaftem Frieden rechnen.
Die meisten Kinder lauschten diesen Geschichten mit offenen Mündern und voller Ernst, aber Atamarie interessierte sich eigentlich mehr für die vulkanische Aktivität des Mount Taranaki und ihre Auswirkungen auf das Land. Ihre Lieblingsfächer in der Otago Girls’ School in Dunedin waren Mathematik, Physik und Geografie. Für romantische Geschichten war eher ihre Freundin Roberta zuständig.
Insofern hatte Atamarie auch an diesem Abend wenig Sinn für die Erzählungen und Lieder der alten Menschen in Parihaka, die den Kindern von der Sternkonstellation berichteten, die sich in dieser oder einer der nächsten Nächte am Himmel zeigen sollte: von Matariki – den Augen des Gottes Tawhirimatea – oder von einer Mutter mit sechs Töchtern, auf dem Weg, der erschöpften Sonne zu helfen, sich nach dem Winter erneut zu erheben … Für Atamarie waren es einfach die Plejaden, die jeden Winter um diese Zeit am Himmel über Neuseeland in Sicht kamen. Sehr nützlich zur Bestimmung der Wintersonnenwende und früher auch für die Navigation auf dem Meer zwischen Hawaiki, der ursprünglichen Heimat der Maori, und Aotearoa, dem Land, in dem sie heute lebten und das die Weißen Neuseeland nannten. Und sehr hübsch anzusehen natürlich am nächtlichen Himmel. Die Magie der Sterne erschloss sich Atamarie allerdings nicht, und den Sagen und Märchen rund um Matariki lauschte sie stets nur mit halbem Ohr.
Dafür interessierte sie sich umso mehr für die Funktion der Erdöfen, welche die Bewohner Parihakas zuvor mit Gemüse und Fleisch befüllt hatten. Dies gehörte zur Zeremonie des Neujahrsfestes, das die Maori beim Auftauchen der Plejaden Ende Mai oder Anfang Juni begingen.
Atamarie linste begeistert in die glühend heißen Höhlen, welche die Männer schon am Vormittag ausgehoben hatten. Hangi nutzten die vulkanische Aktivität des Taranaki zum Garen der Speisen. Man wickelte Fleisch und Gemüse in Blätter, legte sie in Körbe und stellte sie auf die kochend heißen Steine. Anschließend wurden sie mit nassen Tüchern bedeckt, und dann verschloss man die Grube mit Erde. Im Laufe der nächsten Stunden sollten die Speisen garen – und möglichst genau dann fertig sein, wenn das Sternbild Matariki am Himmel aufleuchtete.
Atamarie sah genauso begierig nach den Sternen aus wie die anderen Kinder. Sie freute sich auf das Fest, schließlich war sie extra dafür aus Dunedin auf die Nordinsel gekommen. Wobei natürlich nicht sicher war, dass die Plejaden sich wirklich während der kurzen Winterferien zeigen würden. Aber Matariki und Kupe, Atamaries Mutter und ihr Stiefvater, hatten es darauf ankommen lassen.
»Du musst das Neujahrsfest mal in Parihaka erleben!«, hatte Matariki, die nach dem Sternbild benannt worden war, geschrieben. Viele Maori-Namen bezeichneten ursprünglich Naturphänomene – Atamarie hieß nach dem Sonnenaufgang. »Es hat hier einen besonderen Zauber.«
Atamarie verdrehte ein bisschen die Augen. Für ihre Eltern hatte alles, was mit Parihaka zusammenhing, einen besonderen Zauber. Sie hatten schon lange vor Atamaries Geburt in dem berühmten Dorf gelebt, damals, als der Prophet Te Whiti hier noch den Frieden zwischen den Weißen, den pakeha, und den Maori gepredigt hatte. Kupe hatte im Gefängnis gesessen, nachdem das Dorf dann von den Engländern gestürmt und die Bewohner enteignet worden waren. Und Matariki war mit dem Mann fortgelaufen, der Atamaries Vater werden sollte.
Sehr viel später war Te Whiti allerdings nach Parihaka zurückgekehrt und mit ihm viele seiner treuen Anhänger. Sie hatten das Dorf wieder aufgebaut und waren dabei, es erneut zu einem spirituellen Zentrum der ersten Siedler Neuseelands werden zu lassen. Diesmal allerdings weniger von Träumen getragen als von Verträgen und sicheren Absprachen. Kupe und Matariki hatten ihr Stück Land von der Regierung Taranakis gekauft – auch wenn sie es nach wie vor nicht richtig fanden, den Weißen Geld für ihr eigenes Stammland zu geben. Kupe, inzwischen Rechtsanwalt, hatte einige Klagen angestrengt. Es war recht wahrscheinlich, dass Te Whiti und sein Stamm Entschädigungszahlungen erhalten und auf Dauer ihr Land zurückbekommen würden.
Die Menschen jedenfalls kamen wieder, und es gab auch erneut Kinder in Parihaka, die Matariki in einer neuen Schule unterrichtete. An eine High School war vorerst allerdings nicht zu denken. Atamarie besuchte deshalb eine renommierte Mädchenschule in Dunedin und verbrachte die Wochenenden abwechselnd bei ihren Großeltern und in der Familie ihrer Freundin Roberta.
Parihaka konnte Atamarie nur in den Ferien besuchen, was sie wunderbar fand. Sie freute sich auf ihre Eltern und das freie Leben im Maori-Dorf, in dem es sehr viel weniger Regeln und Verbote gab als in der Otago Girls’ School. Einige Wochen Flachsweben, Tanzen und Spielen der traditionellen Maori-Musikinstrumente, Fischen und Arbeit auf den Feldern genügten ihr aber stets. Das Motto von Parihaka Wir wollen die Welt zu einem besseren Ort machen! kam Atamaries Neigungen zwar entgegen, allerdings hatte sie völlig andere Vorstellungen als die Leute, die in Parihaka die traditionellen Künste des Maori-Volkes unterrichteten. Immer wenn das Mädchen Anstrengungen machte, etwas konkret zu verbessern – den Webrahmen zum Beispiel, an dem sie Flachs weben sollte, oder die Reuse zum Fischefangen –, lehnte man seine Vorschläge empört ab. Und manchmal fielen sogar unfreundliche Worte über Atamaries pakeha-Abstammung, worüber sich Matariki mehr aufregte als ihre Tochter. Atamarie war es gänzlich egal, wie viele ihrer Vorfahren aus dem einen oder dem anderen Volk stammten. Sie wollte nur nicht mehr Stunden mit Webarbeiten verbringen als unbedingt nötig, und sie hatte keine Lust, Fische zu verlieren, weil die Reuse nicht richtig schloss.
Am Ende der Ferien würde sie froh sein, Parihaka wieder verlassen und nach Dunedin zurückkehren zu können. Die Otago Girls’ School war eine äußerst moderne Einrichtung, und die Lehrerinnen unterstützten Erfindungsreichtum bei ihren Schülerinnen.
Jetzt aber stand das Neujahrsfest der Maori bevor, und irgendwann mussten die Plejaden erscheinen. Die alten Leute wachten bereits die dritte Nacht in Folge, obwohl das eigentlich sinnlos war. Wenn die Sterne in Sicht kamen, so in der Regel gleich nach Sonnenuntergang.
»Es ist eine Zeit des Wartens und des Sicherinnerns, Atamarie«, erklärte Matariki. »Die alten Leute denken über das Gestern, Heute und Morgen nach, über das alte Jahr und das neue … Da ist es gar nicht so wichtig, ob die Sterne an diesem Tag erscheinen oder an einem anderen.«
Atamarie verstand das zwar nicht, aber es zwang sie natürlich auch keiner dazu, wach zu bleiben. Wenn das Essen gar und verspeist war und die Erwachsenen noch Musik machten und redeten, verzogen sich die Kinder schon in die Schlafhäuser, kuschelten sich aneinander und erzählten Geschichten. Für Atamarie war das dann fast wie im Internat in Dunedin – nur dass hier nicht mit dem Auftauchen einer Lehrerin zu rechnen war, die ihre Zöglinge energisch zur Ordnung rief.
Nun sah sie gemeinsam mit den anderen Kindern zu, wie die Sonne in der Tasmansee versank. Das Licht über dem Ackerland rund um Parihaka wurde diffus, und nur der Schnee vom kegelförmigen Gipfel des Berges leuchtete noch ein wenig golden. Der Himmel verdunkelte sich rasch – und plötzlich sah Atamarie die Sterne! Strahlend hell und klar stiegen die Plejaden auf über dem Meer, angeführt von dem größten der sieben Sterne: Whanui.
Die Kinder begannen sofort, die Sternformation mit dem traditionellen Lied zu begrüßen, das ihre Lehrerin Matariki ihnen beigebracht hatte:
»Ka puta Matariki ka rere Whanui.
Ko te tohu tena o te tau e!«
Matariki ist zurück! Whanui beginnt seinen Flug.
Das Zeichen für ein neues Jahr!
»Und ein gutes Zeichen!«, freute sich Atamaries Mutter und nahm ihren Mann und ihre Tochter in die Arme. Kupe war extra von Wellington nach Parihaka gekommen, um das Neujahrsfest mit ihnen zu feiern. Er hatte oft dort zu tun, unter anderem bewarb er sich um einen der Maori-Sitze im Parlament. Jetzt küsste er Matariki und Atamarie und hörte zu, wie seine Frau die Zeichen deutete.
»Wenn die Sterne so klar am Himmel stehen, gibt es einen kurzen Winter, und wir können die Einsaat schon im September ausbringen«, belehrte sie ihre Familie und ihre Schüler. »Wenn sie dagegen verhangen wirken und nah beieinanderstehen, als müssten sie sich aneinander wärmen, dann wird der Winter hart, und das Pflanzen beginnt erst im Oktober.«
Atamarie runzelte mal wieder die Stirn. Ihre Lehrerin in Dunedin hätte wahrscheinlich nur ein paar Wolken dafür verantwortlich gemacht, wenn man die Sterne schlecht gesehen hätte. Atamarie stellte sich im Moment andere Fragen.
»Warum weinen die Großmütter eigentlich, Mommy?«, erkundigte sie sich. Die alten Leute waren beim Anblick der Sterne in Weinen und Wehklagen ausgebrochen. »Es ist doch schön, dass die Sterne da sind! Und ein neues Jahr!«
Matariki nickte und strich ihr langes schwarzes Haar zurück. »Ja, aber die Alten denken noch an das letzte Jahr. Sie nennen den Sternen die Namen der Menschen, die seit ihrem letzten Auftauchen verstorben sind, und beten für sie. Und dann beweinen sie die Toten zum letzten Mal, bevor das neue Jahr beginnt.«
Die alten Leute hatten nun auch begonnen, die hangi zu öffnen, wobei ihnen Kupe und die anderen Männer gleich halfen. Kurz darauf stieg aromatischer Duft aus den Erdöfen zum Himmel.
»Der Duft nährt die Sterne«, verriet Matariki, »und gibt ihnen Kraft nach ihrer langen Reise.«
Atamarie lief das Wasser im Munde zusammen, aber bevor sich die Menschen von den Speisen aus den Erdöfen nährten, gab es noch verschiedene Begrüßungszeremonien für die Sterne. Junge und Alte sangen und tanzten die traditionellen haka. Dazu ließen die Erwachsenen Bier- und Weinkrüge und Whiskeyflaschen kreisen, und Matariki und Kupe wurden wie immer wehmütig und sprachen mit ihren Freunden über die alten Zeiten in Parihaka. Wenn man ihnen glaubte, war das Leben damals ein einziges Fest gewesen. Das Dorf war angefüllt mit jungen Menschen aus allen Teilen Aotearoas, und jeden Abend gab es Lachen, Musik und Tanz.
Die meisten Erwachsenen verbrachten die gesamte Neujahrsnacht draußen an den Feuern, aber Atamarie und die anderen Kinder schliefen irgendwann ein – um gleich am nächsten Morgen wieder mit Feuereifer dabei zu sein. Am Neujahrstag ging das Fest schließlich weiter, wieder wurde getanzt, gesungen, wurden Spiele gespielt, und vor allem holten die Jungen ihre Fluggeräte hervor. Drachen zu bauen gehörte zu den Traditionen Aotearoas, die in Parihaka lebendig gehalten wurden. Das Maori-Wort dafür war manu.
Ein paar Fachleute in der Kunst des Drachenbaus hatten denn auch in den letzten Wochen im Dorf unterrichtet. Aber als Atamarie aus Dunedin gekommen war, hatten alle Männer und Kinder aus dem Dorf bereits ihre Arbeiten beendet, sie selbst hatte nicht mehr mitmachen können. Insofern stand sie jetzt mit leeren Händen daneben, während die anderen dem großen Augenblick entgegenfieberten, ihre manu als Mittler zwischen der Welt und den Sternen, den Göttern und den Menschen in den Himmel zu schicken. Natürlich war sie etwas traurig, den Lehrgang verpasst zu haben, aber dennoch konnte Atamarie es kaum abwarten, die Drachen fliegen zu sehen. Im Gegensatz zu den meisten anderen Mädchen bewunderte sie nicht in erster Linie den bunten Schmuck der manu, bestehend aus Federn und Muscheln, oder die kunstvolle Bemalung, die ihnen Gesichter gab und sie zu birdmen – Vogelmenschen – machte. Atamarie war es wichtiger, herauszufinden, warum sich diese flachen, aber doch recht schweren Gestelle aus Holz und Blättern überhaupt in die Lüfte erhoben.
Sie schlenderte zu einem der Jungen hinüber, der einen besonders großen, liebevoll mit Rauten und Stammeszeichen verzierten Drachen flugfertig machte.
»Der hat gar keinen Schwanz«, bemerkte sie.
Der Junge sah sie stirnrunzelnd an. »Wieso sollte ein manu einen Schwanz haben?«, erkundigte er sich.
»Weil pakeha-Drachen einen haben«, belehrte ihn Atamarie. »Ich hab’s auf Bildern gesehen.«
Der Junge zuckte die Schultern. »Da hat der tohunga nichts von gesagt. Nur dass man ein Gestänge braucht und eine Leine – oder zwei, wenn man lenken will. Aber das hat er uns noch nicht gezeigt. Das sei zu schwierig, meint er.«
Dennoch hatte der Junge zwei Schnüre aus Flachs an seiner Konstruktion angebracht.
»Erst mal muss das Ding aber überhaupt in die Luft«, konstatierte Atamarie. »Wie geht das? Warum steigt ein manu?«
»Durch den Atem der Götter«, antwortete der Junge. »Der manu tanzt mit ihrer Lebenskraft.«
Atamarie runzelte die Stirn. »Also durch den Wind«, sagte sie dann. »Aber wenn nun kein Wind ist?«
»Wenn die Götter ihm den Segen versagen, fliegt er nicht«, antwortete der Junge. »Es sei denn, man lässt ihn irgendwo heruntersegeln, von einer Klippe oder so. Aber dabei vermittelt er keine Botschaften an die Götter, er tanzt ja nicht hoch, sondern gleitet nur herunter. Und außerdem ist er dann natürlich weg.« Der Junge machte sich an den Seilen seines gewaltigen Drachens zu schaffen. Atamarie half ihm, das Fluggerät aufzustellen.
»Er ist fast so groß wie ich«, meinte sie. »Glaubst du, man könnte ihn sozusagen, hm … reiten? Und mitfliegen?« Atamarie reizte das weitaus mehr als die Kommunikation mit den Göttern.
Der Junge lachte. »Soll jedenfalls mal einer gemacht haben. Ein Häuptling der Ngati Kahungunu – Nukupewapewa. Er wollte das Pa Maungaraki erobern, aber es klappte nicht, seine Krieger konnten die Mauern des Forts nicht überwinden. Deshalb baute er einen riesigen manu aus Raupo-Blättern in der Form eines Vogels mit weit gespreizten Federn. Daran band er einen Mann fest und ließ den Drachen von einem Felsen oberhalb des Pa heruntersegeln. Er landete im Fort, und der Flieger öffnete den Eroberern die Tore.«
Atamarie lauschte mit leuchtenden Augen. »Deiner ist auch ein manu raupo«, stellte sie fest. »Du musst weit gelaufen sein, ich wüsste gar nicht, wo hier Raupo wächst.« Raupo war eine schilfartige Pflanze und wuchs in flachen Gewässern.
Der Junge lächelte verschmitzt und ein bisschen, als habe sie ein Geheimnis gelüftet. »Jaaa …«, sagte er dann, »war auch nicht einfach, ihn zu finden. Aber die Mühe lohnt sich vielleicht.«
Der Wunsch, den er an die Götter richten wollte, stand ihm im Gesicht geschrieben.
»Rawiri! Was machst du denn? Willst du den Drachen nicht endlich steigen lassen?«
Der Junge zuckte zusammen, als er die Stimme des tohunga hörte. Tatsächlich hatten sowohl er als auch Atamarie den Start der ersten Drachen verpasst, die meisten Jungen hatten ihre Fluggeräte bereits in den Wind gehalten und sahen nun fasziniert zu, wie sie aufstiegen. Die Priester von Parihaka beteten und sangen dazu, die Drachen sollten ihre Wünsche und ihren Segen hinauf zu den Sternen tragen. Atamarie verlor sich ein paar Herzschläge lang in dem wunderschönen Anblick der bunten manu vor dem auch heute sehr klaren Winterhimmel. Auch der Meister hatte seinen gewaltigen manu aute jetzt in die Lüfte gesandt und lenkte ihn geschickt zwischen all den kleineren Drachen seiner Schüler hindurch.
Rawiri kämpfte allerdings noch mit seinen zwei Schnüren und dem Problem, dass er allein kaum mit dem sehr großen Drachen fertig wurde.
»Soll ich ihn mal hochhalten?«, fragte Atamarie begierig.
Der Junge nickte. Und dann griff das Mädchen nach dem Drachen und wurde fast umgerissen von der Gewalt, mit der ihn der Wind aus seinen Händen zog. Der Drachen stieg steil in den Himmel, aber als Rawiri den ersten Versuch machte, seine Bahn zu beeinflussen, indem er die rechte Leine stärker anzog als die linke, stürzte er genauso steil ab.
Atamarie und Rawiri rannten gleichermaßen erschrocken und bestürzt auf den gefallenen Drachen zu, aber zum Glück war er nicht beschädigt.
»Jedenfalls ist nichts Wichtiges kaputt«, meinte Atamarie. Nur der Feder- und Muschelschmuck hatte ein bisschen gelitten.
Rawiri runzelte die Stirn und suchte hektisch nach einer Möglichkeit, die Verzierung wieder in Ordnung zu bringen. »Der tohunga meint, das sei durchaus wichtig. Der Drachen sieht durch die Augen aus Muscheln, und die Bemalung ist unsere Botschaft an die Götter …«
Tohunga waren nicht nur Fachleute auf speziellen Gebieten wie Drachenbau, Jadeschnitzen, Musik oder Heilkunst, sondern hielten auch Kontakt zu den für ihre Künste zuständigen Geistern.
Atamarie zuckte die Schultern. »Also zu den Göttern muss er ja erst mal raufkommen«, bemerkte sie dann. »Lass es uns noch mal probieren. Die Botschaft können wir dann schicken, wenn wir wissen, dass es klappt.« Sie hatte auf keinen Fall Lust, jetzt noch zu warten, bis Rawiri den Schmuck erneuert hatte. Stattdessen schaute sie nun aufmerksamer zum Himmel und konzentrierte sich auf den Drachen des tohunga, der Rawiris abgestürzten Vogel eben etwas schadenfroh musterte. Natürlich, er hatte ihm gleich gesagt, es sei für Anfänger zu schwierig, einen Lenkdrachen zu bauen. Aber Atamaries Ehrgeiz war jetzt geweckt.
»Du musst die Leinen weiter außen festmachen«, schlug sie vor. »Und tiefer. Und das Beste wäre überhaupt, wir hätten vier …«
Rawiri schien ein bisschen in seiner Ehre gekränkt, aber nach einem weiteren erfolglosen Versuch fixierte er die Schnüre tatsächlich so, wie Atamarie es wollte. Mit verblüffendem Erfolg!
Der Drachen stieg wieder schnell auf, stand diesmal aber viel sicherer in der Luft, und als Rawiri einen vorsichtigen Lenkversuch machte, folgte er gehorsam seinem Leinenzug.
»Es geht! Er fliegt, er fliegt! Er fliegt, wohin ich will!« Rawiri jubelte. Sein vogelartiger Drachen behauptete sich stolz neben dem dreieckigen des Meisters.
»Willst du auch mal?«, fragte er großzügig.
Atamarie griff ohne Zögern nach der Schnur. Sie war das einzige Mädchen, das hier die Leinen eines manu hielt, aber das störte sie nicht. In großen Schwüngen lenkte sie den Drachen über den Himmel.
»Ich glaube, sie stimmt, diese Legende von den Ngati Kahungunu«, meinte Rawiri. »Man kann mitfliegen. Wie ein Vogel. Der Drachen muss nur groß sein und die Götter auf seiner Seite haben.«
Atamarie nickte. Natürlich konnte man mitfliegen, der Wind hätte sie ja eben schon fast mit hochgerissen. Aber …
»Es muss auch ohne Wind gehen«, gab sie entschieden zurück.
GESCHENKEDER GÖTTER
NeuseelandDunedin, Christchurch,Lawrence, Parihaka
1899 – 1900
KAPITEL 1
Das Lehrerseminar war in einem Nebengebäude der Universität von Dunedin untergebracht, und Atamarie fand den schmucklosen Bau einfach nur scheußlich. Aber gut, sie musste ja nicht hier studieren. Das College, das sie selbst gerade aufgenommen hatte, war sehr viel weitläufiger und wirkte deutlich imponierender. Gotischer Stil, hatte ihre Tante Heather gesagt, aber natürlich ein Nachbau. Als man in Europa gotische Kathedralen gebaut hatte, war Neuseeland noch nicht von Weißen besiedelt gewesen.
Atamarie fragte sich, ob sie sich die Namen aller möglichen Baustile würde merken müssen, wenn sie jetzt am Canterbury College studierte. »Baukonstruktion« stand tatsächlich auf dem Lehrplan. Aber das war ja wieder etwas anderes als Architektur, oder? Nun ja, sie würde noch genug Zeit haben, sich damit zu beschäftigen. Jetzt musste sie erst mal Roberta von ihrem Erfolg berichten – und hören, wie es ihr am ersten Tag ihrer Studentenzeit ergangen war.
Atamarie stieg die Treppe zum Eingang hinauf und ließ sich auf einer der oberen Treppenstufen nieder. Fröhlich summte sie vor sich hin. Sie war ausgesprochen guter Dinge, wenn auch etwas müde nach der langen Zugfahrt. Dabei war die Verbindung gut, es war heute kein großes Problem mehr, zwischen Christchurch und Dunedin hin- und herzureisen.
Das jedenfalls versicherten sich Atamarie und Roberta, seit sie sich für ihre jeweiligen Studienfächer entschieden und dabei festgestellt hatten, dass sich ihre Wege hier zum ersten Mal seit neun Jahren trennen würden. Die Mädchen hatten einander kennengelernt, als ihre Mütter noch beide in Wellington auf der Nordinsel lebten und gemeinsam das Büro einer der Organisationen leiteten, die für das Frauenwahlrecht kämpften. Nachdem das glücklich errungen war, hatten beide Frauen geheiratet. Atamaries Mutter Matariki war mit ihrem Mann Kupe nach Parihaka gezogen und Robertas Mutter Violet mit ihrem Gatten Sean in dessen Heimatstadt Dunedin. Roberta hatten sie natürlich mitgenommen. Sie durfte wie Atamarie die Otago Girls’ School besuchen. Die beiden hatten hier einige Wochen zuvor ihren Highschoolabschluss gemeistert und freuten sich nun an einem weiteren Erfolg der Frauenrechtlerinnen in Neuseeland: Die Universitäten der Südinsel standen Frauen unbeschränkt offen. Selbst dann, wenn sie ein eher ungewöhnliches Studienfach anstrebten wie Atamarie.
Im Inneren des Schulgebäudes tat sich jetzt etwas. Anscheinend endete der Seminartag, und gleich darauf traten auch die ersten Studenten aus den Toren. Fast durchweg junge Frauen, konservativ gekleidet in engen dunklen Röcke und Blusen in gedeckten Farben, die unter den strengen Kostümjacken hervorblitzten. Einige wenige trugen schmucklose, sackartig fallende Reformkleider, die in Atamaries Augen ebenso langweilig und altjüngferlich wirkten wie der scheinbar unvermeidliche Kapotthut, den hier wirklich jede junge Frau spazieren trug. Dabei ging es doch auch anders. Atamarie und Roberta schnürten sich nicht, aber ihre raffiniert geschnittenen Kleider stammten aus Lady’s Goldmine, dem berühmtesten Modehaus der Stadt. Sowohl Roberta als auch Atamarie nannten Kathleen Burton, eine der Besitzerinnen der Boutique, Grandma, obwohl nur Atamarie blutsverwandt mit ihr verwandt war. Deren leiblicher Vater Colin war Kathleens Sohn, ebenso wie Robertas Stiefvater Sean.
Atamarie trug an diesem Tag jedenfalls ein sonnengelbes, mit bunten Blumen bedrucktes Reformkleid, darüber eine dunkelgrüne Mantille und dazu einen niedlichen Strohhut auf ihrem blonden Haar. Sie bemerkte, dass die Blicke der wenigen männlichen Studenten wohlgefällig auf ihr ruhten, während die Frauen eher ungnädig schauten. Sicher war es nicht üblich, womöglich sogar verboten, hier auf den Stufen zu sitzen.
Aber dann erschien auch endlich Roberta, und Atamarie sprang auf, um die Freundin zu umarmen. Dabei hätte sie Roberta auf Anhieb kaum wiedererkannt, so sehr versuchte die, sich der hiesigen Kleiderordnung anzupassen. Sie trug ihr unauffälligstes dunkelblaues Kleid, kombiniert mit einem schwarzen kurzen Mantel.
»Du siehst aus wie eine Eule!«, warf Atamarie ihr vor, nachdem sie die ersten Begrüßungen ausgetauscht hatten. »Müsst ihr euch so anziehen? Dieser Hut sieht aus, als käme er aus der tiefsten Truhe von Grandma Daldy.«
Amey Daldy war eine Frauenrechtlerin, die Atamaries und Robertas Mütter zwar überaus schätzten, die aber nicht gerade für ihre Extravaganz in Sachen Mode bekannt war.
Roberta lächelte verschämt – und zog damit trotz ihrer dezenten Aufmachung die Aufmerksamkeit der männlichen Studenten auf sich. Egal, wie sie sich verkleidete, Roberta Fence war eine Schönheit. Ihr volles Haar – jetzt in einen Knoten gezwungen, aber sonst lang und wellig über ihren ganzen Rücken fallend, war von einem satten Kastanienbraun. Ihr Gesicht war herzförmig und wirkte trotz klassischer Schönheit stets weich und sanft. Sie hatte volle Lippen und blaue Augen – nicht ganz so spektakulär türkisfarben wie die ihrer Mutter, aber tiefblau und klar wie die Seen im Hochland.
»Wir sollen seriös aussehen«, meinte sie dann. »Aber das sollen doch alle Studentinnen, oder?« Sie musterte Atamaries Aufzug missbilligend.
Atamarie zuckte die Achseln. »Ich falle sowieso auf, egal, was ich anziehe. Und sag jetzt nicht, Eulen seien die Vögel der Weisheit. Wenn du mich fragst, sind Papageien sehr viel pfiffiger.«
Roberta lachte und hakte sich bei Atamarie ein. Wenn sie ehrlich sein sollte, so hatte sie die Freundin schon in den zwei Tagen vermisst, die Atamarie in Christchurch gewesen war. Auf jeden Fall hatte sie in diesen Tagen erheblich zu wenig gelacht.
»Hast du den Studienplatz denn überhaupt gekriegt?«, erkundigte sie sich, während die zwei ein Café in der Nähe der Universität ansteuerten.
Atamarie nickte. »Klar. Ging ja nicht anders. Ich hatte die besten Noten von allen. Aber es war lustig! Professor Dobbins hielt mich zuerst wohl für eine Art Luftspiegelung.«
Sie kicherte und zog die Nase kraus, als trüge sie einen Kneifer oder eine dicke Brille. Dann imitierte sie den Hochschullehrer: »›Mr. Parekura Turei … oder nein … äh … Miss?‹ Der Mann war total verwirrt. Und dabei hatte er sich doch so auf den ersten Maori-Studenten gefreut. Wahrscheinlich hat er einen Riesenkrieger mit Tätowierungen erwartet.«
Roberta kicherte jetzt auch. »Und dann kamst du …«
Atamarie hatte mit einem Maori-Krieger absolut nichts gemeinsam. Sie war nicht klein, aber doch zartgliedrig, ihre weiblichen Formen zeichneten sich unter dem weiten Reformkleid erst zaghaft ab. Zudem hätte auf den ersten Blick niemand eine Maori in ihr vermutet. Atamarie hatte zwar etwas dunklere Haut als die meisten Weißen, und ihre Augen standen ein wenig schräg, aber ansonsten kam sie ganz nach ihrer Großmutter Kathleen – einer klassischen Schönheit mit hohen Wangenknochen, einer geraden Nase und feingeschnittenen Lippen.
»Aber wie konnte er …? Dein Vorname …«
Atamarie zuckte die Schultern. »Du musst zugeben, dass auch viele Maori-Männernamen auf i enden«, meinte sie. »Und der Mann ist Ingenieur, kein Sprachwissenschaftler. Das merkte man auch daran, dass ihm gleich erst mal die Worte fehlten. Aber ich hab mich dann vorgestellt, ihm mein Zeugnis hingehalten …«
»Was hat er dazu gesagt?«, fragte Roberta.
Atamarie lachte. »Solange er mich nicht angucken musste, war alles gut. Wobei ich ja eigentlich gar nicht furchterregend aussehe, oder?« Roberta verdrehte die Augen. Atamarie wusste genau, dass sie einen mehr als ansprechenden Anblick bot. »Aber immer, wenn er von den Papieren aufguckte, schien er an seinem Verstand zu zweifeln. Und dann fragte er mich, ob ich denn auch wirklich wüsste, was hier auf mich zukäme, und betete den Lehrplan runter: Grundsätze des Hoch- und Tiefbaus, Vermessungswesen, technisches Zeichnen, praktische Geometrie – Theorie und Praxis der Konstruktion von Dampfmaschinen …«
Atamarie lächelte voller Vorfreude.
»Und, was hast du gesagt?« Roberta ahnte bereits Schreckliches.
Atamarie blinzelte. »Na, was schon? Ich hab ihm gesagt, ich interessierte mich für Flugmaschinen. Und dann auch ein bisschen von Cayley und Lilienthal erzählt, er sollte ja nicht denken, ich wäre so eine Art … hm … Luftikus!« Sie lachte schon wieder.
Roberta öffnete die Tür des Cafés. »Ein wahres Wunder, dass du nicht gleich rausgeflogen bist«, bemerkte sie.
Atamarie hob die Brauen. »Dann hätte Onkel Sean das College verklagt«, sagte sie gelassen. »Aber Professor Dobbins trug es sowieso mit Fassung. Er war ganz nett und lächelte sogar. Und meinte, er fände es immer schön, wenn seine Studenten hoch hinaus wollten. Dann konnte ich gehen – und den nächsten sprachlos machen. Der Student, der den Neuen die Hochschule zeigen sollte, hat deutlich länger gebraucht, bis er wieder zu sich kam!«
Das Canterbury College of Engineering bestand seit zwölf Jahren und hatte mit zwei Teilzeitdozenten und zweiundzwanzig Studenten klein angefangen. Nach wie vor war der Studentenkreis überschaubar – und Atamarie würde als erste Frau ins College eintreten.
»Und wie war’s sonst?«, fragte Roberta. »Mit Heather? Habt ihr was unternommen?«
Atamarie zuckte die Schultern. »Erst mussten wir ja mal ein Zimmer finden. Aber das war einfach, Heather und Chloé haben Bekannte in Christchurch, zwei ganz nette Frauen. Wohnen zusammen wie Heather und Chloé und haben einen Buchladen. Da krieg ich auch gleich die ganzen Fachbücher. Und das Haus ist hübsch und nah an der Universität. Das Zimmer schön groß – Herrenbesuch soll ich vorher ankündigen!«
Sie kicherte. Die letzte Regelung war großzügig, gewöhnlich war es Studenten vollständig verboten, andersgeschlechtliche Freunde oder Freundinnen mit aufs Zimmer zu nehmen. Aber Heather und Chloé waren aufgeschlossen und modern – und ihre Freundinnen offensichtlich auch.
»Du willst dir doch wohl nicht gleich einen Freund suchen!«, empörte sich Roberta.
Atamarie seufzte. »Robbie, ich bin das einzige weibliche Wesen, das Ingenieurwissenschaften studiert. Wenn ich nicht völlig vereinsamen will, muss ich mich zwangsläufig mit den Jungen anfreunden. Was ja nicht gleich heißen muss, das Bett mit ihnen zu teilen.«
Roberta lief umgehend rot an, als Atamarie so unverblümt von Geschlechtsverkehr sprach. Die beiden jungen Frauen waren aufgeklärt – auch Roberta hatte die Ferien schon in Parihaka verbracht und den lockeren Umgang der Maori-Frauen mit der Liebe mitbekommen. Trotzdem hätte sie sich vorsichtiger ausgedrückt. Und sie selbst hatte auch noch keinerlei praktische Erfahrungen mit dem anderen Geschlecht, während Atamarie schon mal mit hübschen Jungen in Parihaka Küsse tauschte. Roberta war romantischer veranlagt. Sie konnte sich durchaus verlieben, aber das behielt sie für sich …
»Ansonsten waren wir dann noch auf der Rennbahn. In Addington. Weil Rosie unbedingt hinwollte. Aber leider lief gerade kein Trabrennen. Lustig war’s trotzdem. Lord Barrington hat uns in die Besitzerloge eingeladen, wir haben Sekt getrunken – und wir durften auf Pferde wetten.«
»Atamie!«
Roberta war entsetzt. Sie war im Rennbahnmilieu aufgewachsen und hatte es immer gehasst. Wetten und Whiskey, das hatte ihre Mutter ihr von klein auf vermittelt, konnten eine Familie ruinieren. Wobei sie aus Erfahrung sprach: Robertas leiblicher Vater war beidem verfallen gewesen.
»Nun hab dich nicht so! Lord Barrington hat drauf bestanden. Und Heather hat verloren, aber ich habe gewonnen. Zwei Mal. Wobei es ganz einfach war, ich hab immer auf das Pferd mit den längsten Beinen gesetzt und dem stromlinienförmigsten Körper. Alles pure Physik … na ja, beim dritten Mal hat’s nicht so geklappt, der Gaul kam nicht in die Gänge, ich glaube, er war einfach faul. Aber es ist genug übrig, um den Kaffee zu bezahlen!«
Vergnügt bestellte Atamarie dazu noch einen großen Teller Kuchen.
»In einer Galerie waren wir auch noch … aber ich hab vergessen, wie der Künstler hieß. Heather war jedenfalls ganz begeistert. Kommst du übrigens heute Abend? Oder muss man sich nicht nur wie die Eulen anziehen, sondern auch mit den Hühnern ins Bett, wenn man Lehrerin werden will?«
Roberta sah ihre Freundin tadelnd an. »Eulen sind nachtaktiv«, quittierte sie die Neckerei. »Und natürlich komme ich. Es ist ja eine Vernissage, kein Nachtclubbesuch! Wie heißt noch die Künstlerin?«
Atamarie zuckte die Achseln. Sie hatte sich auch das nicht gemerkt, aber damit war sie nicht allein in Dunedin. Es gab in dieser Stadt zwar recht viele reiche Leute, die sich Kunst leisten konnten, aber echten Enthusiasmus brachten nur wenige dafür auf. Dennoch waren die Vernissagen in Heathers und Chloé Coltranes Galerie sehr beliebt. Sie gehörten zu den wichtigsten gesellschaftlichen Anlässen in der Stadt, und die Einladungen waren heiß begehrt. Chloé war allerdings auch eine ausgesprochen begabte Gastgeberin und Heather als Künstlerin weit über Neuseeland hinaus bekannt. Die beiden Frauen lebten seit zehn Jahren zusammen, und viele ihrer Kunden nahmen an, dass es sich um Schwestern handelte. Das stimmte jedoch nicht, Chloé verdankte ihren Nachnamen einer unglücklichen Ehe mit Heathers Bruder.
Zwischen Atamarie und Roberta entstand eine kurze Gesprächspause, während der Kaffee serviert und Kuchen aufgetragen wurde. Roberta gab Zucker in ihre Tasse, während Atamarie ihren Gedanken nachhing. Wahrscheinlich überlegte sie schon, welches Kleid sie am Abend tragen würde – Kathleen hatte sicher etwas Neues für ihre beiden Enkelinnen. Sie pflegte stets zu behaupten, die Mädchen täten ihr einen Gefallen damit, die teuren Kleider anzunehmen. Schließlich machten sie damit ja Reklame für Lady’s Goldmine.
Roberta kämpfte ein wenig mit sich, wagte dann aber, Atamarie die Frage zu stellen, die ihr schon tagelang auf den Nägeln brannte.
»Weißt du zufällig, ob … ob dein … hm … Onkel auch kommt?«
Atamarie grinste. »Welcher?«, fragte sie dann hinterhältig.
Roberta lief sofort rot an. »Na ja, hm … Kevin?«
Sie versuchte, ihre Stimme unbeteiligt klingen zu lassen, fast, als fiele es ihr schwer, sich an Kevins Namen zu erinnern. Aber im Grunde war das sowieso vergebene Liebesmüh. Atamarie kannte sie zu gut. Sie wusste genau, von welchem der beiden jüngeren Brüder ihrer Mutter die Rede war. Roberta war seit Monaten verliebt in Kevin, den Älteren der beiden, der nach einem irischen Heiligen benannt worden war wie sein Großvater. Aber natürlich durfte davon niemand etwas wissen. Es war ja Unsinn, auch nur zu hoffen, dass der erfolgreiche junge Arzt die Freundin seiner Nichte bemerken, geschweige denn ihr Avancen machen würde. Jedenfalls solange Atamarie und Roberta noch zur Schule gingen, war das höchst unwahrscheinlich gewesen. Aber nun, als Studentin … Robertas Eltern gehörten zur besseren Gesellschaft von Dunedin, in ihrem Gefolge würde die junge Frau sicher zu Konzerten und Bällen, Vernissagen und Theateraufführungen eingeladen werden. Kevin Drury traf man bei fast jedem dieser Anlässe. Gemeinsam mit einem Freund hatte er vor wenigen Jahren eine Arztpraxis in Dunedin eröffnet und warb immer noch um neue Patienten. Am liebsten natürlich gut betuchte Herrschaften und bevorzugt Frauen. Die liefen ihm auch in Scharen zu. Mit seinem lockigen schwarzen Haar und seinen wachen blauen Augen sah er ausgesprochen gut aus. Dazu war er ein verwegener Reiter, der kein Jagdspringen ausließ und sein Pferd mitunter sogar auf der Rennbahn selbst vorstellte.
Kevins Bruder Patrick war sehr viel unauffälliger. Er hatte Landwirtschaft studiert und gedachte, eines Tages die Farm seiner Eltern zu übernehmen. Vorerst arbeitete er allerdings als Berater für die Viehzüchtervereinigung und das Landwirtschaftsministerium in Otago. Die Gegend wandelte sich langsam wieder vom Zentrum der Goldgräberei zu einer landwirtschaftlich geprägten Region. Und nicht all die neuen Grundbesitzer und Schafzüchter kannten sich wirklich aus mit Weideführung und Wollerzeugung. Mancher träumte zwar vom Dasein als Schafbaron, hatte aber im Grunde nicht mehr aufzuweisen als Erfahrung – und Glück – beim Waschen von Gold.
»Kevin kommt bestimmt«, erklärte Atamarie. »Allerdings meint Heather, er habe schon wieder eine neue Freundin. Sie soll wunderschön sein, sie überlegt, sie zu bitten, ihr Modell zu stehen …«
Frauenporträts gehörten zu Heathers liebsten Motiven, und sie hatte damit schon große Erfolge erzielt. Heather verstand sich darauf, das Wesen einer Frau, ihren Charakter und ihre Erfahrungen in den Bildern einzufangen.
Roberta seufzte. »Kevin sieht ja auch sehr gut aus«, bemerkte sie, scheinbar beiläufig, aber es klang verzweifelt.
Atamarie lachte, legte die Hand auf den Arm ihrer Freundin und tat, als wollte sie Roberta schütteln. »Er mag ja der Prinz sein, Robbie, aber du bist auch alles andere als Aschenputtel! Wenn du dich ein bisschen zurechtmachst und nicht immer auf den Boden guckst oder rot anläufst und vollständig die Sprache verlierst, wenn du Kevin siehst, kannst du alle ausstechen.«
Roberta rührte weiter in ihrer Kaffeetasse. »Dazu müsste er mich erst mal angucken«, murmelte sie. »Aber er …«
»Dann mach’s anders und werd einfach mal ohnmächtig!«, schlug Atamarie scherzhaft vor. »Das ist gut, du lässt dich hinfallen, und ich schreie: Wir brauchen einen Arzt! Dann kann er nicht anders.«
Roberta hätte jetzt eigentlich in Gelächter ausbrechen müssen, aber sie kaute nur auf ihrer Unterlippe. »Du nimmst mich nicht ernst«, sagte sie schließlich.
Atamarie stöhnte. »Vielleicht siehst du die Sache mit Kevin etwas zu ernst«, gab sie dann zu bedenken. »Was sehr bedenklich ist. Denn du … du willst doch nicht einfach nur ein paar Küsse, oder? Du suchst einen Mann, der dich wirklich liebt. Und was das angeht, bist du bei Kevin sicher an der falschen Adresse. Er ist nett, und er ist witzig – ich hab ihn wirklich sehr gern, Robbie. Aber er sucht keine Frau, zumindest vorerst nicht, das hat er deutlich gesagt, als Grandma Lizzie ihn neulich drauf ansprach. Auf Dauer muss er natürlich heiraten, das erwartet man ja von einem niedergelassenen Arzt. Aber erst mal … Grandma Lizzie meint, er sei wie Grandpa Michael. Der hätte sich auch erst ›die Hörner abstoßen müssen‹, bevor er sich ernstlich für sie interessierte. Keine Ahnung, was sie damit meint, aber eins ist sicher: Kevin will erst mal nicht heiraten. Der sucht das Abenteuer!«
KAPITEL 2
Heather Coltrane hatte nicht übertrieben, als sie von Kevin Drurys neuer Freundin sprach. Juliet, wie er die junge Frau kurz vorstellte, ohne sich mit einem Nachnamen aufzuhalten, war eine außergewöhnliche Schönheit. Wobei sich kaum feststellen ließ, zu welchen Volksgruppen ihre Vorfahren gehört haben mochten. Ganz sicher war sie keine Weiße, aber eine Maori-Abstammung stand ihr auch nicht im Gesicht geschrieben. Juliet hatte schwarzes Haar, das in dichten Locken über ihre Schultern fiel, goldbraun angehauchte Haut und volle Lippen, dazu aber erstaunlich leuchtend blaue Augen unter schweren Lidern.
»Sie wirkt eher wie eine Kreolin«, mutmaßte Heather. Sie war weit gereist und dabei Menschen aus verschiedenen Kulturkreisen begegnet. »Und findet ihr es nicht seltsam, dass er sie nur mit dem Vornamen vorstellt? Wo mag er sie getroffen haben?«
Heather begrüßte eben Robertas Mutter Violet und ihren Stiefvater Sean, die kurz nach Roberta und Atamarie die Galerieräume betreten hatten. Atamarie war gleich ungehemmt zu Kevin und seiner neuen Freundin herübergeschlendert und hatte kurz mit den beiden gesprochen, während Roberta vor Aufregung im Boden zu versinken schien. Sie hatte bei der Vorstellung kaum ein Wort herausbekommen, aber Juliet sah ohnehin nicht aus, als hätte sie vor, sich die Namen irgendwelcher Mädchen zu merken. Dafür sprach sie angelegentlich mit ein paar Herren, die sich sofort um sie versammelt hatten und sich jetzt darum rissen, sie mit Champagner und Hors d’œuvres zu verwöhnen.
»Als Herkunftsland des Champagners bevorzugt die Lady jedenfalls Frankreich«, bemerkte Chloé säuerlich und küsste Violet zur Begrüßung auf die Wange. »Das ist bestimmt schon das dritte Glas von dem teuersten Sekt, den wir haben. Wenn das so weitergeht, tanzt sie uns am Ende des Abends auf dem Tisch.«
»Ein bisschen Demimonde, nicht?«, fragte Violet stirnrunzelnd, und Sean lächelte.
Es klang, als erprobe sie da wieder mal ein neues Wort. Violet hatte als junges Mädchen ein mehrbändiges Lexikon geschenkt bekommen und daraus ihre gesamte Bildung bezogen. Über Jahre hinweg hatte sie immer wieder darin gelesen, bis ihr auch die ungewöhnlichsten Begriffe geläufig waren. Selbst solche, für die es im braven Dunedin selten Anwendungsmöglichkeiten gab.
Heather lachte. »Jedenfalls weit entfernt von einer Schafbaronesse. Lizzie und Michael werden nicht begeistert sein.«
Kevins und Patricks Eltern, Lizzie und Michael Drury, führten eine Schaffarm in Otago, und natürlich hofften sie, dass ihre Söhne irgendwann Frauen ehelichen würden, die den Hof mit ihnen führten. Aber Kevin schlug ja ohnehin aus der Art. Er hatte sich nie besonders für Farmarbeit interessiert und ganz sicher nicht für die Töchter der reichen Viehzüchter aus den Plains.
Die mysteriöse Juliet war jedenfalls das Gesprächsthema des Abends – die etwas düsteren Gemälde, welche die Vernissage heute zeigte, fielen deutlich gegen sie ab. Wobei es vor allem die Frauen waren, die sich für Juliets Herkunft interessierten. Die Männer hatten zu viel damit zu tun, sie zu bewundern: Juliets schlanke, aber kurvenreiche Figur war ähnlich faszinierend wie ihr fremdländisch wirkendes Gesicht. Kevin führte die junge Frau denn auch vor wie eine Trophäe. Er war unverkennbar stolz auf seine Eroberung, ohne dabei allerdings seine anderen Bewunderinnen zu vernachlässigen. Mit Juliet im Schlepptau wanderte er von einer der Dunediner Matronen zur anderen und plauderte charmant über dies und das, während Juliet geheimnisvoll lächelte und sich auf keinen Versuch einließ, sie auszuhorchen.
»Es wirkt einfach besser, wenn man sich schnürt«, seufzte Roberta, als Juliet an ihr vorbeitänzelte.
Dabei sah sie selbst an diesem Abend entzückend aus. Roberta trug ein aquamarinblaues Kleid, das raffiniert geschnitten war und allein durch seinen Faltenwurf die Figur der Trägerin betonte. Ein Korsett hätte das natürlich in noch stärkerem Maße getan, aber ohne den Panzer aus Fischgrät konnte Roberta durchatmen und sich mit natürlicher Anmut bewegen. Juliet, die obendrein einen der hochmodernen, sehr engen Röcke trug, vermochte dagegen nur zu trippeln. Was sie wieder rührend hilflos wirken ließ, wie Roberta bemerkte.
»Im Korsett wird man auch schneller ohnmächtig«, neckte dagegen Atamarie. »Wobei dir diese Option immer noch offensteht. Los, Robbie, dieses Bild da, von dem kriegt man unweigerlich Schwindelanfälle. Bau dich davor auf, und dann lass dich fallen!«
Die Bilder wirkten tatsächlich deprimierend, aber Roberta fühlte sich heute auch ohne düstere Landschaftsansichten schlecht. Unglücklich verfolgte sie Kevin und seine Eroberung mit Blicken. Atamarie zog sie schließlich energisch weg.
»Nun lächle endlich mal, Roberta! Schau, da ist Patrick, den haben wir noch gar nicht begrüßt.«
Patrick Drury, Kevins jüngerer Bruder, war ein aufgeschlossener, freundlicher Mensch, und ihm gegenüber war Roberta gewöhnlich nicht schüchtern. Sie wurde ihm bei Gesellschaften oft als Tischdame zugewiesen, da er bislang stets allein kam und bei den Gastgebern als umgänglich bekannt war. Wen auch immer man neben ihm platzierte, Patrick konnte sich unbeschwert unterhalten. Sein Beruf zwang ihn schließlich zur höflichen Konversation mit den unterschiedlichsten Menschen. Auf den Schaffarmen begegneten ihm vom britischen Adligen bis zum ungeschlachten Goldgräber alle. Bisher hatte Atamarie zudem das Gefühl gehabt, dass er gerade mit Roberta gern zusammen war und seine Augen neuerdings sogar aufleuchteten, wenn er sie sah. Früher hatte er sie zweifellos nur als kleines Mädchen wahrgenommen, aber jetzt begann er, die schöne junge Frau in ihr zu erkennen.
Bis jetzt war das jedenfalls so gewesen, aber an diesem Abend verhielt er sich anders. Obwohl er den jungen Frauen pflichtschuldig Champagner holte und auch ein wenig mit ihnen plauderte, wirkte er doch abgelenkt und schien sich nur aus Höflichkeit mit Atamarie und Roberta abzugeben. Roberta fiel das nicht auf, aber Atamarie bemerkte schnell, dass Patrick ein ähnliches Problem zu haben schien wie ihre Freundin: Auch er konnte die Augen nicht von Kevin und Juliet lassen. Die schwarzhaarige Schönheit schien ihn vollkommen zu faszinieren, aber hier hatte er sicher keine Chancen.
Patrick war längst nicht so gut aussehend wie Kevin. Statt des schwarzen vollen Haars seines Vaters Michael hatte er die dunkelblonden Locken seiner Mutter Lizzie geerbt und ebenso ihre sanften porzellanblauen Augen. Insgesamt war er kleiner und wirkte weniger imposant als Kevin – sicher kein Mann, den sich eine Frau wie Juliet lange genug ansehen würde, um seine inneren Werte zu erkennen.
Atamarie gab es schließlich auf, ein Gespräch zwischen Roberta und Patrick anzuregen. Die beiden würden sich höchstens gegenseitig herunterziehen. Sie lotste Roberta also weiter und schaute sich dabei nach einem Kellner um. Vielleicht besserte sich Robertas Stimmung, wenn sie noch ein Glas Sekt trank. Patrick folgte derweil seinem Bruder und dessen Freundin wie ein Hündchen.
In der Mitte der Galerie trafen Roberta und Atamarie auf Rosie, Heathers und Chloés Dienstmädchen. Die hellblonde junge Frau stand hölzern herum und hielt ein Tablett mit Sektgläsern in der Hand. Sie wirkte dabei so unbeteiligt, als versuche sie, einen Tisch zu imitieren.
Atamarie nahm ihr zwei Gläser Sekt ab und lächelte ihr zu.
»Was macht das Fohlen, Rosie?«, erkundigte sie sich – woraufhin Rosies eigentlich recht hübsches Gesicht sofort zu strahlen begann.
Rosie kam nur im Umgang mit Pferden aus sich heraus. Als Hausmädchen bewährte sie sich halbwegs – sie hatte ihrer Schwester Violet schon als Kind geholfen, Chloé als Zofe zur Hand zu gehen. Aber wirklich glücklich und überaus geschickt war sie nur mit Trabrennpferden. Chloé hatte sie angelernt, als sie noch gemeinsam mit ihrem früheren Mann ein Gestüt in den Fjordlands bewirtschaftete. Heute war von all den Pferden nur noch die Stute Dancing Rose geblieben, ehemals zum Trabrennen gezüchtet, aber jetzt nur noch vor Chloés und Heathers Chaise eingesetzt. Rosie fand das stets etwas traurig. Aber im letzten Jahr hatte Chloé ihr Pferd decken lassen, und jetzt stand ein Stutfohlen im Stall. Und Chloé wehrte sich auch längst nicht mehr so vehement, das Nachwuchspferd vielleicht noch mal auf der Rennbahn starten zu lassen. Schließlich hatte sie ihren früheren Mann seit Jahren nicht gesehen. Colin Coltrane war auf den Rennbahnen der Südinsel kein Begriff mehr, weder Chloé und Heather noch Rosie liefen Gefahr, ihn dort zu treffen. Warum sollte Rose’s Trotting Diamond also nicht an frühere Erfolge anknüpfen? Rosie jedenfalls schien der Zeit entgegenzufiebern, wenn das Fohlen alt genug war, einen Sulky zu ziehen.
Während Atamarie gutmütig ihren Schwärmereien lauschte, sprach Roberta mit Kathleen Burton und ihrem Mann Peter. Der Reverend wirkte wie immer beruhigend auf die junge Frau. Roberta konnte sich noch genau erinnern, wie sicher sie sich damals in seinem und Kathleens Haus gefühlt hatte, nachdem ihre Mutter ihrem gewalttätigen Ehemann endlich entkommen war. Zudem bemerkte sie, dass der Reverend heute zu den wenigen anwesenden Männern gehörte, denen Kevin und Juliet keinen zweiten Blick wert schienen. Stattdessen befragte er Roberta und dann auch Atamarie freundlich nach ihren Studien. Er fand es aufregend, dass Atamarie Ingenieurwissenschaften studieren wollte, und regte Roberta jetzt schon an, nach Abschluss ihrer Ausbildung in seinem Pfarrsprengel zu unterrichten.
»Wir bauen gerade eine Schule, Roberta, es lohnt sich endlich, die Leute werden sesshaft und kriegen Kinder!«
Bislang hatte der Reverend sich hauptsächlich mit den seelischen, aber auch ganz praktischen Problemen der neu einwandernden und frustriert von den Feldern zurückkehrenden Goldsucher beschäftigt. Inzwischen war der Goldrausch in Otago jedoch abgeflaut. Es zog europäische Abenteurer in die Gold- und Diamantenminen Südafrikas. Die in Dunedin gestrandeten erfolglosen Digger hatten andere Arbeit gefunden, oft mithilfe des Reverends. Sie bauten nun ihre Häuser im Umfeld seiner Kirche, sein Sprengel vergrößerte sich, und er freute sich auf ganz normale Pfarrarbeit mit Sonntagsschule, Taufen und Eheschließungen.
Schließlich gesellten sich auch Heather und Chloé zu der Gruppe um Kathleen und den Reverend. Ihre wichtigsten Pflichten als Gastgeberinnen und Betreiberinnen der Galerie hatten sie schließlich erledigt. Alle Gäste waren mit Getränken versorgt, und Chloé hatte ihre einführende Rede zu der Künstlerin und ihren Werken gehalten.
»Der Verkauf lässt sich allerdings schleppend an«, meinte Heather bedauernd. »Dabei sind das kleine Kostbarkeiten.« Bewundernd studierte sie eins der akribisch gemalten Gemälde.
Atamarie verdrehte die Augen. »Also, für Kostbarkeiten schillern sie mir zu wenig«, bemerkte sie. »Aber vielleicht solltet ihr Beerdigungsunternehmer ansprechen. Da könnte ich mir die Bilder gut vorstellen, in den Empfangsräumen oder …«
Die anderen lachten.
»Du verstehst nichts von Kunst«, rügte Heather ihre Nichte.
»Aber von kubischen Modifikationen von Kohlenstoff«, gab Atamarie die Neckerei ungerührt zurück. »Wie viele von diesen komischen Bildern muss man wohl malen, damit man sich so einen Ring kaufen kann?«
Sie wies auf Heathers Finger und lenkte damit auch Kathleens und Robertas Aufmerksamkeit auf den feinen Goldring mit dem glitzernden Diamanten.
Kathleen lächelte ihrer Tochter zu. »Was für ein wunderschönes Stück! Überhaupt siehst du großartig aus in dem neuen Kostüm! Nur schade, dass es nicht aus meiner Kollektion ist.«
Heather wurde ob der Schmeichelei unweigerlich ein bisschen rot. Sie war keine außergewöhnliche Schönheit mit ihrem feinen aschblonden Haar, das ziemlich unfrisierbar wirkte. In Europa hatte Heather es eine Zeitlang kurz getragen, aber hier galt so etwas auch für Künstlerinnen als zu extravagant. Man tuschelte schon genug über ihr Faible für weite, orientalisch geschnittene Hosenröcke und die dazu passenden gewagten Jacken und Blusen. Heathers Gesichtszüge waren früher zart und madonnenhaft gewesen, jetzt wirkten sie fast etwas herb, und ihre braunen Augen blickten nicht mehr sanft und fügsam wie ehedem, sondern klug und durchaus mal spöttisch in die Welt.
»Ich finde, er steht Chloé viel besser!«, spielte sie das Kompliment nun auch herunter. »Komm, Chloé, zeig mal deinen!«
Die dunkelhaarige Chloé wirkte insgesamt fraulicher und damenhafter als ihre Freundin. Sie trug heute ein rotes Empirekleid aus Kathleens Kollektion, dessen Farbe der Diamant in ihrem Ring widerzuspiegeln schien.
»Diamantringe!«, bemerkte der Reverend lächelnd. »Nobel, nobel, ich sehe schon, ich übe längst nicht genug Druck auf euch aus, wenn ich für meine Armenküchen sammle. Ihr scheint ja Geld im Überfluss zu haben.«
»Heather hat ein paar Bilder verkauft«, erklärte Chloé und wirkte dabei ein bisschen befangen. »Und da meinte sie … also die Galerie besteht doch jetzt seit bald zehn Jahren … Wir sollten das feiern.«
»Gibt’s die wirklich schon so lange?«, fragte Kathleen verwundert, hielt dann aber inne, bevor sie laut nachrechnete. Es war offensichtlich, dass Heather und Chloé hier keine Geschäftsidee feierten, sondern eher eine große Liebe. »Jedenfalls sind die Ringe wunderschön«, sagte sie dann. »Und Diamanten sind ja jetzt auch durchaus erschwinglich, seit sie so viele davon finden, in … wo war das noch, Peter, in Südafrika, nicht wahr?«
Peter Burton nickte, wurde dabei jedoch ernst. »Am Kap der Guten Hoffnung. Und ich fürchte, den Namen des Landes werden wir demnächst häufiger hören«, meinte er dann. »Es heißt, es würde dort Krieg geben …«
»Krieg?«, fragte Atamarie interessiert. Bislang kannte sie Kriege eigentlich nur aus dem Geschichtsunterricht. Und natürlich aus den Erzählungen ihrer Eltern, die sich noch an die letzten Gefechte der Landkriege zwischen Maori und pakeha erinnerten. Ihr selbst erschien es allerdings ziemlich unvorstellbar, wirklich mit Gewehren oder gar Speeren aufeinander loszugehen. Kämpfe waren für sie eher mit Wortgefechten, Zeitungsartikeln und dem Verfassen unendlicher Mengen von Petitionen verbunden, mit denen man das Parlament für die eigenen politischen Ziele zu begeistern suchte. »Zwischen wem?«, erkundigte sie sich.
Roberta wäre diese Angelegenheit normalerweise gleichgültig gewesen – Politik interessierte sie nicht wirklich, trotz ihres und Atamaries früherem kindlichen Traum, erste Premierministerin Neuseelands zu werden. Aber nun lebte sie auf, denn Kevin Drury gesellte sich zu ihnen. Juliet war ebenfalls näher getreten, um einen Blick auf Heathers und Chloés Ringe zu werfen, schien davon aber nicht sonderlich beeindruckt. Sie trug auffälligeren Schmuck, der kaum weniger schillerte – allerdings zerrissen sich die Damen bereits die Mäuler darüber, ob es sich nicht lediglich um Strasssteine handelte. Ein Fauxpas in der calvinistisch geprägten Gesellschaft Dunedins, wo man eher wenig Schmuck trug – aber wenn, dann echten!
Kevin hatte die letzten Worte des Reverends gehört. Auch Patrick mischte sich nun in die Unterhaltung ein – offensichtlich ganz froh, endlich etwas beitragen zu können. Juliet hatte bislang kein Wort mit ihm gewechselt.
»Zwischen England und den Buren«, beantwortete er jetzt Atamaries Frage. »Letztere sind eigentlich Niederländer, aber seit sie in Südafrika siedeln, nennen sie sich Buren oder Afrikaaner. Sie beanspruchen da ein paar Gebiete, obwohl das Land eigentlich schon vor ein paar Jahrhunderten von England erobert worden ist.«
Der Reverend nickte. »Und bislang hat kein Hahn danach gekräht«, bemerkte er. »Erst seit sie massenhaft Diamanten und Gold fördern, beginnt man die Sache infrage zu stellen. Natürlich nur unter den edelsten Gesichtspunkten. Kann England es hinnehmen, dass sie die Eingeborenen schlimmer behandeln als Vieh? Dass die Zuwanderer in den Goldgräbergebieten kein Stimmrecht haben?«
Kathleen runzelte die Stirn. »Seit wann interessieren sich Goldgräber für Politik?«, fragte sie. »Die meisten können doch kaum lesen und schreiben, und wer an der Regierung ist, ist ihnen absolut egal.«
»Umgekehrt wird allerdings ein Schuh draus.« Kevin lächelte. »Die Politik interessiert sich für das Gold.«
Roberta beobachtete fasziniert, wie seine leuchtend blauen Augen spöttisch aufblitzten und Grübchen auf seinen gebräunten Wangen erschienen. Sie ließen sein sonst etwas kantiges Gesicht weich wirken – und seinen Blick unwiderstehlich.
Roberta bemühte sich, sein Lächeln ungeniert zu erwidern, und erinnerte sich jetzt auch an Atamaries Anregung vom Morgen. Sie musste Kevin irgendwie auf sich aufmerksam machen. Zum Beispiel, indem sie etwas sagte. Am besten etwas Kluges. Roberta zermarterte sich das Hirn.
»Aber Neuseeland hat doch nichts damit zu tun, wenn England in Südafrika kämpft, oder?«, fragte sie schließlich – und errötete, als alle sie ansahen.
»Das kommt ganz darauf an, was unserem Premierminister einfällt«, meinte Heather trocken. »Wobei Mr. Seddon für seine sonderbaren Ideen bekannt ist. Und seine Seitenwechsel …«
Seddon hatte den Frauen beim Kampf um das Wahlrecht so manche Nuss zu knacken gegeben.
»Mal ganz abgesehen davon, dass es jeden denkenden Menschen etwas angeht, wenn um Gold und Diamanten Kriege geführt werden«, sagte der Reverend, und Roberta errötete gleich wieder. Allzu klug war ihre Bemerkung also nicht gewesen.
»Ihr meint, sie könnten wirklich Neuseeländer nach Südafrika schicken, um da zu kämpfen?«, fragte Atamarie. Sie sah mehr den Aspekt des Abenteuers.
»Warum nicht?«, meinte Kevin und spielte beiläufig mit Juliets Fingern. Die junge Frau hatte ihm lasziv die Hand auf den linken Arm gelegt, und er seinerseits schob die rechte darüber. Kathleen registrierte, dass dies schon den ganzen Abend so ging – Kevin und Juliet konnten die Hände nicht voneinander lassen. »Ob man Truppen aus England oder aus Neuseeland schickt, verschiffen muss man sie so oder so. Natürlich kann man keinen zwingen. Aber Freiwillige …«
Roberta spürte plötzlich Angst in sich aufsteigen.
»Aber Sie … du … ihr …« Im letzten Moment dachte sie immerhin daran, auch die anderen Männer in die Frage einzubeziehen. Wobei natürlich nur noch Patrick infrage kam, der Reverend war sicher zu alt, um ins Feld zu ziehen. »Ihr würdet doch nicht gehen?«
Sie atmete auf, als die Männer lachten, fühlte sich allerdings peinlich berührt, als Juliet einstimmte.
»Nicht ohne meine Erlaubnis«, erklärte diese anzüglich und zog Kevin an sich. »Es gibt süßere Schlachtfelder als das Kap, um sich als Held zu zeigen …«
KAPITEL 3
»Meinst du eigentlich, dass die … Beziehung zu dieser Juliet deinem Renommee guttut?« Lizzie Drury betrat Kevins Praxisräume und war nahe daran, die Tür mit Schwung hinter sich zuzuwerfen. Dabei hatte sie eigentlich ruhig mit ihrem Sohn reden wollen. Aber nachdem sie den Stein des Anstoßes eben ganz selbstverständlich aus seiner Wohnung hatte kommen sehen, konnte sie sich nicht mehr zurückhalten. »Meine Güte, dem Mädchen sieht man die Halbwelt doch auf hundert Yard Entfernung an. Wo hast du es bloß aufgegriffen? Und wie kommst du auf den Gedanken, es mit zu … zu solchen Einladungen zu nehmen wie gestern?«
Kevin wandte sich heftig zu Lizzy um. »Ich muss doch bitten, Mutter! Nicht in diesem Ton. Und nicht so laut, sicher kommen gleich Patienten …«
Kevin lauschte besorgt in Richtung seiner über den Praxisräumen gelegenen Wohnung. Er lebte hier, sein Kollege Christian Folks hatte ein Haus in der Nähe.
»Patienten!« Lizzie rang die Hände. »Heute ist Sonntag, Kevin. Und falls es dich beruhigt, die junge Dame ist schon weg.«
Das Wort Dame klang eher wie eine Beleidigung als wie ein Ehrentitel. »So viel Benimm hat sie wenigstens, dass sie sich rausstiehlt, bevor das Hausmädchen kommt.«
Über Kevins selbstbewusste Miene zog eine leicht verlegene Röte. Es war ihm zweifellos nicht recht, dass seine Eltern Juliets Abgang mitbekommen hatten. Schließlich kannte er seine Mutter und wusste, was sie von seinen diversen Frauenbekanntschaften hielt.
Lizzie ihrerseits hatte das Thema Juliet eigentlich nicht mehr ansprechen wollen, nachdem sie Kevins neue Freundin bei einer Abendeinladung kennengelernt hatte. Heute Morgen brannte es ihr jedoch so auf den Nägeln, dass sie das Hotelfrühstück gar nicht recht hatte genießen können. Sobald ein Besuch am Sonntagmorgen eben vertretbar war, hatte sie ihren Mann Michael zu dem hochherrschaftlichen Steinhaus in der Lower Stuart Street geschleppt, in dem Kevin und Christian ihre Praxisräume gemietet hatten.
»Juliet hatte … äh … sie hatte etwas in … in meiner Wohnung vergessen, und da …«
»Ich frag mal besser nicht, was«, meinte sein Vater belustigt. Michael hatte die gleichen strahlend blauen Augen und das Grübchenlächeln wie sein Sohn. Auch er hatte in jungen Jahren nichts anbrennen lassen – und auch ihm waren die Ausreden gerade Lizzie gegenüber nicht immer glatt von den Lippen gegangen.
Kevin versuchte, sich nicht einschüchtern zu lassen. »Juliet ist eine äußerst ehrbare junge Dame, die sich in Gesellschaft zu benehmen weiß«, verteidigte er seine Eroberung. »Sie erschien mir als durchaus adäquate Begleitung zu dem Empfang der Dunloes. Und Mr. Dunloe war ja auch sehr beeindruckt …«
»Was einiges über die Talente der jungen Frau aussagt«, kommentierte Lizzie bissig. »Mr. Dunloe mag beeindruckt gewesen sein. Mrs. Dunloe erschien mir eher peinlich berührt.«
Letzteres war ein wenig übertrieben. Claire Dunloe hatte zwar etwas indignierte Blicke auf Juliets auffälliges rotes Kleid und ihren Talmischmuck geworfen, aber ansonsten gab es eigentlich nichts anzumerken. Juliets Tischmanieren waren perfekt, sie wusste nichtssagend zu plaudern, und diesmal hatte sie sich auch mit dem Champagnerkonsum zurückgehalten. Aber dennoch hatte sie auf dem Empfang des Bankdirektors Dunloe und seiner Gattin Claire wie ein exotischer Fremdkörper gewirkt – wobei Lizzie eher an einen Feuerwerkskörper dachte. Diese junge Frau konnte für Zündstoff sorgen, da war sie sich sicher.
»Die Gesellschaft redet jedenfalls über sie«, meinte Lizzie. »Und so laut, dass es bis nach Tuapeka durchgedrungen ist.« Tuapeka, in dessen Nähe Lizzies und Michaels Farm lag, befand sich etwa vierzig Meilen von Dunedin entfernt und wurde seit dem Jahr 1866 Lawrence genannt. Lizzie und Michael konnten sich an die Namensänderung allerdings nie ganz gewöhnen. Nach Dunedin kamen die Drurys eher selten, aber eine Einladung des Bankdirektors mochten sie nun doch nicht ausschlagen. »Ich habe jedenfalls davon gehört, dass sie auf der Vernissage von Heather und Chloé gesungen hat!«
Kevin rieb sich die Stirn. Dieser Auftritt gehörte nicht zu seinen liebsten Erinnerungen, Juliet hatte es zweifellos übertrieben. Aber die Vernissage war unbestreitbar langweilig gewesen, die Bilder düster und die Leute wenig gesprächig. Dafür hatte es aber reichlich Champagner gegeben, dem Juliet schwer widerstehen konnte … Jedenfalls hatte sie sich, als die Unterhaltung nur noch dahinplätscherte, an die Musiker gewandt, und das Trio hatte sie schließlich beim Singen eines populären amerikanischen Schlagers begleitet. Die Reaktion der Dunediner Gesellschaft darauf war keineswegs ablehnend gewesen, wenn Kevin sich recht erinnerte. Auch er hatte vorher schon einige Gläser geleert. Allerdings … Überrascht hatten die Burtons und die Dunloes, die McEnroes und McDougals schon geguckt … Chloé, eine geschickte Gastgeberin, hatte die Situation schließlich gerettet, indem sie kurz mit der Sängerin sprach und sich dann mit deren Vorstellung an die Gäste wandte. Sie löste damit das Rätsel um ihren Namen und ihre Vorgeschichte, was allerdings für weiteren Gesprächsstoff sorgte: Juliet LaBree war gebürtige Amerikanerin und gehörte dem Ensemble einer in Wellington gastierenden Varietétruppe an. Zumindest noch einige Wochen zuvor …
»Wie kommt die ehrbare junge Dame denn überhaupt von Wellington hierher?«, erkundigte sich Michael, wobei er eher interessiert klang als inquisitorisch. Juliet hatte durchaus Eindruck auf ihn gemacht – wie wohl auf so ziemlich jedes männliche Wesen, vom Straßenfeger bis zum Bankdirektor. Und egal, wie eifrig die Herren ihren Damen zustimmten, wenn es darum ging, dass sie sicher nicht in die allerfeinste Gesellschaft gehörte: Ein bisschen beneideten sie Kevin alle um seinen Fang.