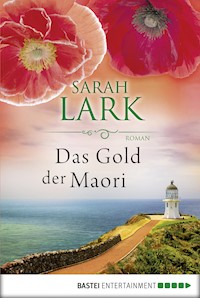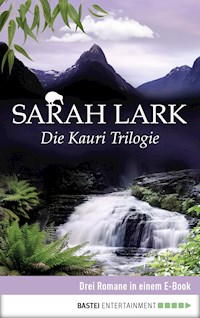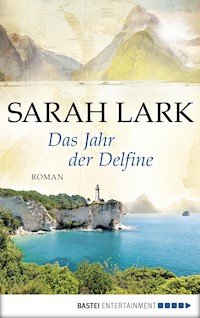Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Lübbe Audio
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Feuerblüten-Trilogie
- Sprache: Deutsch
- Neuseeland, Canterbury Plains, 1853. Auf Rata Station ist die nächste Generation herangewachsen: Cat und Ida sind stolz auf ihre wunderbaren Töchter Carol und Linda. Von den Nachbarn jedoch wird die Familie mit ihrer erfolgreichen Farm voller Neid betrachtet. Als ein schrecklicher Schicksalsschlag die Familie in tiefe Verzweiflung stürzt, ist Rata Station in Gefahr. Carol und Linda verlieren die Farm und damit ihr Zuhause und ihren Wohlstand. Aber sie sind bereit, für ihr Glück und ihre Zukunft zu kämpfen ...
Der zweite Band der SPIEGEL-Bestseller-Trilogie jetzt im Taschenbuch
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Zeit:9 Std. 34 min
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
SARAH LARK
DER KLANG DES MUSCHELHORNS
Roman
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Originalausgabe
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen.
Copyright © 2014 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat: Melanie Blank-Schröder
Landkarte: Reinhard Borner
Umschlaggestaltung: Johannes Wiebel, punchdesign, München
Einband-/Umschlagmotiv: Johannes Wiebel, punchdesign, München,
unter Verwendung von Motiven von © Shutterstock/leungchopan; Shutterstock/Scorpp; Shutterstock/B.S.Karan
Datenkonvertierung E-Book: Greiner & Reichel, Köln
ISBN 978-3-8387-5292-1
Sie finden uns im Internet unter:
www.luebbe.de
Bitte beachten Sie auch: www.lesejury.de
E rere kau mai te awa nui nei
Mai i te kahui maunga ki Tangaroa.
Ko au te awa
Ko te awa ko au.
The river flows
From the mountains to the sea.
I am the river
The river is me.
Lied der Maori-Stämme am Whanganui
(sehr frei ins Englische übersetzt)
Die Maori glauben, die Seele des Menschen wäre an seinem Geburtsort fest verankert und mit den Flüssen und Bergen seiner Heimat untrennbar verbunden.
MISSION
Russell − Neuseeland (Nordinsel)
Adelaide − Australien
1863
KAPITEL 1
»Ist es noch weit?«
Mara Jensch war schlecht gelaunt, und sie langweilte sich. Der Weg zum Dorf der Ngati Hine zog sich endlos hin, und obwohl die Landschaft unzweifelhaft schön war und das Wetter gut, hatte Mara genug von Manuka-, Rimo- und Koromiko-Bäumen, von Regenwäldern und Farndschungeln. Sie wollte nach Hause, zurück auf die Südinsel, zurück nach Rata Station.
»Höchstens noch ein paar Meilen«, antwortete Father O’Toole, ein katholischer Priester und Missionar, der gut Maori sprach und bei dieser Expedition als Übersetzer dabei war.
»Quengel nicht!«, mahnte Maras Mutter Ida, lenkte ihre kleine braune Stute neben Maras Schimmel und sah ihre Tochter strafend an. »Du hörst dich an wie ein ungezogenes Kind.«
Mara zog einen Flunsch. Sie wusste, dass sie ihren Eltern auf die Nerven fiel. Ihre Stimmung war schließlich seit Wochen schlecht. Die Reise auf die Nordinsel gefiel ihr überhaupt nicht. Weder konnte sie die Begeisterung ihrer Mutter für weite Strände und warmes Klima teilen noch das Interesse ihres Vaters an der Vermittlung zwischen Maori-Stämmen und englischen Siedlern. Mara sah darin für sich keine Notwendigkeit − ihr Verhältnis zu den Maori war hervorragend. Schließlich liebte sie einen Häuptlingssohn.
Eine Zeit lang verlor sich das Mädchen in Tagträumen, in denen es mit seinem Freund Eru über das endlose Grasland der Canterbury Plains wanderte. Mara hielt seine Hand, lächelte ihm zu … Vor ihrer Abreise hatten sie sogar schon zaghafte Küsse getauscht. Dann jedoch riss ein erschrockener Ausruf Mara aus ihren Fantasien.
»Was war das?« Der Vertreter des Gouverneurs, der Maras Vater für diese Mission angeheuert hatte, horchte furchtsam in den Wald. »Ich meine, ich hätte da etwas gesehen. Ist es möglich, dass sie uns ausspionieren?«
Kennard Johnson, ein kleiner, dicklicher Mann, dem das mehrstündige Reiten schwerzufallen schien, wandte sich nervös an die beiden englischen Soldaten, die er als Leibwächter mit sich führte. Mara und ihr Vater Karl konnten darüber nur lachen. Im Ernstfall hätten sie nicht das Geringste ausrichten können. Wenn der Maori-Stamm, zu dem ihre Gruppe unterwegs war, entschlossen gewesen wäre, Mr. Johnson zu massakrieren, so hätte er mindestens ein Regiment von Rotröcken gebraucht, um ihn daran zu hindern.
Father O’Toole schüttelte den Kopf. »Das muss ein Tier gewesen sein«, beruhigte er den Regierungsbeamten, um ihn mit seinen nächsten Worten erneut zu verunsichern. »Einen Maori-Krieger würden Sie weder sehen noch hören. Wir sind jetzt allerdings recht nah am Dorf. Natürlich werden wir beobachtet …«
Mr. Johnsons Blick wurde nun endgültig furchtsam. Maras Eltern sahen einander vielsagend an. Für Ida und Karl Jensch waren Besuche bei Maori-Stämmen nichts Ungewöhnliches. Wenn die beiden sich vor irgendetwas fürchteten, so höchstens vor einer Kurzschlussreaktion der pakeha, wie die Maori die englischen Siedler in Neuseeland nannten. Maras Eltern hatten da schon einiges erlebt. Gewalt zwischen Maori und pakeha ging nur selten von den Maori aus. Viel häufiger entlud sich die Furcht der Engländer vor den tätowierten »Wilden« in einem unüberlegten Schuss, der dann schlimme Folgen hatte.
»Bleiben Sie vor allem ruhig«, mahnte Karl Jensch jetzt noch einmal die anderen Teilnehmer der Expedition.
Neben den Regierungsvertretern begleiteten sie zwei Farmer, deren Beschwerden gegen die Ngati Hine die ganze Angelegenheit erst ausgelöst hatten. Mara musterte sie mit all dem Groll eines jungen Mädchens, dessen Pläne durchkreuzt worden waren. Ohne diese beiden Dummköpfe wäre sie längst auf dem Weg nach Hause. Ihr Vater hatte zur Schafschur auf Rata Station sein wollen, und die Schiffspassage von Russell ganz oben im Norden der Nordinsel nach Lyttelton Harbour auf der Südinsel war schon gebucht gewesen. Im letzten Moment war dann die Bitte des Gouverneurs an Karl Jensch ergangen, den Konflikt zwischen diesen Farmern und dem Häuptling der Ngati Hine möglichst gütlich beizulegen. Das sollte sich durch den schlichten Vergleich einiger Landkarten machen lassen. Karl hatte die Vermessungen vorgenommen und die Pläne gezeichnet, als Häuptling Paraone Kawiti einige Jahre zuvor Siedlungsland an die Krone verkauft hatte.
»Die Ngati Hine sind uns nicht feindlich gesinnt«, sprach Karl weiter. »Denken Sie daran – man hat uns eingeladen. Der Häuptling ist genau wie wir an einer friedlichen Lösung der Probleme interessiert. Es gibt keinen Grund, sich zu fürchten …«
»Ich fürchte mich nicht!«, fiel ihm einer der Farmer ins Wort. »Im Gegenteil! Die haben Grund, sich zu fürchten, die …«
»›Die‹«, bemerkte Maras Mutter Ida, »haben wahrscheinlich um die fünfzig bewaffnete Männer. Vielleicht haben sie nur Speere und Kriegskeulen, doch sie wissen damit umzugehen. Es wäre also vernünftig, Mr. Simson, sie nicht zu provozieren …«
Mara seufzte. Während des inzwischen fünf Stunden dauernden Rittes hatte sie sich schon drei oder vier ähnliche Unterhaltungen anhören müssen. Am Anfang waren die beiden Farmer sogar noch deutlich aggressiver gewesen. Sie schienen der Meinung zu sein, diese Expedition gelte weniger der Problemlösung als der Disziplinierung der Einheimischen. Jetzt, da die Reiter dem Maori-Dorf näher kamen – und den Farmern vielleicht auch aufging, wie weit sie sich von der nächsten pakeha-Siedlung entfernt hatten –, wurde zumindest einer der Männer ruhiger. Insgesamt war die Atmosphäre jedoch angespannt. Das änderte sich auch nicht, als das marae jetzt in Sicht kam.
Für Mara war das mit bunten Ornamenten geschmückte, von mannsgroßen Götterfiguren bewachte Tor des Dorfes ein gewohnter Anblick. Sah man esjedoch zum ersten Mal, konnte das einschüchtern. Kennard Johnson und seine Männer hatten vorher sicher noch nie ein marae betreten.
»Nicht feindlich gesinnt?«, fragte der Beamte beklommen. »Also für mich sehen die alles andere als freundlich aus …«
Der Vertreter des Gouverneurs wies verstört auf das zugegeben martialisch wirkende Empfangskomitee, dem sich die Reiter jetzt gegenübersahen. Auch Mara war verwundert, und ihre Eltern wirkten alarmiert. In einem Maori-marae hätte man eigentlich spielende Kinder sehen müssen sowie Männer und Frauen, die gelassen ihren Alltagsarbeiten nachgingen. Hier erwartete die Weißen jedoch nur der Häuptling, stolz und bedrohlich aufgebaut vor der Phalanx seiner Krieger. Sein nackter Oberkörper und sein Gesicht waren tätowiert. Der aufwendig gearbeitete rockartige Lendenschurz aus gehärtetem Flachs ließ seine Gestalt noch massiger wirken. Am Gürtel des Häuptlings hingen Kriegskeulen, in der Hand hielt er einen Speer.
»Die Kerle werden doch nicht angreifen?«, fragte einer der beiden englischen Soldaten.
»Ach was«, antwortete Father O’Toole. Der Priester, ein großer, hagerer Mann, der nicht mehr ganz jung war, stieg gelassen vom Pferd. »Die wollen Ihnen nur Angst machen.«
Das gelang dem Häuptling und seiner Truppe gleich noch besser. Als die Weißen näher kamen, hob Paraone Kawiti, ariki der Ngati Hine, seinen Speer. Seine Krieger begannen, rhythmisch aufzustampfen, breitbeinig vor- und zurückzutreten und dabei die Speere zu schwingen. Dazu erhoben sie die Stimmen zu einem düsteren Gesang. Er wurde umso härter und lauter, je schneller sie die Bewegungen ausführten.
Die Männer neben dem Beauftragten des Gouverneurs tasteten nach ihren Waffen. Die beiden Farmer suchten Schutz hinter den Soldaten. Der Missionar blieb gelassen.
Maras Vater lenkte sein Pferd zwischen die Soldaten und die Krieger. »Lassen Sie um Himmels willen die Waffen stecken!«, herrschte er die Engländer an. »Reagieren Sie einfach nicht. Warten Sie ab.«
Ob es an Karls zornigen oder Father O’Tooles begütigenden Worten lag: Die Delegation des Gouverneurs schaffte es, unbeeindruckt zu tun, obwohl nun ein Krieger nach dem anderen vortrat, seinen Speer auf den Boden stampfte, Grimassen schnitt und den »Feinden« Schmähungen entgegenspie.
Mara, die im Gegensatz zu ihren Eltern, den Farmern und den Regierungsvertretern jedes Wort des Kriegstanzes und Gesanges verstand, verdrehte die Augen. Auch dieses Getue der Maori auf der Nordinsel hielt nur auf. Der Stamm der Ngai Tahu, in dessen Nachbarschaft sie aufgewachsen war und zu dem ihr Freund Eru gehörte, verzichtete längst auf solche Demonstrationen der Stärke bei jeder Konfrontation mit den Weißen. Seit Erus Mutter Jane, eine pakeha, den Häuptling geheiratet hatte, begrüßte man sich dort einfach per Handschlag. Das vereinfachte den Umgang mit Besuchern und Geschäftsfreunden. Die meisten pakeha kamen zum marae der Ngai Tahu, um Geschäfte zu machen. Erus Mutter und sein Vater Te Haitara hatten eine erfolgreiche Schafzucht aufgebaut, mit deren Hilfe der Stamm reich geworden war.
»Dem Ritual zufolge sollten wir jetzt … hm … auch etwas singen«, murmelte Father O’Toole, als die Krieger ihren Tanz endlich beendet hatten. »Das gehört sozusagen zur gegenseitigen Vorstellung. Natürlich wissen die Leute hier, dass dies bei den pakeha nicht üblich ist. Sie tun jetzt so kriegerisch, aber eigentlich sind sie recht zivilisiert. Der Häuptling hat den Fahnenmast wieder aufstellen lassen, den Hone Heke damals in Russell gekappt hat … Himmel, ich hab den Mann selbst getauft …«
Diese Rede sollte sicher tröstlich wirken. Sie klang jedoch so, als zeigte sich O’Toole überrascht und nicht wenig beunruhigt über Paraone Kawitis Rückfall in alte Stammesrituale.
Mara überlegte, ob die Prozedur sich durch ein Lied etwas abkürzen ließ. Wenn dieser Vergleich der Karten schnell über die Bühne ging, konnten sie vielleicht noch am Abend nach Russell zurückreiten – und dann am kommenden Morgen ein Schiff zur Südinsel nehmen. Sollte es jetzt allerdings Streit geben und die Männer diskutierten endlos über das weitere Vorgehen, dann kam sie hier nie weg.
Mara schob ihr hüftlanges dunkles Haar zurück, das sie für den Besuch bei den Maori nicht geflochten hatte, sondern offen trug wie eine Einheimische. Dann trat sie wie selbstverständlich vor.
»Ich kann ja etwas singen«, bot sie an und zog ihr Lieblingsinstrument, eine kleine Koauau, aus der Tasche.
Ebenso bestaunt von den pakeha wie von den gerade noch grimmig die Zähne fletschenden Kriegern hob sie die Flöte zur Nase und blies eine Melodie. Dann begann sie zu singen: ein schlichtes, im Gegensatz zu dem martialischen Kriegsgeschreifast verstörend melodisches Lied, das die Landschaft der Canterbury Plains auf der Südinsel beschrieb. Die endlosen Weiten wogenden Grases, die Flüsse gesäumt von Raupo-Dickicht, die schneebedeckten Berge, zwischen denen sich glasklare, fischreiche Seen verbargen. Das Lied gehörte zu einem powhiri, der förmlichen Begrüßung in einem marae, die mit Gesängen und Tänzen in traditioneller Kleidung verbunden war und dazu diente, Einheimische und Gäste zu einer Einheit zu verbinden. Ein wandernder Stamm stellte sich seinen Gastgebern vor, indem er seine Heimat beschrieb. Mara trug das Lied schlicht und selbstsicher vor. Sie verfügte über eine reine Altstimme, an der sich die Maori-Musiker ihrer Heimat ebenso begeistern konnten wie ihre englische Hauslehrerin.
Auch an diesem Tag blieben ihre Zuhörer nicht unbeeindruckt. Nicht nur, dass der Häuptling und seine Männer ihre Waffen sinken ließen, es regte sich nun auch etwas in den mit Schnitzereien geschmückten Holzhäusern rund um den Versammlungsplatz. Eine alte Frau trat aus dem wharenui, dem Gemeinschaftshaus, gefolgt von einer Gruppe junger Mädchen in Maras Alter. Entschlossen führte sie ihre Schäfchen vor die Krieger und ließ sie ebenfalls ein Lied anstimmen. Die Mädchen sangen von den Schönheiten der Nordinsel, den endlosen weißen Stränden, den tausend Farben des Meeres und den Geistern der heiligen Kauri-Bäume, die über weite grüne Hügel wachten.
Mara lächelte und hoffte, dass die Ngati Hine das jetzt nicht zum Anlass nahmen, das gesamte powhiri durchzuführen. Das konnte Stunden dauern. Tatsächlich beließ es die Frau – offenbar eine Stammesälteste – dann aber doch bei einem Lied. Danach trat sie auf die beiden Frauen in der Gruppe der pakeha zu. Ida, der Älteren, bot sie das Gesicht zum hongi, dem traditionellen Gruß. Misstrauisch beäugt von den Farmern, Johnson und den Soldaten legten die Frauen Nase und Stirn aneinander.
Karl Jensch und Father O’Toole wirkten erleichtert. Auch Mara atmete auf. Endlich ging es voran.
»Ich habe Geschenke mitgebracht«, sagte Ida. »Meine Tochter und ich wollen beim Stamm bleiben, während die Männer die Missverständnisse klären. Natürlich nur, wenn es euch recht ist. Wir wussten nicht, wie ernst es ist mit diesem Streit um das Land.«
Mara übersetzte bereitwillig, und die Frau nickte. Sie bedeutete Ida, sie seien willkommen.
Karl und der Übersetzer sprachen inzwischen mit dem Häuptling. Paraone Kawiti äußerte sich zunächst feindlich, schien dann aber bereit, Karls Anregung zu folgen und gemeinsam zu prüfen, wem die Landstriche, auf die Farmer und Maori gleichermaßen Anspruch erhoben, tatsächlich gehörten.
Die alte Frau, die eben die Mädchen herausgeführt und den vorläufigen Friedensschluss eingeleitet hatte, begab sich eifrig in eines der Häuser. Gleich danach kam sie mit einer Kopie der Vertragsformulare und Karten wieder heraus, die der Stamm beim Verkauf seines Landes erhalten hatte. Alles war ordentlich zusammengelegt, ganz offensichtlich gehütet wie ein Heiligtum.
Mara beobachtete mit mäßigem Interesse, wie Karl die Papiere vorsichtig entfaltete und sein eigenes Material danebenlegte.
»Darf ich fragen, welches die umstrittenen Ländereien sind, Mr. Simson und Mr. Carter?«, wandte er sich dann an die Farmer. »Das würde uns Zeit ersparen. Wir müssen dann nicht das ganze Land umreiten.«
Mara hoffte, dass sich die beiden aufs Kartenlesen verstanden. Leider wies nur einer, Pete Carter, schnell und gezielt auf ein Gebiet, das direkt an der Grenze zum verbleibenden Land der Maori lag.
»Ich hab’s gekauft, weil ich meine Schafe dort grasen lassen wollte. Dann stellte ich fest, dass die Maori-Frauen darauf einen Acker angelegt hatten. Und als ich die Schafe trotzdem hintrieb, standen da plötzlich Kerle mit Speeren und Musketen und verteidigten ›ihr Land‹!«
»Gut«, meinte Karl. »Dann begeben wir uns da gleich einmal hin. Ariki, Sie werden uns doch begleiten, oder? Und was ist mit Ihrem Land, Mr. Simson?«
Der vierschrötige, rotgesichtige Farmer schob sich vor, konnte mit der Karte allerdings wenig anfangen. Dafür wies die alte Maori-Frau mit dem Finger auf eine Stelle auf dem Papier.
»Hier. Land gehören nicht ihm, nicht uns«, erklärte sie in erstaunlich gutem Englisch. »Gehört Götter. Wohnen Geister. Er nicht machen kaputt!«
»Da hören Sie’s!«, höhnte Simson. »Sie sagt selbst, es gehört ihnen nicht. Also …«
»Hier ist es als Maori-Land eingetragen«, sagte Karl streng. »Sehen Sie die kleine Ausbuchtung auf der Karte? Die Stelle muss sie meinen. Wir werden uns das jetzt ebenfalls ansehen. Kommen Sie, ariki, Father O’Toole … Je eher wir aufbrechen, desto schneller ist die Sache geklärt. Und Sie, Mr. Johnson, machen Mr. Simson und Mr. Carter bitte klar, dass sie die Entscheidungen zu akzeptieren haben. Mir schwant nämlich schon, was da auf uns zukommt …«
Karl ging zu seinem Pferd, und Ida und Mara folgten ihm, um die Geschenke für die Maori-Frauen aus ihren Satteltaschen zu nehmen. Es waren nur kleine Dinge − bunte Tücher, etwas billiger Schmuck und ein paar Säckchen mit Saatgut. Praktischere Geschenke wie Decken oder Kochgerät hatten sie auf den Pferden nicht transportieren können. Mara erkannte jedoch mit einem Blick auf die jetzt aus den Häusern strömenden Frauen, dass sie das auch nicht nötig hatten. Der Stamm war offensichtlich begütert, der Häuptling musste die Erlöse aus den Landverkäufen gerecht verteilt haben. Die Frauen und Kinder trugen größtenteils pakeha-Kleidung, besser geeignet für das Klima in Neuseeland als die traditionellen, aus Flachs gewebten Trachten der Maori. Viele trugen kleine Holzkreuze an Lederbändern um den Hals. Sie ersetzten die winzigen Götterfiguren, die die Stämme aus Pounamu-Jade schnitzten. Einige der Frauen strebten vertrauensvoll auf Father O’Toole zu, sprachen mit ihm und ließen sich segnen.
»Wir alle Christen!«, erklärte eine junge Frau der verwunderten Ida und berührte stolz ihr Kreuzchen. »Getauft! Mission Kororareka!«
»Unsere Mission bei Russell besteht seit 1838«, fügte Father O’Toole stolz hinzu. »Sie wurde von französischen Dominikanerpatern und Maristenpadres und -schwestern gegründet.«
»Das sind … Katholiken?«, vergewisserte sich Maras Mutter etwas unsicher.
Sie selbst war in einer strengen Gemeinde der Altlutheraner aufgewachsen. »Papisten« hatte man ihr dort stets eher als Antichristen denn als Mitbrüder und -schwestern in Jesu dargestellt.
Mara hatte sich über die Unterschiede zwischen den christlichen Glaubensrichtungen nie großartig Gedanken gemacht. In der Nähe von Rata Station gab es keine Kirche, ein regelmäßiger Besuch von Gottesdiensten war den Kindern also nicht möglich. Ida betete mit ihren Töchtern, sofern sie zu Hause war. Wenn sie ihren Mann auf seinen Reisen als Landvermesser begleitete, blieben Mara und ihre Schwestern allerdings unter der Aufsicht von Catherine Rata. Idas Freundin und die »zweite Mutter« der Mädchen, betete nicht zum Gott der Christen. Sie war bei einem Maori-Stamm aufgewachsen und brachte den Kindern eher die Götter und Geister der Einheimischen nahe. Zu diesem Glaubensgemisch kam dann noch ein bisschen Anglikanismus. Maras Hauslehrerin, Miss Foggerty, hatte unter anderem mit Inbrunst, aber ohne viel Erfolg, Religionsunterricht erteilt. Die Kinder hatten die strenge, humorlose Frau nicht leiden können. Bevor sie zu ihrem Gott beteten, wandten sie sich lieber mit ein paar Verwünschungen an die Geister. Mara und Eru hätten Miss Foggerty zu gern nach England zurückgezaubert. Geglückt war das nicht. Mara konnte sich an kein Gebet erinnern, das je erhört worden wäre.
Father O’Toole lächelte. »Ich für meinen Teil bin Ire, bei uns sind alle Katholiken. Doch so wichtig finde ich das hier gar nicht. Egal, über welche Glaubensrichtung die Maori zu Gott finden – entscheidend ist, dass es uns gelingt, sie vom Götzendienst abzubringen.«
»Wichtig ist, sie friedlich zu halten«, brummte Karl. Auch er wollte endlich weiter. Es brannte ihm auf der Seele, dass er Cat und seinen Freund und Kompagnon Chris Fenroy mit der Schafschur allein ließ. »Also kommen Sie jetzt, Father, Ihre Schäfchen können Sie hinterher zählen.«
Die Männer machten sich auf den Weg, Ida und Mara schlossen sich der jungen Frau an, die ihnen eben das Kreuz gezeigt hatte. Sie sprach ein paar Worte Englisch und bedeutete Ida, den Frauen bei den Vorbereitungen für ein großes Fest am Abend behilflich zu sein. Aufgeregt miteinander plaudernd brachten sie Süßkartoffeln und Raupo-Knollen auf den Versammlungsplatz, um sie zu schälen und zu zerkleinern. Andere nahmen Vögel und Fische aus, die sie über offenen Feuern zu garen gedachten.
Ida griff selbstverständlich zu Schälmesser und Gemüse. Mara fand, dass ihre Mutter in der Runde der Frauen kaum auffiel. Ida Jensch hatte dunkles glattes Haar, das sie natürlich aufgesteckt trug, doch das wurde inzwischen auch Mode bei vielen Maori-Frauen. Idas Teint war nicht mehr so hell wie früher, die Sonne der Nordinsel hatte ihre Haut gebräunt. Lediglich ihre sehr hellen porzellanblauen Augen hätten sie gleich als Außenseiterin zu erkennen gegeben – und natürlich ihre mangelnden Sprachkenntnisse.
»Verstehe ich das richtig, Mara, die planen hier ein Fest?«, fragte sie ihre Tochter. »Ich meine … das ist natürlich sehr nett. Nur ein wenig befremdlich, oder? Vorhin haben sie uns noch mit einem Kriegs-haka begrüßt. Der Häuptling trat auf, als wollte er sich auf uns stürzen … Und gleich darauf wird ein großes Essen für uns organisiert?«
Mara war das auch schon aufgefallen, und es machte sie nicht gerade glücklich. Ein Fest würde eine Übernachtung bei den Ngati Hine nach sich ziehen.
»Das Fest ist nicht für uns, Mamida«, gab sie jetzt Auskunft. Sie hatte eben ein paar gleichaltrige Mädchen danach gefragt. »Das planen sie schon länger. Kawa, die Frau des Häuptlings, ist ganz aufgeregt deswegen. Sie erwarten heute Abend einen Missionar, oder besser einen Reverend. Te Ua Haumene ist ein Maori aus einem Stamm in der Region Taranaki. Er wurde in einer dortigen Mission erzogen und studierte die Bibel. Dann diente er in anderen Missionen, vielleicht wurde er sogar zum Priester geweiht. Genau wissen die Mädchen das nicht. Jetzt jedenfalls ist er eine Art Prophet. Irgendwelche Götter haben ihm etwas Wichtiges offenbart. Darüber will er heute predigen.«
»Aber es gibt keine neuen Propheten«, wandte Ida streng ein. »Nur Gott und Jesus und den Heiligen Geist. Wenn es neue Offenbarungen gäbe, dann … dann müsste man ja die Bibel umschreiben.«
Mara zuckte die Schultern und seufzte. »Ich fürchte, wir werden es bald hören. Sofern sich Vater und Mr. Johnson und diese Farmer nicht gänzlich mit dem Häuptling zerstreiten. Die Frauen jedenfalls haben uns schon zum Gottesdienst eingeladen, und Father O’Toole wird sicher bleiben wollen. Auch wenn dieser Haumene wohl Anglikaner ist oder war oder was auch immer.«
»O ja, Father O’Toole große Mann, gute Christ!«, mischte sich eine junge Maori-Frau ein, die neben Ida Gemüse putzte. Sie schien sehr stolz auf ihr gebrochenes Englisch. »Uns gelesen Geschichte von Bibel in unsere Sprache. Und jetzt noch besser!« Die Frau war sichtlich erfreut. »Jetzt Te Ua Haumene eigene Prophet Maori. Schreibt eigene Bibel für eigene Volk!«
KAPITEL 2
Die Männer kehrten kaum zwei Stunden nach ihrem Aufbruch zurück. Der Häuptling und die Stammesälteste, die neben den Pferden der pakeha hergelaufen waren, wirkten euphorisch, Kennard Johnson und seine Männer entspannt. Selbst der Farmer Carter schien zufrieden zu sein. Nur Simson schäumte.
»Ich lass das nicht auf sich beruhen, da können Sie sicher sein!«, erklärte er Karl Jensch und Father O’Toole, deren gelangweilten Mienen zufolge zum wiederholten Mal. »Ich wende mich an den Gouverneur, an die Krone. England muss das Recht eines Mannes schützen!«
»In England könnten Sie auch nicht losgehen und die Bäume Ihres Nachbarn umhauen«, beschied ihn Kennard Johnson mit rüden Worten. »Gut, vielleicht würde der sie nicht gleich mit dem Tod bedrohen. Da hat der Häuptling sicher etwas überreagiert …«
»Für den Stamm ist dieser Baum heilig«, warf Karl ein. »Und Sie haben ihn doch auch gesehen. Ein prachtvoller Kauri, bestimmt Hunderte, wenn nicht Tausende Jahre alt!«
»Hunderte, wenn nicht Tausende Dollar wert!«, rief Simson. »Das ist bestes Holz, da lecken sich die Leute in Wellington die Finger nach. Und hier … Dabei sagt die Alte doch selbst, sie wollten das Land gar nicht.«
Er wies auf die Stammesälteste, die gelassen neben dem Häuptling dahinschritt und Simson keines Blickes würdigte. Dabei verstand sie seine Rede sicher zumindest in Teilen.
»Das hat sie so nicht gesagt«, berichtigte Karl. »Sie beansprucht selbstverständlich das Land, und das hat sie damals schon bei der Landnahme deutlich gemacht. Ich habe Ihnen die Karte gezeigt. Allerdings nicht für sich, sondern für ihre Geister, denen der Baum gehört. Das muss man respektieren.«
»Ich denke, die Kerle sind getauft!« Simson ließ nicht locker, auch als die Männer jetzt abstiegen und ihre Pferde anbanden. »Was sagen Sie denn dazu, Reverend?«
Mara schob sich näher heran. Wenn ihr Vater nicht absattelte, bestanden gute Chancen, dass es gleich weiterging. Vielleicht kam sie ja doch noch um diesen Gottesdienst herum. Ihre Hoffnung erfüllte sich jedoch nicht. Karl klopfte seinem Pferd den Hals und nahm ihm den Sattel ab.
»Father«, berichtigte O’Toole, der aussah, als hätte er in eine Zitrone gebissen. »Ich bin da, ehrlich gesagt, etwas hin- und hergerissen, Mr. Simson. Mein Glaube gebietet mir, einen Baum wie diesen zu fällen, in der Tradition des heiligen Bonifatius. Es ist gottlos, Pflanzen und Tiere anzubeten. Der Herr sagt, wir sollen keine Götter neben ihm haben. Andererseits ist es ein schöner Baum, ein prachtvolles Beispiel für die Wunder Seiner Schöpfung.«
»Mr. Simson, es kommt gar nicht darauf an, was Father O’Toole dazu sagt«, unterbrach Karl den Sermon des Priesters. »Oder darauf, ob das ein besonderer Baum ist oder eine Südbuche wie tausend andere. Es kommt nur darauf an, ob der Baum auf Ihrem Land steht oder auf dem Land Ihrer Nachbarn. Und in diesem Fall gehört das Land eindeutig den Ngati Hine. Der Baum damit auch, also lassen Sie ihn gefälligst unbehelligt.«
»Und glauben Sie bloß nicht, dass Sie irgendwie damit durchkommen, wenn sie den Kauri trotzdem fällen«, fügte Kennard Johnson hinzu. »Die Krone wird keinen Krieg anfangen, wenn Paraone Kawiti Sie deshalb massakriert. Es gibt Präzedenzfälle. Denken Sie an den Wairau-Konflikt!«
Damals waren etliche Engländer zu Tode gekommen, nachdem ein Mitglied der pakeha-Truppe eine Häuptlingsfrau erschossen hatte. Der Gouverneur hatte die Schuld später für die Kolonisten auf sich genommen und sich bei den Maori entschuldigt, statt seine Leute zu rächen.
Simson ritt schließlich verärgert ab, während der Häuptling nun auch die Männer der Kommission zum Fest und zur Predigt des »Propheten« einlud. Carter blieb. Für ihn war die Entscheidung wohl positiv ausgefallen. Als Karl eine Flasche Whiskey aus seiner Satteltasche zog und zur Feier des Friedensschlusses kreisen ließ, nahm er ein paar kräftige Schluck. Kurz darauf saß er mit den englischen Soldaten an einem Feuer, umschwärmt von ein paar kichernden Maori-Mädchen.
Mara sah ihre Hoffnungen auf einen baldigen Aufbruch weiter schwinden.
»Heißt das, wir bleiben über Nacht?«, wandte sie sich an ihren Vater, den sie auf der Suche nach ihrer Mutter begleitete.
Karl zuckte die Schultern. »Sieht fast so aus, Mara. Father O’Toole ist ganz erpicht darauf, diesen Prediger zu hören, und Mr. Johnson bewegt sich, als täte ihm jetzt schon alles weh. Sehr unwahrscheinlich, dass der sich heute noch mal auf ein Pferd setzt.«
Mara verzog den Mund. »Ich dachte …«
»Ich kann’s nicht ändern, Mara«, unterbrach Karl sie ein bisschen ungeduldig. »Du weißt, mich zieht es auch nach Rata Station – und aus gewichtigeren Gründen als dich, meine Süße. Du willst doch nur nach Hause, um möglichst schnell wieder mit Eru anzubandeln, und das gibt erfahrungsgemäß nur Schwierigkeiten. Jane wird ihren Sohn mit Zähnen und Klauen verteidigen …«
Mara blitzte ihren Vater an. »Ich kann auch ganz schön gemein sein«, erklärte sie.
Karl lachte. »Wenn Eru und du erwachsen seid, Mara, kannst du dich mit seiner Mutter um ihn schlagen. Oder ihr lasst ihn einfach selbst entscheiden. Aber jetzt bist du gerade mal fünfzehn und er erst vierzehn, wenn ich mich richtig erinnere. Da werdet ihr euch Janes Wünschen beugen müssen. Deine Mutter und ich sind da übrigens ganz ihrer Meinung. Grundsätzlich ist dein Eru zwar ein netter Junge, und vielleicht werdet ihr auch irgendwann mal ein Paar. Doch das hat noch ein paar Jahre Zeit. Derzeit seid ihr viel zu jung. Ah, da ist Ida ja.«
Karl gesellte sich zu seiner Frau, um von seinen Erlebnissen mit den Farmern und den Maori zu berichten. Mara verkniff sich ein paar böse Bemerkungen bezüglich seiner Ausführungen zum Thema Eru. Ida und Karl würden ihr doch nicht zuhören. Also lauschte sie widerwillig seiner Erzählung.
»Dieser Simson kann froh sein, dass er seinen Vorstoß überlebt hat«, begann Karl. »Eine Priesterin hat ihn dabei erwischt, gleich als er Anstalten machte, die Axt zu schwingen, um ihren heiligen Kauri-Baum umzulegen. Sie hat einen Riesenradau gemacht, was ein paar Krieger mitbekamen, die ihn dann sofort stoppten. Nicht auszudenken, wenn es ihm gelungen wäre, den Baum zu fällen!«
Ida nickte. »Und der andere?«, fragte sie. »Weshalb gab es Streit mit Mr. Carter?«
Karl lächelte. »In dem Fall lag der Fehler bei den Maori. Du kennst sie ja, für sie gehört das Land demjenigen, der es nutzt. Und da Carter dieses Feld weder bestellt noch beweidet hat, während eine der Frauen gern ihr Kumara-Feld ausgeweitet hätte, hat sie es einfach umgegraben. Sie verstand gar nicht, weshalb er sich deshalb so aufregte, aber er sollte auch nicht ihren Acker zerstören. Jetzt haben wir das geklärt, und alle haben sich geeinigt: In diesem Jahr wird die Frau ihre Kartoffeln noch ernten und Mr. Carter die Hälfte abgeben. Im nächsten Jahr bestellt sie das Land nicht mehr. Im Grunde war das nicht mehr als ein Missverständnis. Dem Farmer ging es auch gar nicht um den halben Morgen Acker. Er hatte nur Angst, der Stamm würde jetzt so weitermachen.«
»Dann ist ja wenigstens in dem Fall alles gut.«
Ida hakte sich bei ihrem Mann ein, und die beiden gingen zu den inzwischen schon fröhlich lodernden Feuern. Mara folgte ihnen. Die Frauen hatten eben mit dem Kochen und Braten begonnen. Aromatische Düfte verbreiteten sich im Dorf, und bei Mara regte sich Hunger. Vor dem Essen war jedoch noch die Predigt zu überstehen.
Als die Dämmerung langsam hereinbrach, meldete ein kleiner Junge, dass sich drei Krieger der Ansiedlung näherten. »Te Ua Haumene! Er kommt!«
Ida runzelte die Stirn. »Was ist der Mann denn jetzt? Krieger oder Priester, Prediger oder Prophet?«
Father O’Toole, der sich neben Ida, Mara und Karl an einem der Feuer niedergelassen hatte, zuckte die Schultern. »Ich weiß es nicht. Ich kenne ihn nicht, wir sind ja eine katholische Mission. Ich habe nur von ihm gehört. Und ich hoffe, er ist wirklich eine Bereicherung für das Christentum in diesem Land. Das heute mit dem Baum, den die Maori anbeten – Sie können das vielleicht nicht verstehen, aber für mich ist das wie … wie eine Ohrfeige, wie ein Zusammenbrechen meines Lebenswerks. Ich kenne diesen Stamm seit Jahrzehnten, ich habe die Kinder unterrichtet, die Leute getauft … Und nun das! Vielleicht sollte ich nach Irland zurückgehen.«
Der Missionar wirkte deprimiert. Karl reichte ihm die Whiskeyflasche.
»So schnell können die sich einfach nicht von ihren Göttern und Geistern verabschieden«, sagte er tröstend. »Vielleicht ist das gar nicht so schlimm. Haben Sie in Irland nicht auch noch nach tausend Jahren Christentum ihre Lepichans? Oder wie heißen die Zwerge, denen Sie Hütten in Ihren Gärten bauen?«
Über das Gesicht des Geistlichen zog ein leichtes Lächeln. »Leprechauns meinen Sie. Und diese Hütten … Ich hab meine Landsleute im Verdacht, darin die Whiskeyvorräte vor ihren Frauen zu verstecken. Aber gut, wenn Sie es so sehen …«
»Genau so muss man es wahrscheinlich sehen«, meinte Karl. »Also seien Sie den Leuten nicht böse. Ich persönlich finde das Verhalten von diesem Simson viel skandalöser. Der meint im Ernst, er könnte mit dem Stamm machen, was er will und stünde damit unter dem Schutz der englischen Krone.«
O’Toole seufzte. »Ja. Unsere weißen Landsleute sind auch nicht alle die besten Christen. Manchmal … Ach, hören Sie nicht auf mich, mitunter empfinde ich nur noch Überdruss. Die Maori, die sich taufen lassen und dann doch machen, was sie wollen … die unsinnigen Kriege in den letzten Jahren, weil ein dickköpfiger, wahrscheinlich betrunkener Häuptling einen Fahnenmast umschlug und die Behörden das gleich als persönlichen Angriff auf die Krone sehen mussten … Die Landnahmen, gegen die sich die Eingeborenen verständlicherweise wehren … Leute wie dieser Simson … Wenn dann ein Maori-Christ auftaucht und als Lehrer wirken will, nehme ich das mal als ein aufscheinendes Licht in dunkler Nacht. Ich hoffe nur, ich werde nicht wieder enttäuscht.«
Te Ua Haumene war ein stattlicher Mann in mittleren Jahren. Er hatte ein großflächiges Gesicht und war nicht tätowiert. Zwischen Nase und Mund verliefen scharfe Falten. Der »Prophet« trug einen Wangenbart, über seinen etwas schläfrig wirkenden dunklen Augen wölbten sich dichte Brauen. Seine Kleidung entsprach weder der Soutane eines katholischen Priesters noch dem traditionell schwarzen Anzug des anglikanischen Missionars. Er trug die Tracht eines wohlsituierten Maori − ein sehr fein gewebtes Obergewand über einem rockartigen Schurz aus Flachs, darüber bauschte sich ein wertvoller Mantel, eines Häuptlings würdig. Seine Begleiter waren einfacher gewandet. Sie trugen Kriegerkleidung. Der Prediger und seine Männer wären überall als ein ariki mit seiner Leibgarde durchgegangen.
Father O’Toole verfolgte mit steinerner Miene, wie die Frauen des Dorfes Te Ua Haumene genauso begeistert entgegenliefen und devot um seinen Segen baten, wie sie es eben bei ihm selbst getan hatten. Die Männer hielten sich zurück, wenngleich zwei der Dorfältesten und ein Verwandter des Häuptlings den hongi mit dem Prediger tauschten. Paraone selbst tat das nicht – ariki der Nordinselstämme hielten stets Abstand zu ihren Untertanen.
Te Ua Haumene und seine Männer nahmen den ihnen von der Frau des ariki angebotenen Platz am zentralen Feuer gern ein. Sie waren offenbar hungrig nach der Wanderung. Der Prophet kam aus Taranaki, predigte jedoch jeden zweiten oder dritten Tag bei einem anderen Stamm, der ihm und seinen Leuten Unterkunft gewährte. Die Ngati Hine taten das sichtlich gern. Sie ehrten ihre Besucher durch hervorragendes Essen und aufwendige Begrüßungszeremonien. Zwischendurch wies die Frau des Häuptlings auch immer mal wieder auf Father O’Toole, und die anderen Dorfbewohner zeigten Te Ua ihre Kreuze. Dieser schien jedoch nicht den Wunsch zu haben, den Priester kennenzulernen. Er grüßte kaum merklich zu ihm hinüber.
»Vielleicht hat er was gegen Papis… äh … Katholiken«, versuchte Ida, den Geistlichen zu trösten, den das Verhalten des Predigers erkennbar verletzte. »Er wurde doch bei den Anglikanern erzogen.«
Father O’Toole zuckte die Schultern. Karl reichte ihm die Whiskeyflasche, und er nahm sie dankbar an.
Mara wünschte sich, auch einen Schluck nehmen zu dürfen. Sie war inzwischen satt und langweilte sich schon wieder. Diese Reise schien kein Ende zu nehmen.
Als Te Ua Haumene sich endlich erhob, um zu den Menschen zu sprechen, war es bereits dunkel geworden. Der Mond stand leuchtend am Himmel, und sein Licht verband sich mit dem Flackern der Feuer zu einer fast gespenstischen Szenerie. Der Wind wehte dem Propheten das lange Haar aus dem Gesicht.
»Sei willkommen, Wind!«, begann Te Ua Haumene seine Rede. Er sah seine Zuhörer dabei nicht an, sein Blick schien sich im Himmel zu verlieren. »Begrüße deinen Boten!«
Father O’Toole übersetzte simultan für Karl und Ida.
»Boten?«, fragte Letztere.
»Haumene heißt ›Mann des Windes‹«, bemerkte Mara und stand auf, um sich etwas Wasser zu holen. Da alle anderen längst ruhig dasaßen und den Worten Te Ua Haumenes andächtig lauschten, fiel sie damit auf. Ein ungnädiger Blick des Propheten streifte sie.
»Hört durch meinen Mund die Worte Gottes. Der Wind weht uns seinen Geist zu, die gute Botschaft, das neue Evangelium – ich bringe es zu den Gläubigen!«
»Pai Marire!«, skandierten die beiden Männer des Propheten.
»Pai Marire!«, rief Te Ua, und seine Zuhörer wiederholten es im Chor.
»Das heißt ›friedlich‹, nicht?«, fragte Karl seine Tochter und den Priester.
Beide nickten.
»Gut und friedfertig, genau«, übersetzte O’Toole. »So nennen sie ihre religiöse Bewegung. Oder auch Hauhau.«
»Aber ein neues Evangelium?«, zweifelte Ida.
Der Priester machte erneut ein missmutiges Gesicht.
»So seid begrüßt, mein Volk, mein auserwähltes Volk …«
Te Ua Haumene hielt kurz inne, wie um seine Worte wirken zu lassen. O’Toole stöhnte leise auf.
»Ich bin hier, um euch zu versammeln«, fuhr Te Ua fort, »in Seinem Namen. Euch zu rufen, wie ich selbst gerufen wurde durch den größten aller Häuptlinge – durch Te Ariki Makaera, den Befehlshaber der Truppen des Himmels.«
»Hm?«, fragte Karl.
»Er meint den Erzengel Michael«, sagte O’Toole gallig.
»Seht, ich bin einer von euch, ich bin Maori, geboren in Taranaki, aber die pakeha verschleppten mich und meine Mutter nach Kawhia. Ich diente ihnen wie ein Sklave, doch ich zürne ihnen nicht, denn es war Gottes Wille, dass ich ihre Sprache lernte und ihre Schrift. Ich studierte die Bibel, Gottes Wort, und ich ließ mich taufen, weil ich sicher war, der Glaube der pakeha könnte mich in ein besseres Leben leiten. Doch dann erschien mir Te Ariki Makaera und offenbarte mir, ich solle nicht der Geführte sein, sondern der Führer. Wie einst Moses sein Volk aus der Knechtschaft leitete, so bin auch ich erwählt. Ich soll euch künden von Gottes Sohn, Tama-Rura, den die pakeha Jesus nennen, wenngleich mir offenbart wurde, dies sei nur ein anderer Name für den Erzengel Gabriel.«
»Der Mann ist verrückt«, murmelte Ida.
»Der Mann ist gefährlich«, stieß Karl hervor.
»Und sie alle, sie alle warten nur mit dem Speer und dem Schwert in der Hand, ihr auserwähltes Volk in die Freiheit zu geleiten.«
»Pai Marire!«, riefen die Männer, und die Dörfler wiederholten es laut.
»Güte und Friede … Passen dazu Schwerter?«, fragte Ida.
Mara zog resigniert die Augenbrauen hoch – eine Geste, mit der sie Erwachsenen zurzeit gern demonstrierte, was sie von ihnen und ihren Ideen hielt.
»Denn ihr seid nicht frei, mein auserwähltes Volk!«, donnerte der Prediger jetzt in die Menge. »Ihr teilt euer Land mit den pakeha, und oft genug glaubt ihr, sie wären eure Freunde, weil sie euch Geld geben und Sachen, die ihr damit kaufen könnt. Doch wahrlich, ich sage euch: Sie geben es euch nicht umsonst! Sie nehmen euer Land, sie nehmen eure Sprache, sie werden euch auch eure Kinder nehmen!«
Die Frauen reagierten mit Ausrufen des Erschreckens, die Männer zum Teil mit Protest.
»Ihr habt diese Menschen nicht eingeladen, sie sind einfach gekommen, um euer Land zu nehmen …«
Karl wollte noch eingreifen, aber Father O’Toole neben ihm war bereits aufgesprungen.
»Wir brachten euch auch den Gott, den du gerade lästerst!«, schrie er dem Prediger zu.
Te Ua Haumene blitzte ihn an. »Ihr mögt das Kanu gewesen sein, auf dem der wahre Gott nach Aotearoa kam«, spie er dem Missionar entgegen. »Aber manchmal muss man das Kanu verbrennen, wenn man in einem Land wirklich heimisch werden will. Gott wird noch da sein, wenn wir die pakeha längst aus unserem Land vertrieben haben. Wenn sie weggeweht wurden durch den Wind! Pai Marire, hau hau!«
Father O’Toole ließ sich fassungslos zurück auf seinen Platz am Feuer fallen. Er rieb sich die Stirn, während immer mehr der Menschen, die er bekehrt und getauft hatte, den Geist Gottes im Wind beschworen.
Te Ua Haumene brachte jetzt auch Bewegung in die Versammlung. Er ließ seine Anhänger einen Pfahl aufstellen, den er niu nannte und der die gute Botschaft versinnbildlichen sollte, die er den Maori brachte. Um diesen Pfahl herum stampften nun seine Männer, fast in der Manier der Kriegstänzer, und forderten die Zuhörer auf mitzumachen. Te Ua Haumene skandierte dabei seltsame Silben und verkündete weitere Grundsätze seiner neuen Religion. Immer mehr junge Dorfbewohner sprangen auf und gesellten sich zu den Kriegern um den niu.
»Wir sollten hier schleunigst weg«, bemerkte Karl. »Bevor der Prophet beginnt, vor dem Land erst mal dieses Dorf von pakeha zu säubern. Mara, lauf hinüber zu Mr. Johnson und den Rotröcken, ich reiße Mr. Carter aus dem Rausch der Verbrüderung mit seinen Nachbarn. Sieht zwar nicht aus, als bekäme in der Runde noch irgendjemand etwas mit, aber verteidigen werden die Jungs ihn auch nicht, wenn von denen dort jemand verrücktspielt. Ida, du bringst Father O’Toole zu den Pferden. Nicht dass der sich noch mal mit diesem Irren anlegt.«
Mara ließ sich das nicht zweimal sagen, und nicht nur, weil sie den Aufbruch herbeisehnte. Sie hatte sich längst mit der Übernachtung im marae abgefunden, der lange Ritt durch die Nacht lockte sie nicht. Aber die gespenstische Atmosphäre, die düsteren Worte des Propheten und der irre Tanz der Männer um den niu machten ihr Angst. Sie betrachtete die Maori als ihr Volk. Wenn sie Eru heiratete, würde sie Mitglied des Stammes der Ngai Tahu werden. So jedoch hatte sie ihre Landsleute noch nie erlebt. Es schien, als verlören sich all ihre Vernunft und ihre Weisheit im Wehen eines bösen Windes.
Father O’Toole schien das ebenso zu empfinden. Er wirkte wie in Trance, als Ida ihn zwischen den Feuern hindurchführte, zum Glück, ohne behelligt zu werden. Ein paar der Dorfbewohner mochten den Rückzug der pakeha bemerken. Dem etwas abseits sitzenden Häuptling blieb er ganz sicher nicht verborgen. Paraone Kawiti ließ die Weißen jedoch ungehindert ziehen. Er schien nicht allzu begeistert von dem Propheten, der da eben seinen Stamm bezauberte. Vielleicht spürte er die von ihm ausgehende Gefahr, oder er fürchtete einfach den Verlust der eigenen Macht über sein Volk. Er nickte dem Landvermesser fast unmerklich zu, Father O’Toole bedachte er mit einem Blick zwischen Geringschätzung und Bedauern.
»Nun machen Sie schon!«, mahnte Karl den Missionar.
Mara, die dem etwas widerwillig aufbrechenden Carter und den höchst alarmierten Soldaten bereits beim Satteln der Pferde geholfen hatte, hielt Father O’Toole die Zügel seines knochigen Braunen hin. Er schien sich kaum entschließen zu können aufzusteigen. Es wirkte, als fehlte ihm die Kraft dazu.
»Ich will hier weg!«, sagte Mara.
»Ich auch«, flüsterte O’Toole. »Dies ist … dies ist unwiderruflich das Ende. Ich gehe zurück nach Galway. Gott schütze dieses Land.«
KAPITEL 3
»Gott hat euch gerufen, und ihr seid dem Ruf gefolgt!« Die Stimme Reverend William Woodcocks erfüllte die kleine Kirche des St. Peter’s College. Wohlgefällig ließ der Erzdiakon von Adelaide seinen Blick über die acht jungen Männer schweifen, die vor dem Altar aufgereiht standen. Sie sahen gläubig und erwartungsvoll zu ihm auf. »Und nun gehet hin in alle Welt und taufet die Völker im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehret sie alles, was ich euch befohlen habe. Und sehet, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende!«
»Amen!«, echoten die acht eben ordinierten Missionare ebenso wie ihre Angehörigen und Freunde, die sich zu diesem feierlichen Gottesdienst versammelt hatten.
Die Australian Church Mission Society unterhielt ein Ausbildungsinstitut, das jedes Jahr eine Handvoll eifriger, fest im Glauben stehender junger Männer in die Welt hinaussandte, um die Heiden zu bekehren. Dabei blieb die Mehrheit von ihnen im Land – der riesige Kontinent Australien bot ein reiches Betätigungsfeld. Ab und zu wurde allerdings auch jemand nach Neuseeland, Indien oder Afrika geschickt.
William Woodcock würde gleich die Aufgabe zufallen, den diesjährigen Kandidaten ihre künftigen Wirkungsfelder zuzuweisen. Er hob segnend die Arme, als das letzte Amen verklungen war. Die acht jungen Missionare formierten sich zum feierlichen Auszug aus der Kirche, während die Orgel aufbrauste und der Chor des Colleges einen Choral anstimmte. Die meisten Gottesdienstbesucher fielen in den Gesang ein. Nahezu alle Aspiranten der Missionsschule stammten aus strenggläubigen Familien. Worte und Melodie der gängigen Kirchenlieder waren hier jedem bekannt.
Franz Lange durchschritt die Kirche an dritter Stelle. Wie seine Brüder im Herrn hielt er den Kopf gesenkt. Erst als er in einer der hinteren Bänke deutsche Worte vernahm, blickte er kurz auf und entdeckte seinen Vater. Jacob Lange stand würdevoll zwischen Franz’ jüngeren Halbbrüdern und sang den Choral in seiner Muttersprache mit. Dabei übertönte seine tiefe sonore Stimme mühelos die Stimmen seiner Banknachbarn. Dass er sie mit seinem Gesang in der Fremdsprache irritierte, bemerkte er gar nicht, und es wäre ihm auch egal gewesen. Für Jacob Lange hatte das Evangelium in der Sprache Martin Luthers verkündet zu werden. Fremdsprachen empfand er als lästiges Ärgernis. Zwanzig Jahre nach seiner Auswanderung aus Mecklenburg sprach er noch immer kaum Englisch. Von Franz’ Ordinationsgottesdienst hatte er folglich kaum ein Wort verstanden.
Und überhaupt hatte Franz bis zuletzt nicht zu hoffen gewagt, sein Vater würde bei seiner Ordination dabei sein. Schließlich hatte die Australian Church Mission Society zwar altlutherische Wurzeln, galt inzwischen jedoch als Organisation der Anglikanischen Kirche und legte das Evangelium nicht mehr gar so streng aus, wie Jacob Lange es erwartete. Für Franz hatte es allerdings keine Alternative gegeben: Die deutsche Gemeinde bei Adelaide, der Langes Familie seit seiner Einwanderung zugehörte, unterhielt selbst kein Predigerseminar. Wenn Franz Gottes Ruf also folgen wollte, so blieb ihm nur der Weg über St. Peter.
Beim Anblick seines Vaters und seiner Brüder – und dem Gedanken an Gottes Ruf – empfand Franz einen kleinen Anflug von schlechtem Gewissen. Er hätte es nie jemandem verraten, aber es war nicht nur die Berufung zum Predigeramt, die ihn von der Farm in der deutschen Siedlung Hahndorf fortzog. Tatsächlich hatte Franz einfach genug von der ewig gleichen schweren Arbeit auf den Feldern, nur unterbrochen von Gottesdiensten und Gebetskreisen. Der junge Mann war von klein auf schwächlich gewesen. Er hatte während seiner Kindheit immer wieder an Erkältungen und Kurzatmigkeit gelitten. Weder das Klima in Mecklenburg noch das auf der Südinsel Neuseelands, auf der Jacob Langes Familie zunächst gelebt hatte, war seiner Natur zuträglich gewesen. Die Wärme in Australien bekam Franz besser, doch die erbarmungslose Plackerei, die die Urbarmachung von neuem Land forderte, hatte nicht dazu beigetragen, dass es ihm gesundheitlich besser ging. Jacob Lange hatte von seinem jüngsten Sohn aus erster Ehe vollen Arbeitseinsatz gefordert. Er schickte das bei der Ankunft in Australien zehnjährige Kind zwar in die deutsche Schule, ließ es am Nachmittag jedoch bis zur Erschöpfung schuften.
Schon damit du nicht auf dumme Gedanken kommst! Franz hatte diesen Satz während seiner Jugend unzählige Male gehört. Jedes Mal wurde der Groll auf seine Geschwister, die sich dem väterlichen Einfluss mehr oder weniger eigenständig entzogen hatten, erneut geschürt. Sowohl Franz’ Bruder Anton als auch seine Schwester Elsbeth waren ohne Segen des Vaters fortgelaufen. Die beiden mussten noch irgendwo in Neuseeland sein, aber Jacob Lange hatte keinen Kontakt zu ihnen und zeigte auch kein Interesse daran, sie aufzuspüren. Lediglich mit seiner ältesten Tochter Ida wechselten Lange und seine zweite Frau Anna gelegentlich Briefe, wenn auch nichtssagende. Ida war in Neuseeland mit einem Mitglied der Altlutheraner Gemeinde verheiratet worden und später auf zwielichtige Art verwitwet. Sie war dann gleich eine neue Ehe eingegangen – wie Franz es verstanden hatte, mit einem Mann, den sein Vater nicht billigte.
Franz und die anderen jungen Missionare durchschritten jetzt die Kirchentür und warteten draußen auf ihre Familien. Die Langes waren unter den Ersten, die in den hellen australischen Wintersonnenschein hinaustraten. Franz versuchte sich an einem Lächeln und streckte seinem Vater und seiner Stiefmutter beide Hände entgegen. Anna gesellte sich mit ihren drei Töchtern eben wieder zu ihrem Mann und den beiden Söhnen. In der Kirche saßen männliche und weibliche Gläubige streng voneinander getrennt. Sie zumindest erwiderte den freundlichen Ausdruck ihres Stiefsohnes. Leicht verschämt lächelte sie ihn unter der adretten Haube hervor an.
Da sonst niemand das Wort ergriff, bemühte sich Franz um eine herzliche Begrüßung. »Vater, Stiefmutter! Ihr glaubt nicht, wie sehr euer Kommen mich freut!«
Franz hoffte, sein Vater würde ihn vielleicht in seine Arme ziehen. Jacob Lange blieb jedoch hölzern vor ihm stehen.
»Jetzt im Winter ist ja nicht so viel zu tun auf der Farm«, brummte er.
Anna Lange blickte zu ihrem Mann auf und schüttelte nachsichtig den Kopf. Dann trat sie auf ihren Stiefsohn zu und ergriff seine ausgestreckten Hände.
»Dein Vater ist sehr stolz auf dich!«, behauptete sie.
Auch Anna sprach Deutsch, konnte sich auf Englisch aber immerhin verständigen. Die Schule in Hahndorf unterrichtete die Landessprache, wenngleich es vielen Siedlern nicht wichtig war, wie gut sich ihre Kinder darin ausdrücken konnten. Die meisten von ihnen verließen das Dorf nie.
Franz Lange war der Unterricht dagegen stets wichtig gewesen. Das Beispiel seiner Schwestern stand ihm dabei ständig vor Augen. Denn sosehr er heimlich wütete, weil Ida und Elsbeth ihn schmählich verlassen hatten − der Ehrgeiz der Schwestern, nach der Ankunft in Neuseeland rasch Englisch zu lernen, hatte sich ausgezahlt. Die beiden waren frei. Franz wusste, dass er die Sprache seines neuen Landes möglichst fließend sprechen musste, wollte er der Fronarbeit in Hahndorf irgendwann entkommen. Er studierte deshalb mit Feuereifer Englisch, obwohl ihm der Umgang mit Zahlen sehr viel mehr lag. Franz rechnete blitzschnell und lernte sehr leicht auswendig, während ihm das Schreiben von Aufsätzen weniger gut gelang. So gesehen wäre er sicher ein besserer Buchhalter und Bankangestellter geworden als ein Prediger. Manchmal hatte er sogar von einem Studium der Mathematik geträumt. Daran war jedoch nicht zu denken. Wenn Jacob Lange seinen Sohn überhaupt ziehen ließ, so lediglich im Namen des Herrn.
»Stolz«, bemerkte er jetzt säuerlich und strich über seinen vollen weißen Bart, »empfinde ich auf Söhne, die ihren Platz kennen, die demütig auf ihrer Scholle bleiben und ihre Eltern unterstützen im harten Kampf ums Dasein. Du, Franz, bist eher eine Enttäuschung. Aber gut, ich akzeptiere, dass Gott dich ruft. Die Wege des Herrn sind unergründlich – und wer weiß, vielleicht sühnst du die Sünden deiner Väter, indem du dich hinaus in Feindesland begibst, um die Wilden zu zähmen. Ich will da nicht mit meinem Schöpfer hadern, ich mag es verdienen, nun auch den letzten Sohn zu verlieren …«
»Du hast noch zwei wunderbare Söhne!«, erinnerte ihn Anna.
Die kleine, stets in die dunkle Tracht der Altlutheranerinnen gekleidete Frau, deren dunkelblondes Haar unter der Haube schon schütter wurde, war kaum älter als Franz’ älteste Schwester. Sie hatte nach der Hochzeit in rascher Folge sieben Kindern das Leben geschenkt. Zwei Jungen und drei Mädchen hatten überlebt und waren kräftig und gesund. Fritz und Herbert halfen auf der Farm schon tüchtig mit. Die Mädchen schienen sich zu ebenso häuslichen und braven Frauen zu entwickeln wie Anna.
Jacob Lange nickte. »Ich sage ja, ich hadere nicht mit dem Schöpfer, er hat mich letztlich reich beschenkt. Dennoch … Franz, vergiss die alte Heimat nicht! Gib deine Sprache und deine Vergangenheit nicht auf. Egal, wohin es dich verschlägt, denk immer daran, dass du ein Junge aus Raben Steinfeld bist …«
»Kommst du, Franz?« Marcus Dunn, während der Ausbildung zum Missionar Franz’ Zimmergenosse, unterbrach Jacob Langes Predigt. »Der Erzdiakon hat John und Gerald schon in sein Büro gebeten. Er gibt bekannt, welcher Ruf an wen ergehen wird! Du bist bestimmt der Nächste.«
Franz ergriff die Gelegenheit, sich bei seiner Familie zu entschuldigen. »Ihr könnt aber gern noch bleiben«, lud er sie ein. »Auf dem Campus wird ein Buffet aufgebaut, es gibt zu essen und zu trinken, wir feiern unseren Abschluss …«
Jacob Lange schnaubte. »Ich sehe da nichts zu feiern. Und wir müssen nach Hause, es sind zehn Kühe zu melken. Also geh mit Gott, Franz. Ich hoffe, er leitet dich wirklich auf diesem Weg …«
Franz biss sich auf die Lippen, aber sein Vater hatte sich schon zum Gehen gewandt. Anna zuckte hilflos die Schultern. Sie war ein sanfter, entgegenkommender Mensch. Als Jacob sie zur Frau genommen hatte, hatte sie Franz liebevoll als ihren Sohn angenommen und sein Leben in vielerlei Hinsicht erleichtert. Ihrem Gatten war sie bedingungslos ergeben. Niemals hätte sie ihm widersprochen oder sich ihm gar entgegengestellt. Franz fragte sich, ob er selbst sich eines Tages eine ähnlich geartete Frau wünschte. Wenn er ehrlich sein sollte, hätte er lieber eine, mit der er sich unterhalten konnte, die nicht immer nur demütig Ja sagte, sondern auch einmal Nein. Franz würde gern Fragen stellen – und Geheimnisse teilen.
Jetzt aber hatte er keine Zeit, über solche Dinge nachzudenken. Der heutige Tag tauchte ihn in ein Wechselbad der Gefühle − die kurze Freude über den erfolgreichen Abschluss der Ausbildung, der Stolz, sich künftig Reverend nennen zu dürfen, die erneuten Schuldgefühle gegenüber seinem Vater und die bohrende Furcht vor der Entscheidung über seine Zukunft.
Denn da war noch etwas, das Franz nie jemandem gesagt hatte und das er auch sich selbst ungern eingestand: So leicht er lernte, so beflissen er predigte und so eifrig er Gottes Wort auslegte – der Gedanke, den zu bekehrenden Heiden demnächst Auge in Auge gegenüberzustehen, ließ ihn vor Angst erstarren. Franz hatte noch nie wirklichen Kontakt zu den Aborigines, den Ureinwohnern Australiens, gehabt. Die früheren Besitzer des Landes, auf dem Hahndorf stand, waren längst an entfernte Orte ausgesiedelt worden. Das galt auch für den Stamm, der ursprünglich auf dem Gebiet von Adelaide gelebt hatte. Auf den Straßen der Stadt sah man Schwarze allenfalls noch als Bettler oder betrunken umhertaumelnde Stadtstreicher – unangenehm, aber harmlos. Während Franz’ Ausbildung zum Missionar hatten Gastdozenten aus dem Outback gelegentlich getaufte Exoten mitgebracht. Auch sie waren nicht furchterregend, sondern zahm und still. Sie trugen westliche Kleidung und hielten die Köpfe demütig gesenkt. Doch Franz erinnerte sich noch genau an die Ankunft der Langes in Neuseeland. Sie waren direkt in die Wirren des Wairau-Zwischenfalls mit feindlichen Maori hineingeraten. In der Stadt Nelson hatte die Familie zwar nie einen Maori zu Gesicht bekommen, aber dem ängstlichen Kind hatten die blutrünstigen Geschichten, die in der Stadt herumgingen, gereicht. In Australien hatte Franz dann noch viel schlimmere gehört. Die Aborigines galten als deutlich kriegerischer als die Maori. Jeder Siedler wusste von Massakern an Einwanderern, aufgeriebenen Expeditionen und blutigen Aufständen. Abbildungen von weiß bemalten Wilden, bewaffnet mit Speeren und Bumerangs, machten die Runde – und dazu war das Outback auch noch voller gefährlicher Tiere. Als Franz gemeinsam mit seinem Vater das Land für die Farm urbar gemacht hatte, war er oft nur um Haaresbreite einem Schlangenbiss oder dem Angriff eines wilden Hundes entkommen. Der Gedanke, nun womöglich erneut in jungfräuliches Land geschickt zu werden, um eine Mission aufzubauen, ließ ihn in Panik verfallen.
Beim Warten vor dem Büro des Erzdiakons kämpfte er nun gegen Herzklopfen und Schweißausbrüche. Er schluckte trocken, als William Woodcock ihn endlich hereinrief. Was sollte er tun, wenn es tatsächlich auf eine Expedition in die Wildnis hinauslief? Konnte er jetzt noch fortlaufen? Würde Gott ihn dafür nicht strafen – oder schlimmer noch, strafte Gott ihn gleich durch die Hand des Erzdiakons, indem er ihn an einen weit schlimmeren Ort verbannte als den, vor dem er geflohen war?
Der Erzdiakon fixierte Franz aus seinen hellen, stechenden Augen. Sie schienen direkt in sein Herz zu blicken. »Setzen Sie sich, Reverend Lange. Sie sind ganz blass. Das Wiedersehen mit der Familie? Oder spüren Sie bereits die Bürde Ihres Amtes?«
Franz murmelte etwas Unverständliches. Dann nahm er sich zusammen. »Ich habe das Fasten noch nicht gebrochen«, gab er zu.
Die künftigen Missionare hatten die Nacht vor der Ordination betend und fastend zugebracht, und beim Gottesdienst wäre auch Franz vor Hunger beinahe umgekommen. Dann hatte ihn die Begegnung mit seiner Familie aber gleich den Appetit gekostet, während sich seine Mitbrüder bestimmt schon gierig über die im Campus angebotenen Speisen hergemacht hatten.
Der Erzdiakon nickte. Unauffällig musterte er den schmächtigen jungen Mann. Franz Lange war mittelgroß, sehr dünn und ging immer etwas gebeugt, als duckte er sich unter einer Peitsche. Den feierlichen schwarzen Anzug füllte er kaum aus. William Woodcock überflog kurz die Angaben von Langes Lehrern zu dessen Eignung für den Dienst als Missionar. Zuverlässig, sicher im Glauben, geduldig, außerordentlich bibelfest, leider kein guter Redner, stand dort. Der junge Mann schien auch Schwierigkeiten zu haben, seinem Gegenüber lange in die Augen zu schauen. Woodcock hielt seinen Blick trotzdem fest. Er schaute in ein noch fast kindlich wirkendes rundes Gesicht mit großen blauen Augen. Darin stand offensichtliche Furcht. Woodcock mochte den Jungen nicht quälen. Er sprach ihn nun freundlich an.
»Dann sollte ich Sie nicht zu lange aufhalten. Sie müssen sich schließlich stärken für die Aufgaben, die vor Ihnen liegen. Sagen Sie mir, Reverend Lange … Wenn Sie die Wahl hätten, sich für irgendeine Aufgabe in der Mission zu entscheiden, was würden Sie tun? Welches Land würden Sie wählen, welche Arbeit?«
Franz rieb sich die Schläfen. Bestand wirklich die Möglichkeit, dass der Erzdiakon ihn in die Entscheidung mit einbezog? Ebenso gut konnte dies eine Fangfrage sein. Sein Vater zumindest hätte eine offene Antwort als mangelnde Demut ausgelegt und ihn dann gerade mit einer Aufgabe betraut, die ihm besonders zuwider war.
»Ich … ich werde den Platz einnehmen, auf den Gott mich stellt«, druckste der junge Mann. »Ich …«
Der Erzdiakon winkte ab. »Natürlich werden Sie das. Davon gehe ich aus. Aber es muss doch Aufgaben geben, die Sie mehr oder weniger locken. Die Ihnen vielleicht auch mehr als andere liegen.«
Franz biss sich erneut auf die Lippen. Fieberhaft suchte er nach einer unverfänglichen Antwort. »Ich mag es zu unterrichten«, behauptete er dann. »Ich bringe Kindern gern etwas bei.«
Tatsächlich hatte Franz nie mit anderen Kindern zu tun gehabt als seinen neuen Geschwistern, und die waren ihm oft etwas begriffsstutzig erschienen. Es hatte ihn jedoch nicht gestört, wenn Anna ihn bat, ihnen irgendeine Schulaufgabe zu erklären. Im Gegenteil, in der Zeit, in der er mit ihnen lernte, schickte sein Vater ihn wenigstens nicht auf die Felder. Und was die Mission anging − wenn die Eingeborenen schon ausreichend zivilisiert waren, um ihre Kinder zur Schule zu schicken, konnten sie so gefährlich nicht sein.
Der Erzdiakon nickte und machte eine Notiz in der Akte, die er vor sich hatte. »Also ein geborener Lehrer«, sagte er freundlich. »Gut zu wissen. Leider ist zurzeit von keiner unserer Missionsstationen direkt die Anfrage nach einem Lehrer eingegangen. Andererseits besteht hier sicher Bedarf in jeder größeren Station, deren Arbeit mit den Heiden schon ein wenig fortgeschritten ist. Würde Sie ein Ruf an eine solch größere Station reizen, Bruder Franz? Oder wäre Ihnen das zu langweilig? Ich hätte hier eine Anfrage aus Neuseeland. Einer unserer altgedienten Missionare, Reverend Völkner, bittet um Verstärkung. Kamen Sie nicht überhaupt mit Ihrer Familie aus Neuseeland, Reverend Lange?«
Franz spürte Hoffnung in sich aufkeimen. Er verband mit Neuseeland nicht die besten Erinnerungen. Tatsächlich war die Siedlung, die sein Vater dort mit seiner norddeutschen Heimatgemeinde gegründet hatte, einer Flutkatastrophe zum Opfer gefallen. Die Stadt Nelson hatte ihm jedoch gefallen – und selbst auf dem Land gab es keine Schlangen, Skorpione oder wilden Tiere.
»Ich komme aus Mecklenburg«, stellte er trotzdem richtig. »Raben Steinfeld …«
Der Erzdiakon winkte ab. »Aber Sie haben in Neuseeland gelebt. Würde es Ihnen gefallen, Franz, wenn wir Sie dorthin entsenden würden? Bitte, sprechen Sie frei heraus! Ich kann nicht jedem Wunsch nachgeben, doch wenn es mir möglich ist, lasse ich die Neigungen der jungen Missionare stets in meine Entscheidungen einfließen. Ihre ersten drei Mitbrüder haben es zum Beispiel vorgezogen, gemeinsam eine neue Missionsstation in China aufzubauen. Da könnten wir auch noch einen vierten Mann brauchen. Wenn Sie also lieber …«
»Nein!« Franz’ Widerspruch kam entschieden zu schnell und zu laut. Wenn der Erzdiakon ihn wirklich auf die Probe stellte, befand er sich wahrscheinlich am kommenden Tag schon auf dem Weg nach China. »Ich … ich meine, ich … natürlich folge ich auch dem Ruf aus … aus ferneren Ländern, ich …«
Der Erzdiakon lächelte. »Sie vernehmen ihn jedoch nicht wirklich«, bemerkte er. »Gut, Reverend Lange. Dann entsenden wir Sie hiermit offiziell nach Opotiki. Das liegt auf der Nordinsel Neuseelands, die Mission besteht seit einigen Jahren. Viel Glück, Bruder Franz! Gehen Sie mit Gott!«
Franz fühlte sich schwindlig, als er wieder auf dem sonnigen Campus stand – und unsäglich erleichtert. Er hätte jetzt zu den auf langen Tischen dargebotenen Speisen gehen, endlich seinen Hunger stillen und seine Mitbrüder mit ihrem Ruf nach China aufziehen können, vielleicht auch ihren gutmütigen Spott ertragen, dass es ihn »nur« nach Neuseeland trieb. Tatsächlich ließ er den Campus jedoch hinter sich und betrat erneut die kleine Kirche.
Inbrünstig dankte er Gott.
RÜCKKEHR
Canterbury Plains, Christchurch,
Lyttelton − Neuseeland (Südinsel)
1863
KAPITEL 1
»Wirst sehen, Carol, dieses Mal holen wir uns den Preis! Im letzten Jahr, mit Jeffrey, das war ja nur so ein Rumpaddeln. Joe zeigt mir eine ganz andere Technik! Kommt schließlich aus Oxford, der Mann. Sein Achter hat das Boat Race gewonnen, ihr wisst schon, diese berühmte Regatta auf der Themse …«
Linda unterdrückte ein gelangweiltes Seufzen. Mrs. Butler hatte den Garten gerade mal für einen Augenblick verlassen, um sich um den Tee zu kümmern, und schon war ihr Sohn Oliver erneut bei seinem augenblicklichen Lieblingsthema, der bevorstehenden Ruderregatta auf dem Avon, veranstaltet vom Christchurcher Ruderklub. Linda fiel es schwer, Interesse zu heucheln. Ihre Halbschwester Carol war dagegen unverdrossen bemüht, den immer gleichen Ausführungen ihres Verlobten aufmunternd lächelnd zu lauschen und sie begeistert zu kommentieren.
Linda und Carol freuten sich auf die Regatta, die bunt geschmückten Boote, die Geselligkeit und das Picknick am Ufer des Flusses. Ganz Christchurch und Umgebung würde sich am Avon versammeln, die Bootsrennen waren eine willkommene Abwechslung von der gerade im Frühjahr aufreibenden Arbeit auf den Schaffarmen. Olivers ständiges Gerede über seine Rudertechnik, über Joe Fitzpatrick, seinen fabelhaften neuen Partner im Zweier, und vor allem seine endlose Analyse der eigenen Siegchancen ermüdeten jedoch auch den geduldigsten Zuhörer. Carol konnte sich nur damit trösten, dass ihr Verlobter bei seinem sportlichen Engagement Zielstrebigkeit, Eifer und Ehrgeiz an den Tag legte – Eigenschaften, die er bei der Arbeit auf der elterlichen Schaffarm eher missen ließ. Darüber klagte zumindest Captain Butler, sein Vater − Olivers Mutter fand es durchaus angemessen, wenn ihr Sohn den Gentleman und nicht den Farmer herauskehrte.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!