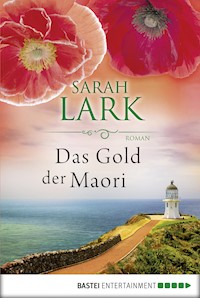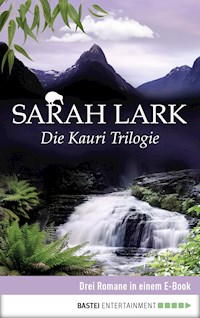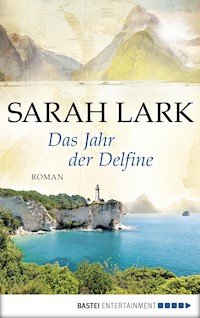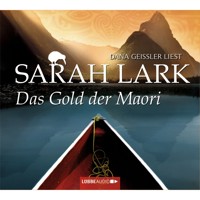Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Lübbe Audio
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Weiße-Wolke-Saga
- Sprache: Deutsch
Sarah Lark legt nach ihren großen Familiensagas nun eine ergreifende Liebesgeschichte zwischen Europa und Neuseeland vor. Der wunderbar illustrierte Roman EINE HOFFNUNG AM ENDE DER WELT knüpft an die Familiengeschichte der McKenzies aus der bekannten Weiße-Wolke-Saga an.
In den Wirren der 1940er Jahre verschlägt es die junge Polin Helena mit ihrer Schwester Luzyna nach Persien. Als sie Aufnahme in Neuseeland erhalten sollen, keimt Hoffnung in Helena auf. Doch nur eine der jungen Frauen wird für die Verschickung ausgewählt.
Zur gleichen Zeit bricht James McKenzie aus Neuseeland auf. Gegen den Willen seiner Eltern will der wagemutige Flieger in Europa für die Ideale der Freiheit kämpfen.
Das Schicksal führt James' und Helenas Wege zusammen ...
Zwei junge Menschen meistern ihr Schicksal und finden das Glück der Liebe vor einem dramatischen Kapitel der Weltgeschichte.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Zeit:7 Std. 30 min
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Inhalt
Über die AutorinTitelImpressumVerratKapitel 1 Kapitel 2Kapitel 3Kapitel 4Kapitel 5Kapitel 6Kapitel 7Kapitel 8AuswegKapitel 1Kapitel 2Kapitel 3Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6Kapitel 7TrugbilderKapitel 1Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 LichtKapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Epilog NachwortSchlussbemerkungÜber die Autorin
Sarah Lark, geboren 1958, war schon immer fasziniert von den Sehnsuchtsorten dieser Erde. Ihre fesselnden Neuseeland- und Karibikromane wurden allesamt Bestseller und finden auch international ein großes Lesepublikum. Sarah Lark ist das Pseudonym einer erfolgreichen deutschen Schriftstellerin. Unter dem Autorennamen Ricarda Jordan entführt sie ihre Leser auch ins farbenprächtige Mittelalter.
SARAH LARK
EINE HOFFNUNG AMENDE DER WELT
Roman
Mit Illustrationen von Tina Dreher
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Originalausgabe
Dieses Werk wurde vermittelt durch
die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen.
Copyright © 2015 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat: Melanie Blank-Schröder
Innenillustrationen und Landkarte: Tina Dreher, Alfeld/Leine
Umschlaggestaltung: © Johannes Wiebel, punchdesign, München unter Verwendung von Motiven von shutterstock/pio3; shutterstock/Pichugin Dmitry; shutterstock/hxdbzxy; © arcangel-images/Mlagorzata Maj; © Trevillion Images/Mark Owen
E-Book-Produktion: Greiner & Reichel, Köln
ISBN 978-3-7325-1277-5
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
VERRAT
Teheran, Persien
Bombay, Indien
Pahiatua, Neuseeland (Nordinsel)
Juli 1944 – Januar 1945
KAPITEL 1
Flüchtlingslager in der Nähe von Teheran, Persien
»Wo ist Luzyna?«
Adam, der mit seinen Eltern auf der Westseite der Baracke wohnte, baute sich atemlos vor Helena auf. Er musste gerannt sein.
»Keine Ahnung.« Helena blickte etwas unwillig von ihrer Näharbeit auf. Bis jetzt hatte sie zufrieden in der Sonne gesessen und sich gefreut, der Enge der Unterkunft entkommen zu sein. Während des Vortages hatte es geregnet, die Bewohner konnten nicht nach draußen. Helenas Schwester hatte sich darüber beklagt, dass die Lagerordnung ihr nicht erlaubte, ihren Freund Kaspar in einer der Männerbaracken zu besuchen. Luzyna hatte mit dem Mädchen, das sein Bett neben dem ihren hatte, gestritten und sich über die Frau auf der Schlafstatt gegenüber aufgeregt, die ständig Selbstgespräche führte. Helena war froh gewesen, als Luzyna am Morgen endlich wieder zur Arbeit in der Feldküche aufgebrochen war. Doch nun störte Adam ihre Ruhe. Erneut schien sich Ärger mit ihrer Schwester anzubahnen. »Ist sie nicht in der Küche?«, fragte Helena resigniert.
»Sie musste zum Arzt«, gab der Junge kopfschüttelnd Auskunft. »Das hat sie jedenfalls der Köchin gesagt.« Dem Lager war ein kleines Hospital angeschlossen. »Mittags wollte sie zurück sein. Bisher ist sie nur nicht aufgetaucht – dabei soll sie mit mir das Essen herbringen und austeilen. Ich kann das nicht allein machen, aber ich will Luzyna auch nicht verraten. Also, falls sie jetzt nicht beim Arzt sein sollte …« Adam, ein dünner blonder Fünfzehnjähriger mit pickligem Gesicht, trat nervös von einem Fuß auf den anderen.
Helena seufzte. Es war immer so. Niemand wollte Luzyna in Schwierigkeiten bringen. Das junge Mädchen fand stets jemanden, der seine Alleingänge deckte und seine Fehler auf sich nahm.
»Sie hatte keinen Termin im Krankenhaus«, sagte Helena und begann, ihre Näharbeit zusammenzulegen. Die Schürze, die sie im Schneiderkurs auf der Nähmaschine genäht hatte, war nicht sonderlich gut gelungen und jetzt schon fleckig, weil Helena sich beim Vernähen der Fäden ständig in die Finger stach. Ihre Talente lagen ganz sicher nicht im Bereich der Handarbeit. »Zumindest hat sie mir nichts davon gesagt. Aber lieb von dir, dass du sie nicht anschwärzen willst. Lass mich eben das Nähzeug hineinbringen, dann komme ich mit und helfe dir.«
Helena stand auf, betrat die Unterkunft und blinzelte in das Halbdunkel des großen Raumes, der nur wenige Fensteröffnungen aufwies. Sie musste aufpassen, nicht über die Habseligkeiten der Bewohner zu stolpern, die auf den engen Gängen zwischen den Schlafstellen abgestellt waren. Die Baracke war hoffnungslos überbelegt, die schmalen Pritschen standen so eng beisammen, dass man seinen Nachbarn schon störte, wenn man sich im Bett herumwarf.
Helena wachte fast jede Nacht auf, weil Luzyna unruhig schlief. Wie viele der polnischen Flüchtlinge, die nach ihrer Zeit in Sibirien in Persien Aufnahme gefunden hatten, litt ihre Schwester unter Albträumen. Die Menschen waren nun endlich in Sicherheit, doch die Erinnerungen an die Vergangenheit verfolgten sie. Bis die Russen im Herbst 1939 nach Stalins verhängnisvollem Pakt mit Hitler in ihr Land einmarschierten, hatten sie als unbescholtene polnische Bürger gelebt. Um Ostpolen gänzlich russisch zu gestalten, ließ der Diktator einen Großteil der polnischen Bevölkerung in sibirische Arbeitslager deportieren. Doch dann, im Juni 1941, brach Deutschland den Nichtangriffspakt, der die Annexion Ostpolens erst möglich gemacht hatte. Stalin war daraufhin gezwungen gewesen, sich mit den Alliierten zusammenzutun, um Hitler zu bekämpfen, und die machten zur Bedingung, dass er diplomatische Beziehungen zur polnischen Exilregierung aufnahm. Dank dieser Verhandlungen kam es zur Amnestie der Polen in Sibirien. Helena und Luzyna waren frei! Im Gefolge der neu gegründeten polnischen Armee, die sich aus den vormals Deportierten rekrutierte, gelangten die Schwestern nach Persien. Das Land stand unter der Aufsicht der Alliierten, die Polen genossen hier Flüchtlingsstatus. Niemand trachtete Helena und Luzyna in dem vorderasiatischen Staat nach dem Leben, doch die jungen Frauen waren über das Leid der vergangenen Jahre noch längst nicht hinweg.
Helena erreichte schließlich den Verschlag, den sie sich mit ihrer Schwester teilte. Sie schob den improvisierten Vorhang aus Decken zur Seite, mit denen sie ihren winzigen persönlichen Bereich vom Gemeinschaftsschlafraum abgetrennt hatten, und warf das Nähzeug auf ihr Bett. Dann hastete sie gemeinsam mit Adam zur Lagerküche. Die Sonne stand hoch über den schneebedeckten Bergen, es war längst Mittag, und die Köche hielten das Essen bereit. Die Flüchtlinge warteten sicher schon ungeduldig. Drei reichhaltige Mahlzeiten bekamen sie hier in Persien täglich, für sie alle immer noch ein kleines Wunder. In Sibirien hatte man sie jahrelang hungern lassen.
Die Feldküche lag etwa hundert Meter von den Unterkünften entfernt, in denen die Menschen untergebracht waren. Adam und Helena erreichten sie über einen breiten, gut befestigten Weg. Das Flüchtlingslager war eigentlich als Kaserne für die persische Luftwaffe geplant gewesen – die zentralen Ziegelsteingebäude waren sehr viel solider gefertigt als die Baracken. Sie waren von einer ordentlichen, gelb gestrichenen Mauer umgeben und nicht von einem unschönen Stacheldrahtzaun, wie man ihn eilig um die Unterkünfte errichtet hatte. Die vier Häuser hatten die Flüchtlingsströme allerdings nicht fassen können. Man hatte die Menschen zunächst in Zelten, dann in rasch hochgezogenen Baracken untergebracht. Die Kasernen beherbergten jetzt hauptsächlich öffentliche Räume wie das Krankenhaus, die Schule und die Werkstätten.
Die Armee hatte dem Flüchtlingslager zwei Feldküchen und ein Küchenzelt zur Verfügung gestellt. Jetzt, im warmen persischen Sommer, empfanden die Küchenhelfer das als durchaus angenehm. Sie saßen gern in der Sonne vor dem Zelt oder im Schatten des Zeltvordachs, um Kartoffeln zu schälen oder Zutaten für Eintöpfe klein zu schneiden. Nach den Jahren in der sibirischen Kälte genossen die Menschen jeden Sonnenstrahl. Noch schöner wäre es natürlich, gäbe es auch ein paar Bäume oder Blumenbeete. Mit einer Verschönerung der Anlage hatte man sich jedoch nicht aufgehalten. Dem Auge schmeichelte allenfalls der Blick auf die fernen Gipfel des Elburs-Gebirges, zu dessen Füßen sich das Lager befand.
»Und die kleine Luzyna?«, fragte einer der Küchenhelfer anzüglich, als Adam und Helena sich jetzt an der Essensausgabe anstellten. Zwei junge Männer luden ihnen sowie den Essensausträgern für die anderen Baracken schwere Kessel mit Dosengulasch und Makkaroni auf Handwagen. »Hat die nicht eigentlich Dienst?«
Helena versteifte sich. »Meine Schwester musste zum Arzt«, behauptete sie mit schmalen Lippen.
Der zweite Küchenjunge lachte. »Von wegen Arzt!«, höhnte er. »Ich hab sie vorhin mit ihrem Kaspar hinter der Remise gesehen. Kann es sein, dass sie das Hospital mit der Reparaturwerkstatt verwechselt hat?«
Der achtzehnjährige Kaspar gehörte zu denjenigen, die bei der Wartung der Lastwagen helfen sollten, mit denen Verpflegung und neue Flüchtlinge ins Lager gebracht wurden. Er tat das ganz gern, während Luzyna die Küchenarbeit verabscheute. Sie hatte sich auch nicht wirklich freiwillig dazu gemeldet, sondern sich widerwillig dem Druck der älteren Schwester gebeugt. Jetzt schwänzte Luzyna, wann immer es möglich war, und Helena bereute schon, sie gezwungen zu haben. Sie fand jedoch nach wie vor, dass die Sechzehnjährige irgendetwas tun sollte, wenn sie schon nicht mehr zur Schule gehen wollte und sich auch nicht für die Ausbildung zur Schneiderin interessierte, mit der Helena selbst zähneknirschend begonnen hatte. Luzyna wollte weder ihre Englischkenntnisse verbessern noch Französisch oder Persisch lernen. Sie schien entschlossen, einfach gar nichts zu tun, außer sich treiben zu lassen und das vermeintliche Paradies zu genießen, in dem sie gestrandet waren.
Helena sah sich um, bevor sie sich anschickte, den Handwagen zu schieben, den Adam zog. Sie selbst empfand das Flüchtlingslager nicht als Paradies, auch wenn es zweifellos der beste Ort war, an den es sie seit der Deportation aus Polen verschlagen hatte. Sie sah weniger die imponierenden schneebedeckten Gebirgsgipfel zwischen grünen Hügeln und Dattelhainen als vielmehr die tristen Baracken und Lagerstraßen, bevölkert von traurigen, entwurzelten Menschen. Und wenngleich sie die Ausflüge in die nur vier Kilometer entfernte Stadt Teheran durchaus genoss, so fühlte Helena sich doch fremd in der quirligen Metropole. Das Chaos auf den Straßen, die durcheinanderschreienden Chauffeure von Autos, Lastwagen, Esel- und Ochsenkarren ängstigten sie, das Feilschen in den Basaren, die quäkende Musik, die Rufe der Muezzins von den Moscheen und die Menschen mit ihren Pluderhosen, langen Kleidern und seltsamen Kopfbedeckungen verunsicherten sie.
Helena konnte den prunkvollen Palast des Schahs durchaus bewundern, aber sie schwärmte nicht wie Luzyna von den eleganten Läden in den westlich orientierten Teilen der Stadt, den Seidenkleidern und dem raffinierten Make-up der dort flanierenden Frauen. Sie schämte sich eher für ihre eigenen schlichten Baumwollkleider, wenn sie durch die Prachtstraßen lief. Die Flüchtlinge hatten neue Kleidung erhalten, nachdem sie im Übergangslager in der Hafenstadt Pahlawi entlaust worden waren. Die meisten der Pullover, Kleider und Mäntel passten jedoch nicht richtig oder waren zu warm für den persischen Sommer. Im Vergleich zu den Frauen in Teheran fühlte Helena sich wie ein hässliches Entlein – wohingegen Luzyna auch in Sackleinen wie eine Prinzessin ausgesehen hätte. Ihre Schwester war bereits jetzt eine Schönheit, und sie wusste das selbst nur zu gut. Luzyna war der festen Überzeugung, dass ihr die Welt einmal zu Füßen liegen würde. Nichts an ihr erinnerte an das wimmernde kleine Wesen, das sich an Helena geklammert hatte, als die russischen Soldaten ihre Familie aus der geräumigen Wohnung in Lemberg gezerrt, den Vater geschlagen und die Mutter beschimpft hatten.
Helena begriff bis heute nicht, warum Stalin sie so brutal aus Ostpolen hatte vertreiben lassen, nachdem er sich mit Adolf Hitler über die Teilung des Landes geeinigt hatte. Bis dahin hatte man doch friedlich mit den Ukrainern und Weißrussen zusammengelebt, die in diesem Bereich Polens die Bevölkerungsmehrheit darstellten. Helenas Vater, ein Zahnarzt, hatte jeden gleich behandelt, und ihre Mutter hatte auch ukrainischen und russischen Kindern Englisch- und Französischunterricht erteilt. Doch die Russen erklärten Hunderttausende polnische Bürger zu Klassen- und Volksfeinden. Sie alle wussten nicht, wie ihnen geschah, als sie aus ihren Häusern geholt, in Viehwaggons verfrachtet und nach Norden geschafft worden waren.
Die darauf folgenden zwei Jahre hatte die Familie im sibirischen Workuta verbracht. Helena, die damals bereits vierzehn Jahre alt gewesen war, hatte mit ihren Eltern in den Wäldern, manchmal auch im Bergwerk geschuftet. Luzyna hatten sie mit ihren kargen Essensrationen irgendwie durchgebracht. Helena erinnerte sich an Sibirien nur noch als eiskalte Hölle – die Temperaturen waren mitunter auf unter minus fünfzig Grad gesunken. Nachts hatte die Familie sich aneinandergeklammert, um sich zu wärmen, sie hatten mit Kälte, Ungeziefer und Hunger zu kämpfen gehabt. Helenas Vater war ein halbes Jahr später bei einem Unfall im Bergwerk umgekommen. Ihre Mutter hatte sich dennoch weiter ans Leben geklammert – auch als sie Axt und Säge hustend und fiebernd kaum noch hatte halten können, war sie zum Holzschlagen in die Wälder gegangen. Einige Monate vor der Befreiung war jedoch auch sie gestorben. Helena erinnerte sich noch gut daran, wie sie und Luzyna sich auf ihrer schmalen, harten Pritsche an sie geschmiegt hatten, um sie zu wärmen. Luzyna war irgendwann erschöpft eingeschlafen, aber Helena hatte ihre Mutter gehalten, ihren mühsamen Atemzügen gelauscht und schließlich ihren letzten Worten. »Pass auf Luzyna auf, Helena! Du musst jetzt für deine Schwester sorgen. Versprich mir, dass du sie nicht allein lässt … Luzyna verdient etwas Besseres, sie muss am Leben bleiben … meine kleine Sonne, mein Licht …«
Helena hatte es versprochen und ihren alten Schmerz niedergekämpft. Wieder war nur von Luzyna die Rede gewesen – Luzyna, die Leuchtende, das hinreißende goldblonde Engelchen mit den azurblauen Augen, der Liebling der ganzen Familie. Wobei Helena ihren Eltern nicht vorwerfen konnte, sie selbst vernachlässigt zu haben. Im Gegenteil, Maria und Janek Grabowski hatten ihren beiden Töchtern stets viel Aufmerksamkeit geschenkt. Helenas Interesse an Sprachen und Literatur war genauso gefördert worden wie Luzynas Freude an Musik und Tanz. Helena erinnerte sich an viele Stunden, in denen sie mit der Mutter Englisch und Französisch studiert oder mit dem Vater seine Lieblingsbücher gelesen hatte. Sie erinnerte sich jedoch auch an das Aufleuchten im Gesicht des Vaters, wenn dann plötzlich Luzyna hereingewirbelt war wie ein Irrwisch, um irgendetwas zu erzählen oder vorzuführen. Sie sah noch den Stolz im Blick ihrer Mutter, als Luzyna in der Musikschule das erste Mal vorgespielt hatte – mit zehn Jahren war sie schon eine recht gute Pianistin gewesen. Hinterher hatten alle den Grabowskis zu ihrer schönen und begabten Tochter gratuliert, während Helena abseitsgestanden hatte.
Zu Helena hatte den Eltern nie jemand gratuliert. Sie war zwar nicht reizlos, doch sie fiel auch nicht auf. Helena Grabowski hatte glattes braunes Haar, das leicht strähnig wurde, wenn man es nicht täglich wusch. Ihr Gesicht war ebenmäßig, die Augen weit auseinanderstehend und groß, doch von eher langweiligem Porzellanblau. Im Gegensatz zu ihrer jüngeren Schwester, die alle beeindruckte, war sie brav und angepasst.
Nach dem Tod der Mutter hatte Helena sich alle Mühe gegeben, ihr Versprechen zu halten. Sie hatte noch mehr von ihren kargen Essensrationen abgezweigt und schwer gearbeitet, um die Schwester zu ernähren. Wären sie nicht befreit worden, wäre auch Helena zweifellos gestorben. Persien war dann die Rettung für sie gewesen, Luzyna sprach immer noch voller Begeisterung von dem Übergangslager am Strand von Pahlawi. Endlich hatte es genug zu essen gegeben, die Kinder hatten im warmen Sand spielen und im Wasser des Kaspischen Meeres schwimmen können. Helenas Erinnerungen waren nicht so ungetrübt. Sie trauerte um die letzten Habseligkeiten ihrer Eltern, die im Zuge der Quarantänemaßnahmen am Strand verbrannt worden waren. Fotos und Briefe waren darunter gewesen, unwiederbringliche Andenken. Helena hatte schluchzend zugesehen, wie der Wind die Asche über den Strand wehte. Für Luzyna mochte Persien ein Paradies sein – für sie selbst blieb das Land ein Teil des Albtraums, der mit ihrer Vertreibung aus Lemberg begonnen hatte.
Jetzt schob sie den Handwagen mit aller Kraft an – sie war auch jetzt noch viel zu dünn und schwach – und versuchte, nicht an die Zukunft zu denken. Es hieß, der Krieg würde bald vorbei sein. Vielleicht konnten sie dann ja nach Polen zurückkehren und ihr altes Leben wieder aufnehmen.
Vor der Baracke warteten die Bewohner auf das Essen, die meisten geduldig und teilnahmslos. Die erwachsenen Flüchtlinge wirkten alt und verbraucht, auch wenn die meisten von ihnen gerade mal im mittleren Alter waren. Wer nicht jung und belastbar nach Sibirien gekommen war, hatte die Gefangenschaft nicht überlebt. Sehr viele waren bei der Ankunft in Persien krank gewesen, Tausende noch in den Hospitälern in Pahlawi und Teheran gestorben – sosehr sich die persischen, indischen und englischen Ärzte auch um sie bemüht hatten. Helena sagte sich, dass sie dem Himmel dafür danken musste, Luzyna und sich selbst gerettet zu haben, aber es fehlte ihr an der notwendigen Demut. Sie konnte nicht glauben, dass Gott es wirklich gut mit ihnen meinte. Er hätte dann schließlich gleich die Deportation verhindern können.
Adam begann nun, das Essen auszuteilen, und Helena fand möglichst für jeden ein freundliches Wort, dem sie eine Kelle Gulasch und Nudeln in sein Essgeschirr aus Blech oder Aluminium füllte. Ziemlich am Ende der Schlange stand dann auch Luzyna. Sie schenkte ihrer Schwester ihr unwiderstehliches Lächeln, als sie ihr den Teller entgegenhielt.
»Das ist sooo nett, dass du für mich eingesprungen bist!«
Luzyna hatte eine helle, weiche Stimme.
Helena verzog das Gesicht. »Das habe ich nicht für dich getan, sondern für die Leute, die sonst auf ihr Essen hätten warten müssen!«, sagte sie vorwurfsvoll. »Wo bist du gewesen, Luzyna? Doch nicht wirklich beim Arzt, oder? All diese Lügen und Drückebergereien … ich kann sie bald nicht mehr ertragen! Denkst du nie darüber nach, was unsere Eltern dazu gesagt hätten? Du weißt, wie pflichtbewusst Mutter und Vater waren. Für dein Verhalten hätten sie sich geschämt!«
Luzyna zuckte die Schultern, selbst dies bei ihr eine anmutige Geste. Sie hatte ihr lockiges Haar im Nacken zusammengebunden, ihr Kleid war zwar alt und abgetragen, saß aber recht gut. Luzyna stichelte ein bisschen an ihren Sachen herum, und gleich sahen sie besser an ihr aus. Unter dem Musselinkleid zeichneten sich weibliche Formen ab – Helena stellte neidvoll fest, dass die Schwester jetzt schon mehr Busen hatte als sie selbst mit ihren fast neunzehn Jahren.
»Mutter und Vater sind tot«, gab Luzyna schnippisch zurück. »Sie können sich nicht mehr schämen. Und wenn sie noch leben würden, hätten sie jetzt auch anderes zu tun.«
Helena nickte ernst. »Zweifellos!«, sagte sie. »Unser Vater würde als Zahnarzt im Lager arbeiten und unsere Mutter als Lehrerin. Ganz sicher würden sie nicht herumlungern und …«
»… das Leben genießen?«, fragte Luzyna aufsässig. »Was ist so schlimm daran? Arbeit und Hunger hatten wir bis jetzt doch genug. Warum also nicht einfach mal in den Tag hinein leben?«
»Und später?«, erkundigte sich Helena. »Wir werden nicht ewig hier im Lager bleiben, man wird dir nicht dauernd das Essen hinterhertragen. Später …«
»… später sind wir vielleicht alle tot!«, sagte Luzyna patzig, griff selbst nach der Kelle, füllte sich etwas zu essen in ihr Geschirr und wandte sich zum Gehen. »Es ist immer noch Krieg, und wer weiß, wie er endet. Die Soldaten sagen, die Amerikaner bauen an einer Waffe, mit der sie die ganze Welt verbrennen können. Und die Deutschen tun das ebenso. Wenn die eher fertig sind … Puff!«
Luzyna machte eine vielsagende Handbewegung, bevor sie sich mit ihrem Teller verzog. Wahrscheinlich wieder in Richtung Remise oder zu Kaspars Baracke, um gemeinsam mit dem jungen Mann zu essen.
Helena sah ihr unglücklich nach. Sie hatte ihren Worten nicht wirklich etwas entgegenzusetzen, und Luzyna war mit ihrer Einstellung auch nicht allein. Fast niemand im Lager machte irgendwelche Pläne für die Zukunft.
KAPITEL 2
Als alle mit Essen versorgt waren, brachten Helena und Adam den Handwagen mit dem Kessel zurück in die Küche. Dort halfen sie noch beim Abwaschen und Aufräumen. Luzyna, zu deren Aufgaben das eigentlich gehört hätte, ließ sich nicht noch einmal blicken.
»Sie schmollt«, konstatierte Adam, als Helena sich darüber beklagte. »Wenn sie sich sonst vor der Morgenarbeit drückt, kommt sie immer mittags zurück. Schon wegen der Sonderrationen.«
Für das Küchenpersonal wurde das Essen erst serviert, wenn alles fertig war. Die Köche und Küchenhelfer aßen dann gemeinsam im Zelt, und dabei fiel meist etwas Besonderes ab. An diesem Tag gab es Obst zum Nachtisch.
»Sie macht das also öfter?«, fragte Helena resigniert.
Adam nickte. »Ihr macht das hier keinen Spaß«, verteidigte er sie. »Sie ist ja auch … also sie ist ja auch so gar kein Küchenmädchen. Sie sagt, sie wolle Pianistin werden … Bestimmt wird sie’s eines Tages, so hübsch, wie sie ist.«
»Ich bin auch kein Küchenmädchen!«, gab Sonia zurück, eine junge Frau, die der Köchin zur Hand ging. »Ich wollte Ärztin werden. Das wird jetzt wohl nichts mehr … Wenngleich man mit zwanzig durchaus noch studieren kann. So ganz hab ich die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Für eine Laufbahn als Pianistin sehe ich allerdings schwarz. Da muss man früher anfangen und üben, üben, üben. Jeden Tag, viele Stunden lang. So viel Arbeitseifer kann ich mir nicht vorstellen bei der lieben Luzyna …«
»Sie hat früher schon sehr viel geübt«, erklärte Helena und ärgerte sich im selben Moment, dass sie ihre Schwester verteidigte. Tatsächlich konnte sie der jungen Frau nur recht geben. Luzyna träumte vielleicht davon, einmal eine berühmte Klaviervirtuosin zu werden, doch sicher strebte sie kein arbeitsintensives Studium an. »Sie wurde einfach aus der Bahn geworfen …«
Die anderen lachten.
»Herzchen, das wurden wir alle!«, erklärte die Köchin. »Und für die meisten von uns wird der Neuanfang schwieriger sein als für euch jungen Leute. Ihr habt doch noch Möglichkeiten … Wenn der Krieg erst vorbei ist … Ihr könnt alles werden …«
Helena zog die Augenbrauen hoch. »Hier?«, fragte sie bitter. »In Persien? Wo wir nicht mal die Sprache richtig verstehen? Ich versuche ja, sie zu lernen, aber es ist elend schwer. Und ich versuche, eine Ausbildung zur Schneiderin zu machen, obwohl ich nicht das geringste Talent dafür habe. Ob ich mir damit mal den Lebensunterhalt verdienen kann, bezweifle ich. Und Luzyna …«
Sie wischte sich rasch eine Träne aus den Augen. Wie es aussah, gedachte Luzyna nicht, sie zu unterstützen. Im Gegenteil, zumindest in der kommenden Zeit würde sie auch noch für ihre Schwester aufkommen müssen.
»Luzyna will zurück nach Polen«, vermeldete Adam, der das junge Mädchen wohl am besten kannte. »Sobald der Krieg vorbei ist.«
»Ja, weil sie sich vorstellt, da sei alles noch wie früher«, bestätigte Helena mutlos. »Aber nach dem, was man so hört, soll in Europa doch alles zerstört sein … Und selbst wenn unser Haus noch stünde – darin wohnen jetzt Russen. Ich glaube nicht, dass wir die einfach rauswerfen können.«
»Wenn ich jünger wäre … ich ginge nach Neuseeland«, sagte Sonia, die von einem Medizinstudium träumte. Ihre Stimme klang sehnsüchtig.
»Wohin?« Helena und Adam fragten gleichzeitig, doch während die Frage des Jungen klang, als hätte er von diesem Land noch nie gehört, schwang in Helenas Stimme Spannung mit.
Neuseeland? Der Name des Inselstaates in Polynesien war bislang nie im Zusammenhang mit Krieg und Flucht gefallen.
»Neuseeland. Das ist so was wie eine englische Kolonie«, erklärte Sonia. »Es liegt irgendwo bei Australien. Sehr, sehr weit weg. Und die Menschen, die dort leben, wollen polnische Flüchtlinge aufnehmen. Meine kleine Schwester ist im Waisenheim in Isfahan. Sie hat mir davon geschrieben.« In Isfahan hatte die polnische Exilregierung ein gut ausgestattetes Waisenhaus für die Kinder der verstorbenen Deportierten organisiert. Es gab dort hervorragende Schulen und beste Betreuung. Helena war bei ihrer Einreise allerdings zu alt gewesen, um aufgenommen zu werden, und Luzyna hatte allein nicht hingewollt. »Es gibt natürlich eine Altersbeschränkung«, fuhr Sonia fort. »Aber ihr beide …«, sie wies auf Adam und Helena, »… ihr werdet bestimmt mitgenommen. Und Luzyna auch. Erkundigt euch einfach mal.«
Helena war voller Aufregung, als sie sich auf den Weg zurück zu ihrer Baracke machte. Neuseeland … Im Gegensatz zu Sonia und Adam war ihr das Land durchaus ein Begriff, sie erinnerte sich noch gut an verheißungsvolle Päckchen mit bunten Briefmarken darauf und Briefe in englischer Sprache, die ihre Mutter mit ihr übersetzt hatte. Ein Freund ihres Vaters, ein deutscher Zahnarzt, war gleich nach Hitlers Machtergreifung nach Neuseeland geflohen. Als Jude hatte er für sich keine Zukunft in Deutschland gesehen, und recht behalten. In den Jahren nach der Auswanderung ließ er seine europäischen Freunde an seinen Erlebnissen in der neuen Welt teilhaben. Die Grabowskis lasen mit Spannung seine Briefe, und besonders nach Kriegsausbruch, als die Versorgungslage schlechter wurde, warteten sie ungeduldig auf seine Pakete, gefüllt mit Konservendosen, getrocknetem Fleisch und Fisch und Süßigkeiten für die Kinder. Helenas Mutter hatte darauf bestanden, dass die Mädchen sich dafür persönlich bedankten – eine gute Gelegenheit, sich im Englischen zu üben. Helena wusste sogar noch seine ungefähre Adresse: Elizabeth Street, Wellington. Wellington, so hatte Werner Neumann geschrieben, sei die Hauptstadt seiner neuen Heimat, und sie schien sich weit weniger von Lemberg oder Düsseldorf zu unterscheiden als Teheran. Er berichtete von Theater- und Opernaufführungen, von Warenhäusern und einem Parlamentsgebäude.
Natürlich war der Kontakt zu den Auswanderern abgerissen, als die Grabowskis deportiert worden waren, doch hier in Persien, wo die Flüchtlinge, die die Sprache verstanden, englische Radiosender hören konnten, hatte Helena stets aufgehorcht, wenn das Land erwähnt wurde. Sie wusste, dass Neuseeland zwar Truppen nach Europa in den Krieg entsandt hatte, im Land selbst waren bisher jedoch keine Bomben gefallen. Alles dort schien friedlich zu sein. Wenn Helena an Neuseeland dachte, hatte sie Schafherden auf grünen Wiesen vor Augen, bunte Holzhäuser und freundliche Menschen. Ihr Nennonkel Werner und seine Familie hatten dort schnell Fuß gefasst. Sie hatten Englisch lernen müssen, doch Helena sprach diese Sprache recht gut. Es wäre sehr viel einfacher, in Neuseeland eine Stellung zu finden oder sogar eine Universität zu besuchen, als in Persien.
Helenas Herz schlug höher bei dem Gedanken, die Neumanns vielleicht sogar einmal zu besuchen, wenn es ihr wirklich gelingen sollte, für sich und Luzyna einen Platz auf dem Auswandererschiff zu ergattern. Sie beschloss, am nächsten Tag bei der Lagerleitung nachzufragen – gleich nachdem sie mit Luzyna darüber gesprochen hatte.
Helena hatte sich für einen Kampf gewappnet, um dann angenehm überrascht zu werden. Luzyna sprach das Thema von sich aus an.
»Kaspar und ich gehen nach Neuseeland!«, eröffnete sie ihrer Schwester, als sie sich am Abend in ihre Decken kuschelten. »Kaspar macht eine Autowerkstatt auf. Viele kann’s da noch nicht geben, es soll alles nur voller Schafe und Kühe sein. Das schrieb ja auch Onkel Werner.«
Helena runzelte die Stirn. Sie konnte sich kaum vorstellen, dass ein so weitläufiges und wohl auch modernes Land wie Neuseeland noch nicht motorisiert sein sollte. Zudem sah sie Kaspar, der gerade erst ein paar Monate bei der Wartung der Lagerfahrzeuge half, noch nicht als den Automechaniker, auf den das Land nur gewartet hatte. An sich war ihr das jedoch egal. Hauptsache, Luzyna stand der Auswanderung positiv gegenüber.
»Wisst ihr denn schon, wie ihr das anstellt?«, fragte Helena also vorsichtig.
Luzyna nickte eifrig. »Klar. Neuseeland will siebenhundert Kinder und Jugendliche aufnehmen, hat Kaspar gehört. Waisen müssen es sein, aber das ist wohl die einzige Bedingung. Die meisten werden aus dem Waisenhaus in Isfahan kommen, doch wir können uns auch melden. Bei Frau Dr. Virchow. Wir sollen da einfach vorsprechen, und sie stellt eine Liste zusammen.«
Frau Dr. Virchow, eine Ärztin, angestellt von der polnischen Exilregierung, war für die Kinder und Jugendlichen in den Lagern rund um Teheran verantwortlich. Sie organisierte die Gesundheitsversorgung, kümmerte sich um die Schulen und Ausbildungsangebote. Helena hatte bereits mehrmals mit ihr zu tun gehabt, unter anderem bei der Anmeldung zum Nähkurs und zum Persischunterricht. Außerdem hatte sie sich als Englischlehrerin beworben, war aufgrund ihrer Jugend allerdings noch vertröstet worden. Sie solle sich erst mal von den Strapazen der Reise und der Haft in Sibirien erholen, hatte Frau Dr. Virchow freundlich entschieden. In einem Jahr werde man dann weitersehen.
Helena hatte jedenfalls keine Angst vor der Ärztin – obwohl sie nicht glauben konnte, dass »einfach vorsprechen« genügte, um einen Platz auf der Liste der nach Polynesien reisenden Flüchtlinge zu erhalten. Zweifellos würde noch eine Gesundheitsprüfung hinzukommen, und vielleicht spielten auch die Englischkenntnisse eine Rolle. Helena war dennoch guten Mutes, sowohl was sie selbst als auch was Luzyna anging. Die Schwester sprach zwar nicht so gut Englisch wie sie, aber immer noch besser als die meisten anderen im Lager. Und gesund waren sie beide, das hatte man ihnen mehrfach bestätigt.
»Du hast doch nichts dagegen, wenn ich mitkomme?«, fragte Helena ihre Schwester schließlich, nachdem Luzyna noch ein bisschen von ihrer und Kaspars rosiger Zukunft am anderen Ende der Welt geschwärmt hatte.
Luzyna lächelte sie an, beugte sich zu ihr herüber und umarmte sie. »Ohne dich, Helena«, erklärte sie, »ginge ich nirgendwo hin!«
Ihre Worte wärmten Helenas Herz, ob Luzyna sie nun ehrlich meinte oder nicht.
Am nächsten Morgen trafen sich die Schwestern mit Kaspar vor den Büros der Lagerleitung. Luzyna schwänzte dafür mal wieder die Küchenarbeit – diesmal allerdings mit Helenas Billigung. Auch Kaspar hatte sich nicht einfach davongeschlichen, sondern den Leiter des lagereigenen Fuhrparks um eine Freistunde gebeten. Jetzt begrüßte der schlaksige, braunhaarige junge Mann Luzyna so liebevoll, als hätten die beiden sich seit Monaten nicht gesehen. Helena war es peinlich, zusehen zu müssen, wie sie sich in aller Öffentlichkeit umarmten und küssten. Die wenigen anderen jungen Leute, die auf eine Unterredung mit Frau Dr. Virchow warteten, beachteten das Paar jedoch nicht. Sie schienen mit ihren eigenen Anliegen genug zu tun zu haben. Helena registrierte, dass es sich um drei Jungen und zwei Mädchen handelte, sie schätzte ihr Alter zwischen vierzehn und sechzehn Jahre. Die Mädchen hielten jüngere Geschwister an der Hand, die mit großen Augen auf Luzyna und Kaspar schauten. Eine der Kleinen kicherte.
»Gibt’s was zu sehen?«, fuhr Kaspar sie an.
Er war wie so oft kurz angebunden und unfreundlich, Helena hatte das auch schon am eigenen Leibe erfahren müssen. Lediglich Luzyna gegenüber verhielt er sich anders.
Das kleine Mädchen schlug erschrocken die Augen nieder. Seine ältere Schwester schien etwas sagen zu wollen, wurde dann jedoch aufgerufen. Sie zog ihre Geschwister mit sich ins Büro von Frau Dr. Virchow. Bis die drei wieder herauskamen, waren gerade mal zehn Minuten vergangen, gleich darauf rief die Ärztin Luzyna zu sich. Sie trat gelassen ein und kam nach kurzer Zeit wieder heraus.
»Sie wollte wissen, ob ich schon mal was von Neuseeland gehört habe und wie ich mir das Land vorstelle. Und ob ich im Englischkurs sei. Ich hab ihr gesagt, ich könne schon Englisch und wir hätten in Neuseeland Verwandte …« Helena sog ob der Lüge scharf die Luft ein, musste allerdings zugeben, dass Luzynas Schwindelei bezüglich der Neumanns ihre Chancen sicher erhöhte. »Tja, und dann fragte sie noch, ob meine Eltern wirklich tot seien, also, ob ich das sicher wüsste. Wenn die Eltern nur vermisst werden, schicken sie die Kinder nicht gern so weit fort. Na ja …«, Luzyna zwinkerte eine Träne fort, »… bei uns besteht da ja kein Zweifel …«
Im Anschluss an zwei weitere Jungen war es dann an Helena, das Büro der Ärztin zu betreten. Sie lächelte ihr freundlich zu.
»Ich glaube, wir kennen uns schon, nicht wahr?«, begrüßte Frau Dr. Virchow sie. »Du nimmst an diversen Kursen teil, und du … Warst du nicht diejenige, die fließend Englisch spricht?«
Helena nickte. »Meine Mutter war Englischlehrerin«, erklärte sie. »Das hat meine Schwester Ihnen sicher schon erzählt. Luzyna Grabowski. Sie war eben hier.«
Frau Dr. Virchow warf einen Blick auf ihre Akten. »Ach ja, die kleine Blonde … Ich wusste nicht, dass sie deine Schwester ist, der Name Grabowski kommt ja häufig vor. Luzyna hat einen sehr guten Eindruck auf mich gemacht. Und du wärest natürlich auch für eine Auswanderung geeignet. Ich fürchte nur … ich fürchte, wir können das nicht für dich organisieren.«
Helena hatte das Gefühl, unversehens von einer Wolke gestoßen zu werden und in ein dunkles Loch zu fallen.
»Aber … aber wieso denn nicht?«, stammelte sie. »Es … ich denke, es gibt siebenhundert Plätze?«
Frau Dr. Virchow nickte. »Für Kinder und Jugendliche zwischen sechs und sechzehn Jahren. Deine Schwester passt gerade noch ins Raster, Helena. Und wenn du jetzt siebzehn wärest … Ich würde versuchen, ein gutes Wort für dich einzulegen. Schon um euch Schwestern nicht zu trennen. Doch mit fast neunzehn … Es tut mir wirklich leid, Helena …«
Helena biss sich auf die Lippen. »Aber Luzyna … würden Sie mitnehmen?«, fragte sie mit erstickter Stimme.
»Deine Schwester würde ich gern mitschicken«, meinte die Ärztin. »Sie erscheint mir sehr geeignet, und es wäre eine große Chance für sie. Natürlich muss sie einverstanden sein, wir zwingen niemanden. Wenn du es gut mit ihr meinst, rätst du ihr zu. Was diese Kinder da erwartet, Helena, ist ein ganz anderes Leben.« Frau Dr. Virchow spielte mit ihrem Füllfederhalter. »Ich beneide sie fast«, sagte sie leise. »Sie entkommen dem Krieg und der schweren Zeit danach, die uns allen bevorsteht. Wir werden Europa völlig neu aufbauen müssen, und ich fürchte, Russland und die Westmächte werden es untereinander aufteilen. Wenn sie sich darüber streiten, gibt es womöglich gleich einen neuen Krieg. Dagegen dort in Neuseeland: keine Zerstörungen, keine Gefahren, und gerade für junge Mädchen fantastische Möglichkeiten. Die Universitäten standen den Frauen dort immer offen. Sie haben seit fünfzig Jahren das Wahlrecht … Es ist sicher nicht das Paradies, Helena, doch es ist das Beste, was deiner Schwester passieren kann.«
Helena schluckte. Sie hörte wieder die Stimme ihrer Mutter: Luzyna verdient etwas Besseres … Jetzt sah es so aus, als würden Marias Träume für ihre jüngere Tochter wahr werden.
»Ich werde ihr gut zureden«, sagte Helena hölzern. »Vielen Dank, Frau Dr. Virchow. Ach ja, und … wenn sich Kaspar Jablonski gleich vorstellt … Sofern Ihnen daran gelegen ist, Luzyna mitzuschicken, dann sagen Sie ihm nicht gleich, dass er mit achtzehn zu alt ist und keine Chance hat. Lassen Sie die beiden noch etwas in dem Glauben, zusammenbleiben zu können. Verliebt wie sie ist, wirft Luzyna sonst alles hin.«
Tatsächlich erfuhr Luzyna von Helenas Ablehnung erst, als es sich nicht mehr vermeiden ließ. Bis dahin verbarg Helena ihren Kummer vor ihrer Schwester und weinte nur heimlich auf ihrer Pritsche, wenn Luzyna schlief, oder über ihrer Näharbeit, die sie dabei auch noch mit Tränenspuren verdarb. Immerhin, so sagte sie sich bitter, würde sie fürderhin nur sich selbst mit dem Schneidern ernähren müssen. Die Verantwortung für Luzyna würde ihr abgenommen. Helena empfand Schuldgefühle, weil sie darüber so etwas wie Erleichterung verspürte.
Schließlich hing die Liste mit den ausgewählten Kindern und Jugendlichen aus, und obwohl Helena im Stillen immer noch auf ein Wunder gehofft hatte, fand sich darauf weder ihr Name noch Kaspars. Lediglich Luzyna gehörte zu den fünfzehn Waisen aus dem Lager bei Teheran, die zehn Tage später abreisen sollten. Luzynas Reaktion darauf entsprach Helenas Erwartungen.
»Gib zu, dass du es gewusst hast!«, schrie das Mädchen seine Schwester an, als Helena es nicht schaffte, sich ausreichend überrascht über ihre Ablehnung zu zeigen. »Du hast genau gewusst, dass sie Kaspar nicht mitnehmen werden, aber du hast nichts gesagt, weil du mich loswerden willst!«
Dass Helena selbst nicht auf der Liste stand, schien ihre Schwester weniger zu stören, allen früheren Beteuerungen zum Trotz. Helena fühlte sich dadurch verletzt, ließ sich jedoch nichts anmerken. Statt Ärger musste sie Diplomatie zeigen. Sie würde Luzyna beruhigen und davon abhalten, direkt zur Lagerleitung zu laufen, um sich abzumelden. Das bedeutete, ihr auf keinen Fall die Hoffnung zu nehmen, Kaspar je wiederzusehen.
»Ja, ich habe es gewusst«, gab Helena zu. »Die Altersbeschränkung gilt jedoch nur für diese Reise, nicht für die Auswanderung an sich. Kaspar und ich werden nachkommen. Frau Dr. Virchow hat uns ausdrücklich Mut gemacht …« Kaspar war nach dem Bewerbungsgespräch tatsächlich recht optimistisch aus dem Büro der Ärztin gekommen. Sie hatte ihm versichert, dass es in Neuseeland gute Chancen für unternehmungslustige junge Einwanderer gebe. Das Land stehe ihm auf jeden Fall offen, ob er nun zu der Gruppe der bald abreisenden Kinder und Jugendlichen gehöre oder nicht. »Und so wie ich Frau Dr. Virchow verstanden habe, könntet ihr eure Pläne auch gar nicht gleich verwirklichen, wenn Kaspar jetzt mitreisen würde«, fuhr Helena fort. »Ihr werdet ja nicht einfach am Hafen von Wellington ausgesetzt, sondern kommt zunächst in ein Übergangslager, besucht die Schule …«
»Ich will keine Schule!«, ereiferte sich Luzyna. »Und Kaspar auch nicht!«
Helena zwang sich zur Geduld und nickte zustimmend. »Eben!«, sagte sie. »Er könnte aber auch nicht gleich eine Autowerkstatt aufbauen. Und heiraten dürftet ihr ebenfalls noch nicht. Dafür bist du zu jung …«
»Mit sechzehn kann man heiraten!«, trumpfte Luzyna auf – in Persien, so hatte sie zumindest gehört, verheiratete man die Mädchen zum Teil schon als Kinder.
»Nicht in Neuseeland!« Helena hatte sich mithilfe der freundlichen Dr. Virchow kundig gemacht. »Da geht es erst mit siebzehn, und auch da nur mit Einwilligung der Erziehungsberechtigten. Das wäre dann irgendjemand von der Lagerleitung in Pahiatua oder wie der Ort heißt. Der würde sie dir jedoch nicht geben. Man holt dich ja nicht als Braut nach Neuseeland, sondern im Rahmen des Programms für Kriegswaisen. Dein neuer Vormund kennt dich nicht und Kaspar erst recht nicht. Nie im Leben gäbe er euch die Erlaubnis zur Heirat. Sieh es ein, Luzyna, so wie ihr euch das vorstellt, geht es nicht. Du reist deinem Kaspar jetzt voraus. Bald kommt er nach, schafft sich erst mal ohne Familie ein Standbein, was sehr viel einfacher ist, und dann holt er dich in Pahiatua ab.«
Luzyna schniefte. »Das muss er mir dann aber versprechen!«, schluchzte sie offenbar besänftigt.
Helena nahm sie in die Arme. »Das tut er bestimmt«, versicherte sie ihrer Schwester. »Wenn er dich wirklich liebt …«
»Natürlich liebt er mich!« Luzynas Kummer wich schon wieder dem Zorn darüber, womöglich nicht ernst genommen zu werden. »Du wirst sehen, Kaspar wird schneller da sein als ich!«
Helena nickte und versuchte, nicht ungläubig zu wirken. Wahrscheinlich würde Kaspar Luzyna sogar das versprechen. Sie war überzeugt davon, dass der junge Mann bis jetzt nicht wusste, wo Neuseeland wirklich lag. Er sprach auch kein Wort Englisch und hatte keinerlei Ersparnisse. Niemals würde es Kaspar Jablonski ohne das Programm für Kriegswaisen nach Neuseeland schaffen. Sie musste nur noch dafür sorgen, dass dies in den nächsten zehn Tagen weder ihm noch ihrer Schwester bewusst wurde.
KAPITEL 3
In den letzten Tagen vor der Abreise wusste Helena kaum, wohin vor Aufregung, während Luzyna so gelassen blieb, als stünde nur ein Ausflug nach Teheran an. Sie machte keine Anstalten, zu packen und ihre Angelegenheiten zu ordnen, und sie lachte, als Helena sie dazu anhielt.
»Helena, ich besitze genau zwei Kleider und zwei Garnituren Unterwäsche. Dazu ein Handtuch, ein Stück Seife, Zahnbürste und Zahnpulver sowie eine Wolldecke. Das habe ich in fünf Minuten zusammengepackt!«
»Vielleicht nimmst du lieber eins von meinen Kleidern mit«, gab Helena zu bedenken. »Mein dunkelrotes ist weniger verschlissen als dein himmelblaues!«
Luzyna verdrehte die Augen. »Das ist ja auch dein Sonntagskleid«, meinte sie. »Das kannst du mir nicht mitgeben. Wahrscheinlich geben sie uns in dem neuen Lager sowieso neue Kleidung.«
»Ich brauche kein Sonntagskleid!«, behauptete Helena. »Aber du sollst gut angezogen sein, auch auf der Reise. Vielleicht können wir noch irgendwo ein Schultertuch eintauschen, damit du nicht frieren musst. Es ist ja größtenteils eine Seereise, und du weißt noch, wie kalt es auf dem Schiff von Krasnovodsk nach Pahlawi war …« Die Fahrt über das Kaspische Meer war ein Albtraum gewesen.
»Da kamen wir auch aus Sibirien.« Luzyna lachte. »Jetzt dagegen geht es nach Süden, wenn ich Frau Dr. Virchow richtig verstanden habe.«
Die rührige Ärztin lud die jungen Auswanderer jeden Abend zu einem Vortrag über ihr künftiges Gastland in einen Klassenraum der Lagerschule ein, erzählte und zeigte Fotografien. Luzyna erwies sich als nur mäßig interessiert. Helena wusste nicht, ob sie tatsächlich jeden Abend brav zum Zuhören erschienen wäre, hätte ihr Frau Dr. Virchow nicht erlaubt, sowohl ihren Freund als auch ihre Schwester mitzubringen. Kaspar Jablonski besuchte die Vorträge gern – auch wenn Helena argwöhnte, dass ihn vor allem die Technik des Diaprojektors interessierte, mit dessen Hilfe die Farbbilder auf eine Leinwand projiziert wurden. Kaspar konnte sich über dieses kleine Wunder begeistern und machte sich gleich am zweiten Tag beliebt, indem er Frau Dr. Virchow die Bedienung des Apparates abnahm.
Was die Ärztin zu den Bildern erzählte, schien an ihm vorbeizurauschen – vielleicht ein Glück, fand Helena. Der junge Mann hätte sonst vielleicht herausgefunden, wie weit entfernt Neuseeland lag und wie schwierig die Reise zu bewerkstelligen war. Auf jeden Fall konnte man nicht einfach ein Schiff besteigen und sich nach Wellington bringen lassen – bis nach Indien sollte die Gruppe über Land transportiert werden. Je mehr Helena darüber hörte, desto mehr schwanden ihre eigenen Hoffnungen, Luzyna irgendwann folgen zu können. Die Reise führte durch mehrere Länder, die Bus- und Zugfahrten kosteten ein Vermögen. Gleichzeitig wuchs Helenas Sehnsucht mit jeder Stunde, die sie Frau Dr. Virchows Vorträgen lauschte, und mit jedem Dia, das Kaspars neues Lieblingsspielzeug an die Wand warf. Helena bestaunte die Naturwunder in Luzynas neuer Heimat, die Farnwälder, Vulkane und heißen Quellen, die schneebedeckten Berge und Palmenhaine, die fischreichen Bäche und Seen und das endlose Farmland. Es gab unzerstörte Städte, die sauber und heimelig wirkten, die jungen Einwanderer würden die Möglichkeit haben, zunächst einmal in einer Fabrik zu arbeiten und etwas Geld zu sparen, um dann vielleicht eine gute Schule oder eine der hervorragenden Universitäten zu besuchen.
Helena hätte sich in Träumen von all dem verlieren können, zwang sich jedoch zum Realismus. Sie drängte Luzyna, ihre Kleider anzuprobieren, und versuchte, sie durch eine Ziernaht hier und einen Abnäher dort attraktiver wirken zu lassen. Mit schlechtem Gewissen entwendete sie aus der Schneiderei Stoff und tauschte ihn gegen ein Schultertuch, das Luzyna warm halten würde und obendrein sehr hübsch zu dem dunkelroten Kleid aussah, das sie ihr vermachte. Wann immer sie mit ihr zusammen war, sprach sie Englisch mit ihr und war erschrocken, wie viel ihre jüngere Schwester in Sibirien vergessen hatte. Helena versuchte, Luzynas Sprachkenntnisse aufzufrischen, und drängte sie, die Adresse der Neumanns auswendig zu lernen. Sie war sich ziemlich sicher, dass Stadt und Straße richtig waren, nur die Hausnummer fiel ihr nicht mehr ein. Trotzdem entschloss sie sich, dem Freund ihres Vaters zu schreiben. Sie erzählte ihrem Nennonkel, was ihrer Familie zugestoßen war, und bat ihn, in Pahiatua nach Luzyna zu fragen und sich um das junge Mädchen zu kümmern. Dabei gab sie sich im Stillen dem Tagtraum hin, die Neumanns könnten vom Schicksal der Grabowskis so gerührt sein, dass sie Helena umgehend Geld schickten, um die Schwestern wieder miteinander zu vereinen.
Neben den Reisevorbereitungen verfolgten Helena und die anderen Flüchtlinge die Entwicklung im fernen Europa. Den Alliierten war eben der Durchbruch an der deutschen Westfront gelungen, und sie hofften, nun schnell durch Nordfrankreich vorstoßen zu können. Das Ziel war Paris und schließlich Berlin. Die Niederlage der Deutschen war nur noch eine Frage der Zeit.
Und dann war der Tag der Abreise tatsächlich da. Die jungen Auswanderer waren angewiesen worden, sich um zehn Uhr morgens auf dem früheren Exerzierplatz in der Lagermitte einzufinden. Ein Lastwagen sollte sie dann nach Isfahan bringen. Sie würden eine Nacht im Waisenhaus schlafen, und von dort aus würde es am nächsten Tag endgültig losgehen: erst auf Lastwagen, dann mit dem Zug und ab Bombay mit dem Schiff nach Wellington.
Helena war bereits um halb zehn mit Luzynas Habseligkeiten zur Stelle, während ihre Schwester sich noch ungestört von Kaspar verabschieden wollte. Der Platz füllte sich. Die anderen Kinder und Jugendlichen hatten es vor Spannung nicht ausgehalten, sie waren wie Helena viel zu früh gekommen. Nun schien über dem Elburs-Gebirge bereits die Sonne, es war warm, und das Warten fiel nicht schwer. Die Kleineren spielten, die Jugendlichen plauderten miteinander und achteten darauf, dass ihre jüngeren Geschwister nicht verloren gingen. Lediglich Helena stand wie auf glühenden Kohlen da. Wo um Himmels willen blieb Luzyna? Helena blickte immer wieder zu der großen Uhr am Hauptgebäude des Lagers und zwang sich zur Ruhe. Es war noch früh – Luzyna hatte noch fünfundzwanzig Minuten Zeit. Dann zwanzig, dann fünfzehn … Um fünf vor zehn waren alle Kinder und Jugendlichen da, eine junge Frau, die Helena nicht kannte, machte sich daran, ihre Namen auf einer Liste abzustreichen. Um zehn Uhr fuhr der Lastwagen auf den Platz.
Helena überlegte fieberhaft. Wahrscheinlich tauschten Kaspar und Luzyna inniglich Küsse und Umarmungen aus und versicherten einander zum hundertsten Mal, dass dies nur eine Trennung auf Zeit sei. Luzyna musste darüber vergessen haben, wie spät es war – oder sie verließ sich einfach darauf, dass Helena sie schon rechtzeitig holen würde. Genau das würde sie jetzt tun müssen. Den Treffpunkt der beiden konnte sie sich vorstellen, es war ein Verschlag hinter der Remise, der ihnen Schutz vor neugierigen Blicken bot. Aber bis dorthin und zurück würde sie sicher fünf Minuten brauchen, wenn nicht zehn … Und die junge Frau mit der Liste rief bereits Luzynas Namen auf, während die anderen jungen Auswanderer auf die Ladefläche des Lastwagens kletterten. Helena würde hingehen und sie sowie den Fahrer bitten müssen, auf Luzyna zu warten.
Sie griff nach dem Bündel ihrer Schwester und ging auf den Lastwagen zu. Ihr Herz klopfte heftig. Sie liebte Luzyna, aber sie hasste es, sich immer wieder für sie zu entschuldigen, immer wieder um Ausnahmen für sie zu bitten und Lügen zu erfinden, um ihre Fehler zu erklären.
Und dann wichen Unwille und Überdruss plötzlich der Wut. Sie war es so leid, stets zurückzustecken, sich aufzuopfern für ein junges Mädchen, das nichts von dem zu schätzen wusste! Für Luzyna war alles selbstverständlich, was Helena für sie tat, und ganz bestimmt würde sie sich auch nicht dafür bedanken, wenn sie ihr jetzt diese einmalige Chance sicherte, die sie eben Gefahr lief, zu verspielen! Im Gegenteil – Helena meinte, ihr mürrisches Gesicht schon vor sich zu sehen, ihr »Ich komm ja gleich, nun hab dich nicht so …« zu hören. Sie würde unwillig hinter ihr hertrotten, um dann ein entschuldigendes Lächeln aufzusetzen und die junge Frau von der Lagerleitung und den Fahrer in null Komma nichts um den Finger zu wickeln …
Helena biss die Zähne zusammen. Dann hatte sie den Lastwagen auch schon erreicht. Die junge Frau mit der Liste warf ihr einen kurzen Blick zu.
»Grabowski, Luzyna?«, fragte sie geschäftsmäßig und hob ihren Stift, um den Namen abzuhaken. Helena öffnete den Mund und suchte nach erklärenden Worten. »Luzyna Grabowski?«
Ungeduldig wiederholte die Frau ihre Frage und wies Helena mit einer Handbewegung an, endlich auf den Lastwagen zu steigen.
Helena schluckte. Ihre Gedanken überschlugen sich.
»Ja«, sagte sie dann heiser. Das Blut rauschte in ihren Ohren. »Ja!«
Helena war wie in Trance, als sie auf die Ladefläche kletterte. Ein Junge hielt ihr die Hand hin und half ihr hinauf – Bedenken schien niemand zu haben. Helena konnte kaum glauben, dass keiner dieser jungen Menschen Luzyna kannte, aber vielleicht hatten sie nicht genau hingehört, als sie aufgerufen worden war. Oder sie hatten sich einfach nie für den Namen von Kaspar Jablonskis hübschem Anhängsel interessiert. Helena kam nun zweifellos zugute, dass ihre Schwester weder die Schule noch irgendwelche Kurse besucht hatte.
Ein Mädchen lächelte Helena zu – sie hatten einander damals auf dem Gang vor Frau Dr. Virchows Büro gesehen, sich allerdings nicht vorgestellt. Und auch die anderen Mitreisenden kannten Helena nicht mit Namen. Weder waren Leute aus ihrem Schneiderinnenkurs noch aus der Persischklasse dabei.
»Ich bin Natalia«, sagte das Mädchen.
Helena räusperte sich. »Lu… Luzyna …«
Durch den schweren Lastwagen ging ein Zittern, als der Fahrer den Motor anließ. Helena blickte über den Platz. Ihr Herz klopfte heftig. Wenn Luzyna jetzt erschien, konnte sie die Sache immer noch richtigstellen …
Luzyna ließ sich jedoch nicht blicken. Auch als der Wagen sich jetzt in Bewegung setzte und die Kinder und Jugendlichen den Zurückbleibenden zuwinkten, konnte Helena ihre Schwester nirgends entdecken. Doch gleich würde der Laster über die Hauptstraße des Lagers fahren und die Remise passieren – und tatsächlich hasteten Luzyna und Kaspar in diesem Moment dahinter hervor. Anscheinend war nun auch ihnen aufgegangen, dass die Uhr längst zehn geschlagen hatte.
Luzyna blickte erschrocken auf die Ladefläche, als der Wagen an ihnen vorbeifuhr. Sie winkte aufgeregt – auch Kaspar versuchte, den Laster anzuhalten. Der Fahrer nahm dies jedoch nur als Abschiedsgruß. Er hupte vergnügt, die Kinder jubelten.
Luzynas Rufe gingen darin unter, aber Helena sah, dass Luzyna ihren Namen rief. Sie hatte sie entdeckt, hatte gesehen, dass Helena ihren Platz einnahm. Der Ausdruck in ihrem Gesicht war unbeschreiblich. Erstaunen, Empörung, Unglauben ob des Verrats, ob der gebrochenen Versprechungen …
Einen Herzschlag lang empfand Helena wilde Freude. Sie hatte sich gerächt, nun fühlte auch Luzyna einmal, wie es war, zurückgelassen und missachtet zu werden! Sie kam jedoch schnell wieder zu sich, und kaltes Entsetzen über sich selbst erfasste sie. Was war sie da nur im Begriff zu tun? Sie war doch für Luzyna verantwortlich! Es war ihre Pflicht, all ihre Launen auszuhalten, sich für die Schwester aufzuopfern, die etwas Besseres verdient hatte … Sie konnte sie hier nicht zurücklassen! Was würde ihre Mutter dazu sagen?
Helena stand auf, winkte, versuchte, sich nach vorn zu drängen.
»Anhalten, wir müssen anhalten, wir …«
»He, bist du verrückt geworden? Setz dich hin, du fällst noch vom Wagen!« Natalia zog sie entschlossen auf den Platz neben sich.
»Nein … Ich muss … wir müssen … meine Schwester …«
Helena hämmerte gegen das Blech des Fahrerhauses. Der junge Perser, der den Wagen steuerte, nahm davon jedoch keine Notiz.
»Hör jetzt auf, wir halten nicht mehr an«, sagte ein Junge und griff energisch nach ihrem Arm. »Wenn du was vergessen hast, musst du in Isfahan was sagen. Die sollen da nett sein, bestimmt können sie dir aushelfen …«
Helenas hilfloses Schluchzen ging im allgemeinen Freudengelächter unter.
Während sich der Lastwagen über kurvige, staubige Straßen durchs Gebirge kämpfte und dann über breitere Wege durch Dattelplantagen und Olivenhaine ratterte, versuchte Helena, sich zu entspannen. Bestimmt würde sich die Sache noch regeln. Besonders auf den ersten Kilometern erwartete sie jeden Moment, einen Wagen hinter dem Laster aufschließen zu sehen. Sie traute Luzyna durchaus zu, jemandem von der Lagerleitung von Helenas Täuschung zu erzählen und eine Verfolgung sowie den Austausch der Schwestern zu organisieren. Auch Kaspar konnte sicher jemanden mobilisieren, vielleicht gab ihm der Fuhrparkleiter gar selbst ein Fahrzeug.