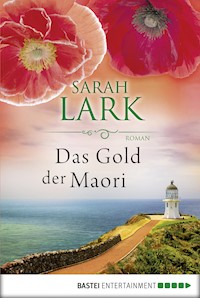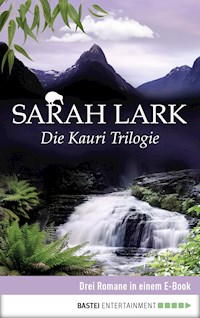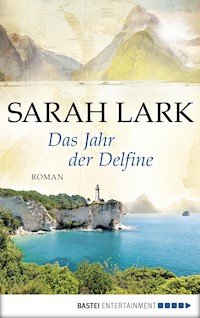9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Feuerblüten-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Opotiki, Nordinsel, 1880: Aroha wächst in dem von ihrer Mutter Linda geführten Waisenhaus glücklich auf. Ein Tag im September verändert jedoch ihr Leben, als sie in Neuseelands großes Zugunglück gerät und Schreckliches erleben muss.
Auf der Schaffarm ihrer Tante, Rata Station, soll sie genesen und wieder Hoffnung finden. Mit Hilfe des träumerischen Robin und ihrer temperamentvollen Cousine March wagt sie schließlich einen großen Schritt, und es kommt zu einer Begegung, die ihrem Leben eine ungeahnte Wendung gibt ...
In sich abgeschlossener, dritter Teil der Spiegel-Bestseller-Trilogie
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1086
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Inhalt
Über die AutorinTitelImpressumStammbaumDie Schnur des DrachensKapitel 1Kapitel 2Kapitel 3Kapitel 4Kapitel 5Kapitel 6Kapitel 7Kapitel 8Kapitel 9Kapitel 10Kapitel 11Fluch oder Gabe?Kapitel 1Kapitel 2Kapitel 3Kapitel 4Kapitel 5Kapitel 6Kapitel 7Kapitel 8Kapitel 9Kapitel 10Kapitel 11Kapitel 12Die Welt verbrenntKapitel 1Kapitel 2Kapitel 3Kapitel 4Kapitel 5Kapitel 6Kapitel 7Kapitel 8Kapitel 9Kapitel 10Kapitel 11Kapitel 12Kapitel 13Kapitel 14VerantwortungKapitel 1Kapitel 2Kapitel 3Kapitel 4Kapitel 5Kapitel 6Kapitel 7Kapitel 8Kapitel 9Billige SündenKapitel 1Kapitel 2Kapitel 3Kapitel 4Kapitel 5Kapitel 6Kapitel 7Kapitel 8Kapitel 9Was ihr wolltKapitel 1Kapitel 2Kapitel 3Kapitel 4Kapitel 5Kapitel 6Kapitel 7Kapitel 8Kapitel 9SommernachtstraumKapitel 1Kapitel 2Kapitel 3NachwortVielen Dank!Über die Autorin
Sarah Lark, geboren 1958, war schon immer fasziniert von den Sehnsuchtsorten dieser Erde. Ihre fesselnden Neuseeland- und Karibikromane wurden allesamt Bestseller und finden auch international ein großes Lesepublikum. Sarah Lark ist das Pseudonym einer erfolgreichen deutschen Schriftstellerin. Unter dem Autorennamen Ricarda Jordan entführt sie ihre Leser auch ins farbenprächtige Mittelalter.
SARAHLARK
DIE LEGENDEDES FEUERBERGES
Roman
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Originalausgabe
Dieses Werk wurde vermittelt durch
die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen.
Copyright © 2015 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat: Melanie Blank-Schröder
Landkarten: Reinhard Borner
Umschlaggestaltung: Johannes Wiebel, punchdesign, München
Einband-/Umschlagmotiv: © Johannes Wiebel, punchdesign, München, unter Verwendung von Motiven von Shutterstock/tiire; shutterstock/Pi-Lens; shutterstock/ThaiWanderer
E-Book-Produktion: Greiner & Reichel, Köln
ISBN 978-3-7325-0603-3
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Taku manu, Ke turua atu nei,
He Karipiripi, ke kaeaea.
Turu taku manu,
hoka taku manu,
Ki tua te haha-wai.
Koia Atutahi, koia Rehua,
Whakahoro tau tara,
Ke te Kapua, Koia E!
Flieg fort von mir, mein Drachen,
tanze rastlos in der Höhe.
Flieg immer höher, herrlicher Vogel,
erhebe dich über die Wolken, das Land und die Wellen.
Flieg zu den Sternen, vorbei an Caropus, weiter zu Antares.
Stürze dich in die Wolken wie ein Kämpfer in die Schlacht.
Flieg!
Turu Manu – ein Lied, mit dem die Maori ihre Drachen zu den Göttern schicken (sehr frei ins Deutsche übersetzt)
DIE SCHNUR DES DRACHENS
Otaki, Wairarapa, Greytown (Nordinsel)
Christchurch, Canterbury Plains, Dunedin (Südinsel)
August 1880 – April 1881
KAPITEL 1
»Ich hab schon ein bisschen Angst …«, gestand Matiu.
Der hochgewachsene Maori trug einen neuen braunen Anzug, in den seine sehnige, schlanke Gestalt noch nicht richtig hineinpasste. Sein dunkles, lockiges Haar hatte er kurz schneiden lassen und streng zurückgekämmt. Linda Lange, seine Ziehmutter, nahm an, dass er Pomade benutzte, um es zu glätten. Vielleicht, weil Naturkrause bei reinblütigen Maori selten war – bei Matiu musste es das Erbe seines Vaters sein, eines Engländers.
»Unsinn, Matiu, du fährst doch zu deiner Familie!«, erklärte Aroha fast ein bisschen ungeduldig.
Lindas Tochter hörte Matius Bedenken wohl nicht zum ersten Mal. Der junge Mann stand Aroha sehr nahe – Linda vermutete, dass die beiden verliebt waren. Sicher hatte Matiu dem Mädchen seine Ängste gestanden, während er Linda und ihren Mann Franz nur an seiner Freude über den Kontakt mit seiner Herkunftsfamilie teilhaben ließ.
»Schon. Aber ich kenne sie doch gar nicht … ich kann nicht mal richtig Maori …«
Matiu trat unsicher von einem Fuß auf den anderen, während er nach dem Zug ausspähte. Auch Linda wartete ungeduldig. Auf dem Bahnsteig der kleinen Stadt Otaki war es zugig und kalt. Sie wollte sich so bald wie möglich auf den Heimweg in das alte marae machen, in dem sie mit Franz und etwa hundert Maori-Kindern lebte. Die Langes leiteten das frühere Heim für Maori-Kriegswaisen seit vierzehn Jahren gemeinsam, inzwischen war es längst in eine Internatsschule umgewandelt worden. Die Schüler kamen freiwillig oder wurden von ihren Familien geschickt. Franz’ und Lindas erste Zöglinge waren erwachsen und entweder zu ihren Stämmen zurückgekehrt, oder sie hatten sich Arbeit auf Farmen in der Umgebung oder in Unternehmen rund um Wellington gesucht. Linda freute sich darauf, einige von ihnen später zu treffen. Sie hatte auf dem Weg noch Einkäufe zu machen, drei ihrer ehemaligen Schutzbefohlenen arbeiteten in Geschäften in Otaki. Doch erst einmal musste sie jetzt Matiu beruhigen.
»Matiu, du sprichst hervorragend Maori!«, versicherte sie ihm. »Mal ganz abgesehen davon, dass dein Stamm auch alle Geduld der Welt für dich aufbrächte, wenn dem nicht so wäre. Du hast doch die Briefe gelesen. Deine Leute freuen sich darüber, dass du Kontakt zu ihnen aufgenommen hast. Sie erinnern sich gut an deine Mutter. Du hast leibliche Verwandte im iwi – und wie du weißt, betrachtet sich der ohnehin als eine große Familie. Du wirst dich vor Müttern und Großmüttern, Vätern, Brüdern und Großvätern nicht retten können.« Linda lächelte ermutigend.
Tatsächlich gehörte Matiu zu den wenigen Pflegekindern der Langes, die ihre ersten Lebensjahre nicht in einem Maori-Dorf verbracht hatten. Er war als Dreijähriger aus Patea, einer Stadt im Süden der Region Taranaki, gekommen – ein Captain der Military Settlers, den Linda aus ihrer eigenen Zeit in Patea kannte, hatte das Kind gebracht und seine traurige Geschichte erzählt. »Einer unserer Siedler hat’s mit einer Maori-Frau aus einem der eroberten Dörfer gezeugt, mit der er auch eine Zeit lang zusammenlebte«, hatte er erklärt. »Sie ist freiwillig mit ihm gegangen oder geraubt worden, wir konnten das nicht herausfinden. Sie sprach kein Wort Englisch. Dann ist die Frau gestorben, vielleicht am Fieber, vielleicht an gebrochenem Herzen … Wer weiß das schon so genau? Der Mann behielt das Kind zunächst. Er fand schnell eine weiße Frau in Patea, die es versorgte. Aber als sie selbst schwanger wurde, sollte der Junge weg.« Captain Langdon hatte ein bisschen befangen gewirkt, fast als schämte er sich seines Mitleids für den Kleinen. »Da dachte ich«, hatte er geendet, »ich nehme ihn mit und bringe ihn bei Ihnen vorbei. Maori-Stämme gibt es in der Gegend nicht mehr. Zu seinen Leuten kann der Kleine also nicht zurück.«
Linda und Franz hatten das Kind natürlich aufgenommen, und Linda hatte die Gelegenheit genutzt, sich von Captain Langdon die Entwicklungen in der Siedlung schildern zu lassen, in der sie vor Arohas Geburt mit ihrem ersten Mann gelebt hatte. Das Gebiet war inzwischen befriedet. Die Siedler, die es im Gegenzug zu ihrem militärischen Einsatz während des Taranaki-Krieges erhalten hatten, bewirtschafteten es, es hatte keine weiteren Zwischenfälle gegeben.
Matiu wuchs trotzdem nicht als pakeha, wie die Maori die weißen Siedler nannten, auf. Im Waisenhaus lernten die Kinder zwar Englisch, aber man sprach ebenso Maori. Sowohl Matiu als auch Aroha beherrschten die Sprache der Einheimischen fließend. Omaka Te Pura, eine alte Maori-Frau, die ihre letzten Lebensjahre in Franz’ und Lindas Kinderheim verbracht hatte, war es gelungen, den Stamm auszumachen, zu dem der Kleine ursprünglich gehörte. Die gewebten Decken und Kleidungsstücke, in die Captain Langdon das Kind gewickelt hatte, und die wohl noch von Matius Mutter stammten, wiesen auf die Ngati Kahungunu hin.
In den Nachwehen des Krieges hatte man von dem Stamm nicht viel gehört, er war vertrieben worden wie viele andere auf der Nordinsel. Ein paar Wochen zuvor hatte Franz gehört, dass die Ngati Kahungunu wieder in ihrem Stammesgebiet in Wairarapa siedelten. Er hatte Matiu, der von jeher ein bisschen mit seiner Herkunft haderte – die »reinblütigen« Maori-Kinder hatten ihn oft genug gehänselt –, ermutigt, Kontakt mit dem Stamm aufzunehmen. Matiu schrieb also einen Brief an den Häuptling, wozu er Tage brauchte. Gemeinsam mit Aroha feilte er an jeder kleinsten Formulierung. Kurz darauf erhielt er eine unerwartet herzliche Antwort. Matiu erfuhr den Namen seiner Mutter, Mahuika, und wie schmerzlich die junge Frau von ihrer Familie vermisst worden war. Sie war tatsächlich von den Engländern entführt worden – gemeinsam mit anderen jungen Männern und Frauen des Stammes. Von den meisten hatten die Ngati Kahungunu nie wieder etwas gehört. Der Stamm sprach nun jedenfalls eine freundliche Einladung an Matiu aus, seine Familie zu besuchen, und heute sollte der Traum für den jungen Mann wahr werden. Kein Grund für irgendwelche Bedenken, fand die kühne Aroha.
»Verstehen werden sie dich auf jeden Fall!«, fügte sie jetzt den Worten ihrer Mutter hinzu. »Und es wird aufregend! Ein Abenteuer! Ich war noch nie in einem echten marae! Also natürlich auf Rata Station. Aber das zählt irgendwie nicht.«
Aroha hatte so lange auf ihre Mutter und ihren Stiefvater eingeredet, bis ihr die beiden erlaubten, ihren Freund auf der Reise zu seiner Maori-Familie zu begleiten. Besonders Franz tat das ungern. Das Mädchen war schließlich erst vierzehn Jahre alt – ein bisschen zu jung, um allein zu verreisen, zumal mit einem jungen Mann, in den es ganz offensichtlich verliebt war! In Maori-Dörfern herrschten schließlich lockere Sitten. Die jungen Leute der Stämme machten sehr frühzeitig erste sexuelle Erfahrungen, was Franz Lange, ursprünglich streng erzogener Altlutheraner und seit fast zwanzig Jahren Reverend der anglikanischen Kirche, regelrecht Angst machte. Linda fand das nicht so bedenklich. Sowohl Aroha als auch Matiu waren mit den Moralvorstellungen der pakeha aufgewachsen, und beide waren besonnene, kluge junge Leute. Sie würden ihre Wertvorstellungen nicht gleich über Bord werfen, wenn sie nun ein paar Nächte in einem Gemeinschaftsschlafhaus der Ngati Kahungunu verbrachten.
Schließlich hatte Arohas guter Highschool-Abschluss den Ausschlag gegeben. Das Mädchen hatte darauf gedrängt, zusammen mit Matiu nach Wellington zu fahren, um das Examen abzulegen. Eigentlich wäre es für sie erst in zwei Jahren so weit gewesen, doch Aroha war blitzgescheit – und sie träumte davon, gemeinsam mit Matiu aufs College zu gehen. Tatsächlich hatte sie die Prüfungen hervorragend gemeistert, und auch Matiu gehörte zu den zehn Besten seines Jahrgangs. Das, so fand Aroha, schrie nach einer Belohnung, und Linda konnte ihren Mann schließlich überreden, der gemeinsamen Reise der »Kinder« zuzustimmen.
»Was zählt denn bitte nicht an dem marae auf Rata Station?«, erkundigte sich Linda mit tadelnder Stimme.
Rata Station war eine Schaffarm auf der Südinsel, die Lindas Familie gehörte. Sie war dort gemeinsam mit ihren mehr oder weniger leiblichen Schwestern Carol und Mara aufgewachsen. Zu ihren Maori-Nachbarn vom Stamm der Ngai Tahu hatten sie meist ein gutes Verhältnis gehabt.
Bevor Aroha antworten konnte, ertönte ein markerschütternder Pfeifton, der das Einfahren des Zuges ankündigte. Linda nahm Matiu und ihre Tochter noch einmal in die Arme, bevor der Lärm noch größer wurde, als die Lokomotive an den Bahnsteig heranratterte.
»Bisher wart ihr meine Familie …«, sagte Matiu leise, als Linda ihn tröstend an sich drückte.
Linda lächelte ihm zu. »Und das bleiben wir!«, versicherte sie ihm. »Egal, ob es dir bei deinem Stamm gefällt oder nicht. Selbst wenn du dich entschließen solltest, dortzubleiben …«
»Was?« Aroha mischte sich kopfschüttelnd ein. »Das planst du doch nicht im Ernst, Matiu? Das ist ein Besuch, Mommy, sonst nichts, er … er will doch aufs College, er …«
Matiu ging nicht auf sie ein. Sein Blick hing an Linda. »Ihr denkt also nicht, ich … ich wäre undankbar? Ihr nehmt mir nicht übel, dass ich zu meinen Leuten will?«
Linda schüttelte in der gleichen Manier den Kopf wie ihre Tochter, nur, dass die Geste bei ihr weniger empört als freundlich ermutigend wirkte.
»Wir denken gar nichts, Matiu, und ganz sicher missgönnen wir dir nicht die Suche nach deinen Wurzeln! Du bist hier immer willkommen …« Sie lächelte. »Aber das nächste Mal, wenn du in unser marae kommst, will ich deine pepeha hören!«
Ihre letzten Worte bewirkten, dass sich endlich auch Matius volle Lippen zu einem Lächeln verzogen. Die pepeha war eine Rede, mit der ein jeder Maori von seiner Herkunft und seinen Ahnen berichtete, wenn er sich anderen vorstellte. Matiu hatte bisher nie eine vortragen können, schließlich hatte er seine Familiengeschichte nicht gekannt. Das sollte sich jetzt ändern.
Er winkte Linda tapfer und offensichtlich getröstet zu, nachdem er Aroha in ein Abteil gefolgt war. Das Mädchen konnte gar nicht abwarten, bis der Zug nach Greytown abfuhr. Aroha liebte es zu reisen. Bislang hatte sie nicht viel von der Nordinsel gesehen, auf der sie geboren war. Allerdings hatte sie schon zweimal gemeinsam mit Linda die Südinsel besucht und ihre Verwandten auf Rata Station kennengelernt.
»Jetzt mal ehrlich … Du denkst doch nicht wirklich daran, bei deinem Stamm zu bleiben?«, erkundigte Aroha sich bei Matiu, als der Zug den Bahnhof verlassen hatte.
Vorerst gab es durch die großen Fenster nicht viel zu sehen, die Lokomotive zog die zwei Wagen durch die Felder und Weiden rund um Otaki. Aroha und Matiu kannten hier jeden Stein.
Matiu griff nach der Hand seiner Freundin. Er konnte es immer noch kaum glauben, dass Reverend Lange ihm diese Reise mit seiner Stieftochter erlaubte. Für ihn war jedes Zusammensein mit Aroha – erst recht allein mit Aroha – ein Geschenk. Dabei waren ursprünglich alle Weichen dafür gestellt gewesen, sie eher wie eine Schwester als wie eine geliebte Freundin zu sehen. Linda hatte den verlassenen Dreijährigen nicht gleich in ein Schlafhaus zu den anderen Waisen geschickt, sondern in dem Blockhaus beherbergt, in dem sie mit ihrem Mann und ihrer Tochter aus erster Ehe lebte. Aroha war damals erst ein Jahr alt gewesen. Zwei Jahre lang hatte sie mit Matiu ein Zimmer geteilt. Und auch wenn beide sich jetzt nicht mehr daran erinnerten – Linda hatte sie oft genug zusammen in ein Bettchen gelegt. Die gelassene, zufriedene Aroha hatte den anfänglich noch verängstigten kleinen Jungen auch später oft beruhigt, wenn er aus einem Albtraum aufgeschreckt war.
Als Matiu fünf Jahre alt geworden war, hatte allerdings die alte Omaka Anspruch auf ihn erhoben und erklärt, er müsse seine Sprache erlernen und die Geschichten seines Volkes hören! Die weise alte Frau hatte damals schon die ersten Anzeichen dafür gespürt, dass die Maori-Kinder Matiu ausgrenzten. Trotz Lindas Bedenken hatte sie den Jungen in ihrer Hütte untergebracht und seine bislang versäumte Maori-Erziehung nachgeholt. Als Omaka schließlich starb, war Matiu in eines der Schlafhäuser für Jungen gezogen. Aroha blieb in all diesen Jahren seine liebste Spielgefährtin und Freundin – aber jetzt, da die Zeit dafür gekommen war, sah Matiu auch die Frau in ihr.
»Ich würde dich nie verlassen!«, sagte er ernst. »Nicht für alle Stämme und Familien und Onkel und Tanten und Väter und Mütter der Welt …«
»Und … Schwestern?«, fragte sie spitzbübisch. »Bestimmt gibt’s bei den Ngati Kahungunu hübsche Mädchen. Und sie … sie sollen … äh … keine Hemmungen haben, sagt Revi Fransi.«
Revi Fransi war der Kosename der Maori-Kinder für Reverend Franz Lange. Aroha hatte ihn selbstverständlich übernommen, statt den zweiten Mann ihrer Mutter Daddy zu nennen.
Matiu sah gleichermaßen belustigt und entzückt, wie sie bei ihren offenen Worten errötete. Um dies zu erkennen, musste man genauer hinsehen als bei den meisten pakeha-Mädchen. Aroha hatte einen eher dunklen Teint. Wären ihre extrem hellen Augen und ihr blondes Haar nicht gewesen, hätte man sie fast für eine Maori halten können. Oft glaubten Besucher, sie wäre ein Mischlingskind wie Matiu. Als Aroha klein war, hatte sie ihre Mutter einmal danach gefragt, schließlich trug sie auch einen Maori-Namen. Linda hatte ihr allerdings versichert, ihre Haut- und Augenfarbe seien das Erbe ihres leiblichen Vaters, Joe Fitzpatrick. Auch bei ihm hatten die Augen in der Farbe des Wassers einer Eislagune in betörendem Kontrast zu seinem eher dunklen Teint gestanden. Nur das blonde Haar komme aus ihrer Familie, hatte Linda erklärt, und den Namen habe ihr Omaka gegeben. Aroha bedeutete »Liebe«.
»Aroha, ich gehöre zu dir! Kein Mädchen auf der Welt ist so schön wie du! Ich könnte nie ein anderes lieben!«, sagte Matiu jetzt sehr ernst.
Aroha war sehr zierlich, ihre weiblichen Formen würden sich noch entwickeln müssen. Ihr zartes Gesicht wirkte mitunter sogar fast kindlich. Aber für ihn war sie bereits zur vollkommenen Schönheit erblüht. Sie war für ihn Wärme, Zärtlichkeit und Trost. Liebe … Omaka hätte ihr keinen passenderen Namen geben können.
Aroha nickte beiläufig. Sie hatte ihre kleine Neckerei schon vergessen – schließlich machte sie sich nicht wirklich Sorgen darüber, dass sie Matiu verlieren könnte. Auch er war für sie ein unwandelbarer Bestandteil ihrer Welt, undenkbar, dass er sich von ihr abwandte. Im Augenblick jedenfalls beschäftigte sie die Aussicht durch die Zugfenster wesentlich mehr als Matius Liebeserklärung. Der Zug hatte die Umgebung von Otaki verlassen und hielt auf die Rimutaka Range zu, einen Gebirgszug zwischen Wellingtons Hutt Valley und der Ebene von Wairarapa.
»Meine Güte, schau dir diese Berge an!«, rief Aroha.
Sie durchquerten bislang noch lichte Wälder, bestehend aus Manuka- und Rimu-Bäumen, Nicau-Palmen und Baumfarnen. In der Ferne grüßte jedoch schon eine imponierende Gebirgslandschaft, und sehr bald führten die Schienen über Brücken, unter denen reißende Flüsse zu sehen waren. Noch etwas später folgte eine Tunneldurchquerung auf die andere. Der Rimutaka Incline Railway war ein Wunder des Eisenbahnbaus. Legionen fleißiger Arbeiter – auch Military Settlers – hatten hier die kühnen Träume wagemutiger Ingenieure in die Tat umgesetzt und der Landschaft aufgezwungen. Die Bahnstrecke führte an Abgründen entlang und durch Tunnel, deren Dunkelheit Aroha erschrocken nach Matius Hand greifen ließ. Noch aufregender erschienen ihr allerdings die Steigungen.
»Wie kommen wir da bloß rauf?«, erkundigte sie sich, als der Wald endgültig dem Gebirge wich.
Es gab hier kaum noch größere Bäume, sondern hauptsächlich niedere Farne, Rata-Dickicht und sturmgepeitschte Buchengewächse. Die Berge türmten sich wie eine unüberwindliche Barriere vor ihnen auf.
»Die Lokomotiven sind sehr stark. Und es gibt ein ganz neuartiges Schienensystem. Eine spezielle Mittelschiene ermöglicht verstärkten Antrieb und sicheres Bremsen«, dozierte Matiu.
Er interessierte sich sehr für den Gleisbau und träumte im Geheimen davon, irgendwann einmal beruflich damit zu tun zu haben. Allerdings verfolgte er ehrgeizigere Ziele als die, einfach nur Schienen zu verlegen. Er hatte sich um ein Stipendium für ein Ingenieurstudium in Wellington beworben.
»Es ist jedenfalls unglaublich!«, erklärte Aroha und spähte schaudernd in einen Abgrund, an dem die Strecke eben entlangführte. Man hatte den Steilhang für den Bau der Schienen abgeholzt, die hier förmlich am Berg zu kleben schienen. »Wer das gebaut hat, kann jedenfalls keine Höhenangst gehabt haben. Mir wird ja schon schwindlig, wenn ich nur runtergucke!«
»Hier hat auch mehr als einer sein Leben gelassen«, bemerkte der Schaffner ernst, der eben ihr Abteil betrat und ihre letzten Worte gehört hatte. »Es hat immer wieder schwere Unfälle gegeben während der Bauzeit, und man muss auch heute noch ständig Obacht geben. Der Regen spült oft Steine und Schutt auf die Schienen oder überschwemmt die Tunnel. Ihr habt Glück mit dem Wetter. Im Winter müssen wir den Betrieb manchmal tagelang einstellen. Es ist ein ständiger Kampf mit den Elementen. Und es ist sehr teuer, diese Zuglinie zu warten. Ich hoffe, ihr wisst das zu würdigen und habt brav Fahrkarten gekauft.« Er lächelte und hob seine Lochzange, um diese zu entwerten.
Aroha und Matiu erwiderten das Lächeln angespannt. Sie hatten sich bisher nicht vorstellen können, die Fahrt mit der Bahn könnte gefährlich sein.
»Halt mich fest!«, bat Aroha, als sich der Zug kurz darauf in engen Kurven einen steilen Berg hinaufquälte.
Matiu legte den Arm um sie – etwas schüchtern, bislang hatte er das nie gewagt.
»Dir kann nichts passieren«, sagte er sanft. »Nicht solange ich bei dir bin.«
KAPITEL 2
Wenn Aroha und Matiu bislang überhaupt vom Taranaki-Krieg gehört hatten, so hatten ihnen die Maori-Krieger stets als tätowierte, halb nackte Kerle vor Augen gestanden, das Haar zum Kriegerknoten gewunden, die Augen rollend, Speer und Kriegskeule in der Hand. Tatsächlich hatten beide noch nie einen Maori in traditioneller Aufmachung gesehen. Omaka hatte sich zwar nicht europäisch gekleidet, die gewebten Röcke der alten Frau – der Reverend hatte nicht geduldet, dass sie im Heim mit nackten Brüsten herumlief wie früher bei ihrem Stamm – unterschieden sich allerdings nicht so sehr von den langen Röcken der pakeha-Frauen. Und Omakas knappe Oberteile waren meist unter einem Umhang verborgen gewesen, da sie leicht fror. Mit den Röcken der Krieger aus gehärtetem Flachs hatte das nichts zu tun gehabt, Omaka war auch nicht tätowiert gewesen. Ihr hoher Rang als Stammesälteste und Zauberin hatte das verboten. Im marae der Ngai Tahu auf der Südinsel waren alle Männer und Frauen wie pakeha gekleidet, und Tätowierungen trugen nur wenige. Vielleicht hatte Aroha deshalb das Gefühl, diese Maori-Siedlung zähle nicht richtig.
Von den Ngati Kahungunu machte sich Aroha nun jedenfalls ein anderes Bild. Die gehörten schließlich zu den Stämmen, die in den Maori-Kriegen gekämpft hatten. Sicher kleideten sie sich noch traditionell und hingen an den alten Riten und Lebensformen. Aroha und Matiu dachten mit einer Mischung aus Schauder und Neugier an wilde Kriegstänze und blutrünstige Gesänge. Hatten die Stämme ihren Gegnern damals nicht die Köpfe abgeschnitten und sie geräuchert? Matiu hatte gehört, es sei im Zuge der Hauhau-Bewegung sogar zu Menschenfresserei gekommen!
Insofern waren die beiden fast etwas enttäuscht, als der Zug in Greytown einfuhr und sie die Maori entdeckten, die sie am Bahnsteig erwarteten. Ein Mann und eine Frau, beide vielleicht um die dreißig Jahre alt, waren in unauffällige pakeha-Kleidung gewandet. Der Mann trug Denimhosen und ein verschlissenes Hemd. Die wenigen Tätowierungen in seinem Gesicht verbarg er unter einem breitkrempigen Hut. Die Frau wies eine kleine Tätowierung um den Mund herum auf, trug ihr Haar jedoch aufgesteckt wie eine pakeha und war in ein einfaches Kattunkleid gehüllt.
Aroha und Matiu fühlten sich sofort unwohl in ihrer vergleichsweise eleganten Kleidung, vor allem Matiu wünschte sich heraus aus seinem steifen Sonntagsanzug. Aroha, die ein tailliertes hellblaues Reisekostüm trug, musste ihm schon wieder Mut zusprechen, als sie das Abteil verließen.
»Komm schon, sie werden dich nicht fressen!«
Matiu grinste. Nach Menschenfressern sahen die beiden wirklich nicht aus. Im Gegenteil – als sie den jungen Maori erkannten, ging ein strahlendes Lächeln in ihren Gesichtern auf.
»Du musst sein Matiu!«, sagte die Frau in gebrochenem Englisch.
»Sei gegrüßt in deine Familie!«, fügte der Mann hinzu. »Ich Hakopa, Bruder von Mahuika. Das Reka, Schwester …«
Also Onkel und Tante von Matiu. Der junge Mann starrte sie ungläubig an und brachte kein Wort heraus.
Aroha schob sich vor. »Ich bin Aroha«, erklärte sie. »Wir können auch Maori sprechen.«
»Kia ora!«, stieß Matiu hervor. »Entschuldigt, ich …«
»Du kein Englisch?«, fragte Reka verwundert. »Ich denken, du mit pakeha leben. Ich üben extra für dich.« Sie lächelte. »Will-kom-men! Aber dann … haere mai!«
Ohne weitere Förmlichkeiten legte sie Matiu die Hände auf die Schultern und bot ihm das Gesicht zum hongi, dem traditionellen Gruß. Matiu spürte ihre Nase und ihre Stirn an seiner, nahm ihren Geruch wahr – und fühlte sich plötzlich sicherer.
»Ich kann natürlich Englisch«, erklärte er dann auf Maori. »In Otaki lernen wir beides. Ich war nur so überrascht …«
»Mit so viel Familie gleich am Bahnhof hat er nicht gerechnet!«, warf Aroha vorlaut ein. »Und wir dachten auch … also wir dachten, jetzt käme so eine Art powhiri und …«
Reka und Hakopa lachten, allerdings weniger fröhlich als bitter.
»Hier?«, fragte Reka. »Ihr habt gedacht, wir würden auf dem Bahnhof für euch singen und tanzen?«
Aroha errötete. »Nein, wir … wir dachten nur … wenn ihr doch jetzt hier wohnt …«
Hakopas Gesicht verhärtete sich. »Ja, Tochter, wir wohnen hier in Wairarapa. Aber das heißt nicht, dass es uns gehört. Die pakeha dulden uns hier, sie haben uns erlaubt, wieder ein marae auf unserem angestammten Land zu errichten. Wenn wir uns anpassen. Wir kleiden uns wie sie, wir arbeiten für sie, wir stellen keine zu großen Ansprüche, was Landbesitz angeht. Natürlich lassen sie uns ein paar Felder bestellen, doch es ist nicht das fruchtbarste Land. Unser Stamm war einmal reich. Jetzt müssen wir sehen, wie wir zurechtkommen. Ohne die Weißen zu provozieren.«
»Unser marae liegt natürlich auch nicht in der Stadt, sondern außerhalb, in den Wäldern«, fügte Reka hinzu. »Weder die pakeha noch wir selbst suchen die Nähe zueinander. Ihr hättet uns nie gefunden, wenn wir nicht gekommen wären, euch abzuholen.«
Aroha nickte und kam sich auf einmal dumm vor. Wie hatten sie glauben können, mit der Eisenbahn der pakeha auf dem direkten Weg in ein Dorf der Maori gefahren zu werden? Oder gar in eine Welt der Maori-Herrschaft über Wairarapa, wie es sie seit zwanzig Jahren nicht mehr gab.
»Wenn wir dann erst mal da sind«, meinte Hakopa, der Arohas Ernüchterung wohl als Enttäuschung deutete, »werden wir euch natürlich in gebührender Weise willkommen heißen. Wir sind so glücklich, Matiu, dass du zu uns zurückgefunden hast. Und du kommst mit deiner … deiner wahine, Matiu?«
Matiu und Aroha erröteten. Dann lachten sie.
»Ja!«, sagte Matiu. »Die pakeha sagen natürlich, wir seien noch zu jung. Aber Aroha wird meine Frau sein!«
Hakopa lächelte. »Sie ist in unserem Stamm willkommen«, sagte er freundlich. »Doch nun kommt, die anderen werden uns schon ungeduldig erwarten. Seid ihr hungrig? Wir haben ein hangi vorbereitet.«
Matiu dachte nicht ans Essen, Aroha horchte jedoch auf. Sie hatte schon viel von dem in Erdöfen gegarten Essen der Maori-Stämme gehört, allerdings noch nie davon gekostet. Die Ngai Tahu bei Rata Station bauten keine hangi – es gab auf den Canterbury Plains keine Vulkanaktivität, die man zum Anfeuern nutzen konnte.
Vor dem kleinen Bahnhof von Greytown wartete ein Leiterwagen mit zwei eher mageren Pferden davor auf die Reisenden.
»Der gehört uns«, erklärte Reka, als wäre das eine gewaltige Errungenschaft.
Hakopa wuchtete Matius und Arohas Gepäck auf die Ladefläche, auch die jungen Leute nahmen dort Platz. Richtige Bänke zum Sitzen gab es nicht, was Aroha lustig fand. Matiu machte sich eher Sorgen um seinen neuen Anzug. Reka und Hakopa erkletterten den Bock, und Hakopa lenkte den Wagen durch die schmucke Hauptstraße der kleinen Stadt.
»Sie nennen es heute Greytown, nach dem Gouverneur, der es den Ngati Kahungunu für ein Spottgeld abgehandelt hat«, erläuterte Hakopa bitter. »Bei uns hieß der Ort Kuratawhiti. Und wir siedelten hier nicht, um die Geister des Waiohine River nicht zu erzürnen. Das war weise. Die pakeha kämpfen bis heute mit Überschwemmungen. Außerdem ließen die Geister die Erde beben, kaum dass die ersten ihrer Siedler hier eingetroffen waren.«
»Erstaunlicherweise schreckte sie das alles nicht ab!«, bemerkte Reka. »So langsam glaube ich, die pakeha schreckt überhaupt nichts ab. Das macht sie so stark, dadurch sind sie uns überlegen.«
Der Wagen rollte inzwischen aus der Stadt hinaus auf den Lake Wairarapa zu. Das marae lag nah am See, wenn auch nicht so nah, dass man das Gewässer von den Häusern aus sehen konnte.
»Die Ufer sind sumpfig«, erklärte Reka. »Gut zum Jagen und Fischen, aber nicht zum Siedeln.«
Rund um Greytown lag erst einmal fruchtbares Farmland, genutzt von den pakeha. Schließlich führte ein Weg am Fluss entlang in die Wälder, und nach einer weiteren, vielleicht halbstündigen Fahrt, kam der Zaun in Sicht, den die Ngati Kahungunu um ihr marae gezogen hatten. Aroha und Matiu erinnerte er an die Begrenzung rund um ihre Schule – Raupo-Stangen, mit Flachs zusammengefügt. Angreifer hielt das nicht ab. Doch die Ngati Kahungunu schienen nicht mit Feinden zu rechnen, oder sie gingen davon aus, dass bei ihnen ohnehin nichts zu stehlen war. Aroha und Matiu hatten Abbildungen von großen, bunt bemalten Götterstatuen gesehen, die den Eingang zu traditionellen Nordinsel-maraes bewachten. Hier allerdings gab es nur ein schmuckloses Tor, das jetzt offen stand. Ein paar Kinder spielten im Eingang und liefen beim Anblick des Wagens aufgeregt los, wohl um das Eintreffen der Besucher zu melden.
Hakopa lenkte die Pferde gleich auf den Versammlungsplatz, um den herum sich die verschiedenen Gemeinschafts-, Koch- und Schlafhäuser gruppierten. Aroha warf einen Blick auf die Gebäude und fand auch sie enttäuschend. Ihr Stiefvater hatte das marae, auf dessen Gelände die Schule lag, mit seinen ersten Zöglingen renoviert, und ein paar der Jugendlichen hatten sich dabei als geschickte Holzschnitzer entpuppt. Reverend Lange hatte ihnen schließlich erlaubt, die Häuser mit traditionellen Schnitzereien zu verzieren und sie zu bemalen. Eins war nun schöner als das andere. Hier dagegen gab es kaum Schnitzereien, die Häuser schienen in Eile und lieblos zusammengezimmert. Das marae wirkte wie ein Provisorium – als wären die Bewohner nicht sicher, ob sie für immer hier wohnen würden.
Was die Begrüßung anging, wurden Arohas und Matius Erwartungen jetzt jedoch erfüllt. Der Stamm hatte sich auf ein Zeremoniell vorbereitet – nicht ganz so förmlich, wie man völlig Fremden die Ehre erwies, doch aufwendig genug, um den Gästen ihre Wertschätzung zu zeigen und Matiu in seinem Stamm willkommen zu heißen. Die jungen Mädchen des Stammes tanzten einen haka, noch während Aroha und Matiu vom Wagen stiegen. Sie sangen vom Meer und vom See, von Fischfang und Jagd. Das Lied schilderte das Land und das Leben des Stammes.
Der Häuptling und die Stammesältesten hatten sich vor dem wharenui, dem Versammlungshaus, eingefunden, wobei sich der ariki, ein noch recht junger Mann mit nicht ganz tätowiertem Gesicht, mit seiner Familie etwas abseits hielt. Es war tapu, den Häuptling zu berühren, nicht einmal sein Schatten sollte auf einen seiner Untertanen fallen. Die Stammesältesten tauschten dagegen gern den hongi mit Matiu und ein paar Frauen auch mit Aroha. Eine der ältesten Frauen brach in Tränen aus, als sie ihr Gesicht an Matius legte.
»Die Mutter deiner Mutter«, erklärte Reka dem peinlich berührten jungen Mann.
Die Frau musste im Stamm einen hohen Rang bekleiden, denn sie stimmte jetzt ein Gebet an, in das alle anderen einfielen. Sie schien zu erwarten, dass auch Aroha und Matiu die Worte mitsprachen, doch so weit, mit seinen Schülern die Anrufungen der Geister zu studieren, war die Toleranz Reverend Langes nun doch nicht gegangen. Reka erkannte das Dilemma, in dem die beiden steckten, und bat Matiu, anschließend ebenfalls ein Gebet zu sprechen.
»Zum pakeha-Gott«, sagte sie. »Den dürfen wir nicht ausschließen. Wir … wir sind nämlich alle getauft.«
Aroha erschien das befremdlich. Sie sollte später erfahren, dass die pakeha ihre Zustimmung zur Ansiedlung des Stammes davon abhängig gemacht hatten, ob die Maori die Religion der Weißen annahmen. Der Häuptling schickte denn auch allsonntäglich eine Abordnung seines iwi in die Kirche, meist junge Leute und Kinder, die mit dem pakeha-Gott und seinen Anhängern noch keine schlechten Erfahrungen gemacht hatten. Überhaupt erwies sich Te Haunui als äußerst flexibel. Er hatte sein Amt erst seit wenigen Jahren inne, sein Vorgänger war in den Wirren der Taranaki-Kriege getötet worden. Oder danach? Aroha schwirrte schon nach kurzer Zeit der Kopf, und jetzt begann einer der Stammesältesten auch noch, die mihi vorzutragen, eine Rede, in der er von der Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft der Ngati Kahungunu erzählte und die Lebenden und Toten vorstellte.
»Unsere Vorfahren kamen mit dem Kanu Takitimu nach Aotearoa, gesegelt von Tamatea Arikinui. Sein Sohn Rongokako nahm Muriwhenua zur Frau, und sie hatten einen Sohn, Tamatea Ure Haea. Dessen Sohn Kahungunu wurde in Kaitaia geboren, und er begründete unseren Stamm. Kahungunu reiste von Kaitaia nach Süden und zeugte viele Kinder. Sie errichteten Dörfer und pflanzten sich fort, sie waren Farmer und Schnitzer und Kanubauer. Es gibt drei wichtige Zweige der Ngati Kahungunu, wir gehörten zu den ki Heretaunga. Wir lebten am Meer …«
Der Sprecher erzählte von der Gründung von Festungen und Kämpfen mit anderen Stämmen, von fünf Häuptlingen der Ngati Kahungunu, die einst den Vertrag von Waitangi unterschrieben, um in Frieden mit den pakeha zu leben. Die Stämme hatten Getreide und Gemüse für die Weißen angebaut, die damals vor allem Walfangstationen an den Küsten des Stammesgebietes betrieben.
»Aber dann kamen die Schaffarmer und ließen ihre Tiere auf unserem Land grasen. Sie gaben uns erst ein paar Waren dafür und dann etwas Geld, und dann sagten sie, das Land gehöre jetzt ihnen!«
Die Stimme des Sprechers klang empört, auch aus den Reihen der Zuhörer erklangen wütende Zwischenrufe. Aroha liefen kalte Schauer über den Rücken. Es war immer wieder das Gleiche, von Kindheit an hatte sie solche Geschichten gehört – von Omaka und von den Kindern, die ins Waisenhaus kamen. Linda hatte ihr irgendwann erklärt, dass die Maori ein anderes Verhältnis zu Eigentum hatten als die pakeha. Sie nahmen das Geld und ließen die Farmer auf ihrem Land siedeln und ihre Schafe weiden, aber ihnen kam nicht in den Sinn, dass sie es damit für immer fortgaben. Als die Weißen dann ernstlich die Hand darauflegten, Städte und Dörfer bauten und immer mehr Land beanspruchten, wehrten sich die Maori. Es kam zu den ersten Kämpfen, wobei jeder fest davon überzeugt war, im Recht zu sein. Sowohl pakeha als auch Maori behaupteten, die jeweils anderen hätten die Verträge gebrochen.
Aroha erwartete nun, Berichte von Kämpfen mit englischen Truppen zu hören, tatsächlich waren die Stämme, die an der Hawke’s Bay siedelten, verhältnismäßig wenig von den Landkriegen betroffen gewesen. Ihr Verhängnis begann erst mit dem Siegeszug der Hauhau-Bewegung, deren Prophet Te Ua Haumene geschworen hatte, die pakeha aus Aotearoa zu vertreiben. Seine Rekrutenwerber erreichten auch die Stämme an der Ostküste. Viele, besonders junge Häuptlinge, verfielen ihrer Lehre, es kam zu Auseinandersetzungen und Morden. Für die Entführung von Matius Mutter und den anderen Leuten aus diesem iwi waren denn auch nicht die pakeha verantwortlich, sondern von ihnen abhängige Kupapa – Maori, die aufseiten der Briten kämpften. Wie bei den Stämmen üblich, hatten sie Kriegsgefangene als Sklaven genommen. Irgendwie musste Mahuika dann mit dem englischen Military Settler in Kontakt gekommen sein, der ihren Sohn gezeugt hatte. Was genau geschehen war, würde man wohl nie in Erfahrung bringen.
»Und als der Krieg schon längst zu Ende schien und wir unsere Toten betrauerten, kamen die pakeha …«
Der Sprecher berichtete, erneut in einem Tonfall zwischen Trauer und Empörung, dass der Gouverneur seinem iwi vorgeworfen hatte, die Hauhau während der Taranaki-Kriege unterstützt zu haben. Ein Argument, das den Weißen in den Sechzigerjahren vielfach als Vorwand dazu gedient hatte, Maori-Land zu konfiszieren. Der von jeher friedliche Stamm hatte zwar versucht, sich gegen die Vertreibung zu wehren, aber den Waffen der Engländer hatten die Maori nichts entgegenzusetzen. Immerhin hatte es für Matius Stamm Ausweichmöglichkeiten gegeben. Die Ngati Kahungunu ki Wairarapa, traditionell angesiedelt in den gleichnamigen Ebenen und im anliegenden Gebirge, hatten ihnen Obdach geboten. Der Stamm hatte in Papawai, einem Fort südöstlich von Greytown, eine große und wichtige Ansiedlung. Matius iwi hatte sich ihnen allerdings nicht anschließen wollen, sondern blieb für sich.
»Unsere Seelen sind nicht hier verankert«, verriet Matius Großmutter Ngaio später. »Unser maunga sind die Hügel und die Klippen um die Bucht, die ihr Hawke’s Bay nennt. Vielleicht werden wir ja irgendwann dorthin zurückkehren …«
Das erklärte die provisorisch errichtete Siedlung – glücklich war dieser iwi hier nicht. Aroha wusste allerdings von ihrer Mutter, dass es für die Menschen noch viel schlimmer hätte kommen können. Viele der von ihrem Land vertriebenen Maori waren in Regionen umgesiedelt worden, in denen traditionell verfeindete Stämme lebten. Dort war es dann zu weiteren Kämpfen und Morden untereinander gekommen.
Matiu saugte jedes Wort der mihi in sich auf, erfuhr er damit doch endlich etwas über seine Geschichte. Aroha dagegen war froh, als der Sprecher endete und mit viel Beifall bedacht wurde. Es folgten Lieder und Tänze, Gebete und der Austausch von Geschenken. Matiu und Aroha hatten ein paar Schnitzereien aus Otaki mitgebracht, die sie Matius Verwandten nun überreichten. Ngaio schenkte Aroha ein Stück Jade.
Schließlich saßen die jungen Leute mit Matius Familie um ein Feuer und kosteten das im Erdofen gegarte Fleisch und Gemüse. Aroha fand es köstlich. Sie freute sich, dass von Matiu langsam die Spannung abfiel. Nachdem er dem Begrüßungszeremoniell noch steif und unsicher beigewohnt hatte, plauderte er jetzt mit ein paar jungen Kriegern. Auch Aroha entspannte sich – bis Reka sich an sie wandte.
»Was ist nun mit deiner Geschichte, Aroha?«, erkundigte sich Matius Tante. »Alle fragen danach. Der ganze Stamm will es wissen. Sie trauen sich nur nicht, dich anzusprechen. Matius wahine – eine pakeha, die einen Maori-Namen trägt und unsere Sprache spricht … Wir haben nie jemanden wie dich getroffen. Wo also ist dein maunga, Aroha? Mit welchem Kanu kamen deine Ahnen nach Aotearoa? Welchem Berg oder See fühlst du dich verbunden?«
Aotearoa war das Maori-Wort für Neuseeland, und jedes Mitglied der Stämme kannte den Namen des Kanus, mit dem seine Vorfahren die Inseln erreicht hatten.
Aroha errötete. Mit einer Frage nach ihrer pepeha hatte sie an diesem Abend nicht mehr gerechnet. Aber wahrscheinlich hatte sie sogar noch Glück. Die Maori hätten sie auch vor dem versammelten Stamm um ihre Lebensgeschichte bitten können. Das Mädchen schluckte den Happen Essen hinunter, den es noch im Mund hatte. Dann holte es tief Luft.
»Ich bin Aroha Fitzpatrick«, begann Aroha mit ihrem Namen und fing dann an zu improvisieren. »Und meine Ahnen sind mit der Brigg Sankt Pauli nach Aotearoa gekommen.«
Tatsächlich traf das nur auf einen einzigen Ahnherrn des Mädchens zu, einen Mann, auf den niemand in Arohas Familie stolz war. Ottfried Brandman hatte Lindas Mutter Cat vergewaltigt und fast zur gleichen Zeit mit seiner damaligen Frau Ida ihre Halbschwester Carol gezeugt. Cat selbst war in Australien geboren und irgendwie mit ihrer trunksüchtigen Mutter zu einer Walfangstation auf der Südinsel gelangt. An den Namen des Schiffes erinnerte sich niemand mehr. Und wie Arohas Vater Joe Fitzpatrick nach Neuseeland gelangt war, wusste das Mädchen auch nicht. Er stammte aus Irland, aber er behauptete, in England studiert zu haben. Wie weit das alles der Wahrheit entspreche, habe sie nie erfahren, hatte Linda gesagt. »Dein Vater war ein Schwindler, Aroha, ein Aufschneider, ein Geschichtenerzähler. Ein charmanter Lügner … Das Leben mit ihm war … abwechslungsreich, doch auch gefährlich. Man konnte ihm leider nicht trauen.«
Ihre Mutter sprach stets mit verhaltener Freundlichkeit über Joe Fitzpatrick, Revi Fransi tat das nicht. Joe sei vor allem ein Lügner gewesen, betonte er immer wieder und verzog dabei sein Gesicht. Arohas Stiefvater machte keinen Hehl aus seiner Verachtung für den Mann.
Aroha wusste, dass Linda ihren Vater schließlich verlassen hatte. Irgendwie war eine andere Frau im Spiel gewesen, den letzten Ausschlag hatte ein Maori-Überfall während der Taranaki-Kriege gegeben, bei dem Fitz, wie ihn alle nannten, seine Frau und seine Tochter im Stich gelassen hatte. Einzelheiten hatte Linda nie erzählt, und Aroha hatte sich auch nicht übermäßig dafür interessiert. Franz Lange war ihr immer ein liebevoller Vater gewesen. Einen zweiten brauchte sie nicht. Insofern passte vielleicht sogar der Hinweis auf die Herkunft ihrer Ahnen in der pepeha: Franz war ebenfalls mit der Sankt Pauli nach Neuseeland gereist.
»Meine Familie siedelte zunächst auf der Südinsel«, erzählte Aroha weiter. »Erst als meine Mutter heiratete, ging sie mit ihrem Mann nach Patea. Er sollte dort Land erhalten …«
»Gestohlenes Land?«, fragte Reka streng.
Aroha biss sich auf die Lippen. Tatsächlich war Joe Fitzpatrick Mitglied eines Regiments der Taranaki Military Settlers gewesen. Man hatte ihm von den Maori requiriertes Land zugeteilt.
»Es hat sich dann nicht ergeben«, sagte Aroha vage.
Als ihr Vater wegen Feigheit vor dem Feind aus der Armee ausgeschlossen worden war, hatte man ihm natürlich auch sein Land entzogen.
»Und wo ist deine Seele verankert, Kind?«, fragte Matius Großmutter, die sich zu ihnen gesellt hatte, besorgt. »Es klingt, als hättest du keine Heimat.«
Aroha wusste nicht, ob sie zuerst nicken oder den Kopf schütteln sollte.
»Doch!«, erklärte sie dann entschieden. »Ich bin in Otaki aufgewachsen – auf Maori-Land. Meine Eltern sagen stets, wir nutzen es nur, es gehört uns nicht …« Tatsächlich hatte die anglikanische Kirche das alte Maori-Fort ohne viel zu fragen für ihr Waisenhaus requiriert, als der örtliche Maori-Stamm aus Otaki abgezogen war. Immerhin waren die Te Ati Awa freiwillig gegangen, um in Taranaki neu zu siedeln. »Aber mein maunga …«, sprach Aroha weiter, »… mein maunga ist nirgendwo auf Aotearoa.« Aroha lächelte. Ihre eigene Geschichte war etwas Besonderes, und bestimmt würde sie ihren Zuhörern gefallen. Matius Verwandte hingen jetzt schon an ihren Lippen. »Omaka, eine tohunga der Ngati Tamakopiri, die meiner Mutter bei der Geburt beigestanden hat, verankerte meine Seele im Reiche Rangis, des Himmelsgottes.« Ein Raunen war zu hören. Auf einmal schien ihr der ganze Stamm zu lauschen. »Sie sandte meine Seele mit dem Rauch des Feuers, in dem sie die Nachgeburt verbrannte, gen Himmel, und sie berief Rangi zu ihrem Beschützer.«
»Sie muss eine große Priesterin gewesen sein!«, bemerkte Reka bewundernd. »Eine Seele in den Himmel zu schicken wie einen Drachen am Neujahrsfest …«
Es war üblich, zu Matariki Drachen aufsteigen zu lassen, denen man Gebete und Wünsche an die Götter mitschickte.
»Auf jeden Fall stellte sie mächtige Geister an deine Seite!«, sagte Ngaio ehrfürchtig. »Omaka besaß sicher viel mana. Aber ob ein solches maunga ein Glück für dich ist, Kleine … Du wirst immer eine Reisende sein. Du wirst keinen Platz haben, an den du gehörst.«
Aroha schüttelte entschlossen den Kopf. »Nein, karani«, erklärte sie. »Ich gehe sehr gern auf Reisen, das ja. Ich würde am liebsten die ganze Welt sehen. Doch ich gehöre zu Matiu. Hier auf der Erde ist er mein maunga!« Sie schmiegte sich an den jungen Mann, der neben ihr saß.
Matiu lächelte glücklich. »Ich halte sie fest, karani!«, sagte er und zog Aroha an sich.
Die alte Frau erwiderte das Lächeln nicht, sie wirkte eher besorgt. »Sei vorsichtig, Enkelsohn«, sagte sie leise. »Es kann gefährlich sein, die Schnur des Drachens zu verkörpern, den die Götter begehren …«
KAPITEL 3
Aroha und Matiu erlebten ein paar wunderschöne Wochen in Wairarapa. Matiu schloss sich den jungen Jägern und Kriegern an. Der örtliche rangatira, dem die Ausbildung der Knaben im Umgang mit den traditionellen Waffen oblag, zog ihn selbstverständlich zu den Übungen hinzu. Aroha lachte, als sie Matiu zum ersten Mal in der traditionellen Kriegerkluft sah, und die anderen Jungen neckten ihn gutmütig, als er seinen eher schmächtigen, kaum muskulösen Brustkorb entblößte.
»Du musst mehr essen!«, erklärte Reka und verwöhnte ihren Neffen nach Kräften.
Der Lake Wairarapa erwies sich tatsächlich als ideal für Fischfang und Jagd. Aroha lernte von den anderen Mädchen des Stammes, wie man Reusen auslegte, und schwatzte dabei mit ihnen über Matiu und die anderen jungen Männer, für die ihre neuen Freundinnen sich interessierten. Am Anfang errötete sie dabei mitunter – Revi Fransi hatte recht gehabt, diese Mädchen waren unglaublich freizügig –, doch bald fand sie nichts mehr dabei, sich vor den anderen auszuziehen und ihre noch knospenden Brüste mit denen ihrer Freundinnen zu vergleichen.
»Die wachsen noch«, meinte die etwas ältere Rere tröstend, die selbst schon weit entwickelt war und von der die anderen munkelten, sie habe schon zweimal mit einem der jungen Krieger im Schilf am See Liebe gemacht.
Matiu wäre zu gern auch mal mit Aroha dort allein gewesen. Das Raupo-Dickicht und die Strände waren wohl der beliebteste Treffpunkt junger Paare. Aroha ließ sich dann tatsächlich überreden. Es war ein sonniger Vorfrühlingstag, und die beiden nahmen eine Decke mit an den Strand, auf der sie sich niederlassen konnten, um einander zu küssen und zu streicheln. Leider hatte es am Tag zuvor geregnet, und es war auch ziemlich kalt. Die beiden entschieden deshalb einträchtig, sich nicht vollständig zu entkleiden. Immerhin erlaubte Aroha ihrem Freund, unter ihrem Kleid nach ihren Brüsten zu tasten, was jedoch etwas enttäuschend war. Matiu fand eigentlich noch nichts Erwähnenswertes, das zu liebkosen sich lohnte. Die Beschreibungen seiner neuen Freunde hatten da vielversprechender geklungen. Nichtsdestotrotz versicherte er Aroha, sich keine schöneren Brüste vorstellen zu können.
Aroha ihrerseits ließ die Hände mit klopfendem Herzen unter den Bund seiner Hose wandern und erschrak, als sich sein Glied daraufhin versteifte. Immerhin hatten die Erzählungen der anderen Mädchen sie darauf vorbereitet, und schließlich war sie stolz, ihren Liebsten erregt zu haben. Aroha und Matiu gaben die Moralvorstellungen der pakeha, mit denen sie aufgewachsen waren, nicht vollständig auf, geschweige denn, dass sie ernstlich gegen sie verstießen. Aber sie lernten in diesen Tagen eine Menge über den männlichen und weiblichen Körper.
Matiu erfuhr in dieser Zeit noch vieles mehr über die Geschichte seines Stammes. Seine Großmutter war tohunga, die Kräuterfrau und Priesterin des Stammes. Sie konnte stundenlang erzählen, sprach von seinen Ahnen mütterlicherseits und berichtete von den Heldentaten der Krieger und der Schönheit der Frauen. Dazu schilderte sie das Leben des Stammes am Meer, sprach vom Fischfang und von wagemutigen Exkursionen der Männer mit ihren Kanus, von gefährlichen Klippen und weißen Stränden, von fruchtbaren grünen Hügeln, über die freundliche Geister wachten. Matiu hörte ihr aufmerksam zu, fand viele Schilderungen allerdings einfach nur befremdlich. Er hatte sich stets mehr für Technik als für Geschichten interessiert. Auch die Jagd und die Kriegskunst lagen ihm nicht. So empfand er es als angenehme Abwechslung, als der Häuptling ihm und Aroha am Sonntag nahelegte, die Kirchgänger des Stammes nach Greytown zu begleiten und dort mit ihnen den Gottesdienst zu besuchen. Die beiden tauschten die traditionelle Maori-Kleidung – auch Aroha hatte gern ausprobiert, wie sich die bunten Röcke und Oberteile aus verwebten Flachsfasern am Körper anfühlten – also wieder mit Reisekostüm und Anzug für den Kirchgang. Zumindest Matiu tat das ganz gern. Er hätte es zwar niemals zugegeben, aber er hatte in der Kluft der jungen Krieger die ganze Zeit hindurch erbärmlich gefroren. Nicht auszudenken, dass die anderen jungen Männer sich darin im Winter im Freien bewegten.
In der kleinen Kirche des Ortes erregten die Besucher des Stammes Aufsehen. Reka stellte sie, zweifellos im Auftrag des Häuptlings, dem Reverend vor, der natürlich schon von der Schule in Otaki gehört hatte.
»Reverend Lange leistet dort ganz hervorragende Arbeit!«, sagte der Priester begeistert. »Du hast einen Highschool-Abschluss, Junge? Davon können die Maori-Kinder hier nur träumen! Die Leute schicken sie natürlich auch nicht zur Schule. Dabei gibt es eine in Papawai. Sie hat bloß nicht den besten Ruf …«
Tatsächlich gab es eine von Missionaren betriebene Schule für Maori-Kinder in der wichtigsten Siedlung der örtlichen Stämme, aber sie schien nicht beliebt zu sein. Matius Stamm schickte jedenfalls keines seiner Kinder dorthin.
Im Anschluss an den Gottesdienst gab es Kaffee, Tee und Kuchen im Gemeinderaum, und der Reverend lud die Maori freundlich ein, sich seiner Gemeinde anzuschließen. Rekas Gesicht war abzulesen, dass sie das sonst nie taten, an diesem Tag wollte sie für ihre Besucher jedoch eine Ausnahme machen. Nachdem sie ein paar Worte mit den anderen Kirchgängern gewechselt hatten, trotteten alle brav mit, suchten sich Plätze an den langen Tischen und ließen sich von den neugierigen Gemeindefrauen bedienen. Schweigend stopften sie Gebäck in sich hinein, während Aroha lebhaft erzählte. Das Mädchen schilderte die Schule und Revi Fransis Missionsarbeit in leuchtenden Farben. Matiu verlor rasch das Interesse. Wie es der Zufall wollte, saß er mit einigen Männern am Tisch, die bei der Eisenbahn arbeiteten oder gearbeitet hatten. Nun lauschte er mit glühenden Wangen ihren Erzählungen und gab sie hinterher Aroha gegenüber wieder.
Das Mädchen hörte gelangweilt zu, fühlte sich aber insgeheim erleichtert. So gut es Aroha bei den Ngati Kahungunu gefiel – auf Dauer bleiben wollte sie nicht bei dem Stamm. Sie war froh, als sie hörte, dass es Matiu genauso ging. Der junge Mann konnte es kaum erwarten, sein Studium der Technik und des Maschinenbaus zu beginnen.
Am Montag erwartete Aroha dann eine Überraschung. Sie hatte sich nach dem Frühstück gerade wieder ihrer Gruppe zugesellt, als Reka und Hakopa sie suchten und im Auftrag des Häuptlings um Übersetzung baten.
»Der Reverend aus Greytown ist da«, erklärte Reka mit einem Gesichtsausdruck, als hätte sich da weniger ein Gottesmann als der Leibhaftige in ihr marae verirrt. »Er will mit dem ariki sprechen, und ich sollte übersetzen … Aber so viel Englisch verstehe ich gar nicht. Willst du nicht helfen, Aroha?«
Aroha nickte und traf vor dem Haus des Häuptlings Matiu, an den wohl dieselbe Bitte gerichtet worden war. Wozu die nur zwei Übersetzer brauchen?, fragte sie sich, begrüßte dann allerdings erst mal den Reverend, der etwas unsicher im Nieselregen stand. Anscheinend erwartete er, hereingebeten zu werden. Das, so wusste Aroha, würde jedoch nicht geschehen.
»Der ariki wird Sie hier empfangen«, erklärte sie dem säuerlich dreinblickenden Priester. »Es … es ist nicht üblich, die Maori sagen tapu, mit einem Häuptling einen Raum zu teilen, dieselbe Luft mit ihm zu atmen … Sein … äh … sein Schatten könnte auf Sie fallen …«
Der Reverend schnaubte. »Ich weiß sehr wohl, was tapu ist, Miss Fitzpatrick«, bemerkte er. »Heidnischer Unsinn. Wobei ich ja durchaus bereit bin, dem ariki meinen Respekt zu zollen. Aber geht das wirklich nicht, ohne im Regen zu stehen?«
Aroha bat den Gottesmann schließlich in den dürftigen Schutz einer Nicau-Palme, wobei sie ihm absolut Verständnis entgegenbrachte. Auch ihr gefiel es bei diesem Wetter nicht unter freiem Himmel, deshalb hatte sie am Morgen Bluse und Rock mit einer warmen pakeha-Jacke kombiniert. Matiu hätten seine neuen Freunde sicher gehänselt, wenn er so verweichlicht dahergekommen wäre. Trotzdem trug er jetzt Denimhosen und eine Lederjacke. Er musste den Besuch des Reverends zum Vorwand genommen haben, sich wärmer anzuziehen.
Der Häuptling dagegen verzichtete darauf, sich den Vorstellungen der pakeha von korrekter Kleidung anzupassen. Er erschien in der Tracht der Krieger und schützte sich nur mit einem wertvollen Mantel, der durch eingewebte Vogelfedern Wärme spendete, vor dem Regen.
»Kiaora, Reverend!«, grüßte der ariki, ohne sich dem Priester zu nähern. »Ich freue mich, Sie einmal in unserem marae begrüßen zu dürfen. Mein Volk bringt Ihnen großen Respekt entgegen.«
Aroha übersetzte seine Worte. Der Reverend nickte und antwortete mit ein paar ähnlichen Höflichkeiten. Allerdings schlich sich ein leichter Tadel in seine weitere Rede. Er freue sich über den eifrigen Besuch des Gottesdienstes, wäre aber noch sehr viel glücklicher, könnte er auch den Häuptling und seine Stammesältesten öfter in der Kirche begrüßen.
Der Häuptling antwortete ausweichend. »Ich habe meine Verpflichtungen«, beschied er den Priester. »Und unsere Ältesten … sie sind nicht mehr allzu gut zu Fuß. Es ist ein weiter Weg nach Greytown. Sie werden sich schon damit zufriedengeben müssen, dass die jungen Leute kommen.«
»Und die Kinder gehen ja wirklich sehr gern in Ihre Sonntagsschule!«, fügte Aroha ihrerseits hinzu.
Eigentlich hatten sich die Jugendlichen nur dahingehend positiv zum Unterricht in Greytown geäußert, dass es dort immer Milch und Kuchen gab. Aber das sagte sie hier lieber nicht.
Das Gesicht des Geistlichen hellte sich auf. »Genau darüber wollte ich mit Ihnen sprechen, ariki. Die Schule. Mir sind einige Ihrer Kinder aufgefallen, die aufgeweckt und eifrig zu sein scheinen. Allerdings sprechen sie kaum genug Englisch, um meinem Unterricht zu folgen. Und natürlich können sie nicht lesen und schreiben, was ebenfalls …«
»Es ist weit bis zur Schule nach Papawai«, bemerkte der Häuptling. Er schien zu wissen, worauf der Reverend hinauswollte. »Die Kinder wären jeden Tag viele Stunden unterwegs.«
»Gibt es da kein Internat?«, platzte Aroha heraus.
Gleich spürte sie den sehr unwilligen Blick des Häuptlings auf sich. Der weite Schulweg war offenbar genauso eine Ausflucht wie die Sache mit den Stammesältesten. Tatsächlich war zumindest Matius Großmutter jeden Tag stundenlang in den Wäldern unterwegs, um Kräuter zu sammeln. Die Wanderung nach Greytown wäre ihr auf keinen Fall schwergefallen.
»Reverend, in Papawai sitzen die Ngati Kahungunu ki Wairarapa«, versuchte der Häuptling nun zu erklären. »Wir sind Ngati Kahungunu ki Heretaunga. Natürlich sind wir keine Feinde. Im Gegenteil, wir sind Brüder. Trotzdem haben wir verschiedene Wurzeln, und in meinem Stamm hoffen viele darauf, einmal zur Hawke’s Bay zurückkehren zu können. Wir wurden unrechtmäßig enteignet. Es muss da Möglichkeiten geben …«
»Umso wichtiger wäre Bildung für Ihr Volk!«, trumpfte der Reverend auf. »Wenn Sie Juristen, Landvermesser, Politiker aus Ihren Reihen hätten, wäre alles einfacher. Sie müssen die Kinder zur Schule schicken!«
Der ariki schüttelte den Kopf. »Sie wären allein unter Fremden«, beharrte er.
Der Reverend biss sich auf die Lippen. Sein Ausdruck wurde eifrig, er schien jetzt seine Trumpfkarte ausspielen zu wollen.
»Nun, es muss ja nicht die Schule in Papawai sein«, sagte er vorsichtig. »Schauen Sie, als Ihre jungen Besucher gestern in meinen Gottesdienst kamen, schickte mir Gott diese Erleuchtung. Reverend Lange betreibt in Otaki eine Schule für Maori-Kinder verschiedener Stämme. Und wie Sie an unserem jungen Freund Matiu sehen …«, er lächelte Arohas Freund zu, »… ist Reverend Lange wohl nicht daran gelegen, die Kinder von ihren Stämmen zu entfremden. Warum schicken Sie nicht ein paar Ihrer Jugendlichen dorthin? Sie wären nicht allein – sie hätten in dem jungen Matiu einen Mentor und ebenso eine Mentorin in Miss Fitzpatrick …«
Aroha wusste nicht recht, wie sie das Wort Mentor übersetzen sollte, aber insgesamt erschien ihr der Vorschlag des Gottesmannes sinnvoll. Auch sie und Matiu hatten schon bedauert, dass die Kinder des Stammes keine Schule besuchten, zumal sie sich durchaus dafür interessierten, etwas zu lernen. Die Jugendlichen radebrechten in Englisch, und viele hatten Aroha und Matiu bestürmt, mit ihnen die Sprache der pakeha zu üben. Einige würden auch gern lesen und schreiben lernen.
Aroha beschloss, sich ihrerseits für den Plan des Reverends einzusetzen. »Revi Fransi und meine Mutter, die Kinder nennen sie koka Linda, sind wie Eltern für die Schüler«, erklärte sie. »Und es stimmt, die Kinder kommen aus verschiedenen Stämmen, zum Teil aus verfeindeten. Am Anfang, als die Schule noch ein Waisenhaus war, gab das große Probleme. Revi Fransi erfand schließlich ein Spiel: Er fuhr die Kinder mit einem Boot, das er Linda nannte, über den Fluss in die Schule. So konnten sie sagen, sie seien mit demselben Kanu in ihren gemeinsamen Teil von Aotearoa gekommen. Alle waren damit zufrieden. Revi Fransi legt großen Wert darauf, dass sich die Kinder vertragen!«
Der Häuptling kaute auf seiner Unterlippe. Sicher befürchtete er keine Streitigkeiten unter den Schülern. Tatsächlich würden sich die Kinder der Ngati Kahungunu nicht untereinander ausgrenzen, egal, zu welchem iwi sie gehörten. Auch dies war nur ein Vorwand, die Schule in Papawai abzulehnen. In Wirklichkeit hatte er Angst davor, dass der Reverend es mit der christlichen Erziehung der Kinder übertrieb. Es gab kaum einen Maori-Häuptling, der Bildungsmöglichkeiten für seine Stammesangehörigen ausschlug. Sie sollten nur in den Traditionen ihres Volkes verwurzelt bleiben.
»Und es ist ja auch gar nicht so weit«, meldete sich plötzlich überraschend Matiu zu Wort. »Nur ein paar Stunden mit dem Zug. Die Kinder müssten nicht jahrelang fortbleiben, sie könnten in den Ferien zurückkommen.«
Der Häuptling spielte mit den Federn seines Mantels. »Dieser Reverend Lange …«, meinte er, »… hätte nichts dagegen?«
Es war ein offenes Geheimnis, dass christliche Missionare ihre Zöglinge ungern wieder aus ihren Fängen ließen. Viele Maori-Stämme hatten schlechte Erfahrungen gemacht. Die Kinder, die sie freiwillig und treuherzig in die Schulen der frommen Brüder geschickt hatten, waren erst Jahre später, völlig verändert zurückgekehrt. Einen Highschool-Abschluss oder gar eine Hochschulbildung hatten sie nicht erhalten, dafür waren sie zu demütigen Knechten und Haushaltshilfen ausgebildet worden, die dann baldmöglichst in pakeha-Familien in Stellung gegeben werden sollten. Letztendlich waren diese Menschen in keiner der beiden Welten mehr zu Hause – weder Maori noch pakeha.
Matiu und Aroha schüttelten gleichermaßen den Kopf.
»Revi Fransi ist nicht so«, beruhigte Matiu den ariki. »In Otaki sind die Kinder glücklich.«
KAPITEL 4
»Und sie kommt sicher zurück? Du versprichst mir das?«
Aputa, die Mutter der kleinen Haki, wandte sich jetzt schon das fünfte Mal mit dem immer gleichen Anliegen an Aroha.
Aroha bejahte erneut. »Wir passen alle auf Haki auf!«, erklärte sie. »Nicht wahr, Kinder?«
Haki war das jüngste der vier Kinder, die der Stamm der Ngati Kahungunu mit Aroha und Matiu nach Otaki schickte. Eigentlich hatten sie geplant, erst Kinder ab zehn Jahren mitzunehmen, aber Haki hatte darauf beharrt, in die Schule zu gehen und zu lernen. Sie war außerordentlich klug, sehr lebhaft und selbstständig. Schließlich hatte sie ihren Eltern die Zustimmung abgetrotzt.
Aroha nutzte die Schutzbedürftigkeit der Jüngsten, um die kleine Gruppe gleich aufeinander einzuschwören. Sie hatte diese Methode oft bei ihren Eltern beobachtet. Wenn die Kinder einen gemeinsamen Auftrag bekamen, besonders, wenn man an ihr Verantwortungsbewusstsein appellierte, beugte das Rivalitäten vor. Nun waren Anaru, Purahi, Koria und Haki ohnehin weit davon entfernt, sich zu streiten. Dafür waren sie viel zu stolz darauf, ausgewählt zu sein und ihren Stamm in Otaki zu vertreten.
»Ich werde Rechtsanwalt!«, erklärte der zwölfjährige Anaru selbstbewusst. »Und dann bringe ich unsere Sache vor die pakeha-Gerichte, und wir kriegen unser Land zurück!«
Anaru sprach von allen Kindern schon am besten Englisch, aber Koria stand ihm dabei in nichts nach. Purahi war eher technisch orientiert. Dass er mit nach Otaki kommen durfte, verdankte er vor allem Matiu, dem sein Erfindungsreichtum und seine Wissbegier schnell aufgefallen waren. Auch Purahi brannte darauf, mehr über den Bau und den Betrieb der Eisenbahn zu erfahren. Aufgeregt spähte er jetzt nach dem Zug aus, der gleich einfahren musste. Matiu und Aroha, die künftigen Schulkinder und ihre Eltern warteten am Bahnsteig. Die Mutter von Purahi und auch die von Haki waren in Tränen aufgelöst, Korias Mutter glättete immer wieder den Rock des neuen pakeha-Kleides ihrer Tochter. Die Kirchengemeinde von Greytown hatte die Maori-Kinder großzügig mittels Spenden neu ausgestattet. Alle hatten Kleidung erhalten – natürlich solche, aus denen die Kinder der Gemeindemitglieder herausgewachsen waren. Ihre Bündel enthielten auch Schulsachen wie Fibeln, Hefte, Bleistifte und Bücher.
Aroha wusste nicht, ob Revi Fransi das wirklich alles brauchte, doch die Kinder fühlten sich außerordentlich wichtig.
»Du liest mir dieses Buch während der Fahrt vor«, bestimmte Koria und hielt Aroha ein Exemplar von Little Princess hin, »und wenn wir dann ankommen, kann ich schon Englisch.«
»Ganz so schnell wird’s nicht gehen«, dämpfte Aroha ihre Erwartungen, um dann auch Anarus Vater noch einmal zu versichern, dass es den Kindern in der Schule ihrer Eltern gut gehen würde.
»Und dieses Ungeheuer?« Purahis Mutter musste gegen das Pfeifen des einfahrenden Zuges anschreien. »Wird es die Kinder nicht verschlingen?«
Sie wies auf die Lokomotive, die auf jemanden, der nie zuvor eine Eisenbahn gesehen hatte, zugegebenermaßen bedrohlich wirken musste.
»Das ist doch kein Ungeheuer, das ist eine Dampflokomotive!« Purahi lachte. »Die zieht die Wagen, mit denen wir fahren. Wie ein Pferd, nur viel, viel stärker …«
»Sie erscheint mir wie ein Drache«, murmelte seine Mutter. »Gelingt es denn den pakeha, sogar Drachen zu zähmen?«
»Manchmal schieben die Loks die Züge auch, sagt Matiu!«, erklärte Purahi begeistert. »Und sie bremsen sie an Steigungen. Wir fahren nämlich durch’s Gebirge. Und durch Tunnel …«
»Wir müssen einsteigen, koka«, wandte sich Matiu sanft an Purahis Mutter. Er nannte sie Tante, denn auch sie gehörte zu seinem großen Verwandtenkreis. »Ihr müsst den Kindern jetzt Lebewohl sagen!«
Matiu und Aroha selbst tauschten den hongi mit Reka, die sich verstohlen Tränen aus den Augen wischte.
»Du musst im nächsten Jahr wiederkommen!«, forderte sie ihren Neffen auf. »Bestimmt. Egal … egal, was deine karani sagt!«
Der Abschied zwischen Matiu und seiner Großmutter hatte sich bewegend gestaltet. Die alte Ngaio hatte einen Segen gesprochen, den Matiu nicht verstand. Wie alle karakia – Gebete, Segenswünsche und Flüche – wurde er blitzschnell aufgesagt. Die Worte waren kaum auseinanderzuhalten. Reka hatte er jedoch in Angst und Schrecken versetzt. Sie hatte es Matiu und Aroha nicht näher erklärt, aber die alte Frau ging offenbar davon aus, ihren Enkel nie wiederzusehen.
Matiu lächelte seiner Tante ermutigend zu. »Ich komme und bringe euch die Kinder zurück«, versprach er. »Gleich im nächsten Sommer. Da sind Semesterferien an der Universität. Dann wird es hier auch schöner sein. Nicht so fürchterlich kalt wie heute.«
Besonders kalt war es eigentlich nie in Greytown, allerdings windig, und der Wind war an diesem Tag eisig. Dazu erreichte er eine Geschwindigkeit, die Aroha den Atem nahm. Das Mädchen war froh, als es endlich im Abteil saß. Aroha wies den aufgeregten Kindern Plätze zu und kontrollierte noch einmal, ob auch wirklich alle Fahrkarten bereitlagen, während Matiu das Gepäck in den Netzen über den Sitzen verstaute. Schließlich setzten sich die schweren Eisenräder der Dampflokomotive in Bewegung. Die Kinder winkten ihren Eltern fröhlich zu. Sie empfanden ganz offensichtlich keinen Abschiedsschmerz, während Purahis Mutter auf dem Bahnsteig beinahe zusammengebrochen wäre. Ihr Mann musste sie halten. Hakis Mutter lief noch ein Stück neben dem Wagen her, in dem sie saßen. Sie schien es kaum auszuhalten, die Kleine fahren zu lassen. Die anderen Eltern wirkten gefasster. Korias Mutter schaffte sogar ein Lächeln, als sie den Kindern nachwinkte.
»So, und jetzt das Buch!«, bestimmte Koria, kaum dass die Lokomotive sich pfeifend in Gang gesetzt hatte. »Was für eine Geschichte ist das? Eine Prinzessin ist … eine Häuptlingstochter, stimmt’s?«
»Der erste Tunnel ist der Prices Creek, richtig?«, wandte sich Purahi an Matiu. »Oder ist es der Siberia? Welcher ist noch mal länger?« Er versuchte, sämtliche Bauwunder der Rimutaka Incline auswendig zu lernen.
Matiu und Aroha begannen zu erklären, viel Zeit, aus dem Fenster zu sehen, würde zumindest Aroha diesmal nicht bleiben. Während sie las und übersetzte – den Maori-Mädchen fehlte allgemeines Wissen über die Sitten der pakeha