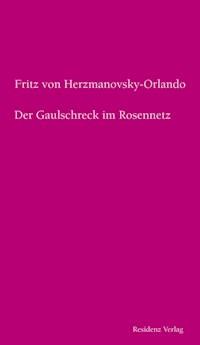Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Residenz
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Fritz von Herzmanovsky-Orlandos Hauptwerk erstmals als Leseausgabe Durch eine Kastentür gelangt der verwaiste, ledige Cyriak von Pizzicolli, der sein Leben lang nie weit von Graz weggekommen ist, auf Traumpfaden in die Tarockei, "das einzige Nachbarland der Welt", ein magisch bevölkertes Phantasiegebilde eines österreichisch-byzantinischen Utopia, dessen Verfassung auf den Regeln des Tarockspiels gründet. Was ihm dort widerfährt, nachdem er der atemberaubend schönen Cyparis ansichtig wird, und warum er am Ende ein Hirschgeweih auf dem Kopf trägt, kann Ihnen nur dieses Buch erzählen und niemand anderer als Fritz von Herzmanovsky-Orlando. "Maskenspiel der Genien" ist sein Hauptwerk und zugleich ein Hauptwerk der österreichischen Literatur des 20. Jahrhunderts - die phantastische Schwester von Musils "Mann ohne Eigenschaften", eine Alice im Wunderland, die durch Kafkas Schloss stolpert, ein von Einfällen und Witz überquellender, wunderschöner Alptraum!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 604
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Fritz von Herzmanovsky-Orlando
Das Maskenspielder Genien
Roman
Herausgegeben vonKlaralinda Ma-Kircher
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek:Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
www.residenzverlag.at
© 2010 Residenz Verlagim Niederösterreichischen PressehausDruck- und Verlagsgesellschaft mbHSt. Pölten – Salzburg – Wien
Alle Urheber- und Leistungsschutzrechte vorbehalten.Keine unerlaubte Vervielfältigung!
ISBN ePub:978-3-7017-4366-7
ISBN mobi:978-2-7017-4408-1
ISBN Printausgabe:978-3-7017-1552-7
1
Cyriakus von Pizzicolli, der Sohn angesehener Eltern, erblickte zu Stixenstein das Licht dieser Welt. Jedem anderen hätte die Wahl dieses Geburtsortes zu denken gegeben. Ihm nicht.
Der moralische Zweck dieser Erzählung ist es, auch dem Borniertesten klarzumachen, dass es nicht gleichgültig ist, in einem Ort mit solch ominösem Namen geboren zu werden. Ja, die signatura rerum!
Cyriak wuchs in den denkbar angenehmsten Verhältnissen auf, und alles deutete darauf hin, dass ihm ein geregeltes Leben bevorstünde, frei von Sorgen, von der bürgerlichen Achtung bemerkenswert überschattet.
Es kam anders. Daran war eine Macht schuld, die Wonne und Schrecken im Gefolge hat, die Macht besonders schöner und anmutiger junger Mädchen, doch solcher von einer Art, dass man sie als die Figurantinnen einer geheimnisvollen Elementargewalt ansprechen muss, deren letzte Ergründung uns in dieser Maske wohl immer verborgen bleiben wird.
Ein Mädchen von solch geheimnisvoller Eigenart kreuzte Pizzicollis Lebensweg, ein ganz außergewöhnlich schönes Geschöpf in dem Alter, wo manchen von ihnen die Reize des Androgynitätsmysteriums in besonderem Maße zu Eigen sind. Die aus solcher Begegnung erwachsende Tragik ward Pizzicolli vollauf zuteil, und dabei ist die Frage offen, ob das rätselvolle Geschöpf, das in seinem Fall die schicksalauslösende Elementarfigur, die Katalysatrix mystica, nicht am Ende die jüngere Schwester der Aphrodite gewesen ist, womit wir ein ganz besonderes Geheimnis zum ersten Male berühren.
Wir könnten da auf sehr seltsame levantinische Geheimquellen hinweisen, wahre Juwelenschreine des Bizarren, auf rätselverschleierte Partien byzantinischen Wissens, das um die Mitte des 15. Jahrhunderts zugrunde gegangen ist, zusammen mit vielem anderem, das mit Dingen jugendlicher Pracht und Herrlichkeit zusammenhing, Wunderblumen eines Erosgartens der Schönheit. Was ließe sich darüber höchst Merkwürdiges und Unerwartetes erzählen, wenn der Raum es gestatten würde!
Pizzicollis Familie stammte aus Ancona, wo, als dieser Teil der sogenannten Legationen des Kirchenstaates noch unter österreichischer Verwaltung stand, der Großvater Cyriaks das Amt eines k. k. Münzwardeins des dorthin dislozierten herzoglich Rovereischen Münzamtes von Urbino bekleidete, ein zwar überaus verantwortliches, aber so gut wie ressortloses Amt.
Es gab im Grunde gar nichts zu tun, da die besagte Münze ihren Betrieb seit 1631 eingestellt hatte, was wieder seinen Grund in einem wohl erst in Jahrhunderten endenden fiskalischen Prozess hat. Um nicht weitschweifig zu werden, sei nur angedeutet, dass die Ursache der Betriebseinstellung eine Kompetenzfrage war, die nicht eher lösbar erscheint, bis nicht festgestellt ist, wieso der erste Herzog Urbinos aus dem Hause delle Rovere zugleich der Sohn des letzten, 1508 gestorbenen Herzogs aus dem Hause Montefeltre, aber auch zugleich der des Papstes Julius II. sein konnte, oder ähnlich, eben seinen Sohn Franz delle Rovere, bisher Tyrann von Sinigaglia, der wiederum ein Sohn des erwähnten Guidobaldo von Montefeltre gewesen sein soll, zum Herzog von Urbino ernannte. Ich habe, ehrlich gesagt, diese Darstellung nie ganz verstanden, doch tritt die Universität Lecce in Apulien für sie ein, wenn ich nicht irre, und man sieht in gewissen Kreisen nicht gerne, dass daran gerüttelt wird. Eines aber steht fest: Leo X., der Nachfolger Julius’ II., dessen Weg zur Hölle buchstäblich mit missratenen Söhnen gepflastert war, hatte, angeekelt von dieser Rechtsfrage, Franzen vertrieben und seinen Nepoten Lorenzo de’Medici, nach Gemälden beurteilt wohl eher der Sohn einer ausnahmsweise schon damals bestandenen Negerjazzband, mit Urbino belehnt.
1631 hatte aber sein damals regierender Nachfolger, Urban VIII., Urbino eingezogen und dem Kirchenstaat einverleibt, wo es bis 1860 blieb, dann aber nach längerer Belagerung an einem langweiligen Nachmittag durch Garibaldi ganz allein erstürmt wurde. Die andren Herren hatten sich beim „Schwarzen“ verplauscht.
Wer aber glaubt, dass die Sache damit endgültig abgetan ist, der irrt. Mit Urbino ist es noch nicht aller Tage Abend, und wir stehen dortorts knapp vor neuen unentwirrbaren Vorgängen, wie man mir im Caffé Centrale besagter Stadt allseitig versicherte.
Vom jungen Cyriak ist eigentlich wenig zu sagen. Er war ein hübscher, wohlerzogener Junge, der sehr streng gehalten wurde. Seine Mutter besonders, eine geborene Baronin Inacher-Kadmič, auf den ungewöhnlichen Namen Autonoë getauft, machte ihn für alles Denkbare verantwortlich. Das ging so weit, dass sie einmal, als eine vorbeifliegende Taube seinen neuen schwarzen Sonntagshut verunreinigt hatte, den schüchternen Jungen anherrschte: „Schau, was du da wieder gemacht hast!“
Vielleicht war seine außerordentliche Wanderlust auf den uneingestandenen Wunsch zurückzuführen, diesen ewigen Vorwürfen zu entfliehen, vielleicht hatte sie weit tiefere Ursachen, möglicherweise Ursachen, die in einem früheren Vorleben fußten, ein Verdacht, der aus dem Verlauf dieser Erzählung Bestärkung findet. Dann war noch bemerkenswert an ihm, dass er Wildbret, insbesondere Hirschfleisch, verabscheute, dass er ferner in einem eigentümlichen Verhältnis von Angezogensein und Abneigung zum Jagdwesen stand und ihm der Name „Anna“ geradezu Entsetzen einflößte. Durch den Artikel „die“ vor dem ominösen Namen gewann dieser Zustand nachgerade beängstigende Dimensionen. Nach dem siebenten Jahr verschwand diese Furcht übrigens vollständig.
Schließlich sei noch zu bemerken, dass zwischen Cyriak und Hunden eine sonderbare Beziehung bestand. Oft kam es vor, dass ganze Rudel gesträubten Haares auf ihn lospreschten, wobei es keinem Menschen erklärlich war, wieso Ansammlungen der Art sich so plötzlich gebildet hatten. Jedes Mal aber stoppten die Köter vor Cyriak, wurden verlegen und machten sich dann, Stück für Stück getrennt, allerhand anders zu schaffen, als ob sie die Sache gar nichts anginge. Schließlich verkrümelten sich diese ordinären Gesellen unmerklich. Das Merkwürdige war, dass regelmäßig Molosser darunter waren, Angehörige einer Hundesorte, die sonst lediglich in antiken Erzählungen vorkommt.
Von einigen kleinen Reisen abgesehen, war Cyriak nie weit von Graz, wo die Familie Pizzicolli wohnte, weggekommen. Das wurde anders, als eine Katastrophe von seltener Tragik Cyriak unvorhergesehen zum Waisenkind machte. Die guten Eltern ertranken gelegentlich einer Sonntagsunterhaltung in der Mur. Nur den verbeulten Zylinder des Vaters, heute ganz ausnahmsweise mit einem heiteren Gamsbärtchen wohl zum Juxe geschmückt, spien die grauen Wogen ans Land. Der bestürzte Junge sah sich frei, machte auch das unbewegliche Erbe zu Geld und fuhr an einem herrlich strahlenden Sommermorgen auf die Bahn. Er bestieg bei voller körperlicher und geistiger Gesundheit den um acht Uhr dreizehn aus Bruck kommenden beschleunigten Personenzug, erreichte gegen elf Uhr die Grenze des Traumreiches und befand sich schon knapp vor Mitternacht desselben Tages über eigenes Verlangen in einer Irrenanstalt.
„Des Traumreiches“, werden wohl alle Leser ausrufen und das Buch geekelt wegwerfen, „davon ist ja schon so viel unsinniges Zeug geschrieben worden. Gibt’s das denn wirklich?“
Ja, und abermals ja! Doch man kann ihnen die Frage nicht übelnehmen, da man sich stets vor Augen halten muss, dass die ganze Welt Österreich mit unerhörter Interesselosigkeit, ja, mit beklagenswertem Unwissen gegenübersteht, kaum dass man das bisschen davon kennt, was die Reisehandbücher Falsches von den paar begangenen Touristenrouten zu sagen wissen. Nicht geringe Schuld daran hat wohl das Versagen der internationalen Fahrplankonferenzen, die es zustande bringen, dass bedeutende Schnellzuglinien, deren Expresse unter Pomp, Gestank und Donner von irgendeiner Grenzstation abgelassen werden, im Innern dieses Landes nach kurzer Frist spurlos versiegen, nachdem sie zuerst den Speisewagen durch irgendeinen geheimnisvollen Abschuppungsprozess verloren haben. Am meisten geschieht dies um Leoben herum, dem Gewitterwinkel des europäischen Reiseverkehrs.
Leoben, ja Leoben! „A Zug, der was drüber kommt, der is, kann ma ruhig sagen, aus’m Wasser.“ Das die ständige Redensart der großen österreichischen Eisenbahnfachleute, während das Interesse der übrigen Chargen am Bahnbetrieb hauptsächlich darin gipfelt, mit Kind und Kegel umsonst oder um hohnvoll kleine Beträge in der Luxusklasse der Netze so oft als möglich spazieren zu fahren. Mehr als einmal habe ich es erlebt, dass alte, erfahrene Stationschefs dem über Leoben fahrenden Express lange kopfschüttelnd nachschauten. Dann gehen sie ins Dienstzimmer zurück, stellen die Telegrafenleitung ab, werfen sich seufzend aufs schwarzlederne Sofa und stöhnen noch lange „Jo, jojo, jo!“, worauf sie in traumgequälten Schlummer versinken.
Wenn man das alles gerecht erwägt, ist es auch nicht wunderzunehmen, dass man ein eigentümliches Staatengebilde nicht wahrgenommen hat, das knapp nach dem Laibacher Kongress 1821 ins Leben trat und sich weiter und weiter frisst, unaufhaltsam die Welt erobernd. Es, und nicht etwa das wanzenerstickte Asien, wird über kurz oder lang zum Beispiel dem britischen Weltreich ein Ende machen. Es, das wie nichts anderes im Europäertum verankert ist und sozusagen den Astralleib der weißen Rasse darstellt, das – vielleicht ist die Bezeichnung die treffendste – das „Reich der Tarocke“. Wie alle transzendentalen Dinge ist die Sache schwer in allgemein verständliche Worte zu fassen.
Wie gesagt, am Laibacher Kongress beschloss man, was auch das Vernünftigste war, zwischen die germanischen, slawischen und romanischen Gebiete einen Pufferstaat zu legen, das Burgund des Südostens, das Burgund der Levante, wie es einige poetisch benannten. Und sie hatten so unrecht nicht, denn gerade Burgund hängt stark mit dem Osten zusammen. Gerade Burgund war es, das das ganze Mittelalter hindurch nach der Herrschaft über die Levante strebte und im Verlauf der Kreuzzüge ganz Griechenland und Teile Vorderasiens eroberte und dort das Königreich Jerusalem, die Fürstentümer Edessa, Tripolis und Antiochia gründete, während in Griechenland Athen, Elis, Achaia und Korinth seine stolzesten Eroberungen waren. Nirgends herrschte ein solcher Glanz wie an diesen Höfen, und lange Zeit war Achaia das Vorbild allen höfischen Lebens, die Hochburg der Minnesänger.
Dass die Verfassung des neu zu gründenden Pufferstaates eine streng monarchistische sein musste, ist in Hinblick auf die Epoche seiner Entstehung ohneweiters klar. Die Frage der Dynastie machte viel Kopfzerbrechen. Verschiedene Häuser kamen in Frage. Dem großen Bayernkönig Ludwig zum Beispiel lag der gewiegte Orientkenner Fallmerayer beständig in den Ohren, alte Anrechte geltend zu machen, und malte Seiner Majestät das Kaisertum Kärnten in glühenden Farben an die Wand.
Ja, in einer vertrauten Stunde entwickelte der phantasiereiche Mann sogar die Idee, einen neuen Kontinent – „Gschnasien“ – zu bilden, eine Idee, die vielleicht einmal wahr wird. Qui vivra verra!
Der von England zur Ablenkung arrangierte griechische Freiheitskampf brach bald darauf aus, und im Londoner Nebel gebraute Intrigen leiteten die wittelsbachische Gefahr nach Hellas ab. Jetzt schien dem Haus Koburg der Thron der Tarockei gewiss. Da raunzte aber wieder Kaiser Franz und wollte dort eine Quartogenitur der Habsburger ins Leben rufen, was aber die andren Herrscherfamilien lebhaft zu verschnupfen begann. Als das europäische Gleichgewicht schon so weit verschleimt war, dass man die Säbel dumpf rasseln hörte, ließ Metternich seinen großen Geist wieder einmal leuchten. Die Lösung war so einfach, dabei so dynastisch als möglich, andrerseits so durch und durch dem tiefsten Empfinden des Volkes, ja dem Ideal des kommenden Jahrs 1848 entsprechend, dass wir nur mit ehrfürchtigem Staunen den Flug dieses großen Geistes bewundern müssen.
Was tat er? Er schuf eben das „Reich der Tarocke“, von Nörglern, denen nie etwas recht ist, auch das „Spiegelreich des linken Weges“ benannt. Die Verfassung war vorbildlich. Man baute sie auf in Anlehnung an die strengen, unerbittlichen Gesetze des in Österreich ungemein populären Tarockspieles, dessen esoterische Bedeutung alle Welträtsel deutbar macht und natürlich weit über den Rahmen dieser schlichten Erzählung hinausginge.
Nach Art der antiken Tetrarchen herrschten im neuen Reiche vier Könige, die man jährlich auf eine geradezu geniale Art und Weise neu wählte. Man legte dieser erwähnten Zeitdauer folgende Beobachtung zugrunde: Bei einem Tarockspiel, das ein ganzes Jahr in Betrieb ist, sind die Könige durch die Bank fast bis zur Unkenntlichkeit verschmutzt. Die kann man mit Benzin notdürftig reinigen, fleischerne Könige nicht.
Und was tat man also bei der Wahl der ein wenig starr kostümierten Landesväter? Man machte vier Männer zu Monarchen, vier Männer, die jeweils den Königen des in Gradiska, der Hauptstadt, aufbewahrten sogenannten Normaltarockspieles am ähnlichsten sahen. Dieses Normaltarockspiel entsprach einer Einrichtung ähnlich dem „Normalmeter“, wie er in Paris, der Metropole aller gockelhaften Wichtigtuerei, aufbewahrt wird.
Das besagte Paket Karten wurde Tag und Nacht von einer Nobelgarde verdienter Männer bewacht und alle vierzehn Tage durch Gelehrte von Weltruf gemischt und dabei kontrolliert. Nach dem Raubmord an Deutschland wollte man es nach Genf verlegt wissen, um dabei ähnlich wie bei der etwa auf gleicher Rangstufe stehenden „Donaukommission“ neue Sinekuren für politische Gigerln zu schaffen.
Durch dieses Wahlsystem war jedem Schwindel, jeder Bestechlichkeit, jeder Intrige der Weg einfach abgeschnitten, und auf diese Art kamen Männer aller Stände, ohne Ansehung von Bildung, Reichtum, Gelehrsamkeit, Abkunft, ja nicht einmal von Unbescholtenheit, zur höchsten Würde, ein Vorgang, den in ähnlich genialer Weise bloß noch das Papsttum sein Eigen nennt. Allerdings wird dort auf den letzterwähnten Punkt rigoros geschaut.
Der eigentlich mächtigste Mann im Reich war aber der sogenannte „Sküs“, nach einer ein wenig komischen, harlekinartigen Figur dieser Karten so genannt. Doch sei man weit entfernt zu glauben, dass diese unbedeutende Äußerlichkeit auch nur das Geringste mit der inneren, erhabenen Würde der Stellung zu tun gehabt hätte. Große Staatsmänner wirken äußerlich immer etwas komisch.
Dieser Sküs also war der Reichskanzler, der den Staat mit diktatorischer Gewalt lenkte, fast stündlich neue Gesetze aus dem Ärmel schüttelte und jede Woche irgendetwas Umwälzendes tat. Ihm zunächst stand an Rang und Ansehen der sogenannte „Mond“, eigentlich ein „Einundzwanziger“, womit gesagt sein wollte, dass diese Figur den einundzwanzigsten Grad einer sehr mystischen Art von Freimaurerei bekleidete. Als dritter rangierte der „Pagat“, der Finanzminister, der großes Wort zu reden hatte. Zusammen bildeten sie die „Trull“, ein niemals zu stürzendes Kabinett.
Das Reich umfasste bei seiner Gründung einen nicht unbeträchtlichen Teil Südösterreichs, ehemaliges Freisingisches, Salzburgisches, Bambergisches und Brixner Enklavengebiet, grenzte im Norden an Steiermark und Kärnten, im Osten an Kroatien, reichte im Süden ans Meer und im Südwesten bis an die Grenze von Venedig, des Lagunenreiches, das es wohl als den ersten Fremdkörper verschlingen dürfte. Denn welche Stadt ist phantastischer und unwirklicher, kaum mehr von dieser Welt, schöner und dabei am wenigsten wirklich bekannt als diese märchenversponnene Königin der Adria und dadurch für den Übergang in ein Traumreich wie geboren.
Rein äußerlich, wer kennt sich dort aus?
Ich, der ich einige Jahre dort das Gymnasium, oder wenigstens das, was man dort für ein Gymnasium zu halten geneigt ist, besuchte, habe zum väterlichen Palazzo, der keine drei Minuten vom Markusplatz entfernt ist, oft nur mit Mühe und nach stundenlangem Umherirren heimgefunden. Wie oft erschien kein Professor! Wie oft traf ich meine arme Mutter mit einer irr blickenden Magd. Sie hatten sich beim Einkaufen verirrt. Oder sah meinen Vater düster zu Boden blicken, am ergrauten Schnurrbart kauen und bisweilen heftig mit dem Stock auf das Pflaster schlagen. „Geh nur nach Haus“, pflegte er mir da zu sagen, „ich lasse Mama grüßen, und sie möchte die Suppe auftragen lassen … ich komme in längstens fünf Minuten …“ Aber oft wurde es Abend, ja tiefe Nacht, ehe der Übermüdete sich zur Mittagstafel setzen konnte.
Soviel vermag die väterliche Autorität, keine Schwäche zu zeigen. Dasselbe auch ein sonderbarer, jedem in Venedig Sesshaften angeflogener Komplex, lieber obdachlos umherzuirren, als nach dem Weg zu fragen oder gar sich führen zu lassen. Es würde übrigens auch gar nichts nützen.
Wir waren ja bloß Fremde, keine geborenen Venezianer. Aber wie oft habe ich auch Eingeborne der Lagunenstadt vor Madonnenbildern wehklagend gefunden, darunter sogar Briefträger und Polizisten, selbst städtische Ingenieure mit Messlatten. Falsche Scham verbot diesen Unglücklichen, Auskünfte über den Weg einzuholen. Sie wandten sich lieber an die höheren Mächte, und die Kirche strich schmunzelnd manch schönes Geld für Gelübde ein. Ich habe auch bemerkt, dass man dort, konform den im Preis herabgesetzten, weil fehlerhaften Kursbüchern, um ein wahres Spottgeld falsche Stadtpläne bekommt, da es ja doch alles eins ist und man wirr hinlithographiert, was einem gerade einfällt. Sogar alte Schnittmuster werden geistlos kopiert oder gar in Stücke zerschnitten naiven Reisenden als Pläne aufgeschwätzt.
Wir wollen dieses traurige Stück Sittengeschichte aber nicht unnütz breittreten und am Schlusse unsrer Betrachtung nur noch bemerken, dass das auffallend rege Straßenleben der im Grund nur wenig bevölkerten Stadt auf Konto der vielen Verirrten kommt. So glaubt man eine Weltstadt zu sehen, worauf der Venezianer nicht wenig stolz ist.
2
Als Metternich die eisenfesten Grundzüge der Verfassung für die Ewigkeit verankert und dem nordischen Geist der Ordnung Genüge geleistet hatte, tauchte unerwartet die verlegene Frage auf: Was geschieht mit den Südprovinzen, wie schaffe ich dort Zufriedenheit, um das unter der Asche glimmende Feuer der neuen nationalen Bewegung nicht zum lodernden Brand werden zu lassen? Und da kam nach wochenlangem Grübeln dem großen Staatsmann die rettende Idee: Lass das uralte poetische Volksideal des Südens politische Realität werden, lass das geheimnisvolle Maskenreich Wahrheit werden, das wahre, tiefe Ideal des Südens, das bisher nur in den Figuren der Commedia dell’Arte den Traum eines Daseins fristen konnte!
Wie seinerzeit aus den Drachenzähnen, die Kadmos säte, Geharnischte sich aus den Furchen des Ackers erhoben, tauchten jetzt schellenklingelnd die Legionen des Harlekinheeres auf, Heere, aus dem Boden gestampft. Die ernsten Skaramuzze folgten, krummnasig, mit riesigen schwarzen Nasenlöchern. Es folgten Brighella, der Vertreter der Fresser und Prahler, Pulcinella, der Bajazzo mit Höcker und großer Hakennase, und der alte Pantalone, in dem sich der ängstliche, vielgeprellte, geizige und verliebte Kleinbürger bis zum Kristallhaften ausgebildet sah. Der schwatzhafte Dorsennus der Antike hatte sich im Dottore modernisiert, dem Ideal des Rechtsgelehrten, der die Leute beschwatzt und betrügt und mit der Ausbeutung der Gesetze gehörig schnürt. Die hohen Stände sahen sich mit befriedigter Eitelkeit im schwadronisierenden Tartaglia geehrt. Das hohe Militär hatte seinen Napperone Flagrabomba, den Capitano Spavento und die alten Kriegshelden Malagamba und Capitano Cucurucu. Damit Arlecchino nicht zu üppig werde, hatte er als Konkurrenten den ebenso tölpelhaften, dummdreisten Truffaldin, von Mezzetin und Gelsomino aufs Redlichste unterstützt. Das schöne Geschlecht sah sich lieblich widergespiegelt in den Figuren der sanften Colombina, der pikanten Zerbinetta, der Pulcella, Spiletta, der Zurlana und Civetta. Alles Figuren der Ewigkeit, wie sie uns der wackere Ficoroni in seinem prachtvollen, aber planlosen Kupferwerke „De larvis, scenicis et figuris comicis“ (Rom 1754) zeigt.
Sie alle wurden in der Tarockei mit offenen Armen aufgenommen und gelangten bald zu hohen Würden in der Gesellschaft und der Verwaltung der wichtigsten Ämter. Und alle diese leichtbeschwingten Wesen führten in stilvoller Maskerade das ganze öffentliche Leben in viel deutlicherer, abgeklärter, man möchte fast sagen hieratischer Weise durch. Sie wirbelten immer bunt durcheinander, umkomplimentierten sich aufs Feierlichste, ohne das Geringste zu arbeiten oder zu schaffen, pompöse, ruhmtriefende Erlässe ausgenommen. Selbst bei der Verlegung von Hundehütten oder etwa der Erneuerung des Sitzbrettes einer ländlichen Bedürfnisanstalt gab es Flaggen, Spaliere, Ehrensalven und stundenlange pathetische Reden. Wenn das alles beendet war, kam es wohl vor, dass auf schäumendem Renner eine Stafette herangebraust kam, mit der Meldung, dass man an falscher Stelle amtiert habe.
Aber gerade solche Staaten blühen und gedeihen und erfreuen sich des Ansehens bei den Nachbarn.
Wie gesagt, der treffliche Cyriak kam gegen elf Uhr am Grenzorte an, den wir verschweigen wollen, liegt es uns doch ferne, den Fremdenverkehr zu fördern oder gar einer leichtsinnigen Wanderlust neue Wege zu weisen. Die Zolluntersuchung war eine äußerst rigorose und wurde mit der größten Strenge gehandhabt. Nichts ist dortzulande verpönter als eine gewisse Wurstsorte, deren Name streng geheim gehalten und die auch niemals gefunden wird. Aber man war zufrieden, das Reisepublikum zu quälen, unnütz aufzuhalten und es die Macht der staatlichen Ordnung gehörig fühlen zu lassen. Feinhörige hörten den Fiskus förmlich vor Vergnügen quieken.
Zahlreiche maskierte und düster aussehende Figuren umringten die Reisenden und maßen nochmals sorgfältig die Gepäcksstücke ab. Dann musste man sich einer Chlorräucherung unterziehen, durch eine mit Karbolwasser gefüllte Pfütze schreiten, und dann wurden die also präparierten Ankömmlinge in einer geräumigen Postkutsche untergebracht, in deren Platzverteilung sich kein Mensch auskannte.
Pizzicollis Sitznachbar war ein sympathisch aussehender älterer Herr, der sich bald als Hofrat an der staatlichen Seidenschwanzbeobachtungsstation zu St. Lambrecht in Steiermark entpuppte.
„Denen Seidenschwänzen“, so begann der Würdige die Unterhaltung, „denen Seidenschwänzen kann man nicht trauen. Ja. So ist es. Nicht anderscht. Hören Sie: Wir sind in St. Lambrecht unserer Siebene. Keiner mehr, keiner weniger. Siebene. Tag und Nacht am Posten. Nachts recht mollige Schreibtische, was wahr ist, ist wahr! Sie wissen, dass die Seidenschwänze Unglück vorausverkünden. Sie können sich nichts Aufregenderes denken, als wenn plötzlich, in tiefschlafender Nacht, der Seidenschwanzbläser auf schaurigem Horn meldet, dass die besagten Unheilvögel dahergerauscht kommen …“
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!