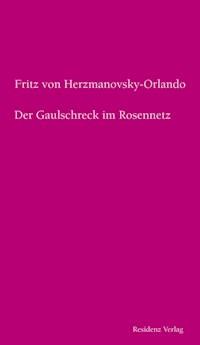Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Residenz
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wunderbar, sonderbar und endlich lieferbar! Die verrückte Welt eines Originalgenies: eine "Bizarrogroteske" über den Untergang der österreichischen Antike Scoglio Pomo heißt die kleine Felsinsel in der Adria, die unentdeckt geblieben wäre, ginge es bei Herzmanovsky-Orlando mit rechten Dingen zu. So aber dient Scoglio Pomo einer Gesellschaft debiler Graf Bobbys, überfressener Damen und holländischer Bohnenkönige als mondäner Kurort. Es geht bunt und prunkvoll zu in diesem sagenhaften Atlantis des liebenswert vertrottelten Österreichertums: Man pflegt seine Marotten und lebt seinen Spleen, man feiert Bälle auf Geisterschiffen, bis der Zauber endlich schwindet, dann liegt man im Wasser. Als die britische Flotte auch noch die letzten Reste der Märcheninsel in Trümmer schießt - ein bedauerlicher Irrtum - und dem greisen Kaiser sein Würstelfrühstück verdirbt, ist das Schicksal dieses Traumreichs endgültig besiegelt. Pomo ist eine Märcheninsel voll wunderlicher Geschichten, bevölkert von Sonderlingen von "eleganter Angetepschtheit". Hier gibt es wirklich nichts, was es nicht gibt! Fritz von Herzmanovsky-Orlando, das Genie der Groteske, ist längst ein Klassikaner der kakanischen Weltliteratur. "Scoglio Pomo", zu Lebzeiten des Autors unveröffentlicht geblieben, erscheint hier zum ersten Mal als Lesefassung in einer Einzelausgabe - ungekürzt, unverändert und in bibliophiler Ausstattung. Es bildet den Auftakt zu einer 4-bändigen Ausgabe seiner wichtigsten Werke.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 345
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Fritz von Herzmanovsky-Orlando
Scoglio Pomo
oder
Rout am Fliegenden Holländer
Roman
Herausgegeben vonKlaralinda Ma-Kircher
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek:
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in derDeutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografischeDaten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
www.residenzverlag.at
© 2007 Residenz Verlag
im Niederösterreichischen Pressehaus
Druck- und Verlagsgesellschaft mbH
St. Pölten – Salzburg – Wien
Alle Urheber- und Leistungsschutzrechte vorbehalten.
Keine unerlaubte Vervielfältigung!
ISBN ePub:
978-3-7017-4364-3
ISBN mobi:
978-2-7017-4407-7
ISBN Printausgabe:
978-3-7017-1469-8
1
Prunkvolles Sonnenlicht lagerte über Dalmatien. Wie ein Riesenspiegel von Saphir blaute die wogende See, beryllfarbig die Säume an den Küsten, in langen Zügen von schwanenweißen Schaumkronen durchfurcht. Wie goldfarbene Marmorschnitzereien erhoben sich da und dort Inseln mit purpurnen Schatten der Berge und Klüfte, vom Opalgeäder der Brandung eingefasst.
Des Meeres poseidonischer Duft war leicht vermischt mit den Wohlgerüchen des Rosmarins und der würzigen Kräuter, die auf den Inseln und den steilen Alpenmassen wuchsen, die hinter dem Küstensaum leuchteten.
Verwunderlich ist’s, dass ein so betriebsamer Kontinent wie Europa solch ein märchenhaft verträumtes Küstenland überhaupt haben kann. Nirgends spürt man das Verglühen Venedigs, ja, des antiken Rom und der Turbanzeit so stark wie hier.
Einen der sonderbarsten Punkte dieses Landes bewohnte die Familie Treo, venezianischer Provinzadel, eine Familie, die San Marco unzählige Kapitäne, perückengeschmückte Proveditori, liebreizende Donzellen und scharfmodellierte Matronen gegeben hatte.
Ihre Geschichte war wie durchweht von Teerduft und Pulverdampf, von Moder und orientalischen Essenzen, und so mancher Vorfahr war in prunkvollen Gemächern der Pest erlegen, auf brennenden Galeeren qualvoll verendet oder als Rudersklave der Türken elend verkommen. Denn so waren die Schicksale der Zeit zwischen dem Tode von Byzanz und dem wogenden Prunkreigen der Barocke, die das sinnverwirrende Märchenschloss ihrer Schönheit fast zu den Göttern emporzutürmen schien. Bis die Französische Revolution die trüben, krätzhalsigen Nachtvögel des Dämons der Finsternis losließ und eine Woge von Kommissknöpfen und Proletariern gebar, die dem Zaubermärchen ein Ende machten und schwere Dissonanzen schufen, die heute noch auf Europa lasten.
Damals verarmten die Treos vollkommen und hausten jetzt in einem verfallenen venezianischen Prachtbau, der sich in Porto Palazzo erhob, einem kleinen Hafen, welcher wiederum in den Trümmern einer weitläufigen römischen Palastanlage eingebaut ist.
In diesem Hause ging es seltsam her.
Feconda, die Ahne, verwendete, sparsam wie sie war, tagsüber statt der Haube eine Dogenkappe, die ihrem Vorfahr mütterlicherseits, dem großen Dandolo, gehört hatte, und wenn sie bei brennendem Sonnenglast in den golddurchfluteten Garten ging, wo starkduftende Suppenkräuter zwischen zerfallenen Marmorgöttern, Seeungeheuern und edlen Vasentrümmern wuchsen, trug sie einen verblichenen, breitkrempigen Kardinalshut aus weißlich gewordenem Purpur.
In diesem Feengarten, der überwuchert war von Rosen und Pelargonien, huschten Lazerten, die aussahen wie Juwelierarbeiten eines Circignani oder Benoni, durch das violette Dämmern der Schatten und führten glitzernde Tänze auf, so hold, dass man meinte, jeden Moment das Lachen der Nymphen zu hören. Doch die erschienen nicht, noch auch bockfüßige, feistbackige Panisken mit frivolem Lächeln, sondern bloß die Schar der ewig hungrigen Enkel, große und kleine. Da waren die Mädchen Kallirhoë und Tetis, Fillide, Gioconda, Omphale, Roxane, Pannychia, Argentina, Polyxena, Praxedis und die Rotte der Buben Triptolem, Triton, Polifemo und Triphon, Adamanto, Simeone, Hasdrubal und Giacinto.
Sie vollführten einen maßlosen Lärm, fraßen, was reif und unreif war, Blumen und Früchte, Meerspinnen und lebende Schnecken, schreiende Geckos und Tausendfüße, die kleine Kallirhoë sogar einmal etwas Dynamit, das Retirato, der alte, einäugige Chioggiot, zum Fischen in fremden Gewässern gebrauchte. Das leichtsinnige Kind wurde während der Inkubationszeit wie ein rohes Ei behandelt. Niemand durfte es stoßen, geschweige denn schlagen. Es war Kallirhoës überseligste Zeit. Nur das beeinträchtigte ihr Glück etwas, dass sie allein im Garten schlafen musste. Denn der Umstand, dass sie häufig aus dem Bette fiel, ließ ihren Aufenthalt in der baufälligen Palastruine nicht angängig erscheinen.
Die Kinder lernten blutwenig, war es doch mit dem Schulwesen auf der Insel gar elend bestellt. Dafür trieben sie sich umso mehr in den Wäldern voll Zedern, Zypressen und knorrigen Rieseneichen herum oder tauchten wie glänzende Fische durch die azurblaue Flut bis auf den antiken Marmorboden, der sich am Grund des Hafenbeckens befand. So floss ihr Leben sorglos dahin, während immer öfter graue Sorgen die Eltern und Feconda beschlichen. Was sollte aus ihnen werden, wenn das Schreckgespenst der modernen Zivilisation ihre Idylle mehr und mehr bedrohte?
Abends versammelte man sich zur gemeinsamen Mahlzeit, die aus großen Kupferkesseln im Saale des Palastes eingenommen wurde. Da gab es köstliche Speisen aus Meerkrebsen und Polypen, goldgelb in Öl gebacken, oder Gerichte aus Melanzanen und Kalbskaldaunen, reich mit Käse gewürzt. Buntes Obst und Honigwaben krönten das Mahl. Herber Rotwein brachte das erregte Lärmen bei Tisch zu immer tollerem Crescendo.
Unbekümmert um das menschliche Treiben blickten Götterbilder, große verwitterte Gemälde, auf die Nachkommen derer herab, die die Meisterwerke einst in den Glanztagen der Renaissance erwarben.
Da war Pluto, der auf üppigem Lager Proserpina umarmt. Zwei Amoretten halten den heftig bellenden Cerberus, aus dessen Mund ein Spruchband flattert: „SE VUOI CHE ENTRI NEL LETTO PLUTO MIO“. Auf einem anderen Bild sah Juno aus geteilten Wolken zu, wie Jupiter die Jo in Gestalt einer Kuh karessierte, einen Silbereimer mit dem Kampf der Lapithen und Kentauern in der Hand. Dieses Bild schmückte die zürnende Inschrift: „IO TI VEGGIO MARITO MI RIBALDO!“ Dort wieder küssen sich auf vergoldetem Prunkbett Mars und Venus auf lüsternste Weise. Der Amor mit Pfeil und Bogen steht dabei und spricht scherzend: „DEH CORCATEVI QUI MATRE MIA BELLA!“ In einer finstren Ecke endlich hing ein düstres Gemälde: Da fraß Saturn ein Stück einer Statue des Ulysses. Die holde Calypso reicht dem offenbar sehr Hungrigen den üppigen Busen zur Ablenkung, den er unfreundlich ablehnt. „VUOI INGOIARE SIFFATO QUESTO PARIDE MARMO“ stand darunter geschrieben.
Ja, die Treos waren einst reich, sehr reich gewesen. Was hatte allein die Brosche mit dem Jüngsten Gericht gekostet, die der berühmte Goldschmied Burcellono Scanabecchi, genannt Pozzoserrato, für die schöne Dichterin Zuzzeri, Dalmatiens Elektra, eine der Vorfahrinnen der Familie, vor Jahrhunderten gemacht hatte! Die Engel waren da aus blassen Korallen gebildet, der Heilige Geist ein Spinell, die Seelen der Verdammten hingegen aus schwarzem Achat.
Aber jetzt war all ihr Reichtum dahin. Nach dem Sturz der Republik waren ihre letzten Schiffe vermodert, ihre Besitzungen in der Levante enteignet worden, und bloß etwas war ihnen geblieben: der Scoglio Pomo, den sie vom großen Dandolo während des vierten Kreuzzuges zum Lehen bekommen hatten. Aber wo lag der? Unglücklicherweise waren alle Aufzeichnungen darüber verschwunden.
Umsonst durchstöberte man die Tagebücher venezianischer Marineure aus verflossenen Tagen und die alten Seekarten der Familie, wo eine Meernixe einen ertrinkenden Admiral notzüchtigte, ein Bild, das die Kinder immer mit glänzenden Augen verschlangen.
Nichts kam heraus! Auch Bonaventura Zemonico und Laus Deo Pakor, verwitterte Kapitäne und langerprobte Freunde der Familie, wussten nicht zu helfen. Freilich behaupteten böse Mäuler, dass die beiden sich auf hoher See nie recht ausgekannt hätten und oft wochenlang herumgekreuzt seien, ehe sie selbst Triest gefunden hätten.
Nun war auch im engsten Kreise der Familie Treo ein tüchtiger Nautiker gewesen, der Onkel Lazzaro, ein Bruder Fecondas. Zum Unglück war auf den Wackeren nicht recht zu zählen, weil ihn ein harter Schicksalsschlag seinem eigentlichen Berufe entfremdet hatte und sogar seinen Lebensabend in ein recht schiefes Licht tauchte.
Er, der einstmals im Karneval zu Neapel seine einzigen Zivilkleider in einer Maskenleihanstalt als Pfand gegen das Kostüm eines Skaramuzz gelassen, hatte das Malheur gehabt, nach durchschwärmter Nacht das Lokal von Banditen glatt ausgeraubt zu finden. Was blieb ihm andres übrig, als gute Miene zum bösen Spiel zu machen und sein Leben fortan als Skaramuzz schlecht und recht weiter zu fristen.
Jahrelang war seine auf ihre Reputation bedachte Familie deshalb mit ihm entzweit und heute, wo die Zeit Gras über die Wunden hatte wachsen lassen und man ihn sogar um seinen Rat anging, war er beruflich so verblödet, und seine vielleicht sachlich gemeinten Auskünfte so skaramuzzesk verzerrt, dass man den stark nach Käse duftenden, mit wilden Schriftzügen und sonderbaren Zerrbildern bedeckten Brief seufzend wegwerfen musste.
Ach, die vielen unversorgten Kinder! Was sollte nur aus denen werden! Ja früher, da kam alle paar Jahre die Pest, oder wurden wenigstens die Mädchen gerne von den Barbaresken geraubt, wenn sie sich nach dem Bade nackt in den Lorbeerhainen tummelten. Aber heute!
Noch zwei Onkel, Salvator Baucolich und Spiridion Papadachi, ebenfalls pensionierte Kapitäne, kramten bereitwilligst im reichen Schatze ihrer maritimen Erinnerungen, ohne je ein greifbares Resultat zu finden. Wie gerne hätten sie der Familie Treo geholfen, zumal die Großmutter, Proserpina Papadachi, deren Mann ein nicht übel gehendes Geschäft mit Fliegenklappen sein Eigen nannte, sehr gerne eine Verbindung ihres Enkels Chameleon Papadachi mit der drittjüngsten Tochter des Hauses Treo, Klytemnestra, gesehen hätte. Es war aber der krumme Papadachi, nicht sein Bruder, der sogenannte Adonis von Křevopolie, der später als zahmer Gorilla verkleidet einen förmlichen Siegeszug durch die Pariser Salons angetreten hatte und fast Präsident der Republik geworden wäre. Jedoch Locusta Bunjevac, die intimste Freundin der alten Feconda, redete ab, weil das Geschäft nicht standesgemäß sei. Onkel Baucolich wiederum, der eine kleine, leider nicht zum Besten gehende Fensterputzanstalt in Orsera betrieb, gedachte nach seinem Tode dem jungen Paar damit unter die Arme zu greifen. Die stolze Großmutter Treo war auch dagegen und behauptete, dass es in dem verfallenen Ruinenstädtchen überhaupt keine Fenster gebe, und sie hatte nicht Unrecht.
Überhaupt, Ehen mit Geschäftsmännern! Auch sie könnte heute eine reiche Frau sein, mit Equipage und Leibabbate, wenn sie seinerzeit den Werbungen des reichen Gemüsehändlers aus Girgenti, des bürgerlich-ordinären Giuseppe Peperoni nachgegeben hätte, oder des Großspediteurs Elephante aus Tarent mit dem blauen Frack und den geräumigen Nankinghosen um die kurzen Beine, der Nacht für Nacht vermittelst eines mauleselgezogenen Orchestrions ihr Ständchen gebracht hatte.
Noch eine letzte Hoffnung gab’s: den alten halbverschollenen Marinemaler Abraham Casembrot, der vor vielen Jahrzehnten mit einem Rotterdamer Käseschiff bei Messina gestrandet war. Dieser verwitterte Holländer studierte oft mit den alten verkommenen Kapitänen auf den großen Planiglobien herum, die mäusezerfressen und wurmzernagt im Palazzo standen. Sie machten zwar einen Lärm wie bei einem mittleren Seetreffen, aber ohne je auf einen grünen Zweig zu kommen. Dann starrten die fünf alten Herren meist ein Weilchen trüb vor sich hin, gingen aber dann an den Strand und tanzten als gespenstische Silhouetten nach Bergamasker Art zum Klange der buntfarbigen Lieder, die Papadachi seinem Dudelsack zu entlocken wusste. Oder Baucolich zeigte den jungen Damen den von seinem gottseligen Vater verfassten Taifunkatalog mit den graziösen Schäferszenen in feinstem Kupferstich. Waren die Herren aber recht guter Laune, dann verloren sie sich wohl in langen Seegeschichten. Von den wundertätigen Zoccoli des Heiligen Franziskus wussten sie zu erzählen, die die wildeste See beruhigten, als der heilige Mann von Neapel nach Spanien segelte, so fett waren sie. Oder von der blutigen Seeschlacht bei Paros, wo drei Brüder Pakor aus Zengg den Kapudan Pascha Tahabiti Bey erschlugen, als er gerade seinen schwarzen Kaffee am vergoldeten Heckbalkon des Admiralschiffes schlürfte. Der norwegische Seeheld Kurt Sievertsen führte damals die Venezianer zum Siege; sein Porträt hing noch im Palazzo, und die kleine Kallirhoë war ihm wie aus dem Gesichte geschnitten. Da hörten die Kinder auf zu fressen und hingen gespannt an den Mündern der salzigen Rhapsoden.
2
Nicht weit vom Adriatischen Meere, von diesem nur durch den schmalen Streifen der Grafschaften Görz und Gradiska getrennt, erhebt sich das Herzogtum Krain, ein Land, reich an stolzem Hochgebirg, dunklen Wäldern und unermesslichen Höhlen. Auch anmutige Seen und reiches Obstland mit zahlreichen Wallfahrtskirchen auf den Gipfeln dienen ihm zum Schmuck. Das Volk zeigt in seinen nichtdeutschen Teilen einen manchmal nicht ganz erfreulichen Slawencharakter; doch die germanische Hochkaste ist reich an originellen, ja selbst recht sonderbaren Herren, die nicht recht in das plattfüßige Getrampel der modernen Schwerkultur passen wollen. Es soll ab und zu – allerdings schon recht selten – vorkommen, dass blitzartig Ritter auftauchen, einen Wucherer ins Verlies werfen oder geschwind einen Handlungsreisenden überfallen; sie nehmen ihm wohl nie etwas weg, da sie im Unterbewusstsein nur nach Pfeffersäcken und Nürnberger Tand suchen. Im Gegenteil! Der heftig Gestikulierende wird noch beschenkt für den Schreck und reichlich geatzt. Aber die „werte Burg“ darf er niemals betreten, und diese Vorkommnisse werden dem Ausland gegenüber sorgfältig unterdrückt, da man schon bemerkt zu haben glaubt, dass das Haus Baedeker die feuerroten Ohren spitze. Und die Macht dieses Hauses ist so groß, eine solche, dass man mit ihr selbst dem blutigen Tyrannen Abdul Hamid so drohen konnte, dass er weinend zu Bett ging.
Mitten im wildesten Krain hauste auf einsamer Burg der Vetter Léo Baliol, ein eleganter junger Herr, der zum Smoking mit Vorliebe ein verwittertes Jägerhütel mit der Schneidfeder daran trug.
Öfter im Jahr fuhr er nach Wien, wo er in der Bristolbar zu treffen war, die er dem alten Stadtpalais seiner Tante, der Gräfin von Cilli, vorzog.
Der alten Dame, deren crève-cœur Léo war, machten er und seine zwei Brüder viel Kummer. Dem ältesten, dem Husarenoberleutnant, hatte die Tante des Öfteren seine bedeutenden Schulden gezahlt. Zuletzt nahm er mit den übrigbleibenden 100 Gulden einen Extrazug von Oberlaibach nach Laibach – man bedenke, wegen einer Station! – und war und blieb verschwunden. Dass er sich nach Konstantinopel gewendet habe und heulender Derwisch geworden sei, konnte man der überfrommen chanoinesse natürlich nicht erzählen. Das Nesthäkchen Léo hatte auch einmal eine böse Geschichte angerichtet: Konnte man es vielleicht der alten Dame verübeln, dass sie die „Bockerlfraß“ – eine außerhalb Wiens unbekannte nervöse Erscheinung – bekam, als sie vernahm, dass Léo bei Beginn des Burenkrieges „seiner entarteten Tante von England“ den Fehdehandschuh hinwarf. Als Pair von Schottland und ehemaliger König der Hebriden glaubte er sich zu dieser intimen Ansprache berechtigt. Lord Goschen, der britische Botschafter in Wien, kam damals mit wehendem Trauerflor am hellgrauen Zylinder händeringend zur Tante, da die alte Viktoria zum ersten Mal im Leben ganz ernüchtert sei und dies die bedenklichsten Folgen haben könne.
Léo blieb unerbittlich und exerzierte seine Freischaren Tag für Tag. Endlich steckte man sich hinter seinen intimsten Freund, Dillon des Grieux, der sein Schloss mehr gegen das Steirische zu hatte, und der, ein Deszendent der berühmten Manon Lescaut, Unsummen hinauswarf, um auszuforschen, wie der schurkische Steuerpächter G. M. mit vollem Namen hieß, der seine entzückende Vorfahrin so schändlich ruiniert hatte. Der Wunsch seines Lebens war, G. M.s Rechtsnachfolger im ritterlichen Tjost zu spießen und Manons Seele, die er sich in Guatemala drüben als zierlichen Kolibri dachte, Ruhe zu verschaffen.
Des Grieux lud ihn auf Auerochsen ein, um sich für die Steinbockjagd bei Baliols zu revanchieren, und Léo nahm an. Nach der Saison wurde der aber doch trübsinnig, weil er seine Ritterpflicht, für die Unterdrückten ins Feld zu ziehen, versäumt zu haben glaubte, und fischte in den finstern Felsendomen Grottenolme oder strich in den Steinwüsten des Hochgebirges umher. Dort flehte er in schwärmerischer Verzückung die heilige Jungfrau um Vergebung an, da sie als erhabenste Dame den Rittern fürsteht. Vielleicht könne er irgendein anderes gutes Werk verrichten, um sein Fehl zu büßen. Da geschah es einmal, dass sich zum Zittern der Kälte ein ganz sonderbares, von Léo noch nie gespürtes Gefühl gesellte. Vom Sonnengeflecht ging es aus, ein Gefühl wie Wonne, Jubel und Grauen, ein Gefühl, das man hat, wenn man dem Unfassbaren gegenübersteht. Er warf sich zu Boden und plötzlich kam er sich vor, als ob er in Lichtgarben schwömme. Jubelnde Stimmen ertönten, gleich sanften Fanfaren aus wunderlieblichen Kehlen. Er bebte in wonnigem Schauder, als er das nie Geahnte und doch wie fern Bekannte vernahm. Eine Flut von Gefühlen durchstürmte sein Inneres. Da – ganz deutlich – vernahm er eine Stimme von unbeschreiblichem Wohllaut, die so zu ihm sprach: „Léo! Weil du stets fromm und gut warst, soll deiner Familie geholfen werden.“
Der Baron erhob seinen Kopf, sah aber nichts mehr als einen Engel von unbeschreiblicher Schönheit, der ihm zuflüsterte: „Pomo, Seekarte XVII 103, Hölders Verlag, Wien“. Dann erfolgte ein Donnerschlag, der alles zerriss, und Léo blieb stundenlang bewusstlos liegen. Wie er wieder nach Hause gekommen war, darüber konnte er sich niemals Rechenschaft ablegen. Er fand sich jedenfalls auf dem großen Bärenfell vor dem Kamin in der Halle vor, mit zerfetztem Smoking und blutigen Lackschuhüberresten. Denn er war die ganze Zeit hindurch in Gesellschaftsdress gekleidet in die Einöden gegangen, weil er eine gewisse Ahnung hatte, dass er unvermutet eine überirdische Begegnung haben könne. Was „Pomo“ sei, war ihm durchaus ein Rätsel. Er fastete und betete acht Tage lang um Erleuchtung und suchte in allen Reisehandbüchern das erwähnte Wort. Die Firma Hölder in Wien, an die er sich telegraphisch wendete, bedeutete ihm, dass erst vorige Woche die fremden Attachés alle Seekarten gekauft hätten und er sich auf unbestimmte Zeit gedulden müsse. Da wandte er sich, wie immer in schweren Fällen, an das einzige reale Mitglied seiner Familie, an den Vetter Michelangelo bei der Landesregierung zu Laibach.
Michelangelo III., Freiherr von Zois, genannt Edelstein, fuhr sofort zu ihm und sprudelte heiser vor Erregung hervor, was für eine eminente Bedeutung der Fund habe. Mit leichter Bitternis ließ er in den Freudenkelch als Wermutstropfen das Wort „vom blinden Adler, der auch einmal eine Wurst aufs Kraut gefunden habe“, einfließen. Aber Léo überhörte das vornehm und bot dem Vetter Zigaretten an, die deshalb so süß schmeckten, weil der Sultan den Tabak mit Odaliskenblut düngen ließ. Sein Bruder, der heulende Derwisch, hatte sie ihm zum Nikolo geschenkt.
Die überglücklichen Treos wurden verständigt, Pomo nach stürmischer Fahrt unschwer gefunden und binnen wenigen Monaten vom eminent praktischen Baron Zois, der sofort in Pension gegangen war, zum schönsten Kurort Südeuropas umgewandelt. Der hatte wieder einmal seinem Prädikat „Edelstein“ Ehre gemacht.
3
Zu dieser Zeit geschah es, dass sich der junge Charles Borromée Howniak auf Reisen begab. Ch. B. H. war eher klein, ein wenig schief gewachsen, rothaarig und sommersprossig. Auch pfiff er beim Sprechen etwas durch die Nase, was den an und für sich fatalen Eindruck seiner Rede noch erhöhte. Er war ganz seiner Mutter nachgeraten, wie dies bei Söhnen nicht selten vorkommt.
Der Vater Howniak hatte nichts zu lachen, denn seine Gemahlin Hekuba war eine nervöse Dame mit stets erregt bebenden Nüstern. Ihr Benehmen war steif, dabei wieder unsicher, wie dies bei Leuten mit dürftiger Kinderstube vorzukommen pflegt. Für ihre kleine Abkunft sprach auch der Umstand Bände, dass sie eifrige Leserin des „Salonblattes“ war. Artikel wie „Sicherem Vernehmen nach hat Ihre Durchlaucht, die Frau Herzogin von Choiseul, schon den siebenten Kapuzineraffen für die Volière auf ihrem Manoir, berühmt durch die reichen Boiserien, gekauft“, konnten die Frau mit andächtiger Begeisterung erfüllen. Und gar die Abbildungen von Bräuten aus der Hocharistokratie, die oft so hässlich waren und so verblödet ausschauten, dass jeder gefühlvolle Mensch aus Verlegenheit für die Dargestellten am liebsten unter den Sesseln durchgekrochen wäre, konnten ihr Freudentränen erpressen.
Der junge Borromée wollte hoch hinaus. Das hatte er von der Mutterseite. Schon als Knabe – man hatte ihn unter unsäglichen Mühen ins exklusivste Institut, das Wiener Theresianum, gebracht – suchte er seinen aristokratischen Kameraden begreiflich zu machen, dass er einer französischen Emigrantenfamilie entstamme. Die Howniaks, ursprünglich Hovnac geschrieben, seien eine Seitenlinie der Ducs de Cognac, der Fezensac und so weiter.
Leider machte der Ordinarius der Klasse, ein gebürtiger Tscheche, wie die Deutschprofessoren in der Regel, dem Traum des jungen Gernegroß ein Ende und riss mit der wahrheitsgetreuen Übersetzung des Familiennamens dem stolzgeblähten kleinen Pfau die schönsten Schweiffedern aus. Sie ist so unschön, dass wir aus ästhetischen Gründen auf eine Wiedergabe verzichten müssen. Nach diesem Debakel litt es den Jüngling nicht länger in dem vornehmen Kolleg und fortan studierte er aus Hochmut überhaupt nichts mehr, was seine Mutter lebhaft unterstützte, da wirkliche Hocharistokraten auch wirklich nie etwas lernen. Dagegen beschloss er, möglichst bald zu heiraten, weil er Ehen in jungen Jahren für standesgemäß hielt. Allerdings dachte er nur an etwas ganz, aber schon ganz Exquisites. Sein Traum war eine Königstochter!
Als seine Jahre es erlaubten, ging er entschlossen auf die Suche. Seine gothaisch orientierte Nase führte ihn an den Traunsee. Dort gab es längs des ganzen Gestades depossedierte Herrscherfamilien in erklecklicher Zahl. Eine Einführung glückte nirgends, so viel Mühe sich der alte Kammerherr Baron Hormusaky, ein Freund von Howniaks Vater, auch gab. Borromée wurde verzagt und ließ die Unterlippe in einer Weise hängen, dass alles den jungen Mann bloß noch schmunzelnd betrachtete. Zu allem Unglück rief Hormusaky, der als Ungar die deutsche Sprache nicht ganz beherrschte, dem immer willensschwächer Werdenden einst vom Fenster zu: „Borromée, werde endlich mannbar!“, womit er natürlich „mannhaft“ meinte. Der laute Zuruf wurde vom promenierenden Publikum vernommen und Howniaks Ansehen der Lächerlichkeit dermaßen preisgegeben, dass er sich um ein anderes Feld der Tätigkeit umschauen musste.
„Rabenseifner ist mein Name. Vertrauen Sie sich mir vollkommen an, ich weiß alles“, sprudelte er hervor. „Professor Sherlock Drummsteak Rabenseifner, Professor of Christian Science“, fügte er mit wahrhaft infernalischem Lachen hinzu. „Haben Sie noch nie von mir gehört? Fall Strahlenberg-Uihazy ... nicht? Wiederhersteller des Familienglückes Dulemba-Vanciorovac ... nicht? Weiß alles! Cognac – Howniak – Fezensac? ... He?“
Jetzt strahlte plötzlich Borromäus und gewann sichtlich Interesse für den fatalen Infernaliker ihm gegenüber.
Der sprang auf, bückte sich blitzschnell nach dem Zylinder und rief, den Hut fahrig schwenkend: „Prinzgemahl Heil! Heil! Hören Sie! Ihre kühnsten, natürlich bloß selbstverständlichen Träume werden sich erfüllen ... garantiere schriftlich für Königstochter aus guter Familie ...“ Howniak glotzte fragend. „Ja, garantiere für fehltrittfreie ... ja, ... keine schwarze, nein europäische Königsfamilie, jawohl, ohne Buckel etc. – keine Balkanware – sofort greifbar, 25 Prozent jetzt, Rest der Vermittlungsgebühr in Akkreditivform bei beliebiger Bank, Gesamtbetrag fr. 100 000 in Gold. So.“ Tief aufatmend lehnte er sich zurück und fletschte mit gelben Zähnen nach dem Heiratslustigen.
„Mir unverständlich, so schnell ...“, murmelte der. „Nicht einmal Balkanware ...“ Auf einmal fuhr er auf und pfiff wie toll durch die Nase. „Ja, Herr, wie können Sie sich unterstehen! Ware! ... eine Kö-Kö... nix, nix ...“ Howniak stotterte vor Wut.
„O Pardon, o bitte tausendmal um Vergebung, o bitte ... Hitze des Gefechts – wollte selbstverständlich ‚Familie‘ sagen, ja, natürlich Balkanfamilie!“
Langsam beruhigte sich Howniak und wollte wissen, wer die „princesse“ denn sei. „Bitte, zuerst – entschuldigen schon – bitte, Geschäftsusance etc. – bitte zuerst bindenden Vorvertrag unterschreiben ... da bitte, nicht oben! Unten – so, danke; also hören bitte: Wir fahren sofort an Übernahmestelle, können, warten Sie, wenn wir den 11 Uhr 20 in Salzburg abgehenden Vliessinger Nachtexpress erwischen, morgen früh um 7 Uhr 12 in Triest sein, und nächsten Morgen, ja, in Pomo, wo Hoheit soeben zum Sommerséjour eingetroffen sind. Nein, noch kein Name – behalte mir angenehme Überraschung vor! ... Bitte auf! Keine Minute zu verlieren!“
Er klingelte und nahm die weitere Expedition in die Hand, den ganz Willenlosen vor sich herschiebend.
4
Übrigens waren Howniak und Rabenseifner nicht die zwei einzigen Reiselustigen, die über Salzburg nach Pomo dampfen wollten. Auch eine gewisse Frau Kličpera mit Fräulein Tochter war dort eingetroffen, um sich vorerst einige Tage in der schönen Mozartstadt von den Reisestrapazen zu erholen und Salzburg und Umgebung zu genießen. Den Vater Kličpera hatte der März desselben Jahres mitgenommen. Ein Schleimschlag hatte den Bedauernswerten jählings dahingerafft, nachdem er ihn schon zweimal vergeblich gestreift.
Er war ein korpulenter, rotgesichtiger Herr gewesen, der es liebte, gehobelten Meerrettich in der Westentasche bei sich zu tragen, um zum Beispiel auch im Theater zu den obligaten Zwischenaktswürsteln mit ordentlicher Ware versorgt zu sein. Gleich ihm hielt seine Familie viel auf Theaterbesuch und Bildung. So verfeinerte Menschen ertrugen natürlich Schicksalsschläge doppelt hart und mussten eine Erholungsreise nach dem Süden antreten, die der Mama Kličpera schon deshalb recht war, um ihre Tochter dem schlechten Einfluss einer Freundin zu entziehen. Diese hieß mit ihrem richtigen Namen Mitzi Pulkrabek, wurde aber wegen ihrer seltenen Niedertracht allgemein Sodomitzi genannt.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!