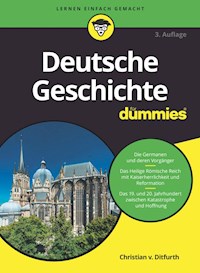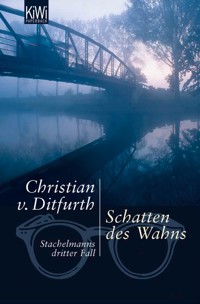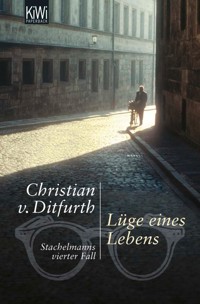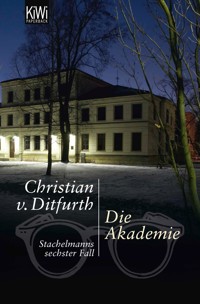Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Pendragon
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Geschichte erleben mit Spannung
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Moskau 2014: Der beste Agent des Bundesnachrichtendienstes stirbt bei einem Verkehrsunfall. Der BND schickt Theo Martenthaler, um die Leiche nach Deutschland zu überführen. Doch was als traurige Routinesache beginnt, endet in einem lebensgefährlichen Verwirrspiel der Geheimdienste. Ein hintergründiger Roman, der in die 1980er Jahre führt, als die Welt am Rand eines Atomkriegs stand.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 606
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Christian v. Ditfurth · Das Moskau-Spiel
Ein Verkehrsunfall in Moskau. Das Opfer: Georg Scheffer, der beste Spion des Bundesnachrichtendienstes in Russland. Der BND schickt Theo Martenthaler, um die Leiche nach Deutschland zu überführen. Ein Job für einen Nachwuchsagenten. Doch als Martenthaler die Leiche identifizieren will, drückt ihm die schöne Moskauer Rechtsmedizinerin Sonja Kustowa eine Urne in die Hand. Mit Scheffers Asche, wie sie behauptet. Ein Täuschungsmanöver des russischen Geheimdienstes FSB. Ist Scheffer wirklich tot? Was steckt hinter dem Verwirrspiel der Moskauer Behörden? Und warum gibt Sonja Kustowa Martenthaler bei einem Kneipenbesuch einen Tipp? Martenthaler löst das Rätsel und fliegt mit dem Beweis nach Hause: Der FSB hat Scheffer ermordet. Das glaubt er, bis er entdecken muss, dass er in die Falle getappt ist. Alles ist anders. Das Spiel ist viel größer, heimtückischer und gefährlicher, als Martenthaler es in seinen finstersten Albträumen gefürchtet hätte. Gekränkt und wütend reist er gegen den Willen des BND zurück nach Moskau. Auf sich allein gestellt und immer in Lebensgefahr, verstrickt er sich in den Intrigen seiner Feinde. Bis er auf eine Spur stößt, die in die Achtzigerjahre führt. Als die Welt am Rand des Atomkriegs stand. Und als Martenthalers Vater zusammen mit Georg Scheffer für den BND gegen die Sowjets in Moskau spionierte.
Wer hat gesagt, der klassische Spionagethriller sei tot? Virtuos und nie um eine überraschende Wendung verlegen, inszeniert Christian v. Ditfurth das Bild einer Welt, in der Wahrheit Lüge ist und Lüge Wahrheit. Der kalte Krieg ist längst nicht vorbei.
CHRISTIAN v. DITFURTH
DAS MOSKAU-
Prolog
Oberstleutnant Stanislaw Jewgrafowitsch Petrow saß mit halb geschlossenen Lidern auf seinem Stuhl und sog den Rauch seiner Zigarette ein. Er hielt den Rauch lange in seiner Lunge, dann atmete er stoßweise, aber gemächlich aus und setzte Wölkchen in die Luft. Er verfolgte sie mit seinen großen blaugrauen Augen. Petrow hatte einen hageren, länglichen, fast rechteckigen Schädel und lockige dunkelbraune Haare. Ein Hauch von Melancholie umgebe ihn, hatte eine Genossin einmal gesagt. Seine Soldaten im Bunker 15 von Serpuchow südlich Moskaus kannten ihn als einen Offizier, der nicht viel redete und dem es lächerlich erschienen wäre, markige Sprüche abzusondern, wie das so viele andere Offiziere der ruhmreichen Sowjetarmee taten.
Seine Soldaten behelligten ihn nicht, wenn er in der Nacht auf der zweiten Ebene des dunklen Kontrollraums auf seinem Stuhl zu dösen schien. In Wahrheit war er wie eine Katze, die im Dämmerschlaf jedes Geräusch hörte und jede Bewegung wahrnahm. Im Notfall würde Petrow in Sekundenbruchteilen tun, was die von ihm selbst verfasste Vorschrift einem diensthabenden Offizier in einem Bunker des sowjetischen Raketenfrühwarnsystems befahl. Es sollte Moskau so schnell wie möglich vor einem amerikanischen Atomraketenangriff warnen, um dem Generalsekretär Andropow und dem Generalstab Zeit zum Gegenschlag zu geben. Fünfundzwanzig Minuten. In diesem Bunker liefen die Datenströme der Aufklärungssatelliten zusammen, der Augen des sowjetischen Weltreichs.
»Wenn wir versagen, wird die Heimat vernichtet und der Feind überlebt«, hatte Petrow seinen Soldaten erklärt, als er vor gut zwei Jahren nach Serpuchow versetzt worden war. »Wenn wir nicht versagen, wird unsere Heimat vernichtet und der Feind auch.« Er erinnerte sich noch gut an die verdutzten Gesichter seiner Untergebenen. Aber wenn die Amerikaner die Dinge ähnlich sahen, würden sie nicht versuchen, einen Atomkrieg zu gewinnen. Doch genau mit dieser Verlockung spielten manche Experten und Politiker im Westen. Ganz öffentlich, und wer wusste, was sie unter Ausschluss der Öffentlichkeit besprachen? Das schrieb die Presse, das meldeten Auslandsberichterstatter im Fernsehen. Für den neuen amerikanischen Präsidenten war die Sowjetunion das Reich des Bösen. Das Böse aber muss vernichtet werden. Immer und überall. Deshalb hatte die sowjetische Militärführung die Offiziere der Raketenstreitkräfte, der Luftwaffe und der Überwachungsstationen zu größter Wachsamkeit vergattert. Der Feind plane einen Angriff. Er fühle sich überlegen. Er wittere seine Chance. Für ihn sei die Sowjetunion eine historische Fehlentwicklung, die er berichtigen wolle. Wie der General bei der letzten Inspektion hatte durchblicken lassen, sammelten die Kundschafter an der unsichtbaren Front überall im Westen Informationen, die bewiesen, was die Moskauer Führung befürchtete.
Petrow ließ sich nicht viel vormachen, aber dass die Stimmung in der politischen und militärischen Führung umgeschlagen war, dass es nicht nur Propagandageschwätz über den stets aggressiven US-Imperialismus war wie sonst, sondern Angst, wirkliche Angst, das spürte er. Er hatte ein Gefühl für Stimmungen. Die waberten von der Führung hinunter in die Partei- und Staatsorgane wie Nebelschwaden.
Meistens durchschaute er die Propaganda, dieses Gespinst aus Lügen, Wahrheiten und Halbwahrheiten, mit dem man den Feind bearbeitete und das eigene Volk anspornte. An allen Unbilden im Sowjetlager war der Feind schuld. Wenn sich irgendwo ein Volk erhob gegen die Parteiherrschaft, wie in der DDR, Ungarn, Polen, der Tschechoslowakei, so steckte der Feind dahinter. Natürlich, man musste den Feind unter Feuer halten, man musste ihn einschüchtern, man musste vielleicht auch mal die Panzer rollen lassen, doch Petrow hatte längst begriffen, dass es sich einige ganz oben etwas zu leicht machten.
Aber diesmal war es ernst.
Manchen Tag schlief er schlecht. Er träumte vom eigenen Versagen, wie er die blinkenden Zeichen auf den Kontrollmonitoren falsch deutete, wie die Trümmer von Moskau in einer Feuersbrunst versanken und zusammengeschmolzen wurden, zuletzt der Turm der Lomonossow-Universität. Seltsamerweise. Nicht weniger erschreckend erschien ihm die Vorstellung, dass ein einziger Raketensprengkopf, der über Moskau explodierte, genügen könnte, sämtliche Befehlsstrukturen lahmzulegen und das Land wehrlos zu machen. Der elektromagnetische Impuls, jenes so rätselhafte wie wissenschaftlich bewiesene Phänomen: die Ausschaltung des Feindes, indem man alle Elektronik auf einen Schlag zerstörte. Da säßen dann die Führer der mächtigen Sowjetunion in ihrem Bunker, und sie würden nichts erfahren von dem, was außerhalb ihrer Betonfestung vor sich ging, und sie konnten niemanden dort draußen mehr erreichen und niemandem mehr etwas befehlen. Bis Verbindungen wiederhergestellt wären, bis die Raketenstreitkräfte den Gegenschlag einleiten könnten, wäre es zu spät, weil die USA bis dahin die Raketensilos und Bomber zerstört hätten. Er sah Menschen vor sich, die Mutter, die Schwester, die Verkäuferin in dem Laden, die ihm gestern verschämt zugelächelt hatte, den Jungen, der mit einem fast luftleeren Fußball die Fensterscheibe des Schuppens zerschossen und mit dem Petrow einen unausgesprochenen Schweigepakt geschlossen hatte, bekräftigt nur durch ein Blinzeln mit beiden Augen, was der Kleine erst mit einem Staunen und dann mit einem strahlenden Lächeln quittiert hatte. Überhaupt die schreienden, lachenden, plärrenden und sich prügelnden Kinder auf dem Schulhof in der Nachbarschaft, welche die sowjetische Disziplin erst noch lernen mussten. Die alten Frauen, die mühsam die Bürgersteige entlanghumpelten und immer eine Tasche trugen. Die Veteranen, die ihre Orden vom letzten Krieg stolz herzeigten, weil sie außer dem Stolz und der jährlichen Parade nichts bekommen hatten. Die schönen jungen Frauen, die im GUM nach Kleidern suchten und zu oft unzufrieden wieder nach Hause gingen. Sie und alle anderen würden zerfetzt und zu Asche verbrannt und vom Feuersturm über die Todesäcker verbreitet, die einmal Städte gewesen waren. Petrow hatte Dokumentarfilme über die Atombombenabwürfe über Hiroshima und Nagasaki gesehen, und er wusste, dass jeder einzelne Sprengkopf unter den vielen Tausenden Mehrfachsprengköpfen, die von den Raketen fast punktgenau ins Ziel befördert wurden, ungleich größere Zerstörungen anrichten würde als die beiden Bomben über Japan.
Er drückte die Zigarette aus und linste auf den Bildschirm vor sich. Flimmernde weiße Schrift auf dunkelgrauem Hintergrund. Wenn er die Schrift lange anstarrte, bekam er Kopfschmerzen.
23 Uhr 57, 25. September 1983, zeigte die Uhr auf dem Schreibtisch an.
Er zündete sich eine weitere Zigarette an, stand auf und ging eine Runde. So, wie er es jedes Mal um diese Zeit tat, wenn die Müdigkeit nach ihm griff. Er schaute sich um, wie seine Leute die Zeit totschlugen. Hauptmann Sokolow, sein Stellvertreter, las wie immer in einem Roman, aber mit einem Auge verfolgte er den Computerbildschirm vor seiner Nase. Lesen im Dienst widersprach den Vorschriften, doch Sokolow hielt sich so wach, ohne seine Aufgabe auch nur eine Sekunde zu vernachlässigen. Leutnant Kirow, der Computerexperte, bearbeitete seine Tastatur. Kirow war ein brillanter Kopf, viel zu schade fürs Militär. Viel zu klug, um in einem muffigen Bunker herumzusitzen. Petrow schaute Kirow über die Schulter, aber er konnte nichts anfangen mit den kryptischen Befehlen, die der Leutnant in den Computer eingab.
Die Tür zum Nebenraum war angelehnt. Dort saßen vier Soldaten, bewaffnet mit AK-47-Sturmgewehren, die den Bunker zu bewachen hatten. Um den Bunker herum war ein Stacheldrahtverhau, der oben und in der Mitte von einem Starkstrom leitenden Draht gesichert wurde. Am Tor standen zwei Soldaten. Vier weitere patrouillierten in Zweierstreifen entlang des Zauns. Zu viel für einen einsamen Bunker südlich von Moskau. Zu wenig, um ein gut geplantes Kommandounternehmen des Feindes abzuwehren. Wenn es dem gelang, unbemerkt in den Luftraum einzudringen, was als unmöglich galt. Allerdings hatte Petrow da seine Zweifel. Das Radar reichte nicht weit genug. Wenn es Raketen im Flug anzeigte, war es für eine Reaktion fast schon zu spät. Es blieben nur Minuten. Deshalb hatten sie das Satellitenfrühwarnsystem gebaut, das die US-Atomraketenbunker vierundzwanzig Stunden am Tag überwachte. Seitdem hatten sie nicht mehr zwölf Minuten Zeit, auf einen Raketenangriff zu reagieren, sondern eine knappe Viertelstunde länger. Milliarden von Rubeln für eine knappe Viertelstunde.
Vor drei Wochen hatte die Luftwaffe dieses südkoreanische Spionageflugzeug über Sachalin abgeschossen. Vielleicht war es doch eine Passagiermaschine auf Irrwegen gewesen, wie die Propaganda des Westens behauptete, die Petrow in den stark gestörten Radiosendungen gehört hatte. Doch Petrow wusste auch, dass US-Bomber sich seit einiger Zeit immer wieder dem sowjetischen Luftraum gefährlich näherten. Provokationen. Sie testeten die Luftabwehr. Da dürfen die sich nicht wundern, wenn wir schießen. Sie legen es darauf an. Was zu viel ist, ist zu viel.
Petrow fuhr zusammen, als die Alarmsirene heulte. An der Kontrollwand blinkte in roter Schrift ein Wort: Start. Sie hatten es vorher nie gesehen. Sokolow und Kirow starrten ihn an. Die Farbe wich aus ihren Gesichtern. Kirows Stirn war mit einem Schlag von Schweißperlen übersät. Sokolows Mund stand halb offen. Auf dem Radarschirm ein Punkt, der sich schnell bewegte. Eine Interkontinentalrakete. Richtung Moskau. Eine Minuteman II, deren Sprengkopf durchs All raste.
Petrow war plötzlich klatschnass am ganzen Körper. Was tun? Die Vorschrift forderte, die Meldung über eine Direktleitung an den Generalstab und Andropow weiterzugeben. Keine Zeit, das Politbüro einzuschalten oder gar den Obersten Sowjet. Die Militärführung würde binnen weniger Minuten allein entscheiden müssen, ob die Interkontinental- und Mittelstreckenraketen der Sowjetunion, land- und seegestützt, gestartet werden sollten, um die einprogrammierten Ziele in den USA und Westeuropa zu vernichten, damit das Territorium der Feindstaaten in ein verstrahltes Trümmerfeld verwandelt wurde, in dem auf Jahrhunderte niemand würde leben können. Die Vorschrift verlangte, die eigenen Raketen zu starten, bevor der Feind sie zerstören konnte. Bevor die Sowjetunion vernichtet und wehrlos war.
Petrow nahm den Telefonhörer, hielt ihn eine Weile in der Hand, dann legte er wieder auf. Sokolow beobachtete, was Petrow tat, sagte aber nichts. Er hätte angerufen, was sonst? Kriegsgericht?
Aber Petrow dachte: Wenn der Feind angriff, dann doch nicht mit einer einzigen Rakete, die zwangsläufig den tödlichen Gegenschlag auslösen musste. Nein. Selbstmord würden die Imperialisten nicht begehen. Das war ein Fehlalarm. Wenn er nach Moskau meldete, was seine Augen sahen, würde Panik herrschen. Panik war ein gefährlicher Berater. Der Weg in den Tod.
Sie starrten. Endlich verschwand der Punkt vom Schirm. Petrow schnaufte durch und schaltete die Sirene aus.
Sokolow und Kirow starrten ihn immer noch an. Sokolow wischte sich mit dem Ärmel über die Stirn.
»Fehlalarm«, flüsterte Petrow.
Kirow lachte, etwas zu laut. Sokolow prustete.
Petrow überlegte, wie er die Meldung über diesen Vorfall abfassen konnte, ohne in Teufels Küche zu kommen. Er habe sofort erkannt, dass es ein Satellitenfehler gewesen sei. Kein Grund, die Führung zu alarmieren. Kein Grund, Unruhe zu schaffen. Wir haben Wichtigeres zu tun.
Wir schützen die Sowjetunion.
Er wusste natürlich, dass nicht nur er über diesen Vorfall berichten würde. Selbstverständlich arbeitete einer der Genossen im Bunker für die GRU, den Geheimdienst der Sowjetarmee.
Die Sirene. Wieder die Sirene. Wieder ein Punkt auf dem Schirm. Sokolow und Kirow zuckten zusammen. Petrow erstarrte.
Er zwang sich, ruhig zu bleiben. In Windeseile durchdachte er alle Möglichkeiten, die in den Vorschriften standen und die ihm seine Fantasie vorschlug. Er schaute auf den Punkt, und als auch der verschwand, schaltete er die Sirene aus und nahm den Telefonhörer, um einen Fehlalarm nach Moskau zu melden. Kaum hatte er den Hörer in der Hand, heulte es wieder und dann noch zwei Mal. Fünf Raketen.
Wenn er fünf Raketen meldete, mindestens fünf Raketen, wie hoch war die Wahrscheinlichkeit, dass die Führung den Gegenschlag auslöste? Er stellte sich die erregte Debatte im Generalstab vor. Wer hatte dort gerade Dienst? Wer entschied wirklich? Fünf Atomraketen würden Moskau pulverisieren. Kaum Zeit, sich in die Bunker zu flüchten. Der Enthauptungsschlag, der die Sowjetführung ausschaltete. Der gigantische elektromagnetische Impuls, der alle Kommunikations- und Überwachungseinrichtungen lähmte.
Petrow konnte nicht übersehen, was der Bildschirm ihm zeigte. Was, verdammt, sollte er tun in diesem Augenblick, in dem der Wahnsinn den teuflischen Beschluss gefasst hatte, dass er, Oberstleutnant Stanislaw Jewgrafowitsch Petrow, über das Schicksal der Erde entschied? Er, der heute gar nicht hier sein sollte, sondern einen kranken Genossen vertrat. Petrow dachte an seine Mutter, die in einer ärmlichen Datscha am Ostrand von Moskau hauste, an den Vater, der an Spätfolgen einer Kriegsverletzung unter unerträglichen Schmerzen zugrunde gegangen war. An die Schwester, die sich frisch verliebt hatte nach einer kaputten Ehe mit einem versoffenen Taugenichts. Auch wenn seine Untergebenen ihn erwartungsvoll und ängstlich anstarrten, war Petrow allein, einsamer, als je ein Mensch gewesen war.
1
»Da ist was im Busch.« Klein hob die Unterarme, die Ellbogen blieben auf den Lehnen seines ledernen Chefsessels liegen, seine Handflächen zeigten zum Gegenüber. »Was im Busch. Und sie klopfen drauf.« Er klopfte mit den Händen leicht auf den Tisch. Ein doppelter Ehering. Mit schmalen Augen starrte er den noch jungen Mann mit dem Intellektuellengesicht an, der ihm gegenübersaß, so, wie er es immer tat, wenn ihm etwas wichtig war. Wenn er eine Antwort suchte. Zum Spalt zusammengekniffene Augen in einem knochigen Kopf. Augen, die noch nie gelächelt haben konnten. In denen man lesen mochte, wie hart einer werden musste, der überlebt hatte. Die Angriffe des Feindes, die Machtkämpfe im Dienst, die Intrigen, den Verrat. Und Klein war einer, der es schätzte, hart zu sein.
Den Verrat.
»Irgendwas.« Er streckte sich ein wenig, öffnete die Augen, hob die Augenbrauen, senkte sie, hob sie wieder. Augenbrauengymnastik. »Und wir wissen nicht, was.« Er schaute sein Gegenüber an, als müsste der es wissen. Als wäre es eine Enttäuschung, wenn er es nicht wüsste. Er knetete Luft mit den Händen. Dann erst lüftete er das Geheimnis: »Scheffer ist tot. Autounfall. Am Ismailowopark, in der Nähe von den Hotelblocks, Sie kennen die. Mit den griechischen Blocknamen.« Er sagte es beiläufig.
Scheffer war tot. Autounfall.
»Sagt die Miliz.«
Die Moskauer Miliz sagt viel oder nichts. Und immer das, was ihr vorgeschrieben wird.
Autounfall.
Theo Martenthaler ließ seine Augen durch die runden Brillengläser die Wand hinter Klein entlangwandern. Ein Regal mit Vorschriften, Gesetzestexten und ein paar Büchern über Osteuropa und Russland. An der Wand ein Landschaftsaquarell, in der Ecke Sessel, grau bezogen, um einen runden Glastisch. Der Blick durch das breite Fenster zeigte Schwärme winziger Schneeflocken, die der Wind fast waagerecht vor sich hertrieb. Weit hinten erkannte man die Mauer, die das BND-Gelände in München-Pullach abschirmte. Hinter der sich schon Gehlen versteckt hatte, nachdem er an einem 6. Dezember hier eingezogen war. Hinter der Felfe gewühlt hatte, der Maulwurf aus dem Osten. Theo Martenthaler hatte schon so oft in Sankt Nikolaus gesessen.
Er schaute auf Klein, der in den vergangenen sieben Jahren darauf geachtet hatte, dass Theo alles lernte, was ein Spionageprofi beherrschen musste. Klein hatte den Kopf zurückgelehnt und presste die Fäuste zusammen. Martenthaler hatte ihn nur einmal so erlebt. Als Kleins Frau gestorben war. Krebs, hieß es. Aber Klein hatte kein Wort darüber verloren.
Autounfall am Ismailowopark. Scheffer tot.
Martenthaler kannte die Betonblöcke. Hotels der Standardkategorie. Teils renoviert, teils noch Sowjetstil. Blick auf den Park mit dem See. Am Horizont, hinter dem Wald, endlose Plattenbauten. Im Wald eine Zwiebelturmkirche, drei Türme. Jeden Morgen ein anderer Sonnenaufgang, mal als Licht hinter einer Wand dunkler Wolken, mal als Feuerkugel am klaren Horizont über dem Wald, der die Feuchtigkeit der Nacht ausdampfte, mal als im Dunst gebrochene weiße Strahlung, die einem in den Augen schmerzte.
Theo Martenthaler war vor acht Monaten aus Moskau zurückgekehrt. Sein erster gefährlicher Einsatz. Zuvor war er in Rom und Lissabon gewesen, Fingerübungen, Geplänkel, langweilig. Klein hatte ihm Zeit gegeben zu lernen, nachdem er gleich nach dem Studium – Politologie, Osteuropäische Geschichte – an der Berliner Humboldt-Universität beim BND angeheuert hatte. Theo sei in die Fußstapfen des Vaters getreten, hatte Klein einmal gesagt. Er hatte es nicht gewollt, das jedenfalls redete Theo sich ein. Aber irgendwie war er dann doch dabei. Große Fußstapfen. In Russland hatte Theo den alten Scheffer wiedergetroffen und mit ihm zusammen das Chaos in der BND-Residentur geklärt. Georg Scheffer war ein perfekter Agentenführer gewesen, aber eine Residentur leiten, das konnte er nicht. In der freien Wildbahn machte ihm niemand etwas vor, er war fürs Täuschen und Tarnen geboren. Am Schreibtisch aber drohte er zu ersticken, sank seine Laune auf den Nullpunkt.
Scheffer hatte ihn in Moskau natürlich gleich auf seinen Vater angesprochen, und Theo erinnerte sich sogar an frühere Zeiten, wenn auch etwas nebelig. Und dann hatte Scheffer Theo getroffen mit einer lapidaren Bemerkung: »Wie der Vater, so der Sohn.« Gewiss wusste Scheffer nichts von dem Familienzerwürfnis. Oder wusste er es doch? Hatte er Kontakt zu Henri gehabt oder es sonst wie erfahren? Hatte er sich dazu eine eigene Psychologie gestrickt: Mag schon sein, dass du deinen Vater verabscheust oder wenigstens nicht viel mit ihm anfangen kannst? Die Wahrheit, mein Lieber, die findet man aber nicht auf der Oberfläche, sondern viel tiefer, als du ahnst. So tief, wie du es nicht einmal befürchtest. Immerhin, in Theo war schon hin und wieder die Idee aufgeschienen, er könne trotz allem seinem Vater mehr ähneln, als ihm lieb war. Er könne sogar versuchen, ihm das zu beweisen. Ihm auch zu zeigen, dass er diesen Job genauso gut, wenigstens genauso gut, beherrschen könne. Vielleicht war sein Leben nichts anderes als ein Wettlauf gegen den Vater. Doch diese Gedanken hatte er immer schnell unterdrückt. Scheffer aber hatte mit einem Satz den Deckel angehoben.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!