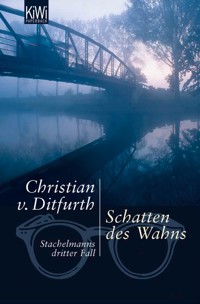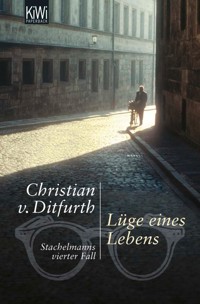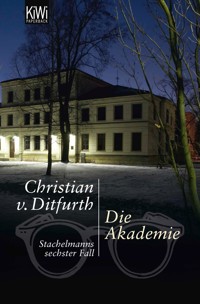
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Stachelmann ermittelt
- Sprache: Deutsch
Einer unsichtbaren politischen Macht auf der Spur Er recherchiere über eine gigantische Verschwörung. Mehr wollte der Leipziger Historiker Heinz Rehmer seinem Ex-Kollegen Stachelmann beim Abendessen nicht erzählen. Am nächsten Morgen liegt seine Leiche im Berliner Bundesarchiv. Stachelmann lässt Rehmers Andeutung keine Ruhe: Hat sie etwas mit dem Mord zu tun? Akribisch prüft Stachelmann zusammen mit seinem Helfer Georgie die Akten, die Rehmer bestellt hatte. Doch die Mühe ist umsonst. Als Stachelmann schon aufgeben will, bedroht ihn ein Unbekannter mit einer Pistole. Dann verschwindet Georgie spurlos. Und die Polizei stößt in Leipzig auf einen Institutschef, der Rehmer so bald wie möglich loswerden wollte. Ein Verwirrspiel, in dem nichts zusammenpasst. Am Ende bleibt Stachelmann nur eine Chance: Rehmers Mörder zu finden, bevor er selbst dessen nächstes Opfer wird. Der sympathischste Versager unter den Detektiven wieder auf den Spuren deutscher Vergangenheit – für Krimifans, die sich auch für Politik und Geschichte interessieren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 538
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
» Buch lesen
» Dank
» Das Buch
» Der Autor
» Impressum
Für Franziska
[Menü]
1
Er genoss diesen Blick auf die Spree und hinüber zum Charlottenburger Schloss seit vielen Jahren. Das Wasser am Bonhoefferufer schimmerte heute grün. Am Himmel zogen dunkle Wolken gemächlich nach Westen. Es hatte viel geregnet in den letzten Tagen, der Herbst hatte sich sonnig angekündigt, als wollte er die Menschen täuschen über seinen Charakter, und dann war er umgeschlagen und brachte Kälte, Regen und Wind, wie es sich gehörte.
Heinrich Walzer stand an der Fensterfront seines großzügigen Büros, wie immer perfekt gekleidet, dunkelgrauer Anzug eines italienischen Edelschneiders, an den Füßen schwarze Maßschuhe aus der Züricher Bahnhofstraße, ein dezent roter Schlips auf hellblauem Hemd, der obere Knopf geschlossen. Walzer wippte auf den Fußballen und straffte seinen Körper. Er hatte ein narbiges Gesicht, späte Spuren einer schweren Akne, eine breite Nase, kurz geschnittene schwarze Haare, darin verwoben graue Fäden. Seine graublauen Augen strahlten Vertrauenswürdigkeit aus. Die meisten beschrieben ihn als einen sympathischen Mann. Und in der Tat war er ein ruhiger Zeitgenosse, zu dessen wichtigsten Eigenschaften es gehörte, dass er zuhören konnte, was seine natürliche Autorität nur unterstrich.
Auf seinem Schreibtisch, Rauchglas auf einem Stahlgestell, links und rechts Stahlcontainer auf Rollen, stand ein zierlicher Bilderrahmen, eine schöne Frau mit langen schwarzen Haaren und zwei hübsche Kinder, lachend.
Er schaute auf die Speedmaster, die er am Stahlarmband trug. In diesem Augenblick klopfte es an der Tür, und sie öffnete sich, ohne dass Walzer etwas gesagt hatte. Herein trat ein mittelgroßer Mann, etwas untersetzt, nervöses Gesicht.
»Karl, schön, dass Sie gekommen sind. Bitte.« Walzer hatte eine tiefe Stimme, ohne dass sie dröhnte. Er deutete auf die Sitzecke und ging dorthin.
Der andere, brauner Anzug, braune Haare, braune Schuhe, unscheinbar, kannte sich aus in dem Büro, und er bewegte sich selbstverständlich darin. Sein Nachname war Ammann, ein promovierter Jurist.
Als beide saßen, kam eine Frau herein, in der Hand ein Tablett. Ein Glas mit Wasser, eine Tasse Tee. Die Frau nickte Ammann zu, der nickte zurück, ohne sie wirklich anzuschauen. Sie war zurückhaltend geschminkt und sonst seltsam grau.
»Ich habe den Vierteljahresbericht gelesen«, sagte Walzer freundlich. »Er ist wie immer ein Meisterwerk der Präzision.« Er zog zwei silbrig glänzende Kugeln aus der Jacketttasche und ließ sie zwischen den Fingern einer Hand wandern, ruhig, fast meditativ.
Der andere verzog keine Miene.
»Die Bildungsprogramme laufen, wie wir es uns vorgestellt hatten. Die meisten Beteiligungen werfen Gewinne ab trotz der Krise. Wir konnten die Zahl unserer Stipendien erhöhen. Es ist eigentlich alles in Ordnung, so, wie im Prinzip seit Ihrem Amtsantritt immer alles in Ordnung war.« Er machte eine kurze Pause. »Vielen Dank, Herr Generalsekretär.« Die Stimme klang jetzt ein bisschen offiziell.
»Ich habe zu danken, Herr Präsident.«
Walzer lächelte, er tat dies sehr einnehmend. »Ein Ärgernis allerdings bleibt. Wir hatten im Vorstand beschlossen, diese Sache der operativen Abteilung zu übertragen. Wie gut, dass sie noch besteht. Sie erinnern sich, da gab es ja Versuche …«
Ammann rutschte ein bisschen hin und her, trank einen Schluck Tee und nickte fast versonnen. »Ich glaube, wir müssen uns keine Sorgen machen. Es ist alles vorbereitet.«
Walzer lächelte. »Wie gut, dass wir immer mit so etwas gerechnet hatten.«
»Wie gut, dass Sie mit so etwas gerechnet hatten«, sagte Ammann sachlich. Es war die Wahrheit, nicht mehr und nicht weniger. Nie hatte die Akademie einen besseren Präsidenten gehabt. Ammann erinnerte sich gut an die große Schlacht, wie er sie nannte, als die Fraktionen in der Akademie aufeinandergeprallt waren wie die Streitwagen antiker Heere und keine Zukunft wartete, am Himmel nicht und sonst auch nirgendwo. Bis Walzer, der Neue, zum richtigen Zeitpunkt, eine Minute früher oder später wäre verheerend gewesen, ihnen allen den Weg wies, auch wenn manche ein, zwei Jahre brauchten, um zu begreifen, wohin es ging.
Aber das war graue Vorzeit.
***
»Sie sind doch Herr Stachelmann?«, flüsterte es.
Da stand ein kleiner, dürrer Mann mit einem Knochenschädel vor ihm, auf der erstaunlich großen Nase eine Hornbrille mit dicken, fast milchigen Gläsern. Stachelmann überlegte fieberhaft, wer es sein könnte. Ja, er hatte ihn schon mal gesehen, sie hatten sogar miteinander gesprochen. Irgendwo, irgendwann. Stachelmann erhob sich und reichte dem Mann die Hand. Dessen Händedruck war schwach, und er zog seine Hand schnell zurück, als hätte er Angst, sie zu verlieren.
»Rehmer mein Name, Sie« – ein unruhiger Blick, dann zog er Stachelmann ungeduldig am Ellbogen aus dem Lesesaal – »werden sich vielleicht nicht mehr erinnern. Wir haben uns vor Jahren hier getroffen und auch auf diesem Kongress … was war das noch mal für einer? Ach, da wo Bohming, das war doch Ihr Chef, diese Rede hielt … Funktionalismus, Intentionalismus, Zivilisationsbruch – historische Interpretationen des Nationalsozialismus.« Er referierte es eintönig. Die Glastür schloss sich automatisch, und sie standen im Flur. An den Wänden Schaukästen, rechts neben dem Zugang zur Treppe, die zu den Mitarbeiterbüros führte, das Telefon mit der Nummernliste.
Von draußen kam ein junger Mann herein, offenbar ein Student. Während er vorbeieilte, um dann nach rechts in den Gang abzubiegen, zog er eine unsichtbare Wolke aus Zigarettenrauch hinter sich her.
»Ich habe gehört, Sie haben die Universität verlassen … man hat ja einiges gehört über Hamburg, diese … Geschichte mit Bohming.«
»Ja, ja«, erwiderte Stachelmann und hoffte, der andere hörte heraus, dass ihn dessen Neugier nervte. Außerdem erinnerte er sich an Bohmings Anmaßung, der seine Assistenten immer ausgenutzt hatte, auch für diesen aufgeblasenen Vortrag. »Das ist ja schon eine Weile her, und ich weiß von den näheren Umständen wenig bis nichts.«
»Ach, wirklich?« Rehmer legte seine Stirn in Falten und schaute Stachelmann mit leicht zur Seite geneigtem Kopf in die Augen.
»Ich war … praktisch schon weg, als das mit Bohming passierte«, log Stachelmann.
»Jedenfalls die Rede, die er hier gehalten hat, die war doch ein bisschen prätentiös. Finden Sie nicht auch?«
Stachelmann hätte jetzt erwidern können, dass Bohming seinen Spitznamen der Sagenhafte nicht zuletzt der Tatsache verdankte, dass er ein Angeber war, eitel, opportunistisch, großkotzig. Aber er sagte: »Daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern.«
»Dann habe ich mich heute Morgen doch nicht getäuscht«, sagte Rehmer.
»Inwiefern?«
»Ich habe Sie im Frühstücksraum erkannt, im Morgenland. Ich übernachte nämlich auch dort.«
Stachelmanns Handy vibrierte in der Hosentasche. Gott sei Dank. Er zog es heraus. »Einen Augenblick, bitte.«
»Ich muss jetzt sowieso los.« Das Handy vibrierte weiter. »Gehen wir doch heute Abend zu dem Italiener.« Er zeigte in Richtung Finckensteinallee. Stachelmann wurde nervös, und er nickte, während er das Gespräch annahm.
»Um acht Uhr! Okay?«, rief Rehmer. »Bis dann!«
»Hallo, Schatz!«
»Hallo, Kleine, wie geht’s?«
»Du fehlst mir«, sagte Valentina mit diesem leicht leidenden Unterton, den sie sich vor einiger Zeit zugelegt hatte. »Wann kommst du?«
»In spätestens einer Woche.«
»Puh!«
»Lass mich die Sache fertig machen, sofern da etwas fertig zu machen ist. Und dann komme ich.«
Warum musste er sich eine Freundin aussuchen, die in Gotha wohnte und Lehrerin war, also festen Arbeitszeiten folgen musste? Er erinnerte sich daran, wie sie eines Tages mit ihrer Reisetasche vor seiner Tür gestanden hatte. Es berührte ihn immer noch.
»Warum ziehst du nicht hierher?«
Wie oft hatten sie darüber schon gesprochen? Fast hätten sie sich einmal gestritten, doch Stachelmann hatte es noch abbiegen können, hatte wachsweiche Erklärungen vorgetragen, in denen die Möglichkeit eines Umzugs nicht völlig ausgeschlossen schien.
»Warum lässt du dich nicht nach Hamburg versetzen?«
»Das habe ich schon tausendmal gesagt. Weil ich da keinen kenne. Weil ich hier so tolle Kollegen habe. Weil man ein Thüringer Mädchen nicht in den kalten und menschenfeindlichen Norden versetzen kann, wo es statt Wurst und Knödeln eklige Krabben gibt, und das schon zum Frühstück.« Sie lachte, blitzschnell war ihre Stimmung umgeschlagen. So war sie. Das hatte er lernen müssen. Er lernte es immer noch. Manchmal gestand er sich ein, dass es ihm ungeheuer schwerfiel, sich auf andere Menschen einzulassen, sich auf das Ungewohnte einzustellen, das er zunächst so reizvoll fand. Da war doch immer eine Kluft zwischen ihm und den anderen, und er konnte sie so wenig überschreiten, wie er es zuließ, dass sie überschritten wurde. Das Verrückte war, dass er diese Kluft kannte, dass sie ihn oft störte, ihn hilflos und einsam machte, und dass sie trotzdem blieb. Du bist der einzige Mensch, den ich kenne, der es schafft, in einer Menge allein zu bleiben. Dieser Satz hatte sich ihm eingeprägt. Er stammte von Anne, und natürlich hatte sie recht. Wie immer.
»Bist du noch dran?«
»Ja, natürlich.« Wehmut überkam ihn, wie immer, wenn er an Anne dachte. Er würde sie nie loswerden. Das war eines der wenigen Dinge, an denen er nicht zweifelte.
»Also, dann bleibt es dabei«, sagte sie, etwas übertrieben fröhlich.
»Natürlich.«
Er ging zurück an seinen Platz im Lesesaal des Bundesarchivs, zu den Akten, die ihn überzeugten, dass er seinem Klienten Carl Rosenzweig kaum helfen konnte, das ihm von den Nazis geraubte Vermögen zu verschaffen. Die Textilfabriken seiner Familie und die dazugehörigen Ladenlokale in Berlin und Potsdam waren 1939 arisiert worden, und nach dem Krieg erklärten die Sowjetischen Besatzungsbehörden und später die DDR -Regierung, sie dürften den Kapitalismus nicht wiedererstehen lassen, und das Bundesamt für offene Vermögensfragen fand die Aktenlage bisher zu dünn, diese Entscheidung aufzuheben. Offenbar waren Dokumente in den Bombennächten verbrannt oder später beiseitegeschafft worden oder beides. Längst hatte ein Westdeutscher die Fabrik billig von der Treuhand gekauft, und die Nachkommen des Eigentümers in Tel Aviv gingen leer aus. Darauf lief es hinaus, wenn Stachelmann nicht noch das große Los fand. Er glaubte es nicht. Ein Historiker bekommt ein Gefühl für die Aktenkonvolute, die er studiert, und er ahnt, was er bestenfalls finden könnte, und das war in diesem Fall nicht gut genug. Und doch würde er weiter Seite um Seite querlesen. Der Kunde hatte einen Anspruch darauf.
Die Tür zum Lesesaal öffnete sich, herein trat eine schlanke junge Frau mit halb langen gelockten hellbraunen Haaren. Sie lächelte ihn an, er lächelte zurück und hob lässig die Hand zum Gruß. Esther arbeitete im Kopierraum, er kannte sie lange, und er genoss so etwas wie eine geheime Vorzugsbehandlung, wenn es darum ging, schnell Kopien von Dokumenten zu erhalten. »Ich habe wieder was für dich.« Also wieder Kopien, die nur dazu dienten nachzuweisen, dass er nicht faul war. »Morgen Vormittag im Kopierraum. Ja?«
***
Walzer wohnte in einer Villa am Wannsee, die einmal einem Weimarer Industriellen und von 1938 bis 1945 einem Schauspieler gehört hatte, der zu Goebbels Lieblingen zählte, dessen Vorzugsbehandlung aber nach 1945 erstaunlicherweise vergaß. Als er die Villa mit Seeblick vor gut fünf Jahren erwarb, hörte sich Walzer die Geschichte der Vorbesitzer eher gelangweilt an, nahm sie aber zum Anlass zu prüfen, ob die Überweisungen der Akademie an Gedenkeinrichtungen für NS -Opfer weiterhin wie beschlossen getätigt wurden. Das gehörte zu dem, was man in der Akademie das Wohlfahrtsprogramm nannte und dessen beeindruckende Mittel Bedürftigen, Verfolgten, Dritte-Welt-Projekten und eben NS -Opfern zugutekamen. Eine so vermögende Einrichtung wie die Akademie musste sich sozial engagieren, und Walzer verachtete die reichen Pinkel, die Millionen erbten, um sie zu verprassen, er verachtete nicht weniger die schwäbischen Unternehmer, die die Welt nur als Absatzmarkt kannten und nicht einen Hauch Verantwortung für deren traurigen Zustand spürten.
Der Präsident bremste den schwarzen Volvo, der gerade die Hälfte der Luxusklasse mit Ringen, Stern oder Niere gekostet hatte, vor dem Tor, betätigte den Funköffner und fühlte, wie die Last des Tages von ihm abfiel, während sich das Tor lautlos öffnete. So war es an jedem Werktagabend. Nun würde er seine Aktentasche in sein Zimmer stellen und sich dann der Familie widmen. Er verachtete diese Leute, die im Büro nicht fertig wurden oder die gar nicht mehr anders konnten, als zu arbeiten, die Workaholics, die Akten mit nach Hause schleppten und ihre Familien terrorisierten. Nicht so laut, Kinder, Papa arbeitet noch.
Er steuerte den Wagen in die Garage neben den Renault-Van, stieg aus, sah, wie das Tor sich schloss und auch die Garagentür sank, und schritt federnd zur Haustür. Er schloss auf und wurde mit großem Geheul empfangen. Marc und Jonas schossen auf ihn zu und hielten ihn fest. Er brüllte wie ein Tiger, aber das machte die Umklammerung nur fester und das Geschrei lauter. Walzer drehte sich erst in die eine, dann in die Gegenrichtung, und er wiederholte es immer schneller, bis er aussah wie ein Twisttänzer, und endlich löste sich die Umklammerung. Gerade befreit, rannte Walzer los in die Küche und die Jungen hinterher. In der Küche empfing ihn Aurelia mit einem strahlenden Lächeln, und die Kinder, die schreiend in die Küche getrampelt waren, blieben plötzlich stehen und beobachteten, wie Walzer seine Frau in die Arme nahm und lange, fast heftig küsste. Er streichelte ihre schwarzen Haare, die sie seit zwei Wochen kurz trug, und löste seinen Mund, um ihre Schönheit zu bewundern, das schlanke Gesicht mit den hohen Wangenknochen, die mandelförmigen dunkelgrünen Augen, die langen Wimpern, diese perfekte Komposition eines unbekannten Meisters, die eigentlich nur betont wurde durch eine schmale Narbe, die waagerecht über der linken Augenbraue verlief.
Jedes Mal, wenn er sie sah, diese zarte Frau, erinnerte er sich, wie er um sie geworben hatte, monatelang, verzweifelt, doch mit der ihm eigenen ruhigen Beharrlichkeit, die alle inneren Regungen überdeckte. Sie hatte am Wochenende im Hinkelstein bedient, der Marburger Kellerkneipe am Marktplatz mit dem drohend an der Decke über dem Tresen hängenden Menhir. Als er sie zum ersten Mal gesehen hatte, schien es ihm kaum vorstellbar, dass sie hier nächtelang Bier ausschenkte und Fässer rollte, ohne zusammenzuklappen. Es hatte ihn nach einer Betriebswirtschaftsklausur mit Kommilitonen dorthin verschlagen, und als er sie sah in dem lauten, verrauchten Gastraum, packte es ihn binnen weniger Augenblicke. Immerhin verriet sie ihm ihren Namen, Aurelia, die Morgenröte. Aber den hätte sie jedem verraten.
Mehr als vier Monate wartete er jede Wochenendnacht vor dem Hinkelstein und brachte sie nach Hause. Zunächst waren ihre Gespräche eintönig. Genauer gesagt, er fragte in seiner Befangenheit Belangloses, und sie antwortete einsilbig oder gar nicht. Aber sie wehrte sich nicht gegen seine Begleitung, nachdem sie ihn beim ersten Mal ärgerlich angestarrt hatte, um sich abzuwenden und eiligen Schritts nach Hause zu gehen. Da lief er mehr in ihrem Schlepptau als neben ihr. Aber es änderte sich. Er musste sie immer wieder anschauen, ihr Profil war von klassischem Zuschnitt, sie war perfekt. Ihr Gang war geschmeidig und unaufdringlich elegant. In ihrem zarten Körper steckte ungeheuer viel Energie, das spürte er sofort.
Nach drei Wochen begann sie ausführlicher zu antworten. Hatte er zuvor den Eindruck gehabt, dass sie sich zwang, etwas zu sagen, so schien sie jetzt auf seine Fragen zu warten. Vielleicht, so fürchtete er, vielleicht war es ihr sonst öde mit ihm. Er lud sie zum Essen ein, aber das wollte sie nicht. Und er war klug genug, ihr nicht aufzulauern vor dem Mietshaus in der Haspelstraße, wo sie in einer Mansardenwohnung lebte, die zur Straßenseite hin zwei kleine Fenster hatte. Er stellte sich ihre Wohnung oft vor, sie war gewiss ordentlich und sauber und hübsch eingerichtet, aber ein Flokati lag bestimmt nicht auf dem Boden. Er dachte eher an klare Linien, funktionsgerechte Möbel und moderne Malerei an den Wänden.
Nach zwei Monaten wusste er immer noch nicht viel von ihr, außer dass sie Geld verdienen musste, freiwillig würde niemand diesen Knochenjob machen. Sie war müde, wenn sie das Hinkelstein verließ, das las er in ihren Augen, wenn sie ihn unsicher anblickte. Sie studierte Romanistik und Germanistik, aber darin steckte keine besondere Erkenntnis. Allerdings fürchtete er, dass sie ihn, den Betriebswirtschaftler, verachten könnte. Typen, die Manager werden wollten, hatten keinen guten Ruf in dieser Zeit. Und später auch nicht, aber aus anderen Gründen.
Eines Nachts erschien sie nicht. Er wartete, bis die Kneipe geschlossen war, verfluchte sich, dass er drinnen niemanden nach ihr gefragt hatte, und erlebte eine verzweifelte Nacht. Er malte sich aus, dass sie weggezogen war, dass sie nun im Ausland lebte, dass er sie nie wiedersehen würde. Aber am nächsten Tag war sie da, und er lachte voller Freude, als sie ihm mit ihrem ernsten Gesicht entgegenkam. Sie sagte kein Wort zur Erklärung, und er fand, dass sie nichts zu erklären hatte. Er hatte kein Recht auf sie, solange sie es ihm nicht eingeräumt hatte. Und doch, erschüttert und erleichtert, wie er gerade war, fragte er sie, ob sie nicht am nächsten Wochenende etwas zusammen unternehmen könnten.
»Ja«, sagte sie sachlich.
An jenem Samstag holte er Aurelia vor dem Mietshaus ab, in dem sie wohnte. Sie hatte sich freigenommen im Hinkelstein, wie sie ihm später beiläufig sagte. Er würde sich immer genau erinnern, wie sie pünktlich aus der Haustür trat im blauen Anorak, darunter ein weißes T-Shirt, schwarze Jeans, die Haare zum Pferdeschwanz gebunden. Sie sieht unternehmungslustig aus, dachte er. Und sie war es. Er nahm sie in den Arm, und sie ließ es geschehen. Zuvor hatte er es sich nicht getraut. Sie roch aufregend nach Rosen, und es fiel ihm schwer, sie loszulassen, auch wenn sie keine Regung zeigte, die ihn dazu hätte bewegen können. Es war ein ungeheurer Augenblick.
Sie fuhren in Walzers Käfer nach Limburg, diese durch und durch schwarze Stadt mit dem alles beherrschenden Dom, und dann an der Lahn entlang nach Gießen. Im trägen Fluss spiegelten sich Bäume und Büsche, am Abend färbte die Sonne das Wasser rot. Unterwegs speisten sie in einem Dorf in einer Gaststätte, und es war schon normal, dass er immer wieder einmal ihre Hand nahm und sie eine Weile hielt. Hand in Hand verließen sie die Gaststätte. Was sie gegessen hatten, wusste er da schon nicht mehr. Seitdem trug er den Zauber eines Tages mit grauem Himmel in sich, aus dem es hin und wieder tröpfelte, bis der Sonnenuntergang alles in seinen Kitsch eintauchte. Die Erinnerung an diese Stunden trübte sich nie, nicht einmal, nachdem er ihre schwarze Seite kennengelernt hatte. Die schwarze Seite, so nannte er das.
***
Plötzlich stand Georgie vor ihm, im Standardoutfit: Mützenjacke, Jeans, Turnschuhe. Er sah dünner aus als sonst, und als Stachelmann das Gesicht seines Freundes musterte, entdeckte er die Spuren des Schlafmangels, die Augen waren kaninchenrot. Zwar hatte Georgie vor ein paar Tagen eher nebenbei gesagt, dass er Stachelmann unterstützen wollte bei dieser trostlosen Restitutionssache Rosenzweig, aber das glaubte Stachelmann erst in diesem Augenblick, als Georgie tatsächlich im Lesesaal des Bundesarchivs in Berlin-Lichterfelde aufgetaucht war. Stachelmann deutete auf den Platz neben sich und schob einen Aktenordner hinüber. »Wir suchen Verträge, Briefe mit Zusicherungen oder Ähnliches.«
»Hm, dann suchen wir mal.« Er hatte gar keine Lust. Stachelmann kannte diesen Zustand, in dem ihm Georgie vorkam wie ein halber Autist. Und er hatte immer noch nicht begriffen, was in diesen Phasen in ihm vorging. Sie waren unberechenbar. Manchmal dauerten sie Tage, manchmal Minuten. Er hatte aber gelernt, dass es sinnlos wäre, Georgie aus dieser Lethargie herausholen zu wollen. Er unterstellte, dass der Freund sich nicht gut fühlte, wenn es so stand mit ihm, aber beschworen hätte er es nicht. Er bildete sich ein, dass diese autistischen Zeiten vermehrt auftraten, seit er sich entschlossen hatte, die Fernbeziehung mit Valentina zu versuchen. Und dass Georgie in dem Maß übellaunig wurde, wie Stachelmann sein Glück lebte und sich wenigstens einredete, die stets wartenden Depressionen umschiffen zu können wie ein kluger Steuermann gefährliche Klippen, die es nur gab, um Schiffe tödlich aufzuschlitzen. Es ging ihm erstaunlich gut, und er genoss sogar die kleinen Spannungen und Ärgernisse, die Streitereien und die immer wieder aufbrechende Unzufriedenheit Valentinas, weil er glaubte, eine Liebe müsse das nicht nur aushalten, sondern bestehe auch daraus; aus kleinen Misshelligkeiten gegen die Erstarrung in Ritualen, die eine Liebesbeziehung von Reibungen befreiten, um sie schließlich auszuhöhlen und abzutöten. Diese Gedanken keimten seit einigen Monaten in ihm, und er verarbeitete so nicht nur seine neue Liebe, sondern auch das Ende der alten, die, wie er inzwischen fand, eher schäbig verkümmert war.
Georgies Autismusübungen konnten ihn nicht mehr irritieren, er nahm sie hin wie Naturgewalten. Immerhin blätterte Georgie in dem Ordner, und er blätterte nicht nur, sondern las auch, wie Stachelmann in einem von Georgie genau registrierten Seitenblick feststellte. Stachelmann wusste, dass er jetzt keinerlei Kritik andeuten durfte. Das wäre etwa so, als würde er mit einer entsicherten Handgranate Ball spielen.
»Heute Abend bin ich mit einem Kollegen bei dem Italiener auf der anderen Straßenseite verabredet«, flüsterte Stachelmann, um sich Anraunzer von Lesesaalnutzern zu ersparen, die aber nichts daran fanden, andere mit dem Windows-Start-Sound zu beglücken, wenn sie ihre Notebooks einschalteten.
»Ich komme mit«, sagte Georgie. Er war wirklich unberechenbar.
Rehmer wartete schon und blickte einen Augenblick verwirrt, als er erkannte, dass Stachelmann nicht allein auftauchte. Er schien unwirsch zu werden, jedenfalls runzelte er die Stirn, und die Augenlider flatterten ein wenig, als weigere er sich, Georgie anzusehen. Doch dann erhob er sich und begrüßte erst Stachelmann und dann Georgie, nachdem dieser ihn als seinen Mitarbeiter vorgestellt hatte. Danach saßen sie schweigend am Tisch. Ein kräftiger Mann mit dickem Bauch erschien, er hielt eine Tafel in der Hand, auf der die aktuellen Gerichte geschrieben standen. Rehmer blinzelte wieder – vielleicht war das seine Masche und hatte nichts mit Georgie zu tun –, dann bestellte er einen gegrillten Wolfsbarsch und einen Pinot Grigio. Beim Wein schloss Stachelmann sich an, entschied sich aber für den Lachs, wogegen Georgie eine Cola bestellte und Spaghetti Bolognese. Daraufhin verschwand der Mann mit der Tafel, und sie schwiegen wieder. Gemurmel, Lachen, Klappern von anderen Tischen füllte den Raum, dann auch zischend die Espressomaschine.
»An was arbeiten Sie, wenn ich fragen darf?«, fragte Stachelmann, um das Schweigen zu brechen.
Rehmer wiegte seinen knochigen Schädel hin und her, dann stierte er Stachelmann an, wackelte noch einmal mit dem Schädel, um schließlich zu sagen: »Eine ganz heikle Sache. Ganz heikle Sache. Ich kann darüber wenig sagen, bin aber sicher, dass es Sie interessieren wird, wenn ich es publiziere.«
Stachelmann unterdrückte ein Gähnen. Die Furcht des einen Historikers vor dem anderen Historiker, vor dem geistigen Diebstahl, wie albern. Stachelmann hatte noch nie ein Geheimnis gemacht aus seinen Projekten, und er war noch nie bestohlen worden.
»Und Sie?«, fragte Rehmer.
»Eine Restitutionssache, eine elende Sucherei nach Verträgen und Briefen, die angeblich beweisen, was mein Auftraggeber behauptet. Ohne Grundbucheinträge läuft bei Immobilien kaum etwas, da muss man schon Handfestes auf den Tisch legen. Und das will und soll ich finden. Am Ende geht’s um das liebe Geld, wie immer.«
»Und finden Sie es?«
»Glaube ich nicht.« Stachelmann spürte die Mutlosigkeit, die ihn überwältigen wollte. Gut, er wurde bezahlt für diesen Job, aber Erfolglosigkeit kratzte an seinem Selbstwertgefühl. Er würde zwar das Honorar für die Suche kassieren, aber er hätte ein schlechtes Gewissen dabei.
»Bei meinem Projekt geht es auch um Geld. Um Millionen, Milliarden vielleicht«, sagte Rehmer plötzlich. Er wiegte wieder den Schädel, als könnte dies seine Aussage noch bedeutender machen.
»Und wann werden Sie darüber schreiben?«
Rehmer hob die Achseln und ließ sie langsam wieder sinken. »Das kann noch Jahre dauern. Ich muss verschlungenen Pfaden folgen, keineswegs nur in Archiven. Keineswegs. Ich bin eigentlich erst am Anfang meiner Suche, aber nun weiß ich endlich genug, um sicher zu sein, dass ich richtig liege. Gefühlt hatte ich es schon lange, aber nun zeichnet sich da etwas ab. Zeichnet sich ab.«
Georgie musterte den Mann wie beiläufig und stierte dann auf eine weit entfernte Stelle, die nur in seinem Auge lag. Stachelmann kannte den Blick. Georgie hielt Rehmer offenbar für einen Aufschneider. Das mochte sein. Und Georgie langweilte sich, aber vermutlich hätte ihm in seinem tristen Zustand auch die spannendste Geschichte der Welt bestenfalls ein herzhaftes Gähnen abgenötigt.
»Und was zeichnet sich ab?«, fragte Georgie mit Ungeduld in der Stimme.
»Ein Komplott, ein gigantisches Komplott. Eine der größten Verschwörungen der Weltgeschichte.«
[Menü]
2
»Hm, das war ja eine Schnarchnase«, brummte Georgie beim Frühstück im Haus Morgenland. »Eine große Verschwörung«, äffte er Rehmer nach. »Millionen, vielleicht Milliarden.«
Stachelmann senkte die Zeitung ein Stück und grinste Georgie über dem Rand an. Immerhin schien sich dessen Laune zu bessern. Er hob die Zeitung wieder und vertiefte sich in die Berliner Landespolitik, also in Fragen, die er ein paar Minuten nach der Lektüre vergessen haben würde. Er senkte die Zeitung wieder ein paar Zentimeter, sodass er Georgie gerade in den Blick bekam, der lustlos auf einem Schinkenbrötchen herumkaute. »Vielleicht ist da ja was dran?«
Georgie schüttelte nur den Kopf.
Der Abend war nicht prickelnd gewesen. Rehmer hatte rätselhafte Bemerkungen über sein großes Geheimnis geraunt, das Essen war gut, und natürlich hatten sie zu viel getrunken, was nach Stachelmanns Meinung allein an Rehmer lag, der einfach zu langweilig war, um einen auf bessere Ideen kommen zu lassen. Er war Dozent an der Leipziger Uni, widmete sich seit einigen Monaten aber nur noch seiner Verschwörung. Der Kollege erschien Stachelmann wie einer von diesen Spinnern, die glaubten, die CIA und womöglich der Mossad, denn Juden hatten ja immer die Finger drin, hätten die Twin Towers zerstört oder die zersetzte Heimatfront hätte dem Kaiser den sicheren Sieg im Ersten Weltkrieg geraubt. Es hätte ihn nicht gewundert, wenn der Mann angefangen hätte, antisemitische Sprüche abzusondern, aber er hatte es nicht getan. Nicht einmal in Andeutungen, das musste Stachelmann zugeben. Er fragte sich, ob er nicht ungerecht war gegenüber Rehmer, weil er ihn nicht mochte, weil der, wie Stachelmann fand, herumfaselte, und das in einer Weise, die jedes Gespräch unmöglich machte. Ein Fanatiker war der Typ allemal. Und warum hatte er sich mit Stachelmann verabreden wollen?
Stachelmann faltete die Zeitung zusammen und legte sie auf den Tisch. Er trank seinen Tee aus, schaute Georgie streng an und sagte mit mahnendem Unterton: »Die Arbeit ruft. Ich geh noch mal aufs Zimmer und dann ins Archiv. Wenn du deine Mitwirkung für erforderlich hältst …«
»Jawoll, mein Führer!«
Georgie sprang auf und salutierte. Dann zog er ab in Richtung Treppe.
Draußen pfiff ein kalter Wind, der Himmel war blassblau, das Sonnenlicht fast weiß. Ein Mülllaster dröhnte vorbei und zog eine schwarze Dieselwolke hinter sich her. Auf dem Weg zum Archiv redeten sie kein Wort. Stachelmann schaute auf die Uhr, es war schon nach zehn, er würde gleich zum Kopierraum gehen. Er sagte Georgie, er solle schon mal die Akten im Lesesaal besorgen, er komme gleich nach. Sie gingen aber zunächst in den Aufenthaltsraum, wo sie ihre Jacken und Taschen in Spinden einschlossen, und Georgie besorgte sich am Automaten einen Kaffee, um zu zeigen, dass er selbst sinnvolle Vorschläge als illegitime Anweisungen missverstand und nicht daran dachte, ihnen sofort zu folgen. Wenn überhaupt. Stachelmann verließ den Aufenthaltsraum und ging im langen Flur nach rechts, um wenige Meter weiter links an einer Tür zu klopfen. Es rührte sich niemand im Kopierraum, und er klopfte kräftiger. Als er immer noch nichts hörte, öffnete er die Tür. Er stand ein paar Sekunden da, bis sein Hirn verstand, was die Augen sahen. Rehmer lag vor dem großen Scanner auf dem Boden, er hatte ein rotes Loch in der Stirn, und auf seinem weißen Hemd hatten sich zwei rote Flecken in der Herzgegend ausgeweitet. Rot und grau, Blut und Hirnmasse sickerten auf den Fußboden und umschlossen fast schon das Bein des Tisches.
***
»Sie verstehen das Problem nicht«, sagte er und klopfte mit den Fingerspitzen ungeduldig auf dem Tisch. »Es geht hier nicht um Kleinscheiß, um Verordnungen, nicht mal um Gesetze, es geht hier ums Ganze.« Er fügte fast pathetisch hinzu: »Um unser Land!«
»Natürlich, Herr Franticek, natürlich. Aber …«
»Nichts aber!« Moritz Franticek stand auf und zeigte sich in seiner Größe. Das machte er gern, weil er wusste, dass seine mächtige Gestalt andere beeindrucken konnte, zumal solche kleinwüchsigen Waschlappen wie diesen Bedenkenträger Schmidt. Horst Schmidt, die Inkarnation des feigen Bürokraten, der schon vor der Geburt an seine Pensionsansprüche dachte und dessen Urangst es war, diese zu verlieren. Der morgens ins Amt hastete und abends pünktlich nach Hause eilte, wo eine verhärmte Ehefrau nach einem Tag des nutzlosen Putzens und Verschönerns das ewig gleiche Abendbrot auf den Tisch stellte, ein Wurst- oder Käsebrot und eine Flasche Bier. Und wo Schmidt aus dem Büro den Langweilerkram erzählte, weil er die Wahrheit nicht erzählen durfte. Davor hätte er sowieso viel zu viel Angst gehabt. Manchmal erschien es Franticek, der Mann bestehe aus seiner Angst und sonst nichts, kein Fleisch, kein Blut. Er hasste diesen fliehenden Blick in den graugrünen Augen unter der hohen Stirn, diese Marotte, sich immer wieder an der Wange zu kratzen, wenn er sich nicht nervös schnäuzte. Um Himmels willen, welcher Irre hatte diesen Mann hierher versetzt und wer ihn befördert, sodass er nun Franticeks rechte Hand war, nicht durch Verdienst oder Erfahrung, sondern wegen der Tücken einer Beamtenlaufbahn?
Franticek fuhr mit der Hand durch seine widerspenstigen roten Locken, die hinter der Stirnglatze wuchsen. So tat er seine Verzweiflung kund über den Umstand, dass er mehr mit den Widrigkeiten im Amt kämpfen musste als mit den Feinden draußen. Von denen gab es viele, und er kannte sie alle in ihren wechselnden Verkleidungen und Namen. Er war ein alter Fahrensmann, dem niemand etwas vormachen konnte. Das glaubte er, und das wussten seine Vorgesetzten. Heute Abend würde er sich in eine Kneipe am Domplatz setzen, eine Zigarre rauchen und ein Kölsch trinken, vielleicht auch zwei, bevor er sich in seiner winzigen Zweizimmerwohnung in der Stolkgasse noch einen Weinbrand gönnte und früh schlafen ging. Wer früher schläft, ist länger wach.
***
Das Erste, das ihm einfiel, war: »Scheiße.« Er hatte Tote gesehen, und einmal hatte er einen Menschen erschossen. Stachelmann wusste, wie das war, aber der Tote vor seinen Augen ließ ihm trotzdem den Magen verkrampfen und Hitze aufsteigen. Er war auf einen Schlag schweißnass. Ihm wurde übel. Seine Hand war plötzlich vor seinen Augen, und die Hand zitterte. Vier, fünf Sekunden stand er starr, bis er endlich das Handy aus der Tasche holte und mehr instinktiv die 110 wählte. Er berichtete der Stimme am anderen Ende stotternd, dass er eine Leiche gefunden habe, im Bundesarchiv an der Finckensteinallee. Er solle warten, sagte die Stimme. Sie war kräftig und ruhig, aber das half Stachelmann jetzt auch nicht.
Er hörte, wie sich Schritte im Gang näherten, und ihn packte die verrückte Idee, der Mörder komme zurück. Aber es war nicht der Mörder, es war die Kopierfrau, die hinter ihm stehen blieb und nichts sagte, wo Stachelmann einen Schrei erwartet hatte.
»Ich habe die Polizei angerufen«, sagte er, aber es war nicht seine Stimme, er quetschte es mehr aus der Kehle. Er starrte immer noch auf Rehmers Leiche.
Esther antwortete nicht. Sie schlich weg.
Stachelmann drehte sich um und trat auf den Gang. Dann schloss er die Tür des Kopierraums und setzte sich daneben auf den Boden. Sofort schoss ihm der Schmerz in Rücken und Knie, und er quälte sich hoch. Eine innere Stimme sagte ihm, dass er sich nicht entfernen durfte von der Leiche. Er war dazu bestimmt, aufzupassen, dass niemand mehr diesen Anblick ertragen musste außer denen, die es von Berufs wegen taten. Er fürchtete die Reaktionen der anderen, ihre Hysterie, ihr Geschrei, ihr Weinen, sein Erschrecken würde nur wachsen, wenn andere Rehmer sahen. Er fand es grausam, dass ausgerechnet er die Leiche gefunden hatte, und noch grausamer, dass er hier warten musste, neben der Leiche, so empfand er es, obwohl eine Tür zwischen ihnen lag. Das ist nicht gerecht, dachte er, und das war es auch nicht. Ein merkwürdiger Gedanke, gab er sich zu.
Dann stand Georgie neben ihm, er hatte ihn nicht kommen sehen, obwohl er doch so hoffte, dass ihn endlich jemand aus dieser Lage befreite. Die Polizei, die Gerichtsmedizin, er kannte das alles. Wo blieben sie?
»Was ist los? Du bist so blass. Schmerzattacke?«
Stachelmann schüttelte den Kopf. »Eine Leiche.« Er deutete auf die Tür und hielt Georgie am Oberarm fest, als der zur Tür gehen wollte, um sie zu öffnen. »Glaub mir, du brauchst das nicht zu sehen.«
Georgie befreite sich mit einem Ruck, fast wütend, und öffnete die Tür. Stachelmann hatte den Bruchteil einer Sekunde gehofft, die Leiche liege nicht mehr da und er habe eine Halluzination gehabt. Aber sie lag da, Georgies Körper verdeckte nur einen Teil, und das Gemisch aus Hirnmasse und Blut hatte inzwischen das Tischbein eingeschlossen. Georgie würgte, behielt es aber in sich. Dann wandte er sich ab und schlug die Tür zu. Sie fiel ins Schloss, der Knall schoss durch den Gang. Stachelmann fuhr zusammen, aber der Schreck weckte ihn aus seiner Lethargie.
»Gestern haben wir mit ihm gesprochen, heute Vormittag ist er tot.«
Georgie war grün im Gesicht. »Das ist wie bei der … Mafia«, stotterte er. Und dann: »Das liegt an dir. Immer wenn ich mit dir unterwegs bin, gibt’s eine Leiche.« Er glotzte Stachelmann an, als wäre dieser der Sensenmann.
Stachelmann winkte ab. Er lehnte sich an die Wand gegenüber der Tür.
»Wo ist Esther?«, fragte Georgie.
»Keine Ahnung. Wahrscheinlich da.« Er zeigte auf die Tür zur Damentoilette. Georgie lehnte sich neben Stachelmann an die Wand. Sie schwiegen. Stachelmann versuchte seine Fassung zu finden, doch er fühlte sich wie ausgehöhlt, leer, unendlich leer.
Er hörte eine Autobremse, dann weitere. Blaulicht blitzte durch die Fenster. Schnelle Schritte im Flur, und als sie um die Ecke bogen, sah er die Polizisten. Zwei Männer und eine Frau in Zivil, vier in Uniform. Stachelmann zeigte auf die Tür des Kopierraums, ein Ziviler im dunkelgrauen Mantel öffnete die Tür und blieb abrupt stehen. Die anderen Zivilen drängten sich daneben. Der in dem grauen Mantel hielt sein Handy ans Ohr. Stachelmann verstand »Gerichtsmedizin«, »Spusi« und noch etwas, das aber gleich verflog. Er kannte das alles, diese Prozedur, die Wichtigtuerei der Polizisten, die Fragen.
Die Uniformierten standen unschlüssig herum, bis der Chef sie anwies, den Tatort abzusichern. Sie schlossen die Tür und stellten sich davor auf. Es sah lächerlich aus.
Der Chef ging zu Stachelmann und Georgie. »Wer hat die Leiche gefunden?« Er hatte eine Metallstimme, die gar nicht passte zu seinem fettigen Vollmondgesicht. Und er hatte Fischaugen.
»Wie heißen Sie?«, fragte Stachelmann.
»Weber, Kriminalhauptkommissar.«
»Ich habe die Leiche gefunden. Dr. Josef Maria Stachelmann.«
Weber schaute ihn ein wenig ungläubig an, dann fragte er: »Haben Sie etwas verändert am Tatort?« Es klang so, als ginge er davon aus.
Frau Bestler, die hübsche Archivarin, die Stachelmann schon manches Mal geholfen hatte, kam vorbei, blieb einen Augenblick stehen, hielt die Hand vor den Mund, wandte sich an Stachelmann und sagte nur: »Die Kopierfrau, Esther …«
»Wer sind Sie denn?«, fuhr Weber sie an.
»Bestler, Archivoberamtsmännin«, sagte sie mechanisch.
»Haben Sie etwas gesehen oder gehört? Sind Sie Zeugin?«
Frau Bestler schüttelte nur den Kopf, dann ging sie zurück in Richtung Lesesaal, sie wankte ein wenig, als hätte sie Gleichgewichtsstörungen.
»Sie kennen das Opfer?« Weber schaute ihn kalt an. Sie saßen in einem Mitarbeiterzimmer im ersten Stockwerk, das die Polizei für Befragungen nutzte.
»Ein wenig«, sagte Stachelmann.
»Was heißt das?« Unwirsch.
»Ich … wir haben gestern mit ihm gegessen bei dem Italiener.« Er zeigte mit dem Finger dessen ungefähre Lage an.
»Wir?«
»Mein Freund und ich.«
Ein skeptischer Blick.
»Der steht vor der Tür. Stand er jedenfalls vorhin noch.«
»Woher kannten Sie Rehmer?«
»Von hier. Und vorher habe ich ihn kurz auf einem Kongress getroffen.«
»Hat Rehmer gestern oder bei anderer Gelegenheit irgendetwas gesagt, das Ihnen besonders auffiel, das womöglich etwas mit der Tat zu tun haben könnte?«
Darüber hatte Stachelmann schon nachgedacht. »Eigentlich nicht. Er hat von einer Riesensache gesprochen, aber das bezog er auf eine Archivrecherche.«
»Was für eine Recherche?«
»Ich weiß es nicht. Er wollte es nicht erzählen. Ich fand, er übertrieb es ein bisschen mit der Geheimnistuerei.«
»Geheimnistuerei«, wiederholte der Hauptkommissar. Er griff nach einem Bleistift auf dem Schreibtisch und begann damit zu spielen. Dann fragte er: »Haben Sie irgendetwas oder irgendjemanden beobachtet?«
Stachelmann schüttelte den Kopf. »Es muss ein Benutzer oder Mitarbeiter gewesen sein«, fiel ihm ein.
Weber schaute ihn wieder skeptisch an und nickte. »Das ist vermutlich so.« Dann warf er einen Blick zu seinem hageren Kollegen, der an der Tür lehnte. Nun schaute er wieder Stachelmann an. Webers Handy klingelte. Er nahm es ans Ohr und sagte nur mehrmals »ja« und »nein« und am Schluss: »Wir werden sehen.« Dann wandte er sich an seinen Kollegen und sagte: »Bisher nichts, keine Spuren. So was wie Kaliber 7,65, jedenfalls keine 9 Millimeter. Hilft nicht weiter, gibt’s wie Sand am Meer.« Das Letztere sagte er mehr zu sich selbst.
»Geheimnistuerei«, sagte er dann, und er kniff seine Augen zusammen, als fiele es ihm gerade wieder ein.
»Das gibt es manchmal bei Historikern«, sagte Stachelmann. »Das sind meistens Wichtigtuer, die spielen sich auf.«
Weber nickte. Er legte den Bleistift zurück auf den Schreibtisch.
»Aber in diesem Fall könnte was dran sein«, sagte Stachelmann. »Vielleicht hat er was herausbekommen? Obwohl, er hatte nichts publiziert, und diese Geheimnistuerei … wie soll da jemand auf ihn kommen?«
»Geben Sie meinem Kollegen Ihre Personalien. Und wenn Ihnen noch etwas einfällt …« Er schob eine Visitenkarte über den Tisch.
Georgie wartete draußen. »Und? Haben sie dich verhaftet?«, fragte er betont humorig.
»Nein, noch nicht.«
»Irgendwas Erhellendes?«
Stachelmann schüttelte den Kopf. »Fällt dir irgendwas ein, was der Rehmer gestern Abend rausgelassen hat?«
Georgie weitete die Augen. »Das war doch nur Gewäsch.«
»Wirklich?«
***
Franticek las die Meldung, knüllte sie zusammen und warf sie in den Papierkorb. Die Papierkugel tippte an den Rand, balancierte einen Augenblick und entschloss sich in letzter Sekunde, in den Korb zu fallen.
Franticek war erleichtert. Er betrieb keinen Sport und war bei diesem Bürobasketball daher umso ehrgeiziger. Er notierte den Treffer in dem Block, der an der Seite seines Schreibtisches lag. Heute noch kein Fehlwurf. Immerhin.
Aber sonst herrschte Langeweile, Verwaltungskram, und auch wenn das ganze Land glaubte, der Verfassungsschutz würde Tag und Nacht islamistische Terroristen verfolgen, hatten die meisten V-Männer und ihre Führer oft nichts zu tun. Und wenn, dann infiltrierten sie irgendwelche bedeutungslosen linksradikalen Splittergruppen oder Nazis, die längst so durchsetzt waren mit Spitzeln, dass selbst das Amt oft nicht wusste, wer Nazi war und wer vom eigenen Laden.
Franticek interessierte sich nur für die großen Fälle, das erlaubte ihm seine Position, und er gestattete sonst nur, dass die jungen Leute ihn um Rat fragten. Franticek war nämlich ein Ass, der Mann, der das Projekt Pluto leitete, die geheimste Operation des Bundesamts. Nur durch ihn war alles in ruhige Bahnen gekommen. Ohne ihn hätte es längst die Mutter aller Skandale gegeben, die die Republik tatsächlich erschüttert hätte. Er war stolz auf sich. Aber das hinderte ihn nicht daran, wachsam zu bleiben. Jeden Tag analysierte er die Informationen, die über Pluto bei ihm eingingen. Meistens waren es nur ein, zwei Zeilen, selten mehrere Seiten, zumal seit diese Leute die Sache wieder im Griff hatten.
Er knüllte ein Reisekostenformular zu einer Kugel, zielte kurz, wobei er die Papierkugel in der Hand nach vorne und nach hinten wiegte, und warf endlich. Diesmal ging der Versuch daneben. Wie um ihn noch mehr zu ärgern, rollte die Kugel unter den Aktenschrank.
***
Sie stand einfach da und schrie. Ihr Gesicht war verzerrt, nicht wiederzuerkennen, und aus den Augen quollen Tränen. Die Schreie waren entsetzlich, er hielt sie nicht aus. Als er sie zum ersten Mal gehört hatte, war er in eine Art Schockstarre verfallen, völlig unfähig zu reagieren. Der Ausbruch kam ohne jede Vorwarnung, und dann herrschte im Schlafzimmer nur noch das Schreien. Er wunderte sich, dass ein so zarter Körper solche Laute erzeugen konnte. Dann endete die Schreiphase, und es folgten die Anwürfe. Er sei fremdgegangen, mit dieser Frau soundso, er wisse schon, die hübsche Blonde, die habe er ihr aus Gemeinheit sogar vorgestellt bei diesem Empfang letzte Woche.
Inzwischen wusste er, es hatte keinen Sinn, über diese Anschuldigungen zu diskutieren. Es waren Wahnvorstellungen. Bei den ersten Ausbrüchen hatte er die Tatsachen genannt, alles genau begründet, quasi gerichtsfest, aber es hatte nichts geholfen. Es hatte sie nur misstrauischer gemacht, sofern das möglich war. Er hatte mit seinem besten Freund, einem Tageszeitungsredakteur, mehrfach darüber gesprochen, aber Reinhard Stabel fiel nur ein, dass Aurelia einen Psychologen aufsuchen solle. Tatsächlich schlug Walzer ihr das in einem Augenblick der Verzweiflung vor und erntete nur einen weiteren Ausbruch, nachdem der vorherige gerade erst abgeklungen war. Nein, sie bilde sich das nicht ein, aber das wolle er ihr einreden. Der Psycho solle sie nur abstumpfen lassen, sie vollpumpen mit diesen Präparaten, die ihr die Sensibilität rauben würden, damit sie nichts mehr merke. Sie habe eben ein Gespür für ihre Umwelt, und es sei daher fast unmöglich, sie zu hintergehen, ohne dass sie es mitbekomme. Sie schrie es heraus und auch noch, dass er es nicht noch einmal wagen solle, sie zu einem Typen zu schicken, der es selbst nötig habe und dafür bezahlt werde, sie für verrückt zu erklären.
An diesem Abend und in dieser Nacht hatte er aufgegeben. Er liebte sie abgöttisch, aber er liebte nur die, die er in Marburg für sich gewonnen hatte. Von der würde er sich nie trennen, und deshalb würde er bei Aurelia bleiben, gleichgültig, was geschah. Und immer wieder erlebte er Tage, an denen sie wieder ein bisschen so war wie früher, auch wenn er die dunklen Wolken nicht mehr übersehen konnte. Die hingen immer über ihm und erinnerten ihn auch in glücklichen Augenblicken an das Unausweichliche. Und doch gelang es ihm, sich an jedem Werktag nach der Arbeit auf zu Hause zu freuen. Er war ein Familienmensch, und das war seine Familie. Auch wenn Aurelia ihm Schlaf und Kraft raubte, er war stark genug, das auszuhalten. Heute und für immer.
***
Obwohl Georgie zunächst gemault hatte, begleitete er Stachelmann in die Kantine, die an der Eingangspforte zum Archivgelände lag. Sie stellten sich in die Schlange. Es gab Soljanka, Rindsgulasch, Spaghetti Bolognese, als Nachtisch Kompott und einen schokoladenfarbenen Pudding. Als sie vorgerückt waren, entdeckte Stachelmann eine der neuen Legenden des deutschen Archivwesens: Erika. Hast du Erika gesehen?, wurde jeder Neuankömmling gefragt. Auf die Antwort, nein, wer das denn sei, wurde einem nur empfohlen, in der Kantine zu speisen, wo das Geheimnis sich von allein enthüllen würde. So war es auch Stachelmann ergangen, wogegen sich Georgie für dieses Rätselspiel überhaupt nicht begeistern konnte. Erika stand tagtäglich hinterm Tresen und trug das verbissenste aller verbissenen Gesichter. Sie fragte nicht, was der, der an der Reihe war, essen wollte, sondern starrte ihn nur mit leicht nach vorn gerecktem Kinn an. Sie schaute jeden Essensempfänger an wie ein hungriger Löwe die gerissene Antilope. Sie nahm die Bestellung schweigend entgegen, knallte das Essen mit einer Kelle oder einer Gabel auf einen Teller und schleuderte diesen dem Empfänger entgegen, was sie aber immerhin so geschickt anstellte, dass nichts verkleckerte. Erika war eine Attraktion, und Stachelmann war begeistert von ihr.
»Die ist ein Gesamtkunstwerk«, flüsterte er Georgie ins Ohr. »Ich garantiere, alle hier lieben sie, sie macht diese Kantine einzigartig im deutschen, ach, was sage ich, im europäischen Archivwesen.« Die Schlange rückte vor, und Stachelmann schwieg. Was würde passieren, wenn Erika ihn hören würde? Würde sie ihre Kelle oder, noch schlimmer, die Gabel als Waffe benutzen?
»Du spinnst«, sagte Georgie in normaler Lautstärke. »Die ist halt schlecht gelaunt.«
Vor ihnen drehten sich zwei Wartende um und grinsten. Auf die Blicke im Rücken achtete Stachelmann nicht.
»Halt die Klappe«, flüsterte Stachelmann, »wenn du das hier überleben willst. Und außerdem, wenn jemand jeden Tag schlecht gelaunt ist, dann ist das keine schlechte Laune, sondern eine Depression oder was noch Schlimmeres.«
»Klugscheißer«, sagte Georgie.
Jetzt war Erika in Sichtweite. Stachelmann schien das Gesicht noch verkniffener als sonst. Ihre Blicke waren kälter als der Nordpol, und die Speisen landeten mit einem besonders lauten Klatschen auf den Tellern, als würde Erika Ohrfeigen austeilen. Womöglich war sie heute richtig schlecht gelaunt, und Stachelmann fragte sich, ob er schuld daran sei. Vielleicht besaß Erika ein übermenschlich empfindliches Gehör oder fühlte, was andere über sie dachten.
Jetzt war ein kleiner Dicker im Blaumann dran. Die Bestellung nahm sie wie immer kommentarlos entgegen, und nur die Tatsache, dass sie mit ihrem Servierwerk begann, zeigte, dass sie sie verstanden hatte. Bestimmt hatte sie noch nie das falsche Gericht serviert, davon war Stachelmann überzeugt. Aber solche Fragen oder Hilfestellungen wie: Ein bisschen mehr Soße vielleicht? Oder: Die Kartoffeln sind heute etwas weich, aber wenn Sie Reis mögen … kannte sie gar nicht. Erika war wie das Schicksal: unbeirrbar bis zum Ende aller Tage. Stachelmann hatte schon überlegt, wie Erika einkaufen ging, wie sie Situationen bewältigte, in denen ihr kein Automat half, den man folgenlos anschweigen durfte. Wie bestellte sie hundert Gramm Gouda an der Käsetheke? Oder kaufte sie nur abgepackten? Wie kam man durchs Leben, ohne ein Wort zu sagen? Und mit diesem Blick?
Sie rückten wieder zwei Schritte nach vorn. Da stieß ihm Georgie den Ellbogen in die Rippen. Der Schmerz war kurz, aber heftig. Bevor Stachelmann ihn anschnauzen konnte, zischte er: »Sie hat den bösen Blick! Den hab ich noch nie gesehen, irre. Hm!«
Tatsächlich durchbohrte Erikas Blick gerade eine Archivarin, nach Stachelmanns Erinnerung zuständig für die deutsche Arbeiterbewegung bis 1945, aber das half ihr jetzt auch nichts. Erikas Augen verwandelten sich in Waffen, aber sie sandten keinen Hitzestrahl, sondern Frost, und die Archivarin verwandelte sich in eine Eissäule. Bis sie dann doch weiterging. Georgie war dran. Er sagte leise und schmallippig »Spaghetti«, die Erika gleich voller Verachtung auf den Teller knallte, um dann die Soße daraufzuschütten, die nach allem Möglichen aussah, nur nicht nach Bolognese, und Erika schien auch ein wenig erleichtert zu sein, dass sie wieder eine Kelle davon losgeworden war, als müsste sie aufessen, was als Rest blieb. Erika sah gar nicht schlecht aus, entdeckte Stachelmann, wenn sie nur einmal lächeln würde, dann würde die Welt sich weiterdrehen.
Aber das tat sie erst wieder, als Stachelmann die Konfrontation überlebt hatte und mit einem Teller Rindsgulasch und Kartoffeln endlich am Tisch saß. Er brauchte ein paar Minuten, um die Nachwirkung der Begegnung zu verkraften, denn Erika schien ihn besonders finster angeschaut zu haben, was Stachelmanns These stützte, dass sie alles hörte, auch das, was nicht einmal ein Richtmikrofon aufschnappen würde. Es wäre auch seltsam gewesen, sie hätte keine übernatürlichen Fähigkeiten gehabt.
Komisch, dachte Stachelmann, wie schnell man über einen Mord hinweggehen kann. Erika, das Essen, die Kantine, ihre Besucher, alles war wie immer.
Bis Georgie mit vollem Mund fragte: »Vielleicht hat er doch was gesagt?«
»Was gesagt?«
Georgie schleuderte Spaghetti um seine Gabel und bespritzte sein Hemd mit Soße. Er beachtete es nicht. »Was ein Hinweis sein könnte.«
Stachelmann bedachte kurz die Gefahren der Zentrifugalkraft am Beispiel einer Spaghettigabel, holte sich dann zurück ins Gespräch, aber nicht ohne sich zu wundern, welch absurde Ideen einem ins Hirn geblasen werden konnten. »Ich habe das Gespräch noch einmal rekapituliert und überhaupt nichts entdeckt, das helfen könnte. Er hat doch nur rumgeprahlt. Ich halte es auch für Quatsch, dass es unbedingt mit seiner Arbeit zu tun haben muss, und tippe auf das Übliche: Neid, Liebe, Geld.«
»Hm. Bin tief beeindruckt«, sagte Georgie, und Stachelmann erwartete schon die nervige Anrede Holmes, die Georgie eine Zeit lang benutzt hatte. Aber sie kam nicht. Manchmal besserten sich die Dinge doch. »War ja nur so eine Idee.«
»Na, die werden sich anschauen, was Rehmer gelesen hat. Die müssen allen Spuren nachgehen. Das Übliche eben. Es soll hin und wieder Kriminalfälle geben, mit denen wir nichts zu tun haben.«
[Menü]
3
Es klopfte an der Hotelzimmertür, nicht laut, aber es war nicht zu überhören. Zaghaft, wie ein Schulmädchen beim Lehrer klopfen würde.
»Herein«, sagte Stachelmann. Die Tür öffnete sich, und ein eher klein gewachsener, fast schmächtiger Mann trat ein.
»Haben Sie einen Augenblick Zeit für mich?« Er fragte leise, fast ängstlich.
»Nein«, sagte Stachelmann. Er hatte seit einer Stunde in dem roten Sessel gesessen und länger, als er wollte, in einem Buch gelesen, auf das er zufällig gestoßen war, Jens Hüttmanns aufregende Studie über die »DDR -Geschichte und ihre Forscher«. »Ich will nicht unhöflich sein, aber ich kenne Sie nicht und wollte bald schlafen.«
Der Mann hatte ein sehr feines Gesicht mit fast ebenmäßigen Zügen. Er trug einen beigen Anzug, weißes Hemd, Krawatte, über dem Arm einen Mantel. Er sah freundlich aus, etwas unterwürfig erschien er Stachelmann. Und dann hatte er eine Pistole in der Hand. Er schloss die Tür hinter sich. Er schraubte fast genüsslich ein langes Rohr auf den Lauf, einen Schalldämpfer. Er setzte sich auf die Bettkante und richtete die Pistole auf Stachelmann. »Vielleicht überzeugt Sie dieses Argument.«
»Ich kenne keines, das mich weniger überzeugen könnte. Wer sind Sie? Was wollen Sie?« Er wartete auf den Schock, aber der kam nicht.
»Zur ersten Frage: Das geht Sie nichts an. Zur Zweiten: Ich möchte genau wissen, was Sie beim Italiener mit Rehmer besprochen haben.« Der Lauf deutete auf Stachelmanns Bauch. Er fühlte dort ein Ziehen.
Es klopfte wieder an der Tür, der Mann erschrak, auch wenn er es sich kaum anmerken ließ. Dann sprang er geräuschlos auf und trat hinter die Tür, während die sich öffnete. »Wann frühstücken wir morgen, und wann gehen wir ins Archiv?« Georgie stand da, reichlich ungekämmt, und seiner Stimme hörte man den Joint an, den er sich gegönnt hatte.
»Frühstück um neun Uhr, okay?«
»Zu früh«, nörgelte Georgie. »Mitten in der Nacht.« Er trat einen Schritt ins Zimmer, da packte ihn der Mann mit der freien Hand, riss ihn ins Zimmer, sodass er neben Stachelmanns Sessel stürzte, während der Mann die Tür schloss, und diesmal drehte er den Schlüssel um. Georgie stand auf, er war völlig verdattert. »Was soll denn der Scheiß?«
Er setzte sich auf den Stuhl am Fenster.
Der Mann saß wieder auf der Bettkante, die Pistole zeigte zwischen Georgie und Stachelmann. »Also, Sie wiederholen jetzt genau, Wort für Wort, was Rehmer gesagt hat gestern Abend.«
»Du spinnst doch«, sagte Georgie.
Die Waffe richtete sich auf seinen Kopf.
Langsam spürte Stachelmann die Angst. Woher wusste dieser Scheißkerl, dass sie mit Rehmer im Restaurant gewesen waren? »Haben Sie ihn bespitzeln lassen?«, fragte Georgie, der auf den gleichen Gedanken gekommen war.
»Halt’s Maul!«
»Sie waren bestimmt schon mal höflicher«, sagte Georgie. Stachelmann hatte den Eindruck, dass der Typ sie nur im Notfall erschießen würde. Nur, wenn sie ihn angriffen. Wenn überhaupt. Das war kein normaler Gangster, und sein letzter Anpfiff wirkte aufgesetzt.
»Wenn wir das Maul halten sollen, dann sagen wir jetzt gar nichts mehr«, erklärte Stachelmann und staunte ein wenig über sich selbst. Georgie sah entschlossen aus.
Der Mann erhob sich und bohrte Stachelmann den Pistolenlauf an den Hals. Kalter Stahl. Es begann zu schmerzen, als der Mann fester drückte. »Schluss mit den Spielchen. Jetzt wird erzählt.«
Warum eigentlich nicht?, dachte Stachelmann. Rehmer hatte nichts rausgelassen. Am meisten erfahren habe ich gerade eben. Nur weil der Typ aufgetaucht ist. Da ist also doch was mit dem Rehmer. Nur was?
Stachelmann schilderte mit gelangweilter Stimme, wie das Gespräch verlaufen war. Der Mann hörte angespannt zu, als fürchtete er, etwas zu überhören. »Eine große Sache oder so ähnlich? Was soll das heißen?«
»Das wissen wir doch nicht!«, schnauzte Georgie. »Und jetzt nehmen Sie Ihr Spielzeug da weg!«
Der Typ nahm die Pistole von Stachelmanns Hals und setzte sich wieder auf die Bettkante.
»Können Sie mir mal verraten, was dieser Affentanz soll?«, fragte Stachelmann. »Sie wissen doch mehr als wir.«
Der Typ stand auf, ließ den Lauf zwischen beiden hin- und herwandern, ging langsam rückwärts zur Tür, schloss sie auf, öffnete sie, zog den Schlüssel ab, steckte die Pistole in den Hosenbund und war blitzschnell draußen. Sie hörten, wie der Typ die Tür von außen abschloss, dann schnelle Schritte auf dem Flur, und endlich war es still.
Georgie reagierte am schnellsten und hatte das Handy schon am Ohr, bevor Stachelmann daran dachte, die Polizei anzurufen.
Weber stand bald im Zimmer, begleitet von seinem hageren Mitarbeiter, und in beider Augen stand der Zweifel. »Sie meinen, das war kein Verbrecher?«
»Na ja«, sagte Stachelmann. »Wenn hier einer Leute bedroht mit einer Waffe, dann ist das wenigstens unfein. Aber ich meine etwas anderes. Der Mann hätte auch Kriminalkommissar sein können, er sah aus wie eine Büroexistenz. Oder wie man sich eine vorstellt. Wie ein Beamter eben.«
Weber guckte noch ein bisschen finsterer. Der Hagere schluckte, dann sagte er endlich etwas. »Sie wollen uns jetzt aber nicht … verarschen. Sie können also mit einem Blick erkennen, ob einer Beamter ist.«
»Klar kann er das. Hm. Sie haben wir auch schon durchschaut. Sie sind von der Polizei!«, triumphierte Georgie.
»Wir haben Ihnen den Mann beschrieben, und jetzt sollten Sie ihn suchen.« Stachelmann ging zur Tür und öffnete sie demonstrativ. »Oder haben Sie noch Fragen oder Antworten, die uns weiterbringen?«
***
Er lag wach, und er wusste, dass sie ebenso wenig schlief. Ihrem Atem hörte er aber an, dass sie sich beruhigte. Er kannte sie so gut. Seine Hand fand ihre Hand und umklammerte sie. Sie ließ es geschehen, erwiderte aber den Druck nicht. Seine Gedanken wanderten zur Akademie, zu den Sorgen, die er sich seit einiger Zeit machen musste. Dafür gebe es keinen Grund mehr, hatte ihm Ammann versichert, der Fall sei geklärt. Aber Walzer kannte viele geklärte Fälle, die gar nicht geklärt waren. Wahrscheinlich bin ich zu misstrauisch, vielleicht wird doch alles wieder wie früher. Eigentlich spricht viel dafür. Der Gedanke beruhigte ihn. Es spricht wirklich viel dafür.
Er wachte auf vom Kindergeschrei. Sie trampelten auf dem Flur und waren glücklich. Plötzlich knallte die Tür auf, und beide stürzten sich auf ihn. Er bekam einen spitzen Ellbogen in die Rippen, aber er zeigte keinen Schmerz. Die Welt war doch schön. Und er trug einen kleinen Teil dazu bei. Während er die Kinderattacke halbherzig abwehrte, dachte er an die neuen Stipendien, die sie vergeben würden, damit Jugendliche aus armen Familien ihre Begabungen entwickeln konnten. Er dachte an die Hilfsprojekte in Osteuropa, wo sie auch gerade begonnen hatten, Romafamilien zu unterstützen, die in Ungarn und Rumänien unter unerträglichen Bedingungen hausten und von den Behörden und vielen Mitbürgern nur weitere Misshandlung und Entrechtung zu erwarten hatten. Er überlegte, ob sie eine Initiative gründen könnten, die in Brüssel Lobbyarbeit für die Roma in Osteuropa macht. Walzer fand den Gedanken aufregend. Das würde er gleich am Nachmittag mit den Vorstandskollegen besprechen.
Mit theatralischem Gebrüll erhob er sich und warf die Kinder auf Aurelias Bettseite. Dann rannte er aus dem Zimmer, die Jungen hinterher. Der Krach war infernalisch. In der Küche stand Aurelia und lachte sie an, ihren Mann und ihre Kinder.
***
»Es ist zum Kotzen!«, donnerte er. Aber er schrie nicht so laut, dass andere ihn hörten. Er las die Eilmeldung und verfluchte alle Mitarbeiter des Amts. Dilettanten, Anfänger, Versager, hirnlose Stümper, die ein böses Schicksal nach Pulheim verschlagen hatte, und ein noch böseres hatte bewirkt, dass diese Figuren eingestellt worden waren, dass ihnen Dienstränge und Pensionsansprüche zuwuchsen, was sie aber nicht im Geringsten daran hinderte, ihren Brötchengeber zu ruinieren. Er knüllte ein Papier zusammen, warf es aber nicht, weil seine Nerven einen Fehlwurf nicht ertragen hätten. Er las die Meldung noch einmal, dann griff er zum Telefonhörer und wählte die Berliner Nummer. Er wurde gleich verbunden.
»Waren Sie das?«
Auf der anderen Seite schnaufte es. Dann: »Sie erwarten doch nicht etwa, dass ich mich am Telefon dazu äußere. Das müssten Sie doch wissen.« Ein heiseres Lachen.
Franticek legte den Hörer auf. Also doch, dachte er. Und er wusste, es würde viel Arbeit auf ihn zukommen. Das war so wie mit dem Steinchen, das man ins Wasser warf. Seine Wellen weiteten sich, bis sie sich am Ufer brachen. Und dann?
***
Esther war bleich um die Nase. Ihr Kopierraum war versiegelt, die Kriminaltechniker wuselten durch die Gänge. Stachelmann und Georgie langweilten sich mit den Akten zur Restitutionssache Rosenzweig herum wie zuvor, aber der Mord ging auch ihnen nicht aus dem Kopf. Nach dem Auftritt des Pistolenmannes hatte Stachelmann noch einmal versucht, das Gespräch mit Rehmer beim Italiener zu rekonstruieren, aber er hatte keinen Hinweis gefunden. Und Rehmers Angeberei war auch keiner. Was musste ein Historiker finden, damit ihn jemand ermordete? Ein Geheimnis, natürlich, das jemandem gefährlich wurde, wenn einer es ausplauderte. Ein Verbrechen könnte ausgegraben werden oder der Beweis für eines sein. In der Tat gibt es Dokumente, die Existenzen zerstören können. Betrug, Raub, Mord, Kriegsverbrechen, das und Weiteres kann zum Himmel stinken, nur weil einer ein Blatt Papier gefunden hat, vielleicht dieses alte, brüchige, graue Papier, mit Lösungsmitteln angerührt, die einem die Hände angreifen. Vielleicht handschriftlich, nur als Randnotiz auf einem getippten Blatt, vielleicht ein Telegramm, ein Protokoll, ein Entwurf, ein Brief. Stachelmann stellte es sich bildhaft vor, wie so ein Dokument aussehen konnte. Mit Hakenkreuz oder SS -Runen, mit einem Behördenkopf, Ministerium für Staatssicherheit – Der Minister, vielleicht die Enthüllung einer verlogenen Karriere, Stachelmann hatte so eine ja selbst aufgedeckt.
»Was ist, mein Herr und Gebieter?«, flüsterte Georgie.
Stachelmann erwischte sich beim Tagträumen. »Das ist doch ein Mist hier«, sagte er.
Die Lesesaaltür öffnete sich, das tat sie immer elektrisch, draußen und drinnen waren Schalter an den Wänden. Herein kam eine schlanke junge Frau mit halb langen schwarzen Haaren und großen Augen. Es durchfuhr ihn, sie ähnelte Anne. Während die Frau aus seinem Blickfeld verschwand, wuchs in ihm ein Gefühl der Verlorenheit. Es war ein Augenblick, den er gefürchtet hatte und den er doch für unvermeidlich hielt. Er hatte es vermasselt, und zwar so gründlich, dass es nichts mehr gab, das er wiedergutmachen könnte. Er fühlte sich abgrundtief mies.
»Und wenn wir uns anschauen, was Rehmer recherchiert hat, hm.«
Stachelmann schüttelte sich innerlich, dann wandte er sich Georgie zu. »Da sitzen die Bullen drauf.«
»Klar, aber nicht auf den Findbüchern.«
»Ich glaube, das darf ich nicht«, sagte Frau Bestler. Sie saßen in der Kantine und tranken Kaffee. Stachelmann hatte Frau Bestler am Haustelefon darum gebeten. Georgie guckte sie treuselig an, aber das verfing nicht. Sie schüttelte den Kopf, nippte wieder an ihrem Kaffee und war einsilbig. »Die Polizei, Sie verstehen …« Sie nippte wieder. »Wir sind ja auch eine Behörde, und wenn ich da …«
Sie hatte recht. Und Stachelmann fragte sich, warum er die Sache nicht ließ, wie sie war. Weil ihm einer mit einer Pistole unter der Nase herumgefummelt hatte. Weil er doch ein bisschen rachsüchtig war und es dem Typen gern zurückzahlen würde. Aber in seiner Währung.
Frau Bestler schaute ein bisschen hilflos auf ihren Kaffeebecher. »Ich muss dann mal wieder …« Sie stand auf, zögerte, doch dann verließ sie die Kantine.
»Du willst den Pistolenfuzzy kriegen«, sagte Georgie.
»Genau«, sagte Stachelmann. »Was sonst?«
Zurück im Lesesaal öffnete Stachelmann den blauen Ordner, in dem unsystematisch verschiedene Arisierungsvorgänge gesammelt waren, darunter Protestbriefe zu kurz gekommener Parteigenossen. Obenauf lag jetzt aber ein Computerausdruck.
***
Ammann war nach Wuppertal-Elberfeld gereist, wo eine Werkzeugmaschinenfabrik saß, an der die Akademie eine Mehrheitsbeteiligung besaß, natürlich nicht unter ihrem Namen, sondern, um das Akademische und der Wohlfahrt dienende Engagement sauber vom Geschäftlichen zu trennen, über eine Holding mit dem Namen Academia. Verstecken mussten sie sich ja nicht. Er wusste, dass die Geschäftsführer der Elberfelder Maschinenbau AG ihn fürchteten, und er fand, dass sie allen Grund dazu hatten. Denn so großzügig die Akademie handelte, so penibel genau arbeitete die Holding, der Walzer ebenfalls vorstand und wo Ammann genauso seine rechte Hand war. Die beiden kannten sich schon länger als zwei Jahrzehnte, waren sich immer wieder begegnet, hatten in Verbänden und Firmen miteinander zu tun gehabt und es gelernt, sich in ihrer Unterschiedlichkeit zu schätzen. Was Walzer nicht konnte, das schaffte Ammann, und umgekehrt. Dabei war Walzer der strategische Kopf und perfekte Moderator, dem es auch in aussichtslos scheinenden Fällen fast immer gelang, einen Kompromiss zu finden. Ammann war schier unübertreffbar in seiner Präzision, seiner Ruhe, seiner technischen und betriebswirtschaftlichen Intelligenz. Einer hatte ihn mal das Rasiermesser