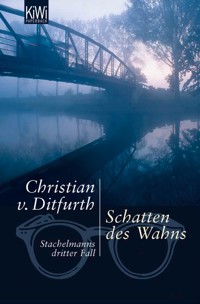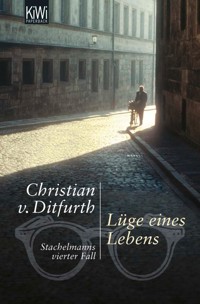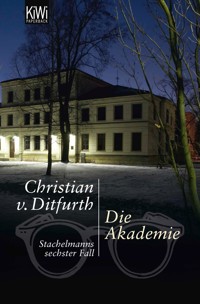8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Stachelmann ermittelt
- Sprache: Deutsch
Stachelmann erstmals original in KiWi – sein fünfter Fall führt in ein Land zwischen Terrorangst und ungesühnter Schuld Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe fliegt in die Luft. Die Bundesrepublik verfällt der Terrorhysterie. Während ganz Deutschland nach Islamisten fahndet, hat der Hamburger Historiker Josef Maria Stachelmann ganz andere Sorgen. Der Universitätsdozent Stachelmann ist Vergangenheit: Seit seinem Abgang von der Universität hält er sich mit einem Büro für historische Ermittlungen über Wasser. Kaum hat er sich notdürftig eingerichtet, steht tatsächlich die klassische blonde Schönheit im Büro. Die Deutschamerikanerin Cecilia gibt Stachelmann den Auftrag, ihren Vater, Franz Laubinger, zu suchen, der Ende der Fünfzigerjahre spurlos verschwunden ist. Letzter Wohnort: Wolfsburg. Stachelmann findet bald heraus, dass Laubinger aus der Bundesrepublik fliehen musste, weil Menschen, die schon in Hitlerdeutschland verfolgt worden waren, in der Adenauerrepublik keineswegs unbehelligt leben konnten. Doch als er glaubt, den Fall gelöst zu haben, verstrickt er sich in einem Labyrinth aus Angst und Hass. Ein Unbekannter bedroht Felix, den Sohn seiner Freundin Anne. Wovor will der Unbekannte Stachelmann warnen? Wovon soll er abgehalten werden? Um Felix zu schützen, macht sich Stachelmann auf die gefährliche Suche. Am Ende verfolgt er einen Mörder, der das Töten von Staats wegen gelernt hat. In Stachelmanns atemberaubenden fünften Fall zeigt sich, wie Unrecht in der Vergangenheit Verbrechen in der Gegenwart heraufbeschwört. Gesamtauflage aller Stachelmann-Krimis: 350.000 Exemplare
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 474
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
» Buch lesen
» Inhalt
» Klappentext
» Informationen zum Autor
» Lieferbare Titel / Lesetipps
» Impressum
Inhalt
Kapitel 1
11
Kapitel 2
15
Kapitel 3
26
Kapitel 4
41
Kapitel 5
62
Kapitel 6
70
Kapitel 7
83
Kapitel 8
106
Kapitel 9
125
Kapitel 10
147
Kapitel 11
174
Kapitel 12
201
Kapitel 13
223
Kapitel 14
239
Kapitel 15
257
Kapitel 16
279
Kapitel 17
303
Kapitel 18
319
Kapitel 19
350
Kapitel 20
367
Kapitel 21
376
Kapitel 22
393
Danksagung
399
[Menü]
|7|Für Elfi
|9|»Gutes wird mit Gutem vergolten,
Böses mit Bösem.
Nichts wird vergessen,
die Zeit der Vergeltung wird kommen.«
Chinesisches Sprichwort
[Menü]
|11|1
Hätte jemand den Ablauf der Ereignisse auf Tonband aufgenommen und das Band später mit extrem langsamer Geschwindigkeit abspielen lassen, dann hätte er das Summen gehört, als der Strom in den Zünder schoss, und den scharfen Knall, als dieser explodierte, worauf eine dumpfe Detonation folgte, als die Stahltonne mit ihrer Mischung aus Dünger, Diesel und anderen Chemikalien im Keller hochging, dann ein Bersten, Klirren und Krachen, als der Boden des Erdgeschosses hochgeschleudert und die Fassade neben der Tür, in Höhe des Wachzimmers, nach außen gedrückt und dann zerrissen wurde. Die Fenster der Vorderseite wurden auf den Vorplatz gesprengt. Dann war es plötzlich still, Rauch quoll das Treppenhaus hoch. Nach eineinhalb Minuten knisterte die Vorderfassade, ein Riss klaffte fast senkrecht nach oben, ein zweiter zog sich von der Stelle, wo der Eingang gewesen war, nach links, hoch bis ans Dach. Ein dritter Riss verband die beiden ersten. Dann wieder Stille. Nach einer knappen Minute grollte es leise, dann immer lauter. Als Bodenbalken der Decke brachen, knallte das trockene Holz. Dann rutschte die Fassade in der Mitte des Gebäudes herunter und türmte einen Haufen, wo vorher der Haupteingang war. Schließlich stürzten die Seitenflügel in die Mitte, wo nichts mehr sie stützte. Staub, überall Staub. Der mischte sich bald mit dem schwarzen Rauch aus dem Keller. Die Schwaden zogen über die Herrenstraße und weiteten sich über der Innenstadt.
Dies geschah am 22. August 2007, um 0 Uhr 30, in |12|der Herrenstraße 45a in Karlsruhe, Baden-Württemberg. Um 10 Uhr 11 ging bei der Deutschen Presse-Agentur in Berlin ein Bekennerschreiben ein. Absender die Gruppe Dar al-Islam, die mitteilte, der Anschlag auf den Bundesgerichtshof sei ein Vergeltungsakt für die Angriffe der Ungläubigen auf die Brüder im Irak und in Afghanistan. Sollte sich die Bundesregierung auch künftig am Krieg gegen die Rechtgläubigen beteiligen, seien weitere Anschläge unvermeidlich. Diese Vergeltungsakte seien Verteidigungsmaßnahmen und würden Deutschland immer härter treffen. »Karlsruhe ist nur eine Warnung.«
Die dpa veröffentlichte das Bekennerschreiben nicht im Wortlaut, sondern um 13 Uhr 43 eine Erklärung des Bundesinnenministeriums, in der das Bekennerschreiben zitiert wurde.
Am Abend gab es in der Tagesschau nur ein Thema. Nun wurde auch gemeldet, dass drei Menschen umgekommen waren. Der Richter Dr. Winfried Kemmer, die Assessorin Karin Schütt und der Justizbeamte Arnim Hold, der im Wachzimmer des Palais des Erbgroßherzogs Friedrich Dienst gehabt hatte, wie das Hauptgebäude des BGH genannt wurde.
In der Sondersendung nach den Nachrichten ereiferten sich Experten und Politiker über die islamistische Bedrohung. Der Bundesinnenminister erklärte, er habe immer gesagt, dass Deutschland im Visier des Terrorismus sei. Es klang so etwas wie Befriedigung mit, schließlich hatte der Minister harte Kritik einstecken müssen für seine Pläne, Freiheitsrechte auszuhöhlen zugunsten einer Sicherheit, die viele für eine teure Illusion hielten. Man konnte heraushören, dass der Innenminister seine Kritiker mitverantwortlich machte für den Anschlag. Schließlich lebe man nicht in einer Diktatur, die Bürger könnten dem Staat vertrauen.
|13|Schon an diesem Abend wurde offenkundig, der Innenminister würde seine Überwachungsmaßnahmen verschärfen, die Kritiker würden abtauchen, die Pressekommentatoren würden den Nachtwächterstaat geißeln.
Der Generalbundesanwalt verkündete die ersten Ermittlungsergebnisse. Der oder die Täter mussten den BGH schon eine Weile beobachtet haben. So fanden sie heraus, dass seit Wochen eine Klempnerfirma die sanitären Einrichtungen des Erbgroßherzoglichen Palais erneuerte. Der oder die Täter hätten einen Handwerker, der auf dem Weg zum BGH gewesen sei, angehalten, ihn bedroht und gezwungen, sie in einem Renault-Lieferwagen einzuschleusen, nachdem sie zuvor an einem anderen Ort eine große Gasflasche geladen hätten. Der Wache an der Einfahrt sei nichts aufgefallen, da dieser Handwerker jeden Tag mit diesem Auto ein- und ausgefahren sei. Der oder die Täter hätten den Mann gezwungen, das Auto auf dem Parkplatz neben dem Haupteingang des Palais abzustellen. Dann hätten sie den Handwerker gezwungen, zusammen mit einem der Täter oder dem Täter die Gasflasche in den Keller des Gebäudes zu tragen. Sofort darauf hätten beide sich wieder ins Auto gesetzt und das Gelände des BGH verlassen, der oder die Täter wieder verborgen im fensterlosen Lastraum des Wagens. Nach dem Wagen und dem Handwerker werde gesucht, bisher habe die Polizei keinen Hinweis auf deren Verbleib. In der Gasflasche habe sich der Sprengstoff befunden, der Zünder sei später mit einem Handy ausgelöst worden.
Spät am Abend wurde der Präsident des baden-württembergischen Verfassungsschutzes im Fernsehen befragt. Nein, von der Gruppe Dar al-Islam habe sein Amt noch nichts gehört. Aber das sei ein Kennzeichen des |14|heutigen Terrorismus, dass überall Gruppen entstünden, die sich für berufen hielten, die westliche Zivilisation zu bekämpfen. »Wenn Sie so wollen, der Feind ist mitten unter uns. Schon lange.«
[Menü]
|15|2
Drei Monate vor dem Anschlag.
Ihr Blick folgte einem Frachter, der tief im Wasser lag. Sie sah weißen Bugschaum. Da unten floss der Charles River zum Atlantik. Ein wenig erinnerte er sie an die Elbe, die Hamburg mit der Nordsee verband. Sie war mit ihrer Mutter vor zwei Jahren in Hamburg gewesen. Die war eines Tages auf die Idee gekommen, nach Deutschland zu fliegen. Sie wollte die Heimat noch einmal sehen. Und so mieteten sie ein Auto und fuhren in die Heide, durch kleine Städte und Dörfer irgendwo zwischen Hamburg und Hannover. Ihre Reise endete in Wolfsburg. »Fast wärst du hier geboren worden«, sagte die Mutter. »Wir haben hier nach dem Krieg gewohnt.« Sie zeigte auf die riesigen Schornsteine, die in den blauen Himmel ragten. Als wäre das Werk ein riesiges Kirchenschiff mit vier Türmen. »Um das da wiederaufzubauen. Dein Vater hat dort gearbeitet. Wie fast alle anderen hier.« Cecilia erinnerte sich, wie fremd ihr diese Stadt erschien, deren Herz ein Autowerk war und die nur für dieses Werk lebte.
Sie waren bald wieder abgefahren, die Mutter schwieg auf der Rückreise nach Hamburg, und Cecilia fühlte, der Mutter war es nicht um Hannover oder Hamburg gegangen, nicht um die Heide, sondern um den kürzesten Besuch von allen, den in Wolfsburg.
Irgendwo zwischen Boston und Hamburg trafen sich gewiss Wassermoleküle der Elbe und des Charles River. Sie schloss die Augen und versuchte sich Meeresströmungen vorzustellen, die sich in Orkanwellen |16|mischten. Doch dann hatte sie wieder die Bilder des heutigen Nachmittags vor Augen. Wie sie in der ersten Reihe der kleinen Friedhofskirche gesessen hatte, neben ihr Elizabeth, die einzige Freundin der Mutter, oder so etwas Ähnliches wie eine Freundin. Und natürlich war Paula erschienen, nicht wegen der Mutter, sondern um Cecilia beizustehen. Die Beerdigung hatte Cecilia wie aus der Ferne erlebt, die Trauerrede hatte sie eigentlich nicht gehört. Erst als der Sarg im Boden verschwand, um verbrannt zu werden, da hatte sie verstanden, dass ihr demnächst die Urne ausgehändigt würde, die Asche ihrer Mutter. Sie hörte in sich hinein, ob die Vorstellung etwas bewegte in ihr, aber da war nichts.
Das Wasser rauschte im Bad, dann klackte die Tür. Paula näherte sich, die Falten in ihrem Gesicht schienen noch tiefer zu sein. Sie setzte sich aufs Sofa, Cecilia gegenüber, blickte zum Fenster hinaus und sagte: »Viel schöner kann man nicht wohnen. Jedenfalls nicht, wenn man nicht stinkreich ist.«
Da fiel Cecilia ein, dass die Wohnung nun ihr gehörte. Hier hatte sie ihre Mutter in den vergangenen Jahren gepflegt. In der letzten Zeit war es hart gewesen, die Mutter hatte sie manchmal nicht erkannt, weigerte sich oft zu essen und schien darauf zu warten, endlich sterben zu können. Ihr Gedächtnis schwand, sie wurde oft wütend, klagte, bat, sie endlich zu töten – »das wollt ihr doch sowieso« –, sprach mit Menschen, die nicht anwesend waren und die Cecilia nicht kannte. Manchmal aber schien die Erinnerung zurückzukommen oder für bestimmte Ereignisse noch nicht gelöscht zu sein.
Paula blickte Cecilia lange an, aber sie sagte nichts, dann schaute sie hinaus auf den Fluss. Ein Motorboot raste schlingernd zum anderen Ufer.
|17|»Ich habe … dir … nicht … alles gesagt.« Cecilia erinnerte sich genau, wie die Mutter sich gequält hatte in ihrem letzten lichten Augenblick. Das Bett stand am Fenster, etwa dort, wo Paula jetzt saß, aber die Mutter schaute nicht hinaus auf den Fluss, ihre Augen waren geschlossen. Eine Träne sickerte aus dem Auge und hinterließ eine glänzende Bahn zum Ohr. Es war ein Morgen gewesen, an dem der Sturm schwarze Wolken zum Meer jagte, manchmal kam die Sonne durch, das Licht weiß gebrochen.
»Du hast … einen guten Vater gehabt.«
Cecilia erinnerte sich, wie sie gestaunt hatte, als die Mutter dies gestand. In all den Jahren war vom Vater kaum die Rede gewesen und wenn doch, dann mit abschätzigem Unterton. Dann klang die Stimme so, wie man über einen sprach, der einer Freundin ein Kind gemacht hatte und dann abgehauen war, um sich der Unterhaltszahlung zu entziehen.
»Du hast … einen guten Vater gehabt.« Sie hatte es wirklich gesagt.
»Aber …«, entgegnete Cecilia.
Die Mutter hob die Hand ein wenig von der Bettdecke und senkte sie wieder. »Er ist gegangen. Und ich habe ihn allein gehen lassen.«
»Du hattest bestimmt einen guten Grund.« Cecilia sagte es mehr, um die Mutter zu trösten.
»Ich habe ihn allein gehen gelassen«, wiederholte die Mutter mit leiser Stimme, was ihr Beharren noch eindringlicher machte. »Ich hätte mitgehen müssen.«
Cecilia hatte überlegt, was sie erwidern sollte. Sie fand es nicht sinnvoll, einer Sterbenden zu widersprechen. Wer stirbt, hat recht. Das hatte sie mal gehört. Wo ist das gewesen und wann? Ach, egal.
»Weißt du, Cecilia, er hatte mich gefragt.« Die Mutter |18|stockte nicht mehr beim Reden. Sie sprach nun fast flüssig, als hätte sie sich endlich entschlossen zu sagen, was gesagt werden musste.
»Ob du mitkommen willst?«
»Und ich habe gesagt: Nein, wo du hingehen willst, kann ich nicht gehen.«
»Aber ich muss«, hatte er gesagt. »Er hatte recht, ich hab’s nicht geglaubt. Ich habe ihm nicht geglaubt. Oder ich wollte ihm nicht glauben.«
»Wohin?«, fragte Cecilia. »Wohin ist er gegangen?« Cecilia erschrak, sie war zu heftig gewesen.
Die Mutter schloss die Augen. Das tat sie immer, wenn sie etwas anstrengte.
Cecilia hätte gern nachgefragt, sie verstand so wenig von dem, was die Mutter sagte. Die Mutter war kurz vor ihrer Geburt in die USA gezogen. Cecilia war Amerikanerin, was ging sie Deutschland an? Es war nicht gut, was sie über dieses Land erfahren hatte. Oder was der Mutter dort angetan worden war. Manchmal hatte die Mutter etwas über früher gesagt, und es hatte immer geklungen wie: Gott sei Dank bin ich nicht mehr dort. Gott sei Dank! Dort, das hieß Trümmer nach der Zerstörung durch den Krieg. Das hieß Arbeit, Arbeit und noch einmal Arbeit. Und das war etwas, das Cecilia mit Freudlosigkeit übersetzte, mit ewigem Ernst, unaufhörlicher Trübsal. Manchmal hatte die Mutter Bemerkungen fallen gelassen, die sich Cecilia etwa so zusammenreimte. Es hatte sie nicht ermuntert nachzufragen. Das war alles so weit weg. Und dort sollte es bleiben. Außerdem wollte sie die Mutter nicht bedrängen mit Fragen. Jetzt nicht mehr.
»Ich hätte mitgehen müssen.« Ihre Augen waren wieder offen. Ein Sonnenstrahl fiel auf das Gesicht der Mutter und leuchtete die Falten aus. Besonders viele zerknitterten |19|die Stirn. Dann verdunkelte eine Wolke das Licht und verjüngte das Gesicht um ein Jahrzehnt.
Cecilia schaute sie an. »Ich bin sicher, du hast alles richtig gemacht. Haben wir nicht gut gelebt?« Natürlich, ihre Scheidung war schmerzhaft gewesen, aber heutzutage hatte man doch keine Biografie, wenn man nicht wenigstens einmal geschieden war. Es war auch eine Befreiung gewesen. Seitdem hatte sie sich noch tiefer in ihrem Beruf vergraben und gutes Geld verdient als Immobilienmaklerin in einem kleinen Büro in der City, das sie mit Walter Hermit teilte. Er hatte sie nach der Scheidung eingestellt und ihr bald die Geschäftspartnerschaft angeboten. Sie kam gut mit ihm aus, nachdem sie seine Annäherungsversuche einmal deutlich zurückgewiesen hatte. Walter war sympathisch, eine ehrliche Haut, sofern man das in diesem Beruf sein konnte, und er sah gut aus. Aber er war ihr zu sehr der Typ Sonnyboy, und nach der Scheidung hatte sie keine Lust auf Beziehungen gehabt. Wenn sich die Sehnsucht nach Liebe oder auch nur Sex bemerkbar machte, musste sie sich nur die letzten eineinhalb Jahre mit Jonathan ins Gedächtnis rufen, in denen sie erlebt hatte, wie krankhafte Eifersucht aus einem unwiderstehlichen Mann einen Dreckskerl gemacht hatte, der sie fortlaufend des Fremdgehens bezichtigte, ohne dass sie jemals die Gelegenheit dazu genutzt hatte. Ich hätte mit anderen Männern ins Bett gehen müssen, dann hätte der Irrsinn wenigstens einen Sinn gehabt, dachte sie. Aber das Ungeheuerliche war, dass Jonathan fremdging, dass er wohl ein halbes Jahr mit einer Nachbarin ins Bett stieg und sie es nicht gemerkt hatte. Erst als die Ehe geschieden war, hatte Jonathan es ihr gestanden, ermutigt durch ein paar Wodkas. Es war ein Verrat gewesen. Dass ihr so etwas passierte. Dass ein krankhaft eifersüchtiger Mann sich die Frechheit |20|herausnahm, genau das zu tun, was er ihr ohne jeden Grund immer wieder vorgeworfen hatte, zum Teil in abstoßenden Szenen: Er hatte geheult, geschrien, Selbstmord angekündigt. Das alles machte sein Verhältnis mit der Nachbarin noch schlimmer. Auch dass Cecilia diese Nachbarin als ein nichtssagendes Wesen empfunden hatte, an das schon keiner mehr dachte, sobald es um die Ecke gegangen war. Mit der! Aber nun war sie darüber hinweg, meistens jedenfalls. Vielleicht würde sich die Enttäuschung nie völlig verdrängen lassen. Der Verrat, der Betrug, die Lügen.
»Was überlegst du?«, fragte Paula.
Da, wo vor Kurzem noch das Bett der Mutter auf Rollen gestanden hatte, war nichts mehr außer den Eindrücken im Teppichboden. Er war grau und fleckig. Sie würde ihn demnächst austauschen. »Ich dachte an das letzte Gespräch mit meiner Mutter. Als sie noch einmal klar war, jedenfalls klarer als in den Tagen zuvor.«
Paula lächelte. Sie war Cecilias beste Freundin, sie kannten sich seit der gemeinsamen Schulzeit. »Ja, das bleibt einem im Gedächtnis.« Paulas Eltern waren schon lange tot.
Cecilia nahm Paula in diesen Augenblicken nicht wahr. Die Mutter hatte früher immer gesagt, der Vater habe sie verlassen, als sie schwanger gewesen sei. »Dein Vater hat mich verraten«, sagte sie einmal, als Cecilia keine Ruhe gab. Alle ihre Freundinnen hatten Väter. Warum sie nicht? Dass er nicht gestorben war, war ihr von Anfang an klar gewesen. »Er hat jetzt bestimmt eine Jüngere, eine, die ihm nicht widerspricht. Er hat ja immer so genau gewusst, was richtig ist und was falsch. Sei froh, dass du diesen Vater nicht hast. Besser keinen Vater als diesen.«
|21|Aber im letzten Gespräch sagte die Mutter: »Du hast einen guten Vater gehabt.« Ein paar Minuten später wiederholte sie es. Die Mutter hatte Cecilia also angelogen in all den Jahren zuvor. Was sollte Cecilia tun? Böse sein konnte sie ihrer Mutter nicht mehr. Das war sie früher oft gewesen, aus lächerlichen Gründen. Cecilia war kein einfaches Kind gewesen. Die Mutter hatte sie verzogen, wollte ihr den Vater ersetzen. Und als Cecilia merkte, dass die Jungs ihr nachschauten, galt sie bald als hochnäsig und zickig. Sie betrachtete sich gern im Spiegel und bildete sich einiges ein auf ihr Aussehen, schlank, hochgewachsen, volle blonde Haare. Nicht nur ein bisschen Unnahbarkeit war ihr geblieben, ja, sie pflegte diese Eigenheit, weil die sie noch interessanter machte. Und sie konnte nicht erkennen, dass es nachteilig für sie gewesen wäre. Besser als langweilig war es allemal. Und schön war sie immer noch.
Paula dagegen war unscheinbar. Natürlich hatte sie nie eine Chance gehabt bei den Jungs, wenn sie mit Cecilia zusammen unterwegs gewesen war. Auf Partys war sie das Mauerblümchen, aber sie trug ihr Schicksal gelassen, fast freudig. Sie war immerhin die beste Freundin der Klassenqueen, das verschaffte ihr Ansehen, es fiel gewissermaßen etwas vom Glanz für sie ab. Cecilia wusste nicht, wie Paula es schaffte, sich wohlzufühlen in ihrer Rolle. Aber sie hatte auch nie wirklich darüber nachgedacht. Gewundert hatte sie sich manchmal, mehr nicht.
»Und ich habe ihn verlassen. Nicht er mich, obwohl er gegangen ist.« Ihre Stimme war leise, aber dadurch umso eindringlicher. »Das muss man verstehen. Ich hätte es verstehen müssen. So schlimm war das Leben dort doch nicht. Und vielleicht hätten wir ja wieder zurückgekonnt. Die Dinge ändern sich. Ich habe ihn verraten.«
|22|Cecilia verstand nicht ganz, was die Mutter sagte. Doch begriff sie, dass sie sich lange gequält haben musste mit ihrer Entscheidung, ihrem Mann, Cecilias Vater, nicht zu folgen. Cecilia lag die Frage auf der Zunge, ob der Vater noch lebe, aber sie schwieg. Sie musste sich erst daran gewöhnen, dass die Mutter sie belogen hatte.
»Ich habe nie wieder etwas von ihm gehört.« Die Mutter strich mit der Hand über die Bettdecke. Die Hand zitterte. »Und ich habe dir deinen Vater genommen.«
»Er ist gegangen, nicht du«, sagte Cecilia und wusste gleich, ihre Mutter würde sich so nicht trösten lassen.
»Er musste weg. Ich habe nie mehr etwas von ihm gehört.«
Cecilia drängte es zu fragen, was der Vater beim Abschied gesagt hatte, aber sie hatte Angst, dass es die Mutter zu stark schmerzen würde.
Paula räusperte sich. Sie stand auf und ging ein paar Schritte zum Fenster. Sie kehrte Cecilia den Rücken zu und schaute hinaus. Ohne sich umzudrehen, sagte sie: »Man begreift es nicht, wenn jemand stirbt. All die Jahre war er da, dann soll er plötzlich weg sein für alle Zeit.«
»Ich habe einen Vater«, sagte Cecilia. Sie flüsterte fast.
Paula drehte sich um, lächelte sie an, aber in ihrem Gesicht stand ein Fragezeichen. Vielleicht dachte sie, jeder Mensch hat einen Vater. Aber Cecilia hatte nie etwas über ihren Vater erzählt. Als Paula sie vor langer Zeit gefragt hatte, wo ihr Vater sei, als die Neugier ihre Angst, etwas Bedrückendes anzusprechen, besiegt hatte, da hatte Cecilia nur gesagt: »Ich kenne ihn nicht.« Und ihre Gestik und Mimik hatten gesagt: Er hat sich nicht um mich gekümmert, was soll ich mich um ihn kümmern?
»Vielleicht lebt er noch«, sagte Cecilia.
Paula nickte. Sie setzte sich wieder und schaute Cecilia |23|in die Augen. »Dann muss er aber sehr alt sein.« Es klang, als wollte sie sagen: Mach dir keine Hoffnung, der ist längst tot. Dann fragte sie: »Er hat wirklich nie von sich hören lassen?« Und es klang, als wollte sie fragen: Warum interessiert er dich plötzlich?
»Ja, aber nun weiß ich, warum er sich nie gemeldet hat.«
»Ja?«
Cecilia antwortete nicht. Sie spürte ein Gefühl in sich, das sie nicht recht begreifen konnte. Etwas zwischen Enttäuschung und Zorn, auch Trauer. Warum hatte die Mutter so lange geschwiegen? Nein, warum hatte sie so lange gelogen? Ihr Schweigen nach der Erklärung, der Vater sei weggegangen, war eine Lüge. Sie hatte der eigenen Tochter den Vater gestohlen. Mochte doch sein, dass Cecilia nach Europa gereist wäre, um ihren Vater kennenzulernen. Vor zwanzig Jahren, da hatte er bestimmt noch gelebt. Sie hatte nicht einmal gewusst, wie er hieß.
Franz.
Als sie eines Tages mitten im Sommer aus der Schule nach Hause kam, brannte das Feuer im Kamin. Die Mutter legte immer mehr Papier nach. Der Ascheberg verriet, dass sie schon viel verbrannt hatte. Die Mutter sagte nichts, als Cecilia ins Wohnzimmer trat und einfach nur schaute. Aber ihr Gesicht war hart gewesen wie eine Maske, als wollte sie sich zwingen, kein Gefühl zu zeigen. Erst nach dem Tod der Mutter verstand Cecilia, die Mutter hatte ihre Vergangenheit verbrannt. Sie hatte es nicht mehr ausgehalten mit den Briefen und Papieren, in denen ihre Lüge weiterlebte. Sie hatte versucht, mit den Papieren die Lüge zu zerstören, aber es war ihr nicht geglückt. Erst auf dem Totenbett hatte die Mutter die Wahrheit wiedergefunden. Cecilia bildete sich ein, die |24|Mutter sei zufrieden gestorben, ihr Gesicht kam Cecilia fast entspannt vor.
»Weißt du, sie ist eingeschlafen, ganz ruhig, und nicht mehr aufgewacht. Das konnte sie wohl nur, weil sie sich von der Lüge befreit hatte.«
Paula schaute sie ungläubig an. Für sie war Cecilias Mutter ein Sinnbild von Rechtschaffenheit gewesen. Kein Mensch, den man liebt, dazu war die Mutter zu spröde gewesen, aber ein Mensch, den man achtet, an dem nichts Falsches war. »Sie hat dich also angelogen?« In ihrer Stimme schwang Ungläubigkeit mit.
»Mein Vater ist nicht abgehauen, sie hat ihn verlassen, noch während sie schwanger mit mir war.« Cecilia brach ab, sie sah, Paula verstand sie nicht.
Paula dachte nach, dann sagte sie: »Deine Mutter hat dir also den Vater gestohlen.«
Gestohlen ist vielleicht das falsche Wort. Und doch war es so, dachte Cecilia. Sie hatte keinen Vater gehabt, weil die Mutter nicht zu ihrem Mann gestanden hatte, als es ihm offenbar schlecht ging. Cecilia schaute sich um in ihrem Wohnzimmer, eigentlich war es das Wohnzimmer der Mutter, sie lebte in einem der Beacon Hill Apartments, nicht weit entfernt. Sie hatte in letzter Zeit hin und wieder gedacht, es sei günstiger für sie, in die Wohnung am Charles River zu ziehen, die sie nun geerbt hatte. Aber seit dem Geständnis war diese Idee verflogen. Sie musste hier weg.
»Kannst du diese Wohnung für mich vermieten?«
Paula schaute sie erstaunt an. Aber nicht, weil sie es als Zumutung empfand, etwas für ihre Freundin zu tun. Das war sie gewohnt. Sie verstand allerdings nicht, warum Cecilia eine Wohnung vermieten wollte, die viel schöner war als ihre. Und dieser Blick auf den Fluss war unbezahlbar. »Natürlich«, sagte Paula.
|25|»Und kannst du in meiner Wohnung nach dem Rechten sehen? Vielleicht einmal die Woche? Die Nachbarn gießen die Blumen. Aber man weiß ja nicht.«
»Gewiss«, sagte Paula. »Aber was hast du vor?«
[Menü]
|26|3
Elf Wochen und zwei Tage vor dem Anschlag.
Stachelmann nieste. Er musste grinsen. Er saß im Staub, wie es sich für einen Historiker gehörte. Genauer gesagt, er saß an einem Stahltisch in einem großen fensterlosen Kellerraum im Backsteingebäude der Werkzeugmaschinenfabrik Schneyder & Söhne AG in Lübeck-Genin und wälzte Akten aus den Dreißiger- und Vierzigerjahren. Niemand hatte die Ordner in den vergangenen Jahrzehnten angefasst. Es war der Staub des Dritten Reichs, der Kriegsjahre, der Zeit des Wirtschaftswunders, der APO, der neuen Ostpolitik, des Flickskandals, der geistig-moralischen Wende Helmut Kohls und seiner schwarzen Kasse. Stachelmann überlegte, ob Staub verschiedener Epochen verschieden aussehen müsse. Ob der Staub der Hitlerzeit ein anderer sei als etwa der aus den Achtzigern. Schließlich unterschieden sich seine Quellen, das Papier, die Abgase, sogar der Straßendreck. Der Staub jener Akten, die er zu lesen hatte, stammte vom Papier und aus dem Gebäude, das kurz nach dem Ersten Weltkrieg errichtet worden war. Es war also größtenteils alter Staub, weil nur selten Menschen hier unten gewesen waren. Wer interessiert sich schon für alte Akten außer Historikern?
Hier saß er seit zwei Wochen. Es war sein erster Auftrag, seit er sich entschieden hatte, ein Büro für historische Ermittlungen zu eröffnen. Obwohl er vor Kurzem erst die Universität verlassen hatte, schien ihm seine Zeit als Dozent und die Habilitation schon weit zurückzuliegen. In diesen Tagen fühlte er sich, als hätte |27|es Bohming, den Ordinarius mit dem Spitznamen »der Sagenhafte«, nur in einer fernen Zeit gegeben. Stachelmann hatte wohl gehört, der Professor habe sich krankschreiben lassen, aber das war ja klar, nach dem, was in den letzten Monaten Stachelmanns als Unidozent geschehen war.
Georgie, den Stachelmann eigentlich nicht mehr hatte wiedersehen wollen, hatte ihm eine Homepage gestrickt – »Sie suchen Ihre Vergangenheit?« – und ins Internet gestellt. Zwei Tage später erhielt Stachelmann eine E-Mail von der Schneyder & Söhne AG aus Lübeck. Schon am Vormittag danach saß Stachelmann einem jungen Geschäftsführer gegenüber, der ihn beauftragte, eine Firmengeschichte zu verfassen. »Aber nichts verschweigen, egal, was da kommt.« Dann fabulierte der Mann, den trotz seines Alters schon eine Halbglatze bedrohte, über die imagefördernde Wirkung der Wahrheit, »inklusive des Nazismus«. Dr. Kolumbitsch, so hieß der Mann, zischte das Wort »Nazismus« durch fast geschlossene Lippen. Es dauerte, bis Stachelmann sich zutraute, den Namen des Geschäftsführers auszusprechen. Kolumbitsch saß hinter seinem Schreibtisch, genauer gesagt, er hüpfte fast mit dem Hintern auf seinem Stuhl herum, schien immer wieder aufstehen zu wollen und überholte sich selbst beim Reden. Dabei setzte er seine rahmenlose Brille ab und wieder auf, dann putzte er sich die Nase, kratzte sich an der Stirn, beugte sich nach vorn und streckte den Rücken, während er über die neue Moral der deutschen Unternehmer sprach, die man sich inzwischen nicht nur leisten könne, sondern offensiv vertreten müsse. »Da ja ohnehin jeder weiß, dass selbst in Klostern Zwangsarbeiter eingesetzt wurden, wäre es geradezu lachhaft, wenn ein deutsches Unternehmen mit Tradition bestreiten würde, es getan zu haben. Wäre ich |28|ein Zyniker, würde ich sagen, das Bekenntnis gehört zum Marketing.«
Stachelmann verstand, was der Mann sagen wollte. Der verachtete die Altvorderen, die sich vor ihrer Verantwortung ins Grab gerettet hatten. Aber er erkannte auch die Vorteile, die sich daraus für ihn und die Firma ergaben. Ein Eingeständnis, das dem Bekenner die Selbsterhöhung erlaubte. Reue, obwohl man selbst keine Verbrechen begangen hatte. Das sah gut aus.
»Wissen Sie, wir verkaufen unsere Maschinen in aller Welt, die meisten in den USA. Unsere Kunden würden bei einer Firma mit unserer Tradition ja geradezu staunen, wenn wir nicht auch im Krieg erstklassige Ware an unsere Kunden geliefert hätten, und das war eben die Wehrmacht. Vor allem Flakmunition, Bauteile für Raketenwerfer, Steuerelemente für Flugzeuge usw. Allmählich betrachten die Leute das von der technischen Seite, verstehen Sie? Und das ist doch auch eine technische Frage, oder?« Technisch, aus seinem Mund kam es wie ein Zischen, etwas heller noch als Nazismus. Dabei rollte er mit seinem Stuhl hin und her, nach hinten und nach vorn, fuhrwerkte mit seinen Armen auf dem Schreibtisch herum wie ein hyperaktives Kind.
Stachelmann lag eine Erwiderung im Mund. Aber es war nicht seine Aufgabe, diesen Mann zu belehren, sondern Geld zu verdienen als Verfasser einer Firmengeschichte. Warum gerade er beauftragt worden war, erfuhr er gleich.
»Ich habe mich am Historischen Seminar der Hamburger Universität erkundigt. Ein ehemaliger Kollege von Ihnen hat mir gesagt, Sie hätten sich gerade selbstständig gemacht. Außerdem seien Sie Lübecker. Das verpflichtet gewissermaßen. Welch Glück für mich.« Und er strahlte wie ein Mensch, der froher nicht sein konnte.
|29|Was könnte Stachelmann verpflichten, weil er Lübecker war? Und warum liegt diesem Mann diese Firmengeschichte so am Herzen? Warum diese Geschichte gerade jetzt? Dumme Frage, wann ist dafür der richtige Zeitpunkt? Er wäre 1945 gewesen. Es steckten ein paar Moleküle Häme in Kolumbitschs Lachen, wenn er über das Projekt sprach, er klang fast so, als wolle er mit Stachelmanns Hilfe jemandem eins auswischen.
Eigentlich war es ein öder Job. Hunderte von Aktenordnern mit Tausenden von Seiten, auf denen meistens nichts stand, was einen aufregen könnte. Zeitweise hatte Stachelmann gefürchtet, das Material würde nicht reichen für ein Buch. Aber inzwischen fürchtete er nur noch, er würde es nicht hinkriegen oder zu lange brauchen. Es erinnerte ihn an das Elend mit seiner Habilschrift, die er weggeworfen hatte, nachdem er fertig gewesen war mit der Quälerei. Doch hin und wieder fand er Dokumente, die er nicht überflog, um gleich weiterzublättern, sondern die er aufmerksam las. Zuletzt Belege für Spenden an die SS, von der die Firmenleitung sich offenbar Unterstützung versprach in der Auseinandersetzung mit anderen Mächtigen des Nazireichs. Die Geschäftsführung schickte auch Denunziationsberichte an die Gestapo über Fremdarbeiter, die im Verdacht der Sabotage standen.
Es klopfte, gleichzeitig öffnete sich leise quietschend die Stahltür. »Der Chef würde Sie gerne sprechen. Wenn es Ihnen recht ist«, sagte Cordula Weinrot, die Chefsekretärin, eine mollige Vierzigjährige, die gerne im Keller auftauchte, seit Stachelmann dort arbeitete. Gleich am Anfang hatte sie ihn ausgefragt, ob er verheiratet sei und ob er allein lebe. Seitdem erschien sie immer mal wieder mit Kaffee, um ein »Schwätzchen zu halten«, wenn der Geschäftsführer außer Haus war. Stachelmann fürchtete ihre Redseligkeit und bewunderte sie doch, weil sie seit |30|sieben Jahren einen Chef ertrug, der pausenlos dies oder jenes wollte, um dann doch etwas ganz anderes zu verlangen. Cordula Weinrot, Lübeckerin seit Geburt, hatte Nerven aus Stahl.
»Wenn es Ihnen recht ist.« Stachelmann war es bei seinem Kellerjob jederzeit recht und unrecht zugleich. Anders gesagt, es war ihm egal. Längst hatte er gemerkt, dass der Chef auf seine Weise nicht weniger schwatzsüchtig war als seine Sekretärin. Stachelmann folgte ihr zum Aufzug, in dem sie ihm immer ein wenig zu nahe kam, rein zufällig gewissermaßen, knapp an der Grenze der Berührung. Er konnte sie riechen, es war nicht unangenehm, unterstrich aber ihre Nähe. Stachelmann fühlte sich bedrängt, aber die paar Sekunden hielt er es aus. Es war eine kleine Befreiung, als der Aufzug in der Chefetage hielt und die Türen sich öffneten.
Dr. Kolumbitsch stand am rückwärtigen Fenster und schaute hinunter auf den Hof. Er wippte auf den Fußballen. »Herr Dr. Stachelmann, danke, dass Sie gleich Zeit gefunden haben. Ich würde gerne mit Ihnen über Ihre Notiz von gestern sprechen.«
Aha, daher wehte also der Wind. Kolumbitsch hatte Stachelmann vor einigen Tagen gebeten, ihm einen kleinen Bericht zu geben, in dem es ihm vor allem auf etwas ankam, das er »Besonderheiten« nannte. Darunter verstand er Dinge, die »aus dem Rahmen fallen«.
Auf dem Tisch lag der kurze Bericht von Stachelmann über die ersten Ergebnisse seiner Arbeit. Er hätte sich nicht darauf einlassen sollen, Notizen für Kolumbitsch zu schreiben. Das konnte nervig werden, wenn der über jedes Detail der Recherche reden wollte.
»Das ist wirklich wahr, was Sie da schreiben?«
Warum sagte der Mann nicht, um was es ihm ging? »Alles.«
|31|»Nun ja.« Kolumbitsch betrachtete das Blatt Papier, auf dem Stachelmanns Bericht stand, seufzte und sagte: »Wirklich?«
Was wollte Kolumbitsch? Dass Stachelmann jetzt sagte, er habe sich geirrt? Oder es sei nicht so schlimm, unwichtig, zu unwichtig, um es in einer Firmengeschichte unterzubringen?
»Wissen Sie, wir wollen das unseren Kunden schenken.«
Stachelmann nickte. Das hatte Kolumbitsch schon erklärt, als er Stachelmann den Auftrag gab.
Kolumbitsch nahm das Blatt mit Stachelmanns Notiz zwischen Zeigefinger und Daumen, als wäre es schmutzig, betrachtete Vorder- und Rückseite, dann wieder die Vorderseite und legte es zurück auf den Schreibtisch. Er wackelte hin und her auf seinem Stuhl, kratzte sich an der Braue, schnippte mit den Fingern, warf Stachelmann einen Blick zu mit auf die Seite geneigtem Kopf, blies leise zischend Luft aus und atmete zischend wieder ein.
Das Telefon auf seinem Schreibtisch klingelte. Er drückte auf einen Knopf auf dem Apparat, ohne abzunehmen, und sagte: »Ich möchte jetzt nicht gestört werden.« Dann drückte er wieder auf den Knopf.
Stachelmann beobachtete sein Gegenüber und fragte sich, ob er sich ärgern oder amüsieren sollte. Er erinnerte sich gut, wie Bohming ihm einmal den Auftrag zugeschanzt hatte, die Geschichte einer Hamburger Werft zu schreiben. Das war gescheitert, weil eine üble Sache dazwischengekommen war. Was würde aus diesem Auftrag werden?
»Denunziation«, sagte Kolumbitsch. Er kratzte sich an der Nase.
Und Stachelmann fiel der Spruch ein: Das größte Schwein im Land ist der Denunziant.
|32|»Mir ist nicht ganz klar, welche Folgen sie hatte.«
Dann hättest du meine Notiz genauer lesen sollen, dachte Stachelmann. »Den Tod in aller Regel. Sabotage wurde mit dem Tod bestraft.«
»Und die Fälle stimmen, ich meine die Zahl?«
»Sieht so aus. Eher kommt noch was dazu.«
»Was heißt, dass die damaligen Eigentümer die Leute der Gestapo ausgeliefert haben«, sagte Kolumbitsch.
Das steht in meinem Bericht, dachte Stachelmann. Ich muss es nicht wiederholen.
»Haben das nicht alle gemacht?«
Du meinst, wenn Denunziation ein Volkssport war, ist sie nicht mehr so übel? Stachelmann überlegte, ob er Kolumbitsch den Auftrag vor die Füße werfen sollte. Aber er brauchte das Geld. »Nicht alle, viele.«
»Nun ja. Und diese Spenden an die SS?«
»Nicht alle, einige.«
Kolumbitsch hustete, um Zeit zu gewinnen. »Nicht alle, einige«, wiederholte er. Stachelmann wusste, Kolumbitsch hätte es leichter, wenn Stachelmann auch etwas sagte. Aber warum sollte er es dem Mann leicht machen? Und warum, verdammt, hatte er sich darauf eingelassen, Kolumbitsch zu berichten? Die Lektion hatte er gelernt, beim nächsten Auftrag würde er es nicht mehr tun.
»Aber wenn fast alle …« Kolumbitsch stockte. »Wenn fast alle es getan haben, muss man es dann so … hervorheben?«
Stachelmann fragte sich, ob er lachen oder fluchen sollte. »Denunziation war eine Art Kitt, der das Dritte Reich zusammenhielt. Ohne Denunziation hätte die Gestapo niemals so erfolgreich arbeiten können. Davon abgesehen, habe ich nichts hervorgehoben.«
»Nun ja.« Kolumbitsch lehnte sich zurück, dann stand er auf, ging zur Vorzimmertür, legte die Hand auf die |33|Klinke, zog sie weg und setzte sich wieder auf seinen Schreibtischstuhl.
Er windet sich wie eine Schlange. Nun sag doch endlich, was du sagen willst.
»Sie verstehen …«
»Nein«, sagte Stachelmann ungeduldig. Er wollte zurück zu seinen Akten, Kolumbitschs Vorführung begann ihn zu nerven. Natürlich wusste er längst, worauf der Geschäftsführer hinauswollte. Aber der hatte die Absicht, Stachelmann so lange zu bereden, bis dieser selbst vorschlug, was Kolumbitsch verlangte. Doch Stachelmann hatte nicht die Absicht, es zu tun.
Kolumbitsch warf ihm einen fast traurigen Blick zu. Er schloss die Augen und schien fieberhaft zu überlegen, wie er herauskommen sollte aus dem Schlamassel. »Wäre es nicht richtig, darauf hinzuweisen, was unsere Firma von anderen unterscheidet?«
»Natürlich«, sagte Stachelmann, der sich mühte, nicht laut zu lachen. »Natürlich.« Das letzte Natürlich sagte er im Ton eines Vaters, der seinen Sohn beruhigen will: Nun reg dich nicht auf, du verstehst das noch nicht, aber es wird schon.
»Dann sind wir uns ja einig.« Kolumbitsch lächelte erst, dann schaute er Stachelmann abwartend an, ein wenig Misstrauen lag im Blick.
Auf was sollten sie sich geeinigt haben? Stachelmann überlegte, ob er Kolumbitsch auflaufen lassen oder sich mit ihm auseinandersetzen sollte. Er hatte einen Vertrag, nirgendwo stand, dass das Buch, das er schreiben sollte, kontrolliert würde. Er hätte einen solchen Vertrag auch nicht unterschrieben. Wie sollte eine Firma am Ende behaupten, die Untersuchung sei unabhängig gewesen, wenn im Vertrag geregelt war, dass Stachelmann sein Manuskript genehmigen lassen musste? Soll ich im |34|Keller sitzen und den Krach vor mir herschieben, oder soll ich es jetzt gleich darauf ankommen lassen? Wenn der mich rausschmeißt, dann muss er mich abfinden. Dagegen spricht, dass eine erste Firmengeschichte aus deiner Hand eine gute Referenz wäre für künftige Auftraggeber. Doch Stachelmann konnte nicht anders: »Einig über was?«
Kolumbitsch setzte an, eine höfliche Grimasse zu ziehen, aber das Gesicht vereiste, bevor es ihm gelungen war. »Zwangsarbeiter, Rüstungslieferungen können wir nicht leugnen. Wollen wir auch nicht. Aber wie mir berichtet wurde, hat man die Zwangsarbeiter anständig behandelt. Ich meine Essen, Ärzte …«
Hat man – eine kleine Nebelkerze, die Verantwortlichen werden unkenntlich.
»Man hat die Zwangsarbeiter mit Hungerrationen bedacht, Kranke hat man an die SS zurückgegeben, damit sie in einem KZ … heute würde man sagen, entsorgt werden konnten. An den Rüstungslieferungen hat man gut verdient, die Menge macht’s, den Betrieb ausgeweitet und Grundlagen geschaffen für die weitere Expansion nach dem Krieg. Es gibt keine Stunde null, für die Industriellen in den späteren Westzonen gab es höchstens einen Moment der Irritation, und dann ging es weiter. So war es bei Flick, Krupp und Deutscher Bank, so war es auch bei dieser Firma. Übrigens war der Hauptverantwortliche für alles der damalige Geschäftsführer Otto Schneyder, der auch die meisten Firmenanteile besaß.« Die Sache begann ihm fast Spaß zu machen. Du bist ein Sadist, schalt er sich. Nach den Enttäuschungen der letzten Jahre, nach den selbst verschuldeten Niederlagen, nach seinem fluchtartigen Abgang von der Universität war er so kleinlich, einen Geschäftsführer zu quälen, der doch nichts anderes wollte als alle anderen Geschäftsführer, |35|nämlich dass seine Firma am Ende einer Maßnahme besser dastand als vorher. Das konnte Stachelmann schon jetzt ausschließen, wenn er es schaffen sollte, die Arbeit zu beenden.
»Sie wissen, dass seine beiden Kinder diese Anteile geerbt haben.«
Stachelmann nickte.
»Und dass es für diese Kinder … schmerzlich wäre, zu erfahren, dass ihr Vater …«
Stachelmann nickte. Es war auch für mich schmerzlich, als ich begriff, dass mein Vater ein Nazi gewesen ist, ein kleiner nur, aber ein Nazi. Warum soll der Schmerz der Schneyder-Kinder größer sein als meiner? Und womit hätten sie es sich verdient, ihn nicht zu spüren? »Ich dachte, es handle sich nur um Söhne«, sagte Stachelmann.
Kolumbitsch schüttelte den Kopf, aber nicht um zu verneinen, sondern weil diese Anmerkung ihn verwirrte. »Nein. ›Söhne‹ bezieht sich auf Oskar Schneyder, seinen früh verstorbenen Bruder Balduin und natürlich den Firmengründer Erwin. Aber …«
»Sie wollen sich jetzt nicht darüber unterhalten, sondern darüber, wie wir die Kuh vom Eis kriegen«, unterbrach ihn Stachelmann.
Kolumbitsch zeigte ein Lächeln. Endlich hatte dieser weltfremde Historiker verstanden. »Die Firmengeschichte muss natürlich wahr sein, sonst hätten wir Sie nicht beauftragen dürfen …«
Wie wahr, dachte Stachelmann, wie wahr.
»… aber müssen die Dinge nicht auch abgewogen werden?« Er war stolz, dass er dieses Wort gefunden hatte.
»Selbstverständlich«, sagte Stachelmann. »Das tun Historiker immer. Alle Fakten abwägen.«
»Gut«, sagte Kolumbitsch.
|36|Schlecht, dachte Stachelmann. Mit so einem Argument würde ich nicht einmal einen Proseminarschein bekommen. Alles abwägen, lächerlich. Gewichten, das wäre richtig und längst nicht alles. »Aber abwägen heißt nicht verschweigen.«
Kolumbitsch hob die Brauen, sein Gesicht erstarrte fast in dieser Miene, dann sanken die Augenbrauen. »Verschweigen? Da verstehen Sie mich falsch.«
Ich versteh dich ganz richtig, dachte Stachelmann.
»Aber die Firmenleitung war damals außerordentlich beliebt bei den Arbeitnehmern, und das muss man doch auch erwähnen.«
»Gewiss. Wenn es sich belegen lässt.«
Kolumbitsch hatte eine Idee, das sah man in seinem Gesicht. »Sprechen Sie doch mit Kollegen von damals, ich könnte Ihnen da Ansprechpartner vermitteln.«
Das kann ich mir vorstellen, dachte Stachelmann. Ehemalige Meister, die besten Freunde der Fremdarbeiter. Die Handlanger der Geschäftsleitung und der SS, die Aufpasser und Herrenmenschen, die alle nur das Beste gewollt hatten. Heute selbstgerechte Tattergreise. Ach, er hatte sie satt, diese Schwadronierer. Ein paar lebten noch, und manchmal wollte Stachelmann nicht auf dem gleichen Boden laufen wie diese gebrechlichen und hilflosen Alten, vor denen einst andere zitterten. Doch in solchen Fällen überkam ihn gleich der Verdacht, er erhöhe sich selbst. Er hatte ja nie eine Gelegenheit gehabt, Rückgrat zu zeigen. Oder zu versagen.
»Gerne spreche ich mit Zeitzeugen«, sagte Stachelmann betont freundlich. »Ich kenne nur keinen Zeitzeugen, der die eigene Rolle nicht geschönt hätte, sofern er in üble Dinge verstrickt war. Das Mindeste ist ja die Behauptung, keine Wahl gehabt zu haben.«
Kolumbitsch wackelte mit dem Kopf, aber seine |37|Augen blickten Stachelmann unentwegt an. »Gewiss«, sagte er und startete gleich einen weiteren Versuch: »Aber gibt es nicht verschiedene Wahrheiten? Würde ein Historiker ein und dieselbe Sache nicht anders darstellen als ein zweiter? Ist es nicht eher eine Frage der Interpretation?«
Stachelmann sah ihm an, wie stolz er war auf diese Frage. In der Tat hatte er instinktiv ein heißes Eisen der Geschichtsdebatte angefasst, ohne sich die Finger zu verbrennen. Nicht schlecht, Herr Kolumbitsch.
»Das wird kontrovers diskutiert«, sagte Stachelmann. »Aber Sie werden leicht feststellen, dass bei allen Unterschieden der Darstellung es zu vielen Fragen Übereinstimmung gibt unter den Historikern. Über die Rolle der Denunzianten allemal. Die haben die Arbeit der Gestapo erst wirksam gemacht. Es gibt auch keine unterschiedlichen Auffassungen über die Rolle und Behandlung der Zwangsarbeiter, schon gar nicht über die SS in diesem Zusammenhang. Und es ließe sich noch viel mehr anführen. Kurz gesagt, wenn Sie einen anderen Historiker mit diesem Auftrag beehren würden« – in das Wort beehren legte er allen Sarkasmus, dessen er fähig war –, »dann stünden Sie bald vor den gleichen Schwierigkeiten wie jetzt. Wenn eine Firma mit Tradition ihre Geschichte aufarbeiten lässt, steigt fast immer Übles an die Oberfläche. Jedenfalls in Deutschland.«
Kolumbitsch schaute ihn betrübt an. Er wirkte ratlos. »Wenn unsere Mehrheitseigner in dieser Firmengeschichte lesen müssen, ihr Vater sei ein … Denunziant gewesen, dessen Opfer umgebracht wurden …«
»… dann haben diese Kinder einen Vater wie andere auch«, unterbrach Stachelmann. Er wurde ungeduldig.
Kolumbitschs Gesicht zeigte erst Ärger, dann Verunsicherung. Stachelmann hatte nie zuvor jemanden kennengelernt, |38|in dessen Gesicht sich so leicht lesen ließ. Poker sollte Kolumbitsch nicht spielen. »Offen gesagt, ich weiß nicht, wie ich das den Eigentümern sagen soll.«
Stachelmann antwortete nicht. Woher sollte er das wissen?
Kolumbitsch starrte ihn an. Warum hilfst du mir nicht?, schien sein Gesicht zu sagen.
Stachelmann sagte: »Wenn Sie nichts einzuwenden haben, würde ich jetzt gern zurück an meine Arbeit.«
Natürlich hatte Kolumbitsch etwas dagegen. Aber was sollte er sagen? Sie hatten einen Vertrag geschlossen, in dem geregelt war, was Stachelmann zu tun hatte. Bestimmt verfluchte der Geschäftsführer den Tag, an dem er auf die Idee gekommen war, eine Firmengeschichte in Auftrag zu geben. Es war so lange gut gelaufen mit seinem Job, nun stand er zum ersten Mal vor einer Sache, die er nicht mehr beherrschte. Er konnte es nicht so weiterlaufen lassen, wusste aber nicht, wie er es beenden sollte ohne Verlust an Geld und Ansehen. Am wichtigsten aber war ihm das Wohlwollen der Eigentümer. Sie hatten sich bisher nicht eingemischt in die Geschäfte, weil es gut lief. Aber sie würden sich einmischen, sobald er herausrückte mit dem, was er angerichtet hatte. »Ja, natürlich«, sagte er fast abwesend. »Natürlich.«
Während er das Chefzimmer verließ, überlegte Stachelmann, ob er mit sich selbst wetten sollte, wann ihn Kolumbitsch hinauswarf. Es war eine Frage der Zeit, und jetzt durfte er keinen Fehler machen, der dem Geschäftsführer als Vorwand dienen konnte.
Bis zum Abend las er weiter in Akten und machte sich Notizen, obwohl er nicht mehr daran glaubte, dass sie für mehr gut waren als für den Papierkorb. Stachelmann war gespannt, was Kolumbitsch sich würde einfallen lassen, um ihn loszuwerden. Oder doch nur die Abfindung?
|39|Als er den Keller endlich verlassen hatte, nahm er den Bus zum Hauptbahnhof und erwischte noch den Zug nach Hamburg. Es war ihm ungewohnt, dass er nicht mehr in Lübeck wohnte, sondern bei Anne in Hamburg. Er hatte sich lange gesträubt, die Wohnung in der Lichten Querstraße nahe der Obertrave aufzugeben, aber Anne hatte recht gehabt.
Vor allem, das hatte Stachelmann mehr und mehr geplagt, konnte er nicht dort wohnen, wo er einen Menschen erschossen hatte. Er hatte den Teppich in der Diele ersetzt, eine Reinigungsfirma hatte den Boden darunter von Blut befreit, es gab keine Spur seines Kampfes mehr. Doch ihm war, als sickerte das Blut immer aufs Neue aus dem Boden. Er mochte noch so sehr an die Kraft des Verstands glauben, daran, dass der die Erschütterung verdrängen würde, es half ihm nichts.
Anne wusste es, das sah er in ihren Blicken, als sie einmal darüber gesprochen hatten, was an diesem furchtbaren Abend geschehen war. Aber sie sagte nichts darüber, vielleicht wartete sie auf seine Fragen. Sie sagte nur, er müsse Geld sparen, wo er könne. Tatsächlich, jetzt gab es nicht mehr eine Überweisung im Monat, die ausgereicht hatte, sein Leben zu bestreiten. Obwohl, mit dem, was Kolumbitsch ihm zahlen wollte, hätte er sich seine alte Wohnung noch eine Weile leisten können. Und der Geschäftsführer würde zahlen müssen, so oder so. Sein Schreibtisch stand nun in Annes Wohnzimmer, er empfand es immer noch als ihres, obwohl er seinen Anteil an der Miete bezahlte. Wenn er zu Hause arbeitete, sorgte Anne dafür, dass Felix im Kindergarten und anschließend bei der Tagesmutter war. Außer an manchen Wochenenden klappte es gut.
Anne hatte ihre Doktorarbeit fertig geschrieben, aber um die Promotion abzuschließen, fehlte ihr nun der |40|Doktorvater, da Bohming krankgeschrieben war. So lange kam sie nicht voran, aber sie ließ sich den Ärger selten anmerken. Manchmal spürte Stachelmann Schuldgefühle, schließlich hatte er Bohmings Zustand verursacht.
[Menü]
|41|4
Elf Wochen und ein Tag vor dem Anschlag.
Er hatte mies geschlafen, war immer wieder aufgewacht, hatte Runde um Runde durch die Wohnung gedreht und schließlich noch eine Diclofenac-Tablette genommen. Als die Schmerzen abebbten, war es nur noch die Hitze, die ihn am Schlaf hinderte.
Anne lag neben ihm und atmete ruhig, wie in so vielen Nächten. Wenn er an ihrer Seite wach lag, fühlte er sich fremd. Er vermisste seine Wohnung in Lübeck, sie war ihm nicht nur Behausung gewesen, sondern auch Teil seines Ichs. Sie sah nach ihm aus, sie roch nach ihm. Und wie sollte er von Annes Wohnung ins Ali Baba gehen und sich betrinken? Er hatte sich in der neuen Umgebung umgeschaut, es gab viele Kneipen, aber keine hatte ihm auch nur annähernd so gut gefallen wie das türkische Restaurant in Lübecks Fischergrube. Sollte er wieder zurückziehen nach Lübeck? Er verdiente doch genug Geld, um die Miete zu bezahlen. Er zahlte ja auch die Hälfte von Annes Wohnung, obwohl sie ihn nicht darum gebeten hatte.
Wie war es mit ihnen beiden? Waren sie glücklich miteinander? War es besser für ihre Liebe, dass sie nun zusammenlebten? Er hatte längst gemerkt, dass sie miteinander umgingen, als hantierten sie mit Porzellan aus der Zeit der Ming-Dynastie. Es hatte keinen Streit gegeben im letzten Vierteljahr, nur Gereiztheiten, die aber keine Chance hatten, sich zum Streit zu entwickeln, weil entweder Anne oder Stachelmann sofort klein beigegeben hatten, fast als gäbe es einen Wettkampf im |42|Zurückweichen. Doch dieses Verhalten dehnte die Zeiten des Beleidigtseins nur aus, das aber beide nicht zeigen wollten, weil sich darin die Frage offenbarte, ob das Zusammenleben wirklich so gut klappte, wie sie es sich einredeten.
»Warum schläfst du nicht?«, murmelte sie. Ihre Hand legte sich auf seinen Oberschenkel.
Er antwortete nicht, es würde sie nur wecken.
Sie zog die Hand weg, drehte sich auf die Seite, schnorchelte, dann atmete sie wieder tief und gleichmäßig. Am Morgen würde sie sich nicht erinnern, etwas gesagt zu haben.
Er musste sich eingestehen, er war nicht zufrieden. Und sie war es auch nicht. Es mochte sein, dass sie ohnehin nicht erwartet hatte, es würde leicht werden mit ihm. Schließlich war es von Anfang an schwierig gewesen. Und doch hatte ihre Beziehung alle Enttäuschungen, Streitereien und Missverständnisse überstanden. Auch seine Launen, seine Schmerzen und seine Unzufriedenheit. Was fand sie an ihm, dass sie trotz allem bei ihm blieb? Er hätte sich längst den Laufpass gegeben, schon damals, als er alle ihre Bemühungen um ihn aus Feigheit übersah und sie ein Kind von einem anderen Mann bekam. Das Kind, das sie von ihm gewollt hatte, da war er sich sicher, auch wenn er sie nie danach fragen würde. Warum hatte sie sich danach wieder auf ihn eingelassen? Sie hätte wunderbare Männer haben können, die alles für sie getan hätten und die gesund gewesen wären. Was war an ihm, das sie an ihn band? Ob er sie doch einmal fragen sollte? Aber gleich spürte er die Angst, sie darauf zu stoßen, dass sie ihn falsch eingeschätzt hatte. Dass sie Eigenschaften bei ihm vermutete, die er nicht hatte. Er war ein Versager, seltsam, dass sie darauf noch nicht gekommen war.
|43|Als der Morgen anbrach, schüttelte es an seiner Schulter. Felix lag dort, wo Anne vorhin noch geschlafen hatte, und grinste ihn an. In der Hand hatte er einen Stoffelefanten mit gelben Ohren, den Stachelmann ihm zu Weihnachten geschenkt hatte. Stachelmann zeigte kurz die Zähne und schloss die Augen. Er war entsetzlich müde und hatte gerade eine Liegeposition gefunden, die weniger schmerzte. Felix schüttelte wieder. Immerhin hatte er es sich abgewöhnt, einfach auf Stachelmann zu springen ohne Rücksicht auf Verluste. Stachelmann knurrte, dann öffnete er die Augen und starrte Felix an. Der lachte erst, doch als Stachelmann ernst blieb und ihn weiter anstarrte, wurde er ängstlich. Vorsichtig stieß er mit der Faust an Stachelmanns Schulter, aber der starrte weiter. Felix wurde es unheimlich. Er lachte verlegen, um seine Angst zu überspielen, aber als Stachelmann nicht aufhörte zu starren, rollte sich Felix vom Bett und rannte zur Tür. Dort drehte er sich noch einmal um, schaute zu Stachelmann, der immer noch starrte, dann schlug er die Tür zu.
Stachelmann schloss die Augen. Noch ein paar Minuten schlafen, nur ein paar Minuten. Er hatte seit Monaten starke Schmerzen, wenn die Wirkung der Tablette nachließ. Vier, fünf Stunden Schlaf war das Längste, und meistens schlief er nicht sofort ein oder wachte viel zu früh auf, weil sein Hirn arbeitete. Er hatte zwar einen Job, aber der war befristet, und Stachelmann würde seine Zeit brauchen, bis er sich daran gewöhnt hatte, dass nicht mehr regelmäßig zum Monatsende sein Gehalt auf dem Konto war. Es war ein seltsames Gefühl, das setzte ihn unter Druck, ließ ihn manchmal fürchten, eines Tages nichts mehr zu verdienen. Je älter er wurde, desto geringer die Wahrscheinlichkeit, eine andere Arbeit zu finden. In manchen Nächten glaubte er, zielstrebig auf |44|Hartz IV hinzuarbeiten. Immerhin war ihm die Endstation bekannt. Er wusste, was geschehen konnte. Aber es gab so viele Menschen, die von Hartz IV leben mussten, warum nicht er? Der Gedanke beruhigte ihn für eine Weile, aber dann krochen die Ängste doch wieder aus allen Ritzen.
Er roch den Tee und stand vorsichtig auf. Dann bewegte er Rücken, Arme und Beine, sie waren steif, aber sonst ging es. Er zog seinen Bademantel an und stakste in die Küche. Felix saß auf seinem Kinderstuhl und spielte mit einem Plastiklöffel. Als er Stachelmann sah, fing er an, mit dem Löffel auf den Rand seines Tellers zu schlagen. Stachelmann versuchte wegzuhören, dann sagte er: »Hör auf, bitte!«
Felix schlug weiter, bis Anne, die gerade sein Müsli zubereitete, sich umdrehte und ihm den Löffel aus der Hand nahm. Er guckte verdutzt auf seine nun leere Hand, drehte sein Gesicht zu Anne, die sich schon wieder mit der Zubereitung seines Essens beschäftigte, dann fing er an zu schreien, schlagartig und in höchster Lautstärke. Sein Gesicht lief rot an, die Hände waren zu Fäusten geballt. Stachelmann wusste, dass Anne diese Schreiattacken nicht beachtete. Felix würde sich das abgewöhnen, wenn er merkte, dass es ihm keinen Vorteil brachte. Schließlich müsse er sich fürchterlich anstrengen, und wenn nichts dabei herauskomme, na, er werde es schon lernen. Schließlich sei er ihr Sohn.
Den letzten Satz hatte Stachelmann als Kritik empfunden, als hätte sie gesagt, Felix hätte dein Sohn sein können, wenn du nur gewollt hättest. Aber wie Stachelmann den Kleinen schreien sah, zweifelte er, ob er ein Kind gewollt hätte. Sie hätte ihn vielleicht überreden können, aber niemals überzeugen.
Schlagartig hörte das Geschrei auf. Manchmal war er |45|morgens froh, wenn er nach Lübeck zur Arbeit fahren konnte. Heute hatte er nicht die geringste Lust. Aber er musste sich disziplinieren. In seinem Vertrag stand, dass er in etwa einem Jahr ein Rohmanuskript abzugeben hatte und ein halbes Jahr später die Endfassung.
»Keine Lust?«, fragte Anne.
Felix fuhrwerkte mit seinem Löffel im Müsli herum. Er plapperte freudig, als hätte er nie geschrien. Er konnte längst sprechen, aber er hatte keine Lust. Maulfaul sei er, sagte Anne, aber es sorgte sie nicht. Besser als ein Schwätzer. In dieser Hinsicht hätte er Stachelmanns Sohn sein können.
»Finstere Gedanken hinter hoher Stirn.« Anne grinste. Seit sie zusammenwohnten, kannte sie ihn noch besser als zuvor. Das Rendezvous mit einer scharf gemachten Tellermine sei manchmal entspannender, als mit ihm im Wohnzimmer zu sitzen. Aber das hatte sie nur am Anfang gesagt. Inzwischen kannte sie seine Zeiten der Abwesenheit und empfand sie nicht mehr als Angriff, auch wenn sie darauf bestand, dass sich einer nicht einfach geistig verabschieden sollte, wenn man dabei war, miteinander zu reden. Aber es hatte keinen Zweck, sie hatte begriffen, er war so, und er meinte es nicht böse. Lebenslang geschädigt durchs Halberemitendasein, lästerte sie.
»Die nerven«, sagte er endlich. »Die wollen mich loswerden, das merke ich.«
»Die hatten wohl geglaubt, du würdest beweisen, dass diese ehrenwerte Firma ein Nest von Widerständlern war. Lauter kleine Robert Boschs.«
Stachelmann hatte ihr gleich am Abend erzählt, dass er Denunziationsakten entdeckt hatte. Bosch war eine der wenigen Ausnahmen gewesen, er hatte den Widerstand gegen Hitler unterstützt. Sklavenarbeiter hatte sein Konzern aber auch beschäftigt.
|46|»Denen flattern die Nerven«, sagte Stachelmann. »Zwangsarbeit gilt ja inzwischen geradezu als Kavaliersdelikt, zu dem man sich heldenmütig bekennt, wenn auch ein paar Jahrzehnte zu spät und mit dem angenehmen Effekt, dass die meisten Opfer und Täter längst tot sind. Aber nun kommt Denunziation dazu, das ist schwerer Tobak. Damit hatten die nicht gerechnet. Ich kann mir gut vorstellen, wie der alte Schneyder sich als verkappter Antinazi gepriesen hat, alle haben es gern geglaubt, so sehr, dass sie sogar einen Historiker an die Akten ließen. Und jetzt das. Ich bin mal gespannt, was sie nun machen.«
»Tut mir leid, dass dein erster Auftrag dir gleich so einen Ärger einträgt.«
»Eigentlich hätte ich nichts anderes erwarten dürfen. Der Ärger ist mein bester Freund.«
»Nun ist es aber gut.«
Felix warf den Löffel auf den Boden, zeigte darauf und begann wieder zu schreien, obwohl er sein Müsli aufgegessen hatte. Anne hob den Löffel auf, Felix schrie weiter.
Wahrscheinlich schrie Felix aus Eifersucht. Stachelmann und Anne hatten sich unterhalten, er stand nicht im Mittelpunkt. Er ist ein Egozentriker, dachte Stachelmann. Alle Kinder sind egomanisch, und es ist eine Frage der Erziehung, ob sie gesellschaftstauglich werden. Irgendwann einmal. Wenn er mit seinen Nerven längst fertig war.
Anne nahm Felix an der Hand und ging mit ihm ins Schlafzimmer. Dort hatte er eine Spielecke, in der Nacht schlief er im Wohnzimmer. Es war viel zu eng für zwei Erwachsene und ein Kind in der Wohnung. Zumal wenn einer der Erwachsenen Stachelmann hieß. Das war ihm klar. Wenn er tagsüber nicht in der Firma im Keller säße, |47|dann müsste er hier arbeiten, im Wohnzimmer. Sie arbeitete meistens in ihrem Büro an der Uni. Im Prinzip klappte es, aber wehe, er musste auch am Abend arbeiten. Bisher war es nicht geschehen, aber es würde geschehen, und dann wurde es richtig schwierig. Es ging so nicht weiter.
Das Geschrei verstummte, Felix spielte wohl, das würde ihn eine Weile ablenken. Hoffentlich so lange, bis Stachelmann die Wohnung verließ. Doch er wusste, er würde sich abregen, wenn Felix beim nächsten Mal ruhig blieb. Aber es schwelte weiter, immer weiter.
Anne kam, stellte sich hinter ihn, streichelte ihm den Kopf und setzte sich auf ihren Platz ihm gegenüber. »Ich nehme mir vor, kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn er Krach macht. Aber wenn es passiert, hab ich doch eines.« Sie schaute ihn traurig an.
Es konnte so nicht weitergehen. Nie war er bei sich selbst. Er konnte sich nicht zurückziehen, sich nicht in seiner Gedankenwelt vergraben. Er hing davon ab, was Anne und Felix taten oder nicht taten. »Ich weiß nicht, ob das mit uns hier zusammen gut geht.« Er sprach nicht weiter, weil er fürchtete, Dinge auszusprechen, die er nicht mehr würde zurückholen können. »Aber das können wir bereden, wenn wir Zeit haben. Und Ruhe.«
Sie nickte bedächtig. Natürlich verstand sie genau, was er meinte. Und er begriff, dass sie es verstand. Plötzlich packte ihn die Angst, sie zu verlieren. Er stand auf, ging zu ihr, nahm ihr Gesicht in beide Hände und küsste sie lang. Es dauerte, bis sie den Kuss erwiderte. Als sie es endlich tat, verloren sie sich einige Augenblicke, aber als er sich wieder aufrichtete, war das Glücksgefühl, das ihm gezeigt hatte, was auch möglich war mit Anne, da war dieses Glücksgefühl verschwunden, und seine Not schaute ihn an.
|48|Er stand neben ihr, ohne sie zu berühren, und überlegte, warum es mit ihm so anders war als mit anderen. Wären nicht viele Männer glücklich, mit einer solchen Freundin zusammenzuleben? Doch er störte sich an diesem oder jenem, lauter Kleinigkeiten. Ihm ging die eigene Mäkelei auf die Nerven. Und wusste, mochte er es auch eine Zeit lang unterdrücken, er würde sich nicht mehr ändern.
»Vielleicht solltest du dir hier in der Nähe ein Zimmer nehmen?«
Sie bohrte in der Wunde, ohne Absicht gewiss. Warum, verdammt, war er aus Lübeck weggezogen? »Ja, vielleicht«, sagte er und setzte sich wieder. Er hätte schon unterwegs sein müssen.
»Und was wird aus deinem Auftrag?« Sie tat so, als wäre sie munter.
»Sie werden mich rausschmeißen. Und versuchen, mir mein Honorar zu kürzen. Wahrscheinlich endet die Sache vor Gericht.«
»Sei nicht so pessimistisch. Du hast einen Vertrag.«
»Sie werden einen Grund finden, wie sie mich loswerden können. Vorher werden sie natürlich versuchen, mich zu beeinflussen. Die haben schon herausposaunt, dass sie diese Firmengeschichte schreiben lassen. Da gab es sogar eine Presseerklärung und Artikel in den LübeckerNachrichten. So leicht kommen sie da nicht raus. Außerdem, ich weiß schon, wie ich denen Feuer unterm Hintern mache. Es ist ganz einfach. Gute Ideen sind immer einfach.« Während er es sagte, stieg seine Laune. Warum bin ich nicht früher darauf gekommen? Macht nichts, die Idee kam gerade rechtzeitig.
»Und, großer Pyromane in spe, wie machst du es?«
Er erzählte es ihr, und sie grinste.
|49|