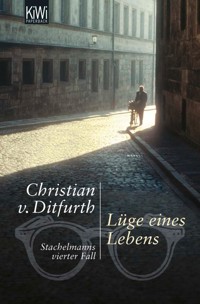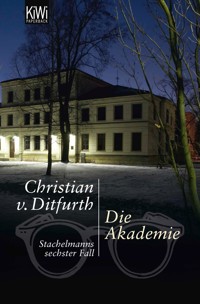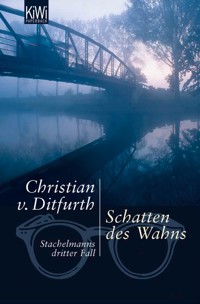
7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Stachelmann ermittelt
- Sprache: Deutsch
Stachelmanns dritter Fall: Die Dinge sind anders, als sie scheinen. Ganz anders. Zwei Jahre mussten die Fans von Josef Maria Stachelmann auf seinen neuen Fall warten. Schon zweimal war der Hamburger Historiker zum unfreiwilligen Ermittler geworden. Diesmal wird Stachelmann zurückgeworfen auf die eigene Geschichte und auf einen Mord in einer Thingstätte, die dereinst Joseph Goebbels eingeweiht hatte. Nach Mitternacht klingelt die Oberkommissarin Carmen Hebel an der Haustür. Sie bringt Stachelmann eine schreckliche Nachricht: Ossi ist tot. Oskar Winter war ihr Kollege und Stachelmanns Freund gewesen. Er wurde tot an seinem Schreibtisch gefunden, sein Kopf lag auf einem Aktenordner, darin Flugblätter, Zeitungsausrisse und Protokolle aus den Siebzigerjahren, als Ossi und Stachelmann in Heidelberg studiert und an die Revolution geglaubt hatten. Alle Indizien sprechen für Freitod, der Staatsanwalt stellt die Ermittlungen ein. Doch Stachelmann zweifelt. Ossi hätte sich nicht umgebracht, und wenn doch, dann nicht mit Gift. Die Akte auf Ossis Schreibtisch ist eine Spur. Statt mit Anne in Urlaub zu fahren, reist er zurück in die eigene Vergangenheit. Er findet heraus, dass Ossi kurz vor seinem Tod in Heidelberg gewesen war, offenbar um ein Verbrechen aufzuklären, das fast dreißig Jahre zurückliegt: den Thingstättenmord. Wurde Ossi umgebracht, weil er den Tätern zu nah gekommen war? Haben die Thingstättenmörder ein zweites Mal zugeschlagen? Wollen sie nun auch Stachelmann töten? Bevor er den Fall lösen kann, muss er Spuren bis nach Italien folgen, denn Tote sind nicht tot, und kaum einer sagt die Wahrheit. Im dritten Band seiner Stachelmann-Reihe zeigt sich Christian v. Ditfurth erneut als Meister des anspruchsvollen Kriminalromans. In der Presse heißt es: »Dieser unfreiwillige Ermittler und sein Autor gehören zum Besten, was die deutsche Krimilandschaft derzeit zu bieten hat«.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 530
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
» Buch lesen
» Über das Buch
» Über den Autor
» Informationen zum Autor (Klappentext)
» Lieferbare Titel / Lesetipps
» Impressum
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Mein Dank gilt
Über das Buch
Der Autor
Impressum
Für Gisela
Things they do look awful cold
I hope I die before I get old
Talkin' 'bout my generation
Pete Townshend (The Who), »My Generation«
[Menü]
1
Sie traten aus dem Haus Kettengasse 25. Drei hatten sich eingehakt, einer ging vorneweg zu einem VW-Käfer, der um die Ecke im Unteren Faulen Pelz stand, an der Mauer des Gefängnisses. Über ihnen hing der Vollmond hinter Stacheldraht.
Sie sagten kein Wort. Der Mann, der eng zwischen zwei anderen ging, schien unwillig zu sein. Er drehte zwei- oder dreimal den Kopf zurück, als wollte er bleiben. Dabei fielen ihm lange braune Locken ins Gesicht, sodass er den Kopf schüttelte, um etwas sehen zu können. Es wirkte, als wollte er nein sagen. Doch er wehrte sich nicht.
Sie mussten alle auf der Fahrerseite einsteigen, so dicht stand der Wagen an der Mauer. Der Mann, der vorne gegangen war, klappte den Fahrersitz vor, dann schob sich einer der beiden, die den Langhaarigen eingehakt hatten, auf die Rückbank. Er trug einen roten Vollbart. Die beiden anderen drückten den Langhaarigen hinein, dann quetschte sich der andere Begleiter daneben. Er hatte ein hageres Gesicht mit hervorstehendem Kinn. »Was soll das?«, sagte der Langhaarige in einem Ton, in dem Ungläubigkeit mitschwang.
Sie hatten geklingelt in der Wohnung im Dachgeschoss und ihn gleich herausgezerrt, als er die Tür geöffnet hatte. Woher hatten sie gewusst, dass er allein war? Marianne und Ingo waren noch nicht zurück vom Kino. Was hatten sie vor? Er spürte die Angst, aber dann sagte er sich, sie wollten ihn nur erschrecken. Die tun keinem was, die nicht.
»Wirst schon sehen«, sagte der Mann, der sich hinters Steuer gesetzt hatte.
Da schüttelte sich der Langhaarige, er drängte zur Tür, wollte den Fahrersitz nach vorn drücken, aber die beiden neben ihm hatten keine Mühe, ihn zu halten.
»Lass den Quatsch«, sagte der mit dem Kinn, der links vom Langhaarigen saß.
Der Langhaarige fiel zurück auf die Bank.
Der Motor startete erst nach dem vierten Versuch. Der Fahrer gab zu viel Gas, dann nahm er den Fuß abrupt vom Pedal, stieg auf die Bremse und würgte den Motor ab. Die Insassen wurden durchgeschüttelt. »Reiß dich zusammen!«, brüllte der Vollbart auf der Rückbank. »Kannst du nicht mehr fahren, oder was?«
Der Fahrer antwortete nicht. Er startete den Motor erneut, trat die Kupplung und legte den ersten Gang ein. Der Motor heulte kurz auf, dann beschleunigte der Wagen ruckartig, hätte fast ein parkendes Auto gerammt, und endlich wurde die Fahrt ruhiger.
Sie fuhren langsam die Friedrich-Ebert-Anlage hinunter. An der großen Kreuzung ging es rechts ab in die Sofienstraße, dann über die Brücke nach Neuenheim. In Handschuhsheim bog der Wagen wieder rechts ab, den Hang hinauf; der Weg wurde immer kurviger. Die Scheinwerfer tanzten die Böschung entlang, Büsche und Bäume trugen noch kein Laub. War der Langhaarige erst überrascht, dann erstaunt gewesen, so griff jetzt wieder die Angst nach ihm, langsam und von unten. Der Darm wurde unruhig, dann der Magen, schließlich kam der Schweiß, und er fragte: »Was habt ihr vor?«
»Mach dir nicht ins Hemd«, sagte der Mann mit dem Kinn neben ihm, ohne ihn anzusehen.
Schweigend fuhren sie in den Wald. Der Langhaarige kannte die Gegend, grau ragte die Ruine des St.-Michaels-Klosters im Mondlicht. Hier hatten sie im letzten Sommer unter Bäumen gesessen, Joints geraucht und Bier getrunken. Aber jetzt war hier niemand, die Kneipe noch nicht geöffnet. Der Fahrer steuerte den Käfer auf den großen Parkplatz hinter der Gaststätte. Sie waren die Einzigen. Dann stiegen sie aus, und die beiden von der Rückbank hakten den Langhaarigen wieder unter. Der ließ sich mitziehen, er war allein, die waren zu dritt. Sie führten ihn weg von der Gaststätte weiter in den Wald hinein. Sie näherten sich der rund gemauerten Bühne der Thingstätte von hinten. Die beiden führten den Langhaarigen durch den Eingang zwischen den beiden Flügeln, dann sah er die Treppen und Sitzreihen aus Stein, die sich steil nach oben streckten. Irgendwo schrie ein Kauz. Geraschel im Wald, der Langhaarige spürte, wie der Vollbart rechts neben ihm zuckte. Erst jetzt entdeckte der Langhaarige den langen, dicken Gegenstand in der Hand des Fahrers. Sie näherten sich der Stahlgittertür des linken Bühnenflügels, von den Sitzreihen aus gesehen. Das lange Ding entpuppte sich als Bolzenschneider mit Hebelgriffen. Der Fahrer setzte die Zange an den Bügel des Vorhängeschlosses, drückte die Griffe zusammen und zog sie auseinander. Das wiederholte er an einer zweiten Stelle des Schlossbügels, und mit einem Klacken fiel das Schloss auf den Steinboden. Dann hatte der Fahrer eine Taschenlampe in der Hand. Er öffnete die Gittertür, leuchtete in den Raum hinein und sagte: »Los!«
Die beiden anderen führten den Langhaarigen in den Lichtkreis. Es roch nach Fäulnis. Eine Ratte huschte durch das Licht hinaus aus dem Raum. Einer schloss die Gittertür, dann sagte der Fahrer: »Knie dich hin!« Er leuchtete dem Langhaarigen ins Gesicht, dann fiel der Schein der Taschenlampe auf den Boden vor dem Langhaarigen. »Dahin!«
Der Langhaarige blieb stehen.
Der mit dem Kinn trat dem Langhaarigen in die rechte Kniekehle. Der schrie auf und sackte zu Boden. Dann kniete er. »Ihr seid wahnsinnig«, sagte er. Nun hatte er nur noch Angst.
»Du bist ein Verräter«, sagte der Fahrer.
Der Langhaarige starrte ihn an und schüttelte den Kopf. »Nein, nein!«
Dann hatte der Vollbart eine Pistole in der Hand, der Fahrer sah sie und fragte: »Was machst du?«
Der Langhaarige begann zu zittern.
Der Vollbart stellte sich hinter den Langhaarigen. Der mit dem Kinn schaute auf die Pistole, dann auf den Langhaarigen. Der Fahrer sagte: »Wir wollen alles wissen.« Auch er klang zittrig.
»Ich habe nichts verraten«, sagte der Langhaarige.
»Du kennst doch den Wieland«, sagte der Fahrer.
»Du hast ihn mir mal gezeigt, daher kenn ich ihn.«
»Du bist mit ihm gesehen worden.«
»Nein«, sagte der Langhaarige. »Doch, ich habe ihn mal um Feuer gebeten.« Er erzählte nicht, wie es ihn gereizt hatte, Wieland nahe zu kommen. So einen genau zu sehen.
»Er war bei dir zu Hause.«
»Er ist gekommen und hat mich bedrängt, mit ihm zu reden.« Das war Wochen, nachdem er ihn um Feuer gebeten hatte. Wieland schien ihn nicht wieder zu erkennen.
Der mit dem Kinn trat dem Langhaarigen ins Gesicht. »Sag die Wahrheit, du Schwein!«, brüllte er. Der Langhaarige fiel auf die Seite. »Los, hoch«, sagte der Fahrer. »Stell dich nicht so an.« Der Langhaarige stöhnte und hockte sich wieder auf die Knie. Er betastete die Stelle, wo ihn der Tritt getroffen hatte.
»Wenn uns jemand hört«, zischte der Vollbart.
»Um die Zeit, hier, bestimmt nicht«, sagte der Fahrer.
»Wegen diesem Schwein werden wir lebenslang Scherereien haben«, sagte der Fahrer. Der Vollbart drückte dem Langhaarigen die Pistole ins Genick.
»Wo hast du die her?«, fragte der mit dem Kinn. Er klang unsicher.
»Von meinem Alten, aus dem Krieg, ist eine 08, durchschlägt alles.« Der Vollbart war stolz.
Dann begannen sie wieder, den Langhaarigen zu befragen und zu quälen. Der aber bestritt alles. Die drei anderen erregten sich immer mehr. Sie fragten, schlugen und traten. Der Langhaarige fiel immer wieder um, die anderen zerrten ihn immer wieder auf die Knie. Längst blutete der Langhaarige aus Gesichtswunden. Er kniete im eigenen Urin.
»Die Flasche hat sich in die Hose gemacht, es stinkt!«, rief der Fahrer hysterisch.
»Bringen wir es zu Ende. Gestehst du deinen Verrat, dann geben wir dir eine Chance.« Der Vollbart trat dem Langhaarigen ins Kreuz, nicht fest, eher als Aufmunterung. Sie bauten ihm eine Brücke. Der Langhaarige schüttelte den Kopf, vielleicht weil er nichts mehr verstand, vielleicht weil er nein sagen wollte.
Den Schuss hörte er nicht mehr. Die Neunmillimeterkugel aus dem letzten Krieg drang in seinen Hinterkopf ein und ließ das Gesicht nach vorne platzen. Dann drang der Knall durch die Gittertür aus dem Raum, raste die steinernen Sitzreihen und Treppen hoch und verlor sich im Wald. Mit einem Ächzen sank der Langhaarige zur Seite. Die drei standen erstarrt vor der Leiche. Der mit dem Kinn übergab sich.
[Menü]
2
Es war die Erleuchtung. Sie blendete ihn, doch bescherte sie ihm ein Glücksgefühl, wie er es nie zuvor erlebt hatte. Endlich kam sie. Sie wollte ihm irgendetwas sagen, etwas Wichtiges. Gewiss, dass er bald den Durchbruch erleben würde, dass nur wenige Schritte fehlten dazu. Ein bisschen musste er sich noch anstrengen, aber es war schon fast alles fertig. Die Erleuchtung rückte ihm näher und gleißte immer heller. Dann spürte er sie, sie war warm, schön warm. Dann wurde sie heiß. Sie kam noch dichter heran. Nun schmerzte sie, er kreuzte die Arme vor seinem Gesicht. Brandblasen wuchsen auf seinen Händen und Armen. Gleich würde die Erleuchtung ihm die Hände wegbrennen, dann die Arme, dann den Kopf. Die Schmerzen waren höllisch.
Er schrie vor Angst und Schmerz. Dann schlug er die Augen auf. Vorsichtig starrte er in die Dunkelheit. Bald sah er Umrisse des Schranks, daneben das alte Bücherregal, in dem sie Bücher aufbewahrte, die er längst zum Altpapiercontainer getragen hätte. Sie hustete, ohne aufzuwachen. Er sah nur den Schattenriss ihres Gesichts im Dämmerlicht, das die Straßenlaterne warf. Sie atmete langsam und gleichmäßig. Er mühte sich, den Schmerz im Rücken zu besänftigen, indem er seinen Körper vorsichtig hin- und herschob auf der Matratze. Es half wenig, er stand auf.
Er tastete sich zur Tür, trat auf etwas Hartes, einen Bleistift vielleicht, und stöhnte auf. Als er im Flur stand und die Schlafzimmertür geschlossen hatte, drehte er das Licht an. Er setzte sich aufs Klo, pinkelte, wusch und trocknete sich die Hände. Dann ging er in die Küche. Die Uhr zeigte halb vier. Er goss sich ein Glas mit Wasser ein und trank es aus. Er setzte sich an den Tisch, blätterte im Hamburger Abendblatt, eine Gerichtsreportage, da fiel ihm Ines ein. Der Prozess war vorbei, er würde sie nie wieder sehen. Er dachte an die Nacht, die sie miteinander verbracht hatten, die Erinnerung reizte ihn. Er schloss die Augen und versuchte sich vorzustellen, wie Ines aussah. Aber die Konturen verschwammen. Dann blätterte er weiter, ohne recht zu verstehen, was er überflog.
Die Küchentür öffnete sich. Anne blieb im Türrahmen stehen: »Was ist? Schmerzen?«
»Ja, auch.«
»Auch?«
»Mich hat die Erleuchtung geweckt«, sagte Stachelmann.
Sie starrte ihn ungläubig an. »Aber sonst geht es dir gut?« Sie trat in die Küche und schloss die Tür. »Wir wecken noch Felix.« Sie gähnte. »Und wie sieht die aus, die Erleuchtung?«
»Hell natürlich, sie blendet. Und sie verbrennt einem erst Hände und Arme, dann den Rest.«
Sie ließ ihre Augen über seine Hände und Arme wandern und schüttelte den Kopf. »Und dir geht es wirklich gut, bis auf die Schmerzen?«
Er nickte. »Warum bist du aufgewacht?«
Sie stellte sich hinter einen Küchenstuhl und stützte die Hände auf dessen Lehne. »Ich habe einen Mist geträumt.«
Er schaute ihr fragend in die Augen.
»Na ja, dass du schon wieder den Detektiv spielst, und diesmal geht es schief.« Sie lachte müde.
Er grinste sie an. »Nein, zweimal reicht. Wirklich. Beim ersten Mal war ich zu neugierig, mein Fehler. Beim zweiten Mal hatte ich keine Wahl. Und damit hat es sich.«
Sie setzte sich auf den Stuhl, stützte die Ellbogen auf den Tisch und legte das Kinn in die Hände. »Hast du denn auch über die andere Sache nachgedacht?«
»Die andere Sache? Ach so. Ja, natürlich.«
»Und was ist das Ergebnis?«
»Es gibt keines, noch nicht.«
»Du machst es uns schwer, Josef, immer so schwer. Warum nur?«
»Ich nehme es ernst, das ist was anderes. Komm, geh schlafen, solche Nachtdiskussionen bringen uns nicht weiter.«
»Die am Tag aber auch nicht.« Sie stand auf und schaute ihn zärtlich an. »Versuch doch auch zu schlafen. Sonst bist du morgen, nee, heute wieder so zerschlagen.«
»Mal sehen, nachher.«
Sie verließ die Küche und schloss die Tür. Er starrte auf die Tür, als könnte er hindurchsehen. Ihr Streit, wann hatte er begonnen? Und um was ging es eigentlich? War Streit überhaupt das richtige Wort? Seit Wochen lief es so, und es zerrte an beider Nerven.
Dann fuhr er zusammen, als hätte ein Blitz ihn getroffen. Es war die Klingel. Einmal, zweimal, dreimal schrillte sie durch die Wohnung. Da sprang er auf, der Stuhl fiel nach hinten um und schlug laut auf den Linoleumboden. Als er die Küchentür aufriss, hörte er Felix weinen.
Anne kam aus dem Schlafzimmer. »Das kann nur ein Besoffener sein, verdammt.« Sie verschwand in Felix' Zimmer. Stachelmann fragte zornig in die Gegensprechanlage: »Sind Sie verrückt?«
»Polizei«, sagte eine leise Frauenstimme. »Machen Sie auf, bitte.«
Die Stimme berührte etwas in ihm. Er hatte sie schon einmal gehört, irgendwann. Stachelmann drückte auf den Knopf, der die Haustür öffnete. Dann eilte er ins Badezimmer, zog sich den Bademantel an, trat zurück in den Flur und wartete. Die Schritte auf der Treppe näherten sich rasch. Es waren leise, schnelle Schritte. Dann sah er sie. Natürlich, er kannte sie. Das war doch Ossis Kollegin. Wie hieß sie nochmal? Sie war klein und hatte kurze schwarze Haare. Sie ähnelt Anne, dachte Stachelmann, nicht nur der Haare wegen. Etwas zierlicher. Sie hatte rote Augen, als wäre sie erkältet. Oder als hätte sie geweint.
»Entschuldigung«, sagte sie. »Es ist früh.« Ihre Augen sagten: Ich kann nicht anders.
Stachelmann führte sie in die Küche, füllte Kaffeepulver in einen Filter und Wasser in die Maschine, dann schaltete er die Kaffeemaschine ein. Die Polizistin setzte sich auf einen Stuhl und nestelte an ihrem Pullover, den sie unter dem Anorak trug. Warum ist sie gekommen? Bestimmt nicht wegen mir oder Anne. Sie war fertig mit den Nerven und würde etwas sagen, wenn sie es für richtig hielt. Wenn seiner Mutter etwas passiert war? Ein Verbrechen? Aber sie will doch zu Anne, woher sollte sie wissen, dass du hier bist? Es beruhigte ihn ein wenig. Aber wenn Annes Mutter etwas geschehen war? Furchtbar, wo sich doch der Vater schon erschossen hatte, ohne einen Abschiedsbrief zu hinterlassen. Er spürte, wie die Ungewissheit ihn zu quälen begann. Er stellte drei Kaffeebecher sowie Zucker und Milch auf den Tisch. Die Polizistin schien es nicht zu bemerken. Sie nestelte am Ausschnitt des Pullovers und starrte auf die Tischplatte. Dann schluckte sie zweimal und sagte: »Wir kennen uns.«
Stachelmann nickte. Er setzte sich ihr gegenüber.
Dann sagte sie: »Ossi ist tot. Heute Nacht.«
Er schaute sie streng an, als vermutete er einen geschmacklosen Scherz. Dann fiel ihm ein: »Sie sind Frau Nebel.«
»Hebel«, sagte sie. »Carmen Hebel. Nennen Sie mich Carmen, das hat Ossi auch getan.«
Ossi war tot. »Tot?«
Sie nickte. Eine Träne lief vom Auge über den Wangenknochen und den Mundwinkel bis zum Kinn, dort blieb sie hängen.
Stachelmann starrte die Träne an. Er hörte Felix schreien.
»Als wir einmal hier vorbeigefahren sind, hat Ossi mir erzählt, dass Sie manchmal bei Ihrer Freundin wohnen. Er hat ein bisschen geschwärmt von Ihrer Freundin, hatte sogar ihren Namen in sein Adressbuch geschrieben. Und einmal haben wir Sie hier vorbeigebracht, Sie haben es gewiss vergessen.« Er hatte es nicht vergessen.
Die Kaffeemaschine spotzte leise, dann zischte und fauchte sie.
Er wollte fragen, wie es geschehen war, spürte aber, es war besser, sie erzählen zu lassen, auch wenn seine Ungeduld ihn plagte.
Anne trat ein, Felix schrie nicht mehr. Sie stellte sich hinter Stachelmann und legte ihre Hände auf seine Schultern. Sie fragte nicht, sondern schaute Carmen an.
Aber die sah es nicht, hatte offenbar nicht einmal bemerkt, dass Anne in die Küche gekommen war. Carmen starrte aus feuchten Augen immer nur auf die Tischplatte. »Er sitzt da an seinem Schreibtisch ... sein Kopf auf der Schreibtischplatte ... auf einem Stapel Papier, einer Art Akte, in der er vor seinem Tod vielleicht gelesen hat.« Sie schüttelte den Kopf. »Nein, er ist jetzt in der Rechtsmedizin, und sie haben ihn vielleicht schon aufgeschnitten.« Sie schüttelte wieder den Kopf. Dann sagte sie noch leiser: »Und wenn er sich umgebracht hat? Warum? Und wenn ihn jemand ermordet hat? Warum? Ich verstehe es nicht.«
Stachelmann spürte, wie Annes Hände seine Schultern fester drückten. Carmens Gesicht hob sich, sie schaute Anne an aus nassen Augen. Die drehte sich weg zur Kaffeemaschine, zog die Kanne heraus und goss ein in die drei Becher auf dem Tisch. Dann setzte sie sich an den Tisch, rührte in ihrem Becher, obwohl sie weder Zucker noch Sahne hineingegeben hatte. Der Löffel kratzte am Becherrand, Stachelmann schaute kurz hin, ärgerte sich einen Augenblick, aber dann war es ihm egal.
»Ich habe ihn gefunden«, sagte Carmen. »So gegen Mitternacht oder kurz danach. Ich kam aus dem Präsidium ...« Sie trank einen Schluck Kaffee. »Wir waren befreundet.« Sie trank hastig mehrere Schlucke. »Es war eigentlich schön, aber auch nicht leicht. Und da gab es dieses Problem, das er vor aller Welt versteckt hat.«
»Welches Problem?«, fragte Anne sanft.
»Alkohol«, erwiderte Carmen. »Ich hab versucht, ihn davon abzubringen. Manchmal hab ich geglaubt, es sei geglückt. Aber dann habe ich wieder eine Flasche gefunden. Wissen Sie, er hat sie versteckt, wenn er wusste, dass ich kam. Zwei- oder dreimal in der Woche. Zusammenziehen wollte ich nicht mit ihm.« Es klang, als machte sie sich einen Vorwurf. Als hätte sie seinen Tod verhindern können, wenn sie mit ihm zusammengezogen wäre.
Stachelmann versank noch tiefer in sich. Er musste nichts sagen oder fragen. Anne würde es tun, und er würde zuhören und nachdenken. Er dachte an die Szene am Flughafen, als er fast erschossen worden wäre und Ossi ihn gerettet hatte. Ossi, der mal die Revolution herbeigesehnt hatte und dann doch Polizist geworden war. Wie er Stachelmann anrief, nachdem er in der Zeitung gelesen hatte von einem Vortrag, den Stachelmann gehalten hatte. Wie er Stachelmann half, sich vom Mordverdacht zu befreien. Ines tauchte wieder auf in seinen Gedanken. Sie hatte Ossi auch gekannt. Natürlich hatte der so getan, als wollte er mit ihr anbändeln. Ossi konnte nicht anders. Er war ein Angeber gewesen, doch dahinter steckte einer, der nicht nur geprotzt hatte. Der seine Unsicherheit versteckte. Aber der war nun tot, vielleicht hatte er sich umgebracht.
»Woran ist er gestorben?«, fragte Anne. Stachelmann hörte es wie hinter einer Wand.
»Er hat wohl Gift geschluckt«, sagte Carmen mit monotoner Stimme. »Der Arzt schließt aus, dass er einen Herzinfarkt oder so was bekommen hat. Er saß auf einem Stuhl, der Oberkörper lag auf der Schreibtischplatte. Er ist nicht auf die Platte gefallen, dann hätte man eine Verletzung gefunden. Ich stelle mir vor, er ist vornüber gesunken. Und die Akten haben den Kopf geschützt, wie ein Polster. Komische Akten, Flugblätter, irgendwas aus Heidelberg, altes Zeug. Ihr Name taucht darin auch auf, gleich auf dem ersten Blatt.« Sie hob kurz ihren Kopf, um Stachelmann anzusehen. Der las in ihren Augen Trauer, aber auch Angst. Vor was hatte sie Angst?
Stachelmann versuchte sich vorzustellen, wie Ossi tot am Schreibtisch gesessen hatte. Aber er bekam das Bild nicht in den Kopf. Was er da hörte und sah, schien ihm weit weg zu sein, wie verschleiert durch eine Nebelwolke.
»Ich habe zuerst die Kollegen gerufen, den Rechtsmediziner. Ich habe der Spurensicherung geholfen, Taut kam sogar, der Hauptkommissar verlässt ungern sein Büro. Schon gar nicht sein Bett.« Ein Lächeln lief über ihr Gesicht und verschwand. »Dann wollte ich mit Ihnen sprechen.« Sie hob wieder den Kopf und schaute Stachelmann kurz ins Gesicht. Dann starrte sie erneut auf die Platte. »Aber Sie sind nicht ans Telefon gegangen. Dann fiel mir ein ...« Sie warf einen Blick auf Anne, um gleich wieder ihre vorherige Haltung einzunehmen. »Ich hab's nicht ausgehalten. Wo sollte ich hin?«
Stachelmann griff über den Tisch und nahm ihre Hand. Sie hatte feingliedrige Finger. Stachelmann drückte die Hand, dann ließ er sie los. »Das war ganz richtig«, sagte er. »Ich war sowieso wach ... wir waren sowieso wach.«
»Er hat viel von Ihnen erzählt. Über die Zeit in Heidelberg.«
Von einer anderen Zeit hätte er auch nichts erzählen können, da er Stachelmann davor nicht gekannt und danach lange Zeit nicht mehr gesehen hatte. Stachelmann ahnte, dass Ossi sich selbst nicht zu kurz hatte kommen lassen in seinen Berichten aus bewegter Zeit. Demonstrationen, Flugblätter verteilen, Seminare umfunktionieren oder sprengen, Prügeleien mit der Polizei. Manchmal war Stachelmann die Protzerei peinlich gewesen. Es fiel ihm ein, wie Ossi Anne und später Ines beeindrucken wollte, so aufdringlich, dass es niemanden beeindrucken könnte. Stachelmann nickte. »Ja, da haben wir manches miteinander erlebt.« Und damals war Ossi auch noch nicht so ein Angeber gewesen, vollendete er den Satz im Kopf. Er muss sich verändert haben, als es abwärts ging mit ihm. Als er nicht Anwalt wurde, als er seine Ideale verlor, als er Polizist wurde, was so ziemlich das Gegenteil war von dem Anwalt der Bewegung, der Revolutionäre vor dem Gericht des Klassenfeinds heraushaute oder wenigstens ihre Verurteilung in ein Fanal ummünzte. Und nun war er tot, vielleicht hatte er sich selbst getötet. Irgendwie wäre das konsequent. Stachelmann überlegte, wie Ossi sich gefühlt haben mochte in seinen letzten Stunden. An was hat er gedacht? Bestimmt an seine große Zeit, in Heidelberg, als Hinz und Kunz ihn kannten als den roten Ossi, und diesen Ehrennamen trug er nicht seiner Haarfarbe wegen.
»Er hat Sie beneidet«, sagte Carmen. »Sie haben es geschafft, er wurde Polizist. Verstehen Sie mich nicht falsch, er war ein guter Polizist. Und auch nicht der Einzige, der zu viel trank. Aber manchmal« – sie suchte nach einem Wort –, »manchmal war er so traurig. Und mir fiel auf, dann sprach er kaum. Wenn doch, machte er Andeutungen über die Zeit des Studiums, Satzfetzen, und Ihr Name fiel dann häufig.« Sie schüttelte den Kopf. »Und dann hat er den Kopf geschüttelt.« Sie schüttelte wieder ihren Kopf. »Und dann hat er gelacht, ein bisschen gequält, und so mit der Hand gewischt.« Sie wischte über den Tisch, als wollte sie Schmutz beseitigen. »Als würde er die Erinnerung wegwischen.« Ihre Hand bewegte sich noch einmal über den Tisch, langsam, vorsichtig, und sie schien einem Gedanken zu folgen.
Stachelmann drängte es, wieder ihre Hand zu nehmen. Doch er unterließ es.
»Er lebte in seiner Erinnerung. Sie quälte ihn und sie half ihm, auch wenn das jetzt komisch klingt.«
»Nein«, sagte Anne. »Das kann ich verstehen. Vielleicht weil Ossi früher mal was war und ihm das Selbstbewusstsein gab, aber wenn er schlecht drauf war, dann zeigte ihm die Erinnerung seinen Abstieg.« Sie setzte an, ihre Hand auf den Mund zu legen. »Er empfand es dann so, glaube ich. Dabei ist es doch kein Abstieg, wenn man Kriminalkommissar wird.«
»Wenn er daran gearbeitet hätte, wäre er längst Hauptkommissar geworden.« Carmen zog ein Taschentuch aus der Jeans und trocknete sich die Augen.
Stachelmann dachte an die Akten, auf denen Ossis Kopf gelegen hatte.
»Wollen Sie ihn noch einmal sehen?«, fragte Carmen.
Stachelmann überlegte, er stellte sich den Leichnam vor in der Rechtsmedizin, weiß, schlaff. »Nein, aber ich möchte gern in die Wohnung.«
Carmen überlegte. »Die ist versiegelt. Aber ich werde Taut fragen, der kennt Sie und macht vielleicht eine Ausnahme. Womöglich finden Sie etwas oder können was erklären. Ich fahre jetzt ins Präsidium und ruf Sie dann an.«
Stachelmann nannte ihr seine Nummer am Historischen Seminar. Carmen schrieb sich die Nummer auf, steckte ihren Notizblock in die Anoraktasche, dann verharrte sie einige Augenblicke. Sie stand auf, fasste an die Tischkante, als wollte sie sich festhalten, dann drehte sie sich weg. Sie murmelte etwas und verließ die Küche, Stachelmann hörte die Wohnungstür klacken.
Sie saßen schweigend zusammen. Stachelmann schaute sich um, als säße er zum ersten Mal in Annes Küche. Anne trommelte lautlos mit den Fingern auf die Tischplatte. Stachelmann blickte zur Uhr an der Wand. Es war kurz nach sechs, draußen dämmerte der Morgen mit Streulicht.
»Hast du ihn gemocht?«
»Weiß nicht«, sagte Stachelmann.
»Das musst du doch wissen.«
»Na, ich habe ihn monatelang nicht treffen wollen.« Womöglich hätte ich es verhindern können, dachte er. Wenn er sich umgebracht hat, dann vielleicht weil er einsam war. Nein, das war er doch nicht. Er hatte was mit Carmen. Aber man kann etwas mit jemandem haben und trotzdem einsam sein. Er hat dich beneidet, obwohl es da nichts zu beneiden gab. Du hättest es ihm ausreden können. Manchmal reicht eine Kleinigkeit, um einem den Rest zu geben. Vielleicht war der Neid so eine Kleinigkeit. Er erinnerte sich, wie sie damals in dieser Kneipe, dem Tokaja, gesessen und über den Holler-Fall gesprochen hatten, über einen Serienmörder, der eine ganze Familie töten wollte, einen nach dem anderen, quasi im Jahrestakt. Im Tokaja hatte er dann auch mit Ines etwas angefangen, was er besser nie angefangen hätte. Er würde nie wieder in diese Gaststätte gehen. Immer wenn er dort war, wurde er in ein Verbrechen verwickelt. Damals, als er mit Ossi im Tokaja gewesen war, da hätte er merken können, wie neidisch Ossi war auf ihn. Er hätte energischer widersprechen müssen. »Er hat sich nicht zum Besseren entwickelt. Man soll ja nichts Schlechtes sagen über Tote, aber früher war er ein Kerl, hier in Hamburg, fast dreißig Jahre später, kam er mir manchmal vor wie ein Aufschneider, wie einer, der sich selbst belügt.«
»Er verbarg etwas Dunkles in sich. Ossi war nett, aber ein bisschen aufdringlich, gerade gegenüber Frauen. Er hat getrunken, na gut, da kenn ich noch ein paar andere, die deshalb nicht zu Bösewichten werden. Doch war da etwas, das mich abgestoßen hat. Etwas Klebriges. Vielleicht spinne ich ja.« Anne schaute Stachelmann in die Augen.
Der wich dem Blick aus. »Ossi war wichtig für mich, damals, als wir gemeinsam studiert haben. Mir kam das immer vor, als wären es viele Semester gewesen. Ich hab vorhin nachgezählt, es waren nur drei. Er war älter als ich, hat mich hin und wieder beschützt. Das rechne ich ihm hoch an, auch wenn er es weniger für mich getan hat als für sein Ego. Aber wenn man ein Vierteljahrhundert später immer noch an alten Geschichten hängt ...«
»Du bist ungerecht, das hat euch verbunden, und deswegen hat er mit den alten Geschichten angefangen. Alles andere wäre doch abwegig gewesen. Rate mal, worüber wir beim letzten Klassentreffen gesprochen haben.«
»Er hat in den alten Geschichten gelebt. Was für ein kleines Leben, ein paar Jahre, und seitdem ist alles Abstieg.«
Sie schwiegen. Stachelmann schenkte Anne und sich Kaffee nach. Ihr Löffel klang im Becher wie eine kleine Glocke fernab.
»Das bist du ihm schuldig.«
»Was?«
»Dass du in seine Wohnung gehst. Dir diese komischen Akten anschaust. Die sollen ja aus Heidelberg stammen.«
»Hm.«
»Das ist doch keine Sache. Schau sie dir an, dann erzähl der Polizei, was drinsteht und was sie bedeuten. Ich stell mir das so vor: Ossi hat in alten Akten, gewissermaßen in alten Zeiten geblättert, in großartigen Zeiten, wie er fand, dann hat ihn der Jammer gepackt, und er hat sich umgebracht, weil er nicht sehen konnte, wie es jemals wieder gut werden könnte.«
»Wenn es so wäre, wie du sagst, dann hätte er sich erschossen und nicht vergiftet. War es Freitod, dann offenbar mit Vorbereitung. Man hat normalerweise nicht genug Tabletten oder gar Gift im Haus, das muss man erst besorgen. Also war es eher so: Er will sich umbringen, aus welchem Grund auch immer, er bereitet alles vor, und bevor er die Tabletten schluckt, erinnert er sich noch einmal an die gute alte Zeit. Er will mit einer schönen Erinnerung abtreten. Vielleicht hat er Mist gebaut im Dienst und hat Angst, dass es rauskommt, vielleicht leidet er unter Depressionen, wundern würde es mich nicht, vielleicht hatte er einfach die Nase voll von einem beschissenen Leben.«
Sie schaute ihn fragend an. »Selbstmord ist schrecklich.«
»Keineswegs«, sagte er. »Freitod ist kein Mord, sondern jedermanns gutes Recht.«
Wieder ein langer Blick, traurig. Er sah, wie sie eine Frage stellen wollte, sie dann aber nicht aussprach. Sie sagte etwas anderes: »Du hast keine Depressionen?«
Die Frage erstaunte ihn. Was hatte er damit zu tun? Er war ja sonst bereit, alles auf sich zu beziehen, Schuld zu suchen, wo andere keine fanden. Sie kannte ihn doch, nein, er war manchmal niedergeschlagen, aber Depressionen sind was anders. Sie sind eine Krankheit.
Mit Ossis Abgang hatte er nichts zu schaffen. Obwohl, wenn er öfter mit ihm gesprochen hätte? Er wehrte den Gedanken ab. Aber der kam wieder. »Ich hätte mich öfter mit ihm treffen sollen. Seit dieser Geschichte mit Griesbach hab ich ihn nicht mehr gesehen. Obwohl er mir geholfen hat. Wir haben ein-, nein zweimal miteinander telefoniert, er hat angerufen, um zu quatschen.«
»Übertreib nicht«, sagte sie. »Als brächte sich jeder um, den du nicht mit deinem Besuch beglückst. Red dir das nicht ein.«
»Wenn ich doch nur eine Ahnung gehabt hätte. Eine Andeutung Ossis, das hätte genügt.« Er schlug mit der Faust auf den Tisch, die Kaffeebecher klapperten. Anne erschrak. Mit Ärger im Blick stand sie auf und verließ wortlos die Küche.
Stachelmann saß noch lange, trank einen weiteren Becher Kaffee, erinnerte sich. Und fragte sich, ob Ossi nicht Recht gehabt hatte, wenn er sich getötet hatte. Er überlegte, wie oft er mit dem Gedanken gespielt hatte abzutreten. Einfach so, ihr könnt mich alle mal. Der Gedanke reizte ihn. Wenn einem das Leben zur Qual wird, warum soll man es nicht beenden?
* * *
17. April 1978
Dieses Schwein. Verräter sind wie Wanzen. Die zerquetscht man auch. Obwohl, Wanzen können nicht wählen, ob sie Wanzen sein wollen. Also sind Verräter schlimmer. Den Feind sieht man klar vor Augen, und er sieht dich. Die Faschisten und ihre – naiven??? Sie müssten es doch wissen!!! Also wollen sie es!!! – Helfer bekämpfen uns mit allen Mitteln. Demokratie, dass ich nicht lache. Wenn die »Demokratie« die falschen Ergebnisse produziert, wird sie abgeschafft. Beispiel Pinochet. Aber ein Verräter ist doppelt gefährlich. Er zersetzt die eigenen Reihen, er verrät deine Taktik an den Feind. Wie viele Kriege wurden durch Verrat entschieden? Wir sind auch im Krieg. Sie töten uns. Und wir töten sie, wenn es notwendig ist. Ich will nicht töten, es ist eklig. Und hoffentlich muss ich es nicht. Wenn ich mir vorstelle, ich wäre es gewesen, der das Schwein abgeknallt hat, ich müsste dauernd dran denken. Ich war sauer, als es passiert war, stinksauer. Mir hatte niemand was gesagt. Man will es doch vorher wissen, wenn man bei einer Hinrichtung mitmacht. Auch ein Revolutionär muss sich auf so was vorbereiten. Es hätte doch nichts gekostet, mir wenigstens was anzudeuten. Ich hätte trotzdem mitgemacht, oder? Doch, Verräter sind schlimmer als Wanzen.
Habe Angelika gesehen, zufällig, beim neuen Italiener in der Hauptstraße. Irgendwer hat gesagt, sie habe einen scharfen Hintern. Das stimmt. Ich glaube, sie hat mir zugelächelt. Zuletzt bei der Demo gegen die Fahrpreiserhöhungen sind wir eine Weile nebeneinander gelaufen. Sie hat mir erzählt vom Stress vor der Germanistikklausur. Und ich habe erzählt, ich hätte beim Studium ausgesetzt, eine revolutionäre Pause. Da hat sie gelacht, aber ich bilde mir ein, sie hat mich ein bisschen bewundert. Weil ich konsequent bin. Wenn wir nicht aufpassen, hat sie gesagt, dann sind bald die Faschisten am Drücker. Und dann schicken sie uns wieder nach Auschwitz. Das hat sie also verstanden.
Ich muss noch an mir arbeiten. Das mit dem Hintern ist sexistisch, würden die Genossinnen der Frauengruppe sagen. Die Frau reduziert auf ihre Geschlechtsmerkmale. Sie haben ja Recht. Und ich werde nichts sagen darüber. Meine Gedanken hinken den heutigen Anforderungen der Revolution hinterher. Im Kopf bin ich manchmal noch richtig reaktionär. Ich muss an mir arbeiten.
Wenn ich Angelika erzählen würde von der Hinrichtung, was würde sie sagen? Auch, dass es konsequent gewesen sei? Das war es doch.
[Menü]
3
Sie lief vor ihm die Treppe hinauf in den dritten Stock. An der Wohnungstür klebte ein Zettel mit der gedruckten Aufschrift O. Winter. Carmen entfernte das Polizeisiegel und schloss auf.
Sie hatte ihn am frühen Nachmittag angerufen und am Philosophenturm abgeholt, um mit ihm zu Ossis Wohnung im Lohkoppelweg 7 in Lokstedt zu fahren. Auf der Fahrt hatten sie kaum miteinander gesprochen. Im Tageslicht sah Carmen noch erschöpfter und niedergeschlagener aus. Ihre Stimme war brüchig, als hätte sie Husten. Auch Stachelmann war müde, aber er kannte diesen Zustand, halb wach zu sein. Oft rissen ihn die Schmerzen aus dem Schlaf.
Carmen drückte die Wohnungstür auf, die klemmte etwas. Stachelmann hatte Ossi nie zu Hause besucht, Ossi hatte ihn nie hierher eingeladen. Es roch muffig und nach Zigarettenrauch. Der Läufer in der Diele war verschlissen, die Wände grau. Die Türen standen offen, links war die Küche, schmutziges Geschirr stand neben der Spüle, Schimmelgeruch drängte sich auf. Gegenüber lag das Wohnzimmer. CDs, Zeitschriften und Bücher lagen herum, ein Zweiersofa an der Wand, ein Sessel an der Schmalseite eines Glastischs. Schlieren zeigten, er war lange nicht gereinigt worden. Von draußen dröhnte der Verkehrslärm durch die geschlossenen Fenster. Der Schreibtisch stand neben einer Tür, die ins Schlafzimmer führte. Stachelmann warf einen Blick hinein, schmuddeliges Bettzeug lag herum, die Hose des Schlafanzugs auf dem Boden. An der Wand ein aufdringlicher Frauenakt, wohl aus einem Kaufhaus. Er setzte sich auf den Schreibtischstuhl und überlegte, was Ossi gedacht hatte in seinen letzten Minuten.
»Wirklich Selbstmord?«, fragte er, auch wenn er fand, es war das falsche Wort. Freitod klang irgendwie komisch. Wer sagte das schon?
»Wahrscheinlich«, sagte Carmen. »Keine Einbruchspuren, sonst auch keine. Es war wohl niemand hier außer Ossi.«
»Und wenn er einen Mörder hineingelassen hat, weil er ihn kannte?«
Carmen stand dicht neben ihm, sie roch gut. Sie hob die Hände, ließ sie wieder sinken. »Möglich ist alles. Aber Mord ist unwahrscheinlich. Äußerst unwahrscheinlich. Wenn den Rechtsmedizinern nicht noch etwas auffällt, werden die Ermittlungen eingestellt.«
Stachelmann verstand es gut. Alles spricht für einen Freitod, kein Indiz dagegen. Es sei denn, die Polizei findet noch eines. Ossi war ausgestiegen aus seinem Leben. Stachelmann begann sich an diese Vorstellung zu gewöhnen. Man muss den Tatsachen ins Auge sehen. Anne hatte Recht, er hätte es nicht verhindern können. Ossi hatte sich nach der Sache mit Ines kaum mehr gemeldet bei ihm. Wäre es seine Pflicht gewesen, Ossi nachzulaufen? Gewiss nicht.
»War der Aktendeckel geschlossen, als Sie ihn fanden?«
Sie nickte.
Er stellte sich vor, Ossi hatte in den Papieren gelesen, dann den Deckel zugeschlagen, um die Tabletten oder das Gift zu schlucken. »Aber legt man sich nicht aufs Bett oder in die Badewanne, wenn man so was vorhat?«
»Eigentlich schon. Aber wer weiß schon, was in seinem Kopf vorging? Er wird seinen Grund gehabt haben. Vielleicht wollte er es anders machen als andere.«
»Wissen Sie schon, was er genommen hat?«
Sie schüttelte den Kopf. »Nein.«
Er schlug den Aktendeckel auf, der Ordner stammte aus Polizeibeständen. Obenauf lag ein Flugblatt. Es ging um Fahrpreiserhöhungen bei der Heidelberger Straßenbahn. Rote-Punkt-Aktion. Stachelmann erinnerte sich, wie die Demonstrationen und Blockaden der Gleise im Chaos geendet hatten. Die linken Gruppen fielen übereinander her, die Studenten widerte es an. Auf dem Flugblatt stand unten handschriftlich Jossi.
»Warum hat er das hingeschrieben? Das ist doch Ihr Spitzname?«
Stachelmann nickte bedächtig. Er überlegte. »Ich hab das wohl geschrieben«, sagte er. Er nahm das Blatt vom Stapel und legte es mit der Vorderseite zuunterst neben den Ordner. Die Rückseite war nicht bedruckt. Er erinnerte sich, es war dieses labbrige Papier, die billigste Sorte, die sie durch die Wachsmatrizendruckmaschine gezogen hatten. Das Papier saugte die Farbe gut auf, bei glattem schmierte sie. Auch das nächste Flugblatt handelte von der Fahrpreiserhöhung, aber Ossi hatte nichts draufgeschrieben. Dann ein handschriftliches Protokoll mit dem Datum vom 3. Mai 1977, Auswertung der revolutionären Maidemo, entzifferte er. Ossi hatte eine grauenhafte Schrift, nach links geneigt, die Buchstaben eng aneinander, manche teilweise übereinander. Es folgten einige Punkte, unter denen Erfolge abgebucht wurden. Mehr Teilnehmer als 1976, oder Eindeutige revolutionäre Parolen. Negativ wurde erwähnt: Immer noch Unklarheiten über den Charakter der RAF-Genossen Leute in Stammheim. Genossen war durchgestrichen. Unklarheiten eben. Er musste grinsen.
»Was ist?«, fragte Carmen irritiert.
»Nicht wichtig«, erwiderte er. »Es erinnert mich nur an meine Dummheit. Manchmal könnte ich darüber weinen, manchmal nur lachen. Heute grinse ich.« Er blätterte weiter. An vieles erinnerte er sich. Manche Papiere waren vor seiner Zeit in Heidelberg erschienen. Maoisten prügelten auf Kommunisten ein, Kommunisten auf Maoisten. »Warum hat er dieses Zeug ausgegraben? Das wird ja nicht all die Jahrzehnte auf dem Schreibtisch gelegen haben?«
»Nein, ich kenne es nicht, habe es nie gesehen. Bedeutet es etwas?«
»Es bedeutet nur, dass Ossi sich in seiner letzten Stunde damit beschäftigt hat. Ein Indiz für Freitod.«
»Aber es fehlt ein Abschiedsbrief«, sagte Carmen. »Die meisten Selbstmörder wollen den Hinterbliebenen etwas erklären. Ich hätte gerne eine Erklärung, und ich glaube, er wusste es. Das ist ein Indiz gegen Selbstmord.« Sie klang sachlich, aber Stachelmann hörte, sie war den Tränen nah. Auch weil sie gekränkt war. Weil Ossi nicht an sie gedacht hatte.
»Vielleicht kann man diesen Ordner als eine Art Abschiedsbrief verstehen. Ich habe meine glücklichste Zeit in Heidelberg verlebt, danach kam nichts Gutes mehr. Entschuldigung.«
Aber Carmen wehrte ab. »Wenn es so sein sollte, dann muss ich es aushalten.«
»Sie müssen mir die Frage jetzt nicht beantworten. Sie und Ossi, Sie waren so richtig ein Paar?«
»Ja, irgendwie schon. Wir haben das natürlich für uns behalten. Sie hätten einen von uns sonst versetzt. Und den letzten Schritt habe ich von Ossi nicht erwartet.« Sie schniefte. »Da hat immer etwas gestanden zwischen uns. Er hat mich nicht wirklich nah an sich herangelassen, niemanden.«
»Vielleicht weil er fürchtete, dass Sie sich von ihm trennen, wenn Sie mehr über ihn erfahren. Er war kein Ausbund von Selbstsicherheit, obwohl er so tat.«
Sie dachte nach. »Dann war es gar nicht gegen mich gerichtet. Er hatte Angst vor sich selbst.«
»Ja. Das befürchte ich.«
»Darf ich Sie duzen?«
»Wenn ich es auch darf. Meine Eltern haben mir den schrecklichen Namen Josef gegeben. Den Zweitnamen verschweige ich, der ist geradezu peinlich.«
Sie lächelte. »Maria«, sagte sie.
»Wenn Sie ... Entschuldigung, du diesen Namen benutzt oder mich Jossi nennst, dann beantrage ich die Wiedereinführung der Prügelstrafe für diese Form der Beleidigung.«
»Hab's verstanden.« Sie lachte leise und wischte sich eine Träne aus dem Auge. Der Unsinn tat ihr gut. »Danke«, sagte sie und streichelte fast unmerklich den Rücken seiner Hand, die auf dem Papierstapel lag. »Er hat so oft von dir gesprochen. Das zeigte, wie unglücklich er war, weil er nicht erreicht hat, was er erreichen wollte.«
»Noch ein Indiz für Freitod«, sagte Stachelmann.
Sie antwortete nicht.
»Was überlegst du?«
»Ob er in letzter Zeit eine Andeutung gemacht hat, die ich als Signal hätte verstehen müssen. Ob ich etwas überhört oder übersehen habe.«
»Ich glaube, das fragen sich alle Leute in so einer Lage. Mach dir keine Vorwürfe, es ist sinnlos. Im Nachhinein findet man immer etwas, das man hätte besser machen können.« Er fuhr sich mit der Hand durch die Haare. »Mir geht's genauso. Warum habe ich mich nicht öfter getroffen mit ihm? Wäre doch keine große Sache gewesen, ein Bier trinken zu gehen. Oder öfter mal telefonieren. Ich habe geahnt, wie einsam er war. Obwohl er dich hatte.«
»Einsam ist das falsche Wort. Er hatte einen guten Draht zu den meisten Kollegen, er hatte gute Ideen, war erfolgreich. Und er hatte mich. Er war nicht einsam, er war unglücklich, selbst dann, wenn er lachte. Und da hättet ihr noch so viel Bier trinken können, es hätte ihn womöglich noch unglücklicher gemacht. Du warst der Maßstab für ihn. Jünger, aber erfolgreich. Und das geworden, was du immer werden wolltest.«
»Dabei habe ich ihm doch erzählt, dass meine Lage gar nicht gut ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich rausfliege, ist größer als die Wahrscheinlichkeit, dass jemals was Richtiges aus mir wird. Vielleicht werde ich sogar Professor, aber dann bereichere ich nur die akademische Reservearmee. Es gibt einen Haufen arbeitslose Professoren oder solche, die praktisch arbeitslos sind, weil sie zwar ihre Minimalpflicht in der Lehre erfüllen, aber besser auf den Titel pfeifen würden und zur Arbeitsagentur gingen.«
»Wirklich?«
Er nickte. Dann stand er auf und ging im Zimmer umher. Sie setzte sich an den Schreibtisch. Er kramte in Regalen, öffnete Schubladen und kam sich vor wie ein Eindringling. In der unteren Schublade entdeckte er Pornovideos. Er schloss die Schublade schnell, als wollte er die Videos nicht wahrnehmen. Sie blätterte in dem Ordner.
Stachelmann setzte sich in den Sessel. »Tatsächlich keine Spuren?«, fragte er.
»Nein. Wahrscheinlich nicht. Die Kriminaltechnik wird noch Fasern untersuchen und Fingerabdrücke auswerten, aber sie haben schon gesagt, dass es eher nichts geben wird.«
»Kann man heutzutage eine Wohnung betreten, ohne Spuren zu hinterlassen?«
»Kaum«, sagte sie. Sie drehte den Stuhl, bis sie ihm gegenübersaß. »Wenigstens ein Haar oder eine Textilfaser oder eine Hautschuppe verliert man. Und mit ein wenig Glück finden wir das dann. Ein Haar genügt für eine DNS-Analyse, die brauchen nicht einmal mehr die Wurzel. Wenn wir die Analyse haben, benötigen wir nur noch das Vergleichsmaterial, und meistens war es das dann. Es soll Kollegen geben, die glauben, Kriminalpolizisten würden sich bald nur noch damit beschäftigen, die richtigen Leute zu verhaften, und Gerichtsverfahren könnte man sich auch bald sparen.«
Stachelmann schaute sie erstaunt an.
»Polizei-Science-Fiction«, sagte sie. »Kommst du mit ins Präsidium?«
Er schaute auf die Uhr und stand auf. »Ich habe am Abend noch ein Seminar. Wenn es nicht zu lange dauert.« Er griff nach Ossis Ordner.
Sie fuhr zügig und routiniert zum Bruno-Georges-Platz. Im Präsidium saßen Mitarbeiter der Mordkommission zusammen, Stachelmann erkannte einige Gesichter, darunter das von Taut, dem Leiter der Kommission, der wie Buddha hinter seinem Schreibtisch thronte. Die Stimmung war schlecht, das spürte Stachelmann sofort. Taut erhob sich nur andeutungsweise und reichte ihm die Hand über den Schreibtisch hinweg. Dann deutete er auf einen Stuhl an der Wand. »Nun?«, fragte er.
Carmen setzte sich neben Stachelmann. Sie zuckte die Schultern. »Einen Abschiedsbrief oder etwas, das man so auslegen könnte, haben auch wir nicht gefunden«, sagte sie. »Dr. Stachelmann wird sich den Ordner genauer anschauen, der auf dem Schreibtisch lag. Aber ob das was bringt? Habt ihr schon was aus der Rechtsmedizin gehört?«
»Ich komme gerade von dort. Eigentlich keine Spur von äußerer Gewalteinwirkung«, sagte Taut.
»Eigentlich?«, fragte Carmen. Sie hatte den Hauch des Zweifels in Tauts Worten gehört.
»Es gibt an der rechten Schläfe eine kaum wahrnehmbare Rötung. Könnte vom Druck eines harten Gegenstands stammen. Oder davon, dass Ossi sich den Kopf gestoßen hat, kurz bevor er das Zeug schluckte.«
Ein langer, hagerer Beamter sagte aufgeregt: »Ich habe es doch gleich gesagt. So einer wie Ossi bringt sich nicht um.«
»Langsam, langsam, Kollege Kurz. Wenn die Rechtsmediziner oder die Kriminaltechniker nicht mehr finden als bisher, kann ich dir jetzt schon sagen, was der Staatsanwalt mit diesen Ermittlungen machen wird. Deckel zu, Affe tot.«
»Aber die Druckstelle ...«
»Wolfgang, die kann sonst wo herkommen. Entscheidend ist, dass wir keine Spur eines Einbruchs gefunden haben. Und wenn die Kriminaltechnik jetzt nicht noch irgendeine außergewöhnliche Spur findet, dann ist die Ermittlung beendet. Auch wenn es brutal klingt, wir haben genug Arbeit. Und wenn Ossi abtreten wollte, dann bin ich der Erste, der das betrauert, er war ein guter Kollege. Aber für jemanden, der sich umbringt, können wir nichts mehr tun. Wenn du es genau wissen willst, bin ich nicht nur traurig, sondern auch zornig. Man tritt nicht so einfach ab. Das ist nicht fair. Schon weil man den Hinterbliebenen die Frage aufzwingt, ob sie etwas hätten tun können. Er hätte wenigstens einen Abschiedsbrief schreiben können. Verdammt.« Für Tauts Verhältnisse war es eine lange Rede. Sie zeigte, wie sehr ihn Ossis Tod aufwühlte.
Bedächtig äußerte sich jetzt ein anderer Beamter, den Stachelmann ebenfalls kannte: »Da gibt es vielleicht doch eine Spur. Ich habe mir die Konten von Ossi angeschaut. Er hatte auf dem einen ein Guthaben von knapp neunzigtausend Euro, auf dem anderen fünfundzwanzigtausend Euro Miese.«
»Hm«, sagte Taut.
»Roland, woher hat ein Polizist so viel Geld?«, fragte Kurz. »Wenn ich mir mein Konto anschaue ...«
Roland Kamm hob die Augenbrauen. »Ich habe noch keine Zeit gehabt, mich damit zu beschäftigen. Ich weiß nur, in den letzten drei Monaten hat Ossi jeweils zehntausend Euro abgehoben, immer am Ende eines Monats. Es gibt weitere, aber eher normale Abhebungen.«
»Warum hat er die Überziehungszinsen bezahlt, statt das Minus auszugleichen?«, fragte Kurz.
»Keine Ahnung«, sagte Kamm. »Weißt du was?« Er warf einen Blick zu Carmen.
Die schüttelte den Kopf.
»Jeden Monat zehntausend Euro in bar, wofür?«, fragte Kurz.
»Vielleicht Zahlungen an seine Ex«, sagte Carmen. »Er hat ja zwei Kinder. Und womöglich hat er bei den Alimenten gezickt, bis ihn die Reue packte.«
»Überprüf das«, sagte Taut.
Carmen wollte etwas erwidern, aber dann schwieg sie doch.
Vielleicht will sie Ossis ehemaliger Frau nicht begegnen, dachte Stachelmann. Er versuchte sich die Szene vorzustellen. Aber dann dachte er an das Geld, das auf Ossis Konto lag, und die mysteriösen Zahlungen. Ob er gespielt hat? Ob er in Bordelle ging? Ob er erpresst wurde? Oder zahlte er tatsächlich an seine ehemalige Familie? Warum dann nicht per Überweisung? Aus Steuergründen oder wegen Hartz IV? Da müsste man sich erkundigen. Vielleicht durfte seine Exfrau nicht so viel Geld auf ihrem Konto haben? Und womöglich würde sie Carmen belügen? Wenn sie Sozialhilfe beziehungsweise dieses Arbeitslosengeld 2 bezog, durfte sie nebenher nicht viel einnehmen. Stachelmann zuckte der Gedanke durch den Kopf, er müsse sich bald auch mit diesen Dingen herumschlagen. Wenn er so weitermachte. Und Ossi hatte in ihm einen gesehen, der es geschafft hatte. Nichts hatte er geschafft, gar nichts.
Ossis Akte lag auf seinem Schoß, ungeduldig folgte er der Diskussion. Dann stand er auf und sagte, zu Carmen gewandt: »Du hältst mich auf dem Laufenden?«
»Ja, tschüs. Ich ruf dich an.«
Stachelmann reichte Taut die Hand, winkte den anderen kurz zu und verließ das Präsidium, Ossis Ordner unter dem Arm. Auf der Straße überraschte ihn ein milder Sommerwind. Der kam von der Nordsee und wehte die Elbe hinunter durch die Stadt, weiter nach Lübeck an die Ostseeküste Schleswig-Holsteins. Stachelmann kam es vor, als hätte er bis dahin das Wetter an diesem Tag nicht gespürt.
In drei Wochen waren Semesterferien, da wollte er mit Anne und Felix in den Urlaub fahren, nach Schweden in ein einsames Haus an einem einsamen See. So hatten sie es vor Monaten schon verabredet. Als er daran dachte, spürte er die Beklemmung, die in ihm wuchs. Da lag etwas zwischen ihnen, und das würde nicht verschwinden in einem Urlaub mit einem Kind, das öfter schrie als andere Kinder, wie Stachelmann glaubte, und das Annes Aufmerksamkeit und Kraft so sehr beanspruchte, dass für ihn nicht viel übrig blieb.
Während er zur U-Bahn-Station Alsterdorf ging, überlegte er, wann ihm die Freude auf den ersten gemeinsamen Urlaub verloren gegangen war. Als Anne andeutete, sie wolle ein Kind von ihm haben? Er hatte es jedenfalls so verstanden und nicht nachgefragt, weil er fürchtete, die Idee könnte sich festsetzen. Was hatte sie gesagt? Ich habe irgendwo gelesen, es sei nicht gut, wenn ein Kind ohne Geschwister aufwächst. Man dürfe natürlich nicht alles ernst nehmen, was geschrieben werde, aber das habe sie sich hin und wieder auch schon überlegt. Und es seien ihr all die Einzelkinder eingefallen, die sie kenne. Die neigten zu Narzissmus, und einige von denen seien verzogen, sie könne es nicht lange aushalten mit ihnen. Irgendwann hatte sie gesagt, sie kenne Leute, deren Ehen bestimmt nie scheitern würden. Jetzt fiel ihm ein, letztes Weihnachten hatte sie angefangen, über Familie und Kinder zu sprechen, so ganz nebenbei, absichtslos vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Als sie den gemeinsam bereiteten Entenbraten aßen, Heiligabend. Stachelmann hatte ihre Gedanken dünnlippig weggeredet, also schnell etwas gefunden, das an Annes Ideen anknüpfte, aber gleich wegführte, zu eigenen Erinnerungen an schreckliche Familien mit schrecklichen Kindern, wohlgemerkt keinen Einzelkindern, deren Welt trotzdem eingegrenzt war auf einen Radius von drei Metern um die eigenen Bauchnabel. Er erinnerte sich an ihre Blicke, als er das sagte, so eher nebenbei, wo doch mitklang, dass sie sich auch über etwas anderes unterhalten könnten. Dann hatten sie erst einmal eine Zeit gar nichts mehr gesagt. Felix hatte geschrien, sie mühten sich, ihn zu beruhigen. Später hatten Anne und Felix Weihnachtsgeschenke ausgepackt, sie hatte Stachelmann geküsst, um sich zu bedanken, er hatte sie geküsst, um sich zu bedanken. Dann waren sie müde und ein wenig angetrunken ins Bett gegangen, am Morgen sprachen sie über vieles, nur nicht über das, was sie am Abend zuvor auch nicht beredet hatten.
Aber ein paar Wochen später fing sie wieder an, redete von ihrem Lebensentwurf, ohne ihn auszumalen. Doch es war klar, er sah nicht vor, dass es so weitergehen könne wie bisher. Warum nicht, fragte sich Stachelmann. Es war gut, wie es war. So ist es im Leben doch selten, und wenn es gut ist, sollte man nichts ändern. Aber er widersprach nicht, sagte eher nebulös, er müsse über dieses und jenes nachdenken, sie nickte verständnisvoll, aber nicht ohne zu zeigen, sie erwarte etwas von ihm.
In der U-Bahn war es heiß. Er fuhr bis zum Stephansplatz und stieg um in die Metro-Bus-Linie 5, die ihn zum Dammtor brachte. Von dort lief er zum Philosophenturm und fuhr mit dem, je nach Kunstverständnis, bemalten oder beschmierten Aufzug nach oben. In seinem Dienstzimmer staute sich die Hitze, er riss das Fenster auf. Ein warmer Wind ließ Blätter von seinem Schreibtisch fliegen, aber er beachtete es nicht. Er legte Ossis Ordner auf den Beistelltisch, der damals den Berg der Schande getragen hatte, all die ungelesenen Akten für seine Habilschrift, und beschwerte den Deckel mit einem Buch. Er schaute auf die Uhr und sah, er hatte noch eine gute halbe Stunde Zeit. Das reichte nicht, um eine Seminararbeit zu korrigieren, so stellte er den PC an. Nachdem der hochgefahren war, entfernte er Müllmails und mögliche Viren aus dem Eingangspostfach und fand nur eine Nachricht, die ihn interessierte. Sie war von Carmen. Die Rechtsmedizin habe einen vorläufigen Befund, der noch überprüft werden müsse. Erfahrungsgemäß aber träfen vorläufige Befunde meistens zu, deshalb informiere sie ihn kurz. Ossi habe ein starkes Schmerzmittel namens Tramal genommen und sich dann ein neuartiges Insulinpräparat, ein Spray, in die Nase gespritzt. Eine Überdosis, die ihn rasch getötet habe. Die Spurensicherung habe ein Insulinspray gefunden auf dem Schreibtisch. Sie hätten es genau untersucht und entdeckt, dass die Sprayöffnung erweitert worden sei, mit einer Nadel oder Ähnlichem. So sollte sich offenbar die Dosis vergrößern beim Sprühen, aber das könne nicht funktionieren. Aufgefallen sei sonst nichts außer einer schwachen Rötung an der Schläfe. Sie hätten auch keine Spuren gefunden, die nicht von Ossi oder ihr stammten. Offenbar habe niemand Ossi besucht, schon gar nicht sei jemand in die Wohnung eingebrochen. Es sehe alles nach Selbstmord aus. Dagegen spreche nur, dass ein Abschiedsbrief fehle, und vielleicht auch die Rötung an der Schläfe. Diese aber könne man sich leicht holen, wenn man beispielsweise seinen Kopf anstoße. Warum Ossi keinen Abschiedsbrief geschrieben habe, werde sein Geheimnis bleiben. Er sei nicht der erste Selbstmörder, der schweigend abtrete. Sie müsse sich damit abfinden und ihre Schuldgefühle verdrängen. Vielleicht könnten sie sich bald wieder treffen, um zu reden. Ihr würde es helfen. Wenn er Ossis Akten gelesen habe, möge er sie bitte zurückgeben. Taut würde trotz der eindeutigen Lage gerne hören, was Stachelmann von diesen Unterlagen halte.
Der Befund überraschte ihn nicht. Er beantwortete aber die Frage nicht, warum Ossi sterben wollte. Er muss verzweifelt gewesen sein. Ob er doch an Depressionen gelitten hat? Aber das hätte Carmen doch gewusst und Stachelmann gesagt, weil es sie entlastete. Einem Menschen, der unter Depressionen litt, kann man nicht helfen durch gutes Zureden. Der verliert sich in seiner Welt der Finsternis. Auf Stachelmann hatte Ossi nicht gewirkt wie ein Depressiver. Dann griff Stachelmann doch zum Telefon. Carmen hob ab.
»Wie kommt er an dieses Spray, gibt es das in Apotheken?«
»Nein«, sagte Carmen. »Das Zeug ist noch nicht im Handel. Wir wissen nicht, woher er es hat. Und wir wissen auch nicht, warum er sich nicht mit einer Überdosis Tramal begnügt hat, die hätte auch gereicht. Die Pathologen sagen, er habe womöglich auf Nummer sicher gehen wollen. So wie die Leute, die in der Badewanne Schlaftabletten nehmen, damit sie ertrinken, falls die Tabletten nicht reichen.«
»Hatte er Depressionen?«
Sie überlegte kurz. »Nein. Er war manchmal niedergeschlagen. Aber wer ist das nicht? Und wer trauert nicht verpassten Gelegenheiten nach?«
»Das Leben ist gepflastert damit«, sagte Stachelmann. »Aber hätten wir alle verpassten Gelegenheiten wahrgenommen, hätten wir verpasst, was wir erlebt haben.«
Sie lachte, und er freute sich. Einige Augenblicke sagte keiner etwas. Er hörte sie atmen.
Es klopfte an der Tür. Sie öffnete sich, ein Gesicht schaute herein. Darauf zeichnete sich ein Vorwurf ab, als es Stachelmann telefonieren sah. »Das Seminar hat angefangen, Herr Stachelmann«, sagte der Student.
»Gleich«, erwiderte Stachelmann unfreundlich. Verstehe einer diese Studenten, früher hätten sie ihren Spaß gehabt, wenn ein Dozent sich verspätete.
Er beendete das Telefonat, dann hängte er sich seine Aktentasche am Riemen über die Schulter und ging zum Seminarraum. Nun fiel ihm ein, er hatte die Seminar arbeit nicht gelesen, die gleich diskutiert werden sollte. Ihre Autorin war eine kleine Rothaarige mit stets verbissenem Gesichtsausdruck. Als er den Seminarraum betrat, erstarben alle Geräusche. Die vielleicht fünfzehn Studenten schauten ihn erwartungsvoll an. Wieder überraschte ihn das Strebertum. Er hatte andere Zeiten kennen gelernt. Zeiten des Aufruhrs, Zeiten der Langeweile, und nun war die Zeit des Strebertums.
»Ich wurde heute Nacht von der Polizei geweckt.«
Irgendjemand kicherte leise.
Es störte Stachelmann. »Ein Bekannter von mir hat... ist tot. Ich musste mich den ganzen Tag damit beschäftigen. Deshalb konnte ich Ihre Arbeit« – er blickte zur Rothaarigen, die ihn mit den Augen anfeindete – »nicht lesen. Aber halten Sie Ihr Referat, ich werde das Schriftliche bis zum nächsten Mal benoten.«
Sie schien widersprechen zu wollen, aber dann kramte sie in einem Papierstapel vor ihr, zog ein Blatt heraus und begann vorzulesen mit einer fast keifenden Stimme. Sie klang nach Rechthaberei und dem Trotz, in dem sich eine Kränkung spiegelt. Dabei war es nicht schlecht, was sie vortrug über Mittelbau-Dora, das Konzentrationslager, in dem die Nazis bis zuletzt Zwangsarbeiter an Wunderwaffen arbeiten ließen. Zunächst war Dora ein Außenlager von Buchenwald gewesen, dann wurde es ein eigenständiges KZ, in dessen Stollensystemen die Gefangenen unter unglaublichen Bedingungen zu überleben versuchten. Vernichtung durch Arbeit. Der berühmte Raketenpionier Wernher von Braun stolperte fast über die Leichen, die täglich gestapelt wurden, Opfer auch seines diabolischen Paktes mit den braunen Mördern, von denen er selbst einer wurde. Aber kurz bevor die Naziherrlichkeit vorbei war, im April 1945, lief er zu den Amerikanern über und tauschte seine Freiheit ein gegen Informationen über die Vergeltungswaffen. Er hätte in Nürnberg auf der Anklagebank sitzen müssen, noch vor einigen anderen, die dort abgeurteilt wurden.
Die Russen machten es nicht besser. Als die Amerikaner ihnen Thüringen abtraten, da räumten die roten Besatzer die Reste der Raketenrüstung zusammen und verschleppten die Ingenieure, die geblieben waren, nach gemeinsam durchzechter Nacht in die Sowjetunion.
Diese Geschichte ging Stachelmann durch den Kopf, während die Studentin referierte über die Häftlinge, die aus dem kurz darauf befreiten Auschwitz nach Dora verschleppt worden waren, um unterwegs oder am Zielort in Massen zu sterben. Durch Kälte, Hunger, Krankheit, Miss-handlung oder Hinrichtung. Warum, verdammt, musste ich mir das Konzentrationslager Buchenwald als Thema aussuchen für meine Habilitation? Das schlägt mir aufs Gemüt, kein Wunder, dass ich nicht zu Potte komme mit meiner Arbeit. Zäh quälte er sich Tag für Tag durch das umfangreiche Rohmanuskript, und wenn er ein Kapitel durchgearbeitet hatte, kehrten über Nacht die Zweifel zurück, ob es Bohmings Ansprüchen und vor allem den eigenen genügen würde. Banal erschien ihm, was er schrieb. Er hörte gar nicht mehr, was die Studentin berichtete, ihre Stimme war nur noch ein Hintergrundgeräusch seiner Gedanken. Zwar deutete der Lehrstuhlinhaber Professor Bohming seit Griesbachs Tod Stachelmann gegenüber immer wieder an, wie gern er ihn als Nachfolger sehen würde. Aber was nutzte es, wenn die Arbeit nicht fertig wurde? Und konnte er Bohming trauen? Vielleicht guckte er sich gerade irgendwo wieder einen neuen Favoriten aus und schmierte dem Honig ums Maul, wie er es bei Stachelmann und Griesbach auch getan hatte. Hausberufung? Kein Problem, du gehst für eine Zeit an eine andere Uni, das deichsle ich. Und dann rufen wir dich zurück. Setzen dich auf Platz eins der Bewerberliste, da wird nichts schief gehen. Wenn ich etwas organisiere, klappt das auch. Wäre doch gelacht.
Da merkte Stachelmann, es war still geworden. Die Augen waren auf ihn gerichtet, das Referat beendet. Er hustete, um die Peinlichkeit zu überspielen. »Ja, vielen Dank. Ein gutes Referat. Gibt es Wortmeldungen?«
Mehr nebenbei erteilte er diesem und jenem das Wort. Er mühte sich zuzuhören, aber die Diskussion rauschte großteils vorbei an ihm. Er war froh, als das Seminar beendet war. Er blieb sitzen, bis der letzte Teilnehmer gegangen war. Der Schmerz kroch vom Gesäß nach oben, zwischen die Schultern. Stachelmann versuchte ihn zu verdrängen. Er dachte an Ossi und daran, dass der vielleicht Recht gehabt hatte. Warum die Qual, die Angst, der Druck? Er fühlte sich alt und müde.
Zurück im Dienstzimmer rief er Anne an. Sie nahm nicht ab, er sprach auf den Anrufbeantworter, dass er für einige Zeit nach Hause fahre. Er müsse Ossis Akte lesen.
Sie wird sich jetzt fragen, warum ich das nicht bei ihr tue. Aber sagen wird sie es mir nicht, ich würde die Frage nur in ihren Augen lesen. Er packte Ossis Akte in seine Tasche, dann ging er zum Dammtorbahnhof. Nieselregen hatte eingesetzt, eine Brise trieb ihm Tropfen ins Gesicht. Er spürte sie kaum.
Im Hauptbahnhof stieg er um in die Regionalbahn nach Lübeck. Die erste Klasse war gut besetzt, sein Lieblingsplatz am Tisch belegt. Er setzte sich in die letzte Reihe ans Fenster. Der Zug fuhr an, der Lärm des Bahnhofs blieb zurück. Dann schloss er die Augen. Der Gleisrhythmus ergriff ihn. Er sah Pete Townshend mit dem Windmühlenarm die Gitarre schlagen, während er sprang und die Beine spreizte. John Entwhistle ließ im Knochenmannanzug den Bass krachen und trank aus dem Becher, der am Mikrophonständer hing und keine Honigmilch enthielt. Keith Moon schlug mit wenigstens drei Händen auf Snaredrum und Tomtoms, die doppelten Bassdrums trieben den Rhythmus voran, während Roger Daltrey ins Mikrophon schreistotterte: Things they do look awful c-c-cold / I hope I die before I get old. / Talkin' 'bout my generation.
* * *
2. Mai 1978
Wir werden sie noch erleben, die Revolution. Gestern haben mehr an der Demo teilgenommen als letztes Jahr. Unter roten Fahnen, hier und da waren auch schwarze. Die Sozis und die Gewerkschaftsbonzen haben ganz schön blöd geguckt. Die hatten noch den Suff im Kopf vom Tanz in den Mai und schleppten ihre fetten Bäuche.
Heute gibt es in der Rhein-Neckar-Zeitung einen langen Artikel über die Hinrichtung. Sie haben keine Spur, nur Spekulationen. Bandenmord, Nazis, Eifersucht. Vielleicht hätten wir einen Bekennerbrief hinterlassen sollen. Als Warnung für alle Verräter. Ich werde es vorschlagen. Wenn die Hinrichtung des Schweins, der für die Faschisten gespitzelt hat, eine revolutionäre Tat war, dann müssen wir damit offensiv umgehen. Auch wenn das Risiko wächst, dass sie uns kriegen.
Ach ja, auf der Demo habe ich Angelika getroffen. Sie hat sich sogar eine Weile bei mir eingehakt. Aber nicht nur bei mir. Ich hätte mich gern mit ihr verabredet. Aber ich hab mich nicht getraut, sie zu fragen.
[Menü]
4
Der Anrufbeantworter blinkte, sieben Nachrichten warteten darauf, abgehört zu werden. Er drückte auf den Wiedergabeknopf. Zuerst seine Mutter, die mit einem Vorwurf im Unterton erklärte, er habe sie lange nicht mehr besucht. Nun habe sie in Vaters Nachlass Dinge gefunden, die ihn vielleicht interessierten. Gleich meldete sich das schlechte Gewissen. Seit dem Tod des Vaters hatte er seine Mutter noch einmal besucht. Und das war nun fast ein Jahr her. Der zweite Anrufer hatte nur ein Piepen und Rauschen hinterlassen, der dritte auch. Nummer vier war Anne, die nur sagte, sie habe angerufen. Offenbar ärgerte sie sich. Fünf bis sieben hatten nicht aufs Band gesprochen.