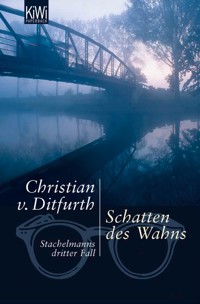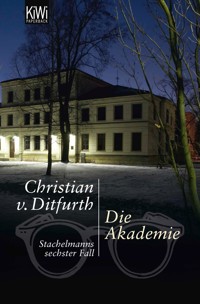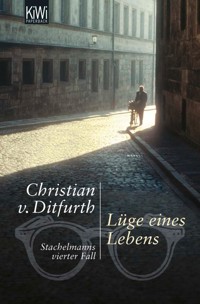
8,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Stachelmann ermittelt
- Sprache: Deutsch
Stachelmanns vierter Fall – die Spur führt nach Buchenwald Alles ist gut. Endlich. Josef Maria Stachelmann hat seine Habilitation glänzend bestanden. Nun fehlt ihm nur noch die Berufung auf einen Lehrstuhl. Aber sein Chef, Professor Bohming, hatte ja versprochen, ihm zu helfen. Sogar Stachelmanns Beziehung mit Anne läuft störungsfrei. Besser könnte es wirklich nicht sein.Doch dann fallen Schüsse an der Hamburger Universität, Schüsse auf Stachelmann. Der Historiker bleibt unverletzt und begreift allmählich, dass der Schütze ihn mit Absicht verfehlt hat. Die Polizei findet heraus, dass der Anschlag mit einem Militärgewehr verübt wurde, mehr Spuren entdeckt sie nicht. Als dann noch eine Rufmordkampagne im Internet gegen ihn beginnt, verliert sich Stachelmann in einem Labyrinth der Angst. Er versteht nur, dass es um seine Arbeit über das KZ Buchenwald geht. Irgendetwas darin stört irgendjemanden. So sehr offenbar, dass er deswegen schießt und mordet. Das Opfer ist eine Studentin. Musste sie sterben, weil sie das Rätsel um den mysteriösen Schützen gelöst hatte?Stachelmann bleibt keine Wahl. Er entschließt sich, den Täter zu suchen, und deckt eine Lebenslüge auf. Aber erst als er sich auf seine Fachkenntnisse besinnt, beginnt er zu ahnen, dass er das Verbrechen nur in Buchenwald aufklären kann, einem Konzentrationslager, dessen Geschichte längst nicht abgeschlossen ist.In diesem packenden Kriminalroman wandeln sich Gewissheiten in Fragen, erweisen sich Verdächtige als Helfer, und Freunde entpuppen sich als Feinde. Als Stachelmann endlich seinen vierten Fall löst, tötet er einen Menschen und trifft eine Lebensentscheidung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 569
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
» Buch lesen
» Mein Dank gilt
» Über das Buch
» Informationen zum Autor (Klappentext)
» Lieferbare Titel / Lesetipps
» Impressum
Für Elfi
Die hinterhältigste Lüge ist die Auslassung.
Simone de Beauvoir
[Menü]
1
Es splitterte und knallte, dann ein Schrei. Etwas befahl Stachelmann, sich auf den Boden zu werfen. Er schlug hart auf die Knie und zerkratzte sich die Hände auf dem Pflaster. Er hatte geschwitzt in der S-Bahn und gefroren auf dem Weg vom Dammtorbahnhof zur Universität, aber in diesem Augenblick fühlte er nichts. Jetzt verstand er, dass er selbst geschrien hatte. Er lag im Schneematsch auf dem Pflaster des Von-Melle-Parks, ein paar Dutzend Schritte nur entfernt vom Eingang des Philosophenturms. Und jemand hatte geschossen. Auf ihn. Warum, verdammt, bin ich nicht ins Gebäude gerannt, statt mich hinzuwerfen? Jetzt spürte er, wie die Nässe kalt durch seine Hose drang. Er versuchte zum Eingang des Philosophenturms zu kriechen, aber er war wie gelähmt. Arme und Beine gehorchten ihm nicht. Er suchte die Angst in sich, aber da war nichts dergleichen. Da war nur ein Staunen.
Wieder ein Schuss. Es pfiff an seinem Ohr vorbei, ganz nah, laut, kurz. Der Knall wurde hin- und hergeworfen zwischen Philosophenturm, Audimax und dem Gebäude der Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Der nächste Schuss. Diesmal hörte Stachelmann ein Splittern, vor ihm staubte es hoch, Steinsplitter flogen ihm ins Gesicht. Menschen schrien durcheinander, Stachelmann hörte den Schrecken und die Angst in den Stimmen.
Dann war die Lähmung weg, und die Angst packte auch ihn. Weg hier, bloß weg. Er hatte keine Deckung, war eine Zielscheibe, wenn der Schütze von oben schoss. Stachelmann kroch zur Eingangstür des Philosophenturms. Neben ihm schlug es ein, der Knall hallte nach. Wieder trafen ihn Splitter im Gesicht, es stach und brannte, er kroch weiter, so schnell er konnte. Stachelmann meinte zu sehen, wie der Unbekannte auf ihn zielte. Jeden Augenblick konnte ihn der Schuss töten. Fast fühlte er schon, wie die Kugel heiß in seinen Rücken eindrang. Schnell, schnell. Die letzten Meter stand er auf, er rannte, schlug einen Haken. Der Schuss traf die Tür, als Stachelmann sie öffnete. Er spürte den Schlag von der Wucht des Geschosses in der Hand, sah das Loch, das die Kugel in die Tür gerissen hatte. Er warf sich ins Gebäude, fiel auf Knie und Ellbogen, stöhnte auf und begriff noch im Rollen, dass er hinter der Mauer unterhalb der Fenster sicher war. Er schmeckte Blut, wischte sich mit der Hand übers Gesicht, die Hand wurde nass und färbte sich rot. Auf der anderen Seite der Tür lagen zwei Studenten. Der eine hatte seinen Kopf unter den Armen begraben, als könnten die ihn gegen Kugeln schützen. Der andere stierte zu Stachelmann.
Stachelmann schaute zur Cafeteria. Menschen lagen auf dem Boden. Seine Augen verharrten bei einer Frau, die ihn anstarrte. So viel Angst hatte er noch nie gesehen. Dann schaute die Frau weg, wie in Zeitlupe.
Warum schoss es nicht mehr?
Er hörte Sirenen. Bald zuckte Blaulicht auf dem Boden und in der Cafeteria. Vor deren Fensterwand stand ein Polizeiauto. Das Licht blinkte auf den Körpern, die in der Cafeteria lagen. Zwei Polizisten öffneten die Eingangstür, sie hatten Pistolen in den Händen.
»Von wo?«, brüllte einer. Als er keine Antwort erhielt, brüllte er noch lauter: »Von wo wird geschossen?«
Stachelmann wollte antworten, öffnete den Mund, bekam aber kein Wort heraus.
»Da«, sagte der Student, der Stachelmann angeglotzt hatte. Er zeigte mit der Hand nach draußen.
Die Polizisten stockten, guckten einen Augenblick ratlos umher, dann stürmten sie wortlos in die Cafeteria. »Scheiße!«, brüllte der eine.
Bald erschien ein Mann im weißen Kittel mit einer schwarzen Tasche, er betrat die Cafeteria, kniete nieder neben der Frau, die Stachelmann angestarrt hatte, fühlte den Puls, holte aus der Tasche eine Spritze und eine Ampulle, brach diese auf, steckte die Nadel der Spritze hinein, zog den Kolben zurück, drückte etwas Flüssigkeit durch die Nadel, desinfizierte die Armbeuge und stach mit der Spritze hinein. Stachelmann folgte jeder Bewegung. Sonst schaute er weg, wenn jemandem eine Spritze gesetzt wurde, sogar im Kino.
Der Polizist, der gebrüllt hatte, zeigte nach draußen und zuckte mit den Achseln. Stachelmann fiel auf, dass niemand mehr schrie. Er kroch in Richtung Cafeteria. Währenddessen linste er hinaus. Überall Polizei, ein Sondereinsatzkommando mit Helmen, Schutzwesten, Maschinenpistolen und Gewehren. Zivilpolizisten. Dann erkannte er Taut, den Leiter der Mordkommission, der seinen mächtigen Körper schon zum Tatort geschleppt hatte. Stachelmann erhob sich, ging zurück zur Tür und trat hinaus. Er hatte Angst, aber seit er Taut gesehen hatte da draußen, konnte er wieder denken. Wenn die vielen Polizisten herumstanden ohne Deckung, dann war das Schießen vorbei. Stachelmann ging mit Gummiknien zu Taut. Der erkannte ihn sofort.
»Herr Dr. Stachelmann, sind Sie verletzt?«
Der blickte an sich hinunter, sah seine verdreckte Kleidung und schüttelte den Kopf. Taut schaute sich hektisch um, entdeckte eine Frau in einem weißen Kittel, schickte einen uniformierten Polizisten zu ihr und wies auf Stachelmann. Die Ärztin eilte zu Taut. Der Hauptkommissar sagte der Ärztin etwas und zeigte wieder auf Stachelmann. Die Ärztin nahm Stachelmann an der Hand und führte ihn zu einem großen Krankenwagen, dessen Hecktüren
geöffnet waren. Daneben weitere Krankenwagen. Sanitäter standen herum. Offenbar waren mehr Krankenwagen herangerast, als gebraucht wurden.
»Setzen Sie sich hinein«, sagte sie freundlich, aber eindringlich. Mit einer Pinzette zupfte sie ihm Steinstückchen aus der Gesichtshaut, zwei Wunden überklebte sie mit Pflaster. Dann fühlte sie den Puls und maß seinen Blutdruck. »Legen Sie sich eine Weile auf die Liege, dann geht es wieder«, sagte sie.
Er tat es und schloss die Augen. In seinem Kopf hallten die Schüsse nach. Er hörte noch einmal die Schreie. Träume ich? Es ist doch unmöglich, dass hier einer wild herumballert. Wir sind doch nicht in Amerika. Aber es war möglich. Kein Zweifel, da hatte jemand geschossen. Auf ihn. Jetzt hörte er es wieder splittern, pfeifen und knallen. Er schaute sich um, als könnte er den Schützen ausfindig machen. Was für einen Grund konnte der haben, auf Stachelmann zu schießen? Ein Amokläufer? Er hob den Kopf und sah, wie Leute ziellos umherliefen. Sie waren überfordert. Das hatten sie noch nicht erlebt. Er setzte sich auf die Liege, ihm schwindelte. Er fixierte das Rücklicht eines Polizeiwagens, bald sah er klarer. Mit den Händen stützte er sich, während er vorsichtig aufstand. Wer hatte geschossen? Und warum? Das musste er begreifen.
Taut stand vor ihm. »Was ist hier los? Wissen Sie etwas?«
»Jemand hat auf mich geschossen.«
»Auf Sie?«
»Ja«, schnauzte Stachelmann. »Auf mich.«
Taut starrte ihn an, dann schaute er sich um. »Können Sie gehen?«
»Lassen Sie ihn«, sagte der Sanitäter.
»Ja«, sagte Stachelmann. Er stand auf, ihm wurde schwindlig, er stützte sich auf die Stoßstange des Krankenwagens.
Der Sanitäter fasste ihn an der Schulter. »Sie müssen sich ausruhen.«
»Nein«, sagte Stachelmann. Der Schwindel ließ nach.
»Haken Sie sich ein«, sagte Taut. Er hielt Stachelmann seinen Arm entgegen.
»Das können Sie nicht machen!«, sagte der Sanitäter energisch.
Stachelmann hakte sich ein und spürte den massigen Körper des Kriminalpolizisten.
»Zeigen Sie mir, wo Sie waren, als die Schüsse fielen.«
Stachelmann guckte sich um, bald hatte er sich orientiert. Er führte Taut zu der Stelle, wo er auf dem Pflaster gelegen hatte. Zwei Einschläge waren mit Kreide markiert. »Hier«, sagte Stachelmann.
Sie näherten sich der Eingangstür des Philosophenturms, Stachelmann brauchte die Stütze, seine Knie waren aus Gummi. Ein paar Schritte vor der Tür wieder ein kleiner Krater, darum ein Kreidekreis. Jemand hatte Schneematsch zur Seite geschoben. Stachelmann erinnerte sich. Er war gerannt, als es neben ihm einschlug. Dann hatte er die Tür aufgerissen. »Dort«, sagte Stachelmann. Er fühlte sich schwach und elend. »Dort ist die letzte Kugel eingeschlagen.« Er zeigte zur Tür. Auch dieses Einschussloch war gekennzeichnet. Taut zog Stachelmann zur Tür. Vorne ein kleines rundes Loch, auf der Rückseite der Tür hatte die Kugel Holzsplitter herausgerissen. Sie lagen verstreut auf dem Boden.
»Das war kein Kleinkalibergewehr«, sagte Taut. Er zog Stachelmann zur Kantine. Die Frau, die auf dem Boden gelegen hatte, war weg. Sie setzten sich an den Tisch. Außer ihnen war niemand im Raum. »Der hat wohl Sie gemeint«, sagte Taut. »Nehmen Sie es mir nicht übel. Aber das hilft uns weiter.«
Stachelmann nickte. Die Schüsse hatten ihm gegolten. Aber viermal hatte der Schütze ihn verfehlt. Beim ersten Mal war Stachelmann gelaufen, bei den beiden folgenden Schüssen hatte er auf dem Boden gelegen, beim letzten, der die Tür traf, war er gerannt. »Er hat viermal vorbeigeschossen.«
»Das ist unser Glück, aber es ist seltsam. Sobald wir die Stelle gefunden haben, von wo aus geschossen wurde, wissen wir mehr. Aber dass der Schütze Sie nicht getroffen hat, ist erstaunlich. Sieht fast so aus, als hätte er absichtlich vorbeigeschossen. Immer dicht daneben. Wer könnte das tun?«
Stachelmann zuckte die Achseln. Wer tut so was?
»Haben Sie mit jemandem Streit gehabt?«
Stachelmann schüttelte den Kopf. In ihm arbeitete es. Das ist doch absurd. »Das war ein Irrer.«
Taut warf ihm einen neugierigen Blick zu. »Wie kommen Sie darauf?«
»Mir fällt kein halbwegs vernünftiger Grund ein. Und so was gibt's doch. Da lebt irgendeiner Allmachtsphantasien aus. Und ich hatte das Pech, zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein.«
»Mag sein. Unsere Erfahrung spricht dagegen. Vielleicht haben Sie jemanden beleidigt, ohne es zu merken? Eine schlechte Note gegeben oder einen durchfallen lassen. Sie glauben gar nicht, wie viele Gründe es geben kann, dass jemand durchdreht. Manche Leute warten geradezu auf einen Auslöser, und der kann anderen völlig unwichtig erscheinen.«
»Ja, ja«, sagte Stachelmann. Er hatte sich wieder einigermaßen im Griff. Der Schwindel war verschwunden, und obwohl er sich noch schwach fühlte, traute er es sich wieder zu, systematisch zu denken.
Ich hatte einfach Pech. Oder es war Absicht.
Ein Polizist eilte auf Taut zu und flüsterte ihm etwas ins Ohr. Dann ging er weg in Richtung WiSo-Fakultät.
»Die Kollegen haben den Ort gefunden, von dem aus geschossen wurde«, sagte Taut. »Kommen Sie mit?«
Stachelmann antwortete nicht, lief aber los. Die Knie waren fast schon wieder gummifrei. Polizisten hielten Neugierige zurück. Fotoapparate blitzten, doch Stachelmann achtete nicht darauf. Irgendjemand rief ihm etwas zu, aber er wollte es nicht hören. Taut holte ihn ein.
»Es ist oben, auf dem Dach«, sagte ein Polizist zu Taut.
Sir fuhren mit dem Fahrstuhl nach oben. Eine Stahltreppe führte zu einer Stahltür, die offen stand. Taut trat als Erster hinaus aufs Dach, Stachelmann folgte ihm, dann noch ein Uniformierter. An der Kante zum Von-Melle-Park standen zwei Männer mit Anoraks, auf dem Rücken die Aufschrift Kriminaltechnik. Stachelmann blieb in Tauts Schlepptau. Der Leiter der Mordkommission näherte sich den Kriminaltechnikern, Stachelmann sah drei Kreidekreise auf dem Beton. In den Kreidekreisen lagen Patronenhülsen.
»Die vierte Hülse haben wir noch nicht gefunden, ist wohl hinuntergefallen«, sagte ein Kriminaltechniker. Er hatte rote Wangen von dem kalten Wind, der den Nieselregen übers Dach trieb. Im schwarzen Schnauzbart hatten sich Tropfen verfangen. Der andere Kriminaltechniker kniete an der Dachkante und wandte den anderen den Rücken zu. »Habt ihr sie?«, rief er hinunter.
»Kaliber 7,62«, sagte sein Kollege. »Das ist schon mal sicher. Wahrscheinlich eine automatische oder halbautomatische Waffe, das zeigen die Abdrücke des Verschlusses auf der Hülse.«
»Also ein Militärgewehr?«, fragte Taut.
»Sieht so aus.«
»Hm.«
Was bedeutete es? Ein Soldat? Unsinn! Militärgewehre gab es zu Millionen überall in der Welt, in Kriegen und Bürgerkriegen. In den Händen von Soldaten, Banden, Todesschwadronen, Guerilleros, Frauen und Kindern. Wahrscheinlich hatten allein in Deutschland Tausende von Waffennarren Militärgewehre im Schrank stehen. Weil sie sich mächtig fühlen wollten. Sie hatten Menschenleben in der Hand. Wir könnten ja, wenn wir wollten ...
»Morgen wissen wir mehr. Wir vergleichen die Hülsen mit den Mustern beim BKA.«
»Gut«, sagte Taut.
Stachelmann stellte sich an die Dachkante. Die Tiefe griff nach seinem Unterleib und zog ihn hinab. Er wehrte sich, stemmte sich gegen das Gefühl. Von hier hatte er einen guten Überblick über den Von-Melle-Park. Und der Schütze hatte ein ideales Schussfeld gehabt. Stachelmann sah sich da unten auf dem Pflaster im Schneematsch liegen. Von hier oben, so nah, würde wahrscheinlich selbst er ein Ziel von dieser Größe treffen. Bei vier Versuchen allemal.
»Kaum zu glauben, dass er vorbeigeschossen hat«, sagte Taut leise. Er hatte sich unmerklich neben Stachelmann gestellt.
»Genau das habe ich auch gedacht.«
»Der hat ganz genau gezielt«, sagte Taut. »Und ganz genau vorbeigeschossen. Der wollte Sie nicht töten.«
Als Stachelmann vor Annes Wohnungstür stand, war er schweißüberströmt und atemlos. Er traf das Schloss nicht mit dem Schlüssel, er versuchte es ein paarmal. Schließlich klingelte er und setzte sich auf die Treppe zum nächsthöheren Stockwerk.
Sie schlug die Hand vor den Mund, als sie ihn sah, dann nahm sie ihn an der Hand. »Komm erst mal rein.« Sie führte ihn ins Badezimmer.
Er setzte sich auf den Klodeckel und schnaufte, dann stand er auf, stellte sich vor den Spiegel und wusch sich vorsichtig Hände und Gesicht. Das Gesicht sah nicht so schlimm aus, wie er befürchtet hatte. Zwei Pflaster, eines unterm Auge, das andere am Kinn. Ein paar Kratzer, das Blut war verschorft und schmierte, als er die Stellen mit dem Waschlappen berührte. Er tupfte sie mit einem Kosmetiktuch notdürftig trocken. Dann begann er sich auszuziehen, während sie verschwand und gleich zurückkehrte mit trockener Kleidung. Sie stützte ihn, als er die Hose wechselte. Dann brachte sie ihn ins Wohnzimmer, er legte sich auf die Couch. Stachelmann hörte es glucksen, die Tür zum Kinderzimmer war angelehnt. Dann klapperte es.
Er berichtete in unvollständigen Sätzen, was geschehen war. Am Ende wiederholte er: »Der hat auf mich geschossen. Knapp vorbei.« Er dachte an die Kugel, die neben ihm im Boden eingeschlagen war, und an die Kugel, die die Tür durchbohrt hatte, als Stachelmann sie geöffnet hatte. »Der hat auf mich geschossen.«
Anne schaute ihn lange an, schüttelte ihren Kopf, sodass die halblangen schwarzen Haare über die Schultern tanzten. »Warum?«
Stachelmann dachte nach, fand aber keine Antwort. »Weiß nicht. Er hat viermal auf mich geschossen. Viermal.«
»Aber doch nicht, weil er dich kennt. Sondern weil du zufällig dort warst.«
»Viermal«, flüsterte Stachelmann.
Sie stand auf, beugte sich über ihn, strich zart über die Pflaster und küsste ihn auf die Stirn. »Das war ein Verrückter. Er hat nicht dich gemeint.«
Stachelmann schloss die Augen. Er versuchte sich vorzustellen, was geschehen war. Es war ein Mann gewesen, bestimmt. Der hatte mit einem Gewehr auf dem Dach der WiSo-Fakultät gelegen und gewartet, bis ihm ein Ziel vor das Visier lief. Stachelmann musste bald zu Taut, um zu erfahren, ob die Polizei schon mehr wusste. Vielleicht hatte sie den Schützen festgenommen. »Ich muss zur Polizei«, sagte er.
»Aber nicht jetzt. Du stehst unter Schock, dein Kreislauf ist nicht stabil. Du klappst zusammen.«
»Dann fahr mich hin.«
Anne warf einen Blick zum Kinderzimmer, dann sagte sie: »Erhol dich erst, dann bring ich dich hin, morgen.«
Er wollte widersprechen, aber dann ließ er es. Sie hatte recht. Und in ihrer Wohnung war er sicher. Wenn er jetzt mit Ossi oder Carmen telefonieren könnte. Aber das ging nicht mehr. Ossi war tot. Und Carmen, der Gedanke an sie machte ihn traurig. Er versuchte sich an ihr Gesicht zu erinnern. Aber es war verschwommen, eigentlich nicht erkennbar.
Anne ging ins Schlafzimmer, wo ihr Schreibtisch stand.
Er grübelte, was er getan haben konnte, damit einer auf ihn schoss. Er suchte in seiner Erinnerung nach etwas, das er einem anderen angetan haben konnte. Er fand nichts. Natürlich hatte er Seminararbeiten kritisiert, aber keinem Studenten einen Schein verwehrt. Nein, da war nichts.
Leise Schritte tapsten näher. Stachelmann linste, es war Felix, mit seinem Lieblingsstofftier, einem Elefanten, in der Hand. Felix stellte den Elefanten auf Stachelmanns Bauch und sagte: »Wau!«
Stachelmann überlegte, welche Geräusche Elefanten machten, und erinnerte sich des letzten Besuchs in Hagenbecks Tierpark. »Elefanten machen so.« Er trötete, Felix lachte und machte es ihm nach. Dabei legte er den Oberarm an die Nase. Dann fegte er hinweg, stolperte über ein Kissen, das er wohl selbst auf den Boden geworfen hatte, erschrak, blieb einen Augenblick liegen, stand wackelig wieder auf und rannte weiter.
Stachelmann schloss die Augen, gleich kehrten die Bilder zurück in seinen Kopf. Und das Geräusch, als die Kugeln neben ihm das Pflaster splittern ließen. Erst hatte es geklungen, als würden Steine aneinandergeschlagen, gleichzeitig pfiff es.
Er hörte die Geräusche in der Wohnung wie durch eine Wand. Als er die Hand vor die Augen hielt, sah er sie zittern. Anne kam aus der Küche und stellte ein Tablett auf den Tisch. Teeduft verbreitete sich. Sie rückte den Sessel näher ans Sofa heran, sodass sie ihm den Kopf streicheln konnte.
»Morgen wirst du wissen, dass du nicht gemeint warst. Vielleicht haben sie den Kerl schon.« Sie goss Tee ein und schob einen Becher in seine Nähe. Er hob den Oberkörper und nahm die Beine von der Couch, bis er saß, dann rückte er ans Ende des Sofas, beugte sich vor, stützte die Ellbogen auf die Sessellehne und schaute Anne ins Gesicht. »Der meinte mich.«
»Aber er hat nicht getroffen. Der wollte dich nicht töten. Der hat irgendeinen Unsinn getrieben. Ein Halbstarker, der in der Zeitung stehen wollte, der jetzt vor seinen Kumpels angibt, was für ein mutiger Kerl er ist. Vielleicht lief da eine Wette? Der lag auf dem Dach und wartete auf einen armen Kerl, dem er Angst einjagen konnte, und der arme Kerl warst dummerweise du.«
Stachelmann überlegte, versuchte sich wieder ins Gedächtnis zu rufen, was geschehen war. Wie soll ich damit leben, dass es einen gibt, der mich vielleicht doch töten will? Der vielleicht nur zu aufgeregt war, um zu treffen? Aber kann man viermal vorbeischießen? Die Entfernung war nicht groß, vielleicht hundert Meter. Und die Schüsse lagen alle haarscharf daneben. Das ist auch eine Art von Genauigkeit. Du bist ihm aufgefallen, du hast dich bewegt. Du hast auf ihn reagiert, das hat ihn womöglich herausgefordert. Oder ihm Spaß gemacht. Dieser Gedanke beruhigte ihn ein wenig. Vielleicht warst du doch nicht gemeint. Anne hatte recht. Er sprach es aus: »Vielleicht wollte er mich doch nicht umbringen. Wenn ich es mir genau überlege.«
»Siehst du«, sagte sie. »Wenn mir so etwas passieren würde, ich würde ausflippen und mich wochenlang verkriechen. Es sei denn, jemand zwänge mich, das zu verarbeiten. Das musst du sofort tun, bevor sich der Irrsinn festsetzt. Wir gehen heute Abend noch aus. Du musst verstehen, dass die Wahrscheinlichkeit mehr als gering ist, ein zweites Mal an einen schießwütigen Irren zu geraten. Es wird nie wieder jemand auf dich schießen.«
»Die Wahrscheinlichkeit ist in meinem Fall nicht geringer als bei jedem anderen Menschen. Die Statistik interessiert sich nicht für die Vergangenheit. Denk an Spieler im Casino. Beim Roulette bleibt die Kugel auf der 35 liegen. Wer würde in der folgenden Runde seine Chips auf die 35 legen? Kaum einer. Dabei ist die Wahrscheinlichkeit, dass die 35 getroffen wird, genauso groß wie bei jeder anderen Zahl. Die Kugel merkt sich nicht, wo sie beim letzten Mal ausgerollt ist.«
»Dass du schon wieder auf Schlaumeiereien verfällst, zeigt, dass es dir besser geht. Fast schon wieder der Alte.« Sie lachte leise. Stachelmann hörte Erleichterung heraus.
Sie tranken Tee und schwiegen eine Weile. Stachelmann mühte sich im lautlosen Dialog mit sich selbst, das Ereignis zu verstehen. Vielleicht war der Täter bereits verhaftet. Ein Verrückter, einer, der ausgeflippt war, dessen Nerven einem Stress nicht mehr standgehalten hatten. Warum hatte er sich die Universität ausgesucht? Warum nicht die Mönckebergstraße? Den Gänsemarkt? Den Hafen? War es ein ehemaliger Student? Einer, der durch eine Prüfung gefallen war? Der es nicht geschafft hatte? »Vielleicht so einer wie ich?«, sagte Stachelmann.
Anne schaute ihn fragend an.
»Na ja, einer, der nicht zu Potte kommt und sich einredet, es liege nicht an ihm, sondern an der Universität, die sein Genie verkenne, unterdrücke, du weißt, was ich meine.«
»Wie kommst du auf dich?«
»Ich gebe zu, es ist ein bisschen schief.«
»Eben. Du bist habilitiert, Herr Professor in spe! Es war zwar eine Würgerei, aber dafür am Ende mit Jauchzen und Frohlocken. Weißt du nicht mehr, wie Bohming gejubelt hat, als der Habilitationsausschuss dich beglückwünschte?«
Natürlich wusste er noch, wie sein Chef, der Lehrstuhlinhaber Professor Bohming mit dem Spitznamen »der Sagenhafte«, so getan hatte, als hätte eigentlich er die Habilitationsschrift verfasst oder als wäre sie wenigstens nie so gut geworden ohne seine Betreuung. Das war vor wenigen Wochen im Senatssitzungssaal im Hauptgebäude der Universität gewesen. Eine großartige Arbeit habe Stachelmann vorgelegt. Das sagte nicht nur Bohming, dessen Betreuung sich darin erschöpft hatte, Stachelmann immer wieder an den Abgabetermin zu erinnern. Andere munkelten von der Karriere, die Stachelmann unweigerlich bevorstehe. Nachdem der so lange habe bangen müssen um seine Vertragsverlängerung, würde es nun in Rekordzeit klappen. Keine Fragen, keine Einwände.
Am meisten bewegt hatte ihn Annes Lob. Er habe nicht nur eine gute Arbeit geschrieben, sondern gezeigt, dass auch ein Wissenschaftler nicht gleichgültig sein müsse gegenüber menschlicher Not, ohne dabei seinen Anspruch aufzugeben. Besonders die Darstellung des Falls Rohrschmidt habe sie gerührt. Das war ein Kölner Historiker, den die Gestapo im Herbst 1937 ins KZ Buchenwald verschleppte und der dort im Steinbruch zu Tode gequält wurde. Stachelmann hatte ihm eine lange Passage gewidmet, nachdem er bei Recherchen eher zufällig auf dieses Verbrechen gestoßen war. Ein Verbrechen unter Millionen und doch besonders bewegend, wohl weil es sich um einen Kollegen handelte.
So gut die Prüfung gelaufen war, nun musste er auf eine Berufung hoffen. Noch war er nicht Professor oder auch nur Privatdozent. Die Urkunde konnte er erst in ein paar Wochen abholen, die Bürokratie ließ sich Zeit. Und dann war er in Wahrheit nichts Halbes und nichts Ganzes. Seine Qualifikation für eine Professorenstelle hatte er nachgewiesen, auch wenn es eine Quälerei gewesen war. Aber ob er eine solche Position je einnehmen würde, das hing allein an der Berufung. Also an dem, worauf ein paar hundert Historiker-Privatdozenten schon seit langem vergeblich hofften. Stachelmann hatte sich nur in eine andere Warteschlange eingereiht.
»Du hast recht. Es wird nie wieder einer auf mich schießen. Ernsthaft verletzt wurde ich auch nicht, also kann ich jetzt Seminararbeiten lesen.« Er gähnte. Es gab nichts Langweiligeres als Seminararbeiten, in denen lustlose Studenten schrieben, was sie begriffen zu haben glaubten oder vortäuschten. Meistens war es irgendwo abgekupfert, aus dem Internet kopiert, oder es war ein aus Büchern zusammengeklaubtes Sammelsurium. Quellen guckte sich kaum ein Student an. Für ein späteres Dasein als Lehrer mochte es reichen. Aber Historiker würde kaum einer werden aus seinem Seminar. Da fiel es ihm schwer, Freude an seiner Lehrtätigkeit zu finden. Er stand auf und ging ins Schlafzimmer. Dort stand sein Laptop. Er schob Annes Notebook zur Seite, stellte seinen Computer auf und startete ihn, dann rief er seine Mails ab. Eine Mail fiel ihm gleich auf. In der Betreffzeile stand: Stachelmann muss weg. Er erschrak, dann glaubte er es nicht. Aber es stand da. Er öffnete die Mail. Sie enthielt nur eine Zeile: Siehe de.sci.geschichte – Stachelmann-thread. Er starrte die Zeile an. Was hieß das? Er begriff es nicht. Was heißt thread? Faden, dafür reichte sein Englisch. Der Stachelmann-Faden, was sollte das sein?
Er hatte nicht gemerkt, dass sie ins Zimmer gekommen war. Sie legte eine Hand auf seine Schulter. »Geht's vor an?« »Lies das. Was heißt das?«
Anne las und überlegte einen Augenblick. »Im Internet gibt es Diskussionsgruppen, das so genannte Usenet, die Abkürzung für user network. Die Diskussionsgruppe de.sci. geschichte kenne ich, die besuche ich oft, manchmal diskutiere ich sogar mit. Unter falschem Namen, wie ich zugeben muss. Es handelt sich um ein deutschsprachiges Forum über Geschichte. Das klingt toll, aber die Freude wird einem vergällt, wenn man mitkriegt, dass die Revisionisten, also Nazis und Halbnazis, wenigstens die Hälfte der Beiträge posten, wie das im Jargon heißt, also in die Gruppe schicken. Es gibt natürlich auch die anderen Fraktionen bis hin zu Stalinisten. Ein thread ist nichts anderes als ein Diskussionsfaden, Beiträge, die sich aufeinander beziehen. Da hat also jemand etwas über dich geschrieben. Das heißt erst mal gar nichts. Allerdings, Stachelmann muss weg, das klingt eher unfreundlich.«
»Ich bewundere deinen Humor. Und wie erfahre ich, was in dieser Gruppe über mich steht?«
»Lass mich machen.« Sie zog an seinem Kragen. Er erhob sich und trat hinter den Stuhl, nachdem sie sich daraufgesetzt hatte. Sie klickte in abenteuerlicher Geschwindigkeit in Menüs und Fenstern des Mailprogramms. »Das kann man auch benutzen, um im Usenet mitzumischen.« In der linken Leiste stand nun unter den Mailordnern der Eintrag News-Konto. Sie klickte darauf, im Hauptfenster des Programms stand oben Newsgruppen abonnieren. Ein weiterer Klick öffnete ein Fenster, in dessen Eingabezeile sie als Suchbegriff Geschichte eintrug. Es dauerte nur wenige Sekunden, bis das Programm die Gruppe zeigte. »Da ist sie schon. Jetzt abonnieren wir die auch auf deinem Computer.« Sie klickte so schnell, dass er nicht mitkam. Er hatte vergessen, wie gut sie klarkam mit dem Internet. »So, das war's. Da ist auch schon der thread. Wobei das eine Übertreibung ist. Es ist nur ein einziger Beitrag, er stammt von vorgestern.« Sie klickte, um die Nachricht zu öffnen. Dann sagte sie: »Um Himmels willen! Das ist ein Verrückter. Kein Wunder, dass ihm niemand antwortet.«
Schweigend lasen sie die wenigen Zeilen, die ein Absender verfasst hatte, der sich hinter dem Kürzel E.T. verbarg:
Dr. Josef Maria Stachelmann nennt sich Historiker. Er ist aber ein Lügner. Seine Habilitationsschrift soll im Mai beim Schmid Verlag erscheinen. Darin verleumdet er die Opfer des Faschismus, vor allem die Häftlinge des KZ Buchenwald. Alle wirklichen Antifaschisten müssen zusammen dafür kämpfen, dass Stachelmanns Lügen nie erscheinen.
»Dass Stachelmanns Lügen nie erscheinen«, las er noch einmal, diesmal laut. »Glaubst du jetzt auch, dass dieser schießwütige Irre mich meinte?«
[Menü]
2
Taut schüttelte den Kopf. Er thronte hinter dem Schreibtisch, sein Bauch hing über der Tischplatte. Er schüttelte noch einmal den Kopf. »Das ist verrückt«, sagte er. »Völlig verrückt.« Und er schüttelte ein drittes Mal den Kopf.
Auf seinem Schreibtisch lag der Ausdruck, den Stachelmann mitgebracht hatte.
»Gestern haben Sie das im Internet gefunden?«
»Jemand hat mir eine Mail geschickt mit dem Verweis auf diese Diskussionsgruppe, und in dieser Gruppe fand ich diesen Text.« Stachelmann deutete auf das Papier. »Der Absender nennt sich E.T., wie der Außerirdische in diesem Kinofilm.«
»Und Sie meinen, der Irre mit dem Gewehr habe Sie gemeint und habe auch dieses Pamphlet verfasst oder Ihnen wenigstens die Mail geschickt?«
Stachelmann zuckte die Achseln. »Alles andere kommt mir unwahrscheinlich vor. Sind Sie schon dran an dem Kerl?«
»Noch nicht so richtig«, sagte Taut. »Aber wir wissen einiges über ihn. Er hat offenbar mit einem Gewehr vom Typ G3 geschossen, wie es bei der Bundeswehr verwendet wird. Sagt jedenfalls die Kriminaltechnik. Es handelt sich womöglich um eine Version mit Zielfernrohr, ohne das kann man mit diesem Gewehr jenseits von dreihundert Metern angeblich nicht mehr viel treffen außer Elefanten. Aber im Von-Melle-Park waren es vom Dach bis zu Ihren Standorten nicht viel mehr als hundert Meter. Für einen geübten Schützen ein Kinderspiel.«
»Und woher kriegt man so ein Gewehr und die Munition?«
»Keine Ahnung«, sagte Taut. »Von den Dingern gibt es Millionen. Und erinnern Sie sich noch an den Überfall auf das Waffenlager vor zig Jahren? Außerdem wurden die Dinger in aller Herren Länder exportiert. Wenn Sie Fernsehnachrichten aus Bürgerkriegsgebieten sehen, schauen Sie mal genau hin. Ohne das G3 gibt's kaum ein Massaker. G3 oder Kalaschnikow. Der Export solcher Waffen richtet mehr Schaden an als der von Panzern oder Kriegsschiffen. Leider kapiert das keiner. Was für ein Absender steht auf der Mail? Warum haben Sie die nicht auch mitgebracht?«
Er hatte sie vergessen. »Der Absender ist nicht herauszufinden. Meine Freundin sagt, es gebe Programme zur Anonymisierung von E-Mails, überhaupt um eigene Spuren im Internet zu verwischen.«
»Toll«, sagte Taut. »Alle drängen sich danach, der Polizei die Arbeit zu erleichtern. Ich erwarte stündlich, dass das BKA den Fall an sich zieht, natürlich nur, um den unterbelichteten Kollegen in Hamburg unter die Arme zu greifen. Dann fehlen noch der Staatsschutz und das Sammelsurium sämtlicher Geheimdienste, der BND wegen Waffenschmuggels, der MAD wegen der Benutzung einer Kriegswaffe, der Verfassungsschutz wegen eines möglichen Anschlags auf die FD GO. Die werden sich um diese Mail reißen. Aber solange ich noch ermitteln darf, möchte ich diesen Schrieb haben. Sie können ihn ja an den Kollegen Kurz weiterleiten, der kennt sich mit so was aus.« Taut kramte im Schreibtischschubfach und schob Stachelmann einen Zettel hin. »An diese Mailadresse.«
Stachelmann faltete das Blatt und steckte es in die Innentasche seines Jacketts.
»Schildern Sie doch noch einmal den Verlauf, so genau, wie Sie sich erinnern können.«
Stachelmann berichtete, was geschehen war. Er sagte aber nichts über seine Angst und dass er am Abend mit Anne ausgegangen war, was er schon auf der Schwelle der Haustür bereut hatte. Aber er hatte durchgehalten, wenn es auch seltsam ausgesehen haben mochte, wie er zum Restaurant eilte, Anne fast hinter sich herzog, sich immer wieder umschaute, ob da nicht jemand war, wie er mit den Augen die Hausfenster absuchte, ob etwas blitzte, der Stahl eines Gewehrs.
Er hatte den Eindruck, dass seine Aussage der Polizei nicht helfen würde. Er hatte kaum etwas gesehen, nur die Frau in der Cafeteria und die Studenten, die am Eingang des Philosophenturms auf dem Boden lagen. »Er hat viermal auf mich geschossen.« Wie oft hatte er das schon gesagt?
»Ja«, sagte Taut. »Er fühlte sich vielleicht herausgefordert, weil er Sie beim ersten Mal nicht getroffen hatte und Sie sich in Deckung bringen wollten. Da konnte er seine Macht nicht mehr ausleben. Man muss sich das vorstellen« – er schloss die Augen –, »was manche Leute fühlen, wenn sie eine Waffe in der Hand halten. Herr über Leben und Tod.« Er öffnete die Augen wieder. »Sie haben Angst, dass es sich wiederholt?«
Stachelmann nickte.
»Und Ihnen ist dazu immer noch nichts und niemand eingefallen?«
»Nein«, sagte Stachelmann. »Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung. Aber Angst.« Das Letztere war ihm herausgerutscht.
Taut schaute kurz auf von der Tischplatte, sagte aber nichts.
»Ich frage mich, wie dieser E.T. an meine Habilitationsschrift kommt.«
»Und wie?«, fragte Taut. Er kannte die Bräuche an Universitäten nicht.
»Die ist noch nicht veröffentlicht. Es gibt ein paar Kopien für die Prüfer, vielleicht haben es welche von denen noch anderen zu lesen gegeben. Und die Leute im Verlag kennen das Manuskript.«
»Das heißt, der Kreis derjenigen, die Ihre Arbeit gelesen haben können, ist überschaubar.«
»Ja.«
»Machen Sie mir eine Liste. Gleich jetzt und hier.« Er schob Stachelmann einen Schreibblock und einen Kugelschreiber über die Tischplatte.
Stachelmann schrieb die Namen der Prüfer auf, dann setzte er den Schmid Verlag auf die Liste. »Glauben Sie ernsthaft, einer der Prüfer oder Herr Schmid zetteln eine Internetkampagne gegen mich an? Oder legen sich aufs Dach der WiSo-Fakultät und ballern mit so einem G3 herum?«
»Eher nicht. Aber irgendwo müssen wir doch anfangen.«
»Natürlich.« Stachelmann erhob sich.
»Machen Sie eine Therapie«, sagte Taut.
»Mal sehen.«
Stachelmann gab Taut die Hand und verließ den Raum. Als er die Straße betrat, knallte es. Er zuckte zusammen, fast hätte er sich auf den Bürgersteig geworfen. Es knallte wieder, und er entdeckte einen alten Benz, dessen Auspuff qualmte. Beim dritten Knall erschrak er nicht mehr. Aber er war froh, als das Taxi kam, das der Pförtner für ihn bestellt hatte.
Zurück bei Anne, berichtete er knapp von seinem Gespräch mit Taut und setzte sich ans Notebook. Felix spielte im Wohnzimmer. Anne stellte sich hinter ihn, als Stachelmann die Diskussionsgruppe Geschichte öffnete. Ein Pluszeichen vor dem Eingangsbeitrag im Stachelmann-thread zeigte an, dass jemand geantwortet hatte. Dieser Jemand nannte sich Günther Weigand, und er schrieb:
Hier postet man unter Klarnamen. Denunziationen sind feige. Also: Klarnamen nennen oder Maul halten.
»Stimmt, im Usenet ist es verpönt, unter falschem Namen zu posten«, sagte Anne. »Aber ein schlechtes Gewissen habe ich deswegen nicht.«
»Was ist das nur für ein Jargon!«, sagte Stachelmann. »Kriegt man raus, wer dieser E.T. ist?«
»Bestimmt nicht. Das hat der irgendwo in einem Internetcafé geschrieben oder wo heutzutage überall Computer mit Netzanschluss herumstehen.«
»Woher weißt du das alles?«
»Du kennst nur meine wenigen Schwächen.« Sie grinste. »Aber die sind eigentlich auch nur verkannte Stärken.«
»Schön, dass es wenigstens einer hier nicht an Selbstbewusstsein mangelt. Wir werden in den nächsten Tagen beobachten, ob E.T. den Mumm hat, sich vorzustellen. Aber was, verdammt, meint der Kerl? In keiner Zeile meiner Arbeit tue ich irgendeinem KZ-Opfer etwas an. Oder hast du was anderes gelesen? Und, überhaupt, meine Arbeit ist noch gar nicht veröffentlicht. Woher kennt er sie?«
»Das ist komisch. Wer weiß, wer sie alles kopiert und weitergegeben hat. Aber vielleicht hat dieser Bekloppte auch nur irgendwas gehört und es in den falschen Hals bekommen.«
»Wenn E.T. auf mich geschossen hat, weil ihm meine Habilschrift nicht gefällt, dann muss ich damit rechnen, dass er es wieder versucht.«
Er stand auf und ging zum Fenster. Schneeflocken wirbelten die Straße entlang. Der Winter war mild gewesen in diesem Jahr, aber er wollte nicht aufhören. Unten eilte eine Frau mit einer Einkaufstasche vorbei. Ob E.T. sich hier herumtrieb? Wenn er seine Arbeit kannte, die noch nicht veröffentlicht war, wusste er vielleicht auch, dass Stachelmann zurzeit meistens bei Anne wohnte. Er wollte zeigen, dass er zusammen mit ihr und Felix leben konnte, nachdem er letzten Sommer eine Krise verursacht hatte, weil er nicht mit in den Urlaub gefahren war, sondern nach Heidelberg. Da wäre ihre Liebe fast gescheitert. Aber in den letzten Wochen ging es besser, er glaubte auch, sich an Felix gewöhnen zu können, zumal der nicht mehr so viel schrie.
Dann trat er schnell vom Fenster zurück, zog den Vorhang zu und linste durch einen seitlichen Spalt hinaus. »Da war etwas, in dem Haus gegenüber.«
»Wo der Gemüseladen ist?«
»Ja. Ich habe es deutlich gesehen.«
Anne stellte sich neben ihn, zog die Vorhänge auf. Er spürte, wie die Angst ihn lähmte. »Pass auf!«, sagte er leise, als dürfte es niemand hören außer Anne.
»Du meinst im dritten Stock«, sagte Anne.
»Ja.«
»Da ist jemand mit einem Staubsauger zugange. Sonst sehe ich nichts.«
Stachelmann zögerte, dann sagte er: »Sicher?«
»Ja.«
»Hm.«
»Es ist normal, dass du jetzt überall diesen Irren vermutest. Versuch zu arbeiten. Vielleicht solltest du tatsächlich eine Therapie machen, Verfolgungswahn ist bestimmt heilbar.«
Da packte ihn der Zorn. »Du glaubst mir nicht. Du hast vergessen, dass mich schon mehrfach Leute bedroht haben. Einmal wurde ich auf die U-Bahn-Gleise gestoßen, dann sollte ich im Krankenhaus ermordet werden, dann ist dieser Wahnsinnige in meine Wohnung eingebrochen, um CDs aufzulegen, damit ich auch wirklich merkte, dass er eingebrochen ist. Nicht zu vergessen, erinnerst du dich nicht mehr an die Leiche, die diese Leute mir in den Kofferraum gelegt haben? Und dann sollte ich sogar vergiftet werden! Alles schon vergessen?«
Sie schaute ihn traurig an, drehte sich weg und ging hinaus.
»Und dann einfach das Gespräch abbrechen, wenn es anders läuft als erwünscht. Toll!«, rief er ihr hinterher.
Er bereute gleich seinen Ausbruch, aber entschuldigen wollte er sich nicht. Er packte den Laptop in seine Aktentasche und verließ die Wohnung. Erst wollte er die Tür zuknallen, dann aber drückte er sie leise ins Schloss. Er lief auf der Grindelallee zur Bahn, um den Von-Melle-Park zu umgehen. Obwohl das der sicherste Ort der Welt war; der Schütze würde dort kein zweites Mal zu schießen wagen, zumindest jetzt nicht, wo es an der Uni von Polizei wimmelte. Würde Stachelmann den Von-Melle-Park und den Philosophenturm jemals wieder betreten können? Ich muss hier weg, dachte er. Nichts wie weg. Du wirst verrückt, wenn du den Anschlag nicht verdrängen kannst. Aber wie soll man ihn verdrängen, wenn man fast jeden Werktag dort ist, wo geschossen wurde? So würde er die Bilder nicht aus dem Kopf treiben können. Du musst weg.
Stachelmann schwitzte, er war schnell gelaufen, die Angst machte ihm Beine. Im Dammtorbahnhof hechelte er, der Schweiß nässte das Hemd, die Haare klebten an der Kopfhaut. In der S-Bahn setzte er sich ans Wagenende, um alles überblicken zu können. Im Hauptbahnhof rannte er zum Gleis 7b, der Zug nach Lübeck wartete schon. Er betrat das Großraumabteil der ersten Klasse, hängte den Mantel an einen Haken der Garderobe, schnaufte und setzte sich an den Tisch. Drei Männer waren ins Gespräch vertieft, Stachelmann kannte ihre Gesichter von vielen Bahnfahrten zwischen Hamburg und Lübeck. Wäre er allein gewesen, hätte er mehr Angst gehabt. Er lehnte sich zurück, schloss die Augen und mühte sich zu begreifen, was geschehen war. Sein Leben hatte sich geändert binnen kürzester Zeit. Er würde es nicht mehr aushalten in Hamburg. Er war endlich so gut wie habilitiert und konnte sich an einer anderen Universität bewerben. Vielleicht in Heidelberg? Nein, da hatte er zu viel Unerfreuliches erlebt. Irgendwo hatte er gehört, man solle nicht zurückkehren zu früheren Lebensstationen. Berlin? Ja, warum eigentlich nicht Berlin? Aber dann schalt er sich einen Spinner. Du kannst froh sein, wenn du überhaupt eine Stelle bekommst. Die Wahrscheinlichkeit, einen Lehrstuhl zu ergattern, lag bestenfalls bei eins zu tausend.
Die Türen knallten zu, es ruckelte, der Zug schlich aus dem Hauptbahnhof. Kaum hatte er die Halle verlassen, tanzten Schneeflocken im Fahrtwind. Er schaute hinaus auf die S-Bahnhöfe, die der Zug passierte. Am frühen Nachmittag war es grau, der Schnee verwandelte sich in Matsch. Auch die Menschen erschienen ihm grau.
In Lübeck stieg er aus. Er eilte die provisorische Stahltreppe am Bahnsteig hinauf in die ebenso provisorische Bahnhofshalle. Oben drehte er sich um und betrachtete die Menschen, die ihm folgten. Niemand beachtete ihn, und keiner fiel ihm auf. Aber wenn der Irre seine Adresse kannte und schon am Haus wartete? Sein erster Impuls war, in den Zug zu steigen und nach Hamburg zurückzufahren. Vielleicht konnte er bei seiner Mutter in Reinbek übernachten. Aber damit würde er sie in Gefahr bringen. Sie war noch schwach von den Krebsoperationen, und manchmal fürchtete er, sie würde sich nicht mehr erholen. Er entschloss sich, doch nach Hause zu gehen. Die Gefahr dort war nicht größer als anderswo, wo er zudem andere Menschen gefährdete. Er hetzte über die Puppenbrücke, Möwen schwammen auf der Stadttrave, immer wieder blieb er stehen und schaute sich um. Aber wodurch könnte ein Mörder sich verraten, wodurch könnte Stachelmann ihn erkennen? Die Angst wuchs, je näher er dem Haus in der Lichten Querstraße kam, in dem seine Wohnung lag. Fast schlich er sich ein Stück an, dann rannte er los, aber vor dem Haus fiel ihm der Schlüsselbund auf den Bürgersteig, ausgerechnet in eine Pfütze. Die Hand zitterte, jetzt wäre der Augenblick gekommen, wo der andere ihn abschießen konnte wie ein Karnickel. Stachelmann hob den Schlüsselbund auf, er war nass geworden, und schüttelte ihn. Diesmal schaffte er es, den Schlüssel ins Schloss zu stecken. Er drehte ihn um, trat in den Flur, drückte die Haustür zu, schloss ab und nahm zwei Treppenstufen mit einem Schritt. Erst als er in seiner Wohnung auf dem Sofa saß, fühlte er sich besser.
Er durchdachte wieder und wieder, was geschehen war. Er hörte wieder den Aufschlag der Geschosse auf dem Pflaster. Warum hat er dich verfehlt?
Da fiel ihm ein, er musste die Mail an den Kommissar Kurz weiterleiten. Er packte den Laptop aus und wartete, bis er gebootet hatte. Dann kramte er in der Jacketttasche nach dem Zettel, den Taut ihm gegeben hatte. Als er ihn endlich gefunden hatte, sandte er die geheimnisvolle Mail an den Kripomann. Der würde damit nichts anfangen können. Stachelmann ging in die Diskussionsgruppe, es waren zwei neue Diskussionsbeiträge aufgetaucht. Ein Leo Müller, wenn er denn so hieß, beschwerte sich:
Nach den Trolls, die hier die Luft verpesten, kommen die Spinner. Wer ist denn dieser Stachelmann? Um was für einen Text geht es? Und was ist daran so schrecklich? Vielleicht erklärt einem das mal einer in einem Deutsch, das auch ich kapiere.
Und dann ein Beitrag – Stachelmanns Hände begannen zu zittern – von E.T.:
Was soll das Gemecker? Wehret den Anfängen! Dieser Stachelmann ist Historiker an der Uni Hamburg, er hat eine Habilitationsschrift verfasst, in der die im KZ Buchenwald gequälten Antifaschisten verhöhnt werden. Reicht das nicht als Grund? Die Arbeit darf nirgendwo erscheinen. Wer das erst mal lesen will, fordert doch, dass die Sudelschrift veröffentlicht wird. Aber damitauch die Holzköpfe es kapieren, werde ich morgen ein paar Zitate liefern. Und wenn es dann noch nicht klar ist, gute Nacht.
Ach ja, ich heiße E.T. Den Namen habe ich mir in eigener Souveränität gegeben. Dem Staat spreche ich nicht nur das Gewaltmonopol ab, sondern auch das Recht, über meinen Namen zu bestimmen. Mal was von Konsequenz gehört?
Übrigens, der Philosophenturm an der Hamburger Uni ist echt interessant. Wer's nicht glaubt, sollte ihn sich mal angucken.
Wer war E.T.? Stachelmann überlegte, wer seine Arbeit kennen konnte. Aber er hatte schon alle Möglichkeiten bedacht, neue fielen ihm nicht ein. War E.T. der Schütze? Er las noch mal dessen Beitrag, das klang verrückt, aber irgendwie las es sich nicht wie die Erklärung eines Killers.
Das Telefon klingelte. Er nahm das Mobilteil ans Ohr.
»Stachelmann.«
»Bild Hamburg. Auf Sie wurde geschossen?« Eine schnarrende Männerstimme.
Stachelmann legte auf. Gleich klingelte es wieder.
»Wenn Sie Wert auf eine wahrheitsgemäße Berichterstattung legen, sollten Sie mit mir reden«, schnarrte es.
»Wollen Sie mich erpressen? Wenn ich nicht mit Ihnen rede, lügen Sie. Tun Sie das nicht sowieso?«
»Was denken Sie, wer hat warum auf Sie geschossen?«
Stachelmann legte auf. Es klingelte.
»Wir geben Ihnen die Chance, Ihre Sicht der Dinge darzulegen«, schnarrte es aus dem Hörer. »Aber wenn Sie nicht wollen ...«
Stachelmann legte auf, dann zog er den Telefonstecker aus der Wandbuchse.
Es klingelte an der Haustür. »Verdammt!«, schimpfte Stachelmann vor sich hin, während er in den Flur ging und in die Gegensprechanlage nur »Ja?« sagte.
»Die Polizei, bitte öffnen Sie.«
Stachelmann drückte auf den Türöffner und bereute es sofort. War es wirklich die Polizei? Er starrte durch den Türspion, tatsächlich erschienen zwei Männer in Polizeiuniform.
»Halten Sie Ihren Dienstausweis vor den Spion!«, rief Stachelmann durch die Tür. Die Angst nässte ihm den Körper. Er beobachtete durch den Spion, wie ein Beamter seinen Ausweis aus der Brusttasche der Lederjacke nestelte und ihn so hielt, dass Stachelmann ihn sehen konnte. Er zögerte, schließlich konnte er den Ausweis in der Weitwinkeloptik nicht lesen, dann öffnete er die Tür. Die Polizisten betraten den Flur. Stachelmann bildete sich ein, die beiden schon einmal gesehen zu haben.
»Wir haben den Auftrag, ein wenig auf Sie aufzupassen. Wundern Sie sich also nicht, wenn ein Dienstfahrzeug vor der Tür steht«, sagte der eine Polizist, dick und groß, aber mit erstaunlich heller Stimme.
»Wer hat Sie beauftragt?«
»Die Hamburger Kollegen. Genaueres weiß ich nicht. Nur, dass ein Irrer auf Sie geschossen hat und es vielleicht wiederholt.«
»Danke«, sagte Stachelmann.
Die beiden zogen ab, und Stachelmann schloss die Tür. Er kehrte zurück ins Wohnzimmer und setzte sich wieder aufs Sofa. Dass er nun bewacht wurde, beruhigte ihn nicht. Im Gegenteil, es unterstrich, wie ernst seine Lage war. Schon wieder. Es war gerade ein paar Monate her, dass er sich mit Verbrechen und Verbrechern herumschlagen hatte müssen, nun ging es wieder los. Warum konnte er nicht endlich in Ruhe arbeiten? Er hatte genug zu tun. Jetzt musste er sehen, dass er sich bewarb, sofern Bohming nicht doch sein Versprechen wahr machte, ihn demnächst als Nachfolger einzusetzen. Auf einem kleinen Umweg über eine andere Uni, wie der Ordinarius gesagt hatte. Weil Hausberufungen nicht möglich waren. Wahrscheinlich hatte Bohming so getönt, weil er glaubte, Stachelmann werde nie fertig mit seiner Habilitation. Jedenfalls hatte der Sagenhafte in letzter Zeit kein Wort mehr darüber verloren. Aber das Manöver musste jetzt eingeleitet werden, sonst war Stachelmann über kurz oder lang arbeitslos. Arbeitslose Privatdozenten und Professoren gab es genug. Sie würden ihm den Vertrag noch einmal verlängern, gewiss. Und dann? Aber im Augenblick wollte er nicht einmal das, er wollte einfach nur weg.
Er hatte nur Ärger und Sorgen. Lohnte sich ein solches Leben? Lohnte es sich? Er dachte an Ossi, seinen Freund bei der Kriminalpolizei, der tot war. Der hatte es hinter sich. Aber die Trübnis lenkte ihn nur kurz ab von der Angst.
In der Nacht schlief er kaum. Was meinte E.T., als er schrieb, man solle sich den Philosophenturm anschauen? Stachelmann war ungeduldig. Welchen Anschlag plante dieser Irre jetzt? Würde er wieder herumballern? Gegen vier Uhr am Morgen kam ihm eine Idee. Er würde E.T. antworten in dieser Diskussionsgruppe, er würde ihn stellen. Aber dann fiel ihm ein, dass der Zitate aus seiner Arbeit veröffentlichen wollte. So lange musste Stachelmann warten, denn wenn es wirklich Zitate waren, dann konnte er darauf eingehen. Musste er vorher die Polizei fragen? Er schüttelte den Kopf auf dem Kissen. Nein, das war seine Sache. Aber wenn er E.T. dadurch reizte, brachte sich Stachelmann dann nicht noch mehr in Gefahr? So gut war die Idee doch nicht. Nein, er würde weiter warten und schauen, was geschah. Vielleicht würde sich demnächst eine Gelegenheit ergeben, etwas zu tun. Er fiel in einen unruhigen Schlaf.
Die Gelenke waren steifer als sonst, als er aufwachte. Er stützte sich aufs Bett beim Aufstehen. Er beugte und streckte Arme und Beine, bis er sich beweglicher fühlte. Da fiel ihm der Anrufer von der Bild-Zeitung ein. Was würde sie schreiben in großen Lettern? Im Bademantel ging er die Treppe hinunter zum Briefkasten und überflog die Lübecker Nachrichten, während er die Treppe hochstieg. Auf der Titelseite ein Bericht über die »Schießerei an der Hamburger Universität«. Die Schlagzeile ärgerte ihn, es klang so, als hätten Leute aufeinander geschossen. Dabei hatte ein Irrer sich den Von-Melle-Park als Menschenjagdrevier ausgesucht. Stachelmann setzte sich an den Küchentisch und las den Artikel konzentriert. Etwa in der Mitte wurde angedeutet, dass die Schüsse möglicherweise einer Lehrkraft des Historischen Seminars gegolten hatten. Die Polizei verfolge aber auch andere Spuren. Sie halte es für wahrscheinlich, dass der Täter ein ehemaliger Bundeswehrsoldat sei. Stachelmann musste grinsen. Wie viele Millionen Männer hatten das G3 in der Grundausbildung bei der Bundeswehr bedienen gelernt? Und wie viele Leute im Ausland hatten Unheil angerichtet mit diesem Gewehr? Da konnte die Polizei ewig ermitteln. Aber für so dumm hielt er Taut und seine Kollegen nicht. Sie hatten der Presse ein bisschen Futter gegeben.
Er legte die Zeitung beiseite und überlegte zum x-ten Mal, was hinter den Schüssen stecken mochte. Aber alles, was ihm einfiel, roch zu stark nach Kino oder einem dieser Politkrimis, die jetzt so in Mode waren. Dass er unabsichtlich ein Nazi-Netzwerk in Panik versetzt hatte und diese Leute sich nun als Antifaschisten tarnten, um ihn auszuschalten. Dass dem Sohn oder Enkel eines KZ-Häftlings irgendeine Aussage in seiner Arbeit nicht passte, weil er glaubte, die Ehre des Vaters oder Großvaters werde befleckt. Dass dieser E.T. einfach ein durchgeknallter Wichtigtuer war, der auf Stachelmann eifersüchtig war, weil der es geschafft hatte. So was gab es nur in Filmen. Doch hatten Filme etwa keinen Einfluss auf die Wirklichkeit? Er erinnerte sich an Bilder aus dem jugoslawischen Bürgerkrieg, auf denen er Soldaten entdeckt hatte, die sich zurechtgemacht hatten wie Rambo oder andere Vorbilder aus Kriegsfilmen. Sie wollten so sein wie ihre Filmhelden. Und wenn der Schütze vom Von-Melle-Park auch einem Vorbild folgte? Ja, vielleicht war es wie im Kino, wie in einem schlechten Film. Wer kannte solche Filme? Stachelmann überlegte, aber ihm fiel niemand ein, der ihm weiterhelfen konnte. Er schaute sich Kriegsfilme nicht an, weder die seriösen noch die unseriösen.
E.T.s Ankündigung fiel ihm wieder ein. Wer könne, solle sich den Philosophenturm angucken. Was bedeutete es? Stachelmann griff zum Telefon, aber dann schaute er auf die Uhr. Viel zu früh, um dort anzurufen. Er schlug sich an den Kopf. Warum hatte er die Polizei nicht informiert, dass E.T. etwas plante am Philosophenturm? Weil dieser Bild-Zeitungs-Typ ihn abgelenkt hatte. Aber das ist nicht die ganze Wahrheit. Wahr ist, dass du durcheinander bist, nicht weißt, was du tust. Der Grund dafür ist die Angst. Sie lässt dich Fehler machen, welche die Angst nur weiter verstärken. Wenn jemand dich zugrunde richtet, dann du selbst. Auch wenn sich in dir alles dagegen wehrt, diesen Irrsinn anzunehmen, du musst akzeptieren, dass die Dinge so sind. Dass einer hinter dir her ist. Wieder. Dass der Grund dafür deine Habilschrift ist. Da wehrte sich sein Verstand. Der Grund ist, dass der Typ verrückt ist. Dass er etwas in deiner Arbeit vielleicht so versteht, wie er es verstehen will. Du kannst lange nach Stellen suchen, die in Frage kämen, es würde nichts nutzen. Weil du nicht weißt, wie der Kerl das liest und versteht. Es gibt keine Eindeutigkeit, nicht einmal in deinem Text, der Leser nimmt nicht nur auf, das Lesen selbst prägt das Verständnis. Genauso wichtig wie dein Text ist das Vorverständnis des Lesers, dieses Lesers, der ein potenzieller Killer ist. Man müsste in seinen Kopf schlüpfen, um ihm so auf die Spur zu kommen. Stachelmann lachte resignierend. Wenn man ihm in den Kopf schlüpft, hat man ihn schon, dann braucht man ihn nicht mehr zu suchen.
Er blätterte in der Zeitung, um die Zeit totzuschlagen. Das Hirn arbeitete weiter, vor allem die Angst. Sollte er heute nach Hamburg fahren? War es nicht zu gefährlich?
Er stand auf, ging ins Wohnzimmer, setzte sich an den Schreibtisch, schaltete den Laptop ein und rief die Geschichts-Diskussionsgruppe auf. Wieder ein neuer Eintrag. Ein Kyffhäuser zitierte einen Teil von E.T.s letztem Schreiben und kommentierte:
E.T. schrieb:
݆brigens, der Philosophenturm an der Hamburger Uni ist echt
interessant. Wer's nicht glaubt, sollte ihn sich mal angucken.‹
War da. Geil, echt geil! Und überall Bullen! Wie im Zoo!
Jetzt hielt er es nicht mehr aus, er musste zur Uni trotz seiner Angst. Eilig zog er sich an, steckte den Laptop in die Aktentasche und ging hinaus ins Schneetreiben. Flocken tanzten im Schein der Straßenlaternen und schmolzen, wenn sie auf dem Asphalt landeten. Das Wasser sammelte sich in Pfützen. Gedankenverloren tappte Stachelmann in eine Pfütze, bald drang die kalte Feuchtigkeit durch Schuh und Socke. Das Hosenbein war nassgespritzt, Schmutzflecken würden bleiben. Im Zug nestelte er in seinen Taschen, holte den Computer aus der Aktentasche und steckte ihn wieder hinein. Ihm gegenüber saß eine Frau mittleren Alters mit einer Wintermütze, die beobachtete, was er trieb. Er glaubte, sie belächelte ihn insgeheim. Nachdem er endlich am Dammtor aus der S-Bahn gestiegen war, rannte er fast zur Universität. Bald sah er Polizeiautos. Der Eingang zum Philosophenturm war abgesperrt mit einem weißroten Band. Innerhalb der Absperrung erkannte Stachelmann Leute der Mordkommission. Auch Taut war gekommen. Stachelmann ging zu einem Beamten, der die Absperrung vor einem Haufen von Neugierigen bewachte, und verlangte, mit Taut zu sprechen. Der Polizist ging zu Taut und zeigte auf Stachelmann. Taut winkte ihn heran. Stachelmann hob das Band und passierte die Absperrung. Jetzt sah er die Schmiererei am Philosophenturm. In Blutrot stand dort: Stachelmann raus! Nazis raus! Und dann noch ein riesiges Hitlergesicht, erkennbar an Schnurrbart und Stirnsträhne.
Stachelmann starrte auf das Graffito. Ihm schien es, als bildete er es sich ein. Das konnte da nicht stehen. Unmöglich. Stachelmann raus! Nazis raus!
»Was meinen Sie?«, fragte Taut.
Stachelmann zuckte die Achseln.
»Haben die Lübecker Kollegen sich bei Ihnen gemeldet?«
Stachelmann stutzte, dann fiel ihm der Polizeibesuch ein. »Ja.«
»Ich halte es für notwendig, Ihnen Schutz zu geben. Jetzt erst recht.« Er deutete auf die Inschrift. »Am liebsten wäre es mir, Sie blieben die kommende Zeit zu Hause. Wenn Sie unterwegs sind, ist es schwierig, auf Sie aufzupassen.«
Stachelmann antwortete nicht. Er wusste nicht, was er tun sollte. Dann fragte er: »Sie sind sicher, dass E.T. der schießwütige Irre ist oder etwas mit dem hier zu tun hat?«
»Nein, aber weil wir es nicht ausschließen können, dass da jemand Jagd auf Sie macht.«
Stachelmann lief es kalt den Rücken hinunter.
Taut schnäuzte sich. »Und ob es E.T. ist oder nicht, Sie sind in Gefahr.«
Sie sind in Gefahr, wiederholte Stachelmann in Gedanken. Er fühlte nichts, nicht einmal Angst. Als stünde er neben sich. Er schaute noch einmal auf das Graffito und fand es riesengroß. Ein Polizeifotograf blitzte immer wieder.
Stachelmann ließ Taut stehen und betrat den Philosophenturm. Im Aufzug betrachteten zwei Polizisten die Kritzeleien. Eine große Schrift, wie von einem Grundschüler, der sich mühte: Wir brauchen keine Revisionisten! Hau ab, Stachelmann!
Er nahm es zur Kenntnis ohne eine Regung. »Ich bin dieser Stachelmann. Wo noch?«, fragte er die Polizisten.
»Oben an der Wand, neben Ihrem Büro.«
Stachelmann las Mitleid und Neugier im Blick des jungen Polizisten, dessen Mütze und Jacke durchnässt waren.
Der Aufzug fuhr nach oben. Niemand sagte etwas. Stachelmann versuchte etwas zu fühlen, aber er war kalt und leer. Tatsächlich stand an der Wand neben der Tür seines Zimmers Hau ab!. Stachelmann schloss die Tür auf, ging hinein und suchte nach Spuren. Offenbar war niemand eingedrungen, immerhin.
Er wählte Annes Nummer und erzählte ihr, was geschehen war.
»Du kannst bei mir bleiben«, sagte sie fast tonlos.
»Nein, dann seid ihr auch in Gefahr. Das muss ich allein klären.«
»Du willst doch nicht schon wieder ...«
»Nein, ich will nicht Detektiv spielen. Das wollte ich noch nie.«
»Aha«, sagte Anne. Das mochte heißen, es ist nun also wie immer und es endet wie immer.
»Wenn E.T. gefunden ist, ist der Spuk vorbei.«
»Überlass es der Polizei.«
»Natürlich«, sagte Stachelmann. »Vielleicht kannst du herkommen, und wir schauen uns diesen so genannten thread in der Diskussionsgruppe noch einmal an.«
Schweigen. Dann sagte sie: »Gut, ich bring Felix unter, dann komme ich.«
Er war erleichtert. Dann fiel ihm ein, dass die Polizei den Philosophenturm abgesperrt hatte. Er trat hinaus in den Flur, entdeckte einen Polizisten und bat ihn, den Hauptkommissar Taut zu unterrichten, damit Frau Derling in den Philosophenturm hineingelassen würde. Der Beamte sprach in sein Handfunkgerät. Nach wenigen Sekunden erklang krächzend »In Ordnung« aus dem Lautsprecher.
Stachelmann setzte sich an seinen Schreibtisch und schaltete den PC ein. Er fand die Diskussionsgruppe. Ein neuer Eintrag, von einem Doppelwhopper.
Kann das in HH leider nicht sehen. Macht Fotos und zeigt die beim Treffen am Krema.
Er schaute diese Zeile lange an und überlegte, was das Krema sein könnte. Dann wusste er es. Ein Krematorium. Es gab also ein Treffen an einem Krematorium. Krematorien fand man auf Friedhöfen. Und in KZs. Er war ein Stück weiter. Wieder öffnete er die Tür seines Büros. Aber er sah keinen Polizisten mehr. Er fuhr wieder hinunter im Aufzug, überwand eine Angstattacke, als er ins Freie trat, und hetzte zu Taut, der in einer Gruppe von zivilen und uniformierten Polizisten stand. »Eine Nachricht!«, rief Stachelmann.
Taut schaute ihn fragend an, und Stachelmann erklärte, was er entdeckt hatte.
»Wo ist der Kollege Kurz?«, rief Taut.
»Hier!«, antwortete Kurz, der wenige Meter entfernt mit Leuten der Kriminaltechnik redete. Als Kurz herbeigeeilt war, schickte ihn Taut zu Stachelmanns Büro. »Da steht was im Computer«, sagte Taut. Und Stachelmann verstand, dass Taut PCs für Teufelszeug hielt.
Kurz und Stachelmann fuhren im Aufzug hoch. Kurz setzte sich an den PC, las und pfiff immer wieder leise.
»Da hat jemand einen Fehler gemacht«, sagte er. Er schaltete den Drucker ein und druckte den thread aus.
In das Geräusch des Druckers hinein sagte er: »Und wieder einer.«
Ein neues posting, diesmal von E.T. Der zitierte die letzte Bemerkung und schrieb:
Ich würde gleich die genaue Anschrift veröffentlichen, du Idiot. Die Bullen lesen mit. Ich sage dir, was sie durch deine Dummheit jetzt schon wissen:
1. Wir sind eine Gruppe.
2.Wir treffen uns regelmäßig.
3. Der Treffpunkt ist ein Krematorium.
4. Also ist der Treffpunkt auf einem Friedhof oder in einem KZ.
»Stimmt«, sagte Kurz, »das wissen wir immerhin. Aber jetzt werden die sich nicht mehr dort treffen.« »Und wenn das nur ein besonders raffiniertes Ablenkungsmanöver ist?«
Kurz warf Stachelmann einen Blick zu. Dann sagte er: »Möglich ist alles. Aber wahrscheinlich ist das nicht. Das sind ziemlich chaotische Diskussionen, öffentlich, jeder kann mitmachen, da lässt sich so ein Manöver schlecht organisieren.«
»Aber betrachten Sie einmal, wie schnell die Beiträge nacheinander gekommen sind. Da kann schon jemand dahinterstecken. Und wenn sich andere Leute in die Diskussion verirren, macht das nichts. Die Fremden können keine Informationen lancieren, die diese Gruppe betreffen. Ihre Teilnahme verwirrt nur andere Leser, die nicht auseinander halten können, wer zur Gruppe gehört und wer nicht.«
Kurz wiegte seinen Kopf. »Ausschließen kann man es nicht«, sagte er dann in einem Ton, der zeigte, dass er darüber nicht mehr sprechen wollte. Er nahm den Ausdruck, faltete ihn und steckte ihn in seine Manteltasche. »Tschüs!«
Stachelmann starrte auf den Bildschirm, als würde der ihm etwas verraten. Da entdeckte er einen weiteren Diskussionsbeitrag, wieder von Günther Weigand:
Nochmal, ihr Feiglinge. Klarname oder Maul halten.
Eines war gewiss, der gehörte nicht zur Gruppe. Und wahrscheinlich hieß er wirklich so.
Es klopfte, und Anne trat ein. »Nun, Meister, neue Erkenntnisse?« Sie wollte ihm helfen, indem sie witzelte. Oder sie wollte sich selbst helfen. Aber es hörte sich lau an.
Stachelmann schüttelte den Kopf und starrte weiter auf den Bildschirm. »Ich habe den Eindruck, die Polizei glaubt, diese postings« – er zog das Wort in die Länge, um zu zeigen, dass er es nicht mochte – »hätten nichts zu tun mit der Schießerei.«
»Sicher?«
»Nein. Aber du hättest diesen Kurz, einen von Tauts Leuten, sehen sollen. Das hat den nicht sonderlich interessiert.«
»Vielleicht hat er recht. Wer Leute umbringt, will sich verstecken und nicht weitere Spuren hinterlassen.«
»Mag sein. Aber erklär mir, warum die Dinge sich ereignen, als wären sie zeitlich genau aufeinander abgestimmt. Erst diese Diskussion, dann die Schüsse. Und die Schmierereien.«
»Hab ich gesehen«, sagte Anne. »In dieser Hinsicht liegst du wohl richtig. Drei Ereignisse, die mit dir zu tun haben, geschehen fast gleichzeitig. Ein Zufall ist das nicht. Vielleicht hat die Diskussionsgruppe den Schützen ermuntert, etwas zu tun. Vielleicht kennt er jemanden aus dieser Gruppe und hat sich anstecken lassen von deren Hass auf dich. Oder vielleicht ist E.T. der Schütze, gewissermaßen im Auftrag dieser seltsamen Gruppe, und die fabriziert nun die ideologische Begleitmusik.«
Stachelmann antwortete nicht. Die Gedanken kreisten in seinem Kopf. Er hielt dieses für wahrscheinlich, dann jenes, bald etwas ganz anderes, und das alles fast zur gleichen Zeit.
Sie saßen sich am Schreibtisch gegenüber und schwiegen. Er überlegte, warum ihm so etwas geschah. Andere Leute lebten vor sich hin, wurden nicht bedroht, gerieten nicht in Kriminalfälle, führten ein herrlich langweiliges Leben. Nichts ersehnte sich Stachelmann mehr als Langeweile. Er malte sich aus, wie es wäre, als C3-Professor Vorlesungen zu halten, sich in Seminaren von Studenten anöden zu lassen, denen gleichgültig war, was sie studierten. Warum war ihm das nicht vergönnt?
Er stand auf, schaute aus dem Fenster und sah unten nur noch wenige Polizisten. Er überlegte, ob er Taut anrufen sollte, um zu erfahren, was er herausgefunden hatte. Aber Taut war jetzt gewiss nicht ansprechbar.
Es klopfte an der Tür.
»Herein!«
Ein Polizeibeamter trat ein, hinter ihm ein zweiter.
»Herr Dr. Stachelmann?«
»Ja?«
»Wir passen ein bisschen auf Sie auf.« Der Beamte sprach so, wie man mit einem Kind spricht.
»Gut«, sagte Stachelmann. »Aber in diese Gegend wird der Irre sich nicht mehr trauen.«
Der Polizist nickte kaum merklich, antwortete aber nicht. Dann schloss er die Tür von außen.
»Gegen einen, der aus großer Entfernung schießt, hilft diese Bewachung nichts«, sagte Stachelmann.
»Und wenn du dir eine schusssichere Weste besorgst ...« »Und einen Helm.« Stachelmann lachte bitter. »Ich kann doch nicht gepanzert durch die Gegend laufen. So weit kriegt der mich nicht.«
»Trotz hilft auch nichts«, sagte Anne. Sie wollte das gesagt haben, obwohl sie wusste, dass Stachelmann stur sein konnte. Jetzt war er stur. Und vor allem zornig.
»So weit kriegt der mich nicht«, wiederholte Stachelmann.
»Willst du was essen?«