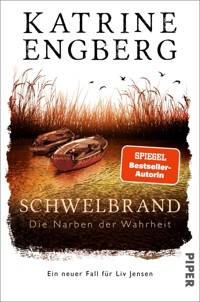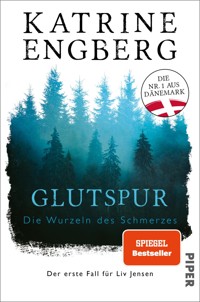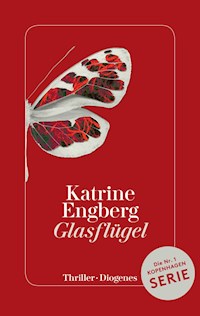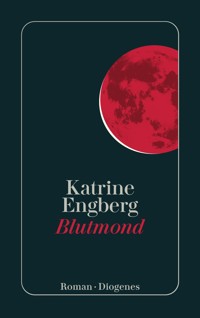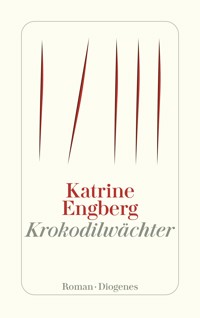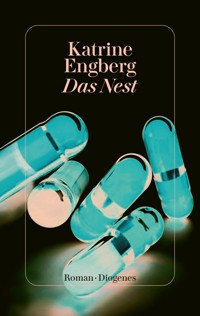
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kørner & Werner
- Sprache: Deutsch
Es ist ein sonniger Tag im April, als der 15-jährige Oscar verschwindet. Von zu Hause abgehauen, denken alle. Doch als die Leiche eines jungen Mannes in einer Müllverbrennungsanlage entdeckt wird, zeichnet sich Schlimmeres ab. Anette Werner und Jeppe Kørner beginnen mit ihren Ermittlungen, die sie in unterirdische Gänge und auf verlassene Inseln führen. Dabei stoßen sie auf einsame Seelen und befremdliche Familiengeheimnisse.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 418
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Katrine Engberg
Das Nest
Der Kopenhagen-Krimi
Aus dem Dänischen von Ulrich Sonnenberg
Diogenes
Für Cassius,
mein Anker, mein Stundenglas, meine kleine strahlende Sonne
Montag, 15. April
Prolog
Am Montagmorgen erwachte Michael mit Halsschmerzen. Er zog die Decke über seinen fiebrigen Kopf und beschloss, sich krankzumelden, bis seine Frau sich mit vor der Brust verschränkten Armen ans Fußende des Bettes stellte und ihn mit diesem Blick ansah. Michael stand auf. Sie hatte ja recht. Er arbeitete noch nicht lange als Kranführer in der Müllverbrennungsanlage und konnte sich keinen schlechten Eindruck erlauben.
Mit einer Mischung aus Paracetamol und schwarzem Kaffee im Magen fuhr er zur Refshaleøen; tatsächlich hatte er das Gefühl, als ginge es ihm allmählich besser. Er parkte, nickte dem Wachmann am Eingang zu und nahm den Aufzug in den Personalraum, um sich umzuziehen. Strenggenommen war es nicht notwendig, denn der Unterdruck in dem abgedichteten Abfallsilo machte die Anlage nahezu geruchlos, aber Michael zog trotzdem immer seinen Overall an. Er band die Sicherheitsschuhe zu, setzte den Helm auf und ging mit schmerzenden Knien durch die Anlage. Die Schmerzen schob er auf den grippalen Infekt.
Die Gänge rund um das Silo waren eine eigene Welt aus Stahl und Ventilen, Steuerarmaturen, Kesseln und Hinweisschildern. Fenster gab es nicht, die Verbrennungsanlage war ein geschlossenes System ohne Wetter und Tageszeiten. Routiniert duckte er sich unter den heißen Wasserrohren, grüßte zwei Kollegen an den Dampfturbinen und schloss den Kranführerraum auf. Er legte seine Pausenverpflegung in den Kühlschrank und setzte Kaffeewasser auf, bevor er sich stöhnend in seinen Arbeitsstuhl fallen ließ. Vor ihm offenbarte sich ein wüster Anblick, an den er sich noch immer nicht ganz gewöhnt hatte.
Ein Fenster – das einzige Fenster des Abfallsilos – gab den Blick frei auf das Herz der Müllverbrennungsanlage: auf die Kehrseite der westlichen Zivilisation, auf einen gigantischen Haufen an schmutzigem Abfall. Michael hatte nie zuvor mit Müll gearbeitet, bei den ersten Schichten hatte er sich nicht sonderlich wohl gefühlt. Als wäre er Zeuge der Apokalypse und müsste etwas dagegen tun. Mit der Zeit war es besser geworden. Inzwischen aß er sogar die von den Kollegen hinterlassenen Kekse, während er den Greifer kontrollierte.
Der Greifer! Mit seinen acht Metern Durchmesser schien er einer Dystopie entsprungen zu sein, in der gigantische Spinnen einen toten Planeten beherrschen. Seinem sechsjährigen Sohn, der die Arbeit seines Vaters für das Tollste überhaupt hielt, hatte er schon einige Fotos des Greifers nach Hause mitgebracht.
In Wahrheit war die Arbeit relativ langweilig. Das System, das die Bewegungen des Greifers von den Schleusen, an denen die Müllwagen entleert wurden, bis zu den Öfen steuerte, war komplett automatisiert. Michael musste nur den unaufhörlichen Transport des Abfalls von links nach rechts überwachen. Und dafür sorgen, dass alles reibungslos ablief.
»Guten Morgen.«
Der Prozessingenieur Kasper Skytte kam herein und setzte sich auf den Stuhl neben Michael. Manchmal wurden die Kranführer informiert, wenn es Schwierigkeiten mit dem Steuersystem gab. Michael hatte allerdings nichts bemerkt.
»Gab’s Probleme?«
»Nein.«
Glücklicherweise redeten die Ingenieure nur ungern mit den Kranführern oder irgendjemandem, der ihren technischen Erläuterungen nicht folgen konnte. Skytte würde ihn in Ruhe arbeiten lassen. Allerdings fühlte Michael sich heiß und fiebrig, vielleicht hätte er seiner Frau doch widersprechen und im Bett bleiben sollen.
»Kaffee?«, fragte Skytte.
»Ich hab gerade welchen aufgesetzt.«
Der Ingenieur klapperte hinter ihm mit den Tassen und der Kaffeekanne. Er gähnte lautstark und ließ sich wieder auf den Stuhl fallen. Beide schauten ins Silo. Michael zog seine Aktentasche heran und suchte etwas Linderndes für seinen Hals. Vielleicht hatte er noch ein paar Strepsils. Er fand einen Blisterstreifen und steckte dankbar eine Tablette in den Mund. Der Greifer näherte sich mit einer vollen Ladung dem Fenster. Es war jedes Mal beeindruckend, wenn er so nahe herankam. Müll fiel aus den enormen Fangarmen, sie sahen aus wie Tentakeln einer Qualle. Ein Seil, eine Persenning, ein Turnschuh.
Michael beugte sich vor und kniff die Augen zusammen. Der Schuh saß an irgendetwas fest. Als die Ladung sich direkt vor dem Fenster befand, fiel ein Arm aus dem Müll und baumelte leblos unter dem Greifer. In derselben Sekunde spuckte Kasper Skytte seinen Kaffee ans Fenster.
Michael hämmerte auf den Alarmknopf.
Samstag, 13. April
Zwei Tage zuvor
1
Das Meer schloss sich über seinem Kopf, er sank dem Grund entgegen, fort vom Licht der Oberfläche. Ein Streifen Tang strich über seine Arme und lud ihn ein, sich tiefer sinken zu lassen. Es war verlockend, sich dem Rausch der Tiefe hinzugeben, wie Jacques Mayol im gleichnamigen Film. Ein letztes Mal ausatmen und sinken, den Körper zu Partikeln werden lassen, die in den senkrechten Sonnenstrahlen des Meeres tanzen.
Aber der Hafen von Snekkersten war vom bodenlosen Blau des Mittelmeers weit entfernt. Er stieß sich vom Grund ab und streckte die Arme in Richtung Licht. Eine Sekunde später durchbrach er die Wasseroberfläche und holte Luft.
»Ich hab schon gedacht, du kommst nie wieder hoch.«
Jeppe Kørner schüttelte sich das Wasser aus den Ohren und kniff die Augen zusammen, um die Gestalt auf dem Badesteg zu erkennen. Über der Wasseroberfläche war die Welt warm und hell. Er schwamm zur Leiter und suchte mit den Füßen die unterste glitschige Stufe. Schaute ein letztes Mal nach unten. Die kühle Tiefe des Meeres weckte immer eine seltsame Sehnsucht in ihm.
»Ich begreife nicht, wie du es so lange aushältst. Ich friere schon nach zehn Sekunden.« Johannes Ledmark schauderte in seinem Bademantel und reichte Jeppe ein Handtuch. »Gehen wir in die Sauna, uns aufwärmen, bevor die Rentner kommen. Ich ertrage den Anblick der ganzen Krampfadern nicht.«
Er zwinkerte, um seinem boshaften Spruch die Spitze zu nehmen, und ging in Richtung Sauna. Jeppe trocknete sich ab und steckte die Füße in die etwas zu kleinen Badelatschen, die Johannes ihm geliehen hatte.
Seit letztem Sommer wohnte Johannes im Erdgeschoss eines alten Backsteinhauses am Snekkersten Strandvejen. Sein Versuch, die zwölfjährige Beziehung zu seinem Ehemann zu retten, war endgültig fehlgeschlagen, ihre gemeinsame Wohnung in Vesterbro stand zum Verkauf. Der Schauspieler Johannes Ledmark versteckte sich vor den neugierigen Blicken der Öffentlichkeit in dem alten Fischerdorf nördlich von Kopenhagen und leckte dort seine Wunden. Das Haus war undicht und heruntergekommen, das Grundstück zugewuchert, aber Johannes schien sich in diesem mittelfristigen Chaos mit Aussicht über den Øresund wohl zu fühlen. Er hatte sich mit Heckenschere und Astschneider sogar um den Garten gekümmert und behauptete hartnäckig, Rasenmähen und auf der Terrasse Unkrautjäten hätten etwas Meditatives.
»Ich glaube, wir haben Glück, die Sauna ist leer.«
Johannes hielt Jeppe die Tür des kleinen schwarzgestrichenen Häuschens auf, sie setzten sich auf die Holzbänke der Sauna. Die trockene Hitze des Ofens stieg durch das Holz und erweckte ihre ausgekühlten Körper wieder zum Leben. Es war ein ungewöhnlich sonnenreiches Frühjahr, doch die Luft hatte durchaus noch Biss, und die Wassertemperaturen waren bisher nicht über acht Grad gestiegen.
»Jetzt sieh uns nur an«, lachte Johannes. »Winterbaden mit Sauna. Jetzt fehlt nur noch ein Stück Smørrebrød und ein Ausflug ins Louisiana-Museum hier an der Küste, und wir wären wie unsere Eltern.«
»Ich mag Smørrebrød!« Jeppe schüttelte das Meerwasser aus seinen kurzen Haaren, damit es ihm nicht länger kalt auf den Rücken tropfte. »Außerdem sind wir doch längst wie unsere Eltern. Du hast es bloß noch nicht bemerkt, weil die Kerle, mit denen du schläfst, nur halb so alt sind wie du.«
»Nicht frech werden!« Johannes schlug mit seinem zusammengerollten Handtuch auf Jeppes Arm, der die Attacke mit seinem Handtuch erwiderte und Johannes’ Schulter erwischte. Sie lachten.
»Außerdem halten meine jungen Liebhaber mir das Alter vom Leib. Sieh mal, ich war nie hübscher als jetzt!« Johannes lächelte ironisch. »Jugendlich und nur einsam an Sonntagen. Was ist mit dir, du hast doch jetzt beinahe so etwas wie Frau und Kinder, oder? Wie ist das?«
Jeppe blickte auf seine Füße, an denen Meerwasser und Schweiß perlten. Sara war tatsächlich nicht nur seine Freundin, sie war auch die Mutter zweier Töchter. Und inzwischen balancierte er oft auf Messers Schneide zwischen Liebe und Gereiztheit.
»Noch wohnen wir nicht zusammen. Es ist gar nicht so einfach, wenn Kinder im Spiel sind.«
Johannes legte den Kopf schief und trocknete seine Ohren mit dem Handtuch. »Andererseits kann man so auch zu Kindern kommen. Das wolltest du doch schon immer gern.«
Jeppe zuckte die Achseln. Mit seiner Exfrau hatte er drei fehlgeschlagene Fertilitätsbehandlungen hinter sich gebracht, bevor sie sich scheiden ließen und sie mit einem anderen Mann ein Kind bekam. Seit damals hatte er mehr oder weniger den Gedanken aufgegeben, Vater zu werden.
»Wenn man selbst keine Kinder hat, kann das durchaus ein bisschen viel werden.«
Johannes sah ihn skeptisch an. »Mal ehrlich, kann man überhaupt lernen, Kinder anderer Leute zu lieben?«
Jeppe sah die elfjährige Amina vor sich, die gestern Morgen erst den Haushalt – und den größten Teil der Nachbarschaft – mit Korea-Pop in Festivallautstärke geweckt hatte und dann einen hysterischen Anfall bekam, als die Musik leiser gestellt wurde.
»Es sind zwei nette Mädchen.«
»Das werte ich als ein Nein«, grinste Johannes. »Ich hab’s geahnt! Aber ich verstehe dich, die meisten Kinder sind ebenso unerträglich wie ihre Eltern.«
»He«, protestierte Jeppe, »das habe ich nicht gesagt! Ich mag Saras Kinder sehr, aber wir müssen uns erst noch kennenlernen. Sie brauchen Zeit, um sich an den neuen Freund ihrer Mutter zu gewöhnen –« Er hielt inne. Spürte, wie die Hitze ihm über den Rücken lief und in die Wangen stieg, bis sie rot glühten. »Sag mal, wollen wir nicht stattdessen über deine Scheidung reden? Wie läuft es mit der Aufteilung eurer Sachen? Redet ihr über eure Anwälte miteinander?«
Johannes hob die Hände wie eine weiße Flagge. »Okay, du hast gewonnen. Gehen wir frühstücken. Ich habe Brötchen gekauft.«
Jeppe stand auf, ein Schweißtropfen fiel von seinem Kinn auf den Boden. »Erst müssen wir noch einmal ins Wasser. Kurz untertauchen.«
»Nein! Ich sterbe, wenn ich noch einmal in dieses eiskalte Meer muss.«
»Ein wenig Sterben bringt dich nicht um. Komm schon, alter Freund!« Jeppe zog Johannes aus der Sauna und schob ihn zur Mole und dem Badesteg. Er sehnte sich bereits nach der Kälte und Dunkelheit unter der Wasseroberfläche. Jeppe legte seinen Bademantel über den Zaun und war schon beinahe am Steg, als er sein Telefon in der Bademanteltasche klingeln hörte. Er ging zurück und blickte aufs Display. Die Polizeikommissarin. Der Wind verursachte Gänsehaut auf seinen nackten Armen.
Der weiche Sand gab unter den Füßen nach, so dass sich jeder Kontakt zwischen den Gummisohlen und dem Strand von Greve in einer Linie von Fußabdrücken verewigte. Anette Werner ließ ihre Hunde vorauslaufen und genoss das Gefühl ihres arbeitenden Körpers und der pumpenden Lunge. Das Meer lag wie ein blaugrauer Gürtel da, der Geruch nach Tang kam mit der Brandung und vermischte sich mit dem scharfen Duft des Strandginsters. Die Morgensonne stand bereits hoch über dem Horizont. Anette rang nach Atem und wunderte sich, warum etwas, das uns zu einem Glücksgefühl verhilft, in der Regel auch mit Schmerz verbunden ist. Wie zum Beispiel Mutter zu werden. Die Geburt Gudruns vor einem Jahr und neun Monaten war zweifellos das Härteste, was sie je erlebt hatte. Und doch liebte sie ihre Tochter grenzenlos und vermisste sie bereits, wenn sie ihr morgens in der Krabbelstube zum Abschied winkte.
Die Hunde bellten. Anette sprintete die hundert Meter bis zu den drei aufgeregten Border Collies. Als sie die Hunde erreichte, hatte sie einen ganz trockenen Mund. Die Hunde schubsten sich knurrend, sprangen hin und her und legten sich flach in den Sand. Anette trennte sie resolut und beugte sich über ihren Fund.
Im Sand lag ein toter Vogel. Ein Eiderentenerpel. Sie erkannte ihn an der scharfen Schwarzweißzeichnung, dem grünen Nacken und der leicht orangefarbenen Brust. Wie ein Säugling lag er auf dem Rücken, den Kopf zur Seite gedreht. Die Federpracht war mehr oder weniger unversehrt, es sah beinahe so aus, als würde er schlafen. Aber zwischen den gelben Beinen, wo sein Bauch sein sollte, klaffte nur ein blutiges Loch. Der Vogel war tot. Vielleicht war er auf dem Flug von Saltholm nach Süden gestorben, zurückgelassen von seinem Schwarm.
Die Sonne blitzte in dem glänzenden Gefieder, und Anette widerstand dem Impuls, das hübsche Tier zu streicheln. Es war schließlich nur ein toter Vogel, nicht viel anders als das Hähnchen, das Svend gestern zum Abendessen zubereitet hatte.
Sie rief den Hunden einen Befehl zu, so dass sie ihr gehorsam zurück zum Auto folgten – aufgeregt, weil sie den Vogel zurücklassen mussten, aber zu gut erzogen, um sich zu widersetzen. Auf dem Parkplatz wurden ihnen die Pfoten abgewischt, dann sprangen sie wie immer auf den Rücksitz und schienen ihren Fund vollkommen vergessen zu haben. Doch als Anette den Motor anließ, begannen sie zu fiepen und zu winseln, als hätten sie etwas von sich selbst am Strand zurückgelassen.
Vor dem Reihenhaus Holmeås Nummer 14 stand Svend und empfing sie mit Gudrun auf dem Arm. Anette sah ihre Tochter strampeln, sie wollte heruntergelassen werden, um die Welt zu erforschen. Immer ungeduldig, nur ruhig, wenn sie schlief. Wie ihre Mutter, dachte Anette stolz. Als der Wagen stillstand, setzte Svend das kleine Mädchen auf den Boden, Gudrun stapfte davon, ohne sich umzublicken. Die Windel wippte, und die kurzen Arme waren ausgestreckt, als würde sie auf einem Seil tanzen.
Anette ließ die Hunde heraus und küsste ihren Mann. Sie zog ihn am Nacken zu sich und verlängerte den Kuss, bis er sich aus ihrer Umarmung wand, ihr Kinn tätschelte und die Hunde zur Haustür scheuchte. »Du bist ja ganz verschwitzt. Aber zum Anbeißen!«
Svend zwinkerte, und während Anette vor dem Spiegel ihre Joggingklamotten auszog, dachte sie zum ersten Mal in ihrer fünfundzwanzigjährigen Beziehung, dass er recht hatte. Sie war schon immer kräftig gebaut gewesen, so hatte es zumindest ihre Mutter immer ausgedrückt – vielleicht um Anette mit der unangenehmen Wahrheit zu verschonen, dass sie dick war. Sie war das stärkste Mädchen ihrer Klasse gewesen, die Größte, mit den breitesten Schultern und den dicksten Schenkeln. Diejenige, die in allen athletischen Disziplinen gewann und immer als Erste in die Mannschaft gewählt wurde, wenn es um Ballspiele ging. Anette hatte ihre Größe nie als Problem gesehen, und Svend hatte sie nie spüren lassen, dass er sie nicht für perfekt hielt, egal, wie korpulent sie zeitweise auch gewesen war.
Doch nun sah sie einen neuen Körper im Spiegel. Das Stillen und die Elternzeit hatten die überflüssigen Kilos verschwinden lassen, als Sechsundvierzigjährige war sie fitter denn je. Noch immer mit Fleisch auf den Knochen, aber mit festerem und stärkerem Fleisch. Und hübscherem. Es überraschte sie, wie gut es sich anfühlte. Im Bad strich sie mit den Händen über ihre Haut und verspürte ein Gefühl des Wohlbehagens, als sie ihre straffe Bauchpartie berührte. Sie trocknete sich vor dem großen Spiegel ab und zog sich halb abgewandt an, um ihren Hintern zu begutachten. Für jemanden, der den eigenen Körper sein Leben lang als Werkzeug und nicht als Zierde gesehen hat, hatte das Gefühl, attraktiv zu sein, etwas Berauschendes.
»Dein Telefon klingelt!«
Svend rief aus der Küche. Anette zog hastig die Hose hoch und lief aus dem Badezimmer. Gudrun saß an dem kleinen Esstisch im Kinderstuhl und bewarf ihren Vater mit Fruchtjoghurt, der das Bombardement lächelnd über sich ergehen ließ. Svend war schon immer ruhig und gelassen gewesen, als Vater schien seine Geduld jedoch grenzenlos zu sein. Anette hüpfte bei dem Versuch, ihre Hose zu schließen, über den Fußboden. Sie griff nach dem Telefon, das neben Svends frischgebackenen Sauerteigbrötchen auf der Anrichte brummte.
»Werner!« Sie bemerkte, dass sie in einen Joghurtklecks getreten war, und fluchte innerlich.
»Tut mir leid, dich am Wochenende zu stören, aber es muss sein. Ich fürchte, es ist ein Notfall. Mit Kørner habe ich bereits gesprochen.« Es war die Stimme der Polizeikommissarin. Anettes Wochenendstimmung rutschte in Richtung ihrer mit Erdbeerjoghurt beschmierten Zehen. Irene Dam, die Polizeikommissarin, die von allen nur PK genannt wurde, hätte nicht an einem Samstag angerufen, wenn es sich nicht wirklich um einen dringenden Fall gehandelt hätte. Den geplanten Familienausflug konnte Anette jedenfalls vergessen.
»Worum geht’s?«
»Ein junger Mann oder besser ein fünfzehnjähriger Junge ist verschwunden. Oscar Dreyer-Hoff. Zuletzt wurde er gestern Nachmittag nach Schulschluss um Viertel vor drei gesehen. Die Eltern glaubten, er würde bei einer Klassenkameradin übernachten, das war aber nicht der Fall. Sie erfuhren es erst, als er heute Morgen nicht wie verabredet nach Hause kam.«
»Und wieso sollen wir uns damit befassen?« Anette suchte etwas, um sich den Fuß abzuwischen. »Fünfzehnjährige verschwinden doch ziemlich häufig für ein, zwei Tage, wenn sie beispielsweise auf eine Fete wollen und die Eltern es ihnen verboten haben. Gibt’s denn irgendwelche Verdachtsmomente?«
»Die Familie hat einen Brief gefunden.«
Anette bekam Augenkontakt zu Svend. Er wusste genau, worauf es hinauslief, sie hatten derartige Situationen oft genug erlebt. Der Waldspaziergang würde ohne Anette stattfinden. Er zuckte die Achseln und schenkte ihr ein aufmunterndes Lächeln, bevor er sich hinter der Zeitung versteckte und plötzlich wieder auftauchte, so dass Gudrun vor Lachen prustete.
»Wurde er gekidnappt?«
Die Polizeikommissarin seufzte. »Das wissen wir nicht mit Sicherheit. Aber die Familie ist … sagen wir ›prominent‹. Ihnen gehört das Auktionshaus Nordhjem. Sie haben schon früher Drohungen erhalten. Wir haben sie seit mehreren Jahren auf dem Schirm.«
Anette hörte das Lachen ihrer Tochter.
»Ich bin unterwegs.«
2
Hinter den Kreuzfahrtschiffen an der Langelinie und der weltberühmten Skulptur der Kleinen Meerjungfrau lag der kleine Jachthafen Søndre Frihavn, zwischen Lagerhäusern und modernen Appartementanlagen, deren schicke Kühlschränke aus Edelstahl immer leer waren, weil ihre Besitzer in Hongkong oder Peking arbeiteten und nur selten nach Kopenhagen kamen.
Jeppe Kørner warf einen Blick auf den Kai, das Restaurant und die Terrasse unter dunkelgrünen Sonnenschirmen. Rote und graue Betongebäude, in der Ferne sah man die Oslo-Fähre. Die Wohngegend war sicherlich begehrt, ja geradezu mondän, eine Schönheitsoffenbarung war sie allerdings nicht.
Dampfærgevej, hatte die Polizeikommissarin gesagt. Familie Dreyer-Hoff wohnte in Nummer 24B im obersten Stockwerk, er hatte sich mit Anette um elf vor dem Haus verabredet.
Jeppe ging am Wasser entlang und ließ den Blick über die kleine Ansammlung von Folkebooten, Jollen und Jachten aus Glasfiber und Holz schweifen, die im Hafen lagen. Ihr Schaukeln und Gluckern verlieh der menschenleeren Gegend einen Hauch von Leben.
Nach hundert Metern entdeckte er Anette vor einem modernen Backsteingebäude. Sie stand am Kai und sah sich ein älteres Holzboot an, das unter einer Persenning lag. Jeppe betrachtete sie lächelnd. Er hätte nie gedacht, so etwas einmal über seine Partnerin sagen zu können, aber sie sah gut aus. Noch immer riesengroß, aber irgendwie länger und so schmal um die Hüften, dass ihre breiten Schultern mit einem Mal sportlich wirkten. Und das lag nicht allein daran, dass sie abgenommen hatte. Anette hatte in der letzten Zeit ein neues Funkeln in den Augen, eine Tiefe, die ihre ansonsten ziemlich schlichten Gesichtszüge veränderte und sie – ja, geradezu hübsch werden ließ. Vielleicht hing es mit ihrer Mutterschaft zusammen, vielleicht war sie aber auch eine dieser Frauen, die mit dem Alter hübscher werden. Doch hätte er die Veränderung kommentiert, hätte es garantiert einen Schlag in die Rippen gesetzt.
»Nutzt du die Gelegenheit, um dir meinen Arsch anzusehen?«, frotzelte sie, ohne sich umzudrehen.
»Na klar, das lass ich mir nicht entgehen.« Jeppe berührte ihre hervorgereckte Faust mit seiner eigenen – eine Art Kompromissgruß zwischen Umarmung und Handschlag, mit dem beide zufrieden waren. »Was musstest du abblasen?«
»Einen Waldspaziergang. Geht schon. Und du?«
»Ich war bei Johannes in Snekkersten.«
»Versteckt er sich noch immer vor der ach so schlimmen Klatschpresse?« Sie zeigte auf das Gebäude auf der anderen Straßenseite. »Der Eingang ist um die Ecke.«
Jeppe hatte keine Lust, die Sticheleien seiner Partnerin zu kommentieren. Außerdem hatte sie ja in gewisser Weise recht. Seit Johannes als geschiedener Mann aus Chile zurückgekehrt war, hatte er sich verkrochen. Jeppe fragte sich, ob Johannes je wieder auf einer Bühne stehen würde.
Die Namensschilder an den Klingeln von Nummer 24B zeigten, dass Familie Dreyer-Hoff die gesamte oberste Etage des Gebäudes bewohnte. Ein sauberer und graffitifreier stählerner Aufzug, der Jeppe an das Rechtsmedizinische Institut denken ließ, brachte sie direkt ins Penthouse der Familie. Auf dem Weg nach oben schickte Jeppe Sara eine SMS und bereitete sie darauf vor, dass er möglicherweise erst spät nach Hause kommen würde.
Die Aufzugtüren öffneten sich zu einem beeindruckenden Raum, in dem die breiten Dielen unter Perserteppichen verschwanden. Fenster, die vom Boden bis zur Decke reichten, boten eine phantastische Aussicht über den Hafen. Der moderne Eindruck der Wohnung wurde durch farbenfrohe Kunstwerke und gediegene, wurmstichige Holzmöbel gebrochen, die man, vermutlich in Seidenpapier verpackt, aus einem italienischen Kloster importiert hatte. Kein spartanisches Zuhause, und die Frau, die sie empfing, sah auch eher üppig aus. Malin Dreyer-Hoff hatte die Figur eines Botticelli-Engels mit großen Augen und pinkfarbenen Lippen. Sie trug ein geblümtes grünes Kleid, das straff über der Brust saß.
»Henrik, sie sind da!«, rief sie heiser, als sie die beiden Polizisten erblickte, und rieb sich nervös ihre Hände, an denen blaue Farbflecken zu sehen waren.
Jeppe streckte die Hand aus. »Guten Tag, Jeppe Kørner von der Ermittlungsabteilung der Kopenhagener Polizei. Dies ist meine Kollegin Anette Werner.«
»Entschuldigen Sie, ich bin nur … Danke, dass Sie so schnell kommen konnten.« Sie beantwortete seinen Händedruck mit einem flackernden Blick.
»Können wir uns irgendwohin setzen?« Jeppe sah sich in dem großen offenen Raum um, der in eine Küche mit Glaswänden und Meeresblick überging. Es sah aus wie eine moderne Version des New Yorker Lofts, von dem er geträumt hatte, seit er als Kind Flashdance gesehen hate. Es sah nach Geld aus.
»Wir gehen zu meinem Mann ins Wohnzimmer.«
Malin Dreyer-Hoff führte sie einen langen Flur entlang. Auf der einen Seite Meeresblick, Zimmertüren auf der anderen. Jeppe warf einen Blick durch eine offene Tür und sah mehrere Gemälde und zwei schicke Computerbildschirme. Die Familie Dreyer-Hoff hatte ihr Vermögen mit einem Online-Auktionshaus für Kunst und Antiquitäten erworben. Es war ihrer Wohnung anzusehen.
Der Flur endete in einem hellen Zimmer, dessen Größe beinahe dem Empfangs- und Küchenraum entsprach. Ein pinkfarbenes Sofa für fünf Personen stand unter einem Bild von Kasper Eistrup, das so perfekt zur Wand passte, dass es sich um eine Auftragsarbeit handeln musste. Am Fenster stand neben einer Staffelei mit einem halbfertigen blauen Gemälde ein großer grauhaariger Mann mit dem Rücken zum Hafen, die Hände in den Hosentaschen. Er hatte eine senkrechte Falte zwischen den Brauen und sah in seiner beigen Leinenhose und dem weißen Hemd über dem kleinen Wohlstandsbauch wie frisch gebügelt aus. Er ließ die Schultern hängen wie Menschen, die den größten Teil des Tages am Schreibtisch verbringen.
Er kam ihnen entgegen und gab ihnen die Hand.
»Henrik Dreyer-Hoff. Guten Tag. Danke, dass Sie kommen konnten.«
Jeppe stutzte über die Formulierung, die besser zu einem Höflichkeitsbesuch gepasst hätte. Aber aus Nervosität sagten die Leute bisweilen die merkwürdigsten Dinge.
»Setzen Sie sich.«
Das Ehepaar setzte sich auf das pinkfarbene Sofa, Jeppe und Anette in zwei dazu passende Sessel ihnen gegenüber. Henrik Dreyer-Hoff legte schützend den Arm um seine Frau.
»Sie haben noch immer nichts von Ihrem Sohn gehört?« Jeppe schlug eine leere Seite seines Notizbuchs auf.
Beide schüttelten den Kopf.
»Wann haben Sie bemerkt, dass er verschwunden ist?«
»Heute Morgen.« Malin Dreyer-Hoff atmete tief durch. »Samstags frühstücken wir immer zusammen. Das ist eine Familientradition. Henrik bereitet den Brunch vor –«
Sie sah ihren Mann an, der nickte.
»Ich koche sehr gern, aber normalerweise habe ich keine Zeit dazu. Am Wochenende jedoch … Oscar will immer Pfannkuchen. Die kleinen amerikanischen mit Sirup.« Henrik hielt inne.
Malin warf ihrem Mann einen missbilligenden Blick zu, als hätte er etwas Falsches gesagt, und wandte sich dann wieder Jeppe zu. »Ich bin früh aufgestanden, um zu malen, während ich darauf wartete, dass die anderen aufwachten und Oscar nach Hause kam. Aber er kam nicht. Um halb neun habe ich ihn angerufen und eine SMS geschickt.«
Jeppe notierte die Uhrzeit, ihm fiel auf, wie fest Henrik seine Hand um die Schulter seiner Frau gelegt hatte. Als würde er sie aufrecht halten. Oder zurückhalten.
»Wo war er über Nacht?«, fragte er. »Oder besser, wo hätte er sein sollen?«
»Bei seiner Freundin Iben. Sie wollten für die Dänischprüfung üben. Aber sie sagt, er sei nicht gekommen. Ich habe sie gegen zehn erreicht. Da wussten wir, dass irgendetwas nicht in Ordnung ist.« Malin Dreyer-Hoff drehte nervös ihren Fingerring.
»Und Iben weiß nicht, wo er sein könnte?«
»Sie meint, er hätte es sich anders überlegt. Es klingt merkwürdig, finde ich. Ihr Vater hätte uns eigentlich auch Bescheid geben können, aber er wusste angeblich nichts von der Verabredung. Sagt er.«
Jeppe reichte ihr sein Notizbuch. »Wir brauchen die Mobilnummern von Oscar, Iben und ihren Eltern.« Sie starrte ratlos auf das Notizbuch, dann schrieb sie. Ihre zitternden Hände offenbarten ihre Angst vor dem Unvorstellbaren.
»Ich glaube, er wurde gekidnappt.« Ihre Stimme bebte. »Allein der Gedanke, dass er –«
»Wo wohnt Iben?«
»In der Fredericiagade«, antwortete Henrik und sah seine Frau an. »Nummer 64, oder? Mit ihrem Vater. Wenn man durchs Kastell geht, ist man in zehn Minuten da. Das macht Oscar immer.«
Jeppe nickte Anette zu, die Malin das Notizbuch abnahm und ans Fenster trat, um Oscars Freundin Iben anzurufen.
»Was ist mit dem Rest der Familie? Waren gestern alle zu Hause?«
»Ja«, antwortete Malin nach einer kurzen Pause. »Victor, unser Ältester, war mit einigen Klassenkameraden in der Stadt, aber Henrik und ich waren hier.«
»Sie haben das hier für uns hinterlassen.« Henrik griff vorsichtig nach einen A4-Blatt auf dem Sofatisch. Sechs mit Computer geschriebene Zeilen auf weißem Papier. »Wir haben es erst heute gefunden. Da wussten wir, dass irgendetwas nicht stimmte, und haben sofort die Polizei angerufen.«
Jeppe zog einen Ärmel über die Fingerspitzen und nahm das Papier entgegen.
Er sah sich um und erblickte das Messer, das Basil Hallward erstochen hatte. Er hatte es oft gereinigt, so dass kein Fleck mehr darauf war. Es war blank und glänzte. Wie es den Maler getötet hatte, so sollte es das Werk des Malers und alles, was es bedeutete, töten. Es sollte die Vergangenheit töten, und wenn die tot wäre, würde er frei sein.
Der Bug glitt geschmeidig durchs Wasser und teilte die Wellen hinter dem Boot zu einem unendlichen V. Möwengeschrei begleitete das Motorengeräusch, die Sonne spielte auf den Wellenkämmen und verwandelte seine Pupillen in zwei kleine schwarze Punkte. Im morgendlichen Licht schimmerte die Müllverbrennungsanlage Amager Bakke, als würde tatsächlich Schnee auf dem schrägen Dach liegen, auf dem eine Skipiste geplant war. Natürlich schien es nur so. Die Vision einer Sportanlage auf dem Dach der Verbrennungsanlage war noch längst nicht umgesetzt, Kopenhagens Skiläufer würden noch eine Weile gezwungen sein, in reale Wintersportgebiete zu reisen.
Im Kopenhagener Hafen war es ruhig. So früh am Tag waren lediglich Fähren und Müllschiffe unterwegs. Doch schon in wenigen Stunden würde das Wasser voller Kanalrundfahrtschiffe sein. Dazu kamen die Jollen, die zum Angeln, Baden oder Campen auf eine der kleinen Inseln im Øresund segelten, Motorboote mit Bier trinkenden Kapitänen und Kajaks mit in Windjacken gepackten Paddlern. Zu dieser Zeit würde er längst fort sein.
Er fuhr ohne Zeitdruck, so gefiel es ihm am besten. Er folgte den Bewegungen des Bootes, der Wind presste ihm Tränen in die Augen. Trekroner tauchte vor ihm auf, rot, grün und freundlich lächelte die Insel in der Sonne. Mads Teigen steuerte den Kutter des Forts sicher in den kleinen Hafen und zum Bootssteg. Dort lag eine einzige Jolle aus Holz vertäut, ansonsten war der Hafen leer. Er band das Boot fest, stellte den Motor ab und sprang an Land. Die steilen Wälle waren mit dem ersten Gras des Frühjahrs überzogen, sie glichen weichen, grüngelb bewachsenen Flügeln, die das alte Fort beschützten.
Das Seefort war ursprünglich ein Teil der Kopenhagener Befestigung gewesen. Ein Bollwerk, das mehrere weitere Forts umfasste und eine Hauptrolle bei der legendären Seeschlacht von Kopenhagen 1801 und dem britischen Angriff von 1807 gespielt hatte, bei dem Dänemark seine gesamte Flotte verlor. Die künstliche Insel Trekroner war bereits 1713 angelegt worden. Damals hatte man drei Kriegsschiffe versenkt und mit Steinen befüllt. Eines der Schiffe hieß Tre Kronor, drei Kronen, und gab dem Fort seinen Namen, obwohl die meisten Menschen glaubten, das Fort hätte erst über zweihundertfünfzig Jahre später seinen Namen erhalten, als die Insel für drei Kronen an den Staat verkauft wurde.
Mads sammelte eine verirrte Plastiktüte auf und ließ seinen Blick über die hufeisenförmige Promenade schweifen. Es war niemand zu sehen. Wie immer blieb sein Blick an dem weißen Leuchtturm hängen, der den Haupteingang zum eigentlichen Fort überragte. Im Ersten Weltkrieg hatten die Kasematten darunter als Unterkünfte für siebenhundertfünfzig Soldaten gedient, und im Zweiten Weltkrieg wurden sie während der dänischen Besetzung von den Deutschen genutzt. Stand man in den verwitterten Gängen unter dem Meeresspiegel, hatte man bis heute das Gefühl, Pulverdampf und Angstschweiß zu riechen. Mit Langeweile vermischte Panik saß noch immer im Mauerwerk und flüsterte die Geschichten Hunderter toter Männer.
Jetzt war das Fort nur noch ein Refugium für Vögel, Nerze und einen einzigen Fortmeister, der in dem alten, rotgestrichenen Kommandantengebäude wohnte. Ein Einsiedler auf seiner Insel, das war sein Schicksal.
Mads Teigen ging über die Plattform, wo sie schon angefangen hatten, Holz für das Mittsommernachtsfeuer zu sammeln, bis zur Außenseite des Walls. Er wollte nach dem Schwanenpärchen sehen, das unten am Wellenbrecher ein Nest gebaut hatte. Vom Kamm des Walls aus hatte er freie Sicht auf die Türme und Spitzen Kopenhagens auf der einen und Malmös schiefen Wolkenkratzer »Turning Torso« auf der anderen Seite. Es war, als würde er sich auf einem eigenen Planeten befinden, so einsam war es hier. Ein kleines Stück Wildnis inmitten der Stadt, nur durch einen schmalen Streifen Wasser von ihrem hektischen Treiben getrennt.
Das Schwanenpaar brütete. Das Weibchen hockte schwer in einem Nest aus Seegras, das Männchen umkreiste es wachsam. In gut einem Monat würde es im Fort einen neuen Wurf kleiner pelziger Schwanenjungen geben, die an ihrer Mutter klebten, um die ersten kritischen Wochen zu überstehen.
Mads lächelte bei dem Gedanken.
Er ging an den alten Seezeichen aus weiß-rot lackiertem Holz vorbei, die auf ihren Sockeln thronten. Gegen Abend sollte hier der erste Polterabend des Jahres gefeiert werden. Mads hatte die Stationen der geplanten Schatzsuche in den unterirdischen Gängen bereits markiert, aber zur Sicherheit ging er die Route noch einmal ab.
Kühle Luft schlug ihm von den dicken Betonmauern der Kasematten entgegen, als er die Wendeltreppe hinunterging. Er hörte das Echo seiner Schritte, als würde ihm jemand auf dem Fuße folgen. Als er an der Tür mit dem aufgemalten roten Kreuz vorbeikam, war das Geräusch so realistisch, dass er sich umdrehte. Natürlich ging ihm niemand nach. Nur die Gespenster in seinem eigenen Kopf.
Mads kontrollierte, ob überall die Seile festgezurrt und die Taschenlampen aufgeladen waren. Dann stieg er die Wendeltreppe wieder hinauf an Licht und Wind. Bis die Gäste eintrafen, konnte er noch ein paar Stunden in der Werkstatt arbeiten. Auf dem Weg zum Kommandantengebäude kam er noch einmal an der am Bootssteg vertäuten Jolle vorbei. Er machte sich keine Gedanken über das Boot. Dennoch schloss er zur Sicherheit die Haustür ab. Er wollte nicht gestört werden.
Die Tür zur Werkstatt verriegelte er ebenfalls, und das Telefon blieb in der Tasche seiner Windjacke. Mads schaltete die Stereoanlage ein, Tschaikowskis siebte Symphonie erfüllte den Raum.
Erleichtert seufzte er bei der Aussicht auf eine Weile absoluter Ruhe für sein nächstes Projekt. Er holte ein in Plastik verpacktes Päckchen aus dem Kühlschrank und legte es auf den Arbeitstisch. Vorsichtig packte er den toten Körper aus, füllte eine Schale mit Wasser und legte das Skalpell bereit.
3
Anette betrachtete die Eltern auf dem pinkfarbenen Sofa und dachte unwillkürlich an das britische Paar, das seine kleine Tochter während des Urlaubs in Portugal verloren hatte. Trotz jahrelanger Suche war sie nie gefunden worden. Viele waren der Ansicht, die Eltern hätten das Verbrechen selbst begangen.
»Der Brief lag auf der Kücheninsel«, erklärte Henrik und zog seine Frau näher an sich heran, als könne er sie physisch gegen die Worte abschirmen. »Wir haben ihn gar nicht bemerkt, bis uns klarwurde, dass Oscar verschwunden ist. Wir dachten, es wären Hausaufgaben oder etwas Ähnliches.«
»Und das ist es nicht?«
Beide schüttelten den Kopf.
»Das Blatt war in der Mitte gefaltet, darauf stand AN M&H. Auch mit Computer geschrieben. Hier!«
Jeppe drehte das Papier um und zeigte es Anette.
»Könnte es sich« – Malin atmete flach – »um einen Erpresserbrief handeln? Es geht doch ums Töten?«
»Es sieht eher aus wie ein Zitat.« Anette sah Jeppe an und wusste, dass er dasselbe dachte. Die meisten Kidnapper hatten ziemlich konkrete Forderungen, die selten lyrisch daherkamen. »Wer ist Basil Hallward?«
»Keine Ahnung.« Malins Antwort kam prompt. »Wir haben den Namen noch nie gehört.«
Anette hörte einen abweisenden Ton in Malin Dreyer-Hoffs Stimme. Als würde die Polizei die falschen Fragen stellen.
»Wir sind schon einmal bedroht worden. Es ist ein paar Jahre her, zwei Jahre vielleicht. Wir haben damals Anzeige erstattet. Sie müssten es in Ihren Akten finden.«
Anette nickte. »Sahen die betreffenden Briefe aus wie dieser?«
Malin zögerte. »Soweit ich mich erinnern kann, waren sie alle ziemlich unterschiedlich, einige mit der Hand geschrieben, andere am Computer. Aber kurz waren sie alle.«
»Haben Sie die Briefe noch?«
»Nein«, warf Henrik ein, bevor seine Frau antworten konnte. »Entscheidend ist doch, dass irgendjemand unserer Familie schaden will. Und nun haben sie Oscar!«
Henriks Stimme brach bei den letzten Worten, er senkte den Kopf. Seine Schultern bebten. Malin legte eine Hand auf sein Bein und tätschelte es ungeduldig. Anettes Eindruck nach sah es nicht sonderlich liebevoll aus.
»Fand die Polizei damals den Absender?«, erkundigte sich Jeppe.
»Nein.«
»Okay, wir sehen uns die Berichte an. Unsere Kriminaltechniker werden dieses Blatt auf mögliche Spuren untersuchen, dann vergleichen wir es mit den früheren Briefen, sollten wir Kopien davon haben.«
Während Jeppe ihr weiteres Vorgehen erklärte, fotografierte Anette das Blatt und steckte es dann in einen braunen Briefumschlag. Sie sah, wie Henrik sich aufrichtete und seinen Arm wieder um seine Frau legte.
»Gibt es Hinweise auf einen Einbruch?«
Henrik schüttelte den Kopf. »Wir haben ein Alarmsystem, das nicht ausgelöst wurde. Aber was spielt das für eine Rolle? Sie haben vermutlich geklingelt, und Oscar hat seine Kidnapper selbst hereingelassen.«
»Wann wurde er zuletzt gesehen und von wem?« Jeppe blätterte eine Seite seines Notizbuchs um.
»Als er gestern um Viertel vor drei die Schule verließ«, antwortete Malin Dreyer-Hoff. »Zahles-Gymnasium am Nørreport. Iben sagt, sie habe ihm noch gewinkt, als er zu Fuß nach Hause ging.«
»Wann kamen Sie nach Hause?«
»Freitags hat unsere Tochter Essie Tanzunterricht. Ich habe sie abgeholt, wir waren kurz nach fünf zu Hause, vielleicht um halb sechs.« Malin berührte Henriks Hand auf ihrer Schulter, als wäre sie ihr unangenehm. Henrik ließ seine Hand dort liegen.
»Haben Sie Ihre Verwandten gefragt, ob sie etwas von ihm gehört haben?«
»Wir haben meine Eltern und meine Schwester angerufen, aber niemand wusste etwas. Das sind unsere engsten Verwandten, Henriks Eltern sind tot. Aber Oscar würde nie einfach so verschwinden, ohne uns Bescheid zu geben.«
Anette setzte sich wieder neben Jeppe. »Wissen Sie, ob er gestern nach der Schule zu Hause war? Ist seine Schultasche hier? Oder sein Notebook?«
Oscars Mutter schüttelte den Kopf. »Auch sein Handy ist weg.«
»Was ist mit seinem Pass?«, fragte Anette weiter. »Ist er noch da?«
»Das habe ich überprüft. Unsere Pässe liegen alle an ihrem Platz in der Schublade.« Sie zeigte auf einen rotlackierten Sekretär. »Was werden Sie unternehmen, um ihn zu finden?«
»Wir veranlassen umgehend eine Fahndung«, versicherte Jeppe. »Wenn er sein Handy dabeihat, finden wir ihn sofort. Sie könnten inzwischen noch einmal all die Personen anrufen, zu denen Oscar normalerweise Kontakt hat.«
In Henriks Augen schimmerten Tränen.
»Haben Sie ein gutes Foto von ihm?«
»Ich hole eins.« Malin befreite sich aus dem Griff ihres Mannes, stand auf und stützte sich einen Augenblick auf die Rückenlehne des Sofas, als sei ihr schwindlig. Dann verließ sie den Raum.
»Haben Sie etwas dagegen, wenn wir einen Blick in sein Zimmer werfen?« Anette bekam keine Antwort. Sie sah Jeppe an, der auf eine Art und Weise die Achseln zuckte, die sie als Zustimmung wertete. Anette erhob sich und ging durch den langen Flur in Richtung Küche. Das erste Zimmer sah aus wie ein Büro mit schweren Holzmöbeln, im nächsten Zimmer saß ein junger Mann mit Kopfhörern. Dunkelhaarig, groß, attraktiv.
»Hej, ich heiße Anette Werner und bin von der Polizei. Du bist vermutlich Victor?«
Er nahm die Kopfhörer ab und legte sie sich um den Nacken. Ein schwerer Beat war daraus zu hören. Anette fielen seine rotgeweinten Augen auf.
»Ich suche Oscars Zimmer.« Sie versuchte, sich nicht von dem Schlagzeug ablenken zu lassen.
»Nennen Sie mich Vic, wie alle anderen.« Der Junge zog sein Mobiltelefon aus der Hosentasche und tippte aufs Display. Die Musik verstummte. »Das hier ist sein Zimmer. Ich sitze hier bloß so –«
»Ich gehe davon aus, dass du nicht weißt, wo dein Bruder ist?«
»Wenn ich das wüsste, wären Sie jetzt nicht hier.« Victor lächelte entschuldigend und wischte sich eine Träne von der Wange. »Sorry, ich will hier nicht den Neunmalklugen spielen, aber es ist nur so … eigenartig.«
Anette ließ ihren Blick über die spartanische Einrichtung des Zimmers schweifen. Ein Schreibtisch und ein blankpolierter Holzstuhl, Regale mit Büchern, ein voller Garderobenständer und eine Kommode, das war alles. Das Zimmer war ebenso sauber und aufgeräumt wie der Rest der Wohnung, aber bei weitem nicht so gemütlich.
An der Wand über dem Schreibtisch hingen dicht an dicht Wechselrahmen mit Zeichnungen. Mit Kohlestift gezeichnete menschliche Gestalten, nackte Körper, Gesichter mit gesenkten Blicken und Geschlechtsteilen, die in schwarzen Flächen verschwanden.
»Sind das seine Zeichnungen?«
»Ja. Oscar ist verdammt gut. Als wir kleiner waren, hat er immer versucht, es mir beizubringen. Er hat mir eine Vase mit Blumen vor die Nase gestellt und mir gezeigt, wie man Perspektiven und Schatten zeichnet. Ich habe es nie begriffen, was ihn auf die Palme brachte, er meinte, ich täte nur so, um ihn zu ärgern.«
Anette lächelte. »Wann hast du ihn das letzte Mal gesehen?«
»Gestern Morgen beim Frühstück.« Er antwortete zögernd, die Stimme schien jeden Moment zu versagen. »Wir haben in der Küche gefrühstückt, mit meiner kleinen Schwester – wie immer –, dann sind wir zusammen zur Schule gegangen. Oscar und ich gehen auf dasselbe Gymnasium, er in die elfte, ich in die dreizehnte Klasse.« Victor griff zu seinem Kopfhörer. »Mutter sagt, jemand hätte ihn gekidnappt. Stimmt das?«
»Es ist noch zu früh, um etwas sagen zu können.«
Der Junge blickte auf den Kopfhörer. »Wir hatten verabredet, gemeinsam nach Hause zu gehen, aber ich … ich hatte noch etwas zu besprechen. Vielleicht, wenn ich unsere Verabredung eingehalten hätte –«
Er sah Anette mit einem flehenden Blick an. Sie hätte ihn gern beruhigt, aber sie wusste ebenso wenig wie er. Und vielleicht hatte er recht.
Victor warf den Kopfhörer auf den Boden. »Einer meiner Freunde sagt, er hätte meinen Bruder gesehen, wie er nach der Schule am Botanischen Garten mit jemandem in einem Auto gesprochen hat.«
Anette hielt den Atem an. »Und wie heißt dein Freund?«
»Jokke. Joakim. Er geht in die Parallelklasse.« Victor zeigte Anette sein Handy. »Ich habe vorhin eine SMS an alle geschrieben, die ich kenne. Er hat gerade zurückgeschrieben.«
»Bist du so nett und schreibst mir die Nummer von … Jokke auf?«
Victor tat es.
»Könnte Oscar irgendetwas Verbotenes getan haben? Vielleicht mit einem Freund, den eure Eltern hier nicht sehen wollen?« Sie lächelte beruhigend, um zu signalisieren, dass er keine Standpauke zu befürchten hatte.
»Nein! Mein Bruder ist okay!«
Anette sah sich noch einmal in Oscars Zimmer um. Ein Schreibtisch, eine Kommode und ein Stuhl, auf dem Victor saß. »Sag mal, wo schläft er eigentlich?«
»Im Familienbett.«
Sie sah ihn fragend an.
»Unsere Eltern sind der Ansicht, es sei gut, wenn wir alle zusammen schlafen. Als ich klein war, haben sie ein Riesenbett für uns alle gebaut. Fünf Meter breit. Ich habe jetzt ein eigenes Bett, aber Oscar schläft noch immer dort.«
Anette spürte einen kalten Hauch im Nacken.
Ein Familienbett?
Auf dem Küchentisch stand eine Schale mit Müsli, das langsam eintrocknete. Das Frühstück – zubereitet von einem Vater ohne Appetit für eine Familie, die nicht da war. Eigentlich sollte Iben hier sitzen und sich über seinen unbeholfenen Versuch amüsieren, die vegane Kost zu servieren, die sie im Haushalt eingeführt hatte. Doch obwohl ihr bester Freund verschwunden war, hatte sich seine idealistische Tochter entschlossen, an dem morgendlichen Treffen ihrer Umweltschutzgruppe teilzunehmen.
Kasper Skytte legte den Kopf in den Nacken und trank den letzten Schluck Fernet-Branca. Das Brennen in der Speiseröhre tat gut, ebenso die anschließende Übelkeit. Eigentlich schmeckte ihm Fernet nicht sonderlich, und schon gar nicht am Morgen, aber heute brauchte er den Schnaps und die selige Gleichgültigkeit, die sich in seinem Körper ausbreitete. Kasper hatte kein Alkoholproblem, aber er wusste genau, dass er zeitweise zu viel trank. Seit seiner einvernehmlichen Scheidung vor sieben Jahren hatte sein ohnehin reichlicher Weinkonsum noch weiter zugenommen, es war ausgesprochen ungesund. Doch mit seiner Rolle als alleinerziehender Vater kam er nur zurecht, wenn er sich hin und wieder einen Schluck gönnte und am Ende eines Arbeitstages ein paar Stunden allein am Computer verbringen konnte.
Als seine Exfrau vor sechs Jahren mit ihrem neuen Freund nach San Sebastián zog, hatten sie vereinbart, dass Iben bei ihm in Dänemark blieb. Kasper hatte die Wohnung, die Tochter und gegen seinen Willen auch Cookie behalten, einen Coton de Tuléar, mit dem er verbissen zweimal am Tag Gassi gegangen war, bis er im letzten Jahr endlich gestorben war. Er hatte mit anderen Worten alles behalten, sie hatte lediglich ihre Freiheit bekommen. Trotzdem schien es, als hätte sie die Tochter mitgenommen, denn die Leere in Ibens Blick wurde mit jedem Jahr größer. Zumindest, wenn sie ihren Vater ansah.
Er hörte die Tür zum Hof klappern und schaute zum Fenster hinaus, um zu sehen, ob sie heimkam. Es war ihr Nachbar. Eigentlich hatte Iben versprochen, nach dem Treffen direkt nach Hause zu kommen, nun ging sie nicht einmal ans Telefon. Kasper warf die Reste des Müslis in den Mülleimer, den Abwasch wollte er später erledigen.
Oscar war verschwunden, und die Polizei war auf dem Weg, um seine Tochter zu vernehmen. Das war die Realität, der er nicht entfliehen konnte. Kasper betete, dass sie rechtzeitig nach Hause kam, damit er die Polizei nicht allein empfangen musste.
Er ging ins Wohnzimmer und schaltete die Lampe am Schreibtisch ein, den er trotz Ibens Protest in das Zimmer gezwängt hatte. Ja, es war eng, aber wo sollte er den Schreibtisch denn sonst hinstellen? Wenn er zu Hause sein musste, wenn sie aus der Schule kam, um für sie zu kochen, dann musste er auch arbeiten können, wenn sie schlief. Über dem Schreibtisch hing ein Plan der neuen Kopenhagener Müllverbrennungsanlage auf Refshaleøen, des ambitionierten Amager Ressource Center, auch ARC genannt. Sein Arbeitsplatz seit dem letzten Jahr, mit dem er sich den größten Teil des Tages beschäftigte. Abgesehen von Iben.
Kasper Skytte breitete vier Blätter auf dem Schreibtisch aus und beugte sich darüber. Die Statistiken zeigten die Emissionen der sechs inneren Rohre in den vergangenen Wochen, der sogenannten scrubbers, die den Rauch von den Öfen zu dem einhundertdreiundzwanzig Meter hohen Schornstein leiteten und dabei reinigten, so dass sauberer weißer Dampf über der Stadt ausgestoßen wurde. Als Prozessingenieur hatte er den Ausstoß von schädlichen Giftstoffen aus dem brennenden Abfall im Auge zu behalten. Gleichzeitig ging es aber auch um die Optimierung der Energie, die von der Anlage produziert wurde. Sämtliche Stufen des Verbrennungsprozesses, von der Abholung des Mülls in der Stadt bis zum computergesteuerten Greifer im eigentlichen Abfallsilo, wurden von ihm und seinen Kollegen überwacht.
Das ARC war in vieler Hinsicht einzigartig. Unter dem Leitsatz Wir nehmen entgegen und geben zurück war die Verbrennungsanlage von Anfang an sehr viel mehr gewesen als nur eine Mülldeponie. Die weltberühmte Architektengruppe BIG hatte ein Dach entworfen, das wie ein fünfundachtzig Meter hoher Skihang konstruiert war, mit Lift, Café und besonderen Kunststoffmatten aus Italien, die es ermöglichten, die Piste ohne die geringste Schneeflocke hinunterzusausen. Amager Bakke, der Hügel von Amager – der neue Erholungsort und das jüngste Wahrzeichen der Stadt. Es hieß, allein das Dachprojekt hätte einen dreistelligen Millionenbetrag gekostet.
Allerdings war die Eröffnung des Hügels bereits mehrfach verschoben worden, und die Presse blies jede einzelne kleine Panne auf, als hätte sie keinerlei Verständnis für die Größe und Bedeutung dieses Projekts. Eine der saubersten Verbrennungsanlagen der Welt, und sie arbeitete einwandfrei. Dennoch hatten sie immer wieder mit Widerständen zu kämpfen. Unter anderem weil sie gezwungen waren, Abfall aus Großbritannien zu importieren, um Kopenhagen genügend Fernwärme liefern zu können. Die Anlage war zu groß ausgelegt, und Kopenhagens Abfallmenge sank. Natürlich stürzten sich die Journalisten darauf. Doch es war der politische Wille gewesen, eine so große Anlage zu bauen, da man nicht riskieren wollte, in zehn Jahren zu wenig Kapazität zu haben.
Kasper legte eine Lupe auf das Blatt, das die letzten Emissionszahlen der NOx-Katalysatoren zeigte. Stickoxid war stark gesundheitsschädlich und wurde daher in vielen Ländern streng reguliert, um Smog und sauren Regen zu vermeiden. Kasper Skytte und sein Team gehörten zu den weltweit führenden Ingenieuren für Rauchgasreinigungsanlagen; Verbrennungsanlagen in Kanada, Indien und Frankreich hatten sie bereits als Berater angefragt. Ihr Ziel war es, dem Rauch der Kraftwerke das komplette CO2 zu entziehen und das Kohlenstoffdioxid in tieferen geologischen Schichten zu deponieren. Grundsätzlich existierte die Technologie bereits, es war lediglich eine Frage der Zeit.
Kasper sah auf die Uhr und rief noch einmal seine Tochter an. Noch immer keine Antwort. Wütend warf er das Telefon auf den Schreibtisch. Es flog zu Boden, ärgerlich hob er es auf und kontrollierte, ob das Display beschädigt war. Die Polizei würde bald hier sein, sie musste nach Hause kommen.
Wieder beugte er sich über den Schreibtisch und zeichnete Striche und Zahlen auf dem Papier ein. Kurven und Maße, versehen mit kleinen gekritzelten Symbolen. Er verschrieb sich und fluchte, dann lehnte er sich im Stuhl zurück und blickte an die Decke. Horchte auf den Schlüssel im Schloss.
Er sollte es nicht tun. Er hatte es sich fest vorgenommen. Aber der Gedanke, den Computer hochzufahren, wuchs in seinem Kopf, bis er die Zahlen vor sich kaum noch lesen konnte. Wenn er sich jetzt schon einloggte, wäre es hinterher einfacher, dann könnte er sich eine Zeit davon fernhalten. Kasper spürte ein Brennen im Leib. Wie eine Entzündung, die vom Bauch durch das Blut in die Haut strömt und sie erzittern lässt. Er griff zu seinem Notebook und spürte, wie die Welt wieder ins Lot kam.
Entlang der Bahngleise zwischen Østerport und der Kreuzung Sølvgade und Øster Voldgade, wo die Schienen unterirdisch verlaufen, leuchteten weißblühende Bäume auf. Zweige mit halbgeöffneten Blütenknospen reckten sich zum Himmel, ihr Duft erfüllte die gesamte Østre Anlæg. Es mussten Mirabellen sein, denn es war zu früh für Traubenkirsche und Weißdorn und die gelben Forsythien. Der erste Blütenflor des Frühjahrs überzog die Stadt. Alles war erfüllt von Leben.
Esther de Laurenti sog wie berauscht den Frühling ein. Sie war gerade siebzig Jahre alt geworden, und mit jedem Jahr, das sie näher an das Ende ihres Lebens brachte, erlebte sie das Eintreffen des Frühlings wie einen Lottogewinn. Sie zog an der Hundeleine mit nur einem Mops am anderen Ende und spürte einen kleinen Stich im Herzen. Die zwölf Jahre alte Epistéme hatte sich im Winter erkältet, und daraus war eine Gehirnentzündung geworden, die der kleine Hund nicht überlebt hatte. Esther war nur noch Dóxa geblieben, die über den Verlust ihrer Lebensgefährtin einige Wochen gewinselt hatte, dann war es überstanden. Nun trippelte sie in bester Verfassung den Weg entlang, ohne irgendein sichtbares Anzeichen von Trauer. Eigenartig, dass der Tod so nahe kommen konnte, ohne nachhaltige Spuren zu hinterlassen.
Esther kraulte die Nackenfalte des Hundes und setzte ihren Spaziergang am Statens-Museum for Kunst fort. Sie ging den Botanischen Garten entlang bis zu den Seen. Die Sonne reflektierte auf dem Wasser, sie musste die Augen zu schmalen Schlitzen zusammenkneifen. Sie lächelte einer Gruppe von Jugendlichen zu, die mit Bierdosen auf einer Bank saßen. Kopenhagen ist am schönsten, wenn es aus dem Winterschlaf erwacht, dachte sie, anders als wir Menschen, die erst unzählige morgendliche Rituale hinter uns bringen müssen, bevor wir überhaupt präsentabel sind.
Gregers, ihr fünfundachtzigjähriger Mitbewohner und Freund, war ein Musterexemplar, wenn es darum ging, den Tag möglichst langsam zu beginnen. Manchmal saß er in der Küche am Peblinge Dossering und war bis weit in den Vormittag hinein ausgesprochen mürrisch. Und mit dem Alter wurde es nur noch schlimmer. Er bewegte sich immer weniger und nörgelte immer mehr. Er kaufte weiterhin bei dem Bäcker in der Blågårdsgade ein und musste daher einmal am Tag die Wohnung verlassen, aber er hatte zunehmend weniger Fleisch auf seinen einst so starken Knochen, und seine Laune überstieg selten den Gefrierpunkt.
Esther zog Dóxa von der Bank weg und dachte dabei an ihre derzeitige Lieblingsbeschäftigung: ihr Schreiben. Noch war es nur eine vorsichtige Idee zu einem Buch, die aber gleichzeitig so interessant war, dass der Gedanke sie nicht mehr losließ. Die Idee war ihr gekommen, als sie an Weihnachten Blumen auf das Grab ihres verstorbenen Freundes Kristoffer gelegt hatte. Es hatte geschneit, die Grabstelle war mit Eisblumen überzogen. Lange hatte sie in der Kälte gestanden und versucht, eine Verbindung zu ihrem vermissten Freund herzustellen. Sie hatte sich verloren und verlassen gefühlt.
Warum fällt es uns so schwer, mit dem Tod umzugehen, obwohl er doch die einzig unabänderliche Tatsache ist?, hatte sie sich gefragt. Wohin mit unserer Trauer, wenn die Rituale um den Tod verschwunden sind und alle sich bemühen, bloß schnell darüber hinwegzukommen?
Die Gedanken summten in ihrem Hinterkopf wie eine beharrliche Wespe, die weder stechen noch verschwinden wollte.
Esther hatte begonnen, über Todesrituale in anderen Kulturen zu lesen, über Trauerarbeit und Begräbnisse. Eines Morgens im März hatte sie sich direkt nach dem Erwachen an den Computer gesetzt, um zu schreiben. Zunächst waren es nur vereinzelte Gedanken über den Tod, doch allmählich begann der Text, Form anzunehmen. Bei dem Gedanken an die entstehende Geschichte kribbelte es in ihrem Bauch.
Sie legte den Kopf zurück und sah hinauf zu ein paar dürren Kastanienblättern. Im Moment war es unmöglich, sich vorzustellen, dass sie bald von federnden, knallgrünen Fächern abgelöst würden.
Todesrituale und strotzendes Frühlingsgrün. Esther konnte sich nicht erinnern, dass es ihr je bessergegangen wäre.
4
D