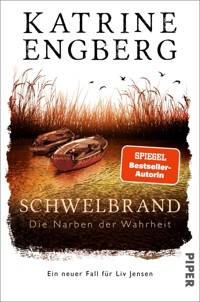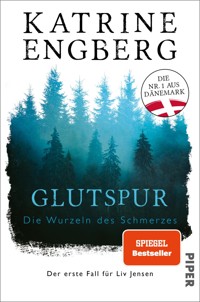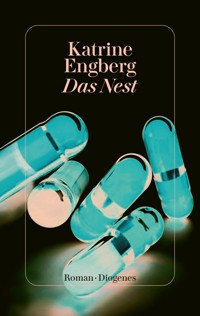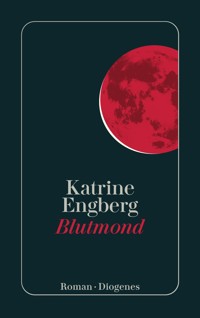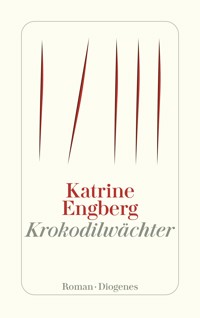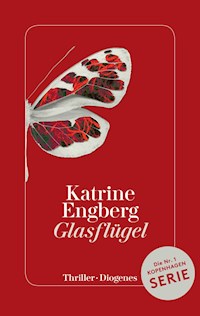
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Kørner & Werner
- Sprache: Deutsch
Jeppe Kørner ermittelt in einem spektakulären Mordfall, der ganz Kopenhagen beschäftigt: Im ältesten Brunnen der Stadt, inmitten der Fußgängerzone, wurde eine Leiche gefunden. Auf die Hilfe seiner Kollegin Anette Werner kann er diesmal nicht zählen, denn die muss sich statt um den Mordfall um ihr Baby kümmern. Bald schon stößt Kørner auf eine düstere Einrichtung für hilfsbedürftige Jugendliche und auf Leute, die ihre eigene Vorstellung von Fürsorge haben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Katrine Engberg
Glasflügel
Ein Kopenhagen-Thriller
Aus dem Dänischen von Ulrich Sonnenberg
Diogenes
Für Sysse Engberg, Heldin und Mutter
Samstag, 14. Oktober
Prolog
Die Glasampullen lagen direkt neben den Einwegspritzen und Kanülenbehältern in dem abschließbaren Schrank. Morphium und Oxycontin für starke Schmerzen, Propafenon gegen Vorhofflimmern und das blutverdünnende Pradaxa, alles war ordentlich in Pappschachteln und Folie verpackt. Die Standardmedikamente in der Kardiologischen Abteilung des Rigshospital dienten der Linderung von Schmerzen, der Verbesserung der Lebensqualität und manchmal sogar der Heilung.
Die Krankenschwester warf einen raschen Blick auf die Medikamente und rechnete. Wie schwer war er? Das Gewicht des Patienten stand auf einer Karteikarte am Kopfende des Bettes, aber sie wollte jetzt nicht im Krankenzimmer nachsehen.
Die Nacht nahm einfach kein Ende. Kurz vor Schichtwechsel hatte sich eine Kollegin krankgemeldet, und sie hatte auch den Nachtdienst übernehmen müssen. Statt den Abend mit der Familie zu verbringen, war sie jetzt seit fast sechzehn Stunden im Dienst. Ihr dröhnte der Schädel vom ständigen Klingeln der Patienten, ihren Fragen und Wünschen, in den Gesundheitslatschen schmerzten die Füße, und ihr Nacken war steif wie ein Brett. Sie gähnte, rieb sich die Augen und sah ihr Spiegelbild in der blanken Innenseite des Metallschranks. Keine zweiunddreißig Jahre alte Frau sollte chronisch so dunkle Ringe unter den Augen haben, die Arbeit machte sie kaputt. Nur noch eine Stunde, dann war ihre Schicht endlich vorbei, dann konnte sie nach Hause gehen und schlafen, während die Familie aufstand und mit Coco Pops vor dem Fernseher frühstückte.
Sie wählte drei Ampullen aus, steckte sie in die Kitteltasche und schloss den Arzneischrank wieder ab. Dreimal 50 mg/ 10 ml Ajmalin, das müsste genügen. Der Patient wog sicher nicht mehr als siebzig Kilo, dreißig Milliliter dieses Medikaments gegen Herzrhythmusstörungen entsprachen also dem Doppelten der empfohlenen Maximaldosis. Genug, um akutes Herzversagen herbeizuführen und ihn von seinen Leiden zu erlösen. Und alle anderen auch, dachte sie, als sie über den leeren Korridor zum Zimmer 8 ging. Ständig hatte der alte Mann Sonderwünsche, er fluchte und beschwerte sich über alles – vom schlechten Krankenhauskaffee bis zur Arroganz der Ärzte. Die ganze Abteilung war sein Gemecker leid.
Und sie hatte schon immer laut und deutlich ihre Meinung gesagt und die Dinge selbst in die Hand genommen. Keine Rolle, mit der man sich beliebt macht, aber was sollte sie machen? Nur passiv zusehen und wie ihre Kolleginnen über den Personalmangel und die fehlenden Bettenplätze jammern? Bestimmt nicht! Sie war nicht Krankenschwester geworden, um Kaffee zu holen und Kratzer zu verbinden. Sie wollte mehr.
Eine Putzfrau schob ihren Wagen mit Eimern und Lappen den Korridor entlang, ohne aufzublicken. Die Krankenschwester ging an ihr vorbei, ihre Hand umklammerte die Ampullen. Ihr Herz schlug jetzt schneller. Gleich würde sie etwas Außergewöhnliches tun, sie würde ihr ganzes Können zeigen und versuchen, ein Leben zu retten. Die lebhafte Erwartung löste das Gefühl der Leere ab, das sie sonst immer empfand. In diesem Augenblick war sie unentbehrlich. So viel stand auf dem Spiel, so viel lastete auf ihren Schultern. In diesem Moment war sie Gott.
Sie schloss die Tür zur Personaltoilette, wusch und desinfizierte ihre Hände und legte die Ajmalin-Ampullen sorgfältig nebeneinander. Mit routinierten Handgriffen befreite sie die Einwegspritze aus ihrer Verpackung, zog die Flüssigkeit auf, schnippte gegen die Spritze und versicherte sich routinemäßig, dass sie keine Luft mehr enthielt. Die Verpackung knüllte sie zusammen und stopfte sie im Mülleimer weit nach unten, bevor sie mit der Spritze in der Kitteltasche die Tür öffnete.
Vor Zimmer 8 warf sie einen diskreten Blick über den Flur. Keine Kollegin, kein Patient war zu sehen. Sie schob die Tür auf und trat in die Dunkelheit. Ein leises Schnarchen teilte ihr mit, dass der Patient schlief. Sie konnte in Ruhe arbeiten.
Sie trat näher und betrachtete den alten Mann, der mit leicht geöffnetem Mund auf dem Rücken lag. Grau, knochig, vertrocknet. Eine kleine Speichelblase zeigte sich in einem der Mundwinkel, die Augenlider zitterten ein wenig. Gibt es auf der Welt Überflüssigeres als mürrische alte Männer?
Sie schraubte das Einspritzventil des Venenkatheters ab, der auf seinem dünnhäutigen Handgelenk saß, und zog die Spritze aus der Tasche. Direkter Zugang zum Blut, das zum Herzen fließt, ein offenes Tor für Gottes verlängerte Fingerspitze.
Ajmalin wirkte zum Glück sehr schnell, der Herzstillstand würde beinahe augenblicklich eintreten. Sie verband die Spritze mit dem Venenkatheter und wusste, dass ihr nur wenig Zeit blieb, die Spritze zu verstecken, bevor der Überwachungsalarm ausgelöst wurde.
Der Patient bewegte sich ein wenig im Schlaf. Sie tätschelte ihm beruhigend die Hand. Dann drückte sie den Kolben der Spritze durch.
Montag, 9. Oktober
Sechs Tage zuvor
1
»Typisch!«
Frederik wischte sich den Regen von der Stirn und setzte die Mütze wieder auf. Er zog die Kapuze des Regencapes darüber, kontrollierte, ob die Satteltaschen seines Fahrrads geschlossen waren, und fuhr los. Das Aufstehen fiel ihm zwar jeden Morgen schwer, wenn der Wecker um 05:15 Uhr klingelte, aber an manchen Tagen war es schlimmer als sonst. Und bei diesem heftigen Regen wusste er nicht mehr so genau, warum er den Job als Zeitungsbote jemals angenommen hatte. Sechs Tage in der Woche, fünfzehn Wohnungen in der Kopenhagener Innenstadt, sechshundertzwanzig Treppenstufen. Leider war es die einzige Möglichkeit, um sich die Klassenfahrt leisten zu können, an der er unbedingt teilnehmen wollte.
Das Verteilzentrum der Zeitung verschwand hinter ihm in der Dunkelheit. Das Telefon in seiner Tasche pumpte ihm Musik in die Ohren, er trat energisch in die Pedale. I got my black shirt on, I got my black gloves on. Es war schon cool, die belebteste Einkaufsstraße der Stadt ganz für sich zu haben. Er fuhr die Strøget hinunter, bis sich Gammeltorv und Nytorv vor ihm öffneten. Sorgfältig renovierte, mehrstöckige Gebäude mit Sprossenfenstern und Dachrinnen aus Kupfer, die bei diesem Herbstregen überflossen, ein paar spärliche Bäume, Bänke, auf denen Abfall herumlag, und dunkelgrüne Bauzäune. Die sandfarbenen Säulen des Kopenhagener Stadtgerichts leuchteten in der morgendlichen Dunkelheit wie mahnend erhobene Zeigefinger über die uralten Kellerkneipen des Platzes.
Frederik sprang vom Rad und lehnte es an den Springbrunnen mitten auf dem Platz. Er zog die Ohrhörer heraus und kontrollierte noch einmal, ob das Geld für eine warme Zimtschnecke in seiner Jackentasche steckte. Dann warf er einen Blick auf den Brunnen, auf dessen Wasseroberfläche die Regentropfen in der Dunkelheit zerplatzten.
Irgendetwas lag im Wasser.
Es lag oft etwas im Wasser. Die Straßenkehrer holten täglich Bierdosen, Plastiktüten und unerklärlicherweise auch einzelne Schuhe aus dem Brunnenbecken.
Aber das hier war kein Schuh.
Frederik taumelte. Im ältesten Springbrunnen Kopenhagens schwamm drei Meter von ihm entfernt ein Mensch, mit dem Gesicht nach unten und zur Seite ausgestreckten Armen. Der Regen prasselte mit einem unschuldigen Geräusch auf den nackten Rücken, die Tropfen spritzten wie Hunderte kleiner selbständiger Springbrunnen in die Höhe.
Frederik war wie gelähmt. Es fühlte sich an wie in einem Alptraum. Dann schrie er: »Hilfe! Hallo, da liegt jemand im Wasser!«
Er wusste, dass er eigentlich in den Brunnen steigen, den Körper umdrehen und Erste Hilfe leisten müsste. Doch der warme Urin, der seinen Schenkel hinunterlief, bewies nur, dass er nicht in der Lage war, auch nur irgendetwas zu tun.
Frederik blickte noch einmal auf den Körper im Wasser. Diesmal wurde ihm erst wirklich klar, was er sah. Er hatte noch nie einen toten Menschen gesehen.
Mit zitternden Knien lief er zum Kiosk an der Ecke. Die automatische Tür öffnete sich, eine blonde Verkäuferin trug summend ein Tablett mit ofenwarmem Gebäck in Richtung Theke, und der Duft von Zimtbutter stieg ihm in die Nase. Von seiner Mütze tropfte es ihm in die Augen. Frederik wischte sich mit dem Handrücken Regenwasser und Tränen aus dem Gesicht und schluchzte: »Helfen Sie mir! Schnell, rufen Sie die Polizei, verdammt noch mal!«
Die Verkäuferin sah ihn mit großen Augen an. Dann ließ sie das Tablett mit den Zimtschnecken los und griff zum Telefon.
Der Himmel über Kopenhagen hatte seine Schleusen geöffnet. Die Konturen der Ziegeldächer verwischten, die Umrisse der Stadt verschwammen. Es goss wie aus Kübeln auf das alte Kopfsteinpflaster des Gammeltorv.
Polizeiassistent Jeppe Kørner kniff die Augen zusammen und wagte einen Blick nach oben. Dass es aufriss, war kaum zu erwarten. Vielleicht ging die Welt ja tatsächlich unter, und die Ozeane eroberten das Land. Er fuhr sich mit der nassen Hand übers Gesicht, unterdrückte ein Gähnen und bückte sich, um unter dem Absperrband hindurchzukriechen. Wasser drang in seine Sneakers, es schwappte bei jedem Schritt.
Durch den Regenschleier sah er in Schutzanzüge gekleidete Silhouetten, die um den Springbrunnen Zelte aufstellten. Dieselben Pavillons, die auch für Gartenfeste vermietet werden – in der Hoffnung, sie dann doch nicht zu brauchen. Jeppe suchte unter dem nächsten Zelt Schutz und schaute auf die Uhr. Es war kurz nach sieben, über der Wolkendecke ging vermutlich gerade die Sonne auf. Im Grunde war es egal. Dieser Tag würde ohnehin nur Grautöne zu bieten haben.
Im Springbrunnen vor ihm lag ein nackter Körper, der von den Arbeitslampen der Kriminaltechniker beleuchtet wurde. Jeppe beobachtete die Szenerie, während er einen Schutzanzug über seine feuchte Kleidung zog. Die Leiche lag mit dem Gesicht im Wasser wie ein Schnorchler im Meer. Der Körper einer Frau, soweit er es aufgrund von Schultern und Rücken beurteilen konnte, nackt, mittleren Alters. Graumeliertes dunkles Haar, zwischen den nassen Locken schimmerte die Kopfhaut.
»Wusstest du, dass dies der Caritasbrunnen ist?«
Jeppe drehte sich um. Hinter ihm stand Kriminaltechniker Clausen, das Gesicht von einer Kapuze umrahmt. In seinem blauen Schutzanzug sah er aus wie ein Astronaut.
»Du wirst lachen, Clausen, aber die Antwort ist nein. Noch nie gehört.«
»Caritas ist Lateinisch und bedeutet Barmherzigkeit. Deshalb ist die Figur oben auf dem Brunnen auch eine schwangere Frau. Der Inbegriff der Nächstenliebe.« Clausen rieb den Regen aus den buschigen Augenbrauen und wischte sich die Hände ab.
»Mich interessiert eher, weshalb im Becken eine Leiche schwimmt.« Jeppe wies mit dem Kopf auf den Brunnen. »Was haben wir?«
Clausen sah sich um und griff nach einem Regenschirm, der an einer der Zeltstangen lehnte. Er spannte ihn auf und trat einen vorsichtigen Schritt ins Freie.
»Scheißwetter, unmögliche Arbeitsbedingungen. Komm!«
Jeppe musste den Kopf einziehen, um seinen schlaksigen Körper der Schirmhöhe des untersetzten Clausen anzupassen. Sie blieben am Rand des Brunnens stehen und betrachteten die Leiche. Im Wasser sah die weiße Haut aus wie aus Marmor. Ein Polizeifotograf versuchte, brauchbare Winkel zu finden und gleichzeitig seine Kamera vor dem Regen zu schützen.
»Die Gerichtsmediziner müssen sie natürlich erst einmal herausholen und obduzieren, bevor wir etwas sagen können. Aber es ist eine Frau, kaukasischer Typ, mittelgroß, ich würde sagen, so um die fünfzig.« Ein Windstoß erfasste die Leiche, so dass sie mit dem Kopf gegen den Beckenrand stieß.
»Sie wurde um fünf Uhr vierzig von einem Zeitungsboten gefunden. Der Anruf bei der Alarmzentrale kam zwei Minuten später von dem Kiosk dort an der Ecke. Keine Ahnung, warum man sie noch nicht aus dem Wasser geholt hat. Der Zeitungsjunge und die Verkäuferin sitzen im Kiosk und warten auf ihre Vernehmung. Die Kioskverkäuferin kam um fünf und ist ganz sicher, dass zu diesem Zeitpunkt nichts im Wasser lag, also muss das Verbrechen heute Morgen zwischen fünf und zwanzig vor sechs stattgefunden haben.«
»Du meinst, das hier ist der Tatort?« Jeppe schlug die Kapuze zurück, um den Platz besser überblicken zu können. »Ist sie deiner Meinung nach mitten auf der Strøget ermordet worden?«
Clausen wandte sich Jeppe zu und hielt dabei seinen Regenschirm schräg, so dass Jeppe im Regen stand.
»Entschuldige, Kørner, so was Blödes! Bist du nass geworden? – Nein, ich habe mich ungenau ausgedrückt. Hier ist sie aller Wahrscheinlichkeit nach nicht ermordet worden. Aus mehreren Gründen.«
»Es wäre zu riskant …« Jeppe versuchte, die Tropfen zu ignorieren, die ihm den Nacken hinunterliefen.
»Richtig, das Risiko, dass jemand vorbeikäme, wäre zu groß. Dass es überhaupt jemand gewagt hat, eine Leiche in den Brunnen des Gammeltorv zu werfen, ist doch kaum zu fassen.« Clausen schüttelte den Kopf. »Aber nicht nur deshalb. Siehst du an den Armen die kleinen Schnitte in der Haut? Die sind nicht so leicht zu erkennen, weil sie im Wasser liegt.«
Jeppe kniff die Augen zusammen und versuchte, trotz des Regens etwas zu erkennen. Direkt an der Wasseroberfläche zeigten sich an den Handgelenken kleine parallele Schnitte in einem symmetrischen Muster. Klaffende Wunden im weißlichen Fleisch. Jeppe hatte das Bild eines verwesenden Wals am Strand vor Augen und versuchte, sein Unbehagen zu verdrängen.
»Aber es ist kein Blut im Wasser?«
»Genau!« Clausen nickte anerkennend. »Sie muss heftig geblutet haben, und doch gibt es keinerlei Blutspuren, weder im Wasser noch am Brunnen. Das hätte der Regen nicht alles wegwaschen können. Hier ist sie nicht gestorben.«
Jeppe ließ seinen Blick über die alten Hausfassaden schweifen. »Hier gibt’s ’ne Menge Überwachungskameras. Wenn der Täter die Leiche in den Brunnen geworfen hat, muss es Aufnahmen davon geben.«
»Wenn?« Clausen klang verärgert. »Sie hat sich bestimmt nicht selbst so zugerichtet und ist dann in den Brunnen gehüpft.«
»Womit wurden ihr die Schnitte beigebracht?«
»Das kann ich noch nicht sagen. Erst muss Nyboe sie auf den Tisch kriegen.« Clausen sprach von Professor Nyboe, dem Pathologen, der bei Mordfällen normalerweise die Obduktion vornahm. »Aber wie auch immer, die Mordwaffe befindet sich nicht hier auf dem Platz. Die Hunde haben eine halbe Stunde gesucht, ohne etwas zu finden. Von ihrer Kleidung auch keine Spur.«
In Jeppes Tasche brummte es. Er wischte sich die Hände am Hosenboden ab und zog das Telefon vorsichtig heraus. Auf dem Display stand Mama, er ignorierte den Anruf. Was wollte sie denn jetzt?
»Also hat jemand am frühen Morgen eine nackte Leiche über die Strøget befördert und in den Brunnen geworfen?«
»Einiges deutet darauf hin, ja.« Clausen verzog sein Gesicht zu einer entschuldigenden Grimasse, als sei er mitverantwortlich für die absurde Szenerie.
»Zum Teufel, wer kommt denn auf so eine Idee?«
Jeppe strich sich das Wasser aus dem Nacken und rieb seine brennenden Augen. Er hatte zu wenig geschlafen, noch dazu schlecht. Eine nackte Frauenleiche war nicht unbedingt das, was er sich für diesen Tag erhofft hatte.
It’s raining again. Too bad I’m losing a friend.
Supertramps Regensong schnurrte im Hinterkopf, und Jeppe ärgerte sich, dass er sich nie aussuchen durfte, von welcher Musik er gequält wurde, wenn sein Gehirn müde und gestresst war. Wie so oft waren es Fetzen ultrakommerzieller Popmusik, die sich in einer Endlosschleife unter seinen Gedanken festsetzten. It’s raining again. Oh no, my love’s at an end. Er zog die Kapuze wieder über den Kopf und ging auf den Kiosk zu, in dem der Zeitungsbote wartete.
Das Gebrüll war unerträglich. Anhaltend, laut und quälend wie ein Zahnarztbohrer. Das schlimmste Geräusch der Welt.
Polizeiassistentin Anette Werner drehte sich auf die andere Seite und kniff die Augen zu. Svend war beim Baby. Sie wollte ein wenig von dem Schlaf nachholen, den sie in der Nacht nicht bekommen hatte. Sie legte sich das Kopfkissen über den Kopf, um die Geräusche der Welt auszusperren. Sie versuchte sich vorzustellen, was sie nicht opfern würde, um endlich einmal wieder durchschlafen zu können, aber es fiel ihr nichts ein.
Im Nebenzimmer mischte sich das Weinen mit Svends beruhigender Stimme. Warum schloss er nicht die Tür? Sollte sie aufstehen und es selbst machen? Tatsächlich musste sie auch pinkeln. Vor dem 1. August dieses Jahres hätte sie eine volle Blase ignoriert und ruhig weitergeschlafen, doch nun konnte sie nicht darauf vertrauen, dass ihr geschundener vierundvierzigjähriger Körper ihr gehorchen würde.
Anette setzte sich schwerfällig auf und stieg aus dem Bett. Wann würde endlich dieses permanente Gefühl von Kater und Jetlag verschwinden?
Sie spürte jedes einzelne Glied ihres Körpers und merkte, wie ihre einst so starke Muskulatur die Knochen nicht mehr stützte. Die Brüste schmerzten. Sie sah an sich herab und stellte fest, dass sie wieder einmal ihre Schuhe nicht ausgezogen hatte. Wie ein Zombie schleppte sie sich am Kinderzimmer vorbei zur Toilette. Wie konnte Svend so ruhig und optimistisch sein? Sie schloss die Tür und betrachtete sich im Spiegel. Ich sehe aus wie eine lebendige Tote, dachte sie, als sie sich auf die Toilette setzte, wäre ich doch bloß tot.
Eigentlich war alles gut gegangen. Die Schwangerschaft war problemlos verlaufen, die Geburt rasch überstanden. Gegen alle Prognosen hatte Anette alle erdenklichen Rekorde bei Erstgebärenden über vierzig geschlagen. Doch als ihr das kleine gesunde Mädchen in die Arme gelegt wurde und sofort anfing zu trinken, hatte Anette nichts empfunden. Zu der Bindung, die eigentlich instinktiv kommen sollte, musste sie sich regelrecht zwingen, Liebe empfand sie kaum.
Bei Svend war das anders.
In den letzten zweieinhalb Monaten hatte er unendlich viel Einsatz gezeigt, und die Liebe zu dem kleinen neuen Menschen war immer größer geworden. Der Blick in seinen Augen, wenn er sie in den Armen hielt! Augen, die vor Stolz strahlten. Svend genoss das Familienleben und ging völlig in seiner Vaterrolle auf. Anette versuchte es, sie gab sich wirklich Mühe. Wenn sie nur nicht so müde gewesen wäre.
Sie legte die Arme auf die Schenkel, beugte sich vor und stützte den Kopf in die Hände.
»Schläfst du, Schatz?«
Ruckartig hob Anette den Kopf. Svends Stimme kam von der anderen Seite der Toilettentür, er schien direkt davor zu stehen.
»Ich pinkle. Kannst du nicht mal zwei Minuten warten?«
Sie hörte die Irritation in ihrer Stimme, diesen Tonfall, den sie von anderen Frauen kannte, nicht aber von sich. Sie stand auf, wusch sich die Hände und öffnete die Tür.
»Sie hat Hunger. Deshalb beruhigt sie sich nicht. Sie sucht mit dem Mund.« Svend hob ihre Tochter behutsam hoch und küsste sie auf die Stirn, bevor er sie Anette gab.
Anette streckte die Arme aus und hatte wie so oft Angst, die Kleine fallen zu lassen. Alle, die behaupten, die Aufzucht von Kindern sei der von Hunden ähnlich, haben ja keine Ahnung, ging ihr durch den Kopf, obwohl sie noch vor zweieinhalb Monaten selbst so etwas behauptet hätte. Sie betrachtete das schreiende Baby in ihren Armen.
»Ich vermisse die Jungs. Wann holen wir sie?«
Svend sah sie mit bekümmerter Miene an. »Den Hunden geht es gut. Auch noch in den nächsten Wochen. Meine Mutter bringt sie dreimal am Tag ins Moor. Wir müssen uns um Gudrun kümmern.«
»Hör auf, sie so zu nennen! Wir haben noch nicht entschieden, wie sie heißen soll.« Anette drückte sich in dem engen Flur resolut an ihrem Mann vorbei.
»Ich dachte, dir würde Gudrun gefallen?«
Anette ging zur Haustür. »Ich setze mich zum Stillen ins Auto. Sag jetzt besser nichts, ich sitze gern dort.« Sie warf die Haustür so rabiat hinter sich zu, wie es mit einem Baby im Arm nur möglich war. Lief durch den Regen zum Auto und fummelte am Schloss herum. Das Baby hörte auf zu schreien, vielleicht weil es Regen im Gesicht nicht gewohnt war.
Der Wagen roch vertraut nach Arbeit und Hund. Anette setzte sich zurecht, knöpfte die Bluse auf und legte die Tochter an ihre pralle Brust. Sie fing sofort an zu trinken. Beruhigte sich. Anette atmete schwer und versuchte, dieses anhaltende Gefühl von Stress in ihrem Körper zu ignorieren. Behutsam wischte sie die Regentropfen von der Stirn ihrer Tochter und streichelte ihr über den Kopf. Wenn sie so still dalag, war es schon sehr schön. Nur mit dem Weinen und dem fehlenden Nachtschlaf kam sie nicht zurecht. Und mit der Elternzeit. Anette vermisste ihre Arbeit.
Sie blickte hinüber zum Haus. Svend saugte oder räumte auf. Anette klappte das Handschuhfach auf und holte das Polizeiradio heraus. Eigentlich hätte es auf der Ladestation im Präsidium liegen sollen, aber Anette hatte es nicht abgeliefert. Es war eine Frage der Zeit, bis die Kollegen im Präsidium bemerkten, dass es fehlte und es abschalteten, aber solange es noch lief, genoss sie es, ein bisschen zuzuhören. Sie achtete darauf, dass der Ton leise gestellt war, damit das Baby sich nicht erschrak, und schaltete ein. Bei dem wohlbekannten Schnarren spürte Anette ein Ziehen im Bauch.
… und wir brauchen einen Wagen für die Tote am Gammeltorv. Die Leiche muss für die Obduktion zum Traumacenter transportiert werden. Die Frederiksberggade, der Gammeltorv und der Nytorv bleiben gesperrt, bis die Kriminaltechniker die Spurensicherung beendet haben …
Ein Mord am Gammeltorv? Den Fall würden ihre Kollegen übernehmen. Anette stöhnte auf. Warum musste etwas so Natürliches wie Stillen so verdammt wehtun?
… und wir brauchen die Aufnahmen sämtlicher Kameras in der Umgebung. Alle Infos an Polizeiassistent Kørner und sein Team …
Polizeiassistent Jeppe Kørner, Beamter der Abteilung für Gewaltkriminalität, besser bekannt als Mordkommission. Ihr Partner.
Kørner, jetzt ohne Werner. Werner, jetzt ohne Arbeit.
Anette schaltete das Radio aus.
»Weiß jemand, wo Saidani bleibt?«
Jeppe stellte die Frage, während er mit dem Rücken zu seinen Kollegen an einem Kabel seines Computers herumfummelte. Eigentlich hätte er am ehesten wissen können, wo sich Polizeiassistentin Sara Saidani im Augenblick aufhielt, hatte er doch den größten Teil der Nacht in ihrem Bett verbracht – nur ging ihre Beziehung vorerst niemanden in der Mordkommission etwas an. So hatten sie es vereinbart.
»Vielleicht ist eines ihrer Kinder krank? Röteln? Pest? Ihre Kinder holen sich doch ständig etwas, und dann kommt sie nicht zur Arbeit.« Polizeiassistent Thomas Larsen warf den Pappbecher, aus dem er gerade einen teuren Coffee-to-go getrunken hatte, gekonnt in den Mülleimer. Larsen hatte keine Kinder, und er verstand nicht, wie man überhaupt Kinder bekommen konnte – ein Standpunkt, den er keineswegs für sich behielt.
Jeppe sah auf die Uhr über der Tür. Fünf nach zehn. »Dann fangen wir ohne sie an.« Er justierte die Helligkeit der Bilder, die über den Flachbildschirm des Besprechungszimmers flimmerten, drehte sich um und nickte den zwölf Kollegen zu, die mit Notizbüchern auf dem Schoß aufmerksam warteten. Nicht jeden Tag wurde eine entstellte Frauenleiche in einem Brunnen auf der Strøget gefunden.
»Okay. Ich fasse zusammen: Der Anruf bei der Alarmzentrale ging um 05:42 Uhr ein, sechs Minuten später war der erste Streifenwagen vor Ort. Der wachhabende Arzt erklärte das Opfer um 06:15 Uhr für tot.« Jeppe kreuzte die Arme vor der Brust. »Lima 11 verständigte uns sofort.«
Die Tür des Besprechungszimmers wurde leise geöffnet, Sara Saidani schlich herein und setzte sich auf einen Stuhl an der Wand. Ihre nassen, dunklen Locken glänzten.
Jeppe fühlte sich plötzlich hellwach, wie immer in ihrer Nähe.
Sie.
Sara Saidani, Kollegin in der Ermittlungseinheit, Mutter von zwei Mädchen, geschieden, tunesische Wurzeln und eine Haut wie Milchschokolade.
»Willkommen, Saidani.« Jeppe warf einen Blick auf seinen Block, obwohl er genau wusste, was dort stand.
»Die Tote wurde bereits vorläufig identifiziert: Bettina Holte, Gesundheits- und Pflegeassistentin, vierundfünfzig Jahre alt, wohnhaft in Husum. Seit gestern ist sie als vermisst gemeldet und daher mit einem Foto in POLSAS, die Identifikation wurde aber noch nicht bestätigt.« Er bezog sich auf das polizeiinterne Berichtssystem, in dem sämtliche Informationen zu anhängigen und abgeschlossenen Fällen gespeichert wurden. Es klang, als sei es clever und effektiv. War es aber nicht. »Die Familie wurde gebeten, die Tote zu identifizieren, wir bekommen bald Bescheid. Die Leiche war unbekleidet und lag mit dem Kopf nach unten im Becken des Brunnens, wie ihr hier auf dem Foto sehen könnt.«
Jeppe zeigte auf das verpixelte Foto, drückte auf eine Taste und wechselte zu einer Nahaufnahme von einem weißen Körper in schwarzem Wasser.
»Laut Zeugenaussagen lag die Leiche um 05:00 Uhr noch nicht im Brunnen, daher nehmen wir an, dass sie zwischen 05:00 und 05:40 Uhr dort abgelegt wurde. Wir brauchen sämtliche Aufzeichnungen der Überwachungskameras –«
»Kørner?«
»Ja, Saidani?«
»Ich habe mir die Aufzeichnungen aus den städtischen Kameras am Gammeltorv besorgt und durchgesehen. Deshalb bin ich zu spät gekommen.« Sara Saidani hob Daumen und Zeigefinger, zwischen denen sie einen USB-Stick hielt. »Die Aufnahmen der Kamera über dem Kiosk sind gut. Spul auf 05:17 vor.«
Jeppe nahm den USB-Stick mit einem anerkennenden Nicken entgegen, klickte das File an und spulte vor. Auf dem Bildschirm sah man im Zeitraffer einen dunklen, leeren Platz, auf dem sich nichts bewegte außer einem Fahrrad, das vom Wind umgeworfen wurde. Bei 05:16 ließ Jeppe den Film in der normalen Geschwindigkeit laufen, nach einer Minute tauchte oben im Bild ein Schatten auf.
»Er kommt aus der Studiestræde auf den Brunnen zu«, rief Larsen eifrig. »Was ist das für ein Gefährt?«
»Ein Lastenfahrrad. Das sieht man doch!« Sara schnipste irritiert in Richtung Bildschirm.
Die dunkle Gestalt näherte sich dem Brunnen und der Straßenlaterne an der Frederiksberggade. Die Person fuhr tatsächlich auf einem Lastenfahrrad und trug einen dunklen Regenponcho mit Kapuze. Es war nicht zu erkennen, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelte. Am Brunnen bremste das Fahrrad, und die Gestalt stieg ab.
»Er steigt ab wie ein Mann. Er schwingt das Bein über den Sattel.« Larsen stand auf und demonstrierte, was er meinte.
Sara reagierte sofort. »So steige ich auch ab, das hat überhaupt nichts zu bedeuten. Seht euch die Pritsche an.«
Die Gestalt im Regenponcho zog ein dunkles Tuch oder eine Plastikplane von der langen, flachen Ladefläche, der tote Körper leuchtete in der Dunkelheit auf. Die Gestalt hob ihn rasch und ohne Mühe über den Beckenrand, schob ihn ins Wasser und blieb dann reglos stehen.
Jeppe zählte zwei Sekunden, fünf. »Was treibt er da?«
»Glotzt«, meinte Larsen. »Verabschiedet sich.«
Nach sieben langen Sekunden setzte die dunkle Silhouette sich auf das Lastenfahrrad und fuhr in derselben Richtung davon, aus der sie gekommen war.
Jeppe wartete einen Moment, um sicherzugehen, dass nichts mehr zu sehen war, dann stoppte er den Film. Ein Mörder auf einem Lastenfahrrad, das gab’s only in Denmark!
»Saidani, sei so nett und schick die Filme der Überwachungskameras unseren Freunden von der Kriminaltechnischen Abteilung. Und bitte sie, die übrigen Überwachungskameras in der Umgebung zu überprüfen, vielleicht finden wir heraus, woher er gekommen ist. Eigentlich müssten wir seiner Spur quer durch die Stadt folgen können.«
Saras braune Augen sahen ihn aus der zweiten Reihe an. Sie schien glücklich zu sein, ihr Gesicht strahlte vor Begeisterung. Oder vielleicht sogar Verliebtheit? Jeppe konnte den Blick nicht recht deuten, er schlug die Augen nieder, um nicht mit einem verräterischen Lächeln zu antworten.
»Wir arbeiten wie immer nach der Devise ›wie, wo und wer‹. Falck und ich bilden ein Team; Saidani, du arbeitest mit Larsen.« Larsen hob die Arme zu einer Siegerpose, und Jeppe spürte einen Anflug von Eifersucht, weil der Trottel mit Sara ein Team bilden durfte. Aber anders ging es nicht, sie wollten kein Gerede riskieren.
»Falck und ich nehmen an der Obduktion teil und verhören anschließend Bettina Holtes nächste Angehörigen. Vorausgesetzt natürlich, dass sie es tatsächlich ist. Saidani kümmert sich wie immer um Mails, Telefon und die sozialen Medien.«
Sara nickte. »Sind all ihre Sachen verschwunden? Portemonnaie, Handy, Kleidung?«
»Bisher ist nichts aufgetaucht.«
»Bittet die Angehörigen um den Computer und besorgt mir Bettina Holtes Telefonnummer, damit ich die Anrufliste einsehen kann. Vielleicht hat sie mit dem Täter kommuniziert.«
»Machen wir. Larsen übernimmt die Befragung der Zeugen und die Vernehmungen der Kollegen, Nachbarn und so weiter.«
Jeppe ließ seinen Blick über seine eigenen Leute und die Verstärkung schweifen. Sie waren bereit für die erste personalaufwendige Arbeit des Tages, die Zeugensuche.
»Wir müssen rund um den Gammeltorv Klinken putzen und sämtliche möglichen Zeugen vernehmen. Vielleicht gibt es ja einen schlaflosen Nachbarn, der um Viertel nach fünf aus dem Fenster geschaut hat.«
Ein Beamter mit Glatze reckte eine gewaltige Pranke. Jeppe kannte ihn als Morten oder Martin, einer der jungen, neu dazugekommenen Kollegen.
»Ich übernehme die Befragung.«
»Ausgezeichnet. Du berichtest direkt Polizeiassistent Larsen.« Der kahlköpfige Morten oder Martin nickte erneut.
»Wir müssen auch das Fahrrad aus dem Überwachungsvideo untersuchen. Können wir die Marke erkennen? Wo wird sie verkauft, wurde ein Fahrrad dieses Typs innerhalb der letzten Monate als gestohlen gemeldet und so weiter.«
Larsen hob die Hand, wie immer stürmisch und ehrgeizig.
Jeppe nickte ihm zu und blickte die Polizeikommissarin in der ersten Reihe an.
»PK, ich gehe davon aus, dass du die Presse informierst?«
Ihre Blicke begegneten sich. PK, wie sie genannt wurde, hatte lange damit gedroht, in Pension zu gehen, aber soweit Jeppe es beurteilen konnte, war sie frischer und tatkräftiger als je zuvor. Er ging davon aus, dass sie ihren Abschied um ein paar Jahre verschoben hatte.
Nun hielt sie wie ein Teenager den Daumen in die Luft. Für sie war eine Pressekonferenz Routine, für Jeppe eine kaum zu ertragende Quälerei.
Dankbar nickte er ihr zu.
»Noch Fragen?« Er sah sich um und ließ den Blick auf Polizeiassistent Falck ruhen, der auf seinen Tisch starrte, als würde irgendetwas absolut Unmögliches von ihm erwartet. Falck war ein älterer Ermittler, dessen Augenbrauen in ihrer Dichte und Fülle mit seinem grauen Schnauzbart konkurrierten. Sein kugelrunder Bauch wurde normalerweise von einem Paar bunter Hosenträger gebändigt, und sein Grundtempo ließ sich am ehesten als Schneckentempo beschreiben. Falck war gerade aus einer längeren, stressbedingten Krankheitspause zurückgekehrt, sah allerdings noch nicht topfit aus.
Jeppe schlug abschließend mit der Hand auf den Tisch. »Na, dann wünsche ich uns allen viel Erfolg!«
Die Polizisten erhoben sich und wandten sich mit ihren Notizbüchern und leeren Kaffeebechern der Tür zu. Sara Saidani und Thomas Larsen verließen gemeinsam den Raum, Larsen hatte ihr leger eine Hand auf die Schulter gelegt. Jeppe fuhr sich mit der Zunge über die Pustel an der Innenseite der Lippe und biss die Zähne zusammen. Nur die Polizeikommissarin und er blieben noch im Besprechungsraum.
Sie sah ihn mit ernster Miene an. »Kørner, ich muss wissen, ob du in der Lage bist, diese Ermittlung zu leiten. Bist du dazu bereit?«
»Was meinst du damit? Du hast mir den Fall doch selbst übertragen.«
Die Polizeikommissarin zog die Augenbrauen hoch. »Ich zweifle nicht an deiner Kompetenz.«
»Warum fragst du dann?«
»Beruhige dich! Ich habe bei diesem Fall nur so ein mulmiges Gefühl. Es wird nicht leicht, die Sache der Presse zu erklären. Und dir fehlt schließlich die Partnerin –«
Davor hatte sie also Angst! Dass er einer so umfangreichen Ermittlung nicht gewachsen war, ohne Anette Werner an seiner Seite zu haben. Jeppe lächelte ihr beruhigend zu.
»Mal sehen, ob der Fall nicht sogar schneller gelöst wird, wenn mir Werner nicht ständig im Weg steht?«
Die Polizeikommissarin klopfte ihm auf die Schulter und verließ den Raum. Sie sah nicht überzeugt aus.
2
»Mit wem sprichst du, Isak?«
Der blasse junge Patient blickte von seinem Buch auf und sah ihn überrascht an. »Mit niemandem. Habe ich laut geredet?«
»Ja, hast du.« Simon Hartvig lächelte beruhigend, ohne Blickkontakt aufzunehmen. Es galt, psychotische Symptome rechtzeitig zu erkennen, damit sie sich nicht verstärkten. Im Augenblick schien Isak ruhig zu sein. »Ist schon okay, lies einfach weiter.«
An den orangefarbenen Wänden des Gemeinschaftsraums hingen Filmplakate. Grease, Pretty Woman, Dumm und Dümmer. Am Kicker spielten zwei andere Patienten, und in der Ecke bastelte eine Gruppe Schlüsselringe aus Garn, ermuntert von Simons enthusiastischer Kollegin Ursula. Regen trommelte aufs Dach, es duftete nach frischgebackenem Brot, und bis zum Mittagessen dauerte es nicht mehr allzu lange. Eigentlich war es ganz gemütlich. In der Abteilung U8 waren psychisch schwerkranke Jugendliche untergebracht. Sie litten an paranoider Schizophrenie, aber an diesem ruhigen Montagvormittag hätte man die Abteilung für eine ganz normale Jugendeinrichtung halten können. Eine Einrichtung mit Gitarrenstunden und ganztägiger Betreuung, Kreativraum, Selbstgebackenem und Gittern vor den Fenstern.
Simon lehnte sich in seinem Stuhl zurück und blickte aus dem Fenster in den Klinikpark. Die Blutbuche direkt vor dem Fenster tropfte missmutig, der Garten rund um das Zentrum für Kinder- und Jugendpsychiatrie von Bispebjerg glich eher einem Friedhof als einem Bereich der Entspannung und Erholung. Es ärgerte ihn, dass die Jugendlichen keine anregendere Umgebung unter freiem Himmel hatten – Natur, mit der sich etwas anfangen ließ, in der man etwas erleben konnte. Er hatte lange darum gekämpft, einen Küchengarten anlegen zu dürfen. Die gesamte moderne Forschung zeigte deutliche Zusammenhänge zwischen Freiluftaktivitäten, gesunder Ernährung und psychischem Wohlbefinden, daher lag es doch eigentlich auf der Hand, in einer psychiatrischen Klinik einen Nutzgarten anzulegen?
Doch das System war unglaublich träge, und er war bereits mit seinem Vorschlag gescheitert, in der Kantine ökologische Kost anzubieten und einen stillgelegten Teil des Krankenhauses zu einem Aktivitätszentrum auszubauen. Diesmal rechnete er sich jedoch bessere Chancen für sein Projekt aus.
Gemeinsam mit seinem Kollegen Gorm hatte er vor einem halben Jahr eine Initiative gestartet, Briefe an den Gemeinderat geschrieben und Unterschriften von Angehörigen und Angestellten gesammelt. Es war ihnen gelungen, einhundertfünfzigtausend Kronen an Spenden für das Nutzgartenprojekt zusammenzutragen. Doch leider waren die Pläne inzwischen beim Amt für Technik und Umwelt gestrandet. Dort war man der Ansicht, das Krankenhausgelände müsse unverändert erhalten, ja, vielleicht sogar unter Denkmalschutz gestellt werden. Aber die Initiative würde nicht aufgeben, dafür würde er sorgen.
Simon ließ den Blick durch den Gemeinschaftsraum schweifen und versicherte sich, dass alle ruhig und beschäftigt waren. Die Schlüsselringgruppe hatte ihr Garn auf den Tisch gelegt und spielte stattdessen irgendein Spiel, Isak las noch immer mit angezogenen Beinen.
Betreuung hatte etwas von der Arbeit eines Handwerkers, man versuchte, einen ernsthaften Schaden mit einem Töpfchen Modellierwachs zu reparieren. Simon ging regelmäßig mit dem Gefühl nach Hause, seine Arbeit als Pädagoge sei sinnlos, da sich nichts änderte. Obwohl er noch jung war und seine Ausbildung vor noch nicht allzu langer Zeit beendet hatte, spürte er bereits, wie sich eine gewisse Resignation in ihm breitmachte. Initiative und Tatkraft fanden hier keinen guten Nährboden. Aber er wollte einfach nicht hinnehmen, dass sich die Lebensumstände der Patienten nicht verbessern ließen und das schöne Klinikgelände nicht sinnvoll genutzt werden könnte. Gerade weil er den Ort mochte und die alten Gebäude schätzte. Sie erinnerten ihn an eine vergangene Zeit, in der die Lösungen nachhaltig waren und nicht bloß Notlösungen.
Die Gesellschaft hatte sich verändert. Heute gingen die Waschmaschinen zwei Monate nach Ablauf der Garantie kaputt, Häuser wurden aus Steinwolle und Gips gebaut, und Leiden wurden mit schmerzstillenden Mitteln bekämpft, ohne zu überlegen, was den Schmerz eigentlich verursacht hatte. Symptombehandlungen.
Der Sieg der Trägheit, der Bankrott des Systems.
Er stand auf, um seine Kontrollrunde zu machen.
»Wer gewinnt? Du schummelst doch etwa nicht, Isolde? Ich behalte dich im Auge!« Er kniff Isolde in den Arm und ging schmunzelnd weiter. Jung zu sein, hatte den Vorteil, dass die Patienten mit ihm besser zurechtkamen als mit vielen seiner älteren Kollegen. Er räumte das Garn ein, obwohl die Gruppe es eigentlich selbst hätte tun müssen, und blieb dann vor Isaks Sessel stehen.
»Hast du gefrühstückt?«
Isak nickte abwesend.
Die Frage klang banal, aber Isak vergaß häufig zu essen, und dann verursachten die Psychopharmaka Übelkeit. Als er das letzte Mal sein Seroquel erbrochen hatte, war er für mehrere Stunden verschwunden. Man fand ihn auf dem Klinikgelände – und am Teich vier Enten mit abgerissenen Köpfen.
Simon begleitete Isak nun bald schon ein halbes Jahr und kannte inzwischen seine Geschichte. Die Schizophrenie war in der Pubertät ausgebrochen, doch da bei ihm schon zuvor das Asperger-Syndrom festgestellt worden war, glaubte die Familie lange, es handele sich um eine weitere Form von autistischer Störung. Es hatte zu lange gedauert, bis er die richtige Behandlung erhielt. Simon konnte zusehen, wie der letzte Rest Hoffnung in den Augen der Familie langsam, aber sicher erlosch, je schlimmer die Krankheit wurde. Inzwischen kam meist nur noch der Vater zu Besuch. Manchmal brachte er Isak eine Zeitschrift oder ein Buch mit, und immer kam er mit einem Lächeln, wie es Simon von seinem eigenen Vater nicht kannte. Isaks Eltern waren liebevolle Menschen, die ohnmächtig miterleben mussten, wie ihr Sohn immer kränker wurde und sich mehr und mehr von dem Traum entfernte, irgendwann ein normales Leben führen zu können.
»Willst du mit in den Ruheraum, wenn die anderen am Computer sitzen?«
»Ja, danke.« Isak stand abrupt auf.
Simon wusste, dass Isak den kleinen Raum mochte, den die Abteilung auf Simons Initiative hin mit Blumentapeten, Duftöl und sanfter Musik eingerichtet hatte. Dort fand er Ruhe zum Lesen, und außerdem sah er nicht, wie die anderen Patienten im Internet surften, zu dem er keinen Zugang bekam.
»Hast du dein Buch?«
Isak hielt sein zerlesenes Exemplar von Papillon hoch. Er war beinahe zwei Meter groß, mager wie ein Massai-Krieger und lief so schlaksig und unrhythmisch, als würde der Fußboden ihm bei jedem zweiten Schritt einen Stoß versetzen. Im Ruheraum ließ er sich auf einen Sitzsack fallen, zog die Beine an und las weiter.
Simon überprüfte, ob der mobile Notruf in seiner Tasche steckte. Isak war bald volljährig und musste dann in eine Einrichtung für Erwachsene integriert werden, für die er noch überhaupt nicht bereit war. Der Gedanke war unerträglich. Wo sollte er wohnen? In einer Einrichtung für psychisch Kranke mit einem einzigen pädagogischen Betreuer für zehn junge Erwachsene? Oder wenn dort kein Platz war, im Fürsorgeheim oder einem Obdachlosenasyl? Womöglich landete Isak sogar auf der Straße, und es würde ihm mit jedem Tag schlechter gehen, bis … Wie lange würde es dauern, bis es schiefging?
Zornig schloss Simon die Tür. Ihm war klar, dass er drastische Mittel anwenden musste, wenn er etwas ändern wollte.
Neben einer Oszillationssäge und einer Handsäge hingen Messer an der gefliesten Wand. Schwere, robuste Arbeitsgeräte, geschaffen, um Brustkästen aufzuschneiden und Schädel zu öffnen. Eine Welt aus Stahl, desinfizierbaren Oberflächen und klinischer Präzision, um mit allem, was der Tod hinterließ, umzugehen. Überall an den Flächen und Ecken gab es diskrete Löcher, um die Körperflüssigkeiten und die letzten Rückstände des Lebens abzuleiten. Spülschläuche und rutschfeste Fußböden, Magnettafeln und Arbeitslampen.
Jeppe Kørner warf einen Blick auf eine überdimensionierte Greifklaue, die von der Decke hing, während er die Druckknöpfe seines Schutzkittels schloss. Er bereute das Chorizo-Sandwich, das er als vorzeitiges Mittagessen gegessen hatte, der Geschmack der Wurst kam immer wieder hoch. Und der Obduktionsbereich des Rechtsmedizinischen Instituts war nicht unbedingt der Ort, an dem man gern den Geschmack von totem Fleisch im Mund hatte.
Neben ihm zog Falck eine weiße Haube über sein graues Haar und glich mehr denn je einem Teddybär aus einem Zeichentrickfilm. Als wäre Paddington in eine heruntergekühlte Welt voller Stahl und Leichen geraten, die darauf warteten, aufgeschlitzt zu werden.
»Wahrscheinlich haben sie schon angefangen.« Jeppe zeigte auf den hintersten Obduktionsraum und ging voran. Paddington trottete hinter ihm her.
Professor Nyboe stand an einer Stahlpritsche, neben ihm ein Sektionsassistent und ein Polizeifotograf. Im Licht der Operationslampe leuchtete die Haut der Leiche wie sonnenbeschienener Schnee.
»Wen haben wir denn da?« Nyboe hob den Kopf und glich mit seinem langen, runzligen Hals einer aristokratischen Schildkröte. »Kørner und Falck, tretet näher. Wir sind gerade mit den äußeren Untersuchungen fertig geworden.«
Jeppe trat an den Tisch und betrachtete den Leichnam. Die Frau lag auf dem Rücken, mit den Handflächen nach oben, nackt und bleich. Ausgeprägter Kiefer und ein vorstehendes Kinn. Die Beine waren voller Krampfadern, das Haar auf dem Kopf und am Geschlecht grau gesprenkelt und gekräuselt. In dieser wehrlosen, allerletzten körperlichen Preisgabe war jeder Makel und jede Unvollkommenheit deutlich zu erkennen. Trotzdem ging eine eigenartig zerbrechliche Schönheit von der toten Frau auf der Pritsche aus.
»Ist sie definitiv identifiziert?«
»Wie vermutet, ist es Bettina Holte, Pflegerin, vierundfünfzig, die mit ihrem Mann in Husum wohnt. Mutter von zwei Kindern. Die Familie hat die Identifikation bestätigt.«
Jeppe nickte Falck zu. »Sorgst du dafür, dass die Suche nach ihr abgebrochen wird?«
Falck trat ein paar Schritte zur Seite und fummelte an seinem Schutzkittel, um an sein Telefon zu kommen.
»Und woran ist sie gestorben?«
Nyboe rieb konzentriert mit einem Wattestäbchen an einer der Brustwarzen der Leiche und legte das Stäbchen in eine sterile Tüte, bevor er antwortete. »Sie starb an Herzversagen, Kørner, letztlich sterben wir alle daran. Willst du noch mehr wissen, bevor ich mit der Obduktion begonnen habe?«
Jeppe unterdrückte ein Seufzen. »Erzähl mir nur, was du bereits weißt. Wenn du so freundlich wärst.«
»Freundlich ist mein zweiter Name.« Nyboe nahm einen Metallstab vom Arbeitstisch hinter sich, einen dieser Teleskop-Zeigestäbe, die Grundschullehrer früher benutzten, wenn sie auf der Weltkarte die Lage von Dschibuti zeigen wollten. Nyboe richtete ihn auf das eine Handgelenk der Leiche.
»Siehst du die Schnitte? Da, da und da.« Er fuhr mit dem Stab von einem Arm zum anderen, dann zur Hüfte.
Jeppe beugte sich vor. Quer über den Handgelenken und an der linken Leiste klaffte die Haut in etwa einen Zentimeter langen Schnitten auf, die symmetrisch zueinander in parallelen Bahnen verliefen. Je zwölf kleine Schnitte, sorgfältig platziert an drei vitalen Pulsadern des Körpers.
»Bettina Holte ist verblutet. Ich habe außer diesen Schnitten keine weiteren äußeren Verletzungen gefunden. Daher kann ich das bereits jetzt mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit sagen.«
»Verblutet?« Jeppe versuchte, sich nicht von Falck ablenken zu lassen, der im Hintergrund laut telefonierte. »Handelt es sich nicht normalerweise um Selbstmord, wenn sich jemand die Pulsadern aufschneidet und verblutet?«
»Hier nicht. Ich kann dir versichern, dass dies kein Selbstmord war.« Nyboe zeigte noch einmal auf die Arme des Leichnams. »Siehst du die roten Flecken auf dem Unterarm? Die Frau war mit ein paar breiten Riemen gefesselt. Auch an den Knöcheln. Vielleicht auch an den Händen, da ist die Haut jedenfalls auch rot.« Er zeigte es.
»Wieso an den Händen?«
»Damit sie nicht das hier macht.« Nyboe hob eine Hand, die im Gummihandschuh steckte, ballte die Faust und drückte sie in Richtung Handgelenk. »Das hätte die Blutung aufgehalten. Zumindest für eine gewisse Zeit.«
Er legte den Stab beiseite und legte nachdenklich einen Finger ans Kinn.
»Die Leichenstarre könnte darauf hinweisen, dass der Tod irgendwann zwischen Mitternacht und drei Uhr morgens eingetreten ist – durch die Auskühlung nach zwei Stunden im Brunnen lässt es sich nicht ganz genau sagen –, außerdem hat die Frau flach auf dem Rücken gelegen, als sie starb. Der Täter hat sie vermutlich festgeschnallt, ihr die Pulsadern aufgeschnitten und gewartet, bis sie verblutet ist.«
Falck war wieder zu ihnen getreten und machte sich leise summend Notizen.
»Der Täter muss sie geknebelt haben. Vielleicht hat er sie auch betäubt. Sonst hätte sie sicher um Hilfe gerufen.«
»Ja, und vor Schmerzen geschrien.« Nyboe schnitt die rotlackierten Fingernägel der Frau in ein Tütchen. »Zu verbluten ist schmerzhaft. Vielleicht nicht in den ersten zehn, fünfzehn Minuten, aber wenn das Herz und die vitalen Organe aussetzen, dann tut das sehr, sehr weh. Und bei diesen Schnitten dürfte es ungefähr eine halbe Stunde gedauert haben, bis sie starb. Es wäre schneller gegangen, hätte er ihr die Pulsader am Hals durchgeschnitten.«
»Also sollte es lange dauern?«
Nyboe nickte nachdenklich und verschloss das Nageltütchen. »Das war offensichtlich beabsichtigt, ja.«
»Grässlich!« Jeppe schüttelte sich vor Unbehagen. »Dann hat er sie sicher auch nicht betäubt.«
»Das wird der toxikologische Bericht zeigen, aber vermutlich hast du recht.« Nyboe klappte seine Stirnlampe herunter und öffnete mit Mühe den Mund der Leiche. »Keine unmittelbaren Zahnschäden, aber deshalb kann sie trotzdem geknebelt worden sein, zum Beispiel mit einer zusammengeknüllten Plastiktüte oder einem weichen Ball. Es ist nicht schwer, einen Menschen am Schreien zu hindern.«
Jeppe schloss die Augen und versuchte, es sich vorzustellen. Die Frau ausgezogen und gefesselt, blutend und außerstande, ihre Schmerzen hinauszuschreien, während das Leben sie langsam und schmerzhaft verließ. »Gibt’s Anzeichen von irgendetwas Sexuellem?«
Nyboe steckte ein sehr langes Wattestäbchen in den Hals der Leiche und reichte es dem Sektionsassistenten, bevor er antwortete. »Nicht unmittelbar. Es läge eigentlich auf der Hand, zumal sie nackt gefunden wurde, aber es gibt weder Hinweise auf Gegenwehr noch auf Penetration oder Sperma in den Körperöffnungen.«
»Okay.« Jeppe beugte sich erneut über die Pritsche und blickte auf das Handgelenk der Frau. »Warum so viele Schnitte? Warum hat der Täter ihr nicht einfach die Pulsadern durchtrennt?«
Nyboe drehte sich um und suchte etwas auf seinem Arbeitstisch. »Aha, Kørner, jetzt fragst du ausnahmsweise mal etwas Relevantes.« Er griff nach einem Skalpell. »Ich weiß es nicht. Zunächst würde ich gern wissen, womit die Schnitte überhaupt ausgeführt wurden.«
Der Sektionsassistent hob den Kopf der Frau an, und Nyboe durchtrennte den Nacken, legte das Skalpell beiseite und drückte das Gesicht der Toten zur Brust. Jeppe wusste, dass Nyboe als Nächstes den Schädel aufsägen würde, um das Gehirn zu entnehmen, das gewogen, in Scheiben geschnitten und untersucht werden musste. Am Ende würde man es zu den anderen Organen in den Bauch legen und die Haut zusammennähen. Der Schädel würde mit Zellstoff und Löschpapier gefüllt. Würde man das Gehirn zurück in den Schädel legen, bestünde die Gefahr, dass während der Beisetzung Flüssigkeit austritt.
»Zeig mir mal deine Hand!«
Jeppe streckte ihm den Arm hin, quer über den gesichtslosen Leichnam auf der Pritsche. »Was hast du vor?«
Nyboe schob Jeppes Ärmel zurück, drehte die Handfläche um und setzte die Schneide eines kleineren Skalpells auf die dünne Haut des Handgelenks.
»Ich glaube nicht, dass ich so symmetrische Schnitte hinbekäme, egal, wie viel Mühe ich mir geben würde. Nicht einmal mit dem kleinsten Skalpell.«
Jeppe zog die Hand zurück und schob den Ärmel hinunter. »Mit anderen Worten: Wir suchen nach einer besonderen Mordwaffe?«
»Ja, Kørner, ganz genau.« Nyboe wedelte mit dem Skalpell in der Hand, das in dem kräftigen Licht aufblitzte. »Wir suchen nach einer besonderen Mordwaffe.«
»Selbstmordgedanken?«
Esther de Laurenti wiederholte die Frage.
Der Psychiater betrachtete sie mit einer professionellen Falte über der randlosen Brille, und sie überlegte noch einmal, ob sie, eine Frau von neunundsechzig Jahren, einen so jungen Arzt überhaupt ernst nehmen konnte. Wie alt mochte er sein? Anfang dreißig?
Esther sah sich in der Praxis um und wich seinem besorgten Blick geschickt aus. Hinter dem Schreibtisch sah man durch ein Fenster auf den Sankt Annæ Plads. An der Wand stand eine Vitrine aus poliertem Walnussholz voller Fachbücher über Psychiatrie und Medizin, an den übrigen Wänden hing moderne Kunst, davor standen Schaukästen mit aufgespießten Schmetterlingen.
»Haben Sie Selbstmordgedanken?«
Sie hatte offenbar zu lange nachgedacht. Esther fiel auf, dass er die Frage beim zweiten Mal lauter gestellt hatte, möglicherweise hielt er sie für schwerhörig. Sie entschied, ihn nicht zu mögen. Ohnehin hatte es sie Überwindung gekostet, ihn aufzusuchen. Einige ihrer alten Freunde aus der Universität hatten diesen Arzt sehr empfohlen, andere lehnten seine Methoden kategorisch ab. Der junge Peter Demant war ein Psychiater, der polarisierte.
Esther konzentrierte sich. »Nein … äh, also nein, schon seit langem nicht mehr.«
»Aber der Gedanke ist Ihnen nicht fremd?« Wie ein Anwalt im Kino zeigte er mit seinem dicken Montblanc-Kugelschreiber auf sie.
»Wie gesagt, vor einem Jahr hatte ich ein fürchterliches Erlebnis, bei dem ich zwei Menschen verloren habe, die mir sehr nahestanden. Und nach dieser Geschichte …« Esther griff nach dem Wasserglas, trank einen Schluck und stellte das Glas wieder ab. »In der Zeit danach gab es ein paar sehr dunkle Phasen. Aber das ist lange her. Um Ihre Frage im Präsens zu beantworten: Nein, ich habe keine Selbstmordgedanken.«
Er notierte etwas auf seinem Block und betrachtete sie über seine Brillengläser hinweg. »Dennoch sind Sie zu mir gekommen. Warum?«
Ja, warum eigentlich? Esther war nicht im eigentlichen Sinn depressiv. Nur vergingen die Tage, ohne dass etwas Besonderes geschah. Sie hatte sich als Literaturwissenschaftsdozentin der Kopenhagener Universität pensionieren lassen. Wohnte sehr zentral am Peblinge Dossering in einer schönen Eigentumswohnung, die sie sich mit ihrem alten Freund und Mieter Gregers und den beiden Möpsen Dóxa und Epistéme teilte. Esther hatte genügend Geld, war körperlich einigermaßen in Form und hatte jede Menge Zeit, um ihre schriftstellerischen Ambitionen zu realisieren. Allerdings brachte sie nichts Vernünftiges zu Papier. Ein Tag löste den anderen mit so alltäglichen Dingen wie Einkaufen, Spazierengehen, Zeitunglesen und abendlichen Einladungen ab. Im Grunde ereignete sich nichts. Die Tage vergingen einfach.
»Ich habe das Gefühl, als sei ich innerlich erstarrt. Steckengeblieben. Mir geht es nicht schlecht, ich bin nur nicht wirklich glücklich. Verstehen Sie, was ich meine?«
Der Psychiater legte den Kopf schräg, auf seinem runden, glattrasierten Gesicht zeigte sich ein Lächeln, das rasch wieder verschwand. »Ja, natürlich, und Sie sind bei weitem nicht die Einzige, der es so ergeht. Depression ist eine Volkskrankheit.«
Esther schüttelte überrascht den Kopf, ihre Ohrringe klirrten. »Ich bin nicht depressiv, nur … steckengeblieben.«
»Können Sie es näher beschreiben?«
Sie wählte ihre Worte sorgfältig, bevor sie antwortete. »Wenn man so will, ging im letzten Sommer etwas in mir kaputt, und es ist schwer, die Bruchstücke wieder zusammenzufügen. Es ist nicht so, dass ich mich ständig niedergeschlagen fühle, nur –«
»Schlaflosigkeit? Wie schlafen Sie nachts?«
»Na ja, ich wache gegen drei oder vier Uhr auf.«
»Und wie sieht’s mit dem Appetit aus?«
Esther zuckte die Achseln. Sie hatte im Laufe der letzten paar Monate tatsächlich vier Kilo abgenommen und kaum Appetit.
Der Psychiater nahm in einer einstudierten Bewegung, die Autorität ausstrahlen sollte, die Brille ab und sah sie mit einem ernsten Gesichtsausdruck an. Esther durchschaute die Absicht, musste aber feststellen, dass es funktionierte.
»Es gab eine tiefgreifende Veränderung in Ihrem Leben. Sie wurden pensioniert und haben danach zwei Todesfälle erlebt. Essen und Schlafen fällt Ihnen schwer, Sie empfinden ein generelles Gefühl der Niedergeschlagenheit. Habe ich das richtig verstanden?«
»Ja, ich denke schon.«
»Ich finde, das klingt, als wären Sie traumatisiert. Möglicherweise fühlen Sie sich zwar nicht depressiv, aber meine Vermutung ist, dass Sie es gewohnt sind, die Zähne zusammenzubeißen und sich durch den Tag zu kämpfen. Gleichzeitig sind Sie jemand, den ich spätreif nenne. Ein Typ, der sich nicht von schwierigen oder traurigen Ereignissen bestimmen lassen möchte und der sich weigert, als Opfer zu gelten. Jemand, der sich nicht nach unten ziehen lässt, sondern immer wieder obenauf schwimmt wie ein Korken.«
Esther spürte, wie ein Gefühl des Unbehagens sich in ihr ausbreitete. Sie wandte den Kopf ab, ihr Blick glitt über die Wände. Wer zum Teufel sammelte aufgespießte Schmetterlinge?
»Aber jetzt holt Sie das Trauma ein. Das ist bei nicht aufgearbeiteten Gefühlen die Regel.« Peter Demant setzte die Brille wieder auf. »Ich schlage vor, wir vereinbaren im Laufe des Herbsts einige Sitzungen. Sie kommen alle vierzehn Tage, damit wir dem, was Sie belastet, auf den Grund gehen können.«
Esther hob eine Hand. »Können mir Tabletten helfen? Eine Glückspille?«
»Sie meinen Antidepressiva?« Er legte den Block auf den blankpolierten Schreibtisch und verzog den Mund zu einem schiefen Lächeln. »Sie machen nicht glücklich, sie bieten lediglich Linderung. Und ich verschreibe sie nicht, bevor ich mir nicht einen Überblick über den Zustand des Patienten verschafft habe.«
»Es ist ja nicht so, dass ich keine Therapie möchte, ich habe nur –«
»Niemand zwingt Sie zu irgendetwas. Wenn Sie meinen Rat hören wollen, dann ist eine Therapie der richtige Weg. Jedenfalls vorläufig.« Er erhob sich. »Wenn Sie die Behandlung fortsetzen möchten, vereinbaren Sie einen Termin in ein paar Wochen. Lassen Sie nicht zu viel Zeit verstreichen.«
Peter Demant ging um seinen Schreibtisch herum und öffnete die Tür zum Vorzimmer. An der Tür gab er ihr die Hand.
»Vielen Dank.«
Esther wurde der lächelnden Praxishelferin überlassen, die das Kartenlesegerät bereithielt. Esther holte ihr Portemonnaie aus der Tasche und gab den PIN-Code ein, den Betrag sah sie nur aus den Augenwinkeln. Sie erhielt eine Quittung, verließ die Praxis und registrierte die vergoldeten Stuckaturen des imposanten Treppenaufgangs.
Eine Dreiviertelstunde war sie dort gewesen, eigentlich müsste sie toben über den vierstelligen Kronenbetrag auf der Quittung. Normalerweise hätte sie auch getobt, normalerweise hätte sie gegen solchen Wucher protestiert. Sie umklammerte das Geländer und lief rasch hinunter, sie musste an die frische Luft. Vielleicht war eine Therapie aber doch der richtige Weg, wenn auch ein anstrengender und kostspieliger. Hatte sie sich nicht einfach aus kindlicher Eitelkeit so vorgeführt gefühlt, beinahe gedemütigt? Weil der Psychiater seiner Diagnose so sicher war, dass er sie augenblicklich stellen konnte? Offensichtlich sah man ihr ihren Zustand an.
Der Sankt Annæ Plads empfing sie mit dunklen Wolken und Pfützen auf den breiten Bürgersteigen. Esther ließ die Haustür mit einem dumpfen Schlag hinter sich zufallen und trat auf die Straße. Sie schloss einen Moment die Augen und atmete tief durch, bevor sie weiterging. Auf der gegenüberliegenden Seite des Platzes gab es eine Saftbar. Sie betrat das Lokal, in dem ein dröhnender Bass pumpte. Die Gäste saßen auf Barhockern und übertönten mit ihren Stimmen die laute Musik, als wäre alles in bester Ordnung. Esther stellte sich in die Schlange und beobachtete den jungen Mann hinter der Bar, der mit Äpfeln jonglierte und den weiblichen Gästen keck zublinzelte. Es wirkte gekünstelt. Trotzdem hatte es etwas sonderbar Beruhigendes.
Sie bestellte einen Smoothie, der junge Mann quittierte ihre Bestellung mit einem flirtenden Lächeln. Sie war bestimmt dreimal so alt wie er. Seine blauen Augen strahlten vor Selbstvertrauen und Fröhlichkeit, und das war ansteckend. Als Esther ihr Portemonnaie aus der Tasche zog, bemerkte sie, dass sie noch immer Demants Quittung in ihrer Hand zerknüllt hielt. Ohne nachzudenken warf sie den Zettel in das Glas, das für Trinkgelder und Telefonnummern hübscher Mädchen gedacht war. Dann lächelte sie zurück.
3
Das weiß verputzte Einfamilienhaus der Familie Holte lag in einem friedlichen Wohnviertel südöstlich des Husum Torv. Am Ende einer langen Einfahrt wurde man von einem soliden Carport aus dunklen Edelhölzern, von Lavendeltöpfen und einem frisch gestrichenen Zaun begrüßt. Hier wohnte ganz offensichtlich eine Familie, die ihr Heim mochte und dafür Zeit und Mühe aufwendete. Zwischen den Platten des Gartenwegs war kein bisschen Moos zu sehen, und die Beete waren gepflegt. Jeppe und Polizeiassistent Falck traten auf die weiße Haustür zu.
Bettina & Michael stand auf dem blankgeputzten Messingschild unter der Klingel. Jeppe drückte sie und trat, als die Tür geöffnet wurde, einen Schritt zurück. Eine Frau blickte sie unter einem sehr langen Pony aus verheulten Augen an. Sie schüttelte den Kopf, als sie die beiden Polizisten sah, und fing wieder an zu weinen. Als würde deren Anwesenheit die Sache realer und damit auch schmerzhafter werden lassen.
»Guten Tag, wir sind von der Abteilung für Gewaltkriminalität. Wir würden gern mit Michael –«
Die Frau drehte sich um und ging einfach davon, doch nach ein paar Schritten schien sie zu merken, dass ihr Verhalten unhöflich war, und kam zurück.
»Entschuldigen Sie. Kommen Sie herein, ich bin Michaels Schwester. Rikke. Normalerweise zieht man hier im Haus die Schuhe aus, aber … treten Sie sich die Schuhe bitte gut ab. Bettina –« Sie hielt inne, blickte auf den blankgescheuerten Holzfußboden und ging dann in eine Küche, die den größten Teil der Grundfläche des Hauses einnahm. Die Wände waren weiß und schmucklos, auf den Fensterbänken stand nichts Überflüssiges, alles war sehr sauber. Das Haus wirkte funktional, aber nicht sonderlich einladend.
Der Mann, der an einer Kücheninsel in der Mitte des Raumes saß, wirkte wie eine unmittelbare Fortsetzung des Hauses. Graumeliertes Haar, eine ordentliche Frisur, glattrasierte Wangen und das diskrete Logo einer Automarke auf seinem weißen Hemd.
»Michael, hier ist die Polizei.«