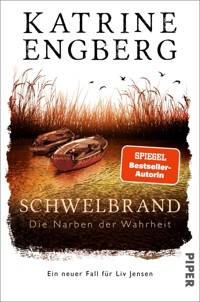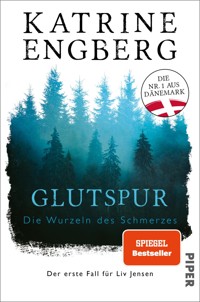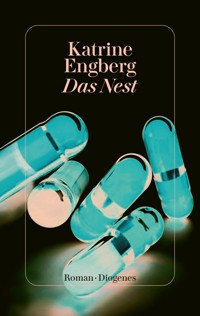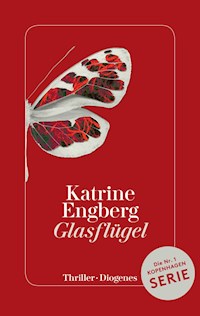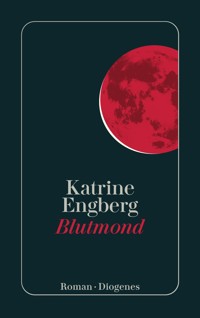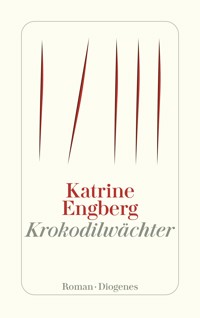11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kørner & Werner
- Sprache: Deutsch
In Kopenhagen wird in einem alten Koffer die Hälfte einer Leiche gefunden. Anette Werner muss den grausamen Mord allein aufklären, denn ihr Kollege Jeppe Kørner nimmt gerade eine Auszeit vom Polizistendasein und ist für den Winter nach Bornholm gezogen. Doch bald holt ihn sein Beruf wieder ein, denn alle Spuren führen auf die abgelegene Insel – und tief in die Vergangenheit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 432
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Katrine Engberg
Wintersonne
Der Kopenhagen-Krimi
Roman
Aus dem Dänischen von Ulrich Sonnenberg
Diogenes
Für Laura Höger,
meine geliebte Schwester und Verbündete.
Es war der Lärm, der ihn weckte. Ein stampfender Rhythmus, wie eine Lokomotive mit hohem Tempo. Er wollte zurück in den Schlaf abtauchen, das dröhnende Geräusch an seinen Trommelfellen zwang ihn jedoch zurück ins Bewusstsein. Unruhig drehte er sich um und spürte einen schneidenden Schmerz im Hinterkopf. Er versuchte die Augen zu öffnen, sie klebten zusammen, und als er eine Hand heben wollte, um sie zu reiben, gehorchte sie nicht.
Das ist einer dieser Albträume, dachte er, in denen ich glaube, wach zu sein. Gleich werde ich wirklich aufwachen, aufstehen und den Tag beginnen. Er wiederholte den Satz wie ein Mantra, er wollte die Kontrolle zurückgewinnen, doch er wusste, dass es nicht stimmte.
Vorsichtig ballte er die Faust und spürte zu seiner Erleichterung, dass die Finger reagierten. Das Gefühl währte jedoch nicht lange. Ein Kabelbinder schnitt in sein Handgelenk, er war gefesselt.
Er blinzelte und zwang sich, die Augen zu öffnen. Sein Blick war verschleiert wie eine fettige Kameralinse, er lag auf der Seite und sah nur sparsames Licht und in der Ferne Bäume. Etwas, das einer Gestalt ähnelte. Wo war er?
Er konnte sich nur daran erinnern, dass er irgendwo an einem Grünstreifen geparkt hatte. Unter einem blauschwarzen Himmel war er durch hohes Gras an mehreren Gebäuden vorbeigelaufen und hatte nasse Hosenbeine bekommen. War er nicht hierhergekommen, um irgendetwas zu finden? Soweit er sich erinnern konnte, war er durch das Tor eines großen Gebäudes gegangen. Und dann?
Schmerz flammte vom Hinterkopf auf, das Nachdenken fiel ihm schwer. Der Lärm nahm ihm die letzte Konzentration. Hatte man ihn niedergeschlagen?
Er mobilisierte seine ganze Kraft, hob den Kopf und blickte auf seine Füße. Nicht weit von seinen Fußsohlen entfernt flimmerte ein schwaches Licht im Takt des Lärms, und in einem klaren Moment wurde ihm bewusst, worum es sich handelte. Eine eingeschaltete Säge. Und er glitt darauf zu.
Ein Schrei übertönte den Lärm. Mehrere Sekunden vergingen, bevor ihm klar wurde, dass er selbst geschrien hatte. Vergeblich zerrte er an den Kabelbindern. Sie gaben nicht nach, er war gefesselt und dem Sägeblatt preisgegeben, das nur noch einen halben Meter von seinen Füßen entfernt war. Panisch warf er sich von einer Seite auf die andere, die Schultern hämmerten auf die Unterlage, Blut tropfte aus der Wunde an seinem Kopf. Es musste doch möglich sein, einen Arm zu befreien.
Wenn er doch nur richtig sehen könnte, dann ließen sich die Kabelbinder um seine Handgelenke vielleicht lösen, vielleicht konnte er die Säge stoppen. Aber er hatte keine Chance. Es war das Ende.
Er schrie um Hilfe, ein Raubtiergebrüll, und bekam keine Antwort.
Montag, 18. November
1
Auf den ersten Blick sah der Koffer aus wie aus einem alten Film. Ein großer viereckiger Reisekoffer mit Verstärkungen an den Ecken und einem breiten Handgriff mit verrosteten Metallbefestigungen. Er lag zwischen dürren Schneebeerenbüschen, die feuchte Erde hatte das Leder verfärbt und die Aufkleber mit Erinnerungen an Hotels in Trondheim und Hannover aufgeweicht.
Anette Werner, Ermittlerin der Abteilung für Gewaltkriminalität, richtete sich auf und blickte auf den Hügel hinter dem Spielplatz der Østre Anlæg. Sie sah eine Bank und einen einsamen Baum, dessen Silhouette sich vor den tief hängenden Wolken abzeichnete. Normalerweise vermieden es die Kinder auf dem Spielplatz, den Hügel hinaufzugehen. Häufig hielten sich dort Leute auf, die Spritzen und Kondome hinterließen, es war besser, ihnen nicht zu nahe zu kommen.
Oben auf der Grasfläche telefonierte der zentrale Ermittlungsleiter, den der Wachhabende alarmiert hatte, mit Kriminaltechnikern und Rechtsmedizinern. Er hatte die Schultern hochgezogen, sein Regenmantel beulte sich über dem Rücken. Zwei Steintreppen führten den Hang hinauf, beide waren mit rot-weiß gestreiftem Flatterband abgesperrt. An der hinteren Treppe stand einer der beiden jungen Beamten, die um Unterstützung gebeten hatten, und achtete darauf, dass sich niemand dem Fundort näherte.
Anette Werner wandte sich wieder dem Koffer zu, schob einen tropfenden Zweig beiseite und hockte sich im Gebüsch neben den anderen Beamten. Der matschige Boden zwischen den Büschen gab die Wurzeln der umstehenden Bäume frei, deren letzte gelbe Blätter kraftlos von den Zweigen hingen.
»Wer hat den Koffer gefunden?« Sie verlor beinahe das Gleichgewicht und griff nach der Schulter des Beamten.
»Erstklässler der Krebs’ Schule. Sie spielen in ihren Pausen gern auf dem Spielplatz und sind hier hochgelaufen, obwohl sie das eigentlich nicht dürfen. Der Koffer war mit Erde bedeckt, aber eine Ecke ragte heraus.« Der junge Beamte zeigte auf die obere rechte Ecke.
»Vielleicht ein Fuchs?«
»Möglich. Die Kinder haben ihre Lehrerin geholt, die der Gestank alarmiert hat. Sie hat die 112 angerufen.«
Der Gestank. Anette roch feuchte Erde und herbstliche Fäule. Die herabgefallenen Blätter wurden bereits zu Humus, Pilze wuchsen. Eine Note von verdorbenem Fleisch lag wie eine süßliche Basis unter den Novembergerüchen.
»Nachdem wir ankamen, haben wir vorsichtig die Erde um den Koffer entfernt, um ihn zu öffnen, aber –« Der junge Beamte räusperte sich unsicher. »Na ja, es ist noch nicht so lange her, dass ich die Polizeischule beendet habe. Wir haben an Obduktionen teilnehmen müssen, und den Leichengeruch vergisst man nicht so schnell.«
Anette warf ihm einen Blick zu. »Ihr habt ihn also nicht geöffnet?«
»Wir haben den Deckel nur kurz angehoben, und dann die Kripo gerufen.«
»Ausgezeichnet.«
Auf dem Spielplatz war Kindergeschrei zu hören. Der Beamte reagierte nervös. »Wir haben es nicht geschafft, alles ordentlich abzusperren, bis ihr gekommen seid. Wir waren ja nur zu zweit.«
»Ja, man kann beinahe das Rascheln ihrer Overalls hören.« Anette zog ein paar Latexhandschuhe aus der Tasche und streifte sie über. Ihre Tochter Gudrun hatte gerade einen neuen Winter-Overall bekommen, himmelblau mit weißen Wölkchen. Ihre blonden Locken hingen jedes Mal im Reißverschluss fest, wenn sie den Anzug selbst zuzog. Gudrun und Anettes Mann Svend waren gestern eine Woche zu Svends Schwester nach Kerteminde gefahren. Anette vermisste die beiden bereits, als der Wagen aus der Einfahrt fuhr.
»Ich öffne den Koffer jetzt, um ganz sicherzugehen, dass wir die Maschinerie nicht unnötig in Gang setzen.«
»Also, ich habe da überhaupt keinen Zweifel«, protestierte der Beamte und wischte seine tropfende Nase mit dem Handrücken ab.
Anette fasste an die Unterkante des Kofferdeckels und spürte die Kälte an ihren Fingerspitzen. Noch hatte es keinen Frost gegeben, nicht einmal nachts, aber die Luft war schon gesättigt von der charakteristischen dänischen Feuchtigkeit, die im Winter durch Mark und Bein geht und Hände und Füße lähmt.
Die Scharniere knarrten, und sie hörte, wie der Beamte neben ihr nach Luft schnappte. In dem Koffer lag ein Körper. Braunlilafarbene Haut mit weißen, schimmelig aussehenden Flecken. Anette musste nur eine Sekunde hinsehen, um zu erkennen, dass es sich um einen Menschen handelte. Allerdings hatte er nur einen Arm und ein Bein. Der Kopf lag in einer der Ecken und war längs zerteilt.
Instinktiv wandte sie den Blick von der Leiche ab. Der Himmel über ihr war grau, die Luft voller feiner, kleiner Wasserperlen. Der Gestank war unbeschreiblich. Ein gutturales Geräusch entfuhr dem jungen Beamten. Anette schloss hastig den Deckel, bevor er sich übergab.
»Aus der Erde sind wir genommen.« Der Pastor steckte die kleine Schaufel in einen Haufen Erde und schüttete etwas davon vorsichtig auf den weißen Sarg, während er mit dem Zeigefinger der anderen Hand seine Brille den Nasenrücken hochschob. »Zur Erde sollen wir wieder werden. Der Herr möge dich auferwecken am Jüngsten Tag.«
Die kleine Versammlung rund um das Grab stand reglos im Nieselregen und verfolgte das Ritual. Jeppe Kørner legte den Arm um Esther de Laurenti und spürte, wie ihr schmächtiger Körper unter dem Mantel zitterte. Jeppe hatte geholfen, den Sarg zu tragen, seine Hand schmerzte. Abgesehen von Esther und ihm selbst waren nur ein paar alte Kollegen des Verstorbenen und ältere Bekannte erschienen. Die drei erwachsenen Kinder und wer weiß wie viele Enkel und Urenkel fehlten. Seit einer hässlichen Scheidung vor vielen Jahren hatte es keine Versöhnung gegeben. Und nun auch kein letzter Abschied.
Gregers Hermansen hatte in dieser Welt keine tiefen Spuren hinterlassen.
Der Pastor betete ein Vaterunser und sprach einen Segen, Jeppes Hals schnürte sich zusammen. Ihn überkam eine gewaltige Tristesse, als er an Gregers’ und seine eigene Bedeutungslosigkeit dachte, an das flüchtige Dasein auf dieser Erde. Im Frühjahr hatten die Ärzte bei Gregers Lungenkrebs diagnostiziert, im Hochsommer hatten sie die Behandlung aufgegeben. Nun stand der Winter kurz bevor, und Gregers Hermansen, der pensionierte Typograf, Esthers Mitbewohner und Vater von drei Kindern, zu denen er keinen Kontakt mehr gehabt hatte, wurde begraben.
Esther hatte sich bis zuletzt in ihrer Wohnung um ihn gekümmert, er sollte nicht in einem Hospiz sterben. Jeppe hatte nicht die Fantasie, sich vorzustellen, wie hart es gewesen sein musste, aber er spürte, dass ihre ohnehin schmächtige Gestalt noch kleiner geworden war. Auch schien es, als schimmerte mehr Grau in den hennagefärbten Haaren.
Wir sind nur Gast auf Erden und wandern ohne Ruh
mit mancherlei Beschwerden der ewigen Heimat zu –
Die Stimmen der kleinen Trauergemeinde gingen zwischen den Grabsteinen unter. Jeppes Zehen waren gefühllos in seinen dünnen Lederschuhen, als sie sich verabschiedeten und aufbrachen. Esther war erst ein paar Meter gegangen, als sie sich zu ihm umdrehte. Er nahm sie in den Arm und ließ sie an seiner Brust weinen, bis sie sich einigermaßen beruhigt hatte.
Gemeinsam gingen sie den asphaltierten Weg zum nächstgelegenen Ausgang des Friedhofs.
»Kein Leichenschmaus?«
Sie schüttelte den Kopf. »Ich habe Jakob angerufen, seinen ältesten Sohn, aber die Familie wünscht nicht teilzunehmen, hieß es. Und Gregers’ alte Kollegen kenne ich nicht, ich hatte also niemanden, der es hätte organisieren können.«
»Gibt’s hier am Tagensvej nicht ein Café? Ich spendiere uns ein Mittagessen.« Er lächelte ihr zu.
Sie hatte sich wie gewöhnlich sehr bunt angezogen, mit einem blauen Wollmantel und einer orangefarbenen Seidenbluse, aber ihr Gesichtsausdruck war düster.
»Wir können es auch nur bei einem Kaffee belassen, wie du willst.«
»Ein Glas Wein wäre mir am liebsten, auch wenn es noch früh am Tag ist.«
»Dann machen wir das.«
Das Café war hell und hatte eine große Fensterfront zur Straße, es war mit Wiener Caféhausstühlen und eng beieinanderstehenden Marmortischen eingerichtet. Abgesehen von einem schläfrigen Kellner war es leer. Sie setzten sich ans Fenster. Der Kellner erhob sich und fing an, nach Speisekarten zu suchen.
»Ich glaube, ich bin nicht mehr ausgegangen, seit Gregers krank wurde. Und jetzt –«
Jeppe wollte gerade sagen, das Leben würde doch weitergehen, aber er bremste sich. Das Letzte, was Trauernde brauchen, ist die Erinnerung daran, dass die Welt sich – gleichgültig gegenüber persönlichem Unglück – unverdrossen weiterdreht.
Der Kellner legte die Speisekarten auf den Tisch und begann, die Tagesgerichte aufzuzählen. Jeppe unterbrach ihn.
»Wir fangen mit einer Flasche vom Rotwein des Hauses und etwas Wasser an, danke. Dann schauen wir, ob wir noch etwas essen möchten.« Jeppe wartete, bis der Kellner hinter der Bar verschwunden war, bevor er nach Esthers Hand griff. »Es muss hart gewesen sein, ihn allein zu pflegen.«
Sie lächelte. »Täglich kam eine ambulante Krankenpflegerin, es gab also Pausen. Für Gregers war es schlimmer als für mich. So abhängig von fremder Hilfe zu sein.«
»Trotzdem –«
»Weißt du, was hart war?« Ihr Blick wanderte auf die Straße und wieder zurück. »Dass es keine Hoffnung mehr gab. Nach der Tomografie in Herlev, als sie sahen, dass der Krebs seine Metastasen bereits ins Gehirn gestreut hatte, war es nur noch eine Frage von Wochen. Ich glaube, ich war bis dahin ziemlich gut gewesen, wenn es darum ging, Gregers bei Laune zu halten, auch als er weder essen noch schlafen konnte. Aber diese Diagnose hat uns beide gebrochen. Wie soll man jemandem Mut zusprechen, wenn es keine Hoffnung auf Besserung gibt?«
Ein Metallverschluss wurde aufgeschraubt. Der Kellner schenkte ihnen Wein ein, stellte die Flasche schwungvoll auf den Tisch und verschwand, bevor sie ihn an das Wasser erinnern konnten, das er vergessen hatte.
Jeppe holte eine Blisterpackung Schmerztabletten aus der Tasche und spülte zwei Tabletten diskret mit einem Schluck lauwarmem mittelmäßigem Rotwein hinunter. Esther sah nicht so aus, als würde ihr der Wein nicht schmecken.
»In Wahrheit sind wir doch alle sterblich«, versuchte er es.
»Ja, aber wir glauben, unsterblich zu sein. Genau das lässt uns all das Sinnlose überstehen: Irgendwie sind wir davon überzeugt, dass ausgerechnet uns der Tod nicht trifft. Sobald es ein Enddatum gibt, wird das Leben komplett absurd. Vor allem, wenn man Schmerzen hat.«
Ihre Stimme war bei den letzten Worten brüchig geworden.
»Hatte er starke Schmerzen?«
Esther trank und stellte ihr Glas mit übertriebener Sorgfalt ab, als hätte sie Angst, dass sie es umwerfen würde, wenn sie nicht aufpasste.
»Lass uns über etwas anderes reden, Jeppe. Der Bart steht dir gut.«
»Findest du?« Er fasste stolz an seine ungewohnte Gesichtsbehaarung. »Ist vor allem Faulheit. Ich habe ihn früher nie wachsen lassen.«
Sie legte den Kopf schräg. »Sag mal, fühlst du dich wohl in deinem Urlaub?«
»Ja, ich glaub schon … Bisher vermisse ich weder die Polizei noch Kopenhagen.«
Jeppe überlegte, ob es tatsächlich so war. Inzwischen hatte er sich so sehr daran gewöhnt, diese Antwort zu geben, dass er gar nicht mehr darüber nachdachte. Seit Mai hatte er seine Arbeit als Ermittler der Abteilung für Gewaltkriminalität ruhen lassen und unbezahlten Urlaub genommen. Seit August hatte er außerdem seine Wohnung an zwei nette ältere Leute vermietet, die ihm regelmäßig mitteilten, wie sehr sie das Stadtleben und die Aussicht über Nyhavn genossen.
»Aber Waldarbeiter? Ist das nicht … Es scheint mir ein ziemlich drastischer Schritt für einen erfolgreichen Ermittler zu sein, einfach so auf eine Insel zu ziehen und Bäume zu fällen, nur weil man Liebeskummer hat. Es kommt mir beinahe ein wenig –«
»Wie ein Klischee vor? Ja, vielleicht. Es war der Vorschlag meiner Mutter, sie kennt den Nachbarn meines Chefs bei der Forstarbeitergruppe, sonst wäre ich vermutlich nie auf die Idee gekommen. Aber wenn man den ganzen Kram leid ist, gibt es nichts Besseres als physische Arbeit. Außerdem bekommt man den Kopf frei und wird darüber hinaus gut bezahlt. Später kann ich mir dann eine Reise leisten. Ist ja auch nur mittelfristig.«
Esther trank einen Schluck Wein und bemerkte ärgerlich, dass das Glas fast leer war. »Hast du noch Kontakt zu Sara?«
»Nein –« Jeppe wollte es erklären, aber er merkte, dass es ihn noch immer schmerzte, ihren Namen auszusprechen. »Ich habe eigentlich kaum Kontakt zu den Kollegen. Und ich muss auch nicht wissen, was in dem neuen Superpolizeipräsidium passiert.«
»Sara war schließlich mehr als nur eine Kollegin.«
»Hm.« Jeppe schenkte Esther nach. Sein eigenes Glas hatte er kaum angerührt. »Willst du heute Nachmittag noch immer mit auf die Insel kommen? Ich nehme die Fähre um halb fünf.«
Esther nickte.
»Erzähl mir noch mal, was du eigentlich dort willst.« Jeppe schraubte den Verschluss auf die Flasche und stellte sie beiseite.
»Erinnerst du dich, dass ich im Frühjahr an einer Biografie gearbeitet habe? Über Margrethe Dybris, eine mit vielen Preisen ausgezeichnete Anthropologin, die in gewissen Kreisen so etwas wie eine Ikone ist. Vor einigen Jahren hat sie durch einen gemeinsamen Kollegen von der Universität tatsächlich Kontakt zu mir aufgenommen, und ich war sehr geehrt über ihr Interesse. Leider ist unser Kontakt im Sande verlaufen, ich weiß gar nicht mehr so genau, warum, und dann starb sie, bevor wir uns überhaupt kennenlernen konnten. Aber ich bilde mir ein, es wäre ihr Wunsch gewesen, dass ich ihre Biografie schreibe.«
Esther lächelte und wirkte jetzt ruhiger. Die Falten auf der Stirn hatten sich geglättet, die Augenwinkel schienen weniger angespannt zu sein. »Margrethe hat weltweit über Todesrituale geforscht, und sie war eine Vorkämpferin des Feminismus. Sie war nie verheiratet, obwohl sie zahlreiche Beziehungen hatte. Zwei Kinder hat sie adoptiert und sich in den Siebzigerjahren auf Bornholm niedergelassen. Dort ist sie vor zwei Jahren auch gestorben. Ich habe mit ihrer Tochter korrespondiert und darf mir das Haus in Bølshavn ansehen.«
»Ist es klug, das ausgerechnet jetzt zu tun?«
Esther hob eine Schulter und ließ sie mit einer unentschiedenen Geste wieder fallen. »Gregers’ Kinder kommen morgen, um seine Zimmer auszuräumen. Ich habe keine große Lust, dabei zu sein.«
»Oh, okay.« Jeppe sah auf die Uhr. »Ich habe noch etwas in der Stadt zu erledigen, aber ich kann um zwei bei dir vorbeikommen und dich abholen.«
»Gut, danke, das passt perfekt. Ich muss nur noch eine Tasche packen und Dóxa bei meinem Nachbarn abliefern, der versprochen hat, sich um sie zu kümmern, solange ich fort bin. Vermutlich bis zum Wochenende.«
Der Kellner kam mit einer Schale Vanillekipferl an den Tisch. Sie dufteten frisch gebacken. »Bitte sehr. Der Koch übt schon mal mit dem Weihnachtsgebäck. Sie sehen aus, als müssten Sie ein bisschen verwöhnt werden.«
Er stellte die Schale ab und verschwand wieder. Der Duft der selbst gebackenen Kipferl breitete sich im Lokal aus. Jeppe nahm einen Keks und lächelte über den Tisch. Esther reagierte nicht.
2
»Sagt mal, worauf warten wir eigentlich?«
Anette zog gereizt an dem Gummiband, das die OP-Haube straff auf ihrem Kopf hielt. Auf dem Stahltisch vor ihnen lag der Lederkoffer mit dem halben Leichnam, der darauf wartete, obduziert zu werden. Im Licht einer kräftigen Lampe war die dunkel gefleckte Haut des Toten überdeutlich zu erkennen.
Auf der anderen Seite des Tisches standen der Kriminaltechniker J.H. Clausen mit einer Spiegelreflexkamera, mit der er bereits mindestens hundert Fotos gemacht hatte, ein technischer Assistent und der Rechtsmediziner Professor Nyboe, der gerade ein paar Hautproben entnommen hatte und ihr nun einen verärgerten Blick zuwarf.
»Dem Toten müssen erst noch die Fingerabdrücke abgenommen werden, bevor wir die Leiche herausheben und weitere Untersuchungen vornehmen können«, erklärte er. »Die daktyloskopischen Experten müssen gleich hier sein. So ist das nun mal, wenn wir sofort obduzieren, es dauert immer etwas, bis wir anfangen können. Normalerweise hätte ich ohnehin erst morgen mit den Untersuchungen begonnen.«
»Und wieso doch noch heute?« Anette sah nicht besonders diskret auf die Uhr.
»Morgen passt es schlecht«, erwiderte Nyboe und zog die Maske unters Kinn. »Meine Frau und ich feiern Silberhochzeit und haben fünfundsechzig Gäste zum Frühstück.«
»Gratuliere!«
»Danke.«
Anette schaute in den Koffer. Sie wartete ungeduldig darauf, dass Nyboe endlich anfing. In ihren zehn Jahren als Ermittlerin hatte sie schon mehrfach Leichenteile und zerstückelte Tote gesehen, aber noch nie einen halben Menschen. Noch dazu bei einem Fall, mit dessen Aufklärung sie betraut war.
»Was ist das Weiße?«
»Die geschwollene Partie?« Nyboe zeigte auf den Schenkel des Toten. »Die Haut ist pastös geworden. Aufgrund von Verwesung, Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen. Der Tote muss einige Zeit in dem Koffer gelegen haben. Nicht so lange, dass kein Fleisch mehr vorhanden wäre, aber bestimmt mehrere Wochen, vielleicht sogar Monate.«
Ein jüngerer Mann in einem grünen Kittel und einer OP-Haube tauchte am Tisch auf. Er rümpfte die Nase, bevor er sich die Maske über die Bartstoppeln zog. »Verdammt, sitzt die stramm! Kann ich sofort anfangen?«
»Hier wird nicht geflucht!« Nyboe sah den Mann streng an. »O ja, wir warten nur auf dich. Aber sei vorsichtig, die Haut sitzt locker!«
Der Fingerabdruck-Experte hob die linke Hand der Leiche und fing an, die Finger nacheinander über ein Stempelkissen, dann auf ein Blatt Papier zu rollen. »Gibt’s nur eine Hand?«
»Ja, du kommst heute billig davon. Fertig?« Nyboe trat einen Schritt näher an den Tisch heran.
Der Mann nickte und verließ den Obduktionssaal. Nyboe band sich eine Kunststoffschürze um und zog frische Handschuhe an.
»Los, heben wir ihn heraus.«
Der rechtsmedizinische Assistent fasste mit an, und zusammen hoben sie den halben Leichnam vorsichtig aus dem Koffer und legten ihn auf den Stahltisch. Der Kriminaltechniker Clausen steckte den Koffer in einen weißen Plastiksack und fuhr dann mit dem Fotografieren fort, während Nyboe die Leiche mit einem Maßband vermaß und die Ergebnisse in ein Diktafon sprach. Immer wieder drehte der Assistent den Toten um, sodass Clausen ihn von allen Seiten fotografieren konnte. Nyboe sah sich die Leiche dabei ebenfalls genau an und murmelte etwas von eventuellen Stichwunden, Schädelbruch und Einschusslöchern.
Anette war ein paar Schritte zurückgetreten, um nicht im Weg zu stehen, sie musste den Hals recken, um alles verfolgen zu können. Obwohl die Verwesung des Toten schon ziemlich fortgeschritten war und Muskeln und Organe längst grau und weich erschienen, hätte man sie in einem Anatomiebuch noch immer erkennen können. Das Gesicht war entlang des Nasenbeins gespalten, der Brustkasten offen, das Becken halbiert. Die Reste eines Hodensacks zeigten, dass es sich um einen Mann handelte, aber abgesehen davon war es schwer, sich anhand dieser irdischen Überreste einen Menschen vorzustellen. Die Augenhöhlen waren leer, und im Mund lag hinter den Resten einer Zahnreihe ein Klumpen, der einmal eine Zunge gewesen sein musste.
»Er hat mindestens sechs und höchstens zwölf Wochen dort gelegen, ich werde es noch genauer eingrenzen können, wenn wir uns die Organe angesehen haben. Es kommt jedoch ungefähr hin.« Nyboe nickte seinem Assistenten zu. »Fangen wir mit den inneren Untersuchungen an.«
Der löste mit einem Schnitt hinter dem Ohr die Gesichtshaut und öffnete die Schädeldecke, sodass das halbe Gehirn in eine Metallschale gehoben werden konnte, ohne weiter verletzt zu werden. Oder besser: gegossen werden konnte. Für Anettes ungeübte Augen sah es flüssig aus. Der Assistent entnahm dem Körper nun das Herz, die Milz und die übrigen Organe und wog sie in einer Metallschale.
»Wie identifizieren wir ihn, falls die Fingerabdrücke nicht registriert sind?«, wollte Anette von Nyboe wissen. »Über die Zähne? Reicht die Hälfte?«
»Das hängt davon ab, wie weit die Zahnmediziner mit Röntgen und Computertomografie kommen. Wir entnehmen dem Schenkelknochen eine DNA-Probe und lassen sie die Rechtsgenetiker untersuchen. Das dauert ein paar Tage. Aber bevor man die Resultate verwerten kann, müssten sie mit irgendetwas verglichen werden können.« Nyboe redete, ohne den Kopf zu heben, er leuchtete dem Leichnam mit einer kleinen, kräftigen Taschenlampe in die Nase.
»Wir werden sämtliche vermissten Männer der letzten drei Monate überprüfen, vielleicht kommen wir damit weiter. Kannst du etwas über sein Alter sagen?«
Nyboe richtete sich auf und schnaubte. »Im Moment kann ich nicht einmal so basale Dinge wie Haut- oder Haarfarbe bestimmen, weil die Verwesung so weit fortgeschritten ist. Aber ausgehend von seiner generellen Physis würde ich meinen, dass wir es mit einem erwachsenen Mann zu tun haben, der noch keine Alterserscheinungen aufweist, du weißt schon: Gicht, Polaps, Hüftoperation. Dreißig bis fünfzig Jahre wäre meine vorsichtige Schätzung.«
»Mist, das hilft nicht viel weiter.«
»Tut mir leid.« Nyboe beugte sich wieder über die Leiche und stach mit einer kleinen Metallnadel in die Nase. »Aber er hat ein hübsches Loch in der Nasenscheidewand, was auf exzessiven Kokainmissbrauch hinweist. Das werden wir vermutlich auch an den Organen feststellen, wenn wir sie unter dem Mikroskop haben.«
Nyboe ging zu seinem Assistenten, der noch immer die Organe wog und die Ergebnisse mit schwarzen und roten Filzstiften auf ein Whiteboard schrieb.
Anette trat einen Schritt auf die Leiche zu. Ein Kopf in normaler Größe, kräftiger Kiefer, gewöhnlicher Körperbau, soweit sie es beurteilen konnte. Nur halbiert.
»Woran ist er gestorben?«
Nyboe hielt mit einem Filzstift in der Hand inne und warf ihr einen Blick zu.
»Er wurde mitten durchgesägt.«
»Komm schon, Nyboe! Ist das die Todesursache?«
Er seufzte. »Bis auf Weiteres gibt es jedenfalls keine Anzeichen auf weitere Verletzungen, aber es ist zu früh, um etwas Definitives zu sagen.«
»Warte mal!« Anette zeigte auf den Leichnam. »Willst du mir damit sagen, dass er noch gelebt hat, als er zersägt wurde?«
»Ja, Werner, ich fürchte, genau das will ich damit sagen.«
Esther schloss die Tür ihrer Wohnung am Peblinge Dossering auf, ohne auf das Namensschild zu achten. Seit einem halben Jahr ignorierte sie es schon, lange war es zu schmerzhaft gewesen, es zu lesen, weil sie wusste, dass es schon bald veraltet sein würde.
Esther de Laurenti & Gregers Hermansen
Jetzt reduziert um schwindelerregende fünfzig Prozent. Eine ganze Wohnung für lediglich die Hälfte der Bewohner, wie sollte diese Gleichung jemals aufgehen?
Dóxa kam mit trippelnden Schritten über den Parkettfußboden gelaufen und empfing sie mit einem trägen Kläffen, bevor sie sich in ihren Korb in der Küche zurückzog. Die Tage, an denen der Mops freudig bellte und umherhüpfte, wenn Esther nach Hause kam, waren lange vorbei.
»Jetzt gibt’s nur noch dich und mich, mein Schatz.« Esther ließ die Worte sacken. Der Tod war ebenso unbegreiflich wie das Ende des Universums. Von nun an würde Gregers am Samstag nicht mehr die Brötchen holen oder aus der Wochenendausgabe der Zeitung das Kreuzworträtsel stibitzen, nie wieder würde er sich über den Knoblauchgeruch aus der Pfanne und die Lautstärke beschweren, wenn sie Puccini auflegte.
Sie packte den Kulturbeutel und Kleidung für einige Tage in ihre Reisetasche und stellte sie in den Flur. Beim Blick in den Kühlschrank musste sie sich eingestehen, dass sie noch immer keinen Appetit hatte. Eine Stunde hatte sie noch totzuschlagen, bevor Jeppe sie abholte, sie konnte ebenso gut noch ein Glas Wein trinken.
Es war lange her, dass sie sich betrunken hatte. Wenn man einen hilflosen Patienten zu betreuen hat, macht man so etwas nicht. Nun gab es aber keinen Grund mehr, nüchtern zu bleiben. Der Korken verließ den Flaschenhals mit einem mitfühlenden Seufzen.
Wäre er zu Hause gewesen, hätte Gregers sie jetzt aufgezogen und eine Lusttrinkerin genannt.
»Aber du bist nicht zu Hause, mein Freund, also trinke ich, wie ich will.« Esther legte den Kopf zurück und trank den Ripasso in großen Schlucken. Sein Tod war auch eine Erleichterung. Durfte sie so etwas denken?
Es war eine Erleichterung, die Bettpfanne und das Blutdruckmessgerät, die Tablettenbox, das Sauerstoffgerät und das Krankenhausbett loszuwerden, das der ambulante Pflegedienst in Gregers’ Zimmer gestellt hatte. Auch die Schmerzanfälle würde sie bestimmt nicht vermissen, die geschwollenen Beine und die Verstopfungen, die ihn rastlos durch die Wohnung laufen ließen, wenn ihn sein eigener Körper quälte. Und schon gar nicht die nächtlichen Panikattacken, bei denen er glaubte, sterben zu müssen. Die Angst hatte sie beide wach gehalten. Noch immer konnte sie seinen leeren Blick in der Dunkelheit sehen und sein kurzatmiges Luftholen hören. So wenig bereit, mit dem Leben abzuschließen, wie man es nur sein konnte.
Nein, Esther würde die Krankheit und den Tod nicht vermissen. Aber Gregers … hatte Bukowski nicht gesagt, dass Einsamkeit das Schönste auf der Welt sein kann?
Vielleicht wenn man jung und agil war und sich allein auf einem Berggipfel oder in einem schottischen Fischerdorf befand, aber nicht, wenn man eine einundsiebzigjährige Dame war, die alle verloren hatte, die ihr nahestanden.
»Wen habe ich denn noch?«, fragte sie Dóxa im Hundekorb. »Wer kümmert sich um mich, wenn ich krank werde?«
Die Frage hing wie ein Echo zwischen den weißen Wänden. Vor langer Zeit hatte sie Kollegen, Liebhaber und Gäste zum Abendessen gehabt, einen Bekanntenkreis, den sie regelmäßig sah und auf den sie sich verlassen konnte. Doch so vieles war versickert, ohne dass sie es bemerkt hatte, verloren in den Schichten eines geschäftigen Alltags. Aber wofür? Was konnte wichtiger sein als die Menschen, die man mag? Sie leerte ihr Glas und hatte das Gefühl, als würde der Küchentisch schwanken.
Esther legte die Hand auf das Medaillon an ihrem Hals – eine Erinnerung an den größten Verlust überhaupt. Ein goldener Anhänger mit einem eingravierten Datum, 18. März 1966, die Erinnerung an das Kind, das sie ausgetragen, geboren und weggegeben hatte, als sie siebzehn Jahre alt war. Auf Druck ihrer Eltern, die sie regelrecht gezwungen hatten, das uneheliche Kind zur Adoption freizugeben. Hätte sie sich ihren Eltern widersetzen müssen, hätte sie etwas ausrichten können?
Diese Frage hatte sie sich unzählige Male gestellt und jedes Mal mit dem Gefühl der Reue gekämpft. Die Antwort war ungewiss. Es blieb die Erkenntnis, die schmerzhafte Wahrheit: Esther hatte niemanden.
Sie hatte nie geheiratet und weitere Kinder bekommen, und ihre engsten Freunde waren in alle Winde verstreut.
»Ich habe dich«, sagte sie in Richtung des Hundekorbs und hörte selbst, wie sie bei »habe« lallte. »Und ich habe Jeppe und mein Buch.«
Sie ging zu ihrem petroleumfarbenen Schreibtisch und betrachtete die Stapel von Papieren, Artikeln und Fotos über Margrethe Dybris’ Feldstudien in Indonesien und Zentralafrika. Eine feine Lage Staub hatte sich darübergelegt, seit Gregers krank geworden war und sie im Frühsommer die Arbeit an ihrem Buch hatte unterbrechen müssen. Der Gedanke, die Recherchen und das Schreiben wiederaufzunehmen, schien im Moment sinnlos. Warum ein Buch schreiben, auf das keiner wartet, wenn der beste Freund tot ist?
Weil Arbeit das Einzige war, das sie aufrechterhielt.
3
Die Leuchtstoffröhren an der Decke schalteten sich mit einem hektischen Blinken ein und zauberten eine Welt aus Glas und Buchenfurnier hervor. Anette ließ die Tür zu ihrem Büro hinter sich auf, damit die Geräusche der Kollegen das Zimmer mit Leben erfüllten; sie warf ihre Tasche auf den Doppelschreibtisch und hängte ihren Mantel über Jeppes leeren Schreibtischstuhl. Dann holte sie sich einen Becher Kaffee mit viel Zucker und stellte ihn neben die beiden benutzten Becher, die sie noch nicht in die Teeküche zurückgebracht hatte. Undenkbar, wenn Jeppe noch hier wäre, ging ihr durch den Kopf, als sie den Computer einschaltete. Seine geradezu anale Pingeligkeit war eine der Eigenschaften, die sie ganz bestimmt nicht vermisste. An das leere Büro hingegen musste sie sich noch immer gewöhnen.
Im Polizeisystem POLSAS fand sie den Bericht des zentralen Ermittlungsleiters, den sie mit ihren eigenen Notizen und Fotos der Obduktion ergänzte.
Todesart: Tötungsdelikt, schrieb sie und zögerte, während sie nach einer möglichst präzisen Beschreibung suchte. Todesursache: Läsion, verursacht durch eine motorisierte Säge mit anschließender Verblutung. Nur eine Hälfte des Toten wurde gefunden (linke Hälfte).
Das musste reichen. Die Kollegen würden verstehen, worum es ging, es war nicht nötig, weitere Details zu beschreiben.
»Bist du bereit?« Die heisere Stimme der Polizeikommissarin unterbrach Anettes Konzentration. PK, wie sie intern nur genannt wurde, stand an der Tür und betrachtete sie mit einem ernsten Blick.
»Es ist vier Uhr, du wirst im Konferenzraum erwartet. Ich habe Flachbildschirme aufstellen lassen, damit du Fotos zeigen kannst. Lass sie einfach stehen, ich brauche sie vielleicht für die morgige Pressekonferenz.«
»Danke, PK.« Anette speicherte den Bericht und schaltete den Computer in den Ruhemodus. »Augenblick, ich muss nur noch –« Sie griff nach ihrer Tasche und warf dabei beinahe ihren Kaffeebecher um.
»Nervös?« Ein paar kleine Ohrringe funkelten an den Ohrläppchen der Polizeikommissarin. Türkis vielleicht, etwas Buntes, aber diskret.
»Nee, fangen wir an!« Anette erhob sich und trank nonchalant ihren Kaffee aus, bevor sie losging. Ihre Vorgesetzte folgte ihr mit einem zustimmenden Nicken.
Der Fußbodenbelag des neuen Polizeipräsidiums war eine graue Linoleumvariante, die beim Zusammentreffen mit den Gummisohlen der Ermittlerinnen laute Geräusche von sich gab. Die Polizeikommissarin und Anette gingen schweigend weiter und ignorierten das Quietschen ihrer Schuhe. Im Konferenzraum wurden sie von neun Augenpaaren und einem gedämpften Murmeln empfangen, das rasch verstummte.
Die Polizeikommissarin ergriff das Wort.
»Ich gehe davon aus, dass alle von dem Fund eines halben Leichnams heute Vormittag in der Østre Anlæg gehört haben. Polizeiassistentin Werner wird die Ermittlungen leiten, sie wird euch jetzt über die Obduktion informieren und die Aufgaben verteilen.«
Während sie sprach, sah sich Anette unter ihren Kollegen um. Sara Saidani saß mit einem verbissenen Gesichtsausdruck da, die schwarzen Locken hatte sie zu einem strammen Pferdeschwanz gebunden. Blass und chronisch ernst, was hatte Jeppe bloß je in ihr gesehen?
Neben ihr stützte sich der pensionsreife Torben Falck auf die Ellenbogen, sodass sein ansehnlicher Schmerbauch gegen den Tisch drückte und die Schultern seines alten Sakkos die Ohren berührten. Neben ihm saßen die beiden jungen Beamten, die sie im Park kennengelernt hatte, flankiert von weiteren fünf uniformierten Kollegen, die sie noch nie gesehen hatte.
Das ungewohnte Gefühl im Zwerchfell nahm zu, der Mund fühlte sich trocken an, die Lippen klebten an den Zähnen.
»Polizeiassistentin Werner?«
Erst jetzt drang zu Anette durch, dass die Polizeikommissarin sie aufrief – offenbar nicht zum ersten Mal. Sie trat neben ihre Chefin.
»Danke, PK, und willkommen. Haben alle den Bericht gelesen?« Im Raum wurde genickt. »Gut, dann wisst ihr bereits, dass wir es mit einer wirklich hässlichen Geschichte zu tun haben. Es handelt sich um einen außerordentlich brutalen Mord, und die Leiche war leider so lange versteckt, dass viele Spuren vernichtet sind und die Identifikation schwierig wird. Die Rechtsmediziner haben sich festgelegt, dass der Verstorbene seit gut zwölf Wochen tot ist und den größten Teil dieser Zeit in dem Koffer im Erdreich lag. Das bedeutet, unser Täter hat den Koffer Ende August oder in der ersten Septemberwoche in der Østre Anlæg vergraben.« Anette räusperte sich und sah die uniformierten Beamten an. »Ihr seid von Tür zu Tür gegangen, ist irgendetwas Brauchbares dabei herausgekommen?«
Einer der Uniformierten meldete sich.
»Ich habe die Zeugenaussagen geprüft, die wir bisher beschaffen konnten. Wir haben uns zunächst auf alle Personen konzentriert, die täglich in den Park kommen – Parkwächter, Gärtner, Angestellte der beiden Museen in der Anlage –, aber bisher hat niemand etwas Ungewöhnliches gesehen.«
Saidani meldete sich. »Ist es nicht merkwürdig, dass ein großer Koffer wochenlang in einem Kopenhagener Park vergraben liegt, ohne dass ihn jemand bemerkt?«
»Das Gebüsch, in dem er versteckt war, ist dicht und wächst an einer Böschung«, antwortete Anette. »Dort kommen kaum Leute vorbei. Ich verstehe allerdings nicht, wie der Täter den Koffer unbemerkt in den Park bringen und vergraben konnte. Das muss doch vermutlich nachts passiert sein, oder?«
In den Stuhlreihen wurde genickt, und der uniformierte Beamte hob erneut die Hand.
»Wir haben angefangen, die Bewohner der Stockholmsgade zu befragen, die auf den Park blicken können. Das Problem ist nur, dass es so lange her ist. Die Leute können sich im Allgemeinen nicht an Vorfälle erinnern, die mehrere Monate zurückliegen. Einer der Bewohner behauptet jedoch, im Laufe des Herbstes einen verdächtigen Lieferwagen bemerkt zu haben.«
»Inwiefern verdächtig?«
»Er stand am späten Abend mit eingeschaltetem Licht da, als würde jemand auf etwas warten oder jemanden beobachten. Dieser Zeuge hat in der Nacht zum 10. September sogar die Polizei angerufen, weil er Angst hatte, dass es sich um einen Einbrecher handeln könnte.«
»Und?« Anette sah ihn erwartungsvoll an. »Was haben wir gemacht?«
Der Beamte legte bedauernd den Kopf schief. »Nichts, fürchte ich. Es wurde kein Bericht geschrieben.«
Anette seufzte. Es wäre auch zu schön gewesen. »Okay. Bleibt an der Spur dran und hört euch um, ob noch weitere Anwohner den Lieferwagen gesehen haben.«
»Verstanden!«
»Falck, frag bei Clausen nach, wann er und die anderen Kriminaltechniker mit Ergebnissen von dem Koffer rechnen.« Falck blinzelte mit einem Auge und steckte die Daumen unter seine gepunkteten Hosenträger. »Saidani, du suchst alle Fälle von vermissten Männern zwischen dreißig und fünfzig Jahren heraus. Konzentrier dich auf das Hauptstadtgebiet, aber such grundsätzlich auch landesweit.«
»Er könnte ebenso gut aus Schweden, Deutschland oder sonst wo in Europa sein, mit dem Auto ist das doch alles nicht sehr weit«, protestierte Sara.
»Solange wir weder besondere Kennzeichen oder Zeugenaussagen haben, müssen wir die Suche eingrenzen und die Daumen drücken, dass er Däne ist.«
Saidani senkte den Blick, entweder wollte sie etwas auf dem Display vor sich überprüfen, oder sie war unzufrieden mit der Anweisung. Anette entschied sich, Ersteres zu glauben.
»Falck, erkundige dich auch bei den Kollegen von der Organisierten Kriminalität, ob die etwas über Zersägen als Mordmethode wissen. Vielleicht geht es hier ja um Bandenkriminalität. Rivalisierende Drogenhändler, was weiß ich.«
Anette erhielt ein kurzes Nicken von der Polizeikommissarin und spürte, wie sich der Knoten in ihrem Bauch langsam löste. Selbstverständlich war sie in der Lage, Mordermittlungen zu leiten, die Kollegen würden gar nicht merken, dass Jeppe nicht mehr da war.
»Das war’s für heute, Leute. Denkt dran: Alles wird fortlaufend im Bericht festgehalten, neue Erkenntnisse werden mir direkt mitgeteilt. PK wird mit der Presse sprechen, ihr verweist sämtliche Journalisten an sie. Und dann noch das ganz Offensichtliche!« Anette hielt beide Zeigefinger in die Luft und legte sie vor ihrem Gesicht zusammen. »Wir haben eine halbe Leiche gefunden. Das bedeutet, dass die andere Hälfte wahrscheinlich noch irgendwo da draußen liegt.«
Eine Reihe roter Rücklichter leitete Jeppe über das Deck und die Rampe der Fähre auf den Kai des Hafens von Rønne. Es war erst kurz vor achtzehn Uhr, aber die Dunkelheit hatte sich längst wie eine schwere Winterdecke über Bornholm gelegt. Die ersten Weihnachtsdekorationen hingen an den Straßenlaternen und leuchteten einsam vor sich hin, die Straßen waren nass und menschenleer.
»Kennst du den Weg?« Esther unterdrückte auf dem Beifahrersitz ein Gähnen.
»Bølshavn, nicht wahr? Das liegt fast auf dem Weg nach Allinge, dauert nur eine halbe Stunde.«
Schweigend fuhren sie in Richtung Osten, kamen an Knudsker in der Mitte der Insel vorbei und erreichten das Waldgebiet Almindingen, in dem Jeppe tagsüber arbeitete. Er folgte den wohlbekannten Kurven und Hügeln der Straße, bis sie zur Nordküste kamen.
»Die Adresse ist Bølshavn 21«, murmelte Esther und zeigte aus dem Fenster, »es muss auf dieser Straßenseite sein, hier ist Nummer 29.«
»Könnte es dieses Haus sein?«
Sie hielten vor einem weißen Fachwerkhaus, in dem Licht brannte, und stiegen aus dem Wagen. Eine Frau von etwa fünfzig Jahren öffnete die moosgrüne Haustür und kam ihnen entgegen. Sie war klein und lebhaft mit grau-braun melierten Haaren, die um ihr lächelndes Gesicht wogten.
»Esther de Laurenti? Ich bin Ida Dybris, willkommen.«
Während sie sich begrüßten, holte Jeppe Esthers Tasche aus dem Kofferraum und brachte sie zur Haustür. »So, ich lasse euch jetzt allein. Esther, wir telefonieren morgen, okay? Und denk dran, ich bin nur eine halbe Stunde entfernt, falls du mich brauchst.«
Er umarmte sie, setzte sich wieder ans Steuer und fuhr in den nördlichsten Ort Bornholms, Allinge-Sandvig. Hier hatte er jeden Sommer im Strandhotel verbracht, bis er mit sechzehn Jahren seiner Mutter erklärt hatte, dass er keine Lust mehr hatte, mit ihr in den Urlaub zu fahren. In seiner Erinnerung waren diese Sommer die letzte unbeschwerte Zeit seines Lebens gewesen, Blasen der Harmonie in einer im Übrigen durchschnittlichen Kindheit. Aber, dachte er, als er den Hügel an der Minigolfbahn hinunterfuhr und neben dem kleinen roten Schuppen am Hafen parkte, so ist das mit den Erinnerungen, wir halten sie möglichst auf Distanz, damit sie in einem unkritischen Licht funkeln können und uns die Möglichkeit geben, über die Gegenwart die Nase zu rümpfen.
Jeppe griff nach einer Papiertüte auf dem Rücksitz, schloss den Wagen ab und ging den Hügel hinauf, bis er Orlas rotes Fischerhaus mit der Hausnummer 6 erreichte. Licht strömte aus den kleinen Sprossenfenstern, es war also jemand zu Hause. Wo sollte er auch hingehen, dachte Jeppe und klopfte an die blau gestrichene Haustür.
Er hörte, wie das Radio abgedreht wurde und sich schleppende Schritte näherten, bevor die Tür aufging und Orlas runzliges Gesicht in Höhe der Türklinke zum Vorschein kam. Der übliche Geruch nach Fischkonserven und feuchter Katzenstreu schlug Jeppe zusammen mit Orlas Lächeln entgegen.
»Du bist es, Jeppe?« Die grau-weißen Locken standen wie ein zerzauster Glorienschein um Orlas Kopf, er blinzelte. »Gut, dass du die Fähre erreicht hast. Pass auf, die Mädels laufen frei herum. Komm rein, bevor sie hinausrennen!«
Jeppe schloss die Tür hinter sich und zog in dem niedrigen Flur den Kopf ein. Er spürte, wie etwas über seinen Fuß flitzte.
»He, pass auf, wo du hintrittst. Ich glaube, Jane will dich willkommen heißen. Vielleicht ist es auch Harriet. Hat sie weiße Ohren?«
Jeppe schaute auf die Ratte, die vor seinem Schuh stehen geblieben war und aussah, als würde sie sich ihren nächsten Schritt überlegen. »Ja.«
»Dann ist es Harriet, sie ist noch immer ein Baby. Ich schließe sie wieder im Bauer ein.«
Orla bückte sich unsicher. Die Ratte wackelte mit den Ohren und ließ sich von Orla hochheben. Er ging zu einem der beiden Käfige im Wohnzimmer, in dem er die sechs Weibchen seiner insgesamt fünfzehn zahmen Ratten hielt, und setzte Harriet vorsichtig auf einen Kletterbaum. Sie fing sofort an, auf und ab zu rennen, und das Geräusch zog kurz darauf die übrigen Weibchen an, die nacheinander in den Bauer krochen.
»Sind alle sechs drin, siehst du das, Jeppe?« Orla legte die Stirn an die Stäbe des Käfigs.
»Sie sind alle da, du kannst zumachen.«
Orla schloss den Käfig, richtete sich auf und lächelte wieder. »Na, wie war die Beerdigung?«
Bevor Jeppe antworten konnte, schlug Orla mit der Hand aufs Sofa. »Warte, setz dich, du musst müde sein. Ich werde etwas holen, womit wir uns stärken können.« Er ging zu einem Mahagonischränkchen und holte eine Flasche Four Roses, die neben dem Hochzeitsfoto von Orla und seiner verstorbenen Frau stand. Er füllte zwei Gläser halb voll mit dem Bourbon Whiskey und brachte sie mit zitternden Händen zum Couchtisch. Dann setzte er sich in seinen abgewetzten Sessel.
»So, jetzt können wir’s uns gemütlich machen. Wie war’s in Kopenhagen?«
»So gut, wie so etwas halt sein kann. Wenn ich ehrlich sein soll, war es eine traurige Angelegenheit. Nicht einmal Gregers’ eigene Kinder kamen, um ihn zu verabschieden.« Jeppe trank einen Schluck von dem süßlich sprittigen Getränk und spürte erst jetzt, wie erschöpft er war. Von dem Tag, von der Reise, vom Leben.
»Das ist schlimm, das hat niemand verdient. Aber du warst da. Und deine Freundin. Also ist er doch nicht ganz allein von uns gegangen.« Orla streifte seine Pantoffeln ab und vollführte mit den Zehen Bewegungen, als würde er Venengymnastik betreiben. »Hast du von der halben Leiche gehört, die man in Kopenhagen in einem Park gefunden hat? Das war den ganzen Nachmittag in den Nachrichten.«
»Eine halbe Leiche?«
»Ja, der Länge nach durchgeschnitten und in einen Koffer gesteckt.« Orla klang gleichermaßen entrüstet wie unterhalten.
Jeppes Instinkt meldete sich. Man war nicht zwölf Jahre Ermittler, ohne dass es auf der Seele Spuren hinterließ. Die Wachsamkeit eines Polizisten verschärfte sich nur mit der Zeit. Aber es war nicht mehr sein Job, etwas zu unternehmen. Er unterdrückte seine nächste Frage mit einem Schluck Whiskey und griff nach der Papiertüte.
»Ich habe das Buch besorgt, um das du gebeten hast. Hier!«
Ein Leuchten ging über Orlas Gesicht. »Oh, das ist nett von dir. Danke.« Er packte das Buch aus. »Selkirks Inselvon Diana Souhami, ich freue mich darauf. Wirst du es mir vorlesen?«
Als Jeppe im August ins Nachbarhaus gezogen war, hatte Orla ihn als Erster zu Kaffee und Kuchen eingeladen, um ihn willkommen zu heißen. Und Jeppe hatte sich angewöhnt, den alleinstehenden Rentner kurz zu besuchen, wenn er von der Arbeit nach Hause kam. Normalerweise nur zu einem kurzen Plausch, aber hin und wieder las er Orla aus den Büchern vor, die der alte Mann nicht mehr entziffern konnte. Mit der Zeit gefiel dieses Arrangement beiden recht gut. So viel gab es abends in Sandvig ohnehin nicht zu tun, wenn man nicht fernsehen oder in die Kneipe gehen wollte.
»Können wir das auf morgen verschieben? Es war ein langer Tag.« Jeppe trank aus. »Ich glaube, ich muss nach Hause.«
»Natürlich, mein Freund. Du findest selbst hinaus, oder?« Orla zwinkerte ihm zu und hob das Buch bis unter seine Nase.
Jeppe trat auf die Straße, wandte das Gesicht dem salzigen Wind zu und ging hinüber zur Hausnummer 4. Mit dem Hausschlüssel in der Hand blieb er einen Moment stehen. Der schwarze Himmel über dem Wasser war gewaltig und von Wolken überzogen, die ihn gleichermaßen anzogen wie erschreckten. Wenn er allein war, wurde er manchmal von dem Drang überwältigt, sich von der Dunkelheit verschlucken zu lassen.
4
Mit einem kleinen, erschöpften Seufzen stellte Esther die Tasche auf dem geblümten Bettüberwurf ab. Das Gästezimmer lag im ersten Stock des alten Hauses, und man durfte nicht sehr viel größer sein als Esthers hundertfünfundsechzig Zentimeter, wenn man sich nicht den Kopf an der Decke stoßen wollte. Eine Lampe mit locker sitzendem Schirm auf dem abgebeizten Nachttisch war die einzige Lichtquelle des Zimmers, sie hatte keine großen Chancen gegen die Novemberdunkelheit.
Das Haus war gemütlich, aber auch ziemlich marode, die Einrichtung geprägt von ökonomischen Lösungen, die eher Wert auf Geist als auf Ästhetik legten. Im buchstäblichen Sinn.
Der größte Teil der Wände war übersät mit Briefen, Notizen, Postkarten, Zeichnungen, Briefumschlägen, Erinnerungszetteln und Grüßen, die alle mit Reißzwecken befestigt und mit der Zeit verblasst waren. Esther hatte das Gefühl, sich durch die gesamte Familiengeschichte lesen zu können, wenn sie nur durch die Zimmer ging.
»Verstehen Sie jetzt, was ich meinte, als ich vorschlug, Sie sollten sich das Haus ansehen?« Ida stand in der Tür. »Es sagt mehr über meine Mutter als irgendein Buch oder ein Artikel, den sie geschrieben hat.«
Esther trat näher an eine bunte Einladung zu einem Theaterabend in Rønne, um den Text zu lesen. »Hat das Haus schon immer so ausgesehen?«
»Immer«, lachte Ida. »Meine Mutter war jemand, die Briefe mit der Hand schrieb und sie mit der alten Schneckenpost verschickte, auch als sie längst schon am Computer arbeitete. Sie mochte das Haptische der Briefe, auch wenn es meinem Bruder und mir peinlich war, wenn uns Freunde besuchten. All diese Zettel an den Wänden, das war so hippiemäßig im Vergleich mit den ordentlichen Wohnungen der anderen. Kommen Sie, ich zeige Ihnen den Rest.«
Sie gingen die knarrenden Treppenstufen hinunter ins Erdgeschoss, das ebenso niedrig war. Kleine Fenster hielten den Seenebel draußen. Die Wände waren entweder von Bücherregalen oder einer dichten Schicht Briefe verdeckt. Es roch muffig, und die Möbel sahen so abgenutzt aus, dass man sie nicht mehr gemütlich nennen konnte. Die meisten Menschen hätten sie längst auf den Sperrmüll geworfen. Der Esstisch wackelte, die geflochtenen Sitzflächen der Stühle hatten Löcher.
Vorsichtig setzten sie sich. Ida öffnete eine Flasche Merlot und goss Esther ein Glas ein. Esther hatte noch immer einen schweren Kopf von dem Wein, den sie mittags getrunken hatte, aber abzulehnen wäre unhöflich gewesen.
»Es ist über zwei Jahre her, seit Ihre Mutter gestorben ist, warum haben Sie das Haus nicht verkauft?«
»Wir haben es tatsächlich versucht, aber als sich ein paar Monate niemand dafür interessierte, haben wir es vom Markt genommen, und mein Bruder Nikolaj beschloss, hier einzuziehen. Er kann ja ebenso gut hier wohnen, bis wir es abstoßen können.« Während sie sprach, band Ida ihr Haar im Nacken zu einem Knoten. Sie war schmächtig gebaut und hatte feine Gesichtszüge, aber kräftige Schultern und Arme wie eine Person, die ihr ganzes Leben Sport getrieben hat. Um ihre blauen Augen deutete sich ein Netz von Lachfältchen an. Sie sieht nett aus, dachte Esther. Intelligent und nett.
»Hat er im Haus etwas verändert?«
»Nicht das Geringste, alles steht noch genau so da wie zu Lebzeiten meiner Mutter.« Idas Gesichtsausdruck veränderte sich, aber nur einen Moment, dann lächelte sie wieder.
»Mein Bruder ist … wie soll ich das sagen … nicht der häusliche Typ. Eine Unterkunft zu haben, in der er billig wohnen kann, reicht ihm vollkommen. Und ich lebe mit meinem Mann Adam und unseren beiden Kindern in Kopenhagen, daher spielt es für mich keine Rolle, ob er hier wohnt oder nicht. Allerdings wäre es schön, wenn er sich ein bisschen mehr um das Haus kümmern würde.«
Sie warf einen Blick auf Spinnweben und ein paar Risse in der Wand und seufzte.
»Tatsächlich haben Nikolaj und ich deshalb vereinbart, dass ich nach Bornholm komme: Wir wollten kleine Schäden ausbessern und das Haus winterfest machen. Und da war es doch ganz praktisch, dass Sie uns gern Gesellschaft leisten wollen.«
»Wenn ich helfen kann –«
Ida lachte laut auf. Sie sah aus wie jemand, der häufig lachte. »Nein, so war das nicht gemeint. Sie sollen hier die Atmosphäre erleben und das bestmögliche Buch über unsere Mutter schreiben. Das hätte sie sich gewünscht.« Sie stand auf und hob die Weinflasche fragend in Esthers Richtung.
»Nein danke, ich glaube, ich habe genug für heute.« Auch Esther erhob sich. »Wo ist Ihr Bruder?«
»Das weiß ich nicht genau.« Ida führte Esther zu einer kleinen Küche mit blau geblümten Kacheln und einer Dunstabzugshaube aus stumpfem Kupfer und packte zwei Einkaufstüten aus. »Wir haben vor längerer Zeit vereinbart, dass ich in dieser Woche komme, aber in letzter Zeit habe ich nichts mehr von ihm gehört. Mein Bruder kann zwischendurch schon mal auf Tour gehen.«
»Auf Tour?«
»Na ja, auf Sauftour. Er ist häufig mit einer Truppe in Allinge unterwegs. Da geht’s schnell hoch her.« Ida schloss einen Küchenschrank und lächelte Esther an. »Darüber müssen Sie sich aber wirklich keine Sorgen machen. Kommen Sie, ich zeige Ihnen das Arbeitszimmer meiner Mutter.«
Ida ging voraus und tastete unterwegs nach den Lichtschaltern. Die Küche befand sich links von der Haustür, und hinter der Treppe, die in den ersten Stock führte, lagen auf der rechten Seite drei Zimmer nebeneinander, das Esszimmer, das Wohnzimmer und das Arbeitszimmer. Im Esszimmer leuchtete eine schwache Pendellampe über dem Tisch, im Wohnzimmer ließ sich jedoch kein Licht einschalten. Der Raum sah heruntergekommen und halb leer aus, auf einem einsamen Sessel lag Staub, in einer Ecke standen pralle schwarze Säcke.
Am anderen Ende des Hauses erreichten sie das Arbeitszimmer, in dem Esther die Konturen eines Erkers erahnen konnte, von dem man hinaus aufs Wasser blickte. Ida schaltete eine funktionierende Lampe ein. In dem Erker war nun ein großer Schreibtisch zu erkennen, der so stand, dass man eine unverstellte Aussicht aufs Meer hatte. Bücher- und Papierstapel lagen auf dem Schreibtisch, dem Boden und den meisten übrigen waagerechten Flächen des Raumes. Auch hier waren die Wände bedeckt mit Briefen, Zeichnungen und Postkarten; rechts vor dem Erker leuchtete ein rotgrünes Plakat der Bornholmer Sägewerke zwischen den weißen Zetteln und Blättern auf.
Ida drehte einen Heizkörper in der Ecke auf.
»Fühlen Sie sich wie zu Hause! Wie gesagt, das Haus ist voller Erinnerungen und Korrespondenzen, und Sie haben hiermit meinen Segen, sich alles anzusehen. Sie hätte nichts dagegen gehabt.«
»Gibt es denn nichts, das zu … privat sein könnte?« Esther ließ die Finger vorsichtig über einen Stapel handgeschriebener Briefe auf dem Schreibtisch gleiten.
»Meine Mutter gehörte nicht zu den Menschen, die Geheimnisse hatten. Ich glaube, sie hat sämtliche Briefe behalten, die sie jemals erhalten hat, viele hängen an den Wänden. Wenn sie selbst Briefe schrieb, legte sie normalerweise Kohlepapier zwischen die Briefbögen, um eine Kopie zu behalten. Lesen Sie alles, was Sie wollen, und wenn Sie auf etwas stoßen, das Ihnen peinlich erscheint, besprechen Sie es mit Nikolaj und mir, bevor Sie darüber schreiben. Können wir uns darauf einigen?«
»Das klingt ausgezeichnet.« Esther warf einen Blick auf die ersten Zeilen des obersten Briefs auf dem Stapel. »Dies sieht aus wie ein Brief. An E.«
Ida lehnte sich über den Schreibtisch. »Elias, ein Kollege und Freund meiner Mutter.« Sie deutete bei dem Wort Gänsefüßchen an. »Sie heirateten, weil sie Kinder wollte. Damals war es schwer, als alleinstehende Frau Kinder zu adoptieren, aber sie haben nie zusammengelebt und wurden kurz nach Nikolajs Adoption geschieden. Ich hatte immer den Verdacht, dass sie die Ehe nur pro forma eingegangen sind, aber meine Mutter weigerte sich, es zu kommentieren. Vielleicht können Sie es ja für uns aufklären.«
»Dann hatte Margrethe möglicherweise doch einige Geheimnisse vor Ihnen –«
Ida brach in Gelächter aus. »Das könnte schon sein. Ärgerlich, dass Sie sie nie kennengelernt haben. Sie hätten sich gemocht. Hat meine Mutter Sie gefragt, ob Sie ihre Biografie schreiben wollen?«
»Nein, so weit kamen wir nicht. Sie nahm über einen Kollegen Kontakt zu mir auf, aber aus irgendeinem Grund antwortete sie nicht, als ich ihr schrieb.«
»War das per Mail? Meine Mutter war digital nicht so versiert, vor allem in den letzten Jahren ihres Lebens nicht. Aber nun klappt es ja posthum mit der Biografie, und ich bin sicher, dass sie zufrieden von ihrer Wolke blickt. Oder wo auch immer sie sitzt.« Ida lächelte herzlich. »Ich hole jetzt das Bettzeug und beziehe Ihr Bett. Bleiben Sie ruhig hier und schauen sich solange um. Ach ja, wir können uns gern duzen, ich heiße Ida.« Sie verließ das Arbeitszimmer und ging nach oben.
Esther blieb am Schreibtisch stehen und sog den Duft von alten Büchern, Staub und Feuchtigkeit ein. Die Wellen schlugen rhythmisch gegen die Klippen, und mit einem Mal ging ihr durch den Kopf, dass die Dunkelheit Augen haben könnte. Dass irgendjemand oder irgendetwas sie in dem erleuchteten Erker beobachtete. Dass diese Augen alles sehen konnten und sie nichts.
Unfug! Esther verdrängte den Gedanken und ließ sich auf dem alten Bürostuhl nieder. In diesem Haus hatte Margrethe Dybris bis zu ihrem Tod fünfundvierzig Jahre gewohnt und gearbeitet. Wenn es einen Ort gab, an dem Esther etwas über diese Frau erfahren konnte, von der sie sich so angezogen fühlte, die sie aber nie kennengelernt hatte, dann war es hier. Sie strich mit der Hand über die Holzarmlehne des Stuhls, die an einigen Stellen glatt geschliffen, an anderen rau war, und zog den Stapel mit den Briefen näher heran.
Bølshavn, Mittwoch, 11. Januar 2017