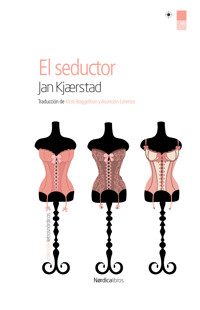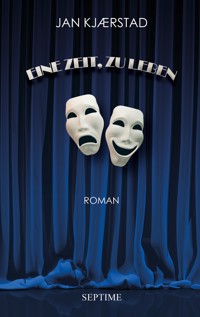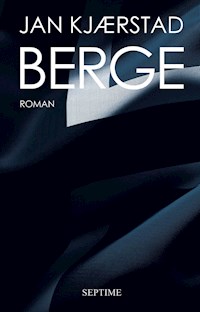17,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Septime Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
John Richard Norman wächst in Oslos denkbar schönster Straße auf: an dem einem Ende befindet sich eine Schokoladenfabrik, am anderen die Segeltuchfabrik "Christiana", jene Fabrik, die dazumal das Schiff der norwegischen Polarexpedition, die Fram, mit den Segeln ausstattete. In diesem Spannungsfeld, zwischen Süßigkeiten und Entdeckungsreisen, wächst John Richard heran und entwickelt sich zum Inbegriff des qualifizierten, leidenschaftlichen Lesers. Mehr noch: Die Wörter lesen und leben sind für ihn gleichbedeutend. Entgegen der Warnung seiner Mutter, dass es nicht gut sei, wenn man sich zu sehr in die Bücher, in die Fiktion vertieft, verschlingt er Bücher wie andere Schokolade. Dass er letztendlich ein herausragender Verlagslektor bei einem renommierten Verlag wird, dessen Autoren fast immer erfolgreich sind, verdankt er einer Gabe: Er weiß immer, wann ein Buch Schokolade ist und wann ein Segel. Als seine Lesefähigkeit unerwartet schwindet – und nicht nur das, denn plötzlich befällt ihn eine schwere Übelkeit, jedes Mal, wenn er ein Manuskript zu lesen beginnt –, sucht John Richard Zuflucht in einem Haus auf einer wenig bevölkerten Insel auf einer Landspitze am Meer. Dort taucht eine fremde Frau auf, in die er sich auf den ersten Blick verliebt, und die große Literatur wird von der großen Liebe in den Schatten gestellt. Oder doch nicht?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 927
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Cover
Impressum
Autor und Klappentext
Titelseite
Buchanfang
Leseproben
Jan Kjaerstad - Der König von Europa
José Luís Peixoto - Friedhof der Klaviere
José Luís Peixoto - Das Haus im Dunkel
Shusaku Endo - Skandal
Shusaku Endo - Schweigen
Ryu Murakami - Das Casting
Ryu Murakami - Coin Locker Babys
Steven Millhauser - Edwin Mullhouse
Peter Rosegger - Weltgift
Mare Kandre - Bübins Kind
Mare Kandre - Aliide, Aliide
Nona Fernández - Die Straße zum 10. Juli
Originaltitel: Jan Kjærstad, Normans område
© 2011 H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard) AS, Oslo, Norway
Die Veröffentlichung dieser Übersetzung wurde ermöglicht durch die finanzielle Unterstützung von NORLA, Norwegian Literature Abroad
© 2017, Septime Verlag, Wien
Alle Rechte vorbehalten.
Lektorat: Rowena Körber
Umschlag: Jürgen Schütz
Umschlagbild: Welle © fotolia – Andrej Pol
Kompassrose © fotolia – Jameschipper
EPUB-Konvertierung: Esther Unterhofer
ISBN: 978-3-903061-54-5
Printversion: Hardcover, Schutzumschlag, Lesebändchen
ISBN: 978-3-902711-65-6
www.septime-verlag.at
www.facebook.com/septimeverlag
www.twitter.com/septimeverlag
Jan Kjærstad
zählt zu den bedeutendsten zeitgenössischen Autoren Norwegens. Der 1953 in Oslo geborene Schriftsteller studierte Theologie, war Pastor und Jazzpianist, später Redakteur der norwegischen Literaturzeitschrift Vinduet. Er veröffentlichte zahlreiche Novellen, Essays und Romane, von denen etliche ins Deutsche übersetzt wurden. Für sein literarisches Schaffen erhielt er mehrere Auszeichnungen, u. a. den renommierten Henrik-Steffens-Preis.
Er lebt als Autor und Kritiker in Oslo. 2013 erschien bei Septime sein Roman: Ich bin die Walker Brüder. 2016 erschien der Roman König von Europa, ebenfalls im Septime Verlag.
Klappentext:
John Richard Norman wächst in Oslos denkbar schönster Straße auf: an dem einem Ende befindet sich eine Schokoladenfabrik, am anderen die Segeltuchfabrik »Christiana«, jene Fabrik, die dazumal das Schiff der norwegischen Polarexpedition, die Fram, mit den Segeln ausstattete. In diesem Spannungsfeld, zwischen Süßigkeiten und Entdeckungsreisen, wächst John Richard heran und entwickelt sich zum Inbegriff des qualifizierten, leidenschaftlichen Lesers. Mehr noch: Die Wörter lesen und leben sind für ihn gleichbedeutend. Entgegen der Warnung seiner Mutter, dass es nicht gut sei, wenn man sich zu sehr in die Bücher, in die Fiktion vertieft, verschlingt er Bücher wie andere Schokolade. Dass er letztendlich ein herausragender Verlagslektor bei einem renommierten Verlag wird, dessen Autoren fast immer erfolgreich sind, verdankt er einer Gabe: Er weiß immer, wann ein Buch Schokolade ist und wann ein Segel. Als seine Lesefähigkeit unerwartet schwindet – und nicht nur das, denn plötzlich befällt ihn eine schwere Übelkeit, jedes Mal, wenn er ein Manuskript zu lesen beginnt –, sucht John Richard Zuflucht in einem Haus auf einer wenig bevölkerten Insel auf einer Landspitze am Meer. Dort taucht eine fremde Frau auf, in die er sich auf den ersten Blick verliebt, und die große Literatur wird von der großen Liebe in den Schatten gestellt. Oder doch nicht? »Dieses Buch handelt von den beiden wichtigsten Dingen im Leben: von der Liebe und von Büchern.« Jan Kjærstad
Jan Kjærstad
Das Norman-Areal
Roman | Septime Verlag
Aus dem Norwegischen von Bernhard Strobel
Gewidmet allen Lesern
Akbarville QX/QCX
File 12/Norwegen (Zeit: »21. Jahrhundert«).
Internationale Universität Guangzhou
Fakultät für Kognitive Paläontologie
I
1
Das Erste, woran ich denke, ist die Straßenbahn, die direkt auf mich zukommt. Riesig, unerklärlich und völlig überrumpelnd. Es ist ein Maitag Anfang der 90er Jahre, und ich sitze in einem Auto, genauer gesagt: einem Mercedes, in einem Stadtteil, mit dem ich wenig vertraut bin. Ich bin in Gedanken versunken, und ich merke erst, dass ich mitten auf den Gleisen stehen geblieben bin, als ich das Bimmeln der Straßenbahn höre wie das Geräusch eines diabolischen Weckers, begleitet von dem alptraumhaften Quietschen der Räder, als der Fahrer zu bremsen versucht. Die Straßenbahn fährt mit hoher Geschwindigkeit, und sofort wird mir bewusst, dass ich es nicht rechtzeitig wegschaffen werde. Die blauweiße Front bäumt sich auf wie ein Koloss, ein unheilvoller Turm, ein gigantischer Rammbock. Trotzdem höre ich nichts, nicht einmal einen Knall, als die Straßenbahn das Auto zerschmettert und es fünfzehn Meter vor sich her den Hügel hinunterschleift. (Riecht es verbrannt?) Ich weiß nicht, wie lange ich bei Bewusstsein war, ich erinnere mich nur, dass ich dachte, dass es eng wird, dass ich in einem Metallsarg liege, dass ich schon tot bin.
Der dramatischste Augenblick meines Lebens?
Ich bin mir da nicht so sicher.
Jedenfalls war es ein einschneidendes Erlebnis – nicht nur deshalb, weil ich lebensgefährliche Verletzungen erlitt, sondern weil ich im Krankenhaus Dr. Lumholtz begegnete.
2
Nein, so wird das nicht richtig. Ich muss mit jener Reihe von Ereignissen beginnen, die dazu führten, dass ich Dr. Lumholtz wiedertraf, viele Jahre später.
Ich muss mit ihr beginnen.
Ich bin allein in der Kajüte, und doch ist es, als ob sie mir direkt gegenüber säße, so nah, dass ich den Flaum auf ihren Ohrläppchen und das zarte Faltendelta erkennen kann, das von ihren Augenwinkeln zu den Schläfen verläuft. Es ist schon beinahe unheimlich, wie leicht es ist, in Gedanken zu jenem Herbsttag zurückzukehren, als ich in dem kleinen Laden beim Hafendamm stand und mich zwischen einer Tafel Firkløver und einer Melkesjokolade entscheiden musste, während der Duft aus den Regalen mir die Samstage meiner Kindheit und die Kioskbesuche mit meiner Mutter in Erinnerung rief, die Schwierigkeit des Auswählens; und gerade, als ich beschlossen hatte, beide Schokoladen zu kaufen, fast wie um zu feiern, dass von nun an alle Tage Wochenendenwären, hob ich den Blick und entdeckte die Frau mitten in meinem Gesichtsfeld. Das heißt, sie befand sich nicht mitten in meinem Gesichtsfeld, sondern sie stand ganz hinten bei der Obst- und Gemüsetheke. Fünf andere Menschen im Laden, und sofort schalten die Augen vier davon weg. Als wäre man ein Insekt, das über Fühler reagiert, chemisch. Noch immer erinnere ich mich an den Ruck, der durch mich hindurchfuhr, das kurzfristige Vakuum im Bauch. Denn es war sie. Sie, schon wieder. Es war das dritte Mal, dass ich sie sah. (»Aller guten Dinge sind drei«, sagte Mutter immer, wenn sie die dritte Tablette schluckte.) Und trotzdem – ich glaube, mich nicht zu täuschen – mischte sich auch Unmut hinzu, nachdem ich mich einen Augenblick davor noch an einer außergewöhnlichen Leichtigkeit im Körper erfreut hatte, ich konnte mit zwei Schokoladen in den Händen dastehen und denken, dass mein neues Dasein keine schwierigeren Probleme bereithielt. Außerdem hatte sich die Übelkeit vorübergehend verflüchtigt. Doch jetzt stand diese Frau dort bei der Obst- und Gemüsetheke, ohne Notiz von mir zu nehmen, und erzeugte eine Unruhe.
Natürlich habe ich mir den Kopf darüber zerbrochen, was sie an sich hatte, wieso sie, ihr Äußeres, so heftig in mir einschlug, aber ich habe darauf keine Antwort, genauso wie bei ein paar anderen Frauen – es sind wirklich nicht viele –, denen ich auf den ersten Blick verfallen bin. Sie stand da in ganz gewöhnlicher Freizeitkleidung, packte ohne Umstände Äpfel (Gravensteiner – sie hatten gerade Saison – gibt es einen besseren Apfel?) in eine Tragetasche, und bildete dennoch das Gravitationszentrum meiner Aufmerksamkeit, so einzigartig begehrenswert, dass ich alles andere um mich herum vergaß, einschließlich der Schokoladen (ganz zu schweigen von dem aufdringlichen Journalisten Morten Kleber, der womöglich im selben Augenblick, eine kaputte Kamera neben sich, eine infame Formulierung für seine Skandalschlagzeile ausklügelte). Ich weiß nicht, ob sie den Anflug von Atemnot bemerkte, meinen sicherlich unverhohlen neugierigen Blick. Sie drehte sich jedenfalls nicht zu mir um.
Ich, John Richard Norman (ja, der Norman), war zwei Wochen davor auf die Insel gekommen, in einem Taxi. Das war im Jahr 2008, nur damit das gesagt ist. Ich hätte den Bus von Fredrikstad nehmen können, aber ich mochte es, mit dem Taxi zu fahren, und wenn auf dem Halteplatz kein Mercedes-Benz stand, sagte ich immer, höflich, dass ich zu warten wünschte, bis einer eintraf. (Dr. Lumholtz lachte über meine PräferenzfürMercedes, wobei ich nicht glaube, dass dies einem freudianischen Hintergedanken geschuldet war. Im Übrigen erwähnte ich nie, dass diese Vorliebe mein Leben gerettet hatte.)
Ich saß mit einem zittrigen Gefühl auf dem gemütlichen Rücksitz, als wir vom Bahnhof nach Kråkerøy fuhren, und noch stärker wurde dieses Gefühl, als wir die ersten Brücken zu den weiter draußen gelegenen Inseln erreichten und alles sich öffnete, als würde ein Vorhang plötzlich aufgezogen und jemand würde gleichzeitig das Licht einschalten. Genau so war es. Denn das Licht änderte seinen Charakter, oder wurde auffallend licht, um es so zu sagen, weshalb ich spontan das Fenster hinunterkurbelte, um die Schärenlandschaft und die Meeresluft besser genießen zu können. Der ganze Anblick ergriff mich so ungewöhnlich stark, dass ich gleich darauf den Fahrer bitten musste, auf einen Rastplatz einzubiegen und den Motor abzustellen, damit ich auch die Meeresvögel hören und den Wind in den Ohren spüren konnte. Ich war noch einmal ein Lazarus. Irgendwie befreit. Bitte sehr, eine neue Möglichkeit. Alle Türen weit offen. Soweit ich mich erinnere, fing ich sogar an, Ulf Lundells bekannte Hymne zu summen. Ich streckte den Kopf aus dem Fenster und wusste mit jeder Zelle, dass meine Entscheidung richtig war. Oder um es mit Mutters Lieblingsschriftsteller zu sagen: Alles hat seine Zeit. Auch ein neues Leben. Oder, wie ich es damals sah, das Gesundwerden.
Das Zurückfinden. Zum Surtsey-Erlebnis. Zu meinem Spezialgebiet.
Wir fuhren weiter, und erst auf der äußersten Insel hielten wir an, auf der Westseite zum offenen Meer hin. Der Wagen kam nicht weiter als bis zu einem Wendeplatz ein paar hundert Meter vom Haus entfernt, und ich spazierte das letzte Stück auf einem Feldweg. Wer mich dort entdeckt hätte, würde sich gewundert, mich vielleicht für einen Geschäftsmann gehalten haben, der vom Weg abgekommen war. Ich trug eine schwarze Jacke, eine schwarze Hose, dazu ein – wie ich glaube – aufsehenerregend weißes Hemd. Den Leuten fielen immer meine Hemden auf, sie wollten wissen, wo ich sie gekauft hätte und wie ich es anstellte, sie so weiß zu bekommen. (Ja, es gibt einen Unterschied zwischen weiß und weiß.) Wieso hatte ich mir nicht etwas Passenderes angezogen? Erst jetzt wird mir bewusst, wie groß meine Zweifel im Vorfeld gewesen sein mussten (obwohl alles Praktische geregelt war: Wohnung, Post, Rechnungen). Für alle Fälle gab ich dem Fahrer doppelt so viel Trinkgeld wie üblich und bat ihn zu warten.
Es war Mitte September, und ich weiß noch, wie sehr es mich überraschte, dass noch immer so viele wilde Blumen auf den Wiesen zu sehen waren. Gelbe, weiße, auch die eine oder andere blaue. Ich kannte ihre Namen nicht, blieb aber stehen. Wann war ich das letzte Mal vor Pflanzen stehen geblieben? Auch vor einem Vogelbeerbaum musste ich kurz innehalten. Es kam mir so vor, als ob es lange her wäre, dass ich so nahe vor diesen orangeroten Beeren stand, die in meinen Knabenjahren so wichtig gewesen waren und deren Geschmack ich plötzlich allein durch ihren Anblick empfinden konnte.
Ich ließ die Taschen draußen und wanderte rasch durch die Zimmer des Hauses. Erst im Wohnzimmer blieb ich stehen, gefangen in einer Erinnerung: Das Haus war eine genaue Entsprechung dessen, was mein Vater, am Bett meiner Kindheit, als »unser Sommerhaus« beschrieben hatte. Die Zimmer, die Aussicht, alles. Ich glaube, ich lächelte. Was mir am allerbesten gefiel, war, dass es keine Bücher gab. Nicht ein einziges Buch im ganzen Haus, nicht einmal ein zerschlissener Western, etwas, das man als Fliegenklatsche verwenden konnte. Die großen Wohnzimmerfenster gingen aufs Meer, aber nicht einmal das übertraf die Zufriedenheit, die ich durch die fehlenden Bücherregale erfuhr.
Ja, kam es tief aus meinem Innern. Dies wird mein Puamahara, dachte ich.
Von der Treppe aus gab ich dem Fahrer ein Zeichen, dass er fahren könne. (Er wohnte auf der Nachbarinsel und ich hatte seine Visitenkarte.) Eine halbe Stunde später spazierte ich in das kleine Dorf, um etwas zu essen einzukaufen. Die anderen Kunden schielten neugierig zu mir herüber, sicher deshalb, weil ich mir nicht die Mühe gemacht hatte, mir etwas anderes anzuziehen. Wie um einem Gerücht oder was weiß ich zuvorzukommen, erklärte ich der Kassiererin (Frau Lorentzen, die auch die Inhaberin war, wie ich später herausfand), wo ich wohnte und was ich hier machte. Sie hieß mich herzlich willkommen auf Stjernøy. Besonders zu dieser Jahreszeit, in der sie gutbetuchte Kunden so dringend benötigten. Sie zwinkerte und gab mir eine Öko-Tragetasche »aufs Haus«. Sie fügte hinzu, ich solle einfach Bescheid sagen, wenn ich bei irgendwas Hilfe bräuchte. Ich weiß nicht, ob es das Hemd war, das Eindruck auf sie machte, jedenfalls wusste ich ihre Mischung aus Humor und Freundlichkeit zu schätzen. Überhaupt zeigten die Menschen, die »Einheimischen«, denen ich in den ersten Tagen begegnete, keine Anzeichen jenes geflüsterten, ordinären Geschwätzes und der schrägen, inzestuösen Ursprünglichkeit, von denen man glauben mag, dass sie in jedem Dorf zu finden seien, da man doch hier nichts anderes tue, als schlechte Romane lesen und Filme anschauen, die auf Biegen und Brechen sämtliche dramaturgischen Kniffe aus dem Lehrbuch beinhalten sollen.
Da war nur diese Frau, die herausstach, sie, die ich bald kennenlernen sollte. (Mit diesen Haaren würde sie überall herausstechen.)
Zurück im Haus bereitete ich mir meine erste, einfache Mahlzeit. Ich weiß nicht, woran es lag, aber alles wurde deutlicher, spürbarer. Das Messer, sein Gewicht, die Art und Weise, wie es in der Hand lag. Der blanke Stahl auf der Leberpastete. Der Duft. Dick aufgestrichen, doppelt so dick wie sonst, und ohne sie glattzustreichen (oder: Ich hatte diese Sorte Leberpastete mehrere Jahrzehnte nicht gegessen). Ich setzte mich ins Wohnzimmer, in einen Schaukelstuhl, den ich vor eines der nach Süden gelegenen Fenster schob. Wann war mir ein Essen das letzte Mal so gut bekommen? Es war ganz normales Brot, aber es schmeckte anders. Und entdeckte ich nicht sogar in der gewöhnlichen Leberpastete einen Hauch von Restaurant-Paté? Selbst der Filterkaffee wirkte speziell, erlesen. Ich aß, ohne etwas anderes zu tun oder an etwas anderes zu denken als an das Essen, und während ich aus dem Fenster sah, zu den Wellen, die sich weiß auf den äußersten Schären brachen, fand ich eine mögliche Antwort auf die Frage, warum mir die Mahlzeit so gut schmeckte: Ich hatte schlicht und einfach gewartet, bis ich Hunger bekam.
Den ganzen restlichen Tag saß ich und schaukelte langsam hin und her und ließ den Blick irgendwo dort draußen auf dem offenen Meer weilen. Was für eine Aussicht. Was für eine Erlösungfür … soll ich mich getrauen zu sagen, die Seele? Ich glaube, ich schickte einen Gedanken an Fred Olsen (»Da ist noch mehr, Junge. Da ist noch mehr!«). Undtrotzdem ließ es sich nicht vermeiden, dass ich bald ins Grübeln geriet. Woher kam diese Idee? Was hatte mich an diesen verhältnismäßig einsamen Ort geführt, in ein Haus auf einer wettergepeitschten Landspitze am Meer? Jäh ging mir auf, dass es etwas mit Amund Holth zu tun haben musste, dass sein Anblick erschütternder gewesen war, als ich mir eingestehen mochte. Einen Monat war es her, dass ich auf ihn gestoßen war, zu allem Überfluss auf der Karl Johans gate, der Prachtstraße des Landes. In dem schönen Spätsommerwetter war ich dort entlanggegangen, oder eher stolziert: soweit ich mich erinnere, strotzte ich geradezu vor Wohlbefinden, vielleicht auch vor Stolz, weil ich soeben an der Tanum-Buchhandlung vorbeigegangen war, wo ich vielen Buchumschlägen wiedererkennend zunicken konnte. Ich weiß sogar noch, was ich dachte, während ich den in der Sonne glitzernden Springbrunnen am Studenterlunden und die liebgewonnene Umgebung auf mich einwirken ließ: Alles ist perfekt. Und dann treffe ich Amund Holth. Das heißt, ich sehe nicht, dass er es ist, erkenne ihn nicht wieder. Doch der Mann, der an mir vorbeigeht, bleibt mit einem überraschten »Hei!« stehen. Und dann: »John Richard?« Ich zögerte, blätterte in der Porträtgalerie des Gedächtnisses, glaubte, es müsse sich um den Vater eines meiner Freunde handeln, doch es war Amund Holth, der zusammen mit mir zur Grundschule gegangen war; es war nur, dass dieser Amund Holth, also ein Altersgenosse, da vor mir stand mit grauem Haar und dem Gesicht eines – ich entsinne mich, dass ich mich weigerte, diese Worte zu denken – alten Mannes. Und es kam mir so vor, als ob es noch gar nicht lange her sei, dass wir als Kinder am Nationalfeiertag am 17. Mai diese Straße, die Karl Johans gate, hinaufmarschiert waren, mit vom Wasser glatt gekämmten Haaren, in blauen Blazern (in deren Innentasche ein Fünfzig-Kronen-Schein schwelte) und mit Fahnen in der Hand. Wir unterhielten uns lange, lachten viel, aber die ganze Zeit starrte ich auf dieses graue Haar, auf dieses, wie soll ich sagen, welke Gesicht. Trotz seiner heiteren Mimik wirkte Amund Holth »stehengeblieben«. Als wäre die Feder in seinem Uhrwerk kaputtgegangen. War das der leichtfüßige Grünschnabel, der Gorilla-Knutsen mit dem Blasrohr eine Vogelbeere ins Auge geschossen und dadurch eine Legende geschaffen hatte, die von mindestens fünfundzwanzig Personen für den Rest ihres Lebens in Erinnerung behalten und weitererzählt werden würde? Als ich später nach Hause schlenderte, halb im Schock, schwante mir, dass er bei meinem Anblick genau dasselbe gedacht haben könnte, obgleich in meinem Haar nicht mehr als eine Andeutung von Grau zu entdecken ist. (Amund, und während mir ein Schauder vom Steißbein bis zum Nacken hinaufkroch: Ist das John Richard, die Rotznase, die in der siebten Klasse ein ganzes Buch verspeist und in der Straße ohne Namen drei Lümmel fast zu Tode erschreckt hat?)
Holth! Wie ein Kommando. Es war nicht alles perfekt. Etwas war falsch. Was war falsch? Der Tod war falsch. Der Tod existierte. (Seit ich klein war, durchzuckt mich immer ein Schrecken, wenn Leute sagen oder rufen: Die Zeit ist um!)
An dem einem Tag feuerst du dem gefürchtetsten Lehrer der Schule eine Vogelbeere in die Visage, und dann, ohne zu merken, wie schnell die Tage vergehen, legt man dich in ein Loch in der Erde.
Ich saß im Schaukelstuhl (wie ein alter Mann?), plötzlich ratlos, warum ich mich hier auf der Insel befand. Hatte ich seit dieser Begegnung, diesem stechenden Memento mori, etwa nicht den Fluss der Zeit verflucht? War ich nicht voller Wehmut gewesen? Oder von einer größeren Wehmut als sonst? Denn das musste das größteRätsel des Lebens sein: dass es uns gelingt, die Unausweichlichkeit des Todes eine Armlänge auf Abstand zu halten, sogar aus dem Bewusstsein zu drängen. Dann begegnen wir Amund Holth, und ein Warnschild schnellt heraus wie ein Springteufel.
Sowie ich das gedacht hatte, wusste ich, dass ich dasselbe trotz allem auch früher schon gedacht hatte, ja, sogar schon, als ich noch ziemlich jung war. Ich fluchte innerlich, schaukelte hin und her und starrte auf einen Punkt am Horizont, der, obgleich es bereits Abend war, immer noch zu sehen war. Der Tod, obwohl schrecklich, war ein triviales Problem. Weil es unlösbar war. (Sogar Walt Whitman griff hier zu kurz.) Man konnte sich vorbereiten, das ja, aber lösen konnte man es nicht. Ich erinnere mich, wie sehr es mich ärgerte, dass ich mich mit diesem grausamen, aber dennoch floskelhaften Gedanken abzulenken versuchte. So banal, oder fast hätte ich gesagt: konventionell, war der Grund meiner Reise nicht. Abgesehen davon: Ich war ja bereits tot. Ich brauchte nicht an den Tod zu denken.
Und die Übelkeit?
Ja, die Übelkeit. Aber was steckte dahinter?
Ich glaube, zumindest eins kann ich beschwören: Das Letzte, woran ich dachte, waren Frauen.
Oder Vishnu. Die Möglichkeit von etwas wie Vishnu.
Ich kam nicht dazu, weiter darüber nachzudenken. Ich schlief im Schaukelstuhl ein. Von einem Moment auf den anderen. Auch das war eigenartig. Normalerweise hatte ich Probleme, überhaupt einzuschlafen.
3
Ich bitte um Geduld. Ich weiß, das klingt wie eine bekannte Geschichte, aber ich verspreche, es ist eine Geschichte, die anders ist, eine, die noch nie erzählt worden ist. Gerade deshalb fällt mir die Darstellung so schwer. Ich befürchte, die Geschichtekönnte unverständlich werden, oder schlimmer: als Erfindung abgetan werden. Vielleicht wird dies hundert (tausend?) Jahre zu frühgeschrieben. Denn ich, John Richard Norman, auchder Käpt’n genannt, war eine Sensation. Ich wollte das Verb ins Präsens setzen, bin mir dessen aber nicht mehr so sicher, und auch Dr. Lumholtz kann keine Abhilfe schaffen. Jedenfalls – ich muss alles der Reihe nach angehen – galt ich zu der Zeit, als ich auf der Insel ankam, noch nicht als Sensation.
Am ersten Morgen im Haus spürte ich noch immer einen Anflug jener Übelkeit, die mich mehrere Monate lang gequält hatte. Ich ging nackt auf die Terrasse. Es war warm und windstill. Ich holte so tief Luft, wie ich konnte. (Das hatte ich in der Stadt nie getan, wie mir bewusst wurde.) Und wieder war ich wie gebannt von der Aussicht, besonders nach Westen und Südwesten. Meer, so weit das Auge reichte. Ein neuer Horizont – war es nicht das, wonach alle strebten? Ich folgte dem Pfad zu einer Bucht direkt unterhalb, zu einer Stelle, von der aus ich mich, mit ein wenig Vorsicht, ins Meer hinausgleiten lassen konnte. Das Wasser war kalt, wenn auch nicht abschreckend kalt. Eher war es das Salz, das mich überraschte, als hätte ich das Erlebnis des Meeres vergessen, das weiße Brausen, das Brennen in den Augen nach dem ersten Untertauchen. Ich schwamm hinaus, drehte mich auf den Rücken und sah, wie schön das Haus in der Landschaft lag. Die Kiefern ringsum hatten seltsam flache Spitzen und glichen Akazien, so als befände ich mich in einem anderen Land. Das Gebäude lag ganz für sich allein auf der Landspitze, mit einerLängsseite (teilweise geschütztdurch eine Felskuppe) zum Meer hin, mit der anderen zur inneren Bucht. Von hier aus sah ich nicht einmal bis zum nächstgelegenen Haus, ich konnte mir einbilden, ich wäre allein auf der Insel.
Auf dem Weg nach oben musste ich mehrmals stehen bleiben und das ungewohnte Gefühl von glattem Fels unter den Fußsohlen in mich aufnehmen. Es erinnerte mich an meine Gymnasialzeit, die Wanderungen zu Carinas Hütte in Vestfold. Kleine Sommersünden. Ich weiß nicht, ob diese Erinnerung mit hineinspielte, doch als ich dort stand, nackt auf einem Felsvorsprung, und dem Ozean vor mir sozusagen einige freundliche Worte zuraunte, spürte ich kein grummelndes Zeichen mehr, dass mein Allgemeinzustand aus dem Gleichgewicht geraten war. Ich entschied mich, hier zu bleiben, das heißt, ich erkannte, dass ich mich entschieden hatte, als ich kurze Zeit später die wenigen Dinge auspackte, die ich mitgenommen hatte, allem voran Hemden, die nicht weiß waren, Alltagskleidung. Sonst war im Haus das meiste vorhanden. Ich legte meine Lebenserinnerungen auf den Tisch neben dem Schaukelstuhl, wollte sie in der Nähe haben, obwohl ich mir nicht sicher war, ob ich sie überhaupt aufschlagenwürde.
Beim Frühstück fiel mir erneut auf, dass mir das Essen besser schmeckte als sonst. Es musste mehr dahinterstecken als nur der Hunger, es mochte etwas zu tun haben mit dem Kontrast zu den opulenten Frühstücksbüffets, den ausgefallenen Tapas und fünfgängigen Abendmenüs, von denen ich mich jahraus, jahrein mehr oder weniger kontinuierlich ernährt hatte. Der kleine Laden im Ort verfügte über eine tadellose Auswahl an Waren, besaß aber trotz allem kaum etwas von den ausgefallenen Dingen, die ich, bei den seltenen Gelegenheiten, wenn ich zu Hause aß, in der Stadt einzukaufen pflegte (Frau Lorentzen beäugte mich mit einem scheelen Blick, als ich fragte, ob sie Manchego-Käse führten). In diesen ersten Tagen waren meine Brote plötzlich mit Dingen belegt, die mich in der Zeit zurückführten. Käse und Radieschen, gekochte Eier und Kaviar, Räucherschinken und Senf. Honig. Dieses goldene Naturprodukt (Honig aus Hymettos!). Was für ein Wunder! Braunkäse und kalte Milch. Wohlschmeckend bis tief ins Mark – und nicht aus Genügsamkeit, sondern von Natur aus. An sich. Salami, fast hätte ich gesagt: norwegische Salami. War das nicht unschlagbar? (Oder war es auch deshalb unschlagbar, weil es das Bild von Vaters eifrigem Gesicht über dem Schneidebrett heraufbeschwor, seine großen, warmen Hände, die eine dicke Scheibe duftender Salami, zusammen mit zwei feuchten Gurkenscheiben, auf den Teller legten, auf diesen Teller, der mich all die Jahre begleitet hatte, weiß mit blauen Blumen am Rand.) Auch eine Zeitung vermisste ich nicht, stattdessen nahm ich die Brote und die Kaffeetasse, die einen Sprung hatte, mit hinaus auf die Terrasse. Dort saß ich und aß, nur in der Unterhose, genoss die Meeresluft und – ich musste lang nachdenken, bis ich herausfand, was es war – das Gefühl von Weite. Das Fehlen von Schranken. Das Fehlen von … da war das Wort: Enge. Wenn es etwas gab, das mich all die Jahre, seit meiner Kindheit, gequält hatte, dann war es die Empfindung, in einem zu kleinen Raum eingepfercht zu sein.
Danach ging ich barfuß durchs Gras, staunte gleichzeitig, wie grün es war, es wirkte sogar noch grüner, noch samtartiger als vor ein paar Monaten. Ebenso überraschte es mich, wie viele Schmetterlinge noch immer herumflatterten. Sie ließen sich auch aus der Nähe studieren, wenn sie sich irgendwo niederließen und ihre Flügel ausbreiteten, um sie zu trocknen oder wozu immer sie das taten. Lange saß ich in der Hocke, die Kaffeetasse in der Hand, und bewunderte das Muster der Flügel von einem der Tiere, als ob ich in diesen Figuren etwas wiedererkannte, etwas, das jenseits von Worten lag. Ich hatte keine Ahnung, wie diese Art hieß. Auf einmal wurde mir bewusst, wie beschämend das war. Ich wusste viel, doch die Namen dieser schönen Geschöpfe kannte ich nicht. Ich hätte auch nicht angebenkönnen, was für Bäume das waren, die ganz innen in der Bucht auf der Hinterseite des Hauses standen, zwei kolossale, verschiedenartige Laubbäume. Wie um zu verbergen, dass es mir an so grundlegenden Kenntnissen mangelte, nannte ich sie Hammurabi und Nebukadnezar, ich weiß nicht, warum. (Dieser ganze, wie soll ich sagen, Hunger nach präzisen Bezeichnungen traf mich im Grunde vollkommen unerwartet. Ich war der Natur gegenüber immer skeptisch gewesen. Hatte nie ein Bedürfnis nach ihr verspürt. Man könnte gut sagen, dass ich gegenüber der Wirklichkeit generell skeptisch war. Der »Wirklichkeit«.)
Im Laufe der ersten zwei Wochen stieß ich zwei Mal auf sie, bevor ich sie bei der Obst- und Gemüsetheke im Laden entdeckte, und es war bei einem Abendspaziergang an diesem zweiten Tag, dass ich sie zum ersten Mal traf. Ich war sozusagen aufs Geratewohl losgewandert, als ich auf der Südseite der Insel auf eine geschützte Bucht mit sichelförmigem Sandstrand stieß. Ich zog mir die Schuhe aus und ging mit langsamen Schritten bis zur Brandung, drehte mich um und betrachtete meine Fußspuren in dem weißen Sand, ich habe Bögen, Kurven schon immer lieber gemocht als gerade Strecken, keine Ahnung warum, es hat vielleicht mit einem vagen Gefühl von Zentripetalkraft zu tun. Große Steine lagen an mehreren Stellen herum, gut geeignet, um darauf zu sitzen, wenn man die Gedanken in den Leerlauf schalten oder sich nur auf die Geräusche des Wassers konzentrieren will, auf den Wind, die Formen der Kiefern im Halbdunkel (irgendetwas an den Zweigen ließ mich an Haiku-Gedichte denken).
Ich hatte mir eine Windjacke geliehen, die im Vorzimmer hing, und zwischen dem ganzen Zeug, das sich in den Taschen befand, war auch eine Streichholzschachtel gewesen. Weil ich ein bisschen fröstelte, kam mir die Idee, ich könnte zwischen drei Steinen, die mir passend erschienen, ein Lagerfeuer anzünden – es lag reichlich Treibholz herum und Zweige, die von den Kiefern abgefallen waren. Es gelang mir, Feuer zu machen (auch das war eine Freude, ein kleiner Triumph, ich erinnerte mich sogleich an die Lagerfeuer zusammen mit Viggo – und Amund Holth! – unten am Akerselva, aus Bretterteilen, die wir auf Baustellen fanden), und ich legte mehr Holz nach. Es wurde ein großes Feuer, ein Feuer, das mich begeisterte, mich stolz machte oder wie immer ich sagen soll. (Hat nicht übrigens Haruki Murakami eine prächtige Erzählung über Lagerfeuer geschrieben?) Ein Geruch wie nach Weihrauch. Ein Stück weiter weg setzte ich mich und ließ eine Handvoll weißen Sand nach der anderen durch meine Finger rieseln, versank in eine elegische Stimmung. Oder in einen Zustand behaglicher Sentimentalität. Dieser Hang zu Feuer – was war das? Eine Lust, Opfer darzubringen? Oder umgekehrt, ein Feiern dessen, die Mächte überlisten zu können? (Dr. Lumholtz behauptete, in mir wohne ein stärkerer Lebensfunke. Habe ich deshalb Lagerfeuer immer gemocht?)
Und dann – meine Aufmerksamkeit erwachte auf tierische Weise: Ich hörte Ruderschläge auf dem Wasser. Jemand näherte sich rudernd. Ich war verunsichert. Wer ruderte heutzutage noch? Es war ein kleines Boot, ich erkannte einen Außenbootmotor, der jedoch nach oben geklappt war. Das Boot glitt näher heran, wie vom Lagerfeuer angezogen, und hielt höchstens zwanzig, dreißig Meter entfernt. Die Person manövrierte mit den Rudern so, dass das kleine Holzboot parallel zum Ufer zu liegen kam. Es war eine Frau.
Meine spontane Reaktion war komisch. Husch! dachte ich, als ob ich im Geiste versuchte, sie zu verscheuchen. Denn ich ahnte sofort, dass das, was da herangeschwommen kam, eine Versuchung war. Etwas, das meine Gemütsruhe störte. Meine langersehnte Gemütsruhe. Ich will es nicht mit Sicherheit sagen, aber ich glaube, ich witterte auch eine Gefahr.
Sie trug einen dicken Pullover, und einen Augenblick war ich von dessen Strickmuster (schwarzweiß?) genauso gebannt wie einige Stunden zuvor von dem Anblick der Schmetterlingsflügel. Und genauso verärgert, weil ich nicht imstande war, es zu identifizieren. Waren das Selbu-Rosen, dieses stolze norwegische Muster? Ihr Haar wirkte dunkel, und sie hatte es auf eine Weise hochgesteckt, die mich verwirrte. Als hätte die Frau sich eben noch in einer Gesellschaft befunden, und plötzlich hätte sie den Einfall gehabt, hinauszugehen und Ruderboot zu fahren, sich nur schnell einen alten Pulli übergeworfen. Hatte sie nicht auch einen langen Rock an? Es war so still in der Bucht, dass ich das Wasser von den Ruderblättern tropfen hörte. Die Frau im Boot. Ein Bild, irgendwas aus einem Film? Sie wendete das Heck in meine Richtung, so dass ich sie von vorn sah. Es war noch nicht ganz dunkel und ich konnte ihre Gesichtszüge erkennen. Und den Blick spüren, den sie auf mir ruhen ließ. Fragend, wie ich dachte. Oder intensiv. Forschend. Sogar im Dämmerlicht konnte ich die Anziehungskraft in diesem Blick spüren. Ich konnte meine Augen nicht von ihr losreißen, sie schienen irgendwo hängengeblieben. Ich wollte aufstehen, aber ich war wunderbar kraftlos (sind das Worte von Sigrid Undset?).
Ich sagte Hei. Es klang lauter, als ich beabsichtigt hatte. Sie sagte nichts, saß nur völlig still und betrachtete mich. Ich fragte mich, ob der Strand womöglich ihr gehörte und sie mir mitzuteilen gedachte, dass Lagerfeuer hier verboten seien. Doch sie blieb stumm, bewegte nur leicht die Ruder, damit das Boot in Position blieb. Die Flammen spiegelten sich in der Lackierung. Das Gluckern von Wasser gegen Holz vermischte sich mit dem Knistern des Feuers. Lange saß sie so da, saß still und beobachtete mich, der in dem Licht des Feuers sicher besser zu sehen war. Als ob sie das amüsierte.
Dann ruderte sie wieder hinaus. Ich stand auf, wusste nicht, wieso. Vielleicht aus purem Eifer oder weil ich die Anspannung imKörper abschütteln musste. Ich stand barfuß in dem weißen Sand und sah sie mit langsamen, kraftvollen Ruderschlägen davongleiten. Ein gutes Stück weiter draußen warf sie den Motor an und verschwand.
In dem Moment dachte ich, dass ich sie nie wiedersehen würde. Die Vorstellung der Gestalt im Boot als etwas Unwillkommenes, einer gefährlichen Ablenkung, machte dem Gedanken Platz, der ganze Zwischenfall könnte etwas Denkwürdiges an sich haben (ich hatte sogar die spontane Eingebung, ein Schriftsteller könnte diese Szene in einer Geschichte verwendet haben). Es ist nichts passiert, sagte ich zu mir. Bleib locker. Konzentrier dich auf das, weshalb du hierhergekommen bist.
Ich warf mehr Holz ins Feuer, legte mir die Jacke unter den Hintern und setzte mich. Ich fand ein paar glattpolierte Steinchen und fing an, sie in der Hand zu rollen wie die Murmeln in meiner Kindheit. Ich weiß nicht, wie es geschah, doch als ich das nächste Mal aufschaute, war das Feuer ausgegangen. Es wirkte, als ob ich mich selbst hypnotisiert hätte, als wäre ich irgendwo anders gewesen (ich bewahrte die Steinchen auf, aber es gelang mir nie, den Trick, oder wie ich es nennen soll, zu wiederholen). Ich schnürte mir die Schuhe zu und schippte Sand über die restliche Glut. Auf dem Heimweg fiel mir dann doch auf, dass etwas geschehen war, dass etwas sich in meinem Zwerchfell regte. Eine kleine Flamme? (D. H. Lawrence jedenfalls hätte sich für keine fünf Pfennig so ausgedrückt.)
4
Die nächsten Tage verwendete ich darauf, mich zurechtzufinden, spazieren zu gehen, die Insel zu erkunden, still stehen zu bleiben und nur zu lauschen – auf den Wind, das Wasser, auf nichts – oder im Schaukelstuhl zu sitzen, über das Meer hinauszublicken, während die Gedanken jene Sphären durchstöberten, die Worte nie erreichen. Ich war überrascht über meine Anpassungsfähigkeit, darüber, dass ich auf einmal Gefallen daran fand, ins Blaue hinein zu leben, das Schattenmuster auf einem Tisch zu betrachten, das das Sonnenlicht durch die Spitzenvorhänge in einem der Zimmer warf, oder zuzusehen, lange – eine halbe Stunde –, wie die Flamme um einen Kerzendocht spielte. Ich nahm mir Zeit, Staub zu wischen, Spinnweben zu entfernen, das Bettzeug auszuschütteln, Teppiche auszuklopfen, ein bisschen aufzuwischen. (Das Seltsame war, dass mir das Freude machte.) Wenn ich darüber nachdenke, war diese erste Zeit von einem ungewohnten Duft erfüllt, auch wenn ich nie herausgefunden habe, woher dieser Duft kam. Sofern es nicht die Luft selbst war. Vielleicht war es das, in was ich mich am meisten verliebt hatte – nicht das Licht, nicht das Meer, sondern dieses Erlebnis von Luft. Die leicht salzige Note. Allein auf dem Felsen vor der Terrasse zu stehen war so erfrischend wie eine Dusche. Dachte ich an die Frau im Ruderboot? Hatten die Nervenzellen bereits ein unauslöschliches Selbu-Muster in meinem Kopf erzeugt? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht an sie dachte. Die Begegnung schien irgendwie unwirklich, verwandt mit einer Halluzination. (Gibt es so etwas wie Abendhalluzinationen?)
In den Tagen, bevor ich sie wieder sah – fast hätte ich gesagt: in Wirklichkeit –, war es eher die Übelkeit, die mir zu schaffen machte. Denn es war nicht der Tod, der mich hierher geführt hatte, der Tod hatte mir immer eine Heidenangst eingejagt, und damit basta. Nein, die Übelkeit war das Problem. Das Unwohlsein. Die Befürchtung, meine Karriere könnte sich dem Ende zuneigen.
Acht Jahre sind vergangen, seit ich auf der Insel war. Oder, ich muss nachdenken. Doch, es stimmt. Acht Jahre. (Würde Amund Holth mich jetzt wiedererkennen?) Ich vermute, der Grund, weshalb diese nicht recht zum Thema passenden Gedanken über den Tod sich hier eingemischt haben, ist darin zu suchen, dass mir vor vierzehn Tagen ein eiskalter Hauch aus der Zeitung entgegenwehte: Dr. Lumholtz ist tot. Zwar war es seit nunmehr drei Jahren still um ihn gewesen, aber trotzdem. Hier saß ich in der Kajüte, unter der Kupferlampe, die mit einer der mitreißendsten Geschichten meines Lebens aufgeladen war, und betrachtete die Todesanzeige, dieses kleine Fensterchen auf der Zeitungsseite, das sich auf eine Aussicht (eine Eiswüste?) hin öffnet, die wir nicht sehen wollen. Am nächsten Tag konnte ich den kurzen, prosaischen Nachruf lesen, verfasst von einem seiner Kollegen. Einst hatten die Zeitungen Dr. Lumholtz mit einer Schlagzeile nach der anderen geehrt. Eine ganze Nation war stolz auf seine wissenschaftliche Leistung (»der Roald Amundsen des Gehirns«). Nun war dieser elektrische Mensch, dieser radikale Vorläufer, nicht mehr wert als eine dürftige, knochentrockene Zeitungsnotiz. Seine gewagte (oder meinetwegen: umstrittene) Theorie in einem einzigen Satz knapp angedeutet. Das Norman-Areal nur ein einziges kümmerliches Mal erwähnt. Doch kein Wort über die Eros-Umwandlung oder den Supracortex, nicht der kleinste Hinweis auf seinen Leitgedanken: das wundersame Nea Ge.
Seit ich diese Zeilen gelesen habe, fühle ich eine Unruhe. Ich weiß nicht, was geschehen wäre, hätte ich nicht einige Tage später einen Stoß bekommen – man könnte sagen: einen Anstoß zum Schreiben. Ich musste in besagter Kupferlampe eine Glühbirne wechseln, und weil sie erstens alt war und ich zweitens unvorsichtig zu Werke ging, bekam ich einen Stromstoß. Zwar nur eine kleine Ohrfeige, doch das genügte, um eine Kettenreaktion von Gedanken auszulösen: Ich konnte sterben, jederzeit, durch einen idiotischen Unfall wie diesen. Und noch wichtiger: Ohne dass ich meine Geschichte erzählt hätte. Da fiel mir etwas ein, das Stine Harr (mein schlechtes Gewissen) mir einmal gesagt hatte: Dass die Geschichtensammlung Tausendundeine Nacht, ihr Lieblingsbuch, in Europa durch die Übersetzung des Franzosen Jean Antoine Galland bekannt geworden war. Wenige wüssten allerdings, dass Galland neben den Geschichten des arabischen Originaltextes auch einige Erzählungen in die Sammlung aufgenommen hatte, die er nur von einem mündlichen Erzähler, einem Syrer namens Hanna Diyab, gehört hatte – darunter »Aladin und die Wunderlampe« und »Ali Baba und die vierzig Räuber«. Hätte Hanna Diyab diese Geschichten nicht an Galland weitererzählt, wäre ein so fabelhaftes Märchen wie »Aladin« bis heute unbekannt.
Der Stromstoß, das Berühren meiner eigenen magischen Lampe, wurde ein Ansporn. Ich hatte eine Geschichte, von der niemand sonst wusste. Ich habe ein Licht in der Stirn. Ein glühendes Gewebe. Ich muss davon erzählen, dachte ich. Irgendwem. Die Nachricht von Dr. Lumholtz’ Tod schlug in mir ein fast wie ein Ruf: Ich muss schreiben! Er war es, der gesagt hatte, ich sei eine Sensation. Ich hätte tot sein sollen – ein Sprung in meinem Schädelknochen und ein Riss in der Herzwurzel beweisen das. Stattdessen wurde ich ein Phänomen (»Wer weiß«, sagte er. »Angenommen, Sie sind der Prototyp eines neuen Menschen?«). Ich muss mich beeilen und von dem Auslöser erzählen, dachte ich. Dem eigentlichen Auslöser. Vielleicht spürte ich auch einen Anflug von Panik. Es gab nur noch mich.
Also habe ich ein Versprechen gegeben: Ich werde meine Version beitragen, bevor es zu spät ist. Ich werde so viel wie möglich aufschreiben, solange die Erinnerung noch brauchbar ist, und ich werde mich auf das knappe Jahr auf Stjernøy konzentrieren, die neun Monate, in denen so viel passiert ist. Jemand muss davon erfahren. Jemand muss es weiterführen. Jemand muss dafür sorgen – und das ist wohl genauso wichtig –, dass diese Geschichte eine Fortsetzung findet.
*
In den ersten Tagen auf der Insel konnte ich niemanden in der Nähe des Hauses beobachten, und ich vermisste die Gesellschaft auch nicht. Dann, zweimal innerhalb kurzer Zeit, wurde ich gestört. Nach etwas mehr als einer Woche – es muss an einem Samstag gewesen sein – bog ein kleiner Alfa Romeo auf den Parkplatz am Ende des Feldwegs. Ich saß zufällig auf der Treppe und schaute hinüber zu Hammurabi und Nebukadnezar, bewunderte nachgerade ihre noch immer grünen, wogenden Baumkronen (gut möglich, dass die Gedanken zu Jean Gionos erbaulicher Allegorie wanderten, Der Mann, der Bäume pflanzte), sah mich jetzt jedoch gezwungen, den Blick der Frau zuzuwenden, die aus dem Auto stieg (und die das Herausschwingen des Körpers aus einem Auto zu einer Kunst erhob). Sie blickte sich um, als suche sie nach anderen Häusern, anderen Möglichkeiten, bevor sie in meine Richtung ging. Eine John-Lennon-Brille mit blauem Glas. Als sie fast da war, hob sie die Hand, vielleicht ein bisschen nervös. Ich winkte zurück, stand auf und ließ mich von ihren Armen empfangen. Sie hielt mich lange umklammert. »Bitte, komm rein«, sagte ich fast betreten und öffnete ihr die Tür.
Im Wohnzimmer befestigte sie ihre Sonnenbrille wie einen Haarreifen am Kopf und sah sich forschend um, vielleicht auch mit einem kleinen Lächeln. »Hier hältst du dich also auf«, sagte sie. »Auf einem Boot. Gehört sich wohl so für den Käpt’n?«
Sie spielte auf all die maritimen Gegenstände an, alte Navigationsinstrumente, Gemälde von Segelschiffen, Knotentafeln, Wimpeln, Schiffsrudern und Laternen. Auf dem Boden vor einem Fenster war sogar ein Maschinentelegraph angeschraubt. Als ob man sich, im Unwetter, einbilden könnte, man stünde auf der Kommandobrücke und würde Befehle an den Maschinenraum weitergeben, den Hebel von VOLL auf HALB schwenken.
»Wie hast du mich gefunden?«
»Hast du vergessen, dass ich Christian auch kenne?«, fragte sie.
»Ich kann dir nicht viel anbieten, ich habe nicht mit Gästen gerechnet«, sagte ich. »Aber du kannst Kaffee haben. Brot. Ich habemehrere Sorten Kekse.«
»Nur ein Glas Wasser. Ich habe auf dem Weg hierher gegessen.«
»Hast du dich ausnahmsweise an die Geschwindigkeitsbegrenzung gehalten?«
Sie tat, als hörte sie mich nicht, lächelte aber. »Wieso bist du nicht ans Telefon gegangen?«
»Ich habe mein Handy schon am ersten Tag ausgeschaltet«, sagte ich. »Nachdem hundert Idioten versucht hatten, mich zu erreichen.«
Sie drehte eine Runde, bog in die anderen Zimmer, studierte alte Porträts an den Wänden, bevor sie wieder zurückkam. »Dann bist du also sozusagen ins Kloster gegangen?«, fragte sie und nahm das Wasserglas entgegen.
»Zeit, Buße zu tun«, sagte ich. »Du weißt schon, das rüpelhafteBenehmen, dieser Berg aus Egoismus.«
»Ironie war nie deine Stärke«, sagte sie. »Was, wenn es etwas Wichtiges wäre?« Sie trug eine dünne, kurze Lederjacke, die ich noch nie an ihr gesehen hatte, die jedoch von einem Sinn für das Exklusive zeugte.
»Esist nie wichtig«, sagte ich. »Wenn eswichtigwäre, würden die Leute herkommen. So wie du.«
»Abgesehen davon, dass die Leute nicht wissen, wo du bist«, sagte sie.
»Verrat es auchkeinem«, sagte ich. »Kein Wort. Versprich mir das, Silje.«
Sie blieb mir die Antwort darauf schuldig. Vielleicht lag es ihr auf der Zunge zu erwidern, dass ich ohnehin wenige Freunde hätte. Sie sagte es nicht. Ich setzte mich in einen der alten Lehnstühle. Sie schlug mehrmals auf eine Schiffsglocke aus Messing, die an der Wand hing, bevor sie sich in den anderen Stuhl sinken ließ.
»Kann ich mir eine Pflaume nehmen?« Das war nicht als Frage gemeint. Sie nahm eine der blauen oder annähernd violetten Früchte (die mich aus irgendeinem Grund an Paul Gauguin denken ließen) aus der Schüssel auf dem Tisch und aß sie auf eine Weise, die mich zum Lächeln brachte. Sie hatte eine Art, Pflaumen zu essen, gute Dinge zu essen, die viele Erinnerungen mit sich brachte. Warme Erinnerungen. Ich hatte die Pflaumen von Frau Lorentzen bekommen (»Aus meinem eigenen Garten, viel besser als die, die wir im Laden verkaufen«, hatte sie gesagt, während sie mir verschwörerisch zuzwinkerte).
Silje leckte sich die Finger, langsam, begehrlich. Und dann, ein anderer Blick: »Trinkst du?« Ihrem Gesicht entnahm ich, dass die Frage die ganze Zeit unterschwellig mitgeschwungen war.
»Ich habe keinen Tropfen Alkohol getrunken, seit ich hier bin«, sagte ich.
Sie wechselte das Thema, wie um ihre Unruhe zu übertünchen. »Wieso bist du nicht weiter weg gefahren? Ich meine, wenn du das Bedürfnis hattest, dich zu isolieren. Oder nicht gestört zu werden. Das ist nicht gerade eine einsame Insel.«
Da war was dran. Tatsächlich hatte ich, halb im Ernst, einen Ort in Erwägung gezogen, der weiter entfernt lag. Gefährlicher war. Oder sagenumwobener. Ulaanbaatar. Cusco. Mogadischu. (Ja, Mogadischu, das wäre was gewesen!) Zumindest die Landesgrenze hätte ich überqueren sollen. Ein Meer. Wohin war Stevenson nochmal gereist? Samoa? Wenn ich mich schon nicht in die Ferne begab, hätte ich es wenigstens ein bisschen mehr ausweiten sollen, ein Projekt finden, es machen wie Thoreau, eine Hütte bauen. Mich wirklich freimachen. Mich nur darauf konzentrieren, zu leben. Erschöpft sein vom Graben eines Deichs. Fischen. Lernen, wie man Hummerfallen baut (die Saison fing auch bald an).
»Einen solchen Ort gibt es nicht«, sagte ich endlich. »Die Gefahr, dass jemand mich hier findet, ist weniger groß als irgendwo in den Bergen von Hokkaidō, Japan.« Ich sah aus dem Fenster und fügte hinzu: »Ich hatte nur einen Wunsch. Ich wollte das Meer in der Nähe haben. Mich mit dem besten Gesprächspartner der Welt unterhalten.«
Ich hätte sagen können, dies sei mein Puamahara.
Sie hätte es nicht verstanden. Möglicherweisehätte kein einziger Mensch in Norwegen das verstanden. Puamahara war ein Wort, das ich mitnur wenigen anderen teilte. (Einer Sekte? Nein, keine Sekte, eher eine Gemeinschaft quer über die Landesgrenzen hinweg.)
»Du hättest wenigstens irgendwohin fahren können, wo es wärmer ist«, sagte sie. »Auf eine griechische Insel.«
Ich schnaubte, obwohl ich es gar nicht wollte. »Du weißt, ich hasse die Hitze. Ich mag Unwetter, kaltes Wasser. Stjernøy ist mein Patmos.«
Oder besser, wie mir gleich darauf einfiel: Mein Galapagos. Hatte ich etwa nicht gehofft, ein paar Entdeckungen zu machen? Kühne Ideen zu empfangen? Die Assoziation an Thoreau hatte ein ganzes Sammelsurium anderer Gedanken herbeigeführt. Emerson. Hawthorne. Whitman. Und dahinter wiederum: Melville. »Ich habe den Plan, endlich etwas aus meiner alten Vision zu machen«, sagte ich. »Walt und Herman mit Hilfe von David Herbert zu vereinen.«
»Der Concord-Traum«, murmelte sie, nickte. Immerhin war sie eine von äußerst wenigen, die mit einem Vornamen wie David Herbert etwas anzufangen wussten – aber sie lachte, so wie sie immer lachte, wenn sie nicht an das glaubte, was ich sagte. Mir lag ein Zitat auf der Zunge, einer von Ismaels Gedanken über die Anziehungskraft des Meeres in Moby-Dick, ich sagte aber nichts mehr dazu.
»Fehlt dir irgendwas?«, fragte sie. »Du siehst nicht besonders gut aus.«
Ich entschied mich, das mit der Übelkeit für mich zu behalten.
»Du würdest es mir sagen, wenn du krank bist, oder?«
»Natürlich«, sagte ich.
»Hast du Mama noch immer nichtgesehen?«
»Leider«, sagte ich. »Immer fragst du mich danach.« Sie wollte, dass wir uns trafen, das wusste ich.
Wieder wanderte sie im Wohnzimmer herum, während sie ungläubig den Kopf schüttelte. »Kein einziges Buch«, sagte sie. »Wie hältst du das aus? Für dich muss das sein, wie wenn ein Alkoholiker in ein muslimisches Land kommt, ohne Zugang zu …«
Ein ängstlicher Blick, als bereue sie ihre Wortwahl. Sie bemerkte das Buch nicht, das auf dem Tisch beim Schaukelstuhl lag. Lebenserinnerungen. Meine tragbare Bibliothek. Ich hatte es noch nicht geöffnet.
»Hast du gekündigt?«, fragte sie.
Ich musste nachdenken. »Nein, ich hab nicht gekündigt.«
»Ichglaube, ich habe da so eine Ahnung, woher das kommt«, sagte sie nach einer langen Pause, irgendwie vorsichtiger. »Wo du doch gerade deinenFünfzigsten gehabt hast.«
Dieses Mal schnaufte ich ganz bewusst. »Du bist zu klug, um mit diesem Klischee daherzukommen. Silje, bitte. Du unterschätzt mich. Ich hatte einfach das Bedürfnis … Ich musste einfach … die Umgebung wechseln. Mir ist bewusst geworden, dass es schon eine Weile her ist, seit ich mir Zeit genommen habe, einfach nur das Leben zu genießen. Kannst du das nicht akzeptieren?«
Der Gedanke an die Feier zu meinem fünfzigsten Geburtstag tauchte nichtsdestoweniger auf. Ein Triumph. Ein Alptraum. Letzteres war den Ansprachen geschuldet. Diese ganzenLügen. Oder vielleicht war nur ich es, der es als Lügen empfand.
»Du hast einesehr selbstkritische Rede gehalten«, sagte sie.
Ich schlug mit den Händen aus. Aber sie hatte da etwas getroffen. Das Gespenst, das regelmäßig auftaucht: Die Befürchtung, mein Leben vertan zu haben.
»Trinkst du?«, fragte sie wieder, diesmal eindringlicher.
»Entspann dich, Silje.«
»Bist du noch immer mit niemandem zusammen? Nichteinmal mit einer deiner jungen Verehrerinnen, dieser …? Wie hat die letzte geheißen … Turid? Entschuldige, dass ich das sage, aber was Frauen angeht, bist du Analphabet. Ich erinnere mich an diese Hübsche. Stine Harr. Armes Ding.«
Ich warf die Arme in die Luft. Kein Grund, ihr zu widersprechen.
Sie suchte meine Augen. »Papa«, sagte sie. »Ich mache mir Sorgen um dich. Hallo? Sieh mich an. Ist alles in Ordnung? Du kommst doch nicht auf dumme Gedanken?«
Sie kam nahe an mich heran, hielt mich wieder umarmt. Fest. Ich erwiderte die Liebkosung, wie um ihr zu zeigen, dass sie sich nicht zu ängstigen brauchte. (Natürlich habe ich das Gespräch nicht wortgetreu in Erinnerung, aber nachdem ich als Form die Erzählung gewählt habe, will ich mich auch all der Freiheiten bedienen, die sie mir bietet.)
Hier von der Kajüte aus betrachtet, mit vielen Jahren Abstand dazwischen, lässt Siljes Besuch mich an eines der Manuskripte denken, das ich einige Monate später auf der Insel gelesen und über das ich mir Folgendes notiert habe:
März 2009. Dolch der Begierde, Autor (dänisch) vorläufig unbekannt. Schöner Einstieg: Ein Mann sitzt im Halbdunkel, Sonnenstreifen fallen durch kleine Löcher eines kuppelförmigen Dachs auf ihn herab (»schließen ihn ein in einem Käfig aus Licht«). Wir erfahren, dass es sehr warm ist, der Raum ist von Dampf erfüllt. Der Mann gießt sich Wasser auf den Kopf (die ganze Stimmung lässt an Marlon Brando/Kurtz in Apocalypse Now denken). Es stellt sich heraus, dass wir uns in einem unterirdischen Badehaus befinden, doch als wir dem Mann später nach draußen folgen und sein Blick sich hebt, finden wir uns zwischen hohen Bergen wieder, an einem Ort wie aus dem Star Wars-Universum. Wir lesen von schmalen Gassen und mehrstöckigen, turmähnlichenHäusern, gefertigt aus Steinblöcken und Lehmziegeln, die hier und dort geometrische Muster bilden, von Fenstern mit farbigem Glas und weißen Fensterrahmen (»eine Pfefferkuchenstadt, mit viel Puderzucker verziert«). Wir erfahren, dass der Mann einen Hamam neben einer Moschee besucht hat und wir uns auf einer »Reise nach Arabien« befinden, genauer: in Sanaa, der Hauptstadt des Jemen. Die Person, eine Tragetasche in der Hand, schlängelt sich durch einen labyrinthischen Souk und gelangt zu einem Haus, wo er ins oberste Stockwerk gewiesen wird, in das Al-Mafraj-Zimmer. Dort begrüßt er drei andere Männer und nimmt zusammen mit ihnen in tiefen Lehnstühlen Platz, mit Aussicht auf die vielen Minarette draußen. Aus seiner Tasche holt er Zweige mit Khat-Blättern, die er eins nach dem anderen kaut, während er zwischendurch aus einer Wasserflasche trinkt. Es wird erzählt, dass man auf Arabisch diskutiert (wir wissen nicht, was gesagt wird, nur dass der Mann, »der Skandinavier« genannt, ebenfalls teilnimmt) und dass Abmachungen getroffen werden.
Zuerst glaube ich, in dem Roman gehe es um eine Art Rimbaud-Gestalt, um jemanden mit einer glorreichen Vergangenheit, doch sehr bald denke ich mir, dass er von einem völlig desillusionierten Skandinavier handeln wird, der in diese wenig touristenfreundliche Stadt im Jemen gekommen ist, um in Einsamkeit zu sterben, regelrecht dahinzuschwinden, mit von Khat geschwollener Wange. Unsere Vermutungen werden auch auf eine im Hintergrund schwelende Liebesgeschickte gelenkt: Vor jedem Kapitel ist ein kurzer, kursiv gedruckter Abschnitt eingeflochten, in dem ein Du unterwegs ist zu ihm, ein Du, von dem sich herausstellt, dass es eine Frau ist, und das immer dichter heranrückt, indem es Individuen in unterschiedlichen Ländern aufsucht, Individuen, die durch ihre Erzählungen (jede davon eine selbstständige – und gute! – Mikroerzählung) zugleich neue Teilstücke der Vergangenheit und der Identität des Skandinaviers aufdecken, Gründe, warum er sich verstecken will. Indessen wird der Leser durch diese eingeschobenen Fragmente die ganze Zeit über »hereingelegt«, auf die falsche Fährte geführt, und auf halber Strecke nimmt die Geschichte einen Kurs, der auch meine eigenen Verdachtsmomente übertrifft. Der Skandinavier pflegt Verbindungen zu denHändlern des Souk, dieGeschäfte machen mit dem Verkauf von Dolchen, diese auffallenden zeremoniellen, krummen und reich dekorierten Dolche, die von allen Männern im Jemen geführt werden, und es wird aufgedeckt, dass er sie mit dem Erlesensten aller Materialien versieht, diefürDolchschäfte Verwendung finden, einem verbotenen Material: dem Horn des Nashorns – das höchste Symbol fürMännlichkeit, deshalbals Statussymbol auch ungeheuer wertvoll. Der Skandinavier ist schlicht ein skrupelloser Anführer eines weitverzweigten Netzwerks, er organisiert eine Reihe von Händlern, die, über Mittelsmänner, Schmuggler und revolutionäre Gruppierungen, das Horn von Wilderern in Südafrika bestellen. Was den Roman unter anderemrätselhaft macht, ist die Schilderung der Geschicklichkeit und des Eifers, mit dem der Skandinavier zu Werke geht, um genügend Nashorn-Hörner heranzuschaffen, seine aufrichtige Bewunderung und sein Respekt für diesen Dolch, den Jambia. Seiner eigentlichen Motivation kommen wir nie auf den Grund (jedenfalls geht es nicht um ökonomischen Gewinn). An einem bestimmten Punkt mag es scheinen, als ob er wirklich wünschte, das Nashorn solle ausgerottet werden. Die ganze Art.
Zwar ist das Du fasziniert von dem Skandinavier, jedoch nicht aus Liebe. Sie wurde von dem World Wildlife Fund engagiert, um den Hintermann des zynischen Handels mit dem Horn des Nashorns aufzuspüren.
Das Ende des Romans erweist sich als nicht zufriedenstellend. Alles schließt mit einer dramatischen Jagd durch den Souk, bei der der Skandinavier, von Auftragskillern verfolgt, die von arabischen Händlern angeheuert wurden, paradoxerweise ausgerechnet von der Frau gerettet wird, der es soeben gelungen ist, die Schlinge um ihn zuzuziehen. Das ganze letzte Kapitel ist unnötig thrillerhaft. Die Hauptfigur aber wird nie »erklärt«. Anerkennung gebührt dem Autor dafür, dass er seinen Helden verlässt, als dieser durch die Irrgänge des Souk läuft, mit einer Kugel in der Schulter und einem Ausdruck rauschartiger Freude im Gesicht.
Silje besuchte mich noch zwei Mal in diesem Herbst (ich will nicht vorgreifen, nur andeuten, dass sie mit meiner Entwicklung zufrieden war). Danach trat sie eine elfmonatige Asienreise an, eine Reise, die heute das darstellt, was früher eine Bildungsreise nach Athen oder Rom war. Mehr werde ich nicht über sie schreiben, sie scheidet hiermit aus der Geschichte. Ich habe meine Tochter immer bewundert. Ihre Musikalität. Ihr Gehör für die Hilfe und Unterstützung, die ein anderer Mensch mitunter braucht. Oder für eine warme Wange. Sie drängte sich nie auf, zeigte nur an, dass sie da war.
Später an diesem Nachmittag wanderte ich zu der Anhöhe mit der Treibmine, dann auf der anderen Seite hinunter durch den alten Steinbruch, bevor ich nach Rødskilen kam, wo ich es mir zur Gewohnheit gemacht hatte, langsam die Anleger entlangzuspazieren und die Boote zu betrachten, besonders die großen Seekreuzer, die noch immer am Wasser lagen. Immer dachte ich dabei an Vater, wir beide und unsere Segelboote. Ich kam mit einem älteren Typen ins Gespräch (seine Falten erinnerten mich an Fred Olsen), der gerade ein Netz flickte. Er fragte, was ich machte. »Kapitän«, sagte ich. »Abgemustert?«, fragte er. »So könnte man es wohl sagen«, sagte ich. »Welche Reederei?«, sagte er. Ich nannte den Namen des Verlags. Er nickte. Ich weiß nicht, ob er verstand, dass das ein Scherz sein sollte, oder ob er ihn tatsächlich für eine Reederei hielt. Wilhelm würde diese Geschichte gefallen haben.
Ich schlenderte weiter durch den Wald und auf die sich nach Süden erstreckende Landspitze zu. Dachte ich an die Frau im Ruderboot? Ich bin mir nicht mehr sicher. Denn war da nicht etwas, das mich in diese Richtung zog? Als ich mich der Bucht auf der Leeseite näherte, fiel mir auf, dass die Kiefern eine dichte Allee bildeten, gleich einem Tunnel, der sich zum Strand und dem Meer hin öffnete. Ich blieb stehen. Der Wind. Das Knirschen der Zweige. Der Duft nach Harz und Nadeln, ein Aroma, heilsamer als Medizin. Wir hatten die dritte Septemberwoche, aber wieder hatte ich die Illusion, als befände ich mich unter ganz anderen Himmelsgefilden, in einem Pinienwald auf einer Mittelmeerinsel.
Auf dem halbmondförmigen Sandstrand (suchte ich zuerst nach Fußspuren?) zog ich mich aus und fing an zu laufen, rannte ins Wasser, dass es aufspritzte, wie wir es als Jungen getan hatten, bevor es so tief wurde, dass ich losschwimmen konnte. Ich erreichte die Stelle, an der ihr Ruderboot gelegen hatte. Ich kann es nicht mit Sicherheit sagen, doch als ich innehielt und auf der Stelle strampelte, war es, als ob ich mit einer warmen Unterströmung in Kontakt käme.
Zurück an Land spielte ich erneut mit dem Gedanken, ein Lagerfeuer anzuzünden. Wie ein Rufzeichen. Oder weil es an sich schön war. (Ich erinnerte mich an das, was Carina gesagt hatte: Kein Lagerfeuer gleicht dem anderen, genau wie die Schneekristalle.) Stattdessen fand ich einen Stein, auf den ich mich setzte, und ließ mich von der Luft trocknen, während ich mit einem Stecken sinnlose Figuren in den Sand zeichnete. Ich weiß nicht, wie lange ich dort saß, doch als ich zum Haus zurückkehrte (in Gedanken sagte ich bereits »nach Hause«), war es ganz dunkel geworden. Ich blieb auf dem Feldweg stehen und schaute zu den Sternen hinauf. Überwältigt. Oder fast ängstlich. Dieses abgeschmackte, aber trotzdem echte Gefühl. Unendlichkeit und Ewigkeit mitten in die Fresse. Es war lange her, dass ich ein Gefühl in mir verspürt hatte, als würde der Boden jäh unter mir weggezogen. Es hatte etwas mit diesem wohlriechenden Abend zu tun, den Wellen, die gegen die glattgeschliffenen Felsen schlugen, mit dem Fehlen künstlichen Lichts, mit Siljes Besuch und der Berührung einer mystisch-warmen Unterströmung. Ich hatte den Eindruck, als würde ich fallen. Nach oben fallen. Oder vielleicht war es eher die Empfindung, dass all das, diese Galaxien, in Bewegung waren. Ich glaube, ich stand mit offenem Mund da. Auch aus Ärger über diesen primitiven Gemütszustand. Irgendwie verwandt mit der Angst vor dem Tod. Ich kann mich auch erinnern, wie verdrießlich es mich stimmte, dass ich kein einziges Sternbild erkennen konnte, abgesehen vom Großen Wagen und, in dessen Verlängerung, den Polarstern. Ja, und natürlich den Orion, aber den fand ich nicht, vielleicht war der Herbst noch nicht weit genug vorgerückt. Bestimmt. Ich schimpfte auf mich selbst. Fünfzig Jahre alt und nicht imstande, mehr als ein lausiges Sternbild ausfindig zu machen. Meine Unwissenheit über die einfachsten Phänomene war erschreckend.
Im Haus fing ich an, Schränke zu durchsuchen, die ich noch nicht geöffnet hatte. Im Wohnzimmer, in einer Schiffstruhe mit der Jahreszahl einer vergangenen Zeit, offenbarte sich eine regelrechte kleine Hausbar, eine Batterie aus Flaschen, zum Abfeuern bereit gegen die Wand aus Zweifeln, die mich umgab. Ich suchte mir eine Flasche Whisky aus, Black & White, eine Marke, die man in Norwegen nicht mehr zu kaufen bekam. Das gefiel mir, aus irgendeinem Grund hatte ich die Vorstellung, dass dies der Lieblingswhisky von General Gordon war. (Und trank Marcello Mastroianni in La Dolce Vita nicht auch Black & White?) Ich fing an zu trinken. Warum, weiß ich nicht, vielleicht aus einem Versuch heraus, mich in etwas aufzulösen, etwas zum Bersten zu bringen. Ich glaube, ein Gedanke an Malcolm Lowrys unterschätzten Roman Unter dem Vulkan tauchte auf. Der Konsul, die Zuflucht im Alkohol. Die Versuchung. So zu werden. Den Rest des Lebens zu trinken, ein ewiges Schwindelgefühl. Um ehrlich zu sein, ich erinnere mich nicht, was ich dachte, aber nach einer Stunde kroch von meiner Brust bis zum Hals ein Schmerz empor, ein Schmerz, der dann von einem Gefühl ersetzt wurde, dass etwas sich zusammenschnürte, etwas heraussickerte. Ich merkte, dass ich weinte. Oder nein, weinen ist das falsche Wort, es war eher ein Wimmern. Ein Flennen. Ich saß da und fühlte mich wie das erbärmlichste aller erbärmlichen Geschöpfe. Ich dachte an Silje, an ihre Besonnenheit. Ich saß da und heulte, lange. Unerklärlich. In Tränen aufgelöst. Genau der Ausdruck war es, der in meinem Bewusstseinsstrom heraufflutete: in Tränen aufgelöst, und ich dachte, dass das irgendeine alberne Phrase sein musste, die ich gelesen hatte. Der Gedanke an das Lesen rief eine neuerliche Welle der Tränen hervor. Scheiße, dachte ich. Scheiße, scheiße, scheiße.
Ich trank weiter. Ich sah einen Zeppelin am Himmel, oder glaubte, einen Zeppelin zu sehen – oder wieso nicht: Laputa –, bis ich begriff, dass es ein liegender Halbmond war. Ich trank noch mehr. Ich glaubte, ich müsse auf ein Boot auf hoher See verfrachtet worden sein, weil der Horizont nicht mehr waagerecht lag. Scheiße, dachte ich. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich glotzte aus dem Fenster, angestrengt, fokussierend. Im Dunkeln erkannte ich den weißen Schaum auf den Wellengipfeln, hörte es fauchen, fand es völlig logisch, dass Wellen fauchen konnten, fast wie: »Jetzt kommen wir und holen dich!«
Scheiße, was machte ich hier.
Irgendwie brachte ich es fertig, mich schlafen zu legen. Das Bett drehte sich. Ich entsinne mich eines Gefühls, als würde das Haus ins Meer hinaustreiben und davonsegeln, bevor es von einer warmen Unterströmung nach unten gezogen wurde.
5
Am nächsten Morgen kehrte die Übelkeit zurück, doch diesmal lag es daran, dass ich einen Kater hatte. Zum Glück, dachte ich – obwohl mir schlecht war. Im Umgang mit dieser Sorte realer Übelkeit hatte ich lange Erfahrung, ich hätte jederzeit an einer Katerweltmeisterschaft teilnehmenkönnen. Ich schleppte mich durchs Wohnzimmer hinaus auf die Natursteinplatten vor der südlichen Wand, wo ich in einem alten, bequemen Liegestuhl zusammensank, eine Tasse schwachen Tees in der Hand. Den ganzen Vormittag widmete ich dem Himmel. Ich konnte mich nie festlegen, ob ich ihn hoch oder niedrig, tief oder weit nennen sollte. Aber er war anders. Ein lindernder Himmel. Genau das Wort fiel mir ein: lindernd. Dort lag ich und döste bis weit in den Nachmittag hinein. Hegte und pflegte meine Melancholie. Rühmte die Stille. Das war das Fabelhafteste von allem: die Stille. Oder richtiger: das Fehlen des Lärms, den Menschen verursachten. Der größte Luxus in der heutigen Gesellschaft.
Geschützt durch die Felskuppe im Westen schlängelten sich die Zweige irgendeiner Art Geißblatt um die Hausecke herum; abends konnte ich noch immer ihren schweren Duft riechen. Dahinter standen ein paar junge Weidenbäume (ich bin mir ziemlich sicher, dass es Weiden waren), die wegen ihrer Blätter die Illusion eines Bambushains hervorriefen, und in dem Erdreich auf dem zum Meer hinabführenden Hang wuchsen kleine Kiefern, das heißt, sie krochen überden Boden auf eine Weise, die an Bonsais erinnerte, von blaugrüner Farbe. Alles das flößte mir zeitweilig das anregend angenehme Gefühl ein, als befände ich mich in einem botanischen Garten, oder schlichtweg im Orient.