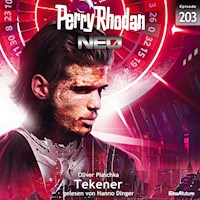Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Torsten Low
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Fantastische Geschichten aus Vergangenheit und Zukunft, den fernen Winkeln der Welt und vom Ende aller Tage. Ein Dieb auf der Flucht im Orient Express. Eine Mission ins strahlende Zentrum der Galaxis. Ein Wasserspeier auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Die letzten Tage der Menschheit in den Weiten der Antarktis ... Vierzehn Reisen hinaus in die Ferne jenseits des Horizonts und hinab in die Tiefen der Seele. Dieser Band vereint Oliver Plaschkas gesammelte Kurzgeschichten in neuer Überarbeitung mit zahlreichen Erstveröffentlichungen. Außerdem dürfen sich Leser seiner Romane auf ein Wiedersehen mit Figuren aus London, Paris und Fairwater freuen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 307
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das oede Land
und andere Geschichten vom Ende der Welt
Das öde Land
und andere Geschichten vom Ende der Welt
Oliver Plaschka
© 2016 Verlag Torsten Low Rössle-Ring 22 86405 Meitingen/Erlingen
Besuchen Sie uns im Internet:www.verlag-torsten-low.de
Alle Rechte vorbehalten.
Cover: Karin Graf und Oliver Plaschka »Texture 305« Sascha Duensing
Illustrationen: Karin Graf
Lektorat und Korrektorat: Vanessa Kaiser und Thomas Lohwasser
eBook-Produktion: Cumedio Publishing Services – www.cumedio.de
ISBN (Buch):978-3-940036-33-9
Inhalt
Vorwort
Der Heimkehrer
Drachenschwingen
Der Fall des verwunschenen Schädels
Ruthie
Die Insel
Solis’ Stimme
Die Frau, der Magier, seine Katze und deren Geheimnis
Die kreisende Schwärze
Solomons Märchen
Die Grenze
Jenseits der Mauer des Morgens
Jimberlyne, Jimberlyne
Der blinde Passagier
Das öde Land
Bibliographie
Lesetipps
Vorwort
Kurzgeschichten führen auf unserem Buchmarkt ein Schattendasein: Wenige lesen sie, noch weniger kaufen sie, und kaum ein Verlag bezahlt einen Autor dafür. Dabei weiß ich noch gut, dass der Markt einmal anders aussah.
Ich erinnere mich an die dicken Science-Fiction-Anthologien meiner Kindheit und Jugend, die einen selbstverständlichen Platz in den Buchhandlungen wie auf den Regalen meiner Freunde besaßen. Ich erinnere mich an das Herzklopfen, als mir während meines Studiums zum ersten Mal eine der schwarzen Arkham-House-Ausgaben mit Geschichten H.P. Lovecrafts in die Hände fiel. An die Ehrfurcht, die Lord Dunsany in mir auslöste, an die poetische Sprache Ray Bradburys und an die schiere Verzweiflung, die aus den Geschichten von James Tiptree Jr. sprach.
Ich nenne diese Namen nicht, um mich in ihrem Licht zu sonnen – sondern um zu bekennen, wie tief ich fiel, denn natürlich war jeder von ihnen zur einen oder anderen Zeit mein Vorbild.
Ich begann mit dem Schreiben von Kurzgeschichten erst nach meinen ersten Romanversuchen. Prägend war meine Zeit in der Creative-Writing-Gruppe des Anglistischen Seminars der Universität Heidelberg, wo ich mit meinen späteren Kollegen Matthias Mösch, Alexander Flory oder Erik Hauser über Eliots objective correlative und Hemingways Eisberge diskutierte. Dass wir in dieser Gruppe ausschließlich auf Englisch schrieben, half mir nicht nur, mich auf die wesentlichen Techniken zu konzentrieren, es ebnete mir auch den Weg, mich mit einer internationalen Gemeinschaft im Internet auszutauschen, ehe dort zwischen Fanfiction und ungeschriebenen Trilogien kaum noch Platz für all jene blieb, für die Handwerk oder Atmosphäre einer Geschichte mindestens ebenso interessant wie ihr Inhalt waren. Die meisten Erzählungen in dieser Sammlung waren irgendwann einmal auf Englisch, und alle verdanken sie ihre Existenz dem Austausch mit anderen Autoren.
Eigener Stil, sagt Barneby in den Magiern von Montparnasse, ist das Ergebnis gescheiterter Imitatio. Diese Wahrheit gilt meines Erachtens für jeden Kunstschaffenden, und ich habe nie ein Geheimnis daraus gemacht. Besagte Kunst, frei nach Hemingway, besteht darin, weit genug danebenzugreifen, dass man als Original durchgeht. So war Fairwater immer ein Schuss in die Richtung, in der ich Twin Peaks vermutete, ohne Twin Peaks je gesehen zu haben; und mein zweiter Roman spielte auch deshalb in Paris, weil Peter S. Beagle – aus dessen Innkeeper’s Song ich die Erzählsituation der Magier übernahm – seinen zweiten Roman nicht in Paris ansiedeln konnte, sondern stattdessen The Last Unicorn schrieb.
Man kann es sich häufig nicht aussuchen, wann und in welcher Form etwas letztlich erscheint, und ich hatte immer große Probleme mit der erschöpften Feststellung, kein Text werde je fertig, aber jeder Text müsse irgendwann aufgegeben werden. Mir fällt dieses Loslassen sehr schwer, und ich neige dazu, jedes Mal, wenn ich über eine alte Geschichte stolpere, mich über meine Versäumnisse zu ärgern; schließlich markieren diese Texte in all ihren Fehlern auch die bi(bli)ographischen Stationen des eigenen Lebens (um hiermit auch James Branch Cabell die Ehre zu erweisen).
So gesehen vereinen die Geschichten vom Ende der Welt also all jene meiner Fehlschläge, die bislang in versprengten und teils vergriffenen Anthologien erschienen, in neuer, überarbeiteter und etwas weniger gescheiterter Form als zuvor.
»Der Heimkehrer« ist eine der fünf Erstveröffentlichungen in diesem Band und vielleicht ein gutes Beispiel für den Versuch, das Wesentliche einer Erzählung unausgesprochen zu lassen. Ihre Grundidee ist meiner eigenen Flugangst geschuldet, gleichwohl ist es eine der positivsten Geschichten der Sammlung, weshalb sie an erster Stelle steht.
»Drachenschwingen« ist eines der beiden Märchen. Es entstand, wie Geschichten leider viel zu selten entstehen: in wenigen Arbeitsgängen innerhalb einer einzigen Woche, mit nur wenig Bedarf an späteren Korrekturen. Ähnlich wie »Die Insel« oder das Zwischenspiel in Fairwater dreht sich die Geschichte des Wasserspeiers um Frosts alte Frage nach dem nicht gewählten Weg im Wald und um unseren Wunsch, das Ende jedes (oder keines) Weges zu kennen. Ursprünglich schrieb ich »Drachenschwingen« für eine Sammlung von Fabienne Siegmund; die Maus Ferdinand verdankt ihre Existenz der Ratte Wilkinson aus Neil Gaimans Sandman. Es existiert eine wunderbare Hörspielfassung von Narratu (Verlag Peter Krüger).
»Der Fall des verwunschenen Schädels« war meine erste Geschichte über den berühmten Meisterdetektiv Sherlock Holmes. Sie entstand für Alisha Bionda und wurde zur Titelgeschichte ihres Bandes; ihr Inhalt ist allerdings einem Missverständnis geschuldet, das mich glauben ließ, sie solle Bezüge zum haitianischen Voodoo aufweisen. Eine wichtige Vorbildfunktion bei meinen unsicheren Schritten in Sir Arthurs Welt erfüllte wiederum Peter S. Beagle, der für »Mr. Sigerson« ebenfalls die Perspektive eines Außenseiters einnahm, der Holmes Abenteuer anstelle des üblichen Chronisten Dr. Watson berichtet. Jeder Logik zum Trotz gab Peter einer seiner Figuren meinen Nachnamen; deshalb benutzt Holmes für sein (kanonisches) Alias auch bei mir den (nicht kanonischen) Vornamen Oscar, den er in »Mr. Sigerson« trägt. Ein paar Jahre später kehrte ich noch einmal in Sir Arthurs Kosmos zurück, als ich mit Erik Hauser die Novelle »Die Wahrheit über Sherlock Holmes« verfasste, die im Fabylon-Verlag in der Sammlung Sherlock Holmes und die Tochter des Henkers erschien.
»Ruthie« mag als eine weitere Stilübung gelten: Fast alles in der Geschichte weist einen Bezug zu Wiedergeburt oder dem Wunsch nach einem Neubeginn auf – viel mehr blieb mir auch nicht übrig, um meinen Aberglauben im Zaum zu halten, als ich an einem Freitag dem 13. unerwartet den »Tod« in meinem Briefkasten fand, den Fabienne mir für ihre Sammlung Das Tarot zugelost hatte. Zu meiner eigenen Überraschung ging mir die Arbeit recht leicht von der Hand, vielleicht auch deshalb, weil ich für das Ende schamlos die rauschhafte Sprache von James Tiptree Jr. im Sinn hatte.
Die zweite (deutsche) Erstveröffentlichung in dieser Sammlung ist »Die Insel«, die zugleich als bislang einzige meiner Erzählungen keinerlei fantastische Elemente aufweist. Dabei wäre sie fast eine Hobbit- Geschichte geworden, wenn mich der fragliche Verleger nicht in letzter Sekunde wieder ausgeladen hätte. Da ich aber ohnehin nie ein gutes Gefühl bei der Verwendung von Tolkiens Schöpfungen hatte, benutzte ich die Idee für unseren nächsten Creative-Writing-Band: Aus Hobbits wurden Piraten, aus dem Auenland eine Insel, die Geschichte aber blieb die gleiche. Das meine ich damit, wenn ich sage, dass der vordergründige Inhalt einer Erzählung oft zweitrangig für mich ist.
»Solis’ Stimme« markierte meinen ersten, erfolglosen (und auch einzigen) Versuch, in ein namhaftes englischsprachiges Magazin aufgenommen zu werden. Sie erschien dann schließlich – als meine erste bei einem Verlag veröffentlichte Kurzgeschichte – in der von David Grashoff herausgegebenen Sammlung Disturbania. Ursprünglich für einen Halloween-Abend entstanden, gab es bald eine Horror- und eine Science-Fiction-Version, und eine, in der sich Solis alles nur einbildet, bis schließlich die gegenwärtige, leicht ironische Fassung entstand, die Elemente all dieser Varianten verbindet.
Eine unverhoffte Nebenrolle in gleich drei Geschichten spielt Céleste aus den Magiern von Montparnasse. Wer den Roman kennt, weiß um das komplizierte Verhältnis, das sie zu Barneby und besonders seiner Katze Serafina pflegt. Am Ende der Magier erleidet Céleste einen Unfall, nach dem ihr weiteres Schicksal ungewiss bleibt. Einen kurzen Blick auf die Zeit danach gibt es in »Drachenschwingen«; einen etwas längeren auf die Zeit vor 1926 und die Vorfälle auf Haiti, die Barneby in den Magiern erwähnt, gewährt »Der Fall des verwunschenen Schädels« (auch wenn das heißt, dass in Célestes Welt sowohl Sir Arthur als auch seine Schöpfung existieren). Antwort auf ihre Ursprünge sowie einige weitere Andeutungen Barnebys gibt »Die Frau, der Magier, seine Katze und deren Geheimnis« – eine Geschichte, der außerdem die Aufgabe zufällt, eine Brücke vom Kristallpalast über die Magier bis zu Fairwater zu schlagen und offene Fragen aus allen drei Büchern zu beantworten, insbesondere die nach der Identität jenes weißgekleideten, oftmals einäugigen Gentlemans, Magiers und Spiegelhändlers, dessen Name verlässlich mit einem »B« beginnt. Vor allem aber gibt es ein Wiedersehen mit Miss Niobe. Wer den Kristallpalast noch nicht kennt, sei gewarnt, dass die Geschichte auch einige klärende Worte zu den Geschehnissen am Ende des Romans findet.
Die wohl offensichtlichste Science-Fiction-Geschichte in diesem Band ist »Die kreisende Schwärze«, die den geduldigen Wahn ihres ursprünglichen Titels (»The Patient Madness«) aber von einer distanzierten Warte und in einer barocken Sprache schildert, die eher den Schauergeschichten des neunzehnten Jahrhunderts nachhängt.
Eine weitere Viele-Jahre-später-Geschichte, diesmal zu Fairwater, ist »Solomons Märchen«. Sie entstand ebenfalls für eine Sammlung Alishas, diesmal im Verbund mit Tanya Carpenter. Verlangt wurden humorvolle, kriminalistische Beiträge – was also lag näher als ein Wiedersehen mit Gloria und Jerry aus der »Fairwater-Affäre«?
»Die Grenze« entstand unter dem Eindruck verschiedener Medienberichte über Waldbrände und Entführungen in einem Sommer vor etwa zehn Jahren, und war – unter dem Titel »The Range« – meine erste Veröffentlichung überhaupt, wenn man die von Matthias und mir herausgegebene Sammlung Gagarin’s Underpants mitzählt. Ich habe sie in den Jahren darauf mehrfach überarbeitet, auch wenn das hieß, eine ohnehin schon schwarze Tür immer schwärzer zu streichen. Der Antagonist der Erzählung, Melchior Ekala (ein wunderbarer Name, den ein alter Freund in einer Rollenspielrunde kreierte) geriet darüber so dämonisch, dass ich, gleich dem tatenlosen Erzähler, bald nicht mehr sicher war, ob er überhaupt existierte. »Die Grenze« erscheint hier erstmals auf Deutsch.
Die kurze Vignette »Jenseits der Mauer des Morgens« ist ähnlich wie »Die kreisende Schwärze« der Gothic fiction zugetan und zitiert im Titel H.P. Lovecrafts »Beyond the Wall of Sleep«. In extrem gestutzter Form fand sie in letzter Minute Aufnahme in eine Sammlung von Boris Koch und darf sich hier in neuem Gewand – und ungeachtet ihres beklemmenden Inhalts – endlich frei entfalten.
Meine wohl am häufigsten umgeschriebene Geschichte dürfte »Jimberlyne, Jimberlyne« sein – das zweite Märchen und die älteste Erzählung dieser Sammlung. Ihre Ursprünge führt sie auf das drogenschwangere Instrumental »She Came Through the Chimney« von Amon Düül II zurück, und in jeder Inkarnation überraschte sie mich aufs Neue, obgleich das Herausarbeiten ihrer zentralen Motive und Symbole zunehmend zu einem Akt der Leichenfledderei geriet. Schließlich fand sie Eingang in eine von Iris Grädler zusammengestellte Vampir-Anthologie, auch wenn Jimberlyne wohl ebenso wenig ein klassischer Vampir sein dürfte wie Céleste.
»Der blinde Passagier« entstand ebenfalls für einen unserer Creative-Writing-Bände: Dark Passages spielte an Bord des Orient-Expresses, in einer Welt des Übernatürlichen, die »The Stowaway« als letzter Beitrag der Sammlung zum Abschluss bringen durfte (oder, wie so oft in der Phantastik, vielleicht auch nicht). Jahr und Rahmenhandlung teilt sich die Geschichte mit dem »Fall des verwunschenen Schädels«, ihre Ursprünge liegen ebenfalls in einer alten Rollenspielrunde begraben (die Krone, um die es geht, gehörte einst einer gewissen Karemonsic). Auch »Der blinde Passagier« erscheint in dieser Sammlung das erste Mal auf Deutsch.
Die Abschlussposition, die er aufgab, nimmt stattdessen eine weitere Erstveröffentlichung ein: »Das öde Land« ist in seinem Titel (und vielleicht auch seinen Ängsten) eine Verbeugung vor T.S. Eliot. Doch ähnlich wie der Schrecken der »Kreisenden Schwärze« für mich nicht so sehr den okkulten Motiven, sondern der Schönheit der fernen Vereinigung von Milchstraße und Andromeda in vier Milliarden Jahren entspringt, ist es in »Das öde Land« weniger die existentielle Leere, die in meinen Augen die Atmosphäre der Geschichte ausmacht, als der Gedanke an jenen durchaus realen Neutrinodetektor IceCube, einen Würfel von einem Kilometer Kantenlänge, und das South Pole Acoustic Test Setup (SPATS), das unter dem antarktischen Eis auf die letzten großen Fragen der Wissenschaft lauscht – was uns gleich Miss Niobe daran erinnern sollte, dass die Welt des Sichtbaren manchmal nicht weniger wunderbar ist als die des Unsichtbaren, an deren Grenze die meisten der Geschichten vom Ende der Welt spielen.
Ich danke Torsten Low für sein Vertrauen und sein Engagement auf unserem kleinen, hart umkämpften Markt, ebenso wie den verschiedenen Herausgebern, die mir die letzten Jahre einen Platz in ihren Anthologien einräumten und auf Messen und anderweitig ihre Erfahrungen mit mir austauschten – namentlich Alisha Bionda, Tanya Carpenter, Fabian Dombrowski, Iris Grädler, David Grashoff, Boris Koch, Ingrid Pointecker und Fabienne Siegmund, außerdem Matthias Mösch, Monika Pleyer und allen Mitgliedern unserer Creative-Writing-Gruppe; sowie nicht zuletzt Vanessa Kaiser und Thomas Lohwasser, die auch das Korrektorat dieser Sammlung übernahmen.
Oliver Plaschka
Der Heimkehrer
Um ein Uhr früh bog der Kombi in seine Einfahrt.
Harold wollte nicht gehen.
Ein trügerischer Frieden hatte sich über die Palmen und Agaven des nächtlichen Gartens gelegt, und es kam ihm so vor, als ob der Kombi etwas Bedrohliches wäre, das nun schlangengleich über den Rasen auf ihn zuglitt. Auf einmal dachte er wieder an das Dach, das er ausbessern, und den Pool, den er reinigen musste, und an seine angebrochene Flasche Bourbon und das angebrochene Kreuzworträtsel und all die vielen anderen guten Gründe, nicht in diesen Wagen zu steigen, sondern hier auf seinem schützenden Berg in der warmen Brise des Pazifik zu bleiben. Doch er wusste, dass ihm kaum eine Wahl blieb.
Argwöhnisch verfolgte er, wie die schimmernden Türen sich lautlos öffneten. Susan und ihr Mann stiegen aus und winkten ihm zu.
»Ihr seid spät dran«, stellte er fest, während sie näherkamen. Die Finger hatte er fest um den Griff des Samsonite geschlossen. »Wollten wir nicht schon vor Mitternacht los?«
»Hi, Daddy«, sagte Susan und drückte ihn kurz. Er verkrampfte sich. »Es tut mir leid. Es gab einfach noch so viel zu regeln, ehe wir uns für ein paar Tage aus dem Staub machen konnten ...«
»Wollen wir hoffen, dass euer Wagen der Herausforderung gewachsen ist.« Er kniff skeptisch die Augen zusammen. »Kommt’s mir nur so vor, oder werden sie von Jahr zu Jahr kleiner? Ist das ein japanisches Fabrikat?«
»Guten Abend, Mr. Tanner.« Steve hielt ihm die Hand hin. »Wie geht es Ihnen?«
»Gut, gut«, sagte Harold und schüttelte seine Hand, ohne ihn richtig zur Kenntnis zu nehmen. »Ist das nicht eine Menge Gepäck da im Kofferraum?«
»Wir haben nicht halb so viel gepackt wie du«, scherzte Susan. »Wieso nur musst du immer wie für eine Weltreise packen? Steve, hilf mir doch mal.«
»Ist nicht meine Schuld«, sagte Harold, während seine Tochter und sein Schwiegersohn ihr Bestes gaben, den schweren Samsonite auf der Rückbank zu verstauen. »Niemand hat Donna darum gebeten, in Vegas zu heiraten. Herr im Himmel! Ich hätte ihnen eine schöne Hochzeit hier in La Jolla ausrichten können, und wir hätten nicht durch die verdammte Wüste dafür fahren müssen.«
»Daddy, lässt du es bitte gut sein? Wir haben das seit Thanksgiving diskutiert. Deine Älteste hat ihren großen Tag, und da darf sie sich auch aussuchen, wo sie feiert, selbst wenn es dir ein paar Unannehmlichkeiten bereitet. Oder uns, was das angeht. Wenn sie Vegas will, soll sie Vegas kriegen.«
»Was ist mit Jennifer?«, fragte Harold. »Hast du schon was von Jennifer gehört?«
Sie zögerte. »Sie wird auch da sein, Daddy. Sie freut sich schon sehr, dich zu sehen.«
»Wieso? Was verspricht sie sich davon?«
»Sie verspricht sich einen schönen Tag mit ihrer Familie, Daddy. Nicht mehr und nicht weniger.«
»Die letzten fünf Jahre waren wir alles, aber keine Familie, Susie, und das weißt du genau.«
Sie kam näher und griff seine Hand. »Bitte, Daddy. Fang nicht wieder damit an.«
»Na schön.« Er räusperte sich. »Vegas erwartet uns. Wie lange brauchen wir bis Sin City?«
Susan warf ihrem Mann einen eindringlichen Blick zu. »Vor Sonnenaufgang sind Sie in Ihrem Bett«, versicherte ihm Steve. »Das ist ein schneller Wagen, Mr. Tanner. Sie werden kaum etwas merken. Er hat diese neue Art von Zellen.«
»Wollen wir hoffen, dass ihr dran gedacht habt, sie auch zu laden«, murmelte Harold, warf einen letzten Blick auf seinen Garten und nahm dann auf der Rückbank Platz. »Brechen wir besser auf, ehe ich’s mir noch anders überlege. Vor Sonnenaufgang, was? Na schön. Je weniger ich von all dem mitkriege, desto besser.«
»Also, ich muss schon sagen«, murmelte er, während hinter ihnen die Lichter La Jollas wie der Sternenhimmel hinter Wolken verschwanden. »Das ist wirklich ein nettes, leises Auto. Und geräumiger, als ich dachte.«
Im Rückspiegel konnte er sehen, wie Steve und Susan abermals argwöhnische Blicke tauschten. »Es ist schon eher ein Van als ein Kombi«, sagte Steve. »Wir dachten, genau das Richtige für Gelegenheiten wie diese.«
»Gelegenheiten wie welche?«
»Wenn wir nicht fliegen«, erklärte Susan.
»Wenn ihr euren umständlichen alten Herrn durch die Gegend kutschieren müsst, meint ihr wohl«, brummte Harold und griff nach seinem Koffer, wie um sich zu vergewissern, dass er noch da war.
»Ich hab gesehen, dass du noch deinen alten Pick-up hast«, wechselte Susan das Thema.
»Aber sicher doch. Ich hab immer gesagt, das einzige Gefährt, dem ich mich je wieder anvertraue, muss schon ein Ford sein. Ich mache hier eine Riesenausnahme für dich, Susie.«
»Manchmal glaube ich, du bist der Letzte, der noch weiß, wie ein Verbrennungsmotor riecht.«
»Ich und meine verdammten Nachbarn.« Harold gackerte.
»Ihr habt immer noch Streit?«
»Die ganze Gegend geht doch den Bach runter.«
»Wahrscheinlich macht es sie nicht gerade attraktiver, wenn man Reporter mit einer Schrotflinte verjagt.«
»Hüte deine Zunge, junge Dame.«
Sie befeuchtete ihre Lippen. »Weißt du, Daddy, du musst nicht ganz allein da oben wohnen. Wir haben jede Menge Platz bei uns, und wir könnten noch anbauen. Ich dachte mir, solange die Regierung zahlt ...«
Harold lachte. »Bei dir klingt das ja, als ob ich reich wäre. Damit du’s weißt, das bin ich nicht, und mit jedem Jahr, das die Demokraten dran sind, wird es schlimmer.« Er schüttelte den Kopf. »Die Preise explodieren ja geradezu. Und denk ja nicht, ich rede nur von der Alkoholsteuer! Ich rede von Wasser und Strom, Handwerkern, Arztkosten, Benzin ...«
»Gehst du noch häufig zum Arzt, Daddy?«, fragte Susan.
»Nein«, sagte er. »Das war nur ein Beispiel.« Darauf schwiegen sie eine Weile.
Harold schaute aus dem Fenster. Durch das leicht getönte Glas wirkten die Sterne wie von einem Schleier verborgen, als ob das Innere des Kombis, das vielleicht doch nicht so geräumig war, wie er gedacht hatte, realer und in jedem Falle greifbarer wäre als die Unendlichkeit, die ihn von allen Seiten umgab ... Er biss die Zähne zusammen und wandte den Blick ab.
Susan und ihr Mann hatten die Stimmen gesenkt und redeten über was auch immer er ihrer Meinung nach nicht zu hören brauchte.
Er durchsuchte seine Taschen. Er fand seinen Füllfederhalter, seine Tabletten, ein paar alte Visitenkarten, die er nicht mehr benötigte, sein Taschentuch und den Geldbeutel mit seinen Kreditkarten, dem Führerschein und etwas Kleingeld. Er steckte alles wieder ein und versuchte, seine Beine in eine bequemere Position zu bringen.
Eine Weile studierte er die Kontrollleuchten im Cockpit, dann wanderte sein Blick nach oben, wo eine weitere getönte Scheibe in den cremefarbenen Fahrzeughimmel eingelassen war. Das feine Gittermuster darin war kaum zu erkennen. »Solarzellen«, murmelte er.
»Hast du in letzter Zeit was von Onkel Bobby gehört?«, erkundigte sich Susan.
»Nein. Warum fragst du?«
»Nur so. Das letzte Mal, als ich ihn gesprochen habe, meinte er, es würde ihn sehr freuen, mal wieder von dir zu hören.«
»Er kann mich jederzeit anrufen«, entgegnete Harold. »Aber die letzten fünf Jahre war Major Robert Grant wohl zu beschäftigt damit, durchs Land zu reisen, wie sich das für einen guten Nationalhelden gehört.«
»Wieso redest du so?«, fragte Susan. »Er ist auch nicht mehr ein Held als du, Daddy.«
»Sie hat recht«, mischte Steve sich ein. »Als ich Ihren Freund des letzte Mal im Fernsehen ...«
»Ich hab dich nicht nach deiner Meinung gefragt, Sohn«, unterbrach Harold. »Also erspar sie mir bitte.«
Steve verstummte. Susan legte ihrem Mann sachte die Hand auf die Schulter.
»Daddy, wieso hältst du nicht ein Nickerchen?«, schlug sie vor. Doch Harold hatte die Augen starr auf ihre Rücklehne gerichtet und gab keine Antwort.
In den folgenden Minuten war das einzige Geräusch im Wagen das sanfte Klicken der Armaturen. Dann machte Susan das Radio an, und sie verbrachten die nächste Stunde ohne eine Wort. Irgendwann hielt Steve kurz an und besorgte ihnen Kaffee, doch danach gab es keine Spuren von Zivilisation mehr jenseits der rauchfarbenen Scheiben, nur die sich langsam wandelnden Muster der Wüste und des Sternenrads, das sich darüber spannte.
»Du bist abgebogen«, stellte Harold fest. »Wieso bist du abgebogen?«
Eine weitere Stunde waren sie durch die Einsamkeit der Mojave-Wüste gefahren, wo nur gelegentlich ein Felsen oder die dornige Silhouette eines Josuabaums wie eine bizarre Prozession von Vogelscheuchen vor dem Fenster vorbeizog.
»Wir wollten die neue Interstate benutzen«, erklärte Steve. »Diese Abkürzung bringt uns schneller ans Ziel, und je schneller wir aus der Wüste raus sind, desto besser, oder nicht?«
»Allerdings«, murmelte Harold. »Allerdings.«
»Ist alles in Ordnung, Daddy?«, fragte Susan. »Hast du ein Nickerchen gemacht?«
»Nicht so richtig.« Harold wich ihrem Blick aus.
»War das Radio zu laut? Wieso hast du nichts gesagt?«
»Tatsächlich war es deutlich angenehmer als der Klang dieses Motors. Wieso hast du es ausgemacht?«
»Wir sind auf halbem Weg zwischen hier und nirgendwo, und die einzigen Sender, die wir reinkriegen, spielen Countrymusik.«
»Wie ich schon sagte, sehr viel angenehmer als der Klang dieses Motors.« Er grunzte. »Davon abgesehen ist es das Gerüttel, das mich wach hält. Wie lange brauchen wir noch? Gott, ich wünschte, wir wären schon da.«
»Daddy ...«
»Wieso musste es Vegas sein? Und die Wüste?« Harold war jetzt hellwach, aber er hob noch immer nicht den Blick und hielt die Rückbank gepackt, als drohte jemand, sie ihm wegzunehmen. »Gott, wir sind so schnell. Kommen wir je irgendwo an? Scheiß doch drauf. Scheiß auf die Wüste und die Sterne und diese winzige Blechdose ...«
»Daddy, bitte beruhige dich.« Susan drehte sich auf ihrem Sitz um. Steve warf ihm im Rückspiegel einen besorgten Blick zu, dann richtete er die Augen wieder auf die Straße, die jetzt so gerade wie ein Lichtstrahl war, so gerade wie ein Komet fliegt. »Daddy, ich möchte, dass du ganz tief Luft holst und dir sagst, dass alles in Ordnung ist. Du bist hier bei uns, und wir fahren auf einer ganz normalen Straße, und wir wollen zu Donnas Hochzeit.«
»Donnas Hochzeit – das ist gut. Wie lange noch bis dahin?«
»Das ist erst morgen«, sagte Susan. »Donna heiratet morgen.«
»Morgen«, wiederholte Harold. »Und wie lange bis dorthin?«
Da begann eine kleine rote Kontrollleuchte zu blinken.
»Susan?«
»Ganz ruhig, Daddy.«
»Susan, stimmt etwas mit dem Auto nicht?«
»Wir haben hier möglicherweise ein kleines Problem«, sagte Steve.
Das Auto fuhr langsamer.
»Steve, was ist los? Rede gefälligst mit mir!«
»Die Akkus ... Sieht so aus, als wären sie fast erschöpft.«
»Gott, ich wusste es!« Wutentbrannt hieb Harold auf die Rücklehne von Susans Sitz ein. »Ich hab noch extra danach gefragt. Und jetzt? Verdammter solarbetriebener japanischer Dreck ...«
»Daddy, würdest du bitte deine Stimme senken? Wir hatten den Wagen gerade erst letzte Woche in der Inspektion.«
»Dann haben sie wohl irgendetwas übersehen. Die Akkus ...«
»Den Akkus ging es gut, als wir dich abholten.«
»Ich kriege keine Luft.«
»Mr. Tanner ...«
»Susie? Ich sagte: Ich kriege keine Luft.«
»Daddy, es ist alles in Ordnung. Hörst du mir zu? Alles wird gut!«
»Wir können so nicht weiter. Oder doch? Gott, wir können nicht weiter ...«
»Wir halten kurz an, Daddy. Alles wird gut.«
»In zwei Stunden geht die Sonne auf«, sagte Steve. Es war wohl aufmunternd gemeint, doch seine Stimme klang über dem Geräusch der sterbenden Maschine so fern wie das Flüstern von Statik. »Dann laden sich die Batterien wieder auf, und wir können weiter. Wir müssen bloß ein bisschen warten. Wir haben jede Menge Zeit.«
»Wir sind gestrandet.« Harold keuchte. Er hatte die Hände schützend vors Gesicht gelegt, die Augen starr auf seine Füße gerichtet.
Der Kombi rollte aus.
»Es tut mir wirklich leid, Mr. Tanner.«
Die Lichter im Innenraum erloschen.
»Macht die Tür auf.«
»Daddy, geht es dir gut?«
»Macht ... die verdammte ... Tür auf!«
Susan stieg aus und half Harold, seine Tür zu öffnen, die nicht verschlossen war.
Als er aus dem klimatisierten Innenraum in die warme Wüstenluft trat, legte sich der Geruch von altem Sand wie eine dicke, abgenutzte Decke über seine Lungen. Harold lehnte sich gegen den staubbedeckten Wagen und atmete schwer. Susan wollte ihm die Hand auf die Schulter legen, doch er stieß sie weg.
Um sie herum erstreckte sich die Mojave in alle Richtungen, und nicht der leiseste Laut war zu hören. Nach allem, was ihre Sinne ihnen mitteilten, waren sie die einzigen lebenden Wesen auf dem Planeten.
»Daddy, du musst langsamer atmen.«
»Ich muss das hier ausziehen«, murmelte Harold und legte seine Jacke ab. Achtlos warf er sie zu Boden, dann begann er, mit zitternden Fingern sein Hemd aufzuknöpfen.
»Möchtest du nicht wieder einsteigen? Du könntest dich auf der Rückbank etwas hinlegen. Vielleicht finden wir einen Radiosender. Wenn die Akkus ...«
Harold wich vor ihr zurück. »Ich kann da nicht wieder rein. Nicht noch einmal. Das Ding ist einfach zu eng ... Ich brauche Luft. Das ist doch ein Sarg! Ich lass mich nicht wieder einsperren ...«
»Niemand will dich einsperren, Daddy. Schau, wir stehen hier draußen im Freien. Keine Wände!«
»Keine Wände«, wiederholte er. »Keine einzige Wand.« Er atmete tief durch. »Ich will mir die Beine vertreten. Dann vielleicht kurz hinsetzen.«
»Kein Problem. Wir können ein paar Schritte gehen.«
Steve machte Anstalten, auszusteigen, aber Susan bedeutete ihm, sitzen zu bleiben. Dann legte sie ihrem Vater einen Arm um die Hüfte, und mit ihrer Hilfe schaffte er es, sich vom Wagen zu lösen und langsam in Richtung des nächsten Hügels zu gehen. Er bewegte sich wie ein Mann, der ihm an Jahren weit voraus war.
Sie waren etwa hundert Meter weit gekommen, als er sich auf einem Felsen niederließ. Seine Hände zitterten, und seine Füße wollten noch laufen, selbst als er schon saß. Hilflos schaute er von rechts nach links, ein Schiffbrüchiger auf einer kargen Insel, erdrückt von der schieren Leere seines Kerkers. Dann wanderten seine Augen suchend über den lackschwarzen Himmel, bis sie auf jenem kleinen roten Flecken namens Mars verweilten.
»Bleib bei mir, Susie«, flüsterte er. »Bitte bleib bei mir, bis die Sonne aufgeht.«
Stumm rückte sie näher und nahm ihn in den Arm.
»Schau, was ich gefunden habe«, sagte sie und drückte ihm die eiförmige Frucht in die Hand. »Gleich da hinten wächst ein Josuabaum.«
Verständnislos starrte Harold die Frucht an.
»Daneben lag eine Coladose«, fuhr sie fort. »Ich frage mich, wie lange schon. Ich dachte, Dosen wären seit mindestens fünfzehn Jahren vom Markt.«
»Ich hätte jetzt sehr gerne eine Cola«, sagte Harold leise und hob den Blick. »Damals haben sie uns keine Dosen erlaubt. Zu viel Nutzlast, hieß es.«
»Wir besorgen dir eine Cola«, sagte Susan. »Du bist bei uns, Daddy. Du bist daheim.«
Doch er hörte ihr gar nicht zu und schien sie kaum zu erkennen. Er hatte die Schuhe ausgezogen und die Zehen im Sand vergraben. Steve beobachtete sie vom Wagen aus. Susan bemerkte seinen Blick und schüttelte den Kopf.
»Es tut mir leid«, sagte sie und nahm abermals neben ihrem Vater Platz. »Es tut mir alles so leid. Wir wollten dir doch nur ...« Sie schloss seine Finger um die Josuafrucht. »Wir hätten dich nicht hierherbringen sollen.«
»Wo?«, flüsterte Harold. »Wo sind denn alle?«
»In Vegas.« Susan lächelte. »Donna und ihr Verlobter warten in Vegas auf uns, Daddy. Und wir werden auch bald dort sein. Jennifer wird dort sein. Hörst du? Deine Frau.«
»Jennifer«, sagte Harold. »Ich würde Jennifer sehr gerne sehen. Ob es ihr gut geht?«
»Es geht ihr gut, Daddy. Allen geht es gut.«
»Es ist so lange her, dass ich sie und die Kinder gesehen habe. Ich denke jeden Tag an sie.«
»Es geht uns gut, Daddy. Ich bin hier. Und Donna will heiraten, weißt du nicht mehr?«
Unmerklich hatte sich das Licht in der Wüste gewandelt. Die ununterscheidbaren Grautöne ringsum erwachten zum Leben, und einer nach dem anderen sprangen die Schemen an ihren Platz, blutrote Felsen hingestreut in den ockerfarbenen Sand. Susan nahm die Hand ihres Vaters und war überrascht, mit welcher Kraft er ihre Finger umklammert hielt.
»Ich kenne diesen Ort«, sagte er. »Ich war schon einmal hier ...«
»Bist du aber nicht mehr!«, rief Susan. »Du bist jetzt bei mir, hörst du? Du bist bei mir!«
»Wie kommt es dann«, fragte Harold, »wie kann es sein, dass alles so weit von uns weg ist ...«
Er erstarrte, als die ersten Stahlen der Sonne sein Gesicht trafen, und Susan brauchte kurz, um zu begreifen, dass das seltsame Wimmern, das sie hörte, tatsächlich von ihrem Vater stammte. Die Felsen erglühten wie reife Äpfel, die ganze Welt schien zu erröten, und Tränen füllten seine Augen.
»Robert?«, rief Harold zitternd, »bist du da?« Und dann verwandelte die aufgehende Sonne die Wüste in ein Meer der Trostlosigkeit und des Rosts unter einem wolkenlosen Himmel, der so blass war, so dünn, dass er fast keine Farbe besaß. In der Ferne erhob sich ein Gebirgszug, unwirklich wie die Kartonhügel einer Schießbude, und der Horizont schien unendlich fern. Und doch drängte er auf ihn ein, ließ ihm keine Möglichkeit zur Flucht.
»Hier bin ich, Harry«, sagte Steve und trat näher. »Was willst du mir sagen?«
»Bobby? Bist du das?«
»Ich bin bei dir, Harry.«
»Es tut mir so leid. Ich halte es einfach nicht länger aus. Nicht noch einen Monat, bis wir zurückkönnen! Nicht noch fast ein Jahr, bis wir wieder daheim sind ... Bobby, ich kann einfach nicht mehr, ich krieg keine Luft ...«
»Atme ganz ruhig, Harry. Du musst ruhig atmen, mein Freund.«
»Was hast du gesagt? Ach, dieser Lärm. Dieser verdammte ...« Er fuhr sich über den Kopf wie um sich ein imaginäres Headset abzureißen. »Ich kann da nicht wieder rein. Ich will einfach nur weg, raus aus dieser Falle, aber ich kann nicht. Bobby! Ich hab Angst vor dem Heimweg. Ich hab Angst, dass ich verrückt werde, und dass wir beide da draußen sterben wegen mir ...«
Steve und Susan tauschten einen raschen Blick. Sie nickte, und als Steve Harold sachte an der Schulter berührte und ihn umarmte, brach Harold endlich in Tränen aus.
»Es ist alles gut«, sagte Steve. »Alles ist gut. Ich bin bei dir, Harry. Ich hab dich nach Hause gebracht. Du bist wieder daheim, Harry ... Du bist wieder daheim.«
»Es tut mir so leid«, schluchzte Harold. »Es tut mir leid, dass ich dich im Stich gelassen habe ... und was du alles hast durchmachen müssen wegen mir.«
»Ist schon gut, alter Freund«, sagte Steve.
Sie saßen noch eine Stunde auf dem Felsen, bis die helle, gelbe Sonne den vertrauten Anblick seiner Familie und der schnurgeraden Straße und des Kombis enthüllte. Die Solarzellen lieferten wieder Strom, Countrymusik lag in der Luft, und von Minute zu Minute wurde es heißer. Sie brachten ihm Wasser, und mit zittrigen Beinen stand Harold auf und ließ sich von Steve zum Wagen führen, während Susan seine Sachen einsammelte.
Auf dem Weg entdecke er den Josuabaum und machte eine Bemerkung darüber, wie wunderbar es doch war, dass ein solcher Baum an einem solchen Ort wuchs, und wie angenehm die saubere Luft und selbst die Hitze waren. Susan schlug vor, die Klimaanlage noch auszulassen und mit offenen Fenstern zu fahren, worin er einwilligte. Was immer zuvor mit dem Wagen nicht gestimmt hatte, er lief wieder tadellos. Gelegentlich studierte Harold die Anzeigen, doch alles, worüber er den Rest der Reise sprach, war, dass er sich auf eine kalte Flasche Cola in Vegas freute, und auf Donna und ihren Verlobten, und auf Jennifer.
Erst, als sie die Stadtgrenze erreichten, tippte er Susan von hinten an, und sie stellte das Radio leiser und schaute ihn an.
»Danke, Kinder. Danke euch beiden. Es ist schon seltsam, wisst ihr ... Aber manchmal vergesse ich fast, wo ich bin. Wie viel Glück ich gehabt habe. Und wie glücklich ich mich schätzen kann, hier bei euch zu sein.«
»Du bist wieder daheim, Daddy.« Susan lächelte. »Onkel Bobby hat dich uns wiedergebracht. Du warst drei Jahre weg, aber jetzt bist du zurück.«
Drachenschwingen
Der Wasserspeier wusste nicht, wie er aussah und was er eigentlich war. Er wusste nur, dass er Schwingen besaß, durch die der Wind blies, und er wusste, dass die anderen Wasserspeier nicht waren wie er. Er konnte einige von ihnen sehen, wenn er an seiner Wand hinabblickte: geduckte, plumpe Kreaturen, die keine Schwingen besaßen und ihm keine Antwort gaben, wenn er ihnen zurief. Er war der Einzige seiner Art – auf dieser Seite. Es gab aber noch andere – auf der anderen Seite, die er nicht sehen konnte.
Das hatte ihm Ferdinand erzählt. Von ihm wusste er auch, dass es überhaupt eine andere Seite gab.
»Erzähl mir von der anderen Seite«, bat er.
»Hm«, sagte Ferdinand. »Tja, weißt du, da sind eine Menge Dächer. Noch mal so viele wie hier.«
»Und die Wasserspeier?«, fragte der Wasserspeier. »Wie sehen sie aus?«
»Furchterregend!«, rief Ferdinand. Er hatte seine Barthaare gesträubt, sich auf die Hinterbeine gesetzt und versucht, ihm Angst einzujagen, was natürlich nicht ging, denn eine Maus kann einem Wasserspeier keine Angst einjagen.
»Haben Sie Hörner? Klauen und Mäuler?«
»Ja, einige, vielleicht«, sagte Ferdinand, in keiner bestimmten Reihenfolge, und der Wasserspeier versuchte, es sich vorzustellen.
»Und Schwingen? Haben sie Schwingen?«
»Hm«, sagte Ferdinand. »Da müsste ich noch mal schauen gehen. Soll ich schauen?«
»Nein«, sagte der Wasserspeier. »Bleib.« Er wusste, wenn Ferdinand ginge, würde er vergessen, dass er hatte zurückkommen wollen, und er hatte nicht viele Gesprächspartner. Außer Ferdinand und seiner Familie kamen nur die Tauben zu ihm, und die meisten Tauben waren ziemlich dumm und hinterließen Schmutz auf den Steinen.
»Haben sie je zu dir gesprochen?«
»Nein«, sagte Ferdinand. »Ganz sicher nicht. Du bist der Einzige.«
Das hatte den Wasserspeier erst stolz gemacht, aber er hatte sich auch gefragt, wie das sein konnte – und nachdem er eine Weile darüber nachgedacht hatte, fand er, dass es auch ein wenig traurig war.
»Erzählst du’s mir, wenn einer der anderen etwas sagt?«, fragte er.
»Ja sicher!«, versprach Ferdinand, und entschuldigte sich dann, um Essen für seine Familie zu suchen. Seine Familie war ziemlich groß, und er verbrachte viel Zeit mit der Suche.
Der Wasserspeier hatte nie Hunger oder Durst. Er hatte Freude daran, wenn der Regen durch sein Maul rann und in einem weiten Bogen nach unten sprudelte, aber er hatte nie das Verlangen verspürt, das Wasser zu trinken, so wie Menschen das tun.
Natürlich wusste er, was Menschen waren: Er sah sie jeden Tag, und er hatte die vage Vorstellung, dass Menschen dieses ganze Dächermeer, das sich vor ihm erstreckte, gebaut hatten, obgleich es ihm ein Rätsel war, wie so unverständige Wesen eine solche Unendlichkeit hatten errichten können. Überall wuselten sie in den Straßen, immer wieder bauten sie ein neues Dach oder rissen ein altes ein, und überhaupt taten sie viele seltsame Dinge.
Ein wenig, fand der Wasserspeier, waren die Menschen wie Tauben. Sie bewegten sich gerne in großen Gruppen und machten eine Menge Lärm und Dreck dabei. Unablässig redeten sie, in einem monotonen Gleichklang von Lauten; und wenn er ganz genau zuhörte, konnte der Wasserspeier sogar verstehen, was die Menschen miteinander sprachen, auch wenn Ferdinand oder die Tauben ihm das nicht glaubten. Die meisten Tauben glaubten nicht einmal, dass Menschen überhaupt vernunftbegabt waren.
»Puh! Menschen«, entrüstete sich eine Taube, als der Wasserspeier sie erstmals mit dieser These konfrontierte. »Dumme Menschen! Puh!«
»Sie sind euch gar nicht mal so unähnlich«, hatte der Wasserspeier eingewandt, und die Taube hatte mit den Flügeln geflattert und den Stein, auf dem sie saß, beschmutzt. »Puh! Puh!«, hatte sie gerufen, und mehr war ihr dazu nicht eingefallen.
Dem Wasserspeier aber war es egal, ob die Tauben ihm glaubten oder nicht. Er war eigentlich ganz froh, wenn Menschen nahe genug kamen, um sie zu belauschen. Schließlich hatte er oft tagelang keine Gesellschaft, manchmal wochenlang, gerade in den Wintermonaten, wenn die Eiszapfen von seinen Fängen hingen und seine Schwingen schwer waren von Schnee. Aber im Sommer fanden hin und wieder Menschen den Weg auf die große Terrasse schräg unter ihm, und aus ihren Gesprächen hatte der Wasserspeier eine Menge gelernt – zum Beispiel, dass er sich auf einer Kirche befand.
Er hätte die Menschen gerne gefragt, was eine Kirche war. Er hätte sie gerne so vieles gefragt; aber die Menschen konnten ihn nicht verstehen.
»Weißt du, was eine Kirche ist?«, fragte der Wasserspeier Ferdinand.
»Hm«, sagte Ferdinand. Er war gerade auf dem Rückweg gewesen und hatte einen großen Krumen im Maul. Jetzt legte er ihn weg und überlegte. Er war gerade zum vierten oder fünften Mal Vater geworden und war eine Menge Fragen gewohnt.
»Also, eine Kirche, da reden die Menschen mit Gott«, sagte Ferdinand.
»Gott?«, fragte der Wasserspeier. »Wer ist das?«
»Na, Gott eben«, sagte Ferdinand. »Der wohnt im Himmel.«
»Im Himmel? Die Tauben haben nie von ihm erzählt.«